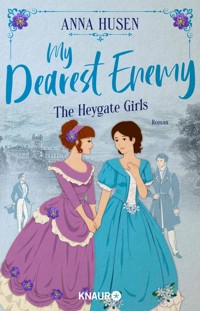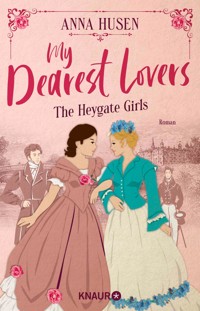9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei junge Liebende, ein tragisches Familiengeheimnis und der Duft von Marzipan: Der historische Roman von Anna Husen entführt in die Marzipan-Stadt Lübeck Ende der 50er-Jahre. Für Luisa Linde und Henry Hawkins ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie einander 1957 am Holstentor in Lübeck begegnen. Doch Luisas Vater, der Direktor des Holstentormuseums, verbietet ihr umgehend den Kontakt zu Henry. Und auch Henrys Vater, der in der Hansestadt eine bekannte Marzipan-Manufaktur besitzt, ist entschieden gegen die Verbindung. Weil ihre Eltern ihnen keinerlei Gründe für ihre Ablehnung nennen wollen, beginnen Luisa und Henry, sich heimlich zu treffen und Nachforschungen anzustellen. Dabei kommen sie nicht nur einer alten Familienfehde auf die Spur, sondern auch einer Rivalität zwischen ihren Vätern, die ihre Liebe von Grund auf infrage stellt … Wunderbar atmosphärisch lässt der historische Roman »Der Duft von Marzipan« das Lübeck der Nachkriegszeit zwischen Traditionsbewusstsein und Aufbruchsstimmung lebendig werden: die perfekte Kulisse für eine schicksalhafte Liebesgeschichte, der ein tragisches Familiengeheimnis entgegensteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anna Husen
Der Duft von Marzipan
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine tragische Familienfehde, eine verbotene Liebe und der Duft von Marzipan
Für Luisa Linde und Henry Hawkins ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie einander 1957 am Holstentor in Lübeck begegnen. Doch Luisas Vater, der Direktor des Holstentormuseums, verbietet ihr umgehend den Kontakt zu Henry. Und auch Henrys Vater, der in der Hansestadt eine bekannte Marzipan-Manufaktur besitzt, ist entschieden gegen die Verbindung. Weil ihre Eltern ihnen keinerlei Gründe für ihre Ablehnung nennen wollen, beginnen Luisa und Henry, sich heimlich zu treffen und Nachforschungen anzustellen. Dabei kommen sie nicht nur einer alten Familienfehde auf die Spur, sondern auch einer Rivalität zwischen ihren Vätern, die ihre Liebe von Grund auf infrage stellt …
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Danksagung
Für Kathi.
Weil Luisa ohne dich ihren Namen nicht hätte.
Weil unsere Freundschaft für mich eines der kostbarsten Dinge auf der Welt ist.
Ich danke dir für die wundervollen Gespräche über all die Geschichten in unseren Köpfen.
Kapitel 1
Luisa!« Die Stimme ihrer Schwester durchbrach Luisas verworrene Gedanken.
Unwillkürlich zuckte sie zusammen und drehte sich um. Die Sonne blendete sie, sodass sie eine Hand vor die Augen hob und blinzelte.
»Schwesterherz!«, rief die jüngere Frau und lief winkend auf sie zu.
Luisa seufzte leise und ließ sich auf der Bank inmitten der Wiese vor dem Holstentor, dem Wahrzeichen Lübecks, nieder. Ein frischer Wind fegte über die Wiese, ringsum fuhren auf den Straßen einige Automobile, und Familien hatten es sich auf dem großen Rasenplatz vor dem Holstentor auf Picknickdecken gemütlich gemacht und genossen diesen herrlichen Frühlingstag.
Sie sah zu Rowena, ihrer Schwester, die ihren dunkelblauen Hut wegen des Windes mit einer Hand festhalten musste. Sie blieb vor Luisa stehen, und die betrachtete ihre kleine Schwester eingehend.
Rowena trug ein dunkelgrünes, knielanges Kleid mit weißen Punkten, das sich ab der Hüfte weit bauschte. Dazu einen roten Gürtel und ein Perlenarmband in derselben Farbe. Ihre dunkelbraunen Haare waren zu einer kunstvollen Frisur hochgesteckt.
»Ich habe nach dir gesucht. Mutter und Vater hatten auch nicht die geringste Ahnung, wo du bist. Beim Frühstück warst du nicht da«, keuchte ihre Schwester, als sie sich neben Luisa auf der Parkbank niederließ. Luisa konnte einen leichten Vorwurf in Rowenas Stimme wahrnehmen und presste die Lippen zusammen.
»Es tut mir leid, dass ich nicht mit euch gefrühstückt habe«, antwortete sie nach einer Weile und zupfte gedankenverloren ein paar Grashalme von ihrem dunkelblauen Kleid.
Rowena stieß Luisa mit dem Ellbogen in die Seite und musterte ihre Schwester aufmerksam. Einige kastanienbraune Strähnen hatten sich aus ihrer Frisur gelöst und kringelten sich in sanften Locken um ihr Gesicht. In ihrem Blick lagen Unschuld und Neugierde.
»Wo warst du den ganzen Morgen?«, hakte Rowena nach.
Luisa seufzte und schloss kurz die Augen. Sie wollte ihrer Schwester nicht erzählen, wieso sie sich heute in den frühen Morgenstunden aus dem Haus geschlichen hatte, als die Sonne gerade erst zögernd über den Horizont geklettert war.
Ich liebe dich, Luisa Linde.
Henrys Stimme hallte in ihren Gedanken wider und ließ ihr Herz heftig gegen die Rippen pochen. Schlagartig öffnete Luisa die Augen und sah ihre Schwester erneut an.
»Bitte, Rowena, sei so gut und stell mir nicht so viele Fragen. Wo ich war, hat dich nicht zu interessieren.«
Rowena stemmte die Hände in die Hüften, sie warf Luisa einen beleidigten Blick zu.
»Ich bin deine Schwester, also hat es mich sehr wohl zu interessieren«, entgegnete Rowena schnippisch.
Luisa winkte lachend ab. »Aber du verbringst doch normalerweise am liebsten den ganzen Tag in einem Café an der Untertrave, schmachtest mit deinen Freundinnen hübsche Männer an und kicherst hinter vorgehaltener Hand über Frauen, die nicht wie du die neueste Mode oder einen kecken Hut mit Federn tragen. Also, was interessiert es dich, wo ich war?« Luisa wusste, dass es nicht gerecht war, so abweisend zu ihrer Schwester zu sein, aber Angst zog sich einem Knoten gleich in ihrem Magen zusammen.
Mit einem Mal wurde Rowenas Blick traurig, und ein Anflug von schlechtem Gewissen erfasste Luisa. Kälte zog sich über ihre Glieder, und sie fröstelte selbst in der Mittagssonne.
»Was soll ich denn sonst tun, du redest in letzter Zeit ja kaum noch mit mir!«
Luisa biss sich nachdenklich auf die Unterlippe und drehte den Anhänger, den ihr Henry heute geschenkt hatte, in den Fingern hin und her. Sie hatte sich die letzten Tage immer wieder frühmorgens aus dem Haus geschlichen, um sich mit ihm zu treffen. Mit ihrem Henry. Mit dem jungen Mann, der den Duft von Marzipan an sich trug, dessen Lippen nach Schokolade schmeckten und dessen Lachen Luisas Herz mit Liebe erfüllte.
»Ich …«, begann Luisa und schüttelte dann den Kopf. »Ich brauche meine Ruhe vor meiner nervigen Schwester!«
Rowena sah sie verletzt an und zog einen traurigen Schmollmund. Sofort bereute Luisa ihre Worte und legte ihrer Schwester eine Hand auf die Schulter.
»Das war nicht so gemeint, das weißt du, oder nicht?«, fragte sie und brachte ein schwaches Lächeln zustande.
Rowena nickte zaghaft und starrte gedankenverloren auf das Holstentor. »Du verheimlichst etwas«, sagte sie nach einiger Zeit tonlos.
Luisa erschrak bei diesen Worten, und das Herz schlug ihr bis zum Hals. »Wie bitte?« Verdattert sah sie ihre Schwester an und spürte, wie ihre Handinnenflächen feucht wurden.
Rowena stützte den Kopf auf die Hände und wippte mit den Füßen hin und her, sagte jedoch kein Wort.
»Rowena!«, sagte Luisa so ruhig wie möglich und packte ihre Schwester am Handgelenk.
Die Jüngere schaute sie trotzig an und riss sich stürmisch los. »Ich habe euch gesehen«, zischte sie zurück und stand auf.
Ein weiterer Windstoß fegte über die Wiese hinweg, und der Stoff von Rowenas Kleid flatterte wild hin und her. Wie groß sie geworden war. Wie erwachsen sie in diesem schicken Kleid aussah. Was für eine Schönheit aus ihrer kleinen Schwester geworden war.
All diese Dinge wurden Luisa in diesem einen Augenblick bewusst. Es fühlte sich für sie an, als würde die Zeit stillstehen.
»Rowena …«, flüsterte Luisa leise und griff erneut nach der Hand ihrer Schwester. Zog sie sanft zurück auf die Bank und zwang die Jüngere, sie anzusehen.
Rowena presste die Lippen fest aufeinander und sagte kein einziges Wort. Sie wich dem Blick ihrer Schwester aus.
»Er ist der Sohn des Mannes, dem die Marzipanmanufaktur außerhalb von Lübeck gehört, richtig?«, fragte Rowena nach einer gefühlten Ewigkeit.
Ihre Haltung war verkrampft, und ihre Hände zitterten leicht. Leise seufzte Luisa und rutschte unbehaglich auf der Bank hin und her. Sie hatte nicht gedacht, dass ihre Schwester ihr Geheimnis lüften würde. Dass Rowena so gewitzt war, ihr zu folgen.
»Henry Hawkins«, antwortete sie tonlos und spürte, wie sie mit einem Mal schneller atmete. Die Aufregung kribbelte in ihren Fingerspitzen. Aber der Gedanke an Henry zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht.
»Ein schöner Name«, erwiderte ihre Schwester ruhig und sah Luisa nun endlich an.
»Ich wollte es dir nicht verheimlichen, aber …«, begann Luisa und versuchte sich die Worte zurechtzulegen.
Es fiel ihr schwer, über Henry zu reden. Generell fiel es ihr schwer, sich mit Worten auszudrücken. Das war nicht ihr Talent. Rowena konnte das viel besser. Sie schrieb Gedichte und Kurzgeschichten. Hatte viele schriftstellerische Vorbilder und träumte davon, ein Buch zu schreiben.
»Du hast Angst, es Vater und Mutter zu sagen, oder?«, bemerkte Rowena scharfsinnig und lehnte sich zurück. Sie schloss die Augen und genoss die warmen Strahlen der Frühlingssonne.
Luisa zuckte unwillkürlich zusammen und fühlte sich ertappt. Natürlich hatte sie Angst. Henry war ein Fremder in der Welt ihrer Eltern. Zudem stammte sein Großvater ursprünglich aus England. Natürlich war seine Familie seit Jahrzehnten in Deutschland eingebürgert, und sein Großvater hatte sogar für die Deutschen im Krieg gekämpft, aber dennoch: Der Makel des Fremden haftete immer noch an ihm und war nicht fortzuwischen.
»Natürlich habe ich Angst«, erwiderte Luisa und spürte, wie sich Tränen in ihren Augen sammelten, die sie hastig fortwischte.
Ihre Eltern waren im Gegensatz zu den Eltern ihrer Freundinnen ziemlich streng und erzogen ihre Töchter recht konservativ. Sie legten Wert darauf, dass ihre Töchter jeden Sonntag brav in die Kirche gingen, und waren beide immer noch der Meinung, dass es für eine Frau genügte, zu heiraten und sich um den Haushalt zu kümmern. Obwohl ihr Vater, Stephan Linde, viel Zeit und Mühe in ihre Schulbildung investiert hatte, so wünschte er sich doch, dass Luisa und Rowena einmal standesgemäß heirateten und ein gesittetes Leben führten.
Genau aus dem Grund hatte Luisa Angst. Ihr Vater war nie jähzornig gewesen, er hatte die Mädchen mit liebevoller Strenge erzogen und ihnen die Konsequenzen ihrer Handlungen gezeigt. Aber nie war er so wütend gewesen, dass sie Angst vor ihm gehabt hatten. Und doch glaubte sie, dass er Henry niemals akzeptieren würde.
Das war es, was Luisa jetzt bedrückte. Sie hatte Angst davor, wie ihre Eltern reagieren würden.
Sie war eine junge Frau, die auf ihren eigenen Beinen stehen wollte, die ihren Schulabschluss mit Bravour gemeistert hatte. Der doch eigentlich jetzt, über ein Jahrzehnt nach dem Krieg, alle Türen dieser Welt offenstehen müssten. Aber ob sie jemals ihre eigenen Entscheidungen würde treffen können, war fraglich. So oft hatte sie sich heimlich mit Henry getroffen. So viele Liebesschwüre waren über ihre Lippen gekommen. Seine Berührungen verursachten ein wohliges Gewitter in ihrer Seele. Seine Hände waren zart und sein Blick sanft. Sie hatte sich in ihn verliebt wie der Sturm in die raue See. Es war ihr größter Wunsch, Henry zu heiraten.
»Wovor hast du so große Angst?« Rowena rückte ein Stück an ihre Schwester heran und ergriff ihre Hände.
Das hatten sie früher immer gemacht. Als kleine Mädchen hatten sie zusammen in einem Bett geschlafen. Eng aneinandergeschmiegt. Die Hände verschränkt in der Finsternis, während die Angst vor dem nächsten Bombenalarm sie bedrückte.
Wenn es irgendjemanden gab, dem Luisa jederzeit ihr Herz ausschütten konnte, dann war es Rowena.
Niemals hatte Rowena ein Geheimnis von Luisa ausgeplaudert, sie tratschte gerne über andere Menschen, aber nicht über ihre Schwester.
»Ich weiß es nicht«, seufzte Luisa leise, und Verzweiflung schwang in ihrer Stimme mit.
»Er ist doch bestimmt ein toller Mann!«, munterte ihre Schwester sie auf. »Seine Eltern sind steinreich, er wird irgendwann die Manufaktur erben, und dann kannst du den ganzen Tag Marzipan in dich hineinfuttern und wirst kugelrund.«
Luisa musste bei diesen Worten lachen, auch wenn ihr gar nicht danach zumute war. Diese Vorstellung war urkomisch.
»Das ist gar nicht lustig«, prustete sie grinsend und stieß ihre Schwester in die Seite.
»Ich finde es lustig«, bemerkte Rowena, wurde dann aber wieder ernst und legte die Stirn in Falten. »Aber wirklich, Schwesterherz, warum sollten unsere Eltern gegen diese Beziehung sein?«
Luisa zuckte schweigend mit den Schultern. Es war wie eine dunkle Vorahnung. Wie eine Finsternis, die ihr in die Glieder kroch und ihr jede Luft zum Atmen nahm.
»Ich bin mir nicht sicher …«, führte sie lahm aus und erhob sich.
»Dann müssen wir es eben herausfinden«, schlug Rowena vor und stand ebenfalls auf. Sie strich die Falten ihres Kleides glatt und rückte ihren Hut gerade. »Ich bin immer an deiner Seite.«
Rowena nahm Luisa in die Arme, und die genoss die Nähe zu ihrer Schwester. Luisa wusste, dass manche Menschen Rowena für oberflächlich hielten, immer nur bedacht auf die neueste Mode und den aktuellsten Tratsch. Aber so war es nicht. Rowena konnte die Gefühle von Menschen sofort durchschauen. Sie war Luisas Fels in der Brandung.
Die Schwestern lösten sich voneinander und spazierten über den Weg zum Holstentor. Unsicher schaute Luisa nach oben auf das Monument ihrer Stadt, eines der letzten verbliebenen Tore der ehemaligen Lübecker Stadtmauer.
Zwei Türme erhoben sich seitlich vom Mittelteil des Tores, der rotbraune Backstein glitzerte in der Sonne, und in den unzähligen kleinen Fenstern spiegelte sich das Licht. Die Turmspitzen mit ihren goldenen Kugeln am Ende schienen den Himmel fast durchbohren zu wollen. Und wenn man genau hinsah, konnte man erkennen, dass das Holstentor ein wenig schief war, dass es nach innen absackte und die Turmspitzen sich einander entgegenneigten.
Im Holstentor arbeitete Luisas und Rowenas Vater. Er war der Leiter des Museums, welches hier seinen Platz gefunden hatte. Kaum vorstellbar, dass so ein Bauwerk ein Museum beherbergte. Luisa und Rowena kannten es in- und auswendig. Sie hatten sich jedes Ausstellungsstück angesehen, durch die kleinen Fenster hinaus auf die Stadt geschaut und zusammen mit ihrem Vater die verschiedenen Räume erkundet.
Wenn Luisa es wollte, dann würde ihr Vater ihr eine Anstellung in diesem Museum geben, gemeinsam mit ihm könnte sie neue Ausstellungen planen, die Räume neu gestalten und Texte dazu schreiben.
Aber tief in ihrem Innern wusste Luisa schon lange nicht mehr, was sie wollte. Seit sie Henry vor einigen Monaten getroffen hatte, waren all ihre Gedanken verworren, und nur ihr verliebtes Herz steuerte sie. Sie hatte vorgehabt, Geschichte zu studieren, um ihren Vater im Museum zu unterstützen, aber so richtig erfreut schien er über diese Idee nie gewesen zu sein. Sie vermutete, dass seine konservative Vorstellung, eine Frau sollte lediglich eine gute Ehe- und Hausfrau sein, im Konflikt mit ihren Wünschen stand.
Aber eigentlich war es nicht ihr innigster Wunsch, Geschichte zu studieren, nein, sie träumte von etwas anderem, auch wenn sie dies ihren Eltern nie offenbart hatte: eine eigene Pralinenmanufaktur. Denn sie liebte Rezepte und deren köstliche Zutaten über alles.
Als die Schwestern gemeinsam die Straße überqueren wollten, fuhr ein junger Bursche auf einem Moped an ihnen vorbei. Er stieß einen Pfiff aus und schenkte ihnen ein Grinsen. Rowena hob die Hand und winkte dem Kerl, der knatternd davonfuhr.
Luisa rümpfte die Nase und betrachtete ihre Schwester kopfschüttelnd. »Du solltest damit aufhören, diese Jungen anzuschmachten. Vater sieht es nicht gerne, wenn du dich mit diesen halbstarken Rabauken abgibst.«
Rowena tat Luisas Einwand mit einer lockeren Handbewegung ab und zog sie mit über die Straße. »Ich weiß, aber Vater hat einfach viel zu starre Prinzipien. Ich finde diese Jungs toll, sie tun, was sie wollen, und hören Rock ’n’ Roll!«
Luisa verdrehte seufzend die Augen, entgegnete aber nichts. Bei diesen Themen waren sie und ihre Schwester sich nie einig.
»Wo hast du Henry eigentlich kennengelernt?«, fragte Rowena, während sie auf eines der Cafés an der Untertrave zusteuerte.
Luisa wollte mit ihrer Schwester eigentlich nicht darüber reden, aber die Aussicht auf einen guten Kaffee und ein saftiges Stück Kuchen lockte sie.
Sie ließ den Blick über die Untertrave und die Häuser schweifen, die sich vor ihnen erhoben. Drei- und viereckige Giebelhäuser reihten sich unermüdlich aneinander. Rote Backsteine, weiße Fassaden und viele lang gezogene Fenster ließen die Häuser noch schmaler wirken, als sie waren. Luisas Blick wanderte die Holstentorstraße hinauf, die sich vor ihnen in einer leichten Steigung erhob.
Man hätte denken können, dass diese wunderschöne Stadt nicht vom Krieg heimgesucht worden war. Aber Luisa erinnerte sich immer noch mit Schrecken an die Bomben, an den sirrenden Alarm, der die Menschen dazu aufrief, die Luftschutzbunker aufzusuchen. An die Angst in den Augen ihrer Mutter, während sie Luisa an der einen und Rowena an der anderen Hand hielt.
Und noch immer waren einige Gebäude nicht vollends wiederaufgebaut worden. Tiefe Lücken klafften zwischen den Häuserreihen, auch wenn nun langsam kein Schutt mehr aus der Stadt heraustransportiert werden musste.
Aber der Lübecker Dom und die Kirche St. Petri waren immer noch nicht wiederaufgebaut worden. Stattdessen hatte man entschieden, die St.-Marien-Kirche, an der Luisa und Rowena auf ihrem Heimweg vorbeigehen würden, als Erstes wieder aufzubauen. Dieses Gotteshaus prägte nun das Stadtbild Lübecks.
Viele Leute waren an diesem wunderbaren Frühlingstag unterwegs. Kinder liefen durch die Straßen, ihre Rufe wurden vom lauen Wind fortgeweht. Die Bäume trugen erste Knospen, und alles begann in zartem Grün zu erstrahlen. Die Sonne glitzerte auf dem ruhigen Wasser der Trave, Vögel zwitscherten in den Bäumen.
Gemeinsam spazierten die Schwestern am Wasser entlang und entschieden sich für ein kleines, schnuckeliges Café, das erst vor wenigen Wochen eröffnet worden war.
Rowena grinste Luisa verschwörerisch an und deutete auf einen Tisch nahe dem Fenster, der unter einem roten Sonnenschirm im Schatten lag. Luisa nickte, und sie setzten sich an den Tisch. Die Stühle waren gemütlich, aus geflochtenem Korb gefertigt und mit weichen Kissen bestückt, und rote Decken lagen auf der Lehne. Der kleine runde Tisch war aus schwarzem Holz, und zwei Karten standen in einem kleinen Ständer darauf sowie ein Aschenbecher, den Luisa einem jungen Kellner ganz schnell auf das Tablett stellte, als er an ihr vorbeiging. Das Café war durch Glaswände von den anderen Restaurants in dieser Straße abgetrennt, welche die Gäste vor dem Wind schützten. Blumentöpfe mit bunten künstlichen Blumen aller Art, für die viele Menschen schwärmten, hingen an diesen Glaswänden, was dem Café eine angenehme Atmosphäre verlieh.
Luisa nahm sich eine der Karten, und urplötzlich kam ihr Rowenas Frage, wo sie Henry kennengelernt hatte, wieder in den Sinn. Während sie durch die Karte blätterte, überlegte sie, was sie ihrer Schwester erzählen wollte. Ob Rowena wirklich die ganze Wahrheit erfahren sollte.
Luisas Augen huschten über die Karte, und sie entdeckte eine Kirschtorte, die mit bitterer Schokolade verfeinert war. Sofort war ihre Neugier für diese Köstlichkeit geweckt, denn wenn es eines gab, was Luisa über alles liebte, dann waren es Backwaren. Und vor allem neue Rezepturen auszuprobieren und ihre Familie mit immer wieder neuen Kuchenkreationen zum Sonntagskaffee zu überraschen.
In ihrem Kopf erschien eine klare Vorstellung dieser Kirschtorte, und sie hätte diese fast gewählt, als ihr Blick auf eine weitere Torte am Ende der Karte fiel. Ein kleines Lächeln erhellte ihr Gesicht.
»Marzipantorte«, flüsterte Luisa und strich mit ihren Fingern über die Karte.
Es war beinahe so, als könnte sie Henrys Stimme hören, den Geschmack seiner Lippen auf den ihren spüren und die Süße des Marzipans schmecken. Vergessen war die raffinierte Kirschtorte, da war nur noch der Gedanke an Henry, und so bestellte sie bei dem jungen Kellner die Marzipantorte und ein Kännchen Kaffee. In Gedanken ganz bei ihrer großen Liebe.
Rowena stützte die Arme auf die Tischplatte und bettete ihren Kopf auf die Hände. Sie sah Luisa eingehend an und pustete sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Bitte erzähle mir alles über ihn«, bettelte sie und grinste ihre Schwester kokett an.
Luisa seufzte resigniert und nestelte an ihrem Armband. Dann begann sie, zuerst zurückhaltend, zu erzählen.
»Vor ungefähr einem Jahr gab es eine Veranstaltung im Museum. Erinnerst du dich daran?«
Ihre Schwester nickte versonnen. Sie hatte nicht daran teilgenommen, da ihr Vater der Meinung war, ein sechzehnjähriges Mädchen sollte lieber brav zu Hause sitzen. Rowena war fuchsteufelswild gewesen, weil Luisa mitkommen durfte.
Beinahe hätte alles in einem riesengroßen Streit geendet, denn Rowena war ein wenig dramatisch veranlagt. Nur durch Luisas Versprechen, ihrer kleinen Schwester später alles zu berichten, hatte Rowena sich beruhigen lassen.
»Dort habe ich ihn zum ersten Mal getroffen«, führte Luisa aus, und ihre Augen begannen zu leuchten.
Sie erinnerte sich gerne an diesen Augenblick. An Henrys blonde Locken, die sein Gesicht umrahmten. Den Glanz in seinen blauen Augen und den verschmitzten Blick. Dieses Lächeln, das immer noch ihr Herz erwärmte.
»Wir haben uns lange unterhalten. Er war eher zufällig zu dieser Veranstaltung gekommen. Ein Freund, den Vater eingeladen hatte, hatte ihn mitgenommen. Er wirkte wie ein Schatten auf See – die Leute schienen durch ihn hindurchzuschauen. Aber ich habe ihn gesehen. Er schien irgendwie fehl am Platz in dieser Museumsatmosphäre …«
»Und dann habt ihr beschlossen, euch öfter zu treffen?« Rowena konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Hör auf, dir irgendwelche Dinge auszumalen«, schalt Luisa ihre Schwester, als der Kellner den Teller mit dem Kuchen vor ihr abstellte.
»Vielen Dank«, sagte Rowena artig, und Luisa griff nach ihrer Gabel.
Bevor sie jedoch zu essen begann, betrachtete sie das Stück Torte eingehend. Sie konnte die verschiedenen Schichten der Köstlichkeit aus Biskuitteig und Creme erkennen, die sogar mit ein paar Früchten gefüllt war. Die Marzipanmasse lag wie eine sanfte Decke über dem Stück Torte, leicht gelblich, mit Puderzucker bestreut und einer Walnuss garniert. Unwillkürlich musste sie an Henry denken, und als sie sich mit einem versonnenen Lächeln ein Stück Torte in den Mund schob, schienen ihre Geschmacksnerven zu explodieren. Die Süße des Biskuitteigs harmonierte perfekt mit der Marzipanmasse, aus der sie die Mandeln leicht herausschmecken konnte, und wurde von der fruchtigen Creme abgerundet.
Es gab einfach nichts Schöneres für Luisa als die raffinierten Zusammenstellungen feinster Zutaten und fantasievolle Rezepturen. Und während sie noch ein Stück von der Torte aß, kam ihr der aberwitzige Gedanke, dass man das Marzipan doch mit so vielen weiteren Zutaten verfeinern könnte, zum Beispiel mit Pistazien oder …
»Achtung, Achtung: Erde an meine Schwester!« Rowenas Stimme riss Luisa aus ihrem Tagtraum, und sie schaute irritiert auf. »Ich habe dich gefragt, ob ihr beiden euch dann öfter getroffen habt.«
Luisa nickte und tupfte sich die Lippen mit einer Serviette ab.
»Ich bin ihm öfter in der Stadt begegnet. Auf dem Heimweg von einem Ball. In den anderen Lübecker Museen. Es war, als würde er nach mir Ausschau halten. Hier auf der Altstadtinsel. Als würden wir uns anziehen wie Magneten …«, murmelte Luisa lächelnd.
»Das klingt so wunderschön!«, sagte Rowena seufzend und trank einen Schluck Kaffee.
Sie verzog das Gesicht zu einer Grimasse und schüttete mehr Zucker, als gut für sie war, hinein.
Rowena war das komplette Gegenteil von Luisa. Zu der Jüngeren hätte eine geheime Liebe vortrefflich gepasst. Doch jetzt war es Luisa, die sich in diesem Dilemma befand.
»Wann willst du ihn Mutter und Vater vorstellen?«, bohrte ihre Schwester weiter nach, aber Luisa hob abwehrend die Hände.
Wieder schlug ihr Herz bis zum Hals. Sie wollte nicht darüber nachdenken. Diese geheime Liebe, dieses Versteckspiel im Schatten zehrte an ihren Kräften. Doch gleichzeitig war es auch so wundervoll. Wildes Herzklopfen und zärtliche Küsse. Leidenschaftliche Umarmungen in der Dunkelheit. Befreites Lachen, so hell wie der Klang von tausend Glöckchen.
Luisa trank einen Schluck Kaffee und aß ihr Stück Torte auf, während sie den Blick durch das Café schweifen ließ. Die Tische des Cafés waren gut besetzt mit feinen Damen, die über den neuesten Klatsch plauderten, Gerüchte austauschten oder über anstehende Hochzeiten redeten.
Durch das Fenster warf Luisa einen Blick ins Innere des Lokals und entdeckte ihre geschwätzige Nachbarin Frau Reim, eine Frau Mitte vierzig, zusammen mit zwei weiteren Damen an einem Tisch.
Die Frauen trugen feine Ausgehkleider aus glänzendem Stoff. Frau Reims helle Locken waren mit vielen winzigen Klammern zu einem Knoten im Nacken hochgesteckt, und ein roter Hut mit Federn lag neben ihrem Teller. Luisa sah, wie die Frauen herzlich lachten und Frau Reim mit ihrer Gabel wild hin und her fuchtelte. Sie alle hatten ein großes Stück Kuchen vor sich, eine Tasse Kaffee und ein kleines Glas Eierlikör, den die Damen gern am Nachmittag zu sich nahmen. Frau Reim erhob das Glas und prostete den anderen beiden Damen zu, ihr lautes Lachen drang an Luisas Ohr.
Gott, wie wenig sie diese Frauen mochte, die tagsüber nichts anderes machten, als Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Die nichts anderes im Kopf hatten als ihr Geschwätz über andere Menschen. Und sich am Nachmittag das erste Glas Likör gönnten, bevor sie am Abend das Essen für ihre Gatten und Kinder zubereiten mussten, sofern sie keine Hausangestellten hatten.
Das Café war von einigen Lampen an den Wänden erleuchtet, die sanftes Licht spendeten und das Szenario in ein dämmriges Gold tauchten. Die Wände waren mit dunklem Holz vertäfelt, sodass das Café sehr edel aussah. Der Tresen auf der linken Seite war aus demselben dunklen Holz, und davor standen gepolsterte Hochstühle, auf denen ein paar Herren saßen, Zeitung lasen oder geschäftig miteinander sprachen. Über dem Tresen hingen einige Bilder von Kaffeewerbungen, Frauen in schicken Kleidern, die in ihren Küchen das feine Gebräu für ihren Gatten zubereiteten. Ein Lächeln auf dem Gesicht und ein geradezu dümmlich seliger Blick, weil sie für den Herrn des Hauses in der Küche stehen durften. Die schrillen bunten Bilder, die im Licht der Sonne glänzten, standen in einem seltsamen Kontrast zu den dunklen Tönen im übrigen Teil des Cafés.
Die meisten älteren Frauen saßen wie Frau Reim und ihre Freundinnen drinnen, um sich vor der Sonne und dem leichten Wind zu schützen. Hier draußen bei Luisa und ihrer Schwester waren Familien mit Kindern, Paare, die vielleicht das erste Mal miteinander ausgingen, und Schulmädchen, die über Jungen in ihrer Schule tratschten.
»Luisa?« Sie hatte ihrer Schwester nicht geantwortet und bemerkte erst, als sie den Kopf drehte und sich von Frau Reims Anblick losriss, wie Rowena über den Tisch nach ihrer Hand griff. Sie war eiskalt. Wie Schnee.
»Du kannst es nicht ewig vor ihnen verheimlichen. Das weißt du selbst, Luisa. Außerdem scheint er eine gute Partie zu sein. Wenn er dir ein guter Mann ist, werden sie nichts dagegen einwenden können. Er ist keiner der Rock ’n’ Roll hörenden und Moped fahrenden Jungen, die mir gefallen.«
Unschlüssig nickte Luisa. Sie war sich da nicht so sicher wie ihre Schwester. Irgendetwas nagte an ihr. Ein Gedanke, den sie nicht zu fassen vermochte. Die schmerzhafte Angst davor, ihren Eltern von Henry zu erzählen, war allgegenwärtig.
»Luisa, bitte zieh nicht so ein trauriges Gesicht«, beschwerte sich Rowena, nachdem sie aufgegessen hatte, »immerhin hast du jemanden, der dich liebt.«
Es versetzte Luisa einen tiefen Stich ins Herz, als sie Rowenas verletzten Blick bemerkte. Ihre Schwester hatte recht. Sie war glücklich und konnte Henrys Küsse immer noch auf ihren Lippen spüren. Rowena wurde dieses Glück nicht zuteil, und trotzdem beschwerte Luisa sich.
»Bitte entschuldige …«, murmelte Luisa verlegen und nestelte an ihrer Geldbörse herum, als der Kellner die Rechnung brachte. Sie gab ein großzügiges Trinkgeld, und der Bursche bedankte sich überschwänglich. Eigentlich war er viel zu jung, um hier zu arbeiten, aber wahrscheinlich brauchte seine Familie das Geld. Seine Gesichtszüge bewegten sich irgendwo zwischen denen eines halbwüchsigen Knaben und eines jungen Mannes. Die Nase viel zu groß, der Mund zu klein.
Auch jetzt, zwölf Jahre nach Ende des Krieges, lebten immer noch viele Familien in Armut. In kleinen beengten Wohnungen mit zu vielen Personen darin.
Welches Glück Rowena und ich doch haben, dachte Luisa reumütig, als sich die Geschwister erhoben und sich auf den Weg nach Hause machten. Sie konnten sich über nichts beschweren, ihre Eltern waren liebevolle Menschen, die immer hart gearbeitet hatten, um ihnen dieses Leben zu ermöglichen. Auch wenn sie ihre Töchter eher streng erzogen und diesen Wandel der Jugend, wie ihr Vater es nannte, nicht billigten.
Aber Luisa konnte nicht richtig glücklich sein, denn dieses Geheimnis belastete sie.
Während sie jedoch mit Rowena durch Lübeck ging, stahl sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. Denn Luisa liebte diese Stadt. Die imposanten Häuser mit ihren vielen Verzierungen. Die verwinkelten Straßen.
Sie liefen von der Untertrave die Fischstraße hinauf, vorbei an der prächtigen Marienkirche mit ihren braunroten Backsteinmauern und ihren grünen Dachschindeln auf den vielen Giebeln und Dächern. Mit langsamen Schritten gingen die Schwestern am Kirchenschiff vorbei, an den Tausenden von Fenstern, in denen sich das Licht der Frühlingssonne spiegelte. Weiße Ornamente mit Kreuzen zierten die beiden über vierzig Meter hohen Kirchtürme, deren Spitzen die Wolken zu durchstoßen schienen.
Aus dem Inneren konnte Luisa leisen, melodischen Gesang vernehmen. Jungenstimmen, die den Stimmbruch noch nicht erreicht hatten und noch klangen wie die Engel Gottes. Luisa bewunderte die filigranen Arbeiten an dieser Kirche und ihre prächtige Gestalt nur zu gerne und blieb einen Augenblick stehen, bevor sie Rowena folgte. Sie war nun zwanzig Jahre alt, und der Krieg war seit vielen Jahren vorüber, aber trotzdem war diese abscheuliche Erinnerung nicht verblasst. Wann immer Luisa durch die Straßen Lübecks lief, erfüllte sie Dankbarkeit, dass nun Ruhe in die Stadt eingekehrt war. Dass sie nicht mehr hungern musste und ein saftiges Stück Torte essen konnte, sogar Schokolade kaufen konnte, die es während des Krieges und auch noch Jahre danach nur zu Wucherpreisen gegeben hatte.
Ihre Absätze klackerten auf dem Pflasterstein, und sie musste höllisch aufpassen, nicht in die Rillen zu treten, damit sie ihre Schuhe nicht ruinierte oder gar stolperte und auf den harten Boden fiel.
Rowena und sie gingen die Fleischhauerstraße entlang und bogen nach rechts in die Königstraße ab. Unschlüssig blieb Luisa vor ihrem Stadthaus stehen, welches sich über drei Stockwerke erstreckte, und schaute nach oben. Weißer Stein zierte die Fassade des Hauses, und auf jeder Etage befanden sich mehrere große Fenster. Über denen im zweiten Stock thronten wie Wächter gruselige, in Stein gehauene Köpfe von Seefahrern.
Rowena sperrte die Tür auf und musterte ihre Schwester lange. »Du musst mit Mutter und Vater reden«, drängte sie noch einmal.
Als Luisa nicht antwortete, drehte sich Rowena zu ihr um und legte ihr die Hände auf die Schultern.
»Versprich es mir«, beharrte sie.
Manchmal war es, als würde Luisa sich selbst in ihrer Schwester sehen. Ihr jüngeres Ich. Vieles, was Rowena jetzt tat, hatte Luisa vor ein paar Jahren auch getan. Sie waren sich viel ähnlicher, als sie manchmal glaubten.
»Ich verspreche es dir«, sagte sie leise und ging mit Rowena zusammen hinein.
Kühle Luft umfing die beiden jungen Frauen, und goldenes Sonnenlicht fiel durch die Fenster hinter ihnen auf den Holzfußboden. Ein paar Staubkörner tanzten im flirrenden Licht. Luisa blickte sich versonnen um. Hier, in ihrem Zuhause, schlug ihr Herz ganz ruhig. Hier fühlte sie sich geborgen.
Sie schlüpfte aus ihren Schuhen und schaute die dunkelbraune Treppe hinauf, die zu den Schlafzimmern ihrer Eltern, ihrer Schwester und ihrem eigenen führte.
»Luisa? Rowena? Seid ihr das?«, ertönte eine kratzige Stimme aus dem Wohnzimmer.
»Ja, Großvater, wir sind es«, rief Rowena und legte ihre Jacke an der Garderobe ab.
Sie schaute Luisa über die Schulter an, aber diese schüttelte den Kopf.
»Komm bitte mit«, flüsterte Rowena leise, »er ist so viel allein, seit Großmutter gestorben ist …«
Diese Worte erweichten Luisas Herz, und sie folgte ihrer Schwester mit bedächtigen Schritten. Ihr Großvater Hans saß in dem großen Ohrensessel am Fenster und schaute hinaus auf die Stadt und die vielen Menschen in den Straßen.
Er lebte allein in der obersten Etage des Hauses, verbrachte aber viel lieber Zeit im Wohnzimmer am Fenster, ein Buch in der Hand und eine schon kalte Tasse Tee auf dem Tisch neben ihm.
»Hallo, meine beiden schönen Mädchen«, begrüßte er die Schwestern. Seine Stimme war heiser und leise, aber seine Haltung immer noch so aufrecht wie eh und je.
»Großvater«, sagte Rowena und drückte ihm einen Kuss auf die raue Wange.
Hans schaute die beiden lächelnd an, und Luisa betrachtete ihren Großvater eingehend. Trotz seiner siebenundsechzig Jahre war er immer noch gut zu Fuß und wortgewandt wie kein anderer. Sanfte Falten befanden sich auf seiner Stirn und der Haut um seine Augen, aber sein Haar war noch voll, auch wenn es in den letzten Jahren ergraut war.
»Wart ihr in der Stadt spazieren und habt die Sonne genossen?«, fragte Hans und deutete auf den Platz neben sich.
Die Schwestern setzten sich, und Rowena strich sorgfältig ihr Kleid glatt. »Ja«, antwortete sie grinsend, »wir haben Torte gegessen.«
»Und mir keine mitgebracht?«, fragte ihr Großvater lachend.
Luisa neigte den Kopf zur Seite und erinnerte sich an die kleine Tüte, die Rowena aus dem Café mitgenommen hatte.
»Schau nur«, erwiderte die jüngere Schwester und zauberte die Tüte hervor. »Natürlich haben wir dir ein Stück Kuchen mitgebracht.«
Du, korrigierte Luisa ihre Schwester in Gedanken und schaute nachdenklich aus dem Fenster.
Ob sie sich in der letzten Zeit verändert hatte? Sie dachte viel zu selten an ihre Mitmenschen und viel zu oft an Henry. Aber vielleicht fühlte sich Verliebtsein so an. Mit den Gedanken und dem Herzen nur bei der großen Liebe …
»Vielen Dank«, sagte Hans lächelnd und packte das Stück Kuchen aus.
»Warte …« Rowena sah sich suchend um. »Wo ist Hilde?«
Hans deutete nach draußen. »Sie ist zusammen mit einem anderen Dienstmädchen einkaufen gegangen.«
»Dann hole ich dir eine Gabel.« Leichtfüßig sprang Rowena auf und verschwand wie ein Schatten aus dem Wohnzimmer.
Luisa starrte immer noch schweigend nach draußen, als die Uhr im Flur schlug und sie zusammenfuhr.
»Was bedrückt dich, mein Kind?«, fragte ihr Großvater plötzlich in die Stille, und eine Gänsehaut legte sich über Luisas Glieder.
»Wie bitte?«, krächzte sie und ärgerte sich im gleichen Augenblick über ihre schwache Stimme.
»Es ist, als könnte man deine Gedanken lesen«, sagte ihr Großvater mit einem sanftmütigen Lächeln und hob die faltige Hand.
Vorsichtig berührte er Luisas Wange und neigte den Kopf zur Seite. »Du bist ganz weit weg, deine Gedanken sind bei jemand anderem, und so schaut nur jemand, der verliebt ist.«
»Oh, Großvater«, murmelte Luisa leise und wollte es ihm gerade erzählen, als Rowena wieder ins Wohnzimmer kam.
»Bitte schön.« Sie hielt Hans die Gabel hin, und er ergriff diese lächelnd.
»Vielen Dank, Rowena«, sagte er und begann schweigend den Kuchen zu essen.
Luisa beobachtete ihn verstohlen. Natürlich, ihr Großvater war alt, er hatte die Liebe schon tausendmal gesehen und gefühlt. Er hatte ihre Großmutter Mathilda abgöttisch geliebt, aber eigentlich wusste Luisa wenig über ihn.
Hans hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft. Aber zwischen seiner Rückkehr und der Geburt ihres Vaters lagen verborgene Jahre. Wie ein Buch mit sieben Siegeln. Als der Zweite Weltkrieg begann, war er Anfang fünfzig gewesen, und aufgrund seiner Kampferfahrung im Ersten Weltkrieg hatte er in diesem folgenden Krieg als Offizier gedient, Befehle erteilt, statt zu kämpfen.
»Eure Eltern wollen heute Abend in das neue Restaurant in der Holstenstraße gehen«, bemerkte Hans und stellte den Teller vor sich auf den Tisch, nachdem er den Kuchen aufgegessen hatte.
»Wirklich?«, fragte Rowena und verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Ich wollte mit meinen Freundinnen ins Kino und danach in das neue Jazz-Café!«
Hans lacht rau und legte seiner Enkelin eine Hand auf den Arm. »Erzähl das lieber nicht deinem Vater, sonst wird er noch ungehalten. In diesen Cafés sind lauter freche Burschen, und es wird viel geraucht.«
Rowena zuckte unschuldig mit den Schultern. »Ich würde niemals rauchen.«
Eine glatte Lüge, dachte Luisa spöttisch, aber sie schwieg lieber.
Hans zwinkerte Rowena zu. »Das glaube ich dir, aber geh heute lieber mit deinen Eltern essen, dann kannst du dich an einem anderen Tag mit deinen Freundinnen treffen, wenn du dich beim Essen gut benimmst.«
»In Ordnung, dann machen wir uns jetzt lieber hübsch«, murmelte Rowena und griff nach der Hand ihrer Schwester, aber Luisa entzog ihr diese sofort. »Ich möchte noch ein bisschen lesen«, erwiderte sie. »Außerdem brauche ich nicht so lange wie du.«
Rowena zog einen Schmollmund, aber sie fing sich schnell wieder. »Dann gehe ich eben allein vor«, erwiderte sie immer noch ein bisschen beleidigt und küsste Hans erneut auf die Wange. »Bis später, Großvater.« Sie winkte noch kurz, und schon war sie um die nächste Ecke verschwunden. Ihre Schritte hallten auf der Treppe wider und erzeugten eine unregelmäßige Melodie in Luisas Ohren.
Sie schaute ihrer Schwester nach und ließ sich dann in die Kissen auf dem Sofa sinken. »Wie kann man nur so viel Energie haben?«, murmelte sie.
Ihr Blick glitt durch das Wohnzimmer, und ihre Hand streifte die weichen Polster der cremefarbenen Couch. Auf der anderen Seite stand ein riesiger, kastenförmiger Fernseher in hellem Braun, der natürlich ausgeschaltet war, denn ihr Großvater Hans hielt nicht viel von dieser modernen Technik.
»Du hattest früher auch so viel Energie«, bemerkte Hans schmunzelnd.
»Wirklich?« Skeptisch schaute sie Hans an und musste bei seinem Blick anfangen zu lachen. »Vielleicht«, gab sie unbehaglich zu, wurde aber sofort wieder nachdenklich.
»Wer ist der junge Mann, der dein Herz so schnell schlagen lässt?«
Die Frage ließ Luisa erstarren. Das Atmen fiel ihr plötzlich schwer. Ihre Kehle fühlte sich staubtrocken an.
»Er …«, fing sie vorsichtig an und schaute nach draußen. Hans lächelte versonnen, griff nach Luisas Hand und streichelte sie. Sie sah ihren Großvater an. Erkannte so viel Lebenserfahrung in ihm. So viele alte Erinnerungen.
»Ich habe ihn vor über einem Jahr kennengelernt …«, flüsterte sie heiser und spürte, wie all diese Erinnerungen durch sie hindurchströmten. »Er ist wunderbar und charmant. Ein wahrer Gentleman, er würde dir gefallen, Großvater. Seiner Familie gehört die Marzipanmanufaktur, und sein Name ist Henry …«
Luisa erschrak, als sie den Blick ihres Großvaters sah. Hatte er vorher lächelnd ihren Worten gelauscht, war sein Gesicht jetzt blass, wie versteinert. Aller Glanz war aus seinen Augen gewichen.
»Großvater?«, fragt sie vorsichtig.
Ihr Herz klopfte wild, so hatte sie ihren Großvater noch nie gesehen.
»Die Marzipanmanufaktur … Sag, Luisa, welchen Nachnamen trägt Henry?«, murmelte Hans leise.
Seine Frage verwirrte Luisa. Es war, als ahnte er die Antwort auf diese Frage, als wollte er die Antwort lieber gar nicht wissen.
Luisa legte die Stirn in Falten. »Henry Hawkins«, antwortete sie ruhig, und in diesem Augenblick zerbrach etwas im Blick ihres Großvaters.
Mit einem Mal hörte die junge Frau ein Poltern hinter sich, ein Stöhnen und eine wütende Stimme.
»Hast du gerade Henry Hawkins gesagt?«
Wie in Trance wandte sich Luisa um. Es war die Stimme ihres Vaters, aber so aufgebracht hatte sie ihn noch nie gesehen. Zornesröte glühte auf seinem Gesicht. Seine rechte Hand umklammerte den Gehstock, den er wegen einer alten Kriegsverletzung benötigte, so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Erregt funkelte er seine Tochter an.
»Vater, ich …«, wollte Luisa erklären, aber ihr Vater kam auf sie zu, das monotone Klack, Klack des Stocks setzte sich schmerzhaft in ihren Gedanken fest.
»Ich will nichts hören! Was hast du mit Henry Hawkins zu tun? Habe ich etwa richtig gehört, dass du dich ohne unser Wissen mit diesem jungen Mann triffst?« Seine Fragen trafen Luisa wie ein Peitschenknall, sie zuckte zusammen und wich dem Blick ihres Vaters aus.
Sie hatten es also ebenfalls geahnt. Genauso wie Rowena. Natürlich, ihre Eltern waren nicht auf den Kopf gefallen, aber Luisa verstand beim besten Willen nicht, warum ihr Vater so ausfallend wurde. Er packte sie unsanft am Handgelenk und zog sie hoch.
Luisa unterdrückte einen Schrei. Sie biss sich auf die Unterlippe. Alles in ihrem Kopf drehte sich. Warum war er bloß so wütend? Natürlich hatte sie es ihren Eltern verheimlicht, aber das schien nicht das wahre Problem zu sein.
Vorsichtig schaute sie zu ihrem Vater auf. Er war fast zwei Meter groß, ein stattlich gebauter Mann mit schwarzen, kurz geschnittenen Haaren und dunkelblauen Augen. Sie hatte ihr Aussehen von ihm geerbt, ebenso den Starrsinn. Aber jetzt, in diesem Moment, fürchtete sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben vor ihm.
»Es tut mir leid«, flüsterte sie tränenerstickt und schaute zu Boden. »Ich wollte das nicht. Aber er ist ein guter Mensch, er …«
»Gar nichts ist er!«, fauchte ihr Vater und ließ ihr Handgelenk los. »Du wirst ihn nicht wiedersehen. Ich will in diesem Haus nie wieder den Namen Henry Hawkins hören.«
»Aber …«, begehrte sie auf, hielt jedoch sofort den Mund, als ihr Vater sie noch einmal anschaute.
Tränen schossen ihr in die Augen.
»Vater, bitte … ich …«, versuchte sie es erneut, aber er trat noch einen Schritt näher auf sie zu und griff erneut nach ihrem Handgelenk.
Ein scharfer Schmerz schoss durch ihren Körper. »Du wirst Henry Hawkins nicht wiedersehen«, raunte ihr Vater ihr noch einmal mit kalter Stimme zu. »Diese Familie bringt nur Unglück.«
Die Worte ihres Vaters gruben sich tief in Luisas Herz. Stephans Blick so voller Zorn, das Lodern in seinen Augen und die Stimme wie Donnergrollen. Sie unterdrückte ein Schluchzen, als ihr Vater ihr Handgelenk losließ, ihr einen letzten wütenden Blick zuwarf und dann die Treppe hochpolterte.
Luisa stand im Wohnzimmer inmitten der vielen Bücherregale und der stickigen Wärme eines traurigen Frühlingstags. Tränen rannen stumm über ihre Wangen, und ihr Handgelenk brannte wie Feuer. Es war, als wäre ihre Welt, ihr ganzes Dasein in tausend Stücke zersprungen, die Splitter bohrten sich tief in ihr Herz.
Sie hörte nur ein dumpfes Dröhnen in ihren Ohren, und ihr Kopf pochte schmerzhaft.
Sie verstand es nicht. Sie konnte nicht begreifen, warum ihr Vater so aufgebracht gewesen war.
So stand sie verloren im Wohnzimmer und schaute auf ihren Großvater, der das Gesicht in den Händen vergraben hatte. Ein leises Schluchzen kam aus seiner Kehle, und Luisa verstand die Welt nicht mehr.
Kapitel 2
Das Rattern und Surren der Maschinen hallte in seinem Herzen wider, und die stickige Luft ließ ihn aufstöhnen. Wärme klebte an den Wänden der Marzipanmanufaktur, goldenes Sonnenlicht fiel durch die großen Fenster in die Halle.
Henry stand auf der Empore, seine Hände umklammerten das Geländer so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Seine Gedanken kreisten um Luisa. Um ihr Lächeln und ihre zarten Hände, die sein Gesicht berührten. Er konnte ihre grünen Augen vor sich sehen, dieser Blick voller Leidenschaft, der sein Herz berührte.
Dampf stieg von den Kesseln auf, in denen die Mandeln für das Marzipan in heißem Wasser gespült wurden. Die Gesichter der Arbeiter, die nah bei den heißen Kesseln standen, waren mit Schweiß bedeckt.
Weiter hinten konnte Henry die Trommeln erkennen, in denen die Mandelmasse mit Zucker und Wasser vermischt wurde, um am Ende zur Rohmasse für das Marzipan zu werden. Das Quietschen der Walzen drang an sein Ohr, die die Rohmasse zu einem feinen Teig walzten. Der Geruch von Zucker und Mandeln hing in der Luft und setzte sich in Henrys Nase fest, genau wie die feinen Röstaromen. Die kleinen, sich drehenden Kessel, in denen die Masse abgeröstet wurde, machten ein schepperndes Geräusch.
Henry riss sich nur mit Mühe von dem Anblick der Marzipanherstellung los und ging die Treppenstufen nach unten zum Lieferanteneingang. Seine Sohlen klackten auf dem Metall, und die Arbeiter, an denen er vorbeiging, grüßten ihn mit einem höflichen Nicken. Durch den dichten Dampf konnte Henry kaum etwas sehen, aber seine Füße kannten den Weg.
Er blieb vor dem großen Rolltor stehen, welches sich im hinteren Teil der Fabrik befand, und hörte die Rufe der Arbeiter, die gerade dabei waren, zwei Lastwagen zu entladen. Die Wagen waren dunkelblau, und die Planen, die die Ware geschützt hatten, hingen seitlich an ihnen herab. Zwei Arbeiter standen auf der Ladefläche und reichten den anderen die Säcke mit den Mandeln.
Henry neigte den Kopf zur Seite und formte mit den Lippen den Schriftzug der Firma, der auf den Lastwagen stand:
Dietrichs’ feinste Mandel.
Das war neu. Der Hersteller Dietrichs kam ihm zwar vage bekannt vor, aber bis jetzt hatte sein Vater sich noch nicht von ihm beliefern lassen. Eine merkwürdige Vorahnung beschlich Henry, aber er ließ sich nicht davon beirren.
»Moin, Henry!«, rief einer der Männer auf dem Wagen und lupfte seinen Hut.
Es war Herbert Mähling, der Vorarbeiter seines Vaters. Henry schenkte dem Mann ein Lächeln und hob die Hand. Mähling sprach kurz mit einem seiner Kollegen und sprang dann behände vom Lastwagen. Die dunklen Locken klebten an seiner Stirn, denn die Mittagssonne war ungewöhnlich warm, aber die Augen des Mannes leuchteten fröhlich. In seinem Blick lag der Schalk.
»Grüß dich, Herbert«, entgegnete Henry und hielt einen der jungen Burschen auf, die gerade die Säcke nach drinnen trugen.
Der Bursche schaute Henry irritiert an, aber auf einen Wink Mählings ließ er den Sack im Schatten bei Henry stehen. Die Säcke mit den Mandeln wurden mit einem Lastenzug nach oben ins Lager transportiert, wo sie in kühler Dunkelheit aufbewahrt wurden.
»Hat mein Vater einen neuen Handelspartner gewonnen?«, fragte Henry, während Herbert den Sack aufschnürte und eine kleine Kelle aus seinem Beutel am Gürtel hervorzauberte, um ein paar Mandeln herauszuschaufeln.
Herbert schaute auf die Lastwagen und zuckte mit den Schultern. »Ich bin nicht sicher, diese Lieferung wurde uns erst heute Morgen angekündigt.«
Henry konnte Herbert an der Nasenspitze ansehen, dass ihm dies nicht behagte, denn wenn es eines gab, was die Arbeiter in der Manufaktur nicht schätzten, dann war es eine Störung ihrer Routine.
Herbert reichte Henry eine Mandel, die dieser eingehend betrachtete. Die braune Haut hatte keine Dellen, und die Mandel war wohlgeformt. Henry steckte sie in den Mund und kaute konzentriert. Die Mandel war bissfest und süß, die Schale kaum zu bemerken. Genau so, wie sein Vater die Mandeln für sein Marzipan gerne hatte.
»Sie schmecken vorzüglich«, murmelte er nachdenklich und nahm sich noch eine.
Die Schale wurde beim Waschen abgerieben, nur die Mandel wurde zur Herstellung benutzt. Aber da ihre Maschinen die Mandel einwandfrei von der Schale befreien konnten, bestellte sein Vater süße Mandeln mit Schale, was auch günstiger war.
Herbert nickte. »Angeblich der Hersteller der allerfeinsten Mandeln.«
Henry schaute zu den Lastern, die fast vollständig entladen waren, und schenkte Herbert ein Lächeln. »Ich kann mich doch darauf verlassen, dass die Mandeln schattig gelagert werden, dann muss ich nicht noch mal nach oben, oder?«
Mähling lachte auf und pfiff einen Burschen herbei, der den Sack sofort nahm und im Inneren der Manufaktur verschwand. »Natürlich«, antwortete er.
Henry hob die Hand zum Abschied und schaute noch kurz zur Außenfassade der Manufaktur, die silbern im Licht der Sonne glänzte. Das kastenförmige Gebäude stand wie ein Klotz auf dem Grundstück, und Dampf stieg daraus empor. Henry begab sich wieder nach drinnen und sah kurz hinauf zu den Lastenaufzügen, auf welchen die Säcke mit einem leisen Quietschen nach oben ins Lager gebracht wurden.
Mit einem zufriedenen Lächeln ging er die Treppe zur Empore wieder hinauf. Unten hatten die Männer eine kleine Pause eingelegt und das alte Radio aufgestellt, welches seit Ewigkeiten in der Manufaktur stand. Eine Kabarettsendung schien zu laufen, denn die Männer lachten immer wieder heiser auf und grinsten frech, während sie dem Sprecher lauschten.
»Henry!«, hörte er plötzlich die Stimme seines Vaters, widerwillig wandte Henry den Kopf und sah sich um.
Sein Vater Nikolas stand in der Tür zu seinem Büro und winkte Henry zu sich. Der unterdrückte ein Stöhnen und fuhr sich durch die krausen, blonden Locken. »Henry! Nun komm bitte her.«
Henry konnte die Ungeduld, die in der Stimme seines Vaters mitschwang, deutlich heraushören und begab sich eilig zu ihm.
Seine Schritte hallten auf der Empore, und unwillkürlich ballte sich seine Hand zur Faust. Unzählige Gedanken stoben durch seinen Kopf, bis er vor seinem Vater zum Stehen kam, er hielt den Kopf gesenkt, um nicht in die graublauen Augen zu blicken, die Henry an ein Raubtier erinnerten.
»Henry.« Nikolas verschränkte die Arme vor der Brust und musterte seinen Sohn mit einem abschätzigen Blick. »Komm bitte in mein Büro, ich möchte dir jemanden vorstellen.«
Henry öffnete den Mund, um zu einer Antwort anzusetzen, aber er schloss ihn wieder, ohne dass ein Wort über seine Lippen kam. Mit einem mulmigen Gefühl folgte er seinem Vater ins Büro und schloss die Tür hinter sich mit einem dumpfen Knall.
Im Inneren des Büros war es stickig und viel zu warm. Er räusperte sich und ließ seinen Blick durch den Raum wandern. Regale an den Wänden, die mit Büchern vollgestopft waren, Aktenordner auf dem Schreibtisch seines Vaters, Papierbogen, mit schwarzer Tinte beschrieben. Henrys Blick blieb an einem Mann hängen, der am Fenster stand und sich zu ihm umdrehte.
»Henry, ich freue mich, Sie kennenzulernen«, begrüßte der Mann ihn und streckte Henry die Hand aus.
Henry ging auf den Mann zu, neigte höflich den Kopf und sah den Herrn eingehend an. Seine dunklen Haare waren nach hinten gekämmt, einige silberne Strähnen zogen sich durch das Schwarz. Braune Augen musterten Henry aufmerksam, und er erwiderte den festen Händedruck.
»Ich freue mich ebenfalls, Herr …?« Fragend sah Henry seinen Vater an, und der klatschte begeistert in die Hände.
»Das ist Herr Dietrichs. Er ist der Inhaber eines Mandelimports in Hamburg, dort vertreibt er als Großhändler die Mandeln, und wir möchten gern enger zusammenarbeiten.«
Henry legte die Stirn in Falten und unterdrückte ein Stöhnen. Daher wehte also der Wind, und deswegen hatten sie heute zwei Lastwagenlieferungen von Dietrichs’ feinste Mandel erhalten. Wie Henry seinen Vater kannte, hatte dieser die Mandeln zu einem Spottpreis bekommen, um erst mal zu testen, ob sie gut genug waren für sein feines Marzipan.
Er wusste, dass sein Vater die Produktion des Marzipans ausbauen wollte. Bessere Mandeln und feinere Schokolade für den Überzug der Pralinen, damit diese noch vorzüglicher schmeckten und sich noch besser verkauften.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Dietrichs«, sagte Henry mit ruhiger Stimme, obwohl er immer noch nicht wusste, warum sein Vater ihm diesen Mann vorstellte.
Auch wenn sein Vater wollte, dass Henry bald in die Marzipanmanufaktur einstieg, traf er bis jetzt alle Entscheidungen allein und behandelte Henry wie einen kleinen Jungen, der noch nicht richtig lesen und schreiben konnte.
»Ich denke, wir werden eine gute Partnerschaft eingehen.« Dietrichs lächelte Henry an und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Auf die eine und andere Art.«
Mit diesen Worten nickte Dietrichs seinem Vater zu und verließ das Büro mit einem melodischen Pfeifen. Die Tür schloss sich erneut mit einem dumpfen Geräusch, und Henrys Herz schlug wild in seiner Brust.
»Was meinte er damit, Vater?«, fragte Henry gespannt und ahnte nichts Gutes.
Nikolas grinste seinen Sohn an. »Dietrichs hat eine wunderschöne Tochter namens Emilie. Sie ist noch nicht verheiratet, und diese Verbindung wird unsere Partnerschaft aufs Trefflichste abrunden.«
Henry starrte seinen Vater an und konnte seinen Abscheu über diese Idee nicht verbergen, denn Nikolas’ Lächeln schwand von seinen Lippen.
»Du scheinst von dieser Idee nicht begeistert zu sein.«
»Ich soll begeistert sein, dass du mich wie ein Pferd verschachern willst?«, knurrte Henry zornig. Er respektierte seinen Vater, er entsprach dessen Wünschen, sich adrett zu kleiden und nicht in einer Lederjacke und mit einer Zigarette im Mundwinkel durch die Gegend zu laufen, wie andere junge Männer in Henrys Alter es taten. Sogar seine Haare hatte er sich nicht wachsen lassen, wie so viele von Henrys Freunden, da sein Vater der Meinung war, dies würde sich nicht für einen zukünftigen Geschäftsmann gehören. Aber Henry würde sich nicht für eine Partnerschaft verkaufen lassen.
Nikolas schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Bitte sei nicht so dramatisch, Henry. Emilie ist eine zauberhafte junge Frau, ihr könntet euch kennenlernen und …«
»Ich will sie nicht kennenlernen«, unterbrach Henry seinen Vater und drehte ihm den Rücken zu. »Ich habe bereits eine junge Frau kennengelernt, der ich mein Herz geschenkt habe.«
Luisas Lachen hallte in Henrys Gedanken wider, und ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Sein Herz schlug wie wild.
Nikolas lachte schallend auf. »Du hast eine junge Frau kennengelernt?«, fragte er, und Henry konnte den Spott in seiner Stimme hören. Als wäre das so unglaubwürdig.
»Dann erzähl mir mehr über deine Angebetete, und wir werden sehen, ob sie eine ebenso gute Partie für dich ist wie Emilie Dietrichs.«
Henry wollte seinem Vater an den Kopf werfen, dass es ihn nicht im Geringsten kümmerte, ob Luisa so wohlhabend war wie er. Aber er besann sich eines Besseren und atmete tief durch. Kurz schloss er die Augen und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, dann sah er seinem Vater in die Augen.
Doch bevor er etwas erwidern konnte, fiel sein Blick zufällig auf eine Karte, die auf dem Schreibtisch seines Vaters lag. Henry kniff die Augen zusammen und ging einen Schritt auf den Tisch zu. Bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass es sich um einen Grundrissplan der Manufaktur handelte, mit den angrenzenden Grundstücken, die ebenfalls darauf eingezeichnet waren.
»Was ist das?«, fragte Henry und strich mit dem Zeigefinger über den Grundrissplan.
Seine Neugier war geweckt, und Luisa rückte für einen winzigen Augenblick in den Hintergrund.
Hastig kam sein Vater auf ihn zu, rollte den Plan zusammen und schob ihn in ein Regal.
»Das lass mal meine Sorge sein, du wolltest mir doch gerade erzählen, welches junge Ding dein Herz erobert hat.« Die Stimme seines Vaters klang höhnisch. Nikolas strich über seinen dunkelgrauen Anzug, wischte ein paar Krümel Marzipanmasse von dem feinen Stoff.
»Ihr Name ist Luisa Linde und …« Weiter kam Henry jedoch nicht, denn Nikolas war mit zwei Schritten bei ihm und hatte die Hand erhoben.
Im nächsten Augenblick spürte Henry einen brennenden Schmerz auf der Wange, der ihm die Tränen in die Augen trieb.
»Luisa Linde ist bestimmt keine gute Partie für dich, Henry«, sagte Nikolas voller Abscheu. »Ich will diesen Namen nie wieder hören, und du wirst diese junge Frau auch nie wiedersehen. Hast du mich verstanden?«
Henry starrte seinen Vater entsetzt an, wagte es nicht, die schmerzende Wange zu berühren. »Aber Vater …«, setzte er an, doch Nikolas hob erneut drohend die Hand, und Henry verschluckte die weiteren Worte, die er seinem Vater gern entgegengeschleudert hätte.
»Es ist besser, wenn du jetzt gehst und dich auf die Prüfungsvorbereitungen für die Universität konzentrierst, damit du bald fertig bist mit deinem Studium und hier arbeiten kannst. Es wird Zeit, dass du Verantwortung übernimmst.«
Henry spürte ein merkwürdiges Kribbeln in den Fingern, und seine Beine fühlten sich taub an. Wie festgefroren stand er da. Unfähig, sich zu bewegen, unfähig, das Verhalten seines Vaters zu verstehen.
»Ich liebe sie, Vater.« Er hatte diese Worte nicht zurückhalten können, denn sie waren die einzige Wahrheit, die Henry noch kannte.
Nikolas drehte sich um und funkelte seinen Sohn zornig an. »Was weißt du denn schon von Liebe?«, fauchte er. »Geh jetzt, und wage es nicht noch einmal, von Luisa Linde auch nur zu sprechen. Als ob ich nicht schon genug Probleme mit dieser Familie hätte …« Die letzten Worte hatte sein Vater eher vor sich hin gemurmelt, und sie ergaben für Henry keinen Sinn.
Doch er wusste, dass es keinen Zweck hätte, mit seinem Vater weiter über Luisa zu sprechen. Er konnte Nikolas’ Zorn förmlich spüren. Ohne ein weiteres Wort verließ er das Büro und stürmte aus der Manufaktur ins Freie.
Kühle Luft umfing ihn und trocknete die Schweißperlen auf seiner Stirn. Henry fuhr sich durch die krausen Locken. Zorn brodelte tief in ihm, am liebsten hätte er die Wut auf seinen Vater laut in die Welt hinausgeschrien, aber dazu fehlte ihm die Kraft.
»Du siehst aus, als hättest du dich mit deinem Vater gestritten«, sagte eine ruhige Stimme hinter ihm, und Henry drehte sich um.
Im Schatten eines Baums saß sein Großvater Matthias auf einer Bank. Die Beine übereinandergeschlagen, ein mattes Lächeln auf den Lippen. Matthias war der Vater von Henrys Mutter Esmara, seine Familie hatte die Manufaktur kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs erworben und stammte ursprünglich aus England, doch sie hatten sich innerhalb kurzer Zeit in Deutschland eingebürgert, und sein Großvater hatte auch für Deutschland im Krieg gekämpft. Damit hatte seine Mutter auch noch Verwandtschaft in England, obwohl sie hier in Deutschland geboren wurde. Doch England war für seine Mutter und auch für seinen Großvater kaum mehr von Bedeutung, für Henry ebenso wenig, denn er war noch nie dort gewesen.
Aber weil Henrys Mutter als Frau in den Vierzigerjahren kein Unternehmen leiten konnte oder sollte, hatte sein Vater Nikolas, der deutscher Herkunft war, kurzerhand den Namen seiner Mutter angenommen, um die Manufaktur unter dem Namen Hawkins weiterzuführen.
Das war auch einer der Gründe gewesen, warum Henrys Vater vom Einsatz im Zweiten Weltkrieg teilweise verschont geblieben war, denn er bekleidete eine wichtige Position in der Manufaktur, weshalb er oft Heimaturlaub hatte und kaum an der Front kämpfen musste.
Anders als Henrys Großvater Matthias, der im Ersten Weltkrieg für Deutschland als einfacher Soldat gedient hatte, da er zu dem Zeitpunkt mit seiner Familie schon als Deutscher eingebürgert gewesen war und somit für seine neue Heimat hatte kämpfen müssen. Aufgrund seiner Erfahrung in der Marine war er im Zweiten Weltkrieg dann ebenfalls eingezogen worden und hatte auf einem Schiff als Offizier gedient. Henry vermochte es sich nicht vorzustellen, wie es war, in zwei Kriegen gekämpft zu haben. Wie viel Leid und Grausamkeit sein Großvater gesehen haben musste.
Er zuckte unwillig mit den Schultern und ging mit langsamen Schritten auf seinen Großvater zu. Sah sich um und fuhr mit den Händen über den feinen Stoff seines Jacketts.
»Möchtest du dich nicht setzen und mir erzählen, was passiert ist?«, fragte Matthias und klopfte auf den Platz neben sich.
Henry musterte seinen Großvater eingehend. Ein gütiger Blick aus dunkelblauen Augen lag auf ihm, und Henry dachte, dass sein Großvater vielleicht die richtige Person wäre, um sich alles von der Seele zu reden. Also setzte Henry sich und bettete das Kinn in die Hände.
Eine Mischung aus Verzweiflung und Wut drohte ihm die Luft zum Atmen zu nehmen wie eine Welle auf hoher See.
»Was ist denn geschehen?« Zaghaft berührte Matthias ihn am Arm, und Henry schaute hoch.
»Vater will mich verschachern wie einen Gaul«, murmelte Henry und schmeckte Bitterkeit auf seiner Zunge.
Matthias lachte rau auf und grinste seinen Enkel an. »Und darüber bist du so verärgert?«
Henry dachte einen Augenblick nach. Nein, darüber war er nicht verärgert. Es passte zu seinem Vater, ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ihm einfach eine fixe Idee zu präsentieren und nicht nach Henrys Meinung zu fragen. So war sein Vater immer gewesen.
»Nein«, antwortete Henry gedehnt. »Ich bin verärgert, weil ich mich in ein Mädchen verliebt habe.«
Matthias stieß einen Pfiff aus. »Das sind ja großartige Neuigkeiten. Aber warum bist du darüber verärgert? Und warum erfahre ich von so etwas immer als Letzter?«
Henry konnte nicht anders: Ein Grinsen erhellte seine Gesichtszüge. Er spürte, wie gut ihm die Anwesenheit seines Großvaters tat. Wie offen er mit Matthias sprechen konnte.
»Ich habe es noch niemandem erzählt«, gab Henry zu und biss sich auf die Unterlippe.
»Ich nehme an, dein Vater billigt die Verbindung mit dieser jungen Dame nicht?«
Sein Großvater hatte wie immer ins Schwarze getroffen. Henry streckte die Beine von sich, guckte hinauf in den strahlend blauen Himmel und dachte an Luisa.
Großer Gott, allein der Gedanke an sie raubte ihm schier den Atem. »Ich weiß überhaupt nicht, warum Vater so zornig geworden ist. Als er ihren Namen gehört hat, ist er völlig außer sich geraten.«
In diesem Augenblick zog eine Wolke vor die Sonne und verdunkelte den Himmel. Henry begann unwillkürlich zu frösteln, als sein Großvater nicht reagierte und mit einem Mal unbehaglich seine Finger knetete.
»Großvater? Was ist los?« Henry sah Matthias voller Schrecken an.
Matthias wirkte angespannt. »Wie heißt denn die junge Dame, in die du dich verliebt hast?«, fragte er, und seine Stimme war so rau, als hätte er zu viele Zigaretten geraucht.
Henry fuhr sich rasch mit der Zunge über die Lippen. »Ihr Name ist Luisa Linde.«
Henry lächelte unbewusst, als er Luisas Namen aussprach. Aber dann sah er in das Gesicht seines Großvaters, und das Lächeln verschwand augenblicklich.
Matthias keuchte erschrocken auf, und als er den Blick hob, sah Henry so viel Trauer in seinen Augen. Beinahe kam es ihm vor, als huschte ein dunkler Schatten über Matthias’ Gesicht.
»Großvater?« Henry streckte eine Hand aus, um seinen Großvater am Arm zu berühren, aber er zögerte. Er war wie eingefroren in der Zeit.
»Ach, Henry«, stöhnte Matthias leise, und eine Träne rollte über seine Wange.
Henry öffnete den Mund, fand aber keine Worte. Sie verhakten sich irgendwie auf seiner Zunge.
Matthias legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Es tut mir leid, Henry. Es tut mir so leid.«
Mit diesen Worten erhob Matthias sich und machte sich mit schweren Schritten auf den Weg in die Manufaktur. Henry wollte noch so vieles sagen, aber er blieb stumm. Er konnte nur zusehen, wie die Gestalt seines Großvaters immer kleiner wurde und dann im Inneren des Gebäudes verschwand.
Henry blickte an den grauen Wänden des Hauses empor, das von einigen grünen Bäumen umrahmt wurde und aus dessen Kamin der Rauch in den Himmel stieg.
Er saß auf der Bank und konnte keinen klaren Gedanken fassen, er verstand einfach nicht, was gerade geschehen war. Was sein Großvater mit diesen Worten gemeint hatte.
Es tut mir leid, Henry. Es tut mir so leid.
Matthias’ Stimme hallte dumpf in seinen Ohren wider, und Henry erhob sich abrupt. Kurz verschwamm die Welt vor seinen Augen, und eine Schweißperle rann über seinen Nacken. Erneut erfasste ihn Zorn und Unverständnis.
Er hörte schnatternde Stimmen und sah, wie zwei Sekretärinnen, die in der Manufaktur die Schreibarbeiten für seinen Vater erledigten, an ihm vorbeigingen.
Sie grüßten Henry höflich, aber er nickte nur stumm und schaute den jungen Frauen in ihren schwarzen Bleistiftröcken und den hellen Blusen nachdenklich hinterher.
»Was ist hier nur los?«, murmelte Henry verwirrt und nestelte in der Tasche seines Jacketts herum.
Er bekam den Autoschlüssel des alten blauen VW Käfers zu fassen, den ihm sein Vater geschenkt hatte, und ging mit langsamen Schritten auf den Wagen zu. Seine Hand zitterte leicht, als er den Schlüssel ins Schloss steckte.