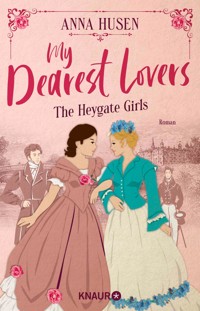
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Heygate Girls
- Sprache: Deutsch
Warum löst ihre Mitbewohnerin auf einmal Herzklopfen bei ihr aus? Der modern erzählte historische New-Adult-Liebesroman »My Dearest Lovers - The Heygate Girls« von Anna Husen verbindet Historical Romance mit New Adult. England, Southend-on-Sea, 1860. Für die unkonventionelle Deutsche Lucie Farber aus Lübeck, die von einem unabhängigen Leben träumt, bricht eine Welt zusammen: Ihre Eltern schicken sie auf das renommierte Heygate Internat für Mädchen. Dort soll sie sich nicht nur auf ihre Aufgaben als Lady vorbereiten – sie soll auch ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen, der bereits für sie von ihren Eltern ausgesucht wurde. Auf dem Internat angekommen, gerät Lucie mit ihrer Mitbewohnerin Amabel aneinander, die unbedingt den Wünschen ihrer Familie und ihres Verlobten gerecht werden möchte. Erst nach einem Sommerball in London gestehen die beiden Mädchen einander ihre Sorgen vor der Zukunft. Eine zarte Freundschaft entsteht, und Lucie fühlt sich zu ihr hingezogen, was sie verwirrt. Vor allem, als der attraktive Arthur um sie zu werben beginnt … Atmosphärisch und mit viel Gefühl: Zwei starke Frauen, die herausfinden müssen, was sie wirklich wollen »My Dearest Lovers« ist der Auftakt der süchtig machenden Academy-Dilogie »The Heygate Girls«. Diese Romance versprüht Bridgerton-Vibes und lässt die romantische Regency-Zeit lebendig werden. Diese beliebten Tropes kommen vor: - forced proximity - found family - death of a parent - rivals to lovers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anna Husen
My Dearest Lovers
The Heygate Girls
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Warum verursacht ihr plötzlich ihre Mitbewohnerin Herzklopfen?
England, 1860: Die unkonventionelle Lucie aus Lübeck wird von ihren Eltern auf das renommierte Heygate Internat für Mädchen geschickt. Dort soll sie sich auf ihre Aufgaben als Lady vorbereiten und Arthur kennenlernen, den Mann, der bereits für sie ausgesucht wurde. Schnell gerät Lucie mit ihrer Mitbewohnerin Amabel aneinander. Erst nach einem Sommerball in London gestehen die beiden Mädchen einander ihre Sorgen vor der Zukunft. Lucie fühlt sich zu Amabel hingezogen, was sie verwirrt. Vor allem, als der attraktive Arthur um sie zu werben beginnt.
»My Dearest Lovers« ist der Auftakt der süchtig machendenAcademy-Dilogie »The Heygate Girls«.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Danksagung
Für das Mädchen, welches immer dachte,
seine Träume seien nichts wert, und
das trotzdem niemals aufgegeben hat.
Ich würde dir gerne sagen, dass sich
alles lohnen wird. Jedes Scheitern,
jedes Verzweifeln. Jede Träne.
Denn schau, wo wir jetzt sind.
Kapitel 1
Lucie
Das Klirren der Gläser ließ meine Glieder vibrieren. Besteck kratzte auf Porzellan, und der Duft von frischem Brot erfüllte den aufgeheizten Salon. Die stickige Luft wurde zerrissen von einem hitzigen Gespräch zwischen meinem Vater und seinem Geschäftspartner über eine neue Handelsroute zwischen Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Mein Vater erzählte, dass der Weinhandel mit Frankreich gut lief, doch sein Gesprächspartner war der Ansicht, man würde sich durch diese vertiefenden Handelsbeziehungen schneller abhängig machen von den anderen Ländern, allen voran England, das durch den Export von Stahl und Eisen große Summen einnahm.
Ich versuchte, dem Gespräch zu lauschen, doch neben mir saß Hilde, meine beste Freundin aus Kindertagen, die mir mit ihrem Geplapper über ihren Verlobten Heinrich Arnolds ein Ohr abkaute.
»Er ist ein wahrer Gentleman! Er hat mir heute ein Blumenbouquet zukommen lassen mit einer Einladung zum Ball bei den Arnolds, auf dem er mich allen als seine zukünftige Ehefrau vorstellen wird! Kannst du dir das vorstellen, Lu? Ich werde in einer großen Villa in Travemünde leben, die feinsten Kleider tragen und bald selbst Gesellschaften geben!«
Und ein schweigender Schatten an seiner Seite sein, ein elegantes Ding, das er zur Schau stellen kann. Mit dem er vor seinen Freunden und Geschäftspartnern angeben kann, und dann wirst du Kinder gebären und alt und grau werden, ohne jemals etwas erlebt zu haben.
Diese Worte lagen mir auf der Zunge, verbrannten meine Kehle, und am liebsten hätte ich sie in die Welt hinausgeschrien, doch ich biss mir eilig auf die Unterlippe und zwang mich zu einem Lächeln. Ich hatte viel über die Frauenbewegungen gelesen, die sich seit einiger Zeit in den größeren Städten bildeten. Von den Frauen, die dafür kämpften, in der Ehe auch einen Beruf ergreifen zu können, eigenständig zu leben, ohne sich an einen Mann zu binden. Doch davon wollte Hilde nichts wissen.
Wir waren seit Kindertagen beste Freundinnen, wie Feuer und Wasser, doch nun … war es anders. Seit ihre Eltern ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, sprach Hilde von nichts anderem als von ihrem Verlobten. Davon, wie wunderbar es werden würde, wenn sie endlich verheiratet sei.
»Das klingt wirklich … schön«, entgegnete ich lahm und musste an mich halten, um das Gesicht nicht zu einer Grimasse zu verziehen, wobei ich ohnehin das Gefühl hatte, auf eine saure Zitrone gebissen zu haben.
Für mich klang eine Ehe einfach nicht so vielversprechend, sondern eher wie ein Gefängnis. Doch ich wollte Hilde nicht die Stimmung vermiesen oder ihre Vorfreude mindern.
»Schön?« Hilde zog eine ihrer fein gezupften Augenbrauen in die Höhe und musterte mich eingehend. »Es ist wunderbar, Lu! Ich werde bald meinem Elternhaus entfliehen und einen eigenen Haushalt führen. Endlich kein Ausgehverbot mehr am Abend und all die Freiheit, die ich mir gewünscht habe.«
»Freiheit? Das nennst du Freiheit?«, rutschte es mir nun doch heraus, und meine Stimme stolperte beinahe. Ein Zittern erschütterte meinen Körper, und mein Magen rumorte. In mir schien eine ungezügelte Wut zu blubbern, die mir sehr bekannt vorkam.
»Wie bitte?« Hilde sah mich verständnislos an und stellte ihr Weinglas etwas zu heftig wieder auf dem Tisch ab, sodass die kostbare rote Flüssigkeit auf das gestärkte Tischtuch schwappte. »Was meinst du damit, Lu?«
Verdammt, dass du auch niemals deine Klappe halten kannst, tadelte ich mich selbst und versuchte mich an einem entschuldigenden Blick, während meine Handinnenflächen feucht wurden.
»Gar nichts, Hilde«, begann ich zögernd und legte ihr eine Hand auf den Arm. »Du wirst eine wunderbare Ehe haben und eine großartige Mutter werden, aber für mich ist das nichts.« Ich versuchte, den Worten die Schärfe zu nehmen, und lächelte sie an.
Ich sah Hilde an der Nasenspitze an, dass sie mir kein Wort glaubte. Ihre Wangen waren gerötet, und sie schob sich mit einer fahrigen Bewegung eine braune Haarsträhne hinters Ohr. Gott, sie kannte mich leider zu gut, um mir diese Worte abzunehmen, und Zorn brodelte erneut in meinem Inneren auf, denn ich wusste beim besten Willen nicht, wie ich mich aus dieser Situation wieder herausmanövrieren konnte.
»Denkst du etwa, du verdienst etwas Besseres als eine Ehe mit einem guten Mann?«, zischte mir Hilde ungewöhnlich heftig zu und verschränkte die Arme vor der Brust.
Ja, dachte ich, sprach es aber nicht aus, sondern senkte den Kopf in der Hoffnung, dass Hilde es auf sich beruhen lassen und meine Worte nur als Trotzreaktion betrachten würde, denn sie heiratete bald und ich eben nicht.
Stattdessen sah ich auf das Foto herab, das ich immer sorgsam in meinem Retikül aufbewahrte. Die Ränder des Papiers waren ausgefranst, das Bildnis beinahe verblasst, aber es war mein Beweggrund, niemals zu heiraten.
Es zeigte meine Mutter und meinen Vater am Tage ihrer Hochzeit. Glücklich und zufrieden standen sie eng umschlungen vor der Kirche, und meine Mama schien mit der Sonne um die Wette zu lächeln. Sie sah wunderschön aus, die weizenblonden Haare waren zu einem Zopf geflochten, und ihre grünen Augen schienen zu strahlen, als wäre sie der glücklichste Mensch der Welt.
Tränen brannten hinter meinen Lidern, und ich biss mir auf die Unterlippe. Langsam hob ich wieder den Blick, versuchte, mich auf das Dinner zu konzentrieren, und schaute in das Gesicht meiner Mutter, so, wie es jetzt war.
Da war nichts mehr von diesem Lächeln, diesem Strahlen, das die ganze Welt hätte blenden können. Nein, mir gegenüber saß eine in sich zusammengesunkene Frau, die in ihrer Suppe löffelte und sich bewegte wie eine kaputte Maschine. Ihre Haut war zerknittert, weiß wie Papier. Schatten flirrten unten ihren Augen, und die weizenblonden Haare waren nun stumpf und glanzlos. Ein raues Husten entrann ihrer Kehle, und ihr ganzer Körper wurde von einem Zittern erschüttert.
»Liebling?«, fragte mein Vater besorgt.
Er legte eine Hand auf Mutters Rücken, und ich musste den Blick abwenden, konnte nicht hinsehen, weil mich alles daran zerbrechen ließ. Mein Herz in immer kleinere Fetzen zerriss, bis nichts mehr von mir übrig war. Diese vermaledeite Tuberkulose fraß meine Mutter von innen heraus auf, und es bekümmerte mich, dass sie all ihr Strahlen durch diese Krankheit eingebüßt hatte.
Zudem schien sie in der Ehe mit meinem Vater all ihren Antrieb verloren zu haben. Ich erinnerte mich noch daran, wie meine Mutter in meiner Kindheit war. So voller Tatendrang und Elan. Sie hatte ihn sogar auf Handelsreisen begleitet, doch ich hatte leider nie mitgedurft. Meine Eltern hatten mich oft allein gelassen. Dafür zürnte ich meinem Vater, denn er war mir fremd. Behandelte mich eher wie Luft, wie ein unwissendes Mädchen.
Und dann war meine Mutter irgendwann plötzlich krank geworden, ihre Lunge war schwach, und sie wurde von Tag zu Tag erschöpfter. Ich wusste nicht, ob sie sich auf einer dieser Reisen angesteckt hatte, aber ich vermutete es.
Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass diese Reisen mir meine Mutter geraubt hatten. Und danach hatte sie kaum mehr Zeit für mich gehabt wegen der Krankheit, die sie so erschöpfte.
Ich glaubte, dass sie in dieser Ehe unglücklich war, und so unglücklich wollte ich nicht werden. Auf keinen Fall wollte ich mein eigenes Strahlen verlieren und das bloße Anhängsel eines Mannes werden.
»Willst du ihr nicht helfen?«, flüsterte Hilde mir zu, und ich zuckte zusammen.
Es war totenstill am Tisch geworden, alle Gespräche waren versiegt, kein Geschirr klapperte mehr, und die Luft fühlte sich zäh wie Marmelade an. Ich wollte schon aufstehen, doch da ebbte das grässliche Husten ab, und meine Mutter erhob die Hand.
»Setz dich … wieder … Liebes«, krächzte sie und hielt sich ein Tuch vor den Mund.
Ich konnte das Blut sehen, das an ihren Mundwinkeln klebte. Ohnmacht und Wut vermischten sich in meinem Inneren zu einer gefährlichen Masse, die zu explodieren drohte. Ich wollte hier nicht sein, ich wollte keine gehobene Konversation führen, und vor allem wollte ich nicht, dass Mama sich für solche Abende aus ihrem Bett quälte. Nur um neben meinem Vater eine gute Figur zu machen, um das Bild einer sittsamen Ehefrau aufrechtzuerhalten.
»Aber …«, begann ich unsicher, ich erinnerte mich daran, dass Mama mir heute vor dem Essen etwas hatte sagen wollen, doch dann waren wir unterbrochen worden, weil Hilde früher als verabredet in unserem Haus erschienen war. So gerne würde ich meine Mama in ihr Schlafzimmer begleiten, sie fragen, was sie mir hatte erzählen wollen, und einen ruhigen Abend mit ihr verbringen.
Doch mit einem Tisch voller Gäste war das nicht mehr als ein Wunschtraum.
Herr Rahms, der Geschäftspartner meines Vaters, und seine Frau Regina. Hildes Eltern, Berthold und Sieglinde, die ein großes Stadthaus außerhalb von Lübeck besaßen. Hildes Vater war in der Politik der Stadt tätig, er war ein einflussreicher Mann mit verkniffenem Gesichtsausdruck, der nun genüsslich seinen Wein trank und so tat, als würde er von dem ganzen Dilemma nichts mitbekommen.
»Es ist alles in Ordnung, mein Engel«, wisperte meine Mutter und setzte sich wieder aufrecht hin. Sie zwang sich zu einem Lächeln, das jedoch ihre Augen nicht erreichte, und erneut machte mein Herz einen unangenehmen Stolperer, und mein Magen zog sich zusammen.
Ich wünschte, meine Mutter hätte meinen Vater niemals geheiratet. Ich wünschte, sie hätte ihr Lächeln behalten, diese Freiheit, von der sie immer sprach, die jedoch nur in ihrer Vergangenheit existiert hatte. Ich konnte mich noch an wenige glückliche Augenblicke in meiner Kindheit mit meiner Mutter erinnern, in denen sie gelacht hatte.
Doch irgendwann war sie mir fremd geworden, weil sie so selten zu Hause gewesen war. Als dann ihre Krankheit immer heftiger geworden war, hatte sie ihr Lächeln komplett verloren.
»Nun …« Mein Vater räusperte sich und setzte sich ebenfalls wieder auf seinen Stuhl. »Dann sollten wir vielleicht jetzt die frohe Kunde verlauten lassen, oder nicht, mein Liebling?«
Er schenkte meiner Mutter ein hinreißendes Lächeln, doch all das war nichts weiter als eine Scharade, ein bloßes Theaterspiel für unsere Gäste. Meiner Mutter würde es besser gehen, wenn sie sich ausruhen könnte und nicht hier sitzen müsste. Doch so einfach waren die Umstände leider nicht.
Obwohl ich glaubte, dass Mama nicht glücklich war, schien mein Vater sie doch zu lieben. Seine dunkelblauen Augen glänzten vor Zuneigung, kleine Lachfältchen zierten seine Haut, und er strich sanft mit dem Daumen über Mutters Hand. Die Ehe war ein wirklich kompliziertes Ding.
»Welche frohe Kunde, Herr Farber?«, fragte Hilde neugierig und schien unseren kleinen Zwist schon wieder vergessen zu haben.
»Nun …«, Papa hob sein Glas und prostete mir zu, »unsere liebe Lucie wird in England ein Mädcheninternat besuchen, genau dasselbe, an dem ihre Mutter war und dort ihren zukünftigen Mann – mich – kennenlernte und ehelichte.«
»Wie bitte?«, würgte ich hervor, und meine Hände fingen an zu zittern, das Weinglas entglitt mir und zerbrach auf dem Tisch, die Flüssigkeit sickerte in die gestärkte Tischdecke.
»Oh, wie wundervoll!«, säuselte Hilde neben mir und warf mir einen koketten Blick zu. Sie schien sich wirklich für mich zu freuen, dass ich heiraten würde, obwohl Übelkeit meine Kehle emporstieg und sich die Welt vor meinen Augen drehte. Doch gleichzeitig konnte ich Hildes Freude verstehen. Wir waren unser ganzes Leben lang dazu erzogen worden, eine Ehe mit einem guten Mann anzustreben. Ihre Freude war ehrlich, und ich wollte ihr nicht zürnen, weil sie mich nicht verstand, denn wir waren immer noch Freundinnen.
Ich hab’s dir doch gesagt, dass du auch irgendwann heiraten wirst. Du hast sowieso keine Wahl, wisperte eine gehässige Stimme in meinem Kopf.
»Ja, oder nicht?« Vater schien gar nicht zu bemerken, dass alles in mir aufschrie, dass ich brodelte wie ein Vulkan und mich kaum noch etwas an diesem Tisch, in diesem Haus halten konnte.
Das kann er nicht ernst meinen. Er kann mich nicht einfach so fortschicken, er kann …
Doch, er kann.
Diese Gewissheit wurde mir plötzlich bewusst, als hätte jemand eine Faust in meinen Magen geschlagen, ich keuchte erschrocken auf und zerknitterte die Fotografie meiner Eltern.
»Das ist wirklich eine wunderbare Neuigkeit«, stimmte Herr Rahms zu. »Wir haben unsere jüngste Tochter auch nach England geschickt, dort ist die Bildung für junge Damen exquisit, und zudem lernen sie auch noch alles Wertvolle, um in die höhere Gesellschaft aufgenommen zu werden.«
»Daran ist gar nichts wundervoll«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und erhob mich. Ich stieß mit dem Knie gegen die Tischplatte, doch der Schmerz war nichts im Vergleich zu der Enttäuschung, die sich in meinem Herzen einnistete und mich in Finsternis ertrinken ließ.
»Was hast du gerade gesagt?«, fragte mein Vater und bemühte sich um einen strengen Tonfall. Er zog die schwarzen Augenbrauen zusammen und neigte den Kopf zur Seite. »Du solltest dich freuen, mein Kind, denn das ist eine einzigartige Möglichkeit. Außerdem wirst du den jungen Mann, den du ehelichen wirst, bestimmt …«
»Ich werde niemanden heiraten!«, platzte es aus mir heraus, und ich schüttelte heftig den Kopf. »Ich werde nicht nach England fahren, um mich von euch verschachern zu lassen wie ein Pferd!«
Totenstille senkte sich über den Salon. Man hätte eine Stecknadel fallen lassen können, und es wäre das lauteste Geräusch der Welt gewesen. Mein Herzschlag pochte dröhnend in meinen Ohren, und es war, als würde es mir den Brustkorb herausreißen. Ich biss mir auf die Unterlippe, schmeckte Blut auf meiner Zunge und konnte nur wie in Trance den Kopf schütteln.
»Lucie …« Es war die Stimme meiner Mutter, die die Stille durchschnitt wie eine Schere einen Faden.
Ich konnte sie nicht ansehen, nein, ich wollte nicht in ihr Gesicht blicken. Dieser Ausdruck von Trauer machte mich schwach, er machte mich verletzlich, und in diesem Augenblick wollte ich kein Herz mehr besitzen.
»Bitte … sieh mich an, mein größter Schatz …«
Ich drehte den Kopf zu ihr, auch wenn ich es nicht wollte. Mein Körper gehorchte mir nicht mehr. Alles fühlte sich taub an, meine Kehle zog sich zusammen, und wenn es einen Moment in meinem Leben gab, in dem ich am liebsten im Erdboden versunken wäre, dann war es dieser.
»Was?«, fragte ich mit zittriger Stimme. »Warum willst du mich fortschicken? Gerade jetzt, wo deine Krankheit jeden Tag schlimmer wird!«
Es war nicht gerecht, ihr diese Dinge an den Kopf zu werfen. Das wusste ich, doch ich konnte nicht anders. Mein Mund sprach, bevor mein Kopf denken konnte.
»Aber genau deswegen will ich doch, dass du nach Southend-on-Sea gehst und dort die Heygate Boarding School for Girls besuchst. Ich habe dort die beste Zeit meines Lebens verbracht und Freundinnen gefunden, die selbst jetzt noch immer alles für mich tun würden. Du wirst deinen zukünftigen Ehemann kennenlernen und dort eine wunderbare Zeit haben. Es ist mein letzter Wunsch für dich, ehe ich …« Sie ließ den Satz auströpfeln, sprach nicht weiter, und das musste sie auch nicht.
Ehe ich sterbe.
Das hatte sie sagen wollen. Dass dies vielleicht das letzte Mal war, dass wir Zeit zusammen verbrachten, bevor meine Eltern mich fortschickten.
»Lucie, es ist der Wunsch deiner Mutter, deswegen …«
»Nein!«, unterbrach ich meinen Vater und erschrak selbst über die Schärfe in meiner Stimme.
Normalerweise konnte ich mich gut kontrollieren, diese brodelnde Wut über die Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft im Zaum halten. Ich war in der Lage, eine angepasste Frau zu sein, so wie die Welt es sich von mir wünschte. Aber nicht in diesem Moment, vielleicht sogar niemals wieder.
»Ich werde nicht dorthin gehen. Ich lasse mich nicht von euch fortschicken und mit irgendeinem Mann verheiraten«, schrie ich wutentbrannt und rannte aus dem Salon hinaus.
Ich hörte noch die Rufe meines Vaters, seine aufgebrachte Stimme kam beinahe ins Stolpern, doch ich ignorierte all das. Im Flur stieß ich mit unserem Dienstmädchen Mimi zusammen, das eine große Platte mit Süßspeisen in den Händen trug, die nun mit einem ohrenbetäubenden Knall zu Boden fiel.
»Fräulein Lucie!«, rief Mimi schockiert. »Was ist denn los? Ist Ihnen nicht wohl?«
»Ich … ich …«, stammelte ich wirr und bückte mich, um die Scherben aufzuheben, doch Mimi hielt meinen Arm fest und schüttelte sanft den Kopf.
»Sie sind ja so aufgewühlt, Fräulein Lucie, lassen Sie das. Sie werden sich noch an den Scherben schneiden. Ich mache das schon …« Sie deutete die Treppe hinauf, schien ganz genau zu wissen, weshalb ich aus dem Salon geflohen war.
»Aber ich kann dir doch helfen, ich habe doch …«
»Es ist schon in Ordnung, Fräulein Lucie. Gehen Sie nur«, forderte Mimi mich nochmals auf, und ich nickte unter Tränen, dankbar, dass sie mich auch ohne weitere Worte verstand.
Ich rannte nach oben in mein Zimmer, knallte die Tür hinter mir zu und rutschte daran hinunter.
Ich werde niemals heiraten, dachte ich entschlossen und ballte die Hände zu Fäusten. Niemals im Leben, und wenn ich dafür meinem Zuhause den Rücken kehren muss.
Kapitel 2
Lucie
Ich wusste nicht, wie lange ich in der Dunkelheit meines Zimmers auf der gepolsterten Fensterbank gesessen und in die Nacht hinausgestarrt hatte. Auf die glitzernden Lichter Lübecks und das reißende Wasser der Trave, welches ich von hier aus sehen konnte. Die Umrisse des imposanten Holstentors schimmerten in der Nacht, und ein Vogel flog vorbei. Ich hatte nur gehört, wie mein Vater im Flur unsere Gäste verabschiedet hatte und das dumpfe Knallen der Haustür, aber ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren.
Erneut stiegen Tränen in meine Augen, als ich daran dachte, dass ich nach England gehen müsste, daran, dass meine Eltern mich verheiraten wollten und ich meine Familie verlassen würde. Dass nichts mehr so war wie bisher. Plötzlich klopfte es an meiner Tür, und ich zuckte erschrocken zusammen.
Ich wollte nicht öffnen, wollte mit niemandem sprechen. Doch als es erneut klopfte, erhob ich mich und tapste über den weichen Teppich zur Tür und öffnete diese. Nur um im nächsten Augenblick wieder zurückzuschrecken.
»Mutter …«
Da stand sie. Mir gegenüber, mit einem winzigen Lächeln auf den Lippen. Die weizenblonden Haare zu einem dicken Zopf gebunden, der über ihrer Schulter hing. Sie hatte sich umgezogen, trug nun ein dunkelblaues Hauskleid ohne jegliche Finesse oder Verzierungen, das um ihren viel zu dünnen Körper schlackerte wie ein Sack.
»Darf ich hineinkommen?«, fragte sie, und ihre Stimme war nur ein Hauch, ihre Worte kaum zu hören.
»Na… natürlich …«, stammelte ich überrumpelt und machte ihr Platz. Dass Mutter hier war und nicht Vater, um mich auszuschimpfen, bedeutete, dass sie versuchte, die Wogen zu glätten. Dass sie mich in Schutz nahm für mein unflätiges Benehmen. Denn Vater war mit Sicherheit fuchsteufelswild und hätte mich am liebsten gleich zur Rede gestellt.
Sie ging zu der gepolsterten Fensterbank und setzte sich darauf. Unschlüssig schloss ich die Tür wieder, wusste aber nicht, ob ich mich überwinden konnte, zu ihr zu kommen.
Ich war so wütend auf sie. Und doch liebte ich sie über alles und wollte ihr keinen Kummer bereiten. Die Tuberkulose zerrte an ihr, schien alle Lebenskraft aus ihr zu saugen.
»Magst du dich zu mir setzen?«, fragte sie vorsichtig, geradeso, als ob sie zu wissen schien, dass die Antwort »Nein« lauten könnte.
Ich nickte schweigend und ließ mich ebenfalls auf die Fensterbank nieder. Starrte durch die Scheibe hindurch, an deren Ecken sich kleine Eiskristalle gebildet hatten. Es hatte zu schneien begonnen, und eine winzige Schicht von weißem Pulverschnee lag auf den Straßen, glitzerte im blassen Licht der Straßenlaternen, und urplötzlich fröstelte es mich.
»Du zürnst mir, oder?«
Ja, wollte ich schreien, blieb aber dennoch stumm. Wie so viele Male in meinem Leben. Wie so oft, wenn ich eigentlich in Tränen ausbrechen und alles verfluchen wollte.
»Ich …«, setzte ich an, zuckte dann aber doch nur schweigend mit den Schultern. Was hätte ich auch sagen sollen? Diese Angelegenheit war schon entschieden worden, lange bevor ich etwas daran hätte ändern können.
Ich musste gehorchen oder weglaufen, aber was wäre das für ein Leben? Ich konnte nichts, ich war nichts, niemand mit gesundem Menschenverstand würde mich für irgendeine Tätigkeit einstellen.
»Das ist in Ordnung«, sprach meine Mutter weiter und legte mir ihre eiskalte Hand aufs Bein.
Wie ein Kuss des Winters kribbelte die Kälte auf meiner nackten Haut. Ob überhaupt noch Wärme in ihr existierte?
»Ich verstehe einfach nicht, warum ich nicht hierbleiben darf«, brach es nun doch aus mir heraus, und ich schniefte in den Ärmel meines Nachtkleides – ziemlich undamenhaft, aber nun war alles einerlei.
»Wir wollen dich damit nicht bestrafen, mein Engel. Es soll ein Geschenk sein.«
»Geschenke mag man für gewöhnlich, aber ich mag dieses überhaupt nicht«, antwortete ich trotzig.
»Du wirst lernen, es zu mögen«, erwiderte meine Mutter zaghaft. »Und du wirst auch deinen zukünftigen Ehemann mögen, vertrau mir. Ich würde dich doch mit keinem Mann verbinden, der nicht gut für dich ist.«
Dass es keinen Mann gab, der jemals gut für mich sein würde, sagte ich lieber nicht. Denn alle Männer taten das Gleiche: Sie unterdrückten ihre Ehefrauen, nahmen ihnen jede Entscheidung ab, und sie mussten gehorchen und Kinder bekommen, damit es Erben gab. Ich hatte Vater und Mutter nie laut streiten hören, aber ich glaubte zu wissen, dass Vater genauso war. Sonst hätte Mutter heute nicht wieder am Tisch mit uns sitzen müssen, obwohl es ihr deutlich schlechter ging.
»Glaubst du mir etwa nicht?«, bohrte meine Mutter weiter, und ich fragte mich nicht zum ersten Mal, ob dies das Antlitz der Frau war, die sie früher einmal gewesen sein musste. Die starke Elizabeth Norton, die auf den Fotografien aus ihrer Kindheit wild und unberechenbar aussah. Mit den unzähmbaren Locken, die wie die Sonne glänzten und die ich von ihr geerbt hatte.
»Ich will dir glauben, Mama.« Meine Worte zitterten, und ich musste an mich halten, um nicht Hals über Kopf das Zimmer zu verlassen. Ich wollte mich dieser Situation entziehen und gleichzeitig all meine brodelnden Gefühle laut in die Welt hinausschreien.
»Aber du tust es nicht«, stellte meine Mutter mit einem sanften Lächeln fest. »Das kann ich verstehen. Die Heygate Boarding School ist ein renommiertes Internat, ich bin mir sicher, dass du dich dort wohlfühlen wirst und neue …«
»Ich will aber nicht dorthin!«, würgte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und erhob mich.
Meine Glieder kribbelten, und ich konnte nicht länger still sitzen, lief im Raum auf und ab wie ein wild gewordenes Tier. Meine Schritte hallten an den Wänden des Zimmers wider, und aus den Augenwinkeln sah ich, wie meine Mutter mich beobachtete. Sie wirkte fast schon amüsiert.
»Was ist?«, fragte ich aufgebracht. »Machst du dich über mich lustig?«
So redet man nicht mit seiner Mutter, murrte eine Stimme in meinem Kopf, und ich versuchte, mich an meine Erziehung zu erinnern. Doch all die Stunden in gutem Benehmen schienen wie weggeblasen, alles ergab keinen Sinn mehr. Es war, als würde mein Leben wie Sand zwischen meinen Fingern zerrinnen.
»Lucie …« Mutter fuhr sich durch ihr Haar und lehnte sich gegen die Fensterscheibe. »Du warst immer schon ein stürmisches Kind, das sich schwer im Zaum halten konnte. Und dann wiederum warst du oft sehr ruhig und in dich gekehrt. Als würden sich ständig zwei Seiten in dir nicht einigen können.«
Ich schnaubte und verschränkte die Arme vor der Brust. Doch so ungerne ich es zugeben wollte, meine Mutter hatte recht, wie so oft.
»Was willst du damit sagen?«, fragte ich und ließ mich auf mein Bett nieder, das leise quietschte.
»Dass du Zeit brauchst, um diese neue Situation zu verarbeiten, und deswegen wirst du auch nicht allein nach Southend reisen.«
Ich legte die Stirn in Falten und neigte den Kopf fragend zur Seite. Für eine winzige Sekunde keimte Hoffnung in mir auf, doch als ein Husten den schlanken Körper meiner Mutter erschütterte, zerbrach dieses Gefühl wie eine auf dem Boden zerschellte Vase.
»Wer wird mich begleiten?«, fragte ich misstrauisch, auch wenn sich die Antwort schon in meinem Kopf zu formen schien.
»Ava wird mitkommen«, erwiderte meine Mutter, und ich musste ein Stöhnen unterdrücken.
Nicht meine Schwester, dachte ich genervt und ließ mich rittlings aufs Bett fallen, drehte mich um und vergrub das Gesicht in den Kissen. Ava lebte in Hamburg mit ihrem Ehemann und den Kindern, und nun würde sie hierherkommen und mich in dieses vermaledeite Internat begleiten.
»Warum Ava?«, nuschelte ich und lauschte auf die Schritte meiner Mutter, die näher kamen.
Das Bett quietschte erneut, und dann strich ihre Hand über meinen Rücken. »Ich kann dich leider nicht begleiten, und dein Vater hat wichtige Geschäfte zu erledigen. Aber Ava kann dir gute Ratschläge erteilen, sie wird dich auch auf die Zeit im Internat vorbereiten und auf deine Hochzeit …«
»Ich verstehe …«, erwiderte ich und erhob mich, sah meine Mutter eingehend an und zog sie dann in meine Arme. »Ach, Mama …«, wisperte ich mit tränenerstickter Stimme. »Ich fürchte mich ganz schrecklich.«
Es war, als hätten diese Worte lange in mir gebrodelt, denn es fühlte sich an, als würde eine schwere Last von mir abfallen. Jetzt, da ich das erste Mal ehrlich zu mir selbst war.
»Das weiß ich doch«, wisperte meine Mutter mir ins Ohr, und als sie sich von mir löste, strich sie mir über die Wange und lächelte dieses eine Lächeln, das sie mir als kleines Mädchen immer schon geschenkt hatte. »Aber genau deswegen musst du gehen, mein Engel. Weil die Dinge, vor denen du dich fürchtest, genau die sind, die du tun musst. Wenn du Angst vor etwas hast, ist es der richtige Weg. Meinst du, du kannst mir in dieser Hinsicht vertrauen?«
Die Worte ergaben keinen rechten Sinn in meinen Ohren, aber ich nickte trotzdem. Vielleicht, weil ich meiner Mutter immer vertraut hatte. Weil sie diejenige war, die meinen Wissensdurst angefacht und die nicht mit mir geschimpft hatte, wenn ich mit einem schmutzigen Kleid nach Hause kam oder sie mit tausend Fragen über die Welt löcherte. Und weil sie diejenige war, die ich glücklich sehen wollte.
»Ich vertraue dir, aber ich habe Angst, dass es bei unserem Abschied das letzte Mal sein wird, dass ich dich sehe …«, murmelte ich und zog meine Mutter erneut in meine Arme, sog ihren Duft nach frisch gewachsener Wäsche und Rosen tief in meine Nase ein.
»Das ist mir bewusst, mein Schatz«, erwiderte meine Mutter dicht an meinem Ohr. »Und ich kann dir nicht versprechen, dass dies nicht so sein wird. Doch es ist mein letzter Wunsch, dass du meine Heimat kennenlernst. Dass du diesen Weg gehst und dich auch von deinem Vater und mir löst. Ich möchte nicht, dass du ständig nur an mich denkst, sondern dein eigenes Leben lebst. Ich will dir damit ein wenig die Last nehmen, die du auf deinen Schultern trägst. Verstehst du mich?«
Ich hatte ihren Worten gelauscht und glaubte mit einem Mal, etwas mehr zu verstehen.
Es bedeutete meiner Mutter die Welt, dass ich ihre Heimat kennenlernen würde, auf dem Weg ihrer Vergangenheit und in ihren Fußstapfen wandern würde. Ich würde dieses Internat für sie besuchen, nicht für mich. Und obwohl daran nichts richtig war, obwohl diese Tatsache all meinen Wünschen widersprach, würde ich es tun.
Ihr letzter Wunsch.
Weil ich meine Mama wenigstens noch einmal glücklich sehen wollte.
»Warum musstet ihr es beim Dinner schon allen erzählen?«, wagte ich zu fragen, und meine Mutter löste sich kurz von mir, stupste mir auf die Nase.
»Ich wollte vorher mit dir sprechen, aber Hilde kam zu früh. Und du kennst doch deinen Vater, er hängt immer alles gerne an die große Glocke.« Sie verdrehte die Augen. »Ich wollte es dir ganz in Ruhe sagen, aber manchmal lässt sich dieser Sturkopf nicht überzeugen. Wir wollen dir wirklich nichts Böses. Morgen früh möchte dein Vater noch mal mit dir sprechen, aber nun gehst du schlafen und freundest dich mit diesem Gedanken an, in Ordnung, mein Engel?«
Ich nickte schluchzend, sie zog mich wieder in ihre Arme, und wir verweilten in dieser Umarmung voller Tränen und sanfter Worte, die mich jedoch nicht zu beruhigen vermochten, denn eine eisige Stimme in mir sprach:
Damit ist das Problem mit diesem zukünftigen Ehemann aber noch nicht geklärt.
Der nächste Morgen kam viel zu schnell, und ich ließ mir von Mimi das Frühstück aufs Zimmer bringen, um die Konfrontation mit meinem Vater noch ein wenig vor mir herzuschieben, aber schließlich stand ich vor der Tür seines Büros und klopfte mit zittrigen Händen an.
»Herein!«, erschallte die raue Stimme meines Vaters aus dem Zimmer, und mit klopfendem Herzen trat ich ein.
Die Tür gab einen protestierenden Laut von sich, und ich schloss sie sorgsam hinter mir, verschränkte meine Finger hinter dem Rücken und senkte brav den Kopf.
»Du wolltest mich sprechen?«
Es roch nach Zigarren im Zimmer, der kalte Rauch wirbelte durch die Luft, und meine Nase fing an zu jucken. Ich verabscheute diesen Gestank, der sich mit dem herben Geruch des sündhaft teuren Alkohols vermischte, der auf Papas Schreibtisch stand.
»Ja, bitte setz dich, Lucie.«
Ich tat, wie mir geheißen, und während mein Vater noch auf einem Dokument herumkritzelte, sah ich mich in seinem Arbeitszimmer um. Riesige Regale zierten die Wände links und rechts von uns, die vollgestopft waren mit Büchern zu allerlei Themen. Ich hatte mich als Kind hin und wieder hier hineingeschlichen und alles erkundet, doch als Papa mich einmal erwischt hatte, sagte er nur: »Diese Bücher sind nichts für Mädchen, als Frau brauchst du solche Dinge nicht zu wissen.«
Als Kind hatte ich nicht verstanden, warum er das zu mir gesagt hatte. Warum ich nicht wissen sollte, wie der menschliche Körper funktionierte oder wie Häuser gebaut wurden. Doch nun, wie ich hier vor ihm saß, war es mir natürlich klar.
Eine Frau sollte solche Dinge nicht wissen, uns wurde eingeredet, dass unsere Gehirne ohnehin viel zu klein waren, um all diese komplizierten gesellschaftlichen Themen zu verstehen. Dabei war das kompletter Unsinn, denn es gab sehr wohl Frauen, die den Männern bewiesen, dass sie genauso klug waren wie sie. In anderen Ländern der Welt würden Frauen sogar bald studieren dürfen, doch hier nicht. Und ich sowieso nicht.
Deswegen hatte mich Papa wohl auch nie auf die Reisen mit meiner Mutter mitgenommen. Weil ich unwissend bleiben sollte. Ein Mädchen, das heiraten und eine gute Ehefrau sein sollte. Ich zürnte Papa, dass er mir Mama so lange Zeit in meiner Kindheit entrissen hatte. Und tief in meinem Inneren glaubte ich auch, dass sie sich auf den Reisen mit Tuberkulose angesteckt hatte. Auch wenn das vermutlich überall hätte geschehen können – aber ein Teil von mir wollte meinem Vater die Schuld geben, so ließ es sich einfacher leben, der Schmerz eher ertragen.
»Nun …« Papa legte den Füllfederhalter zur Seite und verschränkte die Hände auf dem Tisch ineinander. »Deine Mutter hat gestern schon mit dir gesprochen, und ich bin froh, dass du zur Besinnung gekommen bist.«
»Zur Besinnung«, rutschte es mir heraus. Vater zog eine Augenbraue hoch und betrachtete mich eingehend, doch er schimpfte mich nicht aus, was ungewöhnlich war.
»Jedenfalls …«, sprach er nach einiger Zeit des Schweigens weiter, »bin ich froh, dass du nun ohne Widerstand nach Southend reisen wirst. Denn es ist das Beste für dich.«
Ich biss mir auf die Unterlippe, damit kein freches Wort über meine Lippen kam. Ich wollte nicht mehr streiten, dafür fehlte mir die Kraft.
»Ava wird in einigen Tagen kommen und mit dir noch ein paar Besorgungen erledigen, bevor ihr nach Hamburg reisen und dort ein Dampfschiff nach London nehmen werdet.«
Ich nickte schweigend. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich war die zweite Tochter der Familie, und man wollte mich ebenso gewinnbringend verheiraten wie meine Schwester. Sie hatte einen reichen Kaufmann aus Hamburg geehelicht und lebte nun in einer wunderschönen Villa an der Alster, hatte schon zwei Kinder und war die geborene Ehefrau.
»Beim Sommerball in London wirst du deinen zukünftigen Ehemann kennenlernen, und ich bin mir sicher, dass ihr euch wohlgesinnt sein werdet.«
»Das kannst du nicht wissen, Vater«, würgte ich hervor, weil ich das Gefühl hatte, wenigstens irgendetwas sagen zu müssen, um mich doch noch gegen diese Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen.
»Denkst du denn, wir suchen dir irgendeinen Mann aus, der nicht unseren Ansprüchen genügen wird?«, fragte Vater mit ungewöhnlicher Schärfe in der Stimme, sodass ich zusammenzuckte.
»Das meine ich nicht …«, setzte ich an und räusperte mich. Unruhig rutschte ich auf dem Stuhl hin und her. »Es geht doch nicht nur um die Ansprüche, die dieser Mann erfüllen wird. Ich kenne ihn gar nicht, woher soll ich wissen, ob ich ihn jemals lieben kann?«
Woher soll ich überhaupt wissen, was Liebe ist, wenn niemand mit mir je darüber redet, was dieses große Wort bedeutet?
Diese Fragen sprach ich nicht aus, denn an Vaters Gesichtsausdruck bemerkte ich, dass selbst meine Worte davor zu viel gewesen waren. Spott funkelte in seinen blauen Augen, und er verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
»Liebe?« Seine Stimme klang beinahe höhnisch in meinen Ohren, und Wut köchelte in meinem Inneren. »Lucie, Liebe entwickelt sich mit der Zeit, es ist nichts, was sofort da ist. Außerdem …«
»Außerdem muss ich den jungen Mann auch nicht lieben?«, unterbrach ich ihn und erhob mich. »Weil ich sowieso nur die vorzeigbare Frau an seiner Seite sein soll? Seine Kinder gebären und ansonsten unsichtbar in seinem Schatten stehen soll?«
»Lucie!« Die Faust meines Vaters donnerte auf den Tisch, und ich kniff die Augen zusammen, wich einige Schritte zurück und legte eine Hand auf meine Brust, mein Herz schlug wie wild.
»Bitte entschuldige …«, murmelte ich und versuchte mich an einem winzigen Lächeln, das jedoch von meinen Lippen zu tropfen schien.
»Genau das meine ich, wenn ich sage, dass es dir guttun wird, nach Southend zu gehen. Dort wirst du zur Besinnung kommen und lernen, was sich für eine junge Frau gehört. Obwohl ich dachte, dass wir dich gut erzogen haben.«
»Das habt ihr auch …«, setzte ich an und zuckte mit den Schultern. Doch ich bin einfach nicht so, wie ihr mich haben wollt. Ich bin ein Mädchen voller Gegensätze.
»Nun …« Vater schüttelte matt den Kopf, zog sein Jackett glatt und ging um den Tisch herum zu mir. »Anscheinend haben wir uns nicht genug Mühe gegeben.«
Er legte mir eine Hand auf die Schulter, und ich schaute zu ihm hoch, bemühte mich, eine stolze Haltung zu bewahren und nicht zu zeigen, wie sehr mich diese Entscheidung meiner Eltern ins Gefühlschaos stürzte.
»Ich verstehe einfach nicht, wie ihr mich an jemanden verheiraten wollt, den ihr selbst nicht mal kennt.«
»Oh, ich habe mit deinem Zukünftigen korrespondiert, er scheint ein gescheiter und ehrbarer Mann zu sein«, erwiderte Vater und strich mir über die Wange. »Sei nett zu ihm, und benimm dich im Internat, du wirst schon sehen, dass alles gut wird.«
Ich werde ihn zum Teufel jagen, dachte ich grimmig, nickte aber folgsam.
»Nun denn …« Vater drehte sich schwungvoll um und klatschte in die Hände. »Ich habe dir bereits alle Informationen zur Heygate Boarding School for Girls herausgesucht, schau sie dir an. Und poliere dein Englisch in den nächsten Wochen ein wenig auf, das wäre alles.«
Er reichte mir einen dicken Ordner mit einem Stapel Papieren darin und machte eine abschließende Geste, doch ich bewegte mich nicht vom Fleck.
»Ich will auch mit ihm korrespondieren.«
Wer hatte das gesagt?, fragte ich mich im gleichen Augenblick, als diese Worte aus meinem Mund rutschten und mit einem Rumpeln zu Boden fielen.
»Bitte?« Vater sah mich irritiert an und legte den Kopf schräg, Verwunderung schien in seinen Augen zu blitzen. »Mit wem?«
»Mit meinem zukünftigen Ehemann«, antwortete ich und verzog das Gesicht zu einem spöttischen Grinsen. »Du durftest ihn schon besser kennenlernen als ich, deswegen bin ich nun am Zug.«
Ich fühlte mich nicht halb so selbstbewusst, wie ich mich gab, und außerdem hatte ich immer noch keine Ahnung, wer da eigentlich sprach. Denn ich wollte diesen Kerl zum Teufel jagen, egal, ob er ein Lord oder Earl war, egal, ob er ein großes Herrenhaus besaß. Ich wollte ihn nicht heiraten.
Doch irgendetwas in mir schien zu flüstern: Versuch es doch wenigstens, es wird leichter, wenn du die Herausforderung annimmst. Wenn du ihn kennenlernst. Und ich glaubte, dass es das Wispern meines Herzens war.
»In Ordnung, das halte ich für eine gute Idee«, stimmte mein Vater mir zu und nahm einen Brief von seinem Schreibtisch. »Hier steht die Adresse, und du kannst auch gerne lesen, was mir der junge Arthur geschrieben hat. Ich bin sicher, er wird dir gefallen. Er studiert Medizin.«
Ich konnte nicht anders, als meinen Vater ein wenig dümmlich anzulächeln, während meine Hände feucht wurden und mein Herz mir bis zum Hals schlug.
Medizin, dachte ich versonnen und beobachtete Vater dabei, wie er den Brief in den Ordner schob. Er hat alles, was ich will. Die Freiheit, studieren zu können, nach der ich mich sehne.
»Ich danke dir, Vater …«, sagte ich noch, bevor ich das Büro mit eiligen Schritten verließ und zurück in mein Zimmer ging. Meine Schritte hallten gespenstisch auf dem leeren Flur wider, und ich stieß die Tür zu meinen Gemächern auf, warf den Ordner aufs Bett und mich gleich daneben.
Und während ich den Brief meines zukünftigen Ehemanns – Arthur Smith – hervorzog, dachte ich daran, dass ich diese Reise wirklich als eine neue Herausforderung betrachten sollte.
Kapitel 3
Lucie
Die Heygate Boarding School for Girls ist eine exquisite Schule für höhere Töchter, die dazu dient, die Frauen perfekt aufs Leben vorzubereiten und ihnen …
Ich brach ab, das Pamphlet über das Internat zu lesen, als ich hörte, wie die Türglocke klingelte und im nächsten Augenblick auch schon die quietschende Stimme meiner Schwester Ava im Flur erschallte.
»Oh, nein …«, flüsterte ich und verdrehte die Augen.
Sie war da. Meine perfekte Schwester, die sofort alles zum Strahlen brachte, sobald sie einen Raum betrat. Die jeden Mann in ihren Bann ziehen konnte, aber doch nur Augen für Reinhold, ihren Ehemann, hatte. Ihre hohe Stimme huschte durch die Türritze, und ich erhob mich mit langsamen Bewegungen aus dem Bett.
Es würde keine Minute dauern, bis …
»Kleine Schwester! Wie schön, dass wir uns endlich wiedersehen.« Die Tür wurde aufgestoßen, kalte Luft fegte hinein, und da stand schon Ava.
Ihre blonden Haare waren zu einem Dutt hochgesteckt, ein kleiner blauer Hut in moderner Schräglage zierte ihren Kopf, und sie trug ein passendes, blaues Kleid dazu, welches mit Applikationen verziert war. Nicht unbedingt ein Reisekleid, aber sehr chic, das musste ich zugeben. Ihre grünen Augen strahlten, und im nächsten Moment zog sie mich stürmisch in ihre Arme.
»Ich habe dich vermisst, Kleines«, flüsterte sie mir zu, und der süßliche Duft ihres Parfums stieg mir in die Nase.
»Ich dich auch«, nuschelte ich wahrheitsgemäß, denn auch wenn meine Schwester für meinen Geschmack viel zu viel redete, liebte ich sie von ganzem Herzen, und ich vermisste sie seit ihrem Umzug nach Hamburg jeden Tag.
Ava löste sich von mir und zog eine ihrer perfekt gezupften Augenbrauen in die Höhe. »Du siehst erschöpft aus, dein Teint ist ganz blass«, stellte sie fest, legte eine Hand unter mein Kinn und drehte meinen Kopf von links nach rechts.
»Ich bin immer so blass«, erwiderte ich spitz und riss mich los, denn ich wollte ungern zugeben, dass Ava recht hatte. Ich fühlte mich elend; und seit ich erfahren hatte, dass ich mein Zuhause bald verlassen würde, schlief ich schlecht. Albträume plagten mich und ließen mich mitten in der Nacht schweißgebadet und mit klopfendem Herzen hochschrecken.
»Mhm …«, machte meine Schwester wenig überzeugt und lächelte mich an. »Gibt es etwas, das du mir erzählen willst, Kleines?«
Ich schüttelte den Kopf und setzte mich gemeinsam mit Ava auf mein Bett. Meine Finger glitten über die Prospekte über das Internat, und die Buchstaben – schwarz auf weißem Grund – brannten sich in meinen Kopf.
»Hast du etwa Angst?«, fragte Ava überrascht und legte ihre Hand auf meine Schulter.
»Ich hab keine Angst!«, rief ich wütend, biss mir jedoch sofort schuldbewusst auf die Unterlippe. Ich wollte meine Schwester nicht anschreien, das hatte sie nicht verdient.
Doch zu meiner Überraschung lachte Ava auf und zog mich erneut in ihre Arme. »Ich sehe schon, der Haussegen hängt wirklich schief. Kein Wunder, dass Mama mich so dringend gebeten hat, hierherzukommen.«
»Mama hat dich darum gebeten?«, fragte ich irritiert und verweilte noch ein wenig länger in der Umarmung meiner Schwester, denn ihre Nähe beruhigte mein aufgewühltes Herz wenigstens für einige Sekunden.
»Natürlich hat sie das, Kleines …« Ava strich zärtlich über meine Wange und erhob sich langsam. Ich hasste es, wenn sie mich »Kleines« oder »Winzling« nannte, auch wenn sechs Jahre Altersunterschied zwischen uns lagen. Aber gleichzeitig liebte ich es auch. Denn ich war als Kind wahrlich ein Winzling gewesen, und selbst jetzt reichte ich Ava kaum bis zur Schulter. Ava, die mehr Zeit mit meiner Mutter verbracht hatte als ich. Als Mama noch nicht so krank gewesen war, da hatte Ava mit ihr Ausflüge unternehmen können. Doch mir war dies fast immer verwehrt geblieben. Vermutlich dachten wir deswegen so unterschiedlich von unseren Eltern.
»Vater wollte dich nur mit Mimi nach England reisen lassen, aber Mama kennt dich besser …« Sie zuckte unbekümmert mit den Schultern und ergriff meine Hände, um mich auf die Füße zu ziehen.
Mich betrübte immer noch, dass mein Vater Mimi, mein Dienstmädchen, mit mir nach Southend schicken wollte, denn er entriss sie ihrer Familie, mit der sie zusammen am Hafen in Lübeck lebte. Doch Mimi schien davon weniger betrübt als ich, was ich noch nicht richtig verstand. Natürlich würde sie in Southend mehr verdienen, denn dort war sie nicht nur mein Dienstmädchen, sondern half auch im Internat. Aber irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Sie war unruhig, machte Fehler bei ihrer Arbeit und schien mit etwas zu kämpfen, doch auf meine Nachfrage hatte sie nur lächelnd abgewinkt, dass sie aufgeregt wegen der Reise sei.
»Und nun hören wir auf damit, Trübsal zu blasen, in Ordnung? Wir machen jetzt einen Spaziergang an der Untertrave, und du erzählst mir, was dich bekümmert, und ich …« Ava tippte sich gegen das Kinn und grinste mich schelmisch an. »Ich erzähle dir alles über die Vorzüge einer Ehe. Immerhin habe ich dazu nun Zeit, da sich das Kindermädchen um meine Kleinen und mein Mann sich um alles andere kümmert.«
»Ihh …« Ich verzog das Gesicht, und Bitterkeit legte sich auf meine Zunge.
Ich wusste natürlich, was in der Hochzeitsnacht zwischen Mann und Frau passierte. Nicht von meinen Eltern, denn darüber sprach man nicht, doch Mimi hatte es mir erzählt. Man mochte es kaum glauben, aber mein Dienstmädchen war meine einzige Vertraute in diesem großen Haus, seit Ava ausgezogen und Mutters Krankheit immer schlimmer geworden war.
Die Menschen am Hafen, wo Mimi wohnte, sprachen über derlei Dinge viel offener, und so hatte ich irgendwann den Mut gefasst, sie danach zu fragen. Außerdem trieb ich mich oft genug im Heiligen-Geist-Hospital herum und war auch schon auf der Geburtsstation gewesen, wo ich mit einer Hebamme hatte sprechen können. Ich hatte mich als Mimi ausgegeben, wenn ich die Geburtsstation besuchte. Denn mein Dienstmädchen hatte eine alte Freundin, die Hebamme war und mich bereitwillig mit auf die Station genommen hatte. Es interessierte kaum jemanden von den Ärzten, was auf den Geburtsstationen vor sich ging, und man war für jede helfende Hand dankbar.
»Ach, so schlimm ist das nicht.« Ava zwinkerte mir zu und zog mich stürmisch mit aus dem Zimmer die Treppe hinunter in den Flur.
»Ich mache mit Lucie einen Spaziergang an der Untertrave, wir sind zum Abendessen zurück!«, rief sie überschwänglich und wartete gar nicht auf eine Antwort von Mutter und Vater, sondern ging rasch mit mir gemeinsam auf die Straße.
»Müssen wir nicht …?« Ich zeigte zur geschlossenen Haustür, doch Ava zuckte nur mit den Schultern.
»Weißt du, was noch einer der Vorteile ist, wenn man eine verheiratete Frau ist? Man braucht nicht mehr die Erlaubnis seiner Eltern, wenn man das Haus verlassen möchte.« Sie hakte sich bei mir unter, und wir gingen die Holstenstraße hinunter zur Trave.
»Aber die deines Mannes«, murrte ich, doch Ava winkte nur lächelnd ab.
»Reinhold lässt mir viel Freiraum, das gebe ich zu. Aber viele Männer sind so, gerade Kaufleute sind dankbar, wenn ihre Frauen das Lesen und Rechnen beherrschen und sich mit ihnen über ihre Arbeit unterhalten können.«
»Das mag bei Reinhold stimmen, aber nicht bei allen Männern«, begehrte ich auf und dachte daran, wie Vater Mutter und mich immer aus seinen wichtigen Gesprächen heraushielt, so tat, als ob wir ohnehin nicht verstehen würden, über was er sprach. Als wären wir auf den Kopf gefallen. »Außerdem heirate ich keinen Kaufmann, sondern einen Lord oder so was Ähnliches.«
»So etwas Ähnliches?« Ava betrachtete mich schmunzelnd und zog eine Augenbraue hoch. »Hast du dich etwa noch gar nicht mit ihm beschäftigt?«
Ich zuckte mit den Schultern, wir waren am Ufer der Trave angekommen, und ich ließ den Blick schweifen. Das blaue Wasser glitzerte verführerisch in der Sonne. Auf den Wiesen hatten es sich einige Familien zum Picknicken gemütlich gemacht, und ein Dampfschiff fuhr laut röhrend an uns vorbei. Auf der anderen Seite der Trave wurden Waren von Lagern zur Eisenbahn transportiert. Lübeck war erst vor einigen Jahren ans Streckennetz angeschlossen worden, doch nun florierte der Handel mit Waren aus aller Welt. Weiter hinten erstreckte sich der Hafen, die schäbigen Baracken und großen Häuser mit winzigen Wohnungen für riesige Familien. Rechts von uns, auf Höhe der Marienbrücke, standen Kaufleute in Reih und Glied vor dem imposanten Backsteingebäude des Hauptzollamtes – es schien, als würde eine sanfte Ruhe über Lübeck liegen. Als würde die Welt den Atem anhalten und die Zeit einfrieren.
»Lucie?«, riss meine Schwester mich aus meinen Gedanken, und ich wandte hastig den Blick vom Hafen ab, obwohl ich unwillkürlich an Mimi denken musste. Ihre Familie wohnte am hintersten Ende der Stadt beim Hafen, dort, wo feine Damen wie Ava und ich niemals hingehen würden. Denn in allen Ecken lauerte dort Gefahr, wenn man in solch hübschen Kleidern umherlief.
»Ich habe meinem zukünftigen Ehemann geschrieben, aber bisher ist noch kein Brief zurückgekommen …«, entgegnete ich und ließ mich mit Ava auf einer Bank nieder. »Vielleicht interessiere ich ihn gar nicht.«
»Höre ich da Wehmut aus deiner Stimme?« Ava stieß mir leicht ihren Ellenbogen in die Seite, und ich schüttelte entrüstet den Kopf.
»Natürlich nicht, das ist mir ganz recht. Ich will ohnehin nicht heiraten.«
»Ach, Lucie …« Ava seufzte schwer und ergriff meine Hand. »Du bist doch ein kluges Mädchen, du weißt, wie unsere Welt funktioniert.«
Das wusste ich. Ich sprach fließend Englisch, Französisch und konnte ebenso lateinische Texte lesen und verstehen. Ich war gut im Rechnen und Schreiben, selbst in Geografie und den wenigen Naturwissenschaften, in denen wir in der höheren Töchterschule unterrichtet worden waren. Trotzdem würde ich niemals studieren können. Ich würde keine Ärztin werden oder Wissenschaftlerin, denn es gab kaum Berufe, die Frauen ergreifen konnten, wenn man von Lehrerin, Gouvernante oder Hebamme mal absah. Und den armen Frauen aus dem Hafenviertel, die arbeiten mussten, weil ihre Familien sonst verhungerten.
Das Leben war himmelschreiend ungerecht.
»Nur weil ich weiß, wie die Welt funktioniert, bedeutet das nicht, dass ich es gut finden muss«, gab ich murrend zurück und starrte auf die Trave.
»Du bist viel zu klug für diese Welt.« Ava räusperte sich und drückte meine Hand. »Weißt du, Mama und Papa wollen nur, dass du gut versorgt bist.«
»Aber mich fragt niemand, was das für mich bedeutet!« Meine Antwort war etwas zu laut, sodass eine Dame, die mit einem kleinen Mädchen am Ufer spazieren ging, sich zu mir umdrehte und mir einen giftigen Blick zuwarf.
Sofort stieg Hitze in meine Wangen, und ich senkte beschämt den Blick. Auch wenn ich manchmal explodierte wie ein Vulkan, zog ich nicht gerne die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf mich. Ich hasste es, im Mittelpunkt zu stehen, und in England würde mir nichts anderes übrig bleiben, als genau diese Situationen zu überstehen.
»Aber du …« Zögerlich sah Ava mich an, als ich mich zu ihr drehte, und ich musterte meine wunderschöne Schwester eingehend.
Im Gegensatz zu ihr war ich ein Schatten. Ihre Gesichtszüge waren ebenmäßig, während meine Nase zu klein und meine Stirn zu groß geraten war. Feine Strähnen ihrer blonden Locken umschmeichelten ihr Gesicht, wo meine Haare kaum zu bändigen waren und immerzu in alle Richtungen abstanden. Sie war freundlich und liebevoll, wusste immer, was sich für eine Dame gehörte. Die perfekt angepasste Frau. Ich beneidete sie darum, dass ihr Herz und ihr Kopf nicht im Konflikt miteinander standen.
»Ich was?«, bohrte ich nach, als Ava nicht weitersprach.
»Du könntest dort glücklich werden, Lu. Hast du daran einmal gedacht?«
Mein Mund klappte auf, während es erneut in mir zu brodeln begann, doch kein einziges Wort drang über meine Lippen. Daran hatte ich tatsächlich nicht gedacht, weil die Wut viel zu stark und präsent war.
»Was – außer Mama und Papa und vielleicht deiner Freundin Hilde – hält dich hier?«, fragte Ava weiter und ließ mich erst gar nicht zu Wort kommen. »Ist es nicht das, was du wolltest? So weit weg von Lübeck zu kommen wie eben möglich? Die Welt entdecken? Diese Möglichkeiten hast du in Southend, und wie ich höre, sind die Lehrerinnen im Internat auch recht modern und aufgeschlossen.«
Ist es nicht das, was du wolltest?
Avas Worte hallten wie eine sanfte Melodie in meinen Ohren wider, und ich musste den dicken Kloß, der sich in meinem Hals gebildet hatte, mühsam hinunterschlucken.
»Ich weiß doch gar nicht, was ich will«, wisperte ich leise und starrte hinab auf meine Hände. Tränen tropften von meinen Wangen, und es war, als würde die Welt für einen kurzen Augenblick innehalten, sich nicht mehr drehen.
»Ach, Kleines …« Ava zog mich in ihre Arme und wischte die Tränen von meinen Wangen fort. »Genau das ist es doch, was ich meine. Dein Leben fängt doch jetzt erst so richtig an. Deswegen ist es gut, dass du diesen neuen Ort kennenlernst.«
Ich schniefte unfein und verweilte noch einen Augenblick in der Umarmung meiner Schwester, dann löste ich mich zaghaft von ihr. »Wenn du meinst …«, setzte ich an, und mein Blick glitt wehmütig über Lübeck hinweg. »Ich werde aber trotzdem nicht einfach irgendeinen Kerl heiraten. Wenn er mir nicht freundlich erscheint, dann können Mama und Papa das vergessen.« Trotzig rieb ich mir über die Wangen.
Ein Schmunzeln lag auf Avas Lippen, und sie strich mir über den Arm. »Du wirst mit Sicherheit das Richtige tun, Kleines«, entgegnete sie, doch in meinen Ohren klang es immer noch, als hätte ich ohnehin niemals eine Wahl gehabt.
Kapitel 4
Lucie
In den folgenden Tagen schleppten mich Ava und meine Mutter – wenn es ihr gut genug ging – zu allen möglichen Läden in der Lübecker Altstadt. Ich wurde komplett neu eingekleidet für meinen Aufenthalt in Southend-on-Sea, obwohl ich erfahren hatte, dass wir Mädchen eine Art Internatsuniform tragen würden.
»Warum brauche ich so viele neue Kleider, wenn ich eh nur Uniform tragen werde?«, murrte ich, als wir erneut den Laden einer ansässigen Schneiderin betraten und ich mich zum gefühlt hundertsten Mal auf das Podest stellte, damit sie Maß nehmen konnte.
»Weil du auch in Southend unterwegs sein wirst, und dafür brauchst du neue Kleider«, erklärte mir Ava zum ebenfalls hundertsten Mal, doch dieser Einwand wollte mir nicht in den Kopf.
»Aber ich habe hübsche Kleider.« Auf einen Wink der Schneiderin streckte ich meine Arme nach links und rechts aus.
»Aus denen du fast herausgewachsen bist.« Ava trank genüsslich einen Schluck Limonade, die ihr das Mädchen, das eine Lehre in der Schneiderei machte, eingeschenkt hatte.
Ich murmelte etwas Unverständliches und ließ die Prozedur über mich ergehen, obwohl all dies so unglaublich belanglos erschien.
»Außerdem …« Ava erhob sich schwungvoll und stieß dabei gegen den kleinen Tisch, der nahe der Sessel stand, auf denen sie und Mutter saßen. Dabei wankte das Glas Limonade gefährlich hin und her, fiel zum Glück jedoch nicht um. »… ist heute Morgen ein Brief für dich angekommen!«
Sie zauberte einen weißen Umschlag aus ihrem Retikül hervor und reichte ihn mir mit einem Zwinkern.
»Hast du etwa schon reingeguckt?«, fragte ich misstrauisch und tippelte von einem Fuß auf den anderen, während die Schneiderin meine Hüfte erneut ausmaß.
»Nein, aber die Adresse spricht für sich.«
Ich schaute auf den Umschlag hinab und zog scharf die Luft ein. Der Brief stammte aus England, das bedeutete …
Nein, warum hat er mir denn geantwortet?, dachte ich unzufrieden, während ich das Briefpapier hervorzog. Ich hatte bis zum Schluss gehofft, dass mein zukünftiger Ehemann genauso wenig Lust auf mich hatte wie ich auf ihn. Dass er mir niemals antworten und dieses ganze Dilemma in Vergessenheit geraten würde. Doch dieser Traum zerplatzte leider.
Ich seufzte leise, als ich begann, den Brief zu lesen. Seine Schrift war gestochen scharf und klar, kein Gekritzel, wie ich es von den meisten Jungen kannte. Auch seine Wortwahl schien hochtrabend, aber dennoch freundlich. Und dieser letzte Satz stach wie ein Messer in mein ohnehin schon kaputtes Herz.
Ich freue mich, bald Ihre Bekanntschaft zu machen, Fräulein Lucie. Es wird mir eine Ehre sein, Sie in Southend herumzuführen, auf den Bällen in London mit Ihnen zu tanzen und Sie von mir als Ihrem zukünftigen Ehemann zu überzeugen.
Wider Willen musste ich schmunzeln. Das klang freundlich und nicht arrogant. Er wollte mich von sich überzeugen, schien zu wissen, dass man eine Dame erobern sollte, auch wenn die Verlobung bereits feststand.
»Und?«, fragte Ava neugierig. »Was schreibt dein Zukünftiger?«
Ich schnaubte und steckte den Brief zurück in den Umschlag. »Ich glaube, das geht dich gar nichts an.«
Ein Laut des Erstaunens entglitt Avas Kehle, dann jedoch begann sie zu lachen. »Du bist wahrlich ein freches Ding, Lu!«
»Lass sie …« Mutter lächelte mich an, und in ihren Augen schienen Tränen zu schimmern. »Der erste Brief des zukünftigen Ehemannes ist nur für die Augen der Ehefrau bestimmt.«
Ich will ja gar nicht seine Ehefrau werden, dachte ich schnippisch, sprach es aber nicht aus, um die in den letzten Wochen geglätteten Wogen nicht erneut aufzuwühlen. Avas Anwesenheit hatte meinen Vater besänftigt, und sie schien auch mein Herz zu beruhigen. Meine Schwester war mein Anker in diesem Sturm auf rauer See.
»In Ordnung …« Die Schneiderin, Frau Herbst, räusperte sich und schob ihre Brille ein Stück die Nase hoch. »Das Kleid benötigt noch minimale Korrekturen, aber Sie sollten es morgen schon abholen können. Haben die Damen noch weitere Wünsche?«
Ich zuckte mit den Schultern und stieg vorsichtig vom Podest, mein Blick streifte meine Mutter. Sie schaute auf das gefaltete Papier herab, das sie in der Hand hielt. Dort hatte sie sorgsam notiert, welche neuen Kleider ich brauchte.
»Nein, ich denke, dass wir dann alles haben. Ein neues Reisekleid, zwei neue Flanierkleider, wenn du in Southend mit deinen Mitschülerinnen unterwegs sein wirst, und dieses wunderschöne Ballkleid.« Sie deutete auf das schillernde blaue Kleid, das nach der neuesten Mode aus Frankreich geschneidert war, und ich nickte schweigend.
Ich fühlte mich wie verkleidet. Das Mädchen, welches ich in dem meterhohen Spiegel sah, das war nicht ich. Ich trug diese modernen Kleider nur ungerne, fühlte mich erdrückt von dieser Last auf meinen Schultern. Nein, ich war das Mädchen, das sich von Mimi ein einfaches Kleid ausborgte, seine weizenblonden Haare unter einem Tuch versteckte und sich heimlich auf der Geburtsstation des Heiligen-Geist-Hospitals herumtrieb, weil Mimis Freundin mir bereitwillig Eintritt in diese faszinierende Welt gewährte. Das war ich, nicht dieses Mädchen, welches mir entgegenblickte.
Aber ich würde niemals die sein können, die ich sein wollte.
»Wunderbar!« Frau Herbst klatschte in die Hände und winkte das Mädchen zu sich. »Hilf Fräulein Lucie aus dem Kleid, und dann erledigst du die Anpassungen.«
»Sehr wohl, Frau Herbst.« Das Mädchen bedeutete mir, ihr zu folgen, und ich tat, wie mir geheißen.
Die Schneiderin hatte ein kleines Vermögen an uns gemacht, und nicht zum ersten Mal fragte ich mich, ob dies nicht alles zu teuer war. Ob Vaters Geschäfte im Salzhandel und mit weiteren Waren so florierten, dass er mich einmal komplett neu einkleiden konnte.
»Ah!« Eine der Nadeln, die Frau Herbst benutzt hatte, um das Kleid anzupassen, bohrte sich in meine Hüften, und ich verzog das Gesicht. Ich hatte mich unbedacht bewegt und nicht daran gedacht, dass das Kleid noch voller piksender Dinger war.
»Oh! Ich bitte vielmals um Verzeihung, gnädiges Fräulein, es tut mir …«
»Schon gut«, unterbrach ich sie mit einem Seufzer und lächelte sie an. »Ich habe mich bewegt, das kann doch mal passieren, nicht deine Schuld.«
Das Mädchen senkte den Blick und arbeitete stumm weiter. Ihre Finger zitterten wie Espenlaub, und ich hatte das ungute Gefühl, dass sie heute noch von Frau Herbst ausgeschimpft werden würde.
Es hätte nichts daran geändert, weil Sie die Tochter des Hausherrn sind. Sie sind dafür nicht verantwortlich, sondern ich. So ist der Lauf der Dinge.
Mimis Worte hallten in meinem Kopf wider, die sie zu mir gesagt hatte, als ich die Gläser umgestoßen hatte an dem Abend, als Vater mir offenbart hatte, dass ich heiraten musste. Sie hatte gesagt, dass es immer die Schuld der Bediensteten sein würde, wenn ein Fehler passiert, niemals die der feinen Herrschaften. Traurig betrachtete ich das Mädchen vor mir. Selbst hier war es immer das Gleiche. Ich hatte mich bewegt, und dadurch waren die Nadeln verrutscht, doch das Mädchen würde die Schimpfe bekommen. Wir waren wahrscheinlich alle nur ein Spielball unserer Lebensumstände.
»So, fertig. Ich helfe Ihnen jetzt aus dem Kleid.« Sie erhob sich und schnürte das Kleidungsstück auf, ich stakste vorsichtig heraus.
Dann trat ich hinter dem Paravent hervor und sah Mutter sowie Ava an. »Wir können uns auf den Weg nach Hause machen.«
»Ich werde nach Hause gehen«, korrigierte mich Ava. »Mama wollte gerne noch einen Spaziergang mit dir machen.«
Ich sah zu meiner Mutter, die mir ein beinahe scheues Lächeln schenkte und mir ihre Hand hinhielt. Nur mit Mühe ergriff ich die ihre, nachdem ich meinen Hut zurechtgerückt hatte.
»In Ordnung, bis später, Ava«, sagte ich und verabschiedete mich von meiner Schwester auf dem Gehsteig.
Die Schneiderei war an der Untertrave gelegen, und bis zu uns nach Hause in die Holstenstraße war es nur ein kurzer Weg. Doch stattdessen lotste mich meine Mutter ins Innere der Stadt, vorbei an den prächtigen alten Bauten und den schmalen Häusern, den Gängen und Höfen, die es überall in Lübeck gab und in denen reiche Mädchen wie ich sich niemals verlieren sollten. Denn dort wohnten die armen Menschen der Stadt und nutzten teilweise sogar die Gänge, die zu den Innenhöfen führten, welche von Häusern umschlossen waren, um dort zu leben.
»Du scheinst die letzten Tage tief in Gedanken versunken gewesen zu sein«, bemerkte meine Mutter mit einem Lächeln, während wir die Beckergrube hinaufgingen, wo sich das imposante Stadttheater befand, und den Geibelplatz ansteuerten, vorbei an der prächtigen Jakobikirche, die majestätisch in den Himmel ragte. Ich konnte leisen Gesang aus dem Inneren der Kirche vernehmen, und ein wehmütiges Lächeln streifte meine Züge.
»Ich werde Lübeck vermissen«, gab ich leise zu, während wir den gemütlichen Marktplatz erreichten, auf dem heute reges Treiben herrschte.
Ich wusste immer noch nicht, warum meine Mutter mit mir spazieren gehen wollte. Früher hatten wir das oft getan. Dann hatte sie statt meiner Gouvernante mich von der höheren Töchterschule abgeholt. Sie ging dann mit mir durch die Straßen Lübecks, kaufte Naschwerk und erzählte mir vieles über die Geschichte der Stadt.
Doch dann hatte sie meinen Vater oft auf Handelsreisen begleitet, und ich war allein zurückgeblieben – Ava hatte damals schon eine Schule in Hamburg besucht.
Und seit ihre Tuberkulose immer schlimmer geworden war, waren unsere Augenblicke der Zweisamkeit noch seltener geworden. Und bald würde es sie gar nicht mehr geben.





























