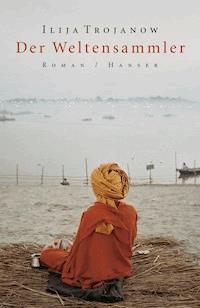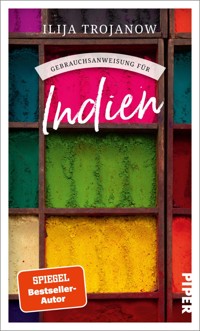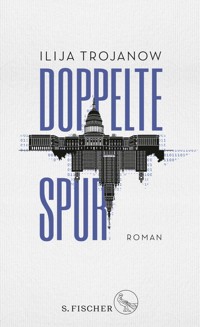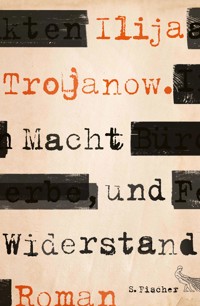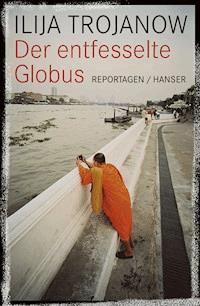
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Trojanow ist auf allen Kontinenten zu Hause: Wie seine Vorbilder Ryszard Kapuczinski und Egon Erwin Kisch ist er am liebsten unterwegs. Was Trojanow zu berichten hat, geht weit über die Schönheit der Landschaften oder die Fremdheit der Sitten hinaus. Er erzählt, wie die Menschen leben: in dem nicht zur Ruhe kommenden Afrika, in den alle Vorstellungen sprengenden Megacitys Indiens oder in anderen Ländern Asiens, die von Naturkatastrophen heimgesucht und von politischen Umwälzungen bedroht werden. Aber auch Bulgarien, das Land seiner Geburt, nimmt dieser geborene Reisende unter die Lupe - seine Schilderungen der alten Seilschaften in neuer Verkleidung lesen sich wie moderne europäische Gruselgeschichten. Neugierig, offen, kritisch und selbstkritisch - mit dem Autor vom Weltensammler als Cicerone sieht man die Welt in einem anderen Licht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
Ilija Trojanow
DER ENTFESSELTE
GLOBUS
Reportagen
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23355-3
© 2008/2011 Carl Hanser Verlag München
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Filmsatz Schröter, München
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Inhalt
7Vorwort
AFRIKA
11Szenen aus der Savanne der Jugend
18Oscar inAfrika
23Eine Antonow über dem Niger
29Nichts Schlimmeres als Alleinsein
33Der Mensch und sein Wild
44Eine erschreckende Stille lag über dem Land
46Jede Regenzeit ein Neuanfang
53Der Kampf um Bälle und Köpfe
59Afrika – Kakafrik – Rikafa
INDIEN
65Die Abschaffung der Armut
75Götter klonen, Strichcodes lesen
Willkommen in Clintonnagar oder
85 Kommt ein Präsident geflogen
88Indien erlesen
98Bombay Revisited
110Die Heuchelei des Westens
ASIEN
123Bali Mon Amour
129Der Golfplatz in der Wüste
139Der Zorn der Straße?
143Augenblicke des Glücks
148Die Verkostung der Welt
BULGARIEN
155Bulgariens Kohlhaas
161Belene – Erinnerungsreise in einen bulgarischen Gulag
171Die Macht kommt aus den Dossiers
177Wo der Staat Teil der Mafia ist
WEGWEISER
183Das Netz von Indra
186Die Wahrheit der verwischten Fakten
192Die Einbürgerung der Pampelmuse
Vorwort
Geboren bin ich in Bulgarien. Aber schon mit sechs lernte ich die Fremde kennen. Seit jenem Tag, an dem ich mit Mutter und Vater in ein Lager kam, in dem in vielen unverständlichen Zungen gesprochen wurde, kann ich meiner Erinnerung vertrauen. Mit sechs wurde ich ins Unverständliche geworfen. Seither versuche ich mir einen Reim darauf zu machen. Kaum war ich verheimatet, wurde ich wieder herausgerissen, einer weiteren Fremde ausgesetzt – einem Auffanglager in Deutschland zunächst, dann einem Internat in Kenia.
Mit sechs saß ich in einem Flüchtlingslager nahe Triest und sehnte mich, durch die Eisenstäbe des Eingangstores hindurch, nach den bunten Spielzeugautos, die ich in der Auslage eines Geschäfts erblickt hatte. Ich stellte mir vor, wie ich in mein Coupé steigen und losbrausen würde, ohne Ziel, ohne Grenzen. Das ist für mich bis zum heutigen Tag das Sinnbild einer wahren Reise – die Ziellosigkeit.
Einige Wochen später schliefen wir – auf dem Weg nach Deutschland – in einem Kuhstall, weil die italienischen Behörden uns gegen unseren Willen nach Übersee aussiedeln wollten. Die Grenze zwischen Österreich und Deutschland erwies sich als schlecht gebundener Schnürsenkel. Mehrmals fragten wir Spaziergänger, in welchem Land wir uns denn befänden und erhielten mal Deutschland, mal Österreich zur Antwort. Bis wir aus dem Wald auf eine Landstraße traten und mein Vater angesichts der sauber geteerten Straße siegessicher verkündete, wir seien in Deutschland. Wir waren Illegale, auf der Flucht, aber ich spürte ein Gefühl der Verzauberung.
Auf dieser Flucht waren wir gewissermaßen nackt. Es ist ein Zustand, bei dem die Welt einen Abdruck auf dem eigenen Körper hinterläßt. Die Flucht endete in Kenia, einem Land, über das ich nichts wußte, von dem ich nichts erwartete, das mir so unbekannt war wie das Vogelgezwitscher, das mich am ersten Morgen nach der Ankunft begrüßte. Die Unvoreingenommenheit erwies sich als gesegneter Begleiter, der sich leider allzu gerne aus dem Staube machte.
Mit zehn starrte ich aus dem Fenster eines Flugzeugs auf der Rollbahn eines Flughafens in Europa. Wir waren gerade zum ersten Mal aus Afrika zurückgekehrt. So erstaunt war ich über den Anblick, der sich mir bot, daß ich ausrief: Mami, hier arbeiten ja weiße Männer! Es gibt keine Heimat, die nicht zur Fremde werden könnte, und umgekehrt. Es hat mich immer wieder erstaunt, wie selbstverständlich etwas werden kann, das anfänglich irritierend oder gar inakzeptabel wirkte.
Es gab Zeiten, da sehnte ich mich nach Rückkehr. Bis ich begriff, daß meine Herkunft kein Raum ist, der für mich reserviert ist, den ich nur aufsperren und entstauben müßte, um wieder einziehen zu können. Die Sehnsucht nach einer bereits erfolgten Ankunft wich den Reizen eines neuerlichen Aufbrechens.
Dieses Buch ist eine Sammlung solcher Aufbrüche aus zwanzig Jahren. Die Texte sind so unterschiedlich, wie die Reisen und die Sehnsüchte es waren. Selten war ich mit einem festen Auftrag unterwegs; den einen oder anderen Text schrieb ich zu einem bestimmten Anlaß. Ich habe für dieses Buch jene Texte ausgewählt, die einem persönlichen Interesse entsprangen und diesem auch heute noch entsprechen. So unterschiedlich sie auch sein mögen, sie erzählen alle von einer Welt, deren flimmernd ungewisse Vielfalt mich weiterhin gefangen hält und beglückt.
AFRIKA
Szenenaus der Savanne der Jugend
Nairobi 1981-1984
Lavington Green. Passion Fruit. Riverside Drive. Pineapple. Westlands. Mango. Der Morgen kalt auf hoher Ebene. Spring Valley. Neben der Tankstelle aufgereiht orangefarbene Kleinbusse der Firma Private Safaris. Der letzte Anstieg. Die Mädchen aus der ersten, aus der zweiten, aus der dritten Klasse, herausgeputzt, eingetüllt, maridadi, im vorderen Teil des Busses, knappe Blicke hinaus auf die Barfüßigen. Die letzte Kreuzung: Rechts hinab zu den Vereinten Nationen, UNEP, links hinauf nach Little Germany. Vor uns Kaffeeplantagen. Lauter VW-Busse auf dem Parkplatz. Ist Mount Kenya heute zu sehen? Von den Stufen, die zum Innenhof hinaufführen, ist an klaren Tagen der Sitz eines anderen Gottes auszumachen. Das beeindruckt die Neuen. Weimarer Republik bei fünfzehn Grad. Homo faber bei zwanzig Grad. Zur ersten Pause bricht die Sonne durch die Wolken. Der Kiosk, geradezu versteckt im hintersten Winkel. Cadbury oder Fudge? Evolution bei fünfundzwanzig Grad. Sur le quai d’Amsterdam bei dreißig Grad. Zur zweiten Pause schilt uns die Sonne, und wir starren an ihr vorbei. Basketball oder Rauchen? Sportsman oder Embassy? Eine Doppelstunde Logarithmen. Draußen zieht der Tag vorbei wie zäher Honig. Die Tage verschmieren. Irgendwann stürmt der Geographielehrer in den Klassenraum. Er scheint aufgeregt zu sein. Ob wir wüßten, wo die Etsch liege. Wir wissen es nicht. Ob irgendeiner von uns die deutsche Nationalhymne kenne. Keiner von uns. Eine Schande sei dies, jawohl. Das ist keine Frage mehr. Maski, die äthiopische Schönheit in unserer Klasse, kontert, dafür kenne sie die kenianische Hymne. Schließlich leben wir in Kenia und nicht in Deutschland, fügt Elly hinzu, halb Ghanaerin, halb Engländerin und schon ganz Frau. Ich bin Österreicherin, sagt Susi. Ich bin Engländerin, denkt sich Natasha. Wozu braucht man eine Hymne, fragt gelangweilt Stephan, seines Zeichens Kenya Cowboy, aufgewachsen am Bamburi Beach, erzogen im Internat in Kileleshwa, wo er jeden Tag mit Cocain Around My Brain und 50 Liegestützen beginnt. Der Lehrer läuft rot an, er schreit. Er scheint der festen Überzeugung zu sein, unser Lebensglück hänge von der Kenntnis der deutschen Hymne ab. Wir sollen sie unbedingt und sofort lernen. Wir weigern uns. Maski stimmt die kenianische Hymne an, auf Kisuaheli. Etwa die Hälfte der Klasse singt mit. Der Lehrer verläßt wütend den Raum. Dem Nationalismus sind die allerletzten Argumente ausgegangen.
Heimfahrt. Nairobi riecht nach Jacarandablüten. Der Baum, der in der Trockenheit erblüht. Die Stadt, die an den Fenstern vorbeirast, hat wenig Ähnlichkeit mit der Stadt des frühen Morgens. Bougeainvilleabüsche wuchern farbprächtig. Die Hausaufgaben liegen im Ranzen wie Blei. Akazien, breit gefächert. Der Busfahrer, Mr Shah, stets grimmig und grollend, ein Mensch, der Türen öffnet und schließt und die leichteste Andeutung von Unfug lauthals erstickt, der manchmal flucht, wenn ihm ein Landrover den Weg abschneidet, und der nur aus seiner Funktion zu bestehen scheint, bis zu jenem Tag spät im August, als ein Staatsstreich versucht wurde und im Radio Marschmusik lief, als geschossen wurde in der Innenstadt und am Flughafen, als in Vierteln, die wir nie besuchten, Grauenhaftes geschah, als die Menschen, die wir Banyanis nannten, ausgeplündert und ihre Frauen vergewaltigt wurden. Seit jenem Tag im August fluchte und schimpfte Mr Shah nicht mehr, er verstummte hinter seinem Lenkrad, es wurde gemunkelt, er habe seinen Sohn oder gar seine ganze Familie verloren, aber wir trauten uns nicht, ihn darauf anzusprechen. Beim Heranwachsen war die Idylle ein Firnis, der jederzeit aufreißen konnte.
Ayah. Karen. Koch. Langata. Askari. Huntington. Shamba boy. Das Mittagessen. Die Frische des Morgens ist verflogen, so als würde zu Mittag nur mit getrockneten Kräutern gewürzt werden. Kaum ist der Nachtisch verdrückt, kommt die leidige Frage nach dem Transport auf. Welche Mutter bringt hin, welche Mutter holt ab? Zum Tennis. Zum Swimmingpool. Zum Kino. Zur Trattoria. Unsere Emanzipation trägt einen klangvollen Namen: Matatu. Zuerst unerlaubt, dann mit zähneknirschender Zustimmung der Eltern. Matatu-Fahrten sind – für manche von uns – die seltenen Abenteuer einer heckenbewehrten Jugend. Eingequetscht zwischen ausladenden Mamas und den tout (Kundenanreißer, übersetzt der Duden Oxford) im Ohr, wie er schreit: Twende…haraka…twende. Aus den Boxen scheppern Reggae und Lingala. Schuldisco. Busfahrten extra organisiert von der Schule. Und eines Tages das erste Konzert von CIA. Wer erinnert sich noch an CIA, die Schulband? Die ein zweites Mal auftritt, bei dem Oktoberfest auf dem Rasen des deutschen katholischen Pfarrers, dort, wo heute die deutsche Botschaft ein vermeintlich bombensicheres Areal hingebaut hat, und unser Sänger, der einzige Kenianer in der Band, einfach nicht erscheint und wir verständnislos enttäuscht sind, auch weil er uns keine versöhnliche Erklärung bietet, bis mir Jahrzehnte später klar wird, wie er sich gefürchtet haben muß vor einem Auftritt in diesem Ghetto mit den Bratwürsten und dem Bier und den vielen gaffenden weißen Gesichtern, die in seinem Land leben, ohne wirklich anwesend zu sein. Und erst viele Jahre später verstehe ich, wie viel mehr Begegnung möglich gewesen wäre, wie viel mehr Kenia ich in mir tragen könnte, wenn Eltern und Lehrer uns weniger abgeschottet hätten.
Lavington Green. Papaya. Riverside Drive. Guava. Westlands. Banane. Gewachsen, gewachsen, immer weiter gewachsen. Die VW-Busse vor der Schule sind vollgepackt mit allem, was man zum Camping im Busch benötigt. Es ist also Freitag. Am Ende der sechsten Stunde, in einer erstaunlichen Umkehrung des Üblichen, stürmen – kaum schellt es – die Lehrer aus den Zimmern und hasten zu ihren Bussen. Die Safarilust treibt sie um, Wochenende um Wochenende, sie kommen ausgelaugt am Montagmorgen herein und erklären uns nachsichtig, sie hätten leider keine Zeit gehabt, die Schulaufgaben zu korrigieren. Kenia ist ein schöner Posten, und später, irgendwo im magistralen Deutschland, über ein Bier gebeugt, erinnern sie sich wehmutsvoll ihrer schönsten Berufszeit. Auch dies ist bemerkenswert: daß manche Schüler Kenia besser kennen als die Lehrer, und somit bezüglich des Landes, in dem beide leben, die Wissenden sind. Inversionen allenthalben. Und Unsicherheiten. Jomo Kenyatta und Helmut Schmidt. Harambee. Daniel arap Moi und Helmut Kohl. Kenya Juu. Tom Mboya. JJ Kariuki. Ngugi wa Tiong’o. Njonjo. Ouko. Tote über Tote, draußen vor der Hecke. Wir erfahren vom Faschismus, nur ist der Faschismus aus den Schulbüchern schon ein halbes Jahrhundert alt. Wir wollen über unser Land, über Kenia diskutieren. Schließlich fotokopiert der Klassenlehrer einen mutigen Leitartikel aus der Zeitung The Standard – der Autor sitzt schon im Gefängnis – und gibt ihn uns zu lesen. Wobei er uns beschwört, es insgeheim zu tun, mit niemandem darüber zu reden. Peace Love & Feigheit. Nyayo House, in dessen Kellern Regimegegner gefoltert werden. Kein einziges Wort darüber im Unterricht. Andererseits lesen wir, auf Initiative des Englischlehrers, einen kenianischen Autor, Meja Mwangi: Going Down River Road. Eine Offenbarung. Es gibt ein Leben, das weit über Runda Estate, Parklands Club, Wilson Airport und Diani Beach hinausreicht. Stephan, der Kenya Cowboy, schlägt vor, wir sollten selber in die verkommene River Road gehen. Um changaa zu trinken, das Gebräu für die billigsten Sehnsüchte. In einer der Kaschemmen. Wir nehmen es uns monatelang vor. Was reden wir nicht darüber. Bis wir lesen, ein Dutzend Menschen sei nach dem Genuß von selbstgebrautem changaa erblindet. Der Plan stirbt, wie auch der Plan, an der East African Safari Rallye teilzunehmen. Waldegaard. Joginder Singh, The Flying Sikh. Mehta Mehta Mehta.
Bock. Faust. Doppelbock. Kommando Bimberle. Der Zug nach Mombasa, abends um fünf und um sieben. Giraffen. Höhlenwanderungen am Mount Suswa. Gnus. Die steinige Leere am Turkana-See. Gerenuks. Klassenfahrten sind umstrittene, heftig umkämpfte Aufbrüche. Der Lehrer M., der mit uns durch die Chulu Hills wandern will, mit Masai als Begleitung und Ziegen als Proviant, ein Vorhaben, das an einigen Mädchen scheitert, die es sich nicht vorstellen können, Tiere zu schlachten, zu denen sie eine persönliche Beziehung aufgebaut haben, und an einigen Eltern, die es sich nicht vorstellen können, ihre Kinder in die Obhut von Wilden zu geben. Wir fahren statt dessen in den Norden. In eine Dürre hinein. Unser Entsetzen über die ausgemergelten Gestalten, die uns so verzweifelt anbetteln, als hinge ihr Leben davon ab. Die unvergeßliche Trauer von ausgetrockneten Flüssen. Im Jahr darauf bricht unser Bus im Schlamm des Mount-Elgon-Nationalparks zusammen. Johannes der Wiener macht sich auf zum einen Parktor, ich zum anderen. Wenn es dunkelt, rufen die Geräusche des Busches alle Ängste zusammen. Paviane und Vögel, die stimmlich aufschneiden. Dann endlich der Aufstieg zum Mount Kenia. Die Erschaffung der Welt zum Sonnenaufgang vom Point Lenana aus. Büffel. Die zerbrochenen Farben auf dem Lake Magadi. Oryxe. Die Migration im Masai Mara. Zebras. Die Absturzstelle am Ngorongoro-Krater. Die häßliche Collage eines hübschen jungen Mannes an der Fassade der Michael-Grzimek-Schule. Kein Heiligenkult. Nie wird uns erklärt, wer Namensgeber unserer Schule gewesen ist. Wir finden es selber heraus: Frankfurter Zoologische Gesellschaft, Tiere Tiere Tiere, Zählungen, und Einheimische, die deswegen das Paradies verlassen mußten. Safari, ursprünglich eine Reise des Menschen, in Ostafrika: seine Reise zu den Tieren.
Als wir Kenia verlassen müssen, heulen wir am Jomo-Kenyatta-Airport, weinen während des gesamten Fluges und verbringen die ersten Jahre in Kaltland in Gedanken an eine baldige Rückkehr. Wir feiern Retro-Parties in Bad Honnef und Wolfratshausen, Jambo jambo bwana, Malaika und immer wieder Cocain. Aber Spliffs sind in Kaltland schwer zu besorgen. Wir leiden eine Weile, dann finden wir uns zurecht. Wir sind gewappnet für die globale Welt, denn was von der Schulzeit bleibt, ist gelebte Vielfalt. Das Aufwachsen in mehreren Sprachen. Die selbstverständliche Existenz des Anderen. Der umgekehrte Blick auf vermeintliche Wahrheiten. Die Erfahrung, daß man mehrere Heimate (›Plural selten‹, sagt Brockhaus Wahrig) und eine dynamische Identität besitzen kann. Wir haben uns zurechtgefunden. Trotz der Unkenrufe manch eines Lehrers, das Niveau in Kenia sei dem Niveau in Deutschland unterlegen, sind die meisten von uns heute überdurchschnittlich erfolgreich. Ein weiter Horizont und eine kulturelle Kompetenz sind halt nützlicher als das Beherrschen der Differentialrechnung. Da, wo sich die Deutschen Auslandsschulen dem Land und dem Kontinent, in dem sie sich befinden, öffnen, wo sie das Ghetto verlassen und eine kulturelle Dynamik ermöglichen, die von Fluß zu Zusammenflüssen führt, da sind sie großartig. Doch dort, wo sie nur Deutschland importieren und unter die Schüler verteilen wie einst Lufthansa alljährlich ihren Weihnachtsstollen, da sind sie so wirkungsarm wie ein altes Schulbuch, das man nie wieder aufschlagen wird.
Neulich saßen wir zusammen in Los Angeles. Sechs Erwachsene, die Hälfte einer Klasse, die 1984 das Abitur abgelegt hat. Zwei Deutsch-Türkinnen, eine Äthiopierin, eine Anglo-Ghanaerin, ein Deutsch-Amerikaner und ein Deutsch-Bulgare. Es war ein unwirklicher Abend, so unwirklich wie jeder Abend am Rodeo Drive. Wir redeten uns die Erinnerungen warm, auf Deutsch, auf Englisch, und eingeworfen einige kenianische Wörter, die man nicht übersetzen und nicht ersetzen kann, Wörter wie aterere und pole sana, squashed banana. Wir feierten das Unvergängliche. Eine Frau trat an unseren Tisch, eine marketing executive von Omega, und fragte uns, woher wir denn kämen. Wir lachten auf. Eine schwierige Frage, erwiderten wir, die Antwort wäre abendfüllend. Was für eine seltsame Sprache wir sprächen. Ein Gemisch, antworteten wir. Woher wir uns denn kennen würden. Aus der deutschen Schule in Nairobi, erklärten wir im Chor. Wir sahen uns an und schmunzelten, ein wenig überrascht von dem jubilierenden Ton. Es hatte fast patriotisch geklungen. Wir prosteten uns zu und stürzten uns wieder ins tiefe Becken der Erinnerung.
Oscar in Afrika
Nairobi 1982
»Haben Sie schon einmal eine Tribüne von hinten gesehen? Alle Menschen sollte man – nur um einen Vorschlag zu machen – mit der Hinteransicht einer Tribüne vertraut machen, bevor man sie vor Tribünen versammelt. Wer jemals eine Tribüne von hinten anschaute, recht anschaute, wird von Stund an gezeichnet und somit gegen jegliche Zauberei, die in dieser oder jener Form auf Tribünen zelebriert wird, gefeit sein. Ähnliches kann man von den Hinteransichten kirchlicher Altäre sagen; doch das steht auf einem anderen Blatt.«
Günter Grass, Die Blechtrommel
Von den vielen ungewöhnlichen, unerwarteten Begegnungen meines Lebens war keine so unvergeßlich wie jene mit Oscar, an einem Sonntag, der sich müde über die sonnige Schwelle unseres Häuschens gelegt hatte. Ich war es gewohnt, sonntags gegen 10.30 einen reinlichen Gesang zu vernehmen, der den Hügel gegenüber unserem Grundstück hinabfloß, und wenn ich meinen Kopf zur Tür herausstreckte, erblickte ich stets eine Kompanie weißgekleideter Damenschaften, zugeknöpft bis oben hin, ihre Schatten im schiefen Gleichschritt, sechs in einer Reihe und sechs Reihen. Jeden Sonntag staunte ich über diese gleichmäßigen Schatten, die alle paar hundert Meter mit dem Gesang stehenblieben, worauf die Kompanie schwankte, bevor der Gesang erneut aufbrauste und das Gleichmaß sich wieder in Bewegung setzte – die Heilsarmee, auf dem Weg zu ihrer allwöchentlichen Versammlung. Doch an diesem besonders trägen Sonntag vernahm ich, zur üblichen Uhrzeit, etwas Ungewohntes, ein Rauschen zunächst und dann einen schrillen Ton. Auf der Hügelkuppel stand nicht wie gewohnt die Heilsarmee, sondern ein wilder Haufen von zerzausten, zerlumpten Kreaturen, das Haar zottig, im Unsinn aller Farben gewandet, in alle Richtungen ausgefranst. Neugierig rannte ich zum offenen Tor, und zu meiner Überraschung bogen sie in unsere kleine Straße ein. Vorneweg marschierte ein Junge mit einer Trompete am Mund, sein Instrument kannte nur zwei Töne, einen waagerechten und einen senkrechten, und abgesehen von diesem zweifachen Ton, der sich nach keinem erkennbaren Morsealphabet richtete, ertönte keine der üblichen Internationalen der Frommen. Vor mir angekommen, setzte der Junge die Trompete ab, und augenblicklich stand der Haufen hinter ihm still.
Ich bin O-Scar, stellte er sich vor, so eigenwillig ausgesprochen, als wäre das O am Anfang ein Ausdruck der Verwunderung über die eigene Existenz, und der Rest seines Namens der Versuch, diese zu verwinden. Aber sein Name war nicht das Bemerkenswerteste an diesem Trompeter. Seine Hautfarbe war bleich, seine Gesichtszüge jedoch afrikanisch.
– Sind Sie ein Albino? fragte ich.
– O nein, mein Bester, Sie sollten sich nicht so bereitwillig auf Ihre Beobachtungskunst verlassen. Ich bin ein Farbverweigerer.
– Sie sind absichtlich so … hm … blaß ums Gesicht?
– Ich habe mich darauf kapriziert. Wissen Sie nicht, auch die schwarzen Babys kommen hellhäutig zur Welt, das sieht man unseren Handflächen an – er unterbrach seine Rede, um einen Ton hinauszuträllern, worauf der ganze Haufen die Handflächen in die Höhe hob und mit imaginären Kastagnetten klapperte –, doch ich beschloß kurz nach meiner Ankunft hierortens bei diesem Unfug nicht mitzumachen …
– Welcher Unfug?
– Die Unterscheidung zwischen weiß und schwarz. Überflüssige Angelegenheit, finden Sie nicht auch, da kann man doch mal trotzig werden.
– Und was machen Sie jetzt, wo ziehen Sie hin?
– Nicht hin, nur umher, wir pfeifen auf falsche Ordnung, wir stellen alles auf den Kopf.
– Was soll das heißen?
– Das werden Sie gleich sehen.
Und er schmunzelte mich an wie jemand, der genau über das Schicksal Bescheid weiß. Dann zog er etwas aus seinem Hosensackerl und leckte daran, bevor er es mir entgegenstreckte.
– Was ist das denn?
– Gelbwurzel.
Nun sprach eine gelbe Zunge zwischen eingegelbten Zähnen.
– Sie müssen verstehen, die Farbe der Lust ist gelb.
– Lust ist doch keine Sünde, unterbrach ich ihn.
– Auch Tugenden besitzen Farben, widersprach er und gab mir sein breitestes gelbes Lächeln.
– Ich weiß nicht so recht.
– Sie müssen noch so viel lernen, mein Bester. Auf ein Nächstes!
Völlig unvermittelt drehte er sich um und blies wieder einen Ton und dann den nächsten, der Haufen setzte sich neuerlich in Bewegung und war keinen Steinwurf entfernt, da schluchzte es ein »Halleluja«, nicht stimmlich hinausposaunt, wie ich es von der Heilsarmee gewohnt war, mitnichten, dieses Halleluja war aspiriert, eine behauchte Lobpreisung, ein Lüftchen, das dem Ausatmen folgt, und es kam offenhörig aus dem Schattenreich der Geräusche, und es öffnete alles, was ihm im Wege stand, alles, was sich ihm verschloß. Aber das begriff ich erst später am Tage, als meine Mutter weder das Tor verschließen konnte noch irgendeine der Türen, auch nicht die Bar, die stets niet- und nagelfest gehalten wurde, weil die Dienstboten dem Tonic nach dem Gin trachteten, und an der Kreuzung nebenan sprang die Ampel nicht mehr auf Rot, und die Läden im Lavington Green Shopping Center ließen sich nicht mehr vergittern, und die indischen Händler mußten in ihren Kolonialwarenhöhlen ausharren, Unmengen Mukhwas kauend, so daß am nächsten Morgen nicht nur ihre Läden, sondern auch der Parkplatz davor und das Rugbyfeld der anliegenden Schule vom Anisgeruch durchfüttert waren, und mir wurde klar: wo Oscar einmal gefistelt hatte, da schloß sich nichts mehr, da kam nichts mehr zum Abschluß.
Am nächsten Sonntag nahm mich Oscar mit ins Stadion. Auf zum Uhuru Stadium, sagte er knapp, dort tritt einer auf, dem das Predigen gelegt werden muß.
Zu meiner Überraschung erwies sich der Prediger als ein Deutscher, ein Mann namens Bonnke, der auf den Plakaten vor dem Stadion das siegesgewisse Lächeln eines Dompteurs an den Tag legte. Ich weiß nicht mehr, wie es ihm gelang, aber Oscar schleuste mich auf die Pressetribüne, wo ich mir Mühe gab, wie der eifrige Reporter einer Schülerzeitung zu wirken. Neben mir saß ein Mitarbeiter der Zeitung Der Wunderheiler, so vermutete ich, denn er hatte eine vorgedruckte Tabelle vor sich ausgebreitet. Offensichtlich war ihm die Verantwortung übertragen worden, die Wunder zu protokollieren. Da waren Spalten für Lahme, die zum Laufen, Stumme, die zum Sprechen, Blinde, die zum Sehen und Taube, die zum Hören gebracht wurden, vier horizontale Spalten, und querbeet wurden ortsabhängig die Leistungen von Bonnke notiert, insgesamt 27 Geheilte in Lusaka, 32 in Lilongwe und nur 17 – ein bescheidener Tag – in Dar-es-Salaam. Die Veranstaltung hatte wohl schon vor einiger Zeit begonnen, denn auch die Kästchen für Nairobi verzeichneten schon einige Striche. Die Stimme des Predigers schallte durch das Rund, er selbst war aber kaum zu sehen. Er stimmte gerade ein Hymne an, da hörte ich einen Ton, der durch Wahn und Glaube drang, einen mir inzwischen wohlvertrauten Ton, der in die Lautsprecheranlage kroch und pfeifend herausschnellte, so grell, daß dem Protokollführer neben mir der Griffel aus der Hand fiel. Alle um mich herum drückten ihre Handflächen gegen die Ohren, und als sie erkannten, wie schutzlos sie gegen den Oscar-Ton waren, sprangen sie auf und hetzten zu den Ausgängen, wie auch die Sänger auf der Bühne auseinanderspritzten, wobei ihre purpurnen Talare im Wechselwind des Chaos hinterherflatterten. Und das letzte, was ich sah, bevor auch ich Zuflucht suchte vor dem waagerechten und dem senkrechten Pfiff, der inzwischen wirbelnd das ganze Stadion erfaßt hatte, war das Niedersinken des Wunderheilers.
Am nächsten Tag stand in der Zeitung The Daily Nation zu lesen, der verehrte Pastor Bonnke, Heiler der Verzweifelten, sei schwer erkrankt, ein mysteriöser Anfall, der ihn nicht nur gelähmt, sondern ihm auch Sprache, Sicht und Gehör geraubt habe. Seitdem, wann immer ich verzweifele an den ungerechten Merkwürdigkeiten des Lebens, entsinne ich mich des zweifachen Trompetentons, der alles auf den Kopf stellen kann, und horche fest hinaus, in der Hoffnung, daß er noch nicht aus der Welt entklungen ist.
Eine Antonow über dem Niger
Guinea. Frühjahr 1994
Als ich den Niger kennenlernte, war er so klein wie eine eingegrabene Steppenschlange und ich so verängstigt wie ein Zivilist in einer ausgemusterten Militärmaschine. Tausend Meter über dem Fluß führte mich Nikolai Goworitsch in die Sprachen Westafrikas ein, an Bord einer Antonow, die den russischen Afghanistankrieg überlebt hatte, um nun Beamte, Händler, Entwicklungshelfer und Menschen wie mich durch Guinea zu fliegen. Nikolai entnahm seiner Hemdtasche ein abgegriffenes Papier, das sich als zigfach zusammengefaltet erwies: sein Notizbuch, an den Falten eingerissen, an den Ecken zerfranst, zu drehen, zu wenden und aufzuklappen, bis die gesuchte Sprache, wozu auch immer benötigt, gefunden wurde. Die Miniaturschrift des Flugingenieurs verzeichnete links von der Mitte das Einmaleins der Höflichkeit auf Russisch – zdrastwuite, spasiba, dosvidanije – und rechts von dem linealgeraden Mittelstrich die Entsprechung auf Bambara, Wolof, Malinke, Kissi, Fula und Soussou. Das Mondgesicht lächelte mich an.
– Mit einigen Worten kannste lange Gespräche führen. Auf Bambara. Antjie. Merk dir das, wird dir nützlich sein, antjie. Mal auf der ersten, mal auf der zweiten Silbe betonen. Dazu lächeln und mit dem Kopf nicken.
Er faltete die Seiten so auseinander und wieder zusammen, daß sich eine leere Seite zeigte. Für eine neue Sprache schien immer Platz zu sein. Er zog einen Strich, und auch dieser Strich geriet – angesichts der wackelnden Antonow wundersam – gerade.
– Und nun…Deutsch!
– Aber das ist doch keine westafrikanische Sprache?
– Macht nichts, macht gar nichts. Ich sammle alle Sprachen.
Wieder faltete er auf und um und präsentierte mir weitere, unvermutete Schätze: Griechisch, Arabisch, Ungarisch und Dänisch.
– Los geht’s. Wir sind gleich in Siguiri.
Wir fingen an.
Guten Tag.
Wie geht es Ihnen.
Gut, danke.
Wohin fahren Sie?
Gesundheit!
Zwanzig Worte und Phrasen später erreichten wir ›Auf Wiedersehen‹. Nikolai steckte seine internationale Sprachfibel wieder ein.
– Harascho.
Kaum waren wir in Siguiri gelandet und die Antonow mitten auf dem Rollfeld zum Stehen gekommen, eilten die Russen hinaus, um Larry zu begrüßen, einen kanadischen Missionar, der in dem islamischen Norden des Landes seit vier Jahren unverzagt seinen Dienst tat. Larry war unter den Weißen in Guinea eine legendäre Figur, denn bevor er nach Siguiri abkommandiert wurde, hatte er sechs Jahre lang in Kankan gewirkt, in der moslemischen Hochburg des Landes, im Schatten der islamischen Universität. Wie die meisten Missionare, die mir über die Jahre in Afrika begegnet sind, hält er die Fremden, die er immer weiterziehen sieht, mit einer gütigen Ausstrahlung auf Distanz.
Auf dem Rollfeld war es fast unerträglich heiß, aber Sarah, Larrys Tochter, strahlte vor Glück – die Russen hatten ihr einen Hasen mitgebracht.
– Zajek.
Nikolai hatte den Hasen unter den Vorderbeinen gepackt, als wollte er ihn impfen.
– Rabbit, sagte Larry zu seiner Tochter, und zu mir: Nice to meet you.
– Rabiet? wiederholte Nikolai, und ich wartete auf den Griff an seine Hemdtasche.
– A beautiful white rabbit. Was macht Conakry?
Larry erhielt murrende Antwort. Sarah zupfte ungeduldig an seiner Hose, wollte wissen, wie sie den Hasen nennen sollte.
Hi Sergei, Nikolai, Dimitri. Larrys Frau kam über die Landebahn gelaufen, zwischen ihren Armen ein großer Korb. Nachdem sie jeden der Russen umarmt hatte, griff sie in den Korb und holte runde Brote heraus, deren frischgebackener Duft sich über den staubigen Geruch des Harmattan legte. Auf der anderen Seite des Flugzeugs, vor dem Flughafengebäude, lehnte ein einsamer Korb voller Baguettes an einer hüfthohen Absperrung, die Brote ordentlich und aufrecht aneinandergereiht, als wären sie französische Soldaten, die der Kolonialismus zurückgelassen hat. Über die Laderampe im offenen Hinterteil der Maschine wurden Säcke ausgeladen. Die Russen betrachteten das Treiben und die Hektik um sie herum mit stoischer Ruhe, als hätten sie jeden Anspruch darauf, eigene Vorstellungen durchzusetzen, längst aufgegeben.
– Es ist hart, wir versuchen die Stellung zu halten, erklärte mir Larry sparsam.
Nikolai versuchte derweil Sarah zu erklären, daß der Hase Schatten brauchte. Sie streichelte sein Fell.
– Ich hab einen Namen: Ich werde ihn Heinz nennen.
– Heinz? Nennt ihr so eure Hasen in Kanada?
Der Kopilot zog eine Augenbraue belustigt in die Höhe.
Die schwereren Säcke erforderten die kräftige Mithilfe einiger Passagiere. Nikolai und ich schlenderten zur Laderampe und betrachteten das Schwitzen. Nikolai schüttelte den Kopf.
– Schon wieder überladen. Das Flugzeug ist ständig überladen. Neulich warteten in Siguiri 21 Passagiere, jeder mit einem Ticket, aber wir hatten nur acht freie Plätze. Was sollten wir tun? Jeder von ihnen hatte einen triftigen Grund, mitfliegen zu müssen. Wir haben alle mitgenommen. Wer keinen Platz bekam, saß auf dem Gang.