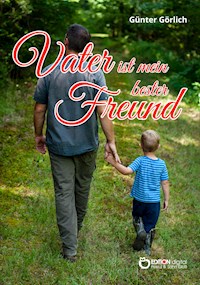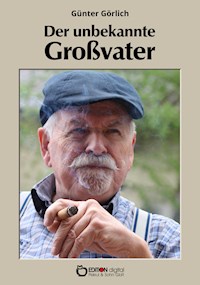7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Diese Situation muss man sich mal aus der Sicht des Opfers vorstellen: Es ist ein Februartag und es ist der kälteste Winter seit dreißig Jahren, wie die Zeitungen schreiben und die müssen es wissen. Die Briefträger haben weniger zu schleppen, denn die Zeitungen sind dünner geworden, weil die Papierfabriken weniger Kohle einbunkern können und deshalb ihre Maschinen gedrosselt haben. Ein Mann kommt die Straße herauf. Er muss jung sein, denn er trägt bei diesem Wetter keine Mütze. Sein Haarschopf aber ist dick und wild. Den Mantelkragen hat er hochgeschlagen. Etwas vornübergebeugt läuft er, weil der Wind ihm die nassen Schneeflocken ins Gesicht treibt. Vielleicht geht er deshalb auch so langsam. Da fliegen ihm Schneebälle entgegen, darunter auch drei harte Eisklumpen aus verharschtem Schnee. Sie treffen den jungen Man am ungeschützten Kopf. Warum läuft er nicht weg? Noch mehr Schneebälle fliegen und treffen. Aber der Mann lässt nur die Arme sinken. Er schwankt und droht mit den Fäusten. Die Angreifer sind vier Jungs aus der 5a, die für eine Schneeballschlacht gegen die 5b am nächsten Tag trainieren, ihr Anführer ist der elfjährige Rainer, auch Bürste gerufen. Rainer brüllt jetzt: „Der ist betrunken. Deckt ihn ein.“ Wieder wirft er und trifft. Auch die anderen sind näher gekommen und werfen wie besessen. Da bemerkt Rainer, wie der Mann die Arme hochwirft und loslaufen will. Ein paar Schritte schwankt er vor, dann fällt er schwer nach hinten. Sein Mantel plustert sich auf. Der Mann setzt sich jetzt auf. Und Rainer starrt auf das Bein des Mannes, der auf der schneebedeckten Straße hockt. Die Hose hat sich hochgeschoben. Dieses Bein ist kunstvoll aus Holz und Leder gearbeitet. Rainer will sich bei dem jungen Mann entschuldigen. Gerade noch kann er im Schneetreiben am Ende einer Straße mit alten Häusern die Gestalten des jungen Mannes und seiner Helfer erkennen. Es ist die Albertstraße. Als er dort von einer alten Frau überrascht wird, zählt er viele Ideen auf, wie die Pioniere alten Menschen im Winter helfen können: Kohlen und Kartoffeln nach oben schleppen und für sie einkaufen. Den Fremden findet er zunächst nicht, dafür einen Mann, der aussieht wie Karl Marx und vielleicht ein Held ist. Rainer entdeckt in der Wohnung von Karl Marx etwas sehr Spannendes, das genau über dem Sofa hängt … „Der Fremde aus der Albertstraße“ ist eine abenteuerliche Geschichte über Mut und Mut zur Wahrheit, über Solidarität und Kollektivgeist – für Mädchen und Jungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Der Fremde aus der Albertstraße
Eine abenteuerliche Geschichte für Mädchen und Jungen
ISBN 978-3-96521-675-4 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1966 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Für Leser von 10 Jahren an.
© 2022 EDITIO digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Die vergessene Baubude
Die Eisblumen an den Fensterscheiben beginnen abzutauen. Sie schmelzen sehr langsam. Noch steckt die Kälte in Glas und Stein. Seit dreißig Jahren ist das der kälteste Winter, schreiben die Zeitungen – und die müssen es wissen. Die Briefträger haben weniger zu schleppen, denn die Zeitungen sind dünner geworden, weil die Papierfabriken weniger Kohle einbunkern können und deshalb ihre Maschinen gedrosselt haben.
Heute knirscht der Schnee nicht mehr unter den Schuhsohlen. Er pappt und lässt sich gut kneten. Rainer streift sich die dicken Fäustlinge ab und schlägt die Ohrenklappen seiner Pelzmütze hoch und spottet über die Freunde.
„He, ihr Zimperliesen! – Handschuhe von den Pfoten. Männer wollt ihr sein?“
Elf Jahre alt ist Rainer. Weil er groß ist und dünn, glaubt man, der Wind könne ihn umpusten. Das ist eine Täuschung. Am besten wissen das die drei anderen: der ernste Ede, der Mäcki mit dem Vollmondgesicht und der kleine, magere Schimmel. So ziehen sie auch ihre Handschuhe aus.
Rainer stampft mit seinen festen Skistiefeln den Schnee. Mutter hat sie ihm zu Weihnachten geschenkt.
Damals sagte sie so nebenbei: „Wenn du die Stiefel nicht jeden Tag putzt, hat’s keinen Zweck, dass du sie behältst.“
Mutter kennt seine große Schwäche.
Der Februartag ist wolkenverhangen. Auf einer weiten, verschneiten Fläche steht einsam eine halbverfallene Baubude. Aus irgendeinem Grunde ist sie nicht abgerissen worden, als der letzte Hochblock fertiggebaut war, und nun steht sie genau in der Mitte zwischen den zehnstöckigen Häusern und den alten, grauen Mietskasernen. Die Baubude erinnert daran, dass hier einmal Tag und Nacht Bagger schaufelten, Kräne schwenkten, schwere Lastkraftwagen rollten – dass es hier immer nach Kalk und Mörtel, nach Beton roch. Jetzt ist die Baubude ein Ziel für die Schneebälle, und das ist zu sehen, so viele kleine weiße Buckel kleben daran.
Rainer schreit mit heiserer Stimme: „Salve! Feuer!“ Vier Schneebälle zerplatzen mit dumpfem Aufschlag an den morschen Brettern. Rainer kneift die Augen zusammen. Über seiner Nase steilt eine Falte.
„Ist langweilig“, sagt Mäcki, „im Fernsehen läuft jetzt ein dufter Film.“ Rainer blickt wütend von oben herab auf Mäcki, denn der ist einen Kopf kleiner, dafür aber so dick wie eine kleine Tonne. Er isst unwahrscheinlich viel Kuchen. Mäcki blinzelt jetzt mit seinen blauen Augen. Vielleicht zwackt die Schneeluft? Oder ist Rainers Blick so böse?
„Üben müssen wir, Dicker … Immer üben. Zufällig hast du die Bude getroffen. Wie sollen wir morgen dastehen? – He, du Nase?“ – Rainer wirft hintereinander drei Bälle. Eng sitzen sie alle nebeneinander.
„Pause“, sagt Ede missmutig und scharrt Schnee zusammen, „ob wir überhaupt morgen was zu melden haben?“ Auf Rainers Stirn vertieft sich die Falte.
„Und dir Schimmel“, fährt er den vierten in ihrem Bunde an, „dir läuft die Nase!“
Schimmel heißt eigentlich Schimmelpfennig. Klein ist er und blass im Gesicht, darin zwei schmale, gelbe Augen. Schimmel ist ein großer Schweiger – aber auch ein guter Zuhörer.
Umständlich angelt er ein Tuch aus der Hosentasche. Die Nase läuft wirklich. Er muss sie ausschnauben. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Ede stößt ihn in die Rippen, dass er fast in den Schnee fällt.
„Mit dem Pioniertuch wischt sich der die Nase …“
Schimmel starrt auf das blaue, zerknitterte Tuch, dann hilflos auf die anderen. Mäcki lacht. Schimmel untersucht seine Taschen. Ein Taschentuch findet er nicht. Rainer holt ein sauberes Tuch hervor.
„Hier, nimm meins“, sagt er, „das Halstuch her. Morgen muss es geplättet sein. Ich geb’s meiner Mutter.“ Schimmel schnäuzt sich gewaltig und lange. Schön lässt es sich in ein sauberes Tuch schnäuzen. Schimmel hat manchmal kein Taschentuch, und oft fehlt ein Knopf, oder ein Loch in der Hose ist nicht gleich geflickt. Seine Mutter ist krank.
Das längste Schnäuzen geht mal zu Ende – und nun stehen sie da und haben keine Lust mehr, die vier getreuen Musketiere der 5a. Morgen soll die auf Tafeln und selbst geschriebenen Plakaten angekündigte große Schneeballschlacht gegen die 5b auf dem Schulhof toben.
Die Augen Rainers, des Hauptmanns der getreuen Musketiere, verengen sich, als er daran denkt.
Der Pionierhäuptling ihrer Klasse ist ein Mädchen. Es hört auf den verrückten Namen Marion. Überhaupt sind mehr Mädchen in der 5a als Jungen. Das ist ein Unglück. Marion will immer nur Lieder singen, basteln oder Ansprachen halten. Friedlich muss es zugehen. Blaue Augen darf es nicht geben. Aber die freche Herausforderung der 5b hat sie sofort angenommen. Vom Lehrertisch hat sie die Sache verkündet, wie ein Marschall, nur eben mit piepsiger Stimme. Eine Schneeballschlacht steht bestimmt im Pionierwinterplan, und der muss erfüllt werden.
Aber wer muss an den Kampf denken und wie er ausgehen wird? Rainer und die anderen getreuen Musketiere. Und so getreu sind die auch nicht mehr. Ungemütlich feuchtkalt ist das Wetter – die Bretterbude kein lohnendes Ziel.
Die 5b hat einen besseren Pionierhäuptling, und Rainer ist ihm nicht ganz grün. Benno hechtet im Kopfsprung vom Fünfmeterbrett ins Wasser. Rainer hat das noch nicht geschafft. Nur so springt er, mit den Füßen zuerst. Benno sagte einmal verächtlich: „Wie ein Mehlsack plumpst du ins Wasser.“
Was ist das schon für ein Trost, wenn Rainer weiß, dass er allein aus seiner Klasse es überhaupt wagt, von dort oben zu springen? Wenn Rainer an Benno denkt, fällt ihm immer das Strandbad ein und der Sprungturm. Er malt sich aus, wie er Benno übertreffen wird. Über das Fünfmeterbrett hinaus steigt er die schmale Eisenleiter zum grauen Zehnmeterturm hoch.
Dieser Tag wird kommen. Blauer Himmel. Das Strandbad voller Menschen. Alle von der Heinrich-Heine-Schule sind da, die Lehrer, alle aus der 5a und 5b – auch die Marion in ihrem roten Badeanzug, der so deutlich von ihrem schwarzen Haar absticht – und natürlich der Benno.
Da klettert er, Rainer, langsam den Turm hinauf. Unter ihm ist das Brausen der vielen Menschenstimmen. Da schauen auf einmal alle zu ihm hinauf. Denn er bleibt nicht auf dem Fünfmeterbrett stehen, er klimmt die Leiter ganz hoch hinauf, dorthin, wo er weit unter sich das grüne Wasser sieht.
Auf der Plattform weht ein leichter Wind und kühlt die brennende Haut. Von hier ist der Blick weit. Er geht über das Häusermeer hinweg, aus dem Kirchtürme und Schornsteine aufragen, auch der Fernsehturm und Hochhäuser mit blitzenden Glasscheiben.
Unter ihm ist das Brausen schwächer geworden. Rainer sieht, wie Benno aufsteht und die Hand vor die Augen hält, weil ihn die Sonne blendet. Marion kauert ganz still am Beckenrand. Viele Gesichter starren zu ihm hoch. Rainer tritt vor zum Rand des Turmes. Die Kokosmatte unter seinen Füßen ist rau. Er schließt die Augen …
„Ich hab ’ne Idee!“, brüllt Mäcki.
Grau und dunstig ist der Winternachmittag. Wo ist die Sonne, die raue Kokosmatte, wo der weite Blick vom Sprungturm?
„Was wird das schon für eine Idee sein“, sagt Rainer.
Ede hört auf, Schneebälle zu kneten. Seine Kugeln sind sauber und sehen wie richtige Schneebälle aus. Den verharschten Schnee hat er weggekratzt.
Mäcki sagt: „Na, wir schmeißen eben auf Leute. Autos können wir auch befeuern.“
Schimmel reißt die Augen auf. Ede legt den Kopf schief. Rainer denkt an Benno und an den morgigen Kampf.
„Gemacht, Männer …"
Unter dem Anorak holt er das Opernglas hervor. Die Perlmutteinfassung glänzt matt.
Mäcki bettelt: „Lass mich mal durchgucken.“
Rainer dreht an der Scharfeinstellung. „Immer langsam. Ihr feuert jetzt. Ich beobachte durch meinen Feldstecher. Artilleriebeobachter sozusagen.“
Ede greift schon nach seinen gutgekneteten Bällen.
„Jeder kann mal Beobachter sein“, tröstet Rainer.
Schneebälle fliegen.
Die vier Scharfschützen sind neben der alten Baubude in „Stellung gegangen“.
„So heißt das im Manöver“, erklärt Rainer. Mädchen kreischen. Frauen schimpfen und drohen. Aus dunklen Wolken fällt nasser Schnee. Schimmels Backen glühen vor Eifer. Mäcki schnauft. Er ist eben zu dick. Ede wirft gelassen und verzieht keine Miene.
Rainer starrt durch sein Opernglas. Er kommandiert: „Mäcki, weiter schmeißen, weiter … Ede, gut getroffen. Der Hut ist vom Kopf. Prima.“
So schreit er eine Weile. Auf einmal verstummt er, lässt das Fernglas sinken und verstaut es hinter dem Reißverschluss. Er geht zu den anderen und sagt: „Pfeifen sind wir. Große Feiglinge.“ Schimmel lässt den Schneeklumpen, den er in der Hand hält, fallen. Mäcki guckt an Rainer vorbei. Ede reibt sich die Hände trocken.
„Keine große Kunst, auf Mädchen zu schmeißen. Kein Mut ist dabei. Langweilig“, erklärt Rainer, und weil die anderen nicht antworten, wiederholt er wütend: „Kein Mut ist dabei. Tatsache!“ Mäcki will seine Idee verteidigen.
„An die Bretterbude knallen ist langweilig.“
Rainer schiebt die Pelzmütze in die Stirn. Unter dem Fell glänzen seine Augen wie schwarze Punkte. Mit der Hand zeigt er die Straße hinauf.
„Den da“, sagt er, „den befeuern wir.“
Die Straße herauf kommt ein Mann. Er muss jung sein, denn er trägt bei diesem Wetter keine Mütze. Sein Haarschopf aber ist dick und wild. Den Mantelkragen hat er hochgeschlagen. Etwas vornübergebeugt läuft er, weil der Wind ihm die nassen Schneeflocken ins Gesicht treibt. Vielleicht geht er deshalb auch so langsam.
Mäcki zieht den Kopf ein. Jetzt hat er keinen Hals mehr, nun ist er eine richtige Kugel. Schimmel schnieft und sagt sogar etwas. „Der kann vielleicht ganz gut rennen.“
„Na und? Da wird’s erst richtig“, entgegnet Rainer.
Ede blickt schweigend auf den näher kommenden Mann.
Rainer spürt wieder die Wut.
„Ich stell mich weiter vorn hin. Mich hat er zuerst. Na, seid ihr jetzt zufrieden?“
Er stapft los, wartet auf keine Antwort. Dem jungen Mann läuft er entgegen, knetet dabei drei Bälle aus verharschtem Schnee, die hart sind wie Eisklumpen.
Er wirft mit voller Kraft und sieht, wie der Mann am Kopf getroffen wird. Schneebälle fliegen, und manche treffen. Der Mann hält die Arme schützend vor den Kopf.
Rainer duckt sich schon, will fortlaufen, weil der Mann doch jetzt wach werden muss, losspringen wird.
Aber der Mann lässt nur die Arme sinken. Er schwankt und droht mit den Fäusten.
Rainer brüllt: „Der ist betrunken. Deckt ihn ein.“
Wieder wirft er und trifft. Auch die anderen sind näher gekommen und werfen wie besessen. Am lautesten schreit Mäcki. Aber er bleibt am dichtesten an der Baubude. Hinter der Bude kann man schnell verschwinden.
Da bemerkt Rainer, wie der Mann die Arme hochwirft und loslaufen will. Ein paar Schritte schwankt er vor, dann fällt er schwer nach hinten. Sein Mantel plustert sich auf. Rainer hat noch einen Eisball in der Hand, blickt auf den gestürzten Mann und denkt: Das war wieder nichts. Der ist ja betrunken.
Der Mann setzt sich jetzt auf.
Mäcki schreit: „Renn, Bürste. Da kommen welche.“
Aber Rainer steht wie festgeklebt. Er starrt auf das Bein des Mannes, der auf der schneebedeckten Straße hockt. Die Hose hat sich hochgeschoben.
Dieses Bein ist kunstvoll aus Holz und Leder gearbeitet.
In Rainers Faust beginnt der Eisball zu schmelzen. Der Junge sieht nur noch das künstliche Bein.
Dann sind Leute bei dem Gestürzten, helfen ihm auf die Füße. Er schwankt, wehrt ab und klopft sich den Mantel sauber.
Da stürzt Rainer davon. Hinter der Baubude sieht er die ängstlichen, gespannten Gesichter seiner Freunde.
Mäcki flüstert: „Den haben wir aber eingedeckt.“
Rainer zerrt sein Opernglas hervor. Er sieht, wie der junge Mann davongeht, begleitet von einer Frau und einem Mann. Sie wollen ihn wohl stützen. Aber er schüttelt den Kopf. Rainer kann nur den Hinterkopf sehen. Das Haar ist dunkel und störrisch. Schnee ist noch im Haar. Der junge Mann spricht mit seinen Helfern. Sicher bedankt er sich. Rainer meint auch zu hören, was die Leute jetzt sagen.
„Die verdammten Lümmel. Feige und schlecht erzogen. Roh sind sie und böse.“
Wie sollen die Leute auch anders sprechen?
Rainer haucht das Opernglas an und reibt es blank.
Schimmel sagt strahlend: „Das war dufte.“ Mäcki kräht: „Ich hab schon gedacht, jetzt haben sie dich. Wie du so stehenbleiben konntest. Hast Nerven.“
Rainer kneift die Augen zusammen, dass sie schmerzen. Ede lehnt gleichmütig an der Bretterwand.
Rainer stößt ihn an. „Was sagst du nun, Ede?“ „Warum musste der auch gerade beschwipst sein.“ Da weiß Rainer, nur er hat das Bein aus Holz und Leder gesehen.
Er stopft sein Opernglas unter den Anorak.
„Macht’s gut. Bis morgen“, sagt er zu den anderen. Im Schneetreiben läuft er auf die Straße zu, an deren Ende er noch die Gestalten des jungen Mannes und seiner Helfer erkennen kann.
Die Freunde werden ihm nachstarren und nichts begreifen.
Schreck im dunklen Hausflur
Rainer läuft, die Arme angewinkelt, das Schwergewicht auf ein Bein verlagernd, wie er sich das im letzten Sommer angewöhnt hat. Er hatte gelesen, dass die Indianer Südamerikas in dieser Weise ungeheure Strecken zurücklegen können, ohne zu ermüden. Aber die Straße ist schneeglatt, der Anorak wiegt ein paar Pfund, und das Opernglas drückt auf der Brust. So biegt er keuchend in die Straße ein, in der nur ein paar Gaslaternen mattes Licht verbreiten. Wie eine dunkle Schlucht ist die Straße, und Rainer hat zwischen den alten Häusern, wenn es dunkel ist, immer ein bisschen Angst.
Im Schneetreiben entdeckt er die Leute vor einem Hauseingang. In diesem Augenblick verschluckt der schwarze Hauseingang eine Gestalt. Rainer ist vom schnellen Lauf heiß geworden. Wer ist im Haus verschwunden? Ist es sein junger Mann?
Der Hauseingang sieht aus wie alle anderen in dieser Straße, dunkel, mit einer hohen, verwitterten Holztür. Verzweifelt sucht Rainer die Hausnummer. Da entdeckt er eine Inschrift in Kellerhöhe.
– Schuhmacher Al… – steht dort geschrieben. Die Schrift war einmal weiß. Vielleicht heißt der Schuhmacher Albert.
Rainer vergisst die Indianerregel. Wie gehetzt läuft er hinter den beiden anderen her. Er überquert die Straße, um die beiden im Schneewind stapfenden Leute zu überholen. Von vorn will er ihnen begegnen, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Unter einer Gaslaterne wartet Rainer. Eine Frau und ein Mann nähern sich. Rainer starrt auf die Füße des Mannes. Die schreiten gleichmäßig. Da wagt Rainer aufzublicken. Der Mann trägt eine Mütze auf dem Kopf. Nun weiß Rainer, dass sein junger Mann im Hausflur beim Schuhmacher Al… verschwunden ist.
Rainer stemmt sich mit seinem ganzen Körper gegen die schwere Holztür. Knarrend gibt sie nach. Dunkelheit ist um Rainer. Er spürt sein Herz pochen, als sei es ein Hammer. Unheimlich erscheint ihm das Haus. Nach feuchtem Keller riecht es, nach morschem Holz, aber auch nach Bohnerwachs. Wo ist nur der Lichtschalter? Irgendwo im Haus bellt ein Hund. Rainer erschrickt, schaut sich nach der Tür um, die er einen Spalt offengelassen hat. Fahles Licht schimmert. Ich kann ja rauslaufen, denkt der Junge. Was will ich nur in diesem dunklen, unheimlichen Haus? Der junge Mann ist aber hier hineingegangen. Vielleicht wohnt er in dem Haus.
Rainer tastet sich an der rauen Wand entlang und spürt zwischen den Fingern, wie die Farbe abblättert. Mit dem Fuß stößt er gegen eine Erhöhung und wäre fast hingefallen.
In diesem Augenblick flammt das Licht auf. Rainer erstarrt und blinzelt hilflos.
Der Hausflur, der zu gleicher Zeit eine Durchfahrt in den Hinterhof ist, erscheint ihm viel kleiner, als er in der Dunkelheit annahm. Trübe brennt die elektrische Lampe, die auch noch einen grünen, verschmutzten Schirm hat. Vor Rainers Nase hängt die Tafel mit den Namen der Hausbewohner.
Die Tafel ist von einem verschnörkelten Rahmen eingefasst. Die Namen sind in verschiedenartiger Schrift geschrieben. Auf so etwas hat Rainer noch nie geachtet, dabei ist er schon oft in alten Häusern herumgestrolcht, meistens mit Mäcki und Ede.
Diese Tafel interessiert ihn sehr. – Otto Raguse – liest Rainer. Ein seltsamer Name. Alle Schilder sind anders beschriftet, darüber wundert er sich. In dem großen Haus, in dem Rainer wohnt, sind alle gedruckt. Hier aber hat jeder seinen Namen selber geschrieben. Otto Raguse zum Beispiel malte seinen Namen einfach auf ein sauberes Stück Pappe, schön mit schwarzer Tusche, so klar und deutlich, dass jeder, der den Otto Raguse hier sucht, das Schild nicht übersehen kann. Auch ein Herr Lehmann schrieb seinen Namen, genau unter Otto Raguse muss er wohnen. Der hat aber so viele Schnörkel um seinen Namen gemalt, dass man geradezu ein Mikroskop braucht, um zu erfahren, dass auch Herr Lehmann in diesem Hause wohnt.
Rainer vergisst bei dem Studieren der Hausbewohnertafel fast, warum er eigentlich in diesen kalten Hausflur schlich. So erschrickt er, als Schritte hinter ihm knirschen. Er sieht eine alte Frau mit einem schwarzen Wolltuch um den Kopf. Dem tapferen Rainer, der seine Freunde immer mit „Männer“ anredet, fallen allerhand Märchen ein, von Hexen und Gespenstern zum Beispiel.
„Hast du die Tür da aufgesperrt?“, fragt die alte Frau mit einer tiefen Stimme.
„Guten Abend!“, stottert Rainer, springt zur Tür und drückt sie zu. In diesem Augenblick bereut er, dass er nicht rausgesprungen ist. Jetzt ist die Tür im Rücken, und die alte Frau steht dicht vor ihm.
„So was Unvernünftiges“, sagt die Frau, und plötzlich fragt sie misstrauisch: „Was treibst du dich denn hier herum? Deinesgleichen hat ja immer Unfug im Kopf und weiß der Teufel noch was.“ Unter dem sclrwarzen Tuch lugt schlohweißes Haar hervor, das Gesicht der alten Frau ist voller Runzeln. Die Augen kann Rainer nicht erkennen, sie liegen tief verborgen in den Augenhöhlen. Die Lampe im Hausflur brennt so trüb.
Rainer scheint es die Sprache verschlagen zu haben.
„Du mit deiner Pelzmütze, du siehst schon aus wie ein Räuber. Bist du etwa einer von denen, die mir vor einer Woche die Schneeschieber gestohlen haben?“
Die Frau rückt näher an Rainer heran. Der sieht jetzt genau die langen schwarzen Fransen des Kopftuches und erinnert sich, dass Großmutter auch so ein Tuch besaß und dass er immer gern Knoten in die Fransen flocht.
Da kommt ihm ein rettender Gedanke. Am Morgen hatte Marion eine ihrer berühmten Ansprachen gehalten. Hochrot im Gesicht stand sie vorn neben dem Lehrertisch und schlug mit dem Lineal auf das Pult, bis Ruhe in der Klasse herrschte. Dann redete sie etwas von alten Leuten in alten Häusern in dieser kalten Zeit.
Rainer interessierte das, wie immer, wenn Marion was sagte, nicht sonderlich. Aber jetzt sagt er rasch zu der alten Frau: „Die Haustafel habe ich mir bloß angesehen. Ich will wissen, wie viel Leute hier wohnen.“
„Was ist denn das nun wieder. Zwölf Familien wohnen im Haus. Willst du vielleicht noch wissen, wann jeder Geburtstag hat? Oder auch, an welcher Krankheit jeder leidet? Wie viel jeder auf seinem Sparbuch hat?“
Die alte Frau ist böse geworden.
Da erinnert er sich an Marions Worte und brummt: „Wie Sie über mich herfallen. Wir wollen doch helfen – wir von den Pionieren. Kohlen tragen und so. Da guck ich mir das Haus eben an. Was sollen wir denn mit Schneeschiebern anfangen.“
Die Frau scheint ein bisschen besänftigt zu sein, denn sie tritt einen Schritt zurück. Rainer atmet erleichtert auf.
„Ach ihr – ihr könnt mit allem was anfangen“, knurrt sie aber noch, „wer hat denn die schönen Bänke im Park weggeschleppt und zerbrochen? Na, warum diese Gemeinheit, wo wir alten Leutchen uns so über die Bänke gefreut haben? Und was die für Geld gekostet haben!“
Rainer ist jetzt froh, dass die grüne Lampe im Hausflur so trübe ist und die alte Frau nicht sehen kann, wie rot er wird. Hatte er nicht auch schon einmal eine Parkbank mit Mäcki und Schimmel ins Gebüsch geschleppt? Sie war verdammt schwer gewesen. Die alte Frau kann wohl nicht Gedanken lesen.
„Helfen wollt ihr – uns alten Leutchen? – Die Stiegen bei uns sind steil. Auch die zum Keller runter. Da hat sich schon mancher ein Bein gebrochen. Ist eben ein altes Haus. Ich wohne schon vierzig Jahre hier. Ja, ja … früher, da bin ich was herumgesprungen … Und wenn’s auf der Straße so glatt ist, da fällt’s uns schwer, zum Kaufmann zu laufen. Ich bin ja noch nicht so, ich bin ja rüstig. Aber die Lehmannsche und die alte Wegelinen …“ Die alte Frau schweigt plötzlich, ihre Stimme ist gut und leise geworden.
Rainer sagt: „Ich werde in der Klasse eine Rede halten. Wir sind dann hier die Helfer.“
„Das ist schön. Wie heißt du denn, Junge?“
„Rainer heiße ich. Bürste werd ich gerufen.“
Rainer hat das gesagt, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders ist.
„Bürste“, wundert sich die Frau, „was ihr so für Namen habt.“ Sie lacht ein bisschen. „Wenn ihr kommt, klingelt bei mir. Ich bin die Melkotten, die Hausmeisterin, weißt du. Hier unten wohn ich.“ Sie zeigt auf eine Tür, zu der ein paar Stufen hinaufführen.
„Ja, wir klingeln bei Ihnen, ganz bestimmt.“
Dann hat Rainer es sehr eilig. Frau Melkott schlürft in ihre Wohnung. Die schwere Tür knarrt wieder in den Angeln. Der Schneewind kneift Rainer in die Backen. Kälter ist es geworden.
Er blickt noch einmal auf das Haus zurück. Grau und unansehnlich steht es in einer Front mit vielen anderen, die auch so aussehen. Dort drin wohnt die alte Frau Melkott, der Otto Raguse, der Herr Lehmann und noch viele andere.
Dort muss auch der junge Mann mit dem Bein aus Holz und Leder wohnen.
Der Fahrstuhl summt in den zehnten Stock hinauf. So hoch oben wohnt Rainer mit seiner Mutter.
Ihm ist nicht sehr wohl zumute. Spät ist es geworden. Als er unten klingelte und Mutter aus dem Lautsprecher fragte, wer da sei, und er leise antwortete: „Ich, Rainer!“, veränderte sich Mutters Stimme merklich.
„Putz dir die Schuhe ab. Schau nach, ob im Briefkasten etwas steckt.“ Das war alles.
Sorgfältig trat er sich die Schuhe ab, vergewisserte sich genau, dass auch kein Schneerest an den Sohlen klebte. Im Briefkasten steckte nur ein Zettel. Darauf stand gedruckt:
„Bürger! Spart Strom! Die Kumpels in der Braunkohle geben ihr Letztes. Denkt daran!“
Den Zettel hält Rainer in der Hand.
Einmal war er mit Mutter nach Leipzig gefahren. Der Zug rollte an einer Landschaft vorüber, die Rainer noch nie gesehen hatte. Wo waren die Wälder, die Felder und Wiesen? Aufgewühlte Erde, riesige Krater. Dazwischen spannten sich elektrische Leitungen. Wie gepanzerte Schlangen rasten seltsame Eisenbahnzüge über die Gleise. Riesenbagger schaufelten.
Mutter sagte: „Das ist unser Gold – die Braunkohle.“
Rainer bat: „Ich will aussteigen. Das will ich mir angucken.“ „Später“, tröstete Mutter, „wenn du groß bist …“ Das ist schon lange her.
Rainer versteht, warum die Leute aufgerufen werden, Strom sparsam zu verbrauchen. Das ist alles auszurechnen. Nur dazu hat Rainer nie die rechte Lust.
Oft spricht Herr Leising über den Bergbau mit Begeisterung, weil er selber Kumpel in der Steinkohle war. Herr Leising unterrichtet in Deutsch.
Bei ihm ist es sehr interessant, weil er viel zu erzählen weiß. Rainer mag ihn gern. Er hat alle Menschen gern, die sich richtig freuen und ärgern können. Auch schimpfen, wenn es nötig ist. Das alles kann Herr Leising. Kraft hat Herr Leising auch. Zwanzig Klimmzüge schafft er. Und ihr Klassenlehrer ist er obendrein. Rainer wird morgen den Zettel an die Tafel kleben. Herr Leising wird sich freuen und sicher etwas über die Kumpel erzählen.
Vor der Wohnungstür schabt Rainer noch einmal seine Schuhe ab. Mutter öffnet die Tür. Sie ist groß und sieht frisch aus, als sei sie gerade nach einer guten Nacht aufgestanden. Dabei hat Mutter den ganzen Tag gearbeitet. Sie ist Richterin. Das große Gebäude, in dem Mutter arbeitet, gefällt Rainer nicht. Es ist aus dicken, dunklen Steinquadern gebaut, und auf dem Dach sind überall Türme hingestellt. Mutter aber gefällt das Haus, weil sie darin arbeitet. Doch Rainer ist hartnäckig, und Mutter hat zugeben müssen: Nun ja, es ist altmodisch. Früher war der Geschmack der Leute anders. Da war eben das modern. Es musste geprotzt werden. Seinen Zweck aber erfüllt’s noch gut. Bis jetzt haben wir kein besseres.
Mutter blickt heute streng. Sie sagt: „Das Abendessen steht auf dem Tisch. Der Tee wird kalt sein. Die Bockwurst auch.“ „Das ist ja nicht so schlimm“, erwidert Rainer.
Mutter meint: „Du musst mir Bescheid sagen, wenn du später kommst.“
Dann nimmt sie Rainer die Jacke ab, die feucht und klamm ist, und entdeckt dabei das Opernglas. Sie schüttelt den Kopf.
„Ich habe beobachtet. Die Vögel im Park.“
„Na, schwindelst du nicht, Rainer?“
Er geht schnell ins Bad, wäscht sich lange und sorgfältig die Hände, viel sorgfältiger als sonst. Mutter zu beschwindeln, das ist so eine Sache. Das gelingt ihm nicht oft. Er will das auch nicht. Aber soll er erzählen, dass er Artilleriebeobachter war. Und dass es doch gut war, das Opernglas mitzunehmen. Sonst hätte er nicht entdeckt, dass der junge Mann nur ein Bein hat. Und überhaupt. Die Vögel im Park hat er wirklich schon öfter beobachtet. Sehr still ist es im Zimmer. Mutter sitzt am Schreibtisch neben der gelben Lampe und liest und schreibt manchmal etwas in ein Heft. Sie liest und schreibt oft bis in die Nacht hinein. Rainer kaut seine Bockwurst. Sie ist noch schön warm. Auch der Tee ist heiß. Rainer liebt diese Abende.
Auf Mutters Schreibtisch steht eine Fotografie. Rainer weiß, dass der Mann, der dort lächelt, sein Vater ist. Er ist schon vor vielen Jahren gestorben. Rainer erinnert sich nur schwach, dass es da einen Mann gab, der oft lachte und wenig zu Hause war.
Das Bild betrachtet Rainer immer mit Scheu.
Einmal fragte er Mutter:
„Warum ist Vater gestorben?“
Mutter sagte langsam: „Er war schwer krank. Niemand hat es gewusst, auch ich nicht. Er war sehr tapfer und wollte keinen beunruhigen.“
Mutter studierte noch an der Universität. Eine Zeit lang war Großmutter bei Rainer, die so aussah wie die Frau Melkott, aber so gut war, dass Rainer mit ihr alles anstellen konnte.
Damals wohnten sie noch in einer kleinen Wohnung am Rande der großen Stadt.
Rainer isst seine Bockwurst und schlürft den Tee. Mutter fragt plötzlich: „Was ist mit dir, Rainer? Du bist so still.“
Rainer blickt rasch zu Mutter hinüber. Sicher hat sie ihn schon eine Weile beobachtet.
„Nichts ist mir“, sagt er, „ich bin bloß müde. Wir wollen alten Leuten helfen.“