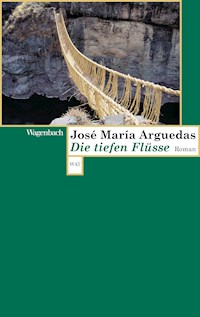Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer Peru literarisch kennenlernen will, muss Arguedas lesen: Sein Meisterwerk "Die tiefen Flüsse" ist ein interkultureller Bildungsroman, ebenso indianisch wie westlich geprägt. Jahrelang ist Ernesto mit seinem Vater, einem mittellosen Anwalt, von einem Dorf zum nächsten gereist. Dem Kindesalter entwachsen, kommt er schließlich auf ein katholisches Internat in der Provinzhauptstadt Abancay, hoch oben in den Anden. Dort ist zum Beispiel Añuco, der Sohn des verarmten Großgrundbesitzers, der zusammen mit dem Kraftprotz Lleras die jüngeren Schüler malträtiert; Palacitos, ein scheuer, kaum des Spanischen mächtiger Indio; Gerardo, der Sohn des Militärkommandeurs; Ántero, der Ernesto mit der Magie eines Kreisels verzaubert, dessen sphärischer Klang den Schulhof erfüllt und zum letzten Mal unbeschwerte Kindheit vorgaukelt. Denn des Nachts wird derselbe Schulhof zu einem düsteren, unheimlichen Ort, wo sich die schwachsinnige Küchenmagd den älteren Schülern hingibt. Arguedas zeichnet sie als Vorbotin der Katastrophe, die über Abancay und das Internat hereinbricht – und in der allein Ernesto einen kühlen Kopf bewahrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem peruanischen Spanisch von Matthias Strobel
Mit einem Vorwort von Marco Thomas Bosshard
Die Originalausgabe erschien 1971 postum unter dem Titel El zorro de arriba y el zorro de abajo bei Editorial Losada in Buenos Aires, die kritische Ausgabe (herausgegeben von Eve-Marie Fell), die hier als Textgrundlage dient, 1990 bei ALLCA XX in Madrid.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amts unterstützt durch Litprom e.V. – Literaturen der Welt.
Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung seiner Arbeit am vorliegenden Text.
E-Book-Ausgabe 2019
© 1971, 2019 Sybila Arredondo de Arguedas
© 2019 für die deutsche Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung: Julie August. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803142634
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3316 8
www.wagenbach.de
Marco Thomas BosshardLiteratur als Vermächtnis
Der Jahrhundertroman Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten und das Leben und Sterben seines Autors
Vor fünfzig Jahren setzte José María Arguedas, der wichtigste peruanische Romancier des 20. Jahrhunderts, seinem Leben ein Ende. Am 28. November 1969 schoss er sich in der Universidad Nacional Agraria in Lima, wo der gelernte Ethnologe seit 1967 dem soziologischen Institut vorstand, in die Schläfe und verstarb vier Tage später, am 2. Dezember 1969, im Krankenhaus. Sein letzter und erst 1971 postum veröffentlichter Roman Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten (im Original El zorro de arriba y el zorro de abajo), den der Wagenbach Verlag anlässlich seines fünfzigsten Todestages hiermit erstmals in der ergreifenden Übersetzung von Matthias Strobel dem deutschsprachigen Publikum zugänglich macht, zeugt von der wachsenden Verzweiflung und Depression Arguedas’, denn Teile seiner Tagebücher sind fester Bestandteil dieses Fragment gebliebenen Romans.
Verglichen mit unserer Zeit, in der das Spiel mit autobiographischen Referenzen und Autofiktionen in der Gegenwartsliteratur manch postmoderne Blüte treibt, ist Arguedas’ Roman – authentischer Bericht und Fiktion in einem – von anderem Kaliber. Literatur war für Arguedas nie ein Selbstzweck, auch kein Mittel zur Evasion oder gar zur Befriedigung von Leserbedürfnissen. Im Gegenteil bildeten Kunst und Leben bei ihm eine unzertrennliche Einheit – und das, wie das Beispiel von Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten zeigt, bis zum bitteren, letzten Ende.
Ein Jahr vor seinem Tod, in einer vorübergehenden Phase des Optimismus und des kreativen Schaffens an seinem letzten Roman, hat Arguedas anlässlich der Verleihung des Premio Inca Garcilaso in seiner Dankesrede die wohl programmatischsten Äußerungen zu seinem Selbstverständnis als Künstler und seinem Werk getätigt. Diese Rede sollte nach dem letzten Willen Arguedas’ seinem Roman Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten als Prolog vorangestellt werden (in dieser Ausgabe findet sie sich, in Anlehnung an die kritische spanischsprachige Ausgabe, die der vorliegenden Übersetzung zugrunde liegt, am Ende des Romans). In ihr verkündet der Autor mit Blick auf den in seinen Texten allgegenwärtigen Zusammenprall der indianischen mit der europäischen Kultur, an die sich erstere in den Augen der westlich geprägten Eliten Perus anzupassen beziehungsweise zu »akkulturieren« habe: »Ich bin kein Akkulturierter; ich bin ein Peruaner, der mit dem Stolz eines glücklichen Teufels sprechen kann wie ein Christ und wie ein Indio, auf Spanisch und auf Quechua.« Und er fährt fort, indem er dem westlichen Fortschrittsdenken den Reichtum der andinen Kultur entgegensetzt: »In der Technik sind sie uns überlegen, beherrschen sie uns, wer weiß wie lange noch, aber in der Kunst können wir sie bereits zwingen, von uns zu lernen, können es sogar tun, ohne uns von hier zu entfernen.« Denn mit ihren »sprechenden Enten« in Seen auf 4000 Metern Höhe, wo »alle Insekten Europas ersticken würden«, und mit ihren »Kolibris, die bis zur Sonne fliegen, um ihr Feuer zu trinken«, bildet die Mythenwelt der Anden die Keimzelle von Arguedas’ Schaffen. Die beiden titelgebenden sprechenden Füchse aus seinem letzten Roman, die wie ein in die Anden versetzter griechischer Chor das Schicksal von Arguedas’ Romanfiguren kommentieren, gehören in dieselbe Reihe mythischer Gestalten, die in einen Dialog mit der westlichen Moderne treten.
Diese Spannungen zwischen der andinen, indianischen Kultur und dem Okzident haben Arguedas zeit seines Lebens geprägt. Geboren 1911 in dem Andenstädtchen Andahuaylas, ist Arguedas’ Kindheit und Jugend gekennzeichnet von steten Ortswechseln in ganz Peru. Arguedas’ Mutter, Tochter eines wohlhabenden Großgrundbesitzers, stirbt schon früh. Der Vater heiratet wenig später erneut und siedelt mit seinen beiden Söhnen Arístides und José María nach Puquio und dann nach San Juan de Lucanas über. Während Arguedas’ älterer Bruder schon bald nach Lima geht, um dort die Schule zu besuchen, und der Vater oft monatelang beruflich unterwegs ist, bleibt José María allein bei seiner Stiefmutter und seinem verhassten Stiefbruder Pablo zurück, den Arguedas als Inbegriff eines gamonal porträtiert, eines ausbeuterischen, die indianischen Bediensteten und Arbeiter verachtenden Großgrundbesitzersöhnchens. Arguedas hat behauptet, dass er in Abwesenheit seines Vaters gezwungen wurde, mit den indianischen Dienstboten der Hazienda in der Küche zu essen und dort zu schlafen. Die emotionalen Bezugspersonen während seiner Kindheit waren deshalb, neben dem selten anwesenden Vater, mehrheitlich Indigene, sodass Arguedas eine besondere affektive Beziehung zum Quechua aufbaut, das er nicht nur einfach – wie jedermann im peruanischen Hochland zu jener Zeit – spricht, sondern in dem er sich vor allem in seiner Lyrik auch künstlerisch ausdrücken wird.
Im Alter von zwölf Jahren begleitete Arguedas seinen Vater, der als Anwalt tätig war und auf der Suche nach Arbeit von einem Ort zum nächsten zog, auf einer seiner langen Reisen, die ihn unter anderem in die großen andinen Städte Huamanga (Ayacucho), Cuzco und Abancay führte, wo er zwei Jahre lang ein Klosterinternat besuchte. Diese einschneidend-eindrückliche Erfahrung bildet den – wie so oft bei Arguedas – autobiographischen Hintergrund des 1958 erschienenen Romans Die tiefen Flüsse (im Wagenbach Verlag als Taschenbuch lieferbar). Die Sekundarschule absolvierte er dann, weiterhin nomadenhaft, zunächst in Ica an der peruanischen Pazifikküste, später wiederum im andinen Huancayo – um schließlich das letzte Schuljahr in der Hauptstadt Lima zu verbringen, wo er 1931 an der Universidad Nacional Mayor de San Marcos, der ältesten Universität Südamerikas, zu studieren begann.
Aus jenen Jahren stammen Arguedas’ erste literarische Veröffentlichungen: 1933 die erste Kurzgeschichte mit einem Titel auf Quechua – Warma kuyay (»Kinderliebe«) –, 1935 der erste Erzählband Agua (»Wasser«). 1937 wird Arguedas für ein Jahr inhaftiert, nachdem er öffentlich gegen einen Gesandten Mussolinis protestiert hat, was er Jahre später in seinem Roman El Sexto von 1961 (der Titel bezieht sich auf den Namen des Gefängnisses) verarbeiten wird. Wieder in Freiheit, veröffentlicht er 1941 seinen ersten Roman, Yawar fiesta, in dessen Titel sich das Quechua programmatisch mit dem Spanischen verbindet. Yawar bedeutet »Blut«, fiesta das »Fest« – und der Titel als Ganzer (»Das Blutfest«) spielt auf ein Ritual in den andinen Dörfern und Städten an, in dem sich die Fusion spanischer und indianischer Elemente manifestiert: Es besteht in einem Stierkampf, bei welchem dem Stier ein Kondor auf dem Nacken festgebunden wird und der so lange dauert, bis der Stier – gereizt und ermattet von den Schnabelhieben des Vogels und seiner Krallen – stirbt. Das Ritual suggeriert die potentielle Besiegbarkeit der europäisch-spanischen Kultur der Invasoren, für die der Stier metaphorisch steht, durch die mit dem Kondor assoziierte andine Tradition.
Neben seinem Schreiben wird Arguedas in jenen Jahren zu einem der wichtigsten Förderer der andinen Folklore. Er sammelt und ediert nicht nur das Liedgut der Quechua und publiziert und interpretiert andine Mythen – etwa denjenigen von der Wiederkehr des Inkarri, des Königs der Inka –, sondern ist in verschiedenen Funktionen für das Erziehungsministerium tätig, sitzt Kulturkommissionen vor, leitet Museen und verschafft den großen, von den kreolischen Eliten bisher belächelten andinen Volksmusikern und huayno-Interpreten ihre ersten Plattenverträge. Parallel setzt er sein Studium an der Universität San Marcos fort und promoviert dort im Alter von 52 Jahren in Ethnologie. Für seine Dissertation betrieb er Feldforschung nicht nur in den Anden, sondern auch in Dorfgemeinschaften der spanischen Provinz Zamora, hält Europa also gleichsam seinen eigenen völkerkundlichen Spiegel vor. Bis 1968 unterrichtet er Ethnologie an seiner Alma mater und bis zu seinem Tod auch an der Universidad Nacional Agraria La Molina.
1964 veröffentlicht Arguedas den auf Deutsch manchmal noch antiquarisch in DDR-Ausgaben auffindbaren Roman mit dem in der Übersetzung irreführenden Titel Trink mein Blut, trink meine Tränen (im Original Todas las sangres), sein bis dato ambitioniertestes Buch, das – unter anderem – die Enteignung von Ländereien zugunsten eines ausländischen Bergbauunternehmens zum Thema hat. An dem Roman entzündet sich eine Polemik, die Arguedas an sich und seiner künstlerischen Schaffenskraft zweifeln lässt und 1966 – im Zusammenspiel mit vielen anderen, persönlichen Faktoren, etwa der Scheidung von seiner ersten Frau Celia – einen ersten Selbstmordversuch nach sich zieht: Eine Gruppe von Schriftstellern, Wissenschaftlern und Kritikern bezeichnet den Roman als soziologisch unpräzise. Und nicht nur auf nationaler Ebene mehren sich die Angriffe auf den zunehmend dünnhäutig reagierenden Arguedas: Der gefeierte shooting star des lateinamerikanischen Booms, der Argentinier Julio Cortázar, äußert sich in einem Interview abfällig über Arguedas und bezeichnet den peruanischen Schriftsteller als Provinzautor. Nur halbherzig wird er von seinem Landsmann Mario Vargas Llosa verteidigt, der in jener Zeit gemeinsam mit Julio Cortázar, Gabriel García Márquez und Carlos Fuentes zu einem der international erfolgreichsten Vertreter der neuen lateinamerikanischen Literatur avanciert und 1978 ein ganzes Buch über Arguedas veröffentlicht hat (La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo) – ohne ihm jedoch gerecht zu werden. Arguedas verfällt in schwerste Depressionen. Weder eine psychotherapeutische Behandlung noch die Heirat mit der Chilenin Sybila Arredondo 1967, einer Patentochter der Nobelpreisträgerin Gabriela Mistral, führen zu einer nachhaltigen Verbesserung seines Zustands. Wie schwer sich der von Selbstzweifeln geplagte Arguedas mit den eloquenten, selbstbewussten, jungen, kommerziell erfolgreichen und weltläufigen Boom-Autoren jener Zeit tut, lässt sich im ersten Tagebuch in Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten nachlesen: Vertrauen und wirkliche Freundschaft verbinden ihn nur mit dem Mexikaner Juan Rulfo, der sich in seiner Literatur, wie Arguedas in Peru, mit dem mestizisch-indigenen Erbe seines Landes auseinandersetzte, und mit dem brasilianischen Romancier João Guimarães Rosa, der in seinen Romanen ebenfalls dem einfachen Mann aus dem sertão eine literarische Stimme verlieh.
Ebenfalls 1966 übersetzt Arguedas eine der wichtigsten indigenen Quellen der Kolonialzeit erstmals aus dem Quechua ins Spanische: das sogenannte Manuskript von Huarochirí, das der deutsche Ethnologe Hermann Trimborn wiederentdeckt und bereits 1939 ediert hat. In diesem Textkonvolut stößt Arguedas auf die beiden sprechenden Füchse – den Fuchs von oben und den Fuchs von unten –, die in seinem im Entstehen begriffenen letzten Roman eine tragende Rolle spielen werden.
Bereits im Manuskript von Huarochirí markieren die beiden Füchse zwei kulturell völlig unterschiedliche Territorien: Der Fuchs von oben repräsentiert das landwirtschaftlich ertragreiche Hochland – die sierra – und die von dort stammenden indianischen Hochkulturen bis zu den Inka, wohingegen der Fuchs von unten für die karge Wüstenlandschaft der Pazifikküste – die costa – steht. Dort siedelten zwar ebenfalls eminente indianische Zivilisationen, jedoch ist die costa seit der Conquista in erster Linie mit den wichtigen Kolonial- und Hafenstädten der spanischen Invasoren assoziiert. In den Jahren von Arguedas’ Lehrtätigkeit hat die andine Anthropologie – allen voran der ukrainischstämmige Peruanist John V. Murra, mit dem Arguedas eine tiefe Freundschaft verband – die immense Wichtigkeit der ›Vertikalität‹ als dem entscheidenden epistemologischen Strukturprinzip der Andenkulturen auch wissenschaftlich detailliert herausgearbeitet: Nicht nur haben die Inka ihre Städte nach dem Prinzip des ständigen Ausgleichs von hanan und hurin – Quechua für ›oben‹ und ›unten‹ – geplant und gebaut, auch die ungemein vielfältige Landwirtschaft der Anden basiert auf der agrarischen Nutzbarmachung unterschiedlichster Klimastufen zwischen der Puna des Hochlands ganz oben und den tropischen Zonen des Amazonas und der ariden Küstenlandschaften ganz unten, die auf der vertikalen Achse nur wenige Kilometer auseinanderliegen.
Genau diesen Gegensatz zwischen hanan und hurin, zwischen Oben und Unten, projiziert Arguedas nun auf das moderne Peru der Küstenstadt Chimbote – und verlässt damit erstmals in seiner literarischen Karriere das Andenhochland als der Hauptszenerie seiner Fiktion. Arguedas zeichnet Chimbote, das sich im Zuge des starken Wachstums der Fischmehlindustrie innerhalb weniger Jahre von einem kleinen Städtchen zu einer Großstadt gewandelt hat, als kapitalistischen Moloch, der auf die Arbeitskraft der unzähligen indianischen und mestizischen Migranten angewiesen ist. Auf der Suche nach einem wirtschaftlich besseren Leben verlassen diese ihre andine Umgebung und siedeln vom Hochland in die Küstenstädte über. So stehen sich in diesem modernen Widerstreit von hanan und hurin die traditionelle, auf Vielfalt, Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit gründende agrarische Wirtschaftsform der Andenkulturen einerseits und die auf Gewinnmaximierung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen und menschlicher Arbeitskraft basierende Wirtschaftsform des modernen Industriekapitalismus andererseits gegenüber. Der mythenumwobene Fischmehlmagnat Braschi, von dem in Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten zwar immer wieder die Rede ist, der aber kein einziges Mal im Roman selber auftritt, setzt hierbei auf eine perfide Strategie wirtschaftlicher Akkulturation, indem er seinen indianischen Arbeitern in den Fabriken zwar überdurchschnittliche Löhne zahlt – ebenso wie die Fischer Chimbotes für ihre Sardellen gute Preise erzielen –, gleichzeitig aber auch zum exzessiven Konsum animiert: Sie sollen ihr verdientes Geld möglichst vollständig wieder in den unzähligen Bordellen der Stadt ausgeben, die Braschi ebenfalls kontrolliert, oder sich verschulden, indem sie eigene Häuser kaufen, die ihnen der Industrielle – auf Kredit, versteht sich – finanziert. Die andinen Migranten aus dem Hochland verlieren auf diese Weise mehr und mehr die Bindung an ihre Ursprungskultur und frönen den Verheißungen des westlichen Kapitalismus – eine Tendenz, die sich, von Arguedas bereits in den 1960er Jahren registriert, während des bemerkenswerten peruanischen Wirtschaftswachstums der letzten Jahre unter neoliberalen Vorzeichen weiter verstärkt hat und deshalb so aktuell erscheint wie damals.
Im dritten Kapitel des Romans tritt erstmals Don Diego auf, eine geheimnisvolle Figur, die sich gleichzeitig europäisch und indianisch kleidet, unendlich schnell die Sanddünen rund um Chimbote hinaufrennen kann und mit ihrem Tanz den Fabrikdirektor Rincón zu Gesängen animiert. Immer wieder weist Arguedas’ Erzähler auf Diegos längliches, tierartiges Gesicht und auf seinen seltsamen Schnurrbart hin. Als ihn der Fabrikdirektor dann auch noch fragt: »Wussten Sie, dass in den Erzählungen der Indios, Cholos und Zambos, die man sich hier im ›Vaterland‹ erzählt, der Fuchs Diego heißt?«, kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass sich einer der Füchse – wie wir sehen werden, der Fuchs von unten – aus dem Romantitel immer stärker in die Handlung einmischt: Die mythisch-magische Gestalt des Fuchses trifft auf die krude soziale Realität einer Industriestadt.
In diesen Erzählungen und Fabeln aus den Anden wird der Fuchs – atuq auf Quechua – häufig auch Antonio genannt; fast immer trägt er also einen spanischen Namen. Selten gehen diese Geschichten gut für ihn aus: Auch wenn er durchaus nicht auf den Kopf gefallen ist, kann sich der andine Fuchs nicht mit dem listenreichen Fuchs aus europäischen Fabeln messen, denn meistens zieht er den Kürzeren. Als nicht sonderlich sympathischem, häufig verspottetem trickster kommt dem Fuchs in den andinen Fabeln eine ambivalente Funktion zu: Nicht nur bringt der andine Fuchs die Welt regelmäßig aus dem Gleichgewicht – er erscheint in einigen Erzählungen auch als Zivilisationsbringer. So lässt sich der Fuchs Antonio in einer der bekanntesten Fabeln vom Kondor als ungebetener Gast zu einem Bankett in den Himmel fliegen, wo er nichts Besseres zu tun hat, als alle anderen tierischen Gäste zu beleidigen und sich den Bauch vollzuschlagen. Da ihn deshalb kein anderer Vogel wieder nach unten auf die Erde zurückbringen will, klettert der Fuchs an einem Strick nach unten und stürzt ab. Dabei werden die Samen und Essensreste aus seinem Bauch über die Erde verstreut – und die Landwirtschaft kommt durch ihn und sein Missgeschick zu den Menschen.
Arguedas lässt seinem Don Diego eine ähnliche Funktion zuteilwerden: Don Diego bringt es nicht nur fertig, die kapitalistischen Produktionsabläufe in der Fischmehlfabrik durch seine indianisch inspirierten Tänze kurzzeitig zu stören, er kann auch mit allen noch so unterschiedlichen Figuren des Romans in ihrer jeweils eigenen, charakteristischen Sprache auf Augenhöhe kommunizieren. Er bringt die bestehende Ordnung aus dem Gleichgewicht und regt eine neue Art des Austauschs an, der Grenzen überwindet: Sogar einem Stotterer gelingt es in seiner Gegenwart, wieder flüssig zu sprechen, und bei seinem letzten Auftritt im Roman inspiriert Don Diego den US-amerikanischen, Che Guevara verehrenden Priester Michael Cardozo zu einer irr- und unsinnigen finalen Rede nahe am hermeneutischen Delirium, die sämtliche sprachlichen Register der indianisch-mestizischen Migrantengesellschaft Chimbotes zwischen Tradition und Moderne miteinander vermischt.
Die immense Vielfalt dieser sprachlichen Register Arguedas’ auch im Deutschen nicht nur erahnbar, sondern auch wirklich fassbar zu machen ist das unendlich große Verdienst der vorliegenden Erstübersetzung dieses Klassikers der modernen lateinamerikanischen Literatur durch Matthias Strobel. Denn die sprachliche Polyphonie des Romans ist Programm, korrespondiert mit dem Anspruch des Autors, ein Kaleidoskop der modernen peruanischen Gesellschaft im Umbruch zu zeichnen: So steht das gestochene Spanisch der Kapitalisten kommentarlos neben dem ›falschen‹, grammatikalisch und syntaktisch verqueren Spanisch der Arbeitsmigranten aus dem Hochland, deren Muttersprache Quechua nur drei Vokale kennt. So sprechen sie viele Vokale falsch aus, während die mestizischen Fischer eine vulgäre Gossensprache pflegen, die wiederum mit der poetischen Sprache des Erzählers einerseits und dem schonungslos-nüchternen Ton der Selbstreflexionen des Autors in den Tagebucheinträgen andererseits kontrastieren.
Die Interventionen von Don Diego, dem Fuchs von unten, der im ständigen Dialog mit dem Fuchs von oben und den verlorenen Figuren des Romans die unvereinbaren Welten Perus zusammenzubringen versucht, mögen einigen der unzähligen Fischer, Arbeiter, Prostituierten, Bergleute, Verrückten, Aussteiger, die die wenigen fertiggestellten Kapitel von Arguedas’ Roman bevölkern, einen Ausweg aus ihrer schwierigen Lage weisen. Viele dieser Figuren werden jedoch scheitern und sterben, wie Arguedas in den abschließenden Tagebucheinträgen andeutet. Auch Arguedas selbst scheitert – an Chimbote und am Leben, nicht anders als seine Protagonisten – und muss sich schließlich eingestehen, seinen Roman nicht weiterschreiben und sein Leben nicht weiterleben zu können. Doch anders als seinen Romanfiguren, die bis zuletzt kämpfen, ist sich der Autor der Ausweglosigkeit seiner Situation sehr wohl bewusst. Während die Romanhandlung, kaum kommt sie in Bewegung, mit dem Selbstmord des Autors schon wieder endet, machen die Tagebucheinträge Arguedas’ Entschluss, sich das Leben zu nehmen, nachvollziehbar.
Die anthropologisch-soziologische Außenperspektive auf die Romanfiguren im fiktionalen Teil des Buchs bildet auf diese Weise das Gegenstück zu einer intimen, auf Introspektion ausgerichteten Schreibweise in den nichtfiktionalen Teilen, in der die psychischen Abgründe des Autors sichtbar werden. Hurin obsiegt über hanan, das Unten über das Oben, wir verfolgen Don Diego, den Fuchs von unten, während wir den Fuchs von oben aus dem Blick verlieren: Nicht umsonst entspricht die hurin pacha oder ukhu pacha in der andinen Kosmologie der Unterwelt. Hurin steht deshalb auch für die Welt der Toten, in die sich der Autor schließlich freiwillig begibt und die in der Topographie des Romans mit Chimbote als Ort des Leidens und Sterbens zusammenfällt. Doch ist der Tod im andinen Verständnis kein teleologischer Endpunkt, keine letzte Zäsur: »Los muertos viven« – »die Toten leben« –, hat Arguedas’ Landsmann Gamaliel Churata, ebenso wie jener auf der Suche nach genuinen, adäquaten Darstellungsformen indoamerikanischen Denkens in der modernen Literatur, dereinst formuliert: Die Kommunikation zwischen den Welten wird über den Tod hinaus weitergeführt, kommt durch ihn nicht zum Erliegen. In diesem Sinne ist es an der Zeit, dass fünfzig Jahre nach Arguedas’ Tod nun auch die westliche Welt – Arguedas’ letzter Roman war in Europa bisher lediglich in italienischer Übersetzung zugänglich – und mit ihr die deutsche Leserschaft in einen Dialog mit dem peruanischen Autor und seinem literarischen Vermächtnis tritt.
Die selbstreflexiv fundierte Verquickung von Kunst, Leben und Tod sowie das fatale Ringen mit dem Totalitätsanspruch machen Arguedas’ Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten nicht nur zu einem der ambitioniertesten Romane, sondern auch zu einer der existentiellsten Leseerfahrungen in der Literatur des 20. Jahrhunderts.
Mit bangem Gefühl widme ich diese verkrüppelte und unausgewogene Erzählung E. A. W. und dem Geiger Máximo Damián Huamani aus San Diego de Ishua.
ERSTER TEIL
Erstes Tagebuch
Santiago de Chile, 10. Mai 1968
Im April 1966, vor gut zwei Jahren also, habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Im Mai 1944 hatte sich ein psychisches Leiden aus der Kindheit schon einmal zu einer Krise ausgewachsen, und ich hatte fast fünf Jahre lang nicht schreiben können. Die Begegnung mit einer fülligen jungen Zamba gab mir das zurück, was die Ärzte »Lebenstonus« nennen. Die Begegnung mit dieser fröhlichen Hure muss der subtile, hochkomplexe Anstoß gewesen sein, den mein Körper und meine Seele brauchten, um die gekappte Bindung zu allen Dingen wiederherzustellen. War diese Verbindung stark, konnte ich dem Wort die Materie der Dinge übertragen. Seit damals habe ich mit Unterbrechungen gelebt, leicht verstümmelt. Die Begegnung mit der Zamba konnte die Leselust in mir nicht vollständig wiederbeleben. In all den Jahren habe ich nur wenige Bücher gelesen. Und nun stehe ich wieder kurz vor dem Selbstmord. Wieder sehe ich mich außerstande, richtig zu kämpfen, richtig zu arbeiten. Und ich möchte nicht wie damals, im April 66, zu einem nichtsnutzigen Kranken werden, einem bedauernswerten Zeugen der Ereignisse.
Tagelang habe ich im April 66 auf den besten Moment gewartet, um mich zu töten. Mein Bruder Arístides besitzt einen Umschlag, der alle Überlegungen darüber enthält, warum ich mich an diesem oder jenem Tag nicht umbringen konnte. Heute habe nicht so sehr vor dem Tod selbst Angst als vielmehr davor, ihn herbeizuführen. Ein Revolver ist schnell und sicher, aber nicht so einfach zu besorgen. Inakzeptabel erscheint mir das schmerzhafte Gift, das die Armen in Lima benutzen, um sich das Leben zu nehmen; an den Namen des Insektizids erinnere ich mich gerade nicht. Was den physischen Schmerz angeht und sicher auch den Moment des Todes selbst, bin ich ein Feigling. Die Pillen – die, wie man mir versichert hat, unter Garantie töten – bescheren einen fantastischen Tod, wenn sie denn töten. Denn wenn nicht, endet man so wie ich, und der Tod klebt an einem fest, nur weil der Körper noch stark ist. Eine unbeschreibliche Empfindung ist das: Es streiten sich in einem – sinnlich wie poetisch – der Wunsch zu leben und der Wunsch zu sterben. Wer so beschaffen ist wie ich, sollte lieber sterben.
Ich fülle diese Seiten, weil man mir bis zum Überdruss erklärt hat, ich müsse nur wieder schreiben, dann würde ich gesund. Da ich jedoch über selbst gewählte, ausgefeilte Themen, ob kleine oder anspruchsvolle, nicht schreiben kann, werde ich über das Einzige schreiben, was mich noch reizt: dass ich es nicht geschafft habe, mich umzubringen, und mir nun den Kopf darüber zerbreche, wie ich doch noch mit Anstand aus dem Leben scheiden kann, ohne all diejenigen, die mein Verschwinden bedauern werden, und all diejenigen, die irgendeine Art von Vergnügen empfinden werden, über Gebühr zu belästigen. Wie wundersam doch meine – und nicht nur meine – Sorge ist, den Selbstmord so zu arrangieren, dass er möglichst gelungen ist. Vermutlich ist dies ein natürlicher Ausdruck der Eitelkeit, des gesunden Menschenverstands und vielleicht auch des Egoismus, die im Gewand von Großzügigkeit und Erbarmen auftreten. Ich werde also versuchen, dieses Thema zu verknüpfen, das einzige Thema, dessen Essenz ich so lebe und empfinde, dass ich es dem Leser vermitteln kann; zu verknüpfen mit den Motiven dieses Romans, den ich endlich getauft habe auf den Namen: Der Fuchs von oben und der Fuchs von unten; zu verknüpfen mit all dem, was mir in so vielen Momenten durch den Kopf gegangen ist über die Menschen und über Peru, ohne dass es spezifisch für den Roman vorgesehen gewesen wäre.
Gestern Abend habe ich beschlossen, mich in Obrajillo, Provinz Canta, oder in San Miguel zu erhängen, sollte ich keinen Revolver auftreiben können. Für den, der mich findet, wird das kein schöner Anblick werden, aber Erhängen führt nun mal, wie ich mich vergewissert habe, den Tod rasch herbei. In Obrajillo und in San Miguel könnte ich zuvor noch die umherstreunenden Schweine am Kopf kraulen, freundlich mit den Hunden plaudern und mich vielleicht sogar mit einigen dieser Straßenköter in der Erde wälzen, sollten sie die extreme Güte haben, mich vorübergehend als einen der Ihren zu betrachten. Es ist mir schon häufiger gelungen, mit den Dorfhunden zu spielen, von Hund zu Hund. Dann ist das Leben irgendwie lebendiger. Doch, doch; vor nicht einmal vierzehn Tagen habe ich es geschafft, in San Miguel de Obrajillo den Kopf eines ziemlich großen nionena (Schweins) zu kraulen. Eigentlich wollte es flüchten, aber das Glück des Gekraultwerdens hielt es zurück; es grunzte genüsslich, dann (wie schwer es mir fällt, die notwendigen Begriffe zu finden!) sank es nach und nach darnieder und quiekte mit geschlossenen Augen lieblich vor sich hin. Der hohe, der unendlich hohe Wasserfall, der herabstürzt vom unerreichbaren Felsengipfel, sang im Quieken dieses nionena, in seinen harten Borsten, die ganz weich wurden; und ebenso die milde Sonne, die den Stein erwärmte, meine Brust, all die Blätter an Bäumen und Büschen, ja selbst das kantige, energische Gesicht meiner Frau erwärmte sie zu Fülle und Schönheit, und diese Sonne war besser zu spüren als irgendwo sonst in der Sprache dieses nionena, in seinem köstlichen Schlaf. Die Wasserfälle Perus, so auch der von San Miguel, die über Abgründe springen, hinunter in senkrechtem Flug, und die Terrassen bewässern, auf denen nährende Pflanzen blühen, werden meine Augen erquicken, kurz bevor der Tod mich ereilt. Sie malen ein Bild der Welt für uns, die wir auf Quechua zu singen wissen; bis in alle Ewigkeit könnten wir ihnen lauschen; sie existieren überhaupt nur wegen dieser zerklüfteten Berge, die sich verspielt zu Schluchten ordnen, Schluchten so tief wie der Tod und doch vor Leben strotzend; wilde Hänge, auf denen der Mensch ausgesät hat, Felder angelegt mit Hand und Verstand, Bäume gepflanzt, die sich von Felsvorsprüngen transparent gen Himmel recken. Nützliche Bäume, so lebensprall wie diese unzähligen Tiefen, in denen wir Menschen wunderschöne Würmchen sind, kraftvolle Würmchen, aber nicht sehr geschätzt von den verschlagenen Mördern, die uns heute regieren. Pachequito, mein Bruder, Hauptmann aus Pinar del Río, und du, Chiqui, von der Casa de las Américas: Wenn wir auch hier den Sozialismus bekommen wie in Kuba, dann werden es noch viel mehr Bäume sein, noch viel mehr Felder, denn die Erde hier ist gut, ein Paradies! Ein Glück, dass mich die Tabletten – die angeblich so sicheren – nicht getötet haben, denn so durfte ich euch kennenlernen, euch und diesen Mann mit dem Maschinengewehr, der im Hafen von Havanna den Eingang zum Terminal Pesquera bewachte. Der junge Kerl lächelte, als man ihm sagte, ich sei ein Freund aus Peru: »Hereinspaziert, Genosse, und schau dir an, was wir geleistet haben.« Sein Gesicht hatte die natürliche Freude, Intelligenz, Kraft und Großzügigkeit dieser Wasserfälle, die Tag und Nacht singen im Licht der Welt und im Licht der Weisheit. Mir allerdings singen sie nicht mehr mit voller Lebenskraft, denn mein mutloser Körper glüht nicht mehr, sondern zittert schon. Das also ist der Tod, und auch der Tod ist nötig, auch der Tod muss sein! Ja, so einfach ist das, Pachequito, so einfach wie dein winziges Äuglein, aus dem die Kraft hervorfunkelt, mit der du getötet hast, um das aufzubauen, was für euch jetzt das gerechte Leben ist. Nicht hinnehmbar sind für den Ungeduldigen die Tage der Bettlägrigkeit oder Versehrtheit, die dem Tod vorausgehen. Nein; ich würde sie nicht ertragen. Ich kann nicht leben, ohne zu kämpfen, ohne für die anderen wenigstens etwas zu tun von dem, was ich gelernt habe, ohne wenigstens etwas zu tun, um die verkommenen Egoisten zu schwächen, die Millionen von Menschen zu Arbeitsochsen degradiert haben. Ich scheue das Leid nicht. Vielleicht, kluger Genosse Dorticós, gelingt es dem Menschen irgendwann, das Leid abzuschaffen, ohne seine Kraft zu schwächen. Du, zum Beispiel, kamst mir in den wenigen Minuten, die ich dich reden hörte, wie ein Mensch vor, der alles Mögliche wusste, der immun war gegen das Leid, so wie deine Brille. In anderen Fällen sind Großzügigkeit und Hellsichtigkeit zum größten Teil das Resultat von Leid. Erst wenn der Schmerz zurückgedrängt, wenn er überwunden ist, entsteht Fülle. Vielleicht ist das Leid das, was der Tod für das Leben ist. Der Mensch wird leiden, weil er sich so sehr anstrengen muss, um physisch – und nur so lohnt es sich – zu den Myriaden von Sternen zu gelangen, die wir in San Miguel betrachten können mit einer heiteren Gelassenheit und die selbst uns, die Verdammten, wie ich einer bin, für Augenblicke beruhigen. Es wird immer viel zu tun sein.
11. Mai
Gestern habe ich vier Seiten geschrieben. Ich schreibe aus therapeutischen Gründen, vergesse dabei aber nicht, dass diese Seiten auch gelesen werden könnten. Wie schwach ist das Wort, wenn das Gemüt krank ist. Wenn auf dem Gemüt all das lastet, was wir über unsere Sinne gelernt haben, wird auch das Wort mit all diesen Themen befrachtet. Und dann vibriert es! 1944 wurde ich zum Ignoranten. Seit damals habe ich nur wenig gelesen. Ich erinnere mich an Melville, an Carpentier, Brecht, Onetti, Rulfo. Wer hat wie du, Juan, das Wort mit all dem Gewicht des Leidens befrachtet, mit Fragen des Gewissens, heiliger Wollust, Männlichkeit, mit allem, was an der menschlichen Kreatur Asche ist, Stein, Wasser, heftige Fäulnis, die gebären und singen will? In diesem Hotel, das mehr tot als lebendig war, dem Guadalajara Hilton, haben sie uns beide einquartiert, reiner Zufall? Du hast mir von deinem Leben erzählt. Du wurdest gefeuert und etwa zwanzig Mal neu ernannt in den Ministerien der mexikanischen Revolution. Du hast für eine Reifenfirma gearbeitet. Den Posten wieder aufgegeben, weil du in ein anderes Land versetzt werden solltest. Während du im Bett lagst und erzähltest, hast du geraucht wie ein Schlot. Von Juárez hattest du nichts Gutes zu berichten. Es hätte mich nicht wundern dürfen, wie unorthodox du die Ursachen und Wirkungen der mexikanischen Geschichte geordnet hast, wie gut du sie kanntest, diese Geschichte, genauso gut oder besser als dein eigenes Leben. Und ich musste lachen darüber, wie du den alten Juárez geschildert hast, als eine unselige Witzfigur. Ich habe mich daran erinnert, wie ich dir in Berlin zum ersten Mal begegnet bin, wie ich dich untergehakt zum Omnibus geführt habe, beseelt von Glück, und wie ich, schon im Beruf stehend, Don Felipe Maywa wiedergetroffen habe, in San Juan de Lucanas, und mich plötzlich so gefühlt habe wie dieser große Indio, in dem ich als Kind einen weisen Mann gesehen habe, einen nachsichtigen Berg. So gefühlt wie er! Und während die anderen Dorfbewohner mich wie einen Gelehrten behandelten und mir so das Licht des Dorfes verleideten, hat er, Don Felipe, mir gestattet, mich bei ihm unterzuhaken. Und ich habe seinen Indioduft gerochen, diese geliebten Ausdünstungen seiner schmutzigen Bayeta. Und ich habe Don Felipe umarmt, von gleich zu gleich. Don Felipe ist von kleiner Statur – noch lebt er. Ich, der ich mittelgroß bin, überrage ihn um einiges. Und doch haben wir uns angesehen von Mann zu Mann. Und genauso groß war mein berechtigtes, gut verstecktes und daher angespanntes Erstaunen. Umschlungen sahen wir einander an, zu diesem anderen Erstaunen der Indios, der Wiraqochas, der hoch angesehenen Dorfbewohner, die mich respektierten, indem sie so taten, als würden sie mich nicht kennen. Wo ich doch dieser Junge war, dieser kleine Junge, der auf einem Maisfeld am anderen Ufer des Huallpamayo sterben wollte, weil mir Don Pablo den Teller mit dem von Facundacha vorgesetzten Essen ins Gesicht geschleudert hatte! Doch auch dort, auf dem Maisfeld, habe ich lediglich bis zum Abend geschlafen. Der Tod wollte mich nicht, so wie er mich auch im Direktionsbüro des Nationalmuseums in Lima nicht wollte. Im Hospital del Empleado wachte ich wieder auf. Ich habe ein liebliches Licht gesehen, dann das sehr verschwommene Gesicht von Leuten. (Eine Apothekerin wollte mir nicht mehr als drei Pillen Seconal verkaufen; sie sagte, mit mehr als drei davon würde ich womöglich einschlafen und nie wieder aufwachen; und ich habe siebenunddreißig geschluckt. Sie waren so wirkungslos wie die schluchzenden Stoßgebete zur Jungfrau Maria auf jenem Maisfeld in Huallpamayo.) Ich sagte, ich sei jener Junge, dem Don Pablo, der Herr des Dorfes, der damalige Kazike, das Essen ins Gesicht geschleudert hatte, doch gleichzeitig war ich eindeutig ein ganz anderer. Und trotzdem waren dieser ganz andere und der Junge vom Maisfeld ein und dasselbe, und Don Felipe, der von kleiner Statur war, gedrungen, so alt und so neu wie ich, nahm ihn an, fand es ganz natürlich, dass es so war. Daher behandelte er mich von gleich zu gleich, so wie du, Juan, in Berlin und in Guadalajara und in Lima, und auch in Guanajuato, diesem Kaff, das genauso heruntergekommen ist wie Cuzco. Du hast geraucht und geredet, und ich habe dir zugehört. Ich fühlte mich erfüllt und zutiefst beglückt, dass wir beide von gleich zu gleich sprachen. Don Alejo Carpentier hingegen habe ich als »überlegen« empfunden, in etwa so wie diese Dorfbewohner mich, die in mir einen Gelehrten sahen. Gelesen hatte ich nur Das Reich von dieser Welt und eine Erzählung; später dann Die verlorenen Spuren. Er ist so ganz anders als wir! Seine Intelligenz durchdringt die Dinge von außen nach innen, wie ein Blitz; er ist ein Gehirn, das hellsichtig und verzückt die Materie der Dinge aufnimmt, und dann beherrscht er sie. Du auch, Juan, aber von innen her, von sehr weit innen, vom Kern selbst; die Intelligenz ist vorhanden; sie hat davor und danach ihren Dienst getan.
Gut, dann will ich noch einmal lesen, was ich geschrieben habe; ich bin ziemlich verwirrt und doch, auch wenn die Nackenschmerzen mich schier erdrücken, um einiges zuversichtlicher als gestern, was das Reden betrifft. Was ich wohl gesagt habe, Juan? Onetti habe ich in Mexiko gesehen. Er ging am Stock, umsorgt von Leuten, die ihn kannten. Ich hatte nichts von ihm gelesen. Schade. Ich hätte ihn gegrüßt; Don Alejo anzusprechen habe ich mich nicht getraut, zweimal wurde er mir vorgestellt. Es heißt, er sei schüchtern, aber empfunden habe ich, ihn empfunden habe ich als einen illustren Europäer, der Spanisch sprach. Einen sehr illustren Europäer, einen dieser Illustren, die der indigenen Kultur Amerikas höfliche Wertschätzung entgegenbringen. Verzeihen Sie mir, Don Alejo; es ist nicht so, dass Sie mir besonders unsympathisch wären. Ich witterte in Ihnen jemanden, der unsere indigenen Angelegenheiten als exzellentes Arbeitsmaterial betrachtet. Sie arbeiten als Dichter und Gelehrter. Ein schwieriges Unterfangen! Wie kann es sein, dass Sie von so viel Auswendiggelerntem aus allen Zeiten so sehr inspiriert werden, geradezu erleuchtet? Onetti erbebt harmonisch in jedem Wort; wie gerne würde ich nach Montevideo fahren – ich bin gerade in Santiago –, unter anderem, um die Hand zu ergreifen, mit der er schreibt. So ist das. Bei Carlos Fuentes ist vieles gekünstelt, Gehabe. Von Cortázar habe ich nur Erzählungen gelesen. Die Anleitungen, die er für die Lektüre von Rayuela erteilt, haben mich erschreckt. Nun gut, dann bleibt mir eben verdientermaßen der Einlass in diesen Palast bis auf Weiteres verwehrt. Lezama Lima suhlt sich in der Essenz der Wörter. Ich habe ihn in Havanna essen sehen wie eine Kreuzung aus Kolibri und Nilpferd. Er hat immerzu den Mund aufgesperrt, sich ein Asthmamittel in die Kehle gesprüht und weitergegessen. Fabelhafter Dicker, Kuba, das den Honig und die Galle Europas verschlungen und verwandelt hat!
13. Mai
Ich fühle mich des Todes. Ein peruanischer Freund hat mich gestern Abend in einen hässlichen Tingeltangelschuppen geschleppt; man hatte ihm gesagt, dort würden chilenische Tänze und Gesänge aufgeführt. Und es war auch sehr unterhaltsam für das Publikum, das wir überheblich, aber auch »objektiv« als vulgär, frivol usw. bezeichnen. Zwischen Nackedeis, Komikern, Jazzbands und Langhaarigen, allesamt mittelmäßig, trat plötzlich ein chilenisches »Ballett« auf! Du meine Güte! Ich sage ja gar nicht, dass daran nichts Chilenisches mehr ist; aber wir, die wir wissen, wie das, was das Volk macht, klingt, wissen gar nicht, ob wir uns ärgern oder staunen sollen. Ich würde auch gar nicht wie andere Schlaumeier sagen, dass das der reinste Mumpitz ist. Irgendetwas Chilenisches ist schon noch dran. Die »Huasos« sind niedlich ausstaffiert, ein bisschen tuntig (fast eine Beleidigung der echten Huasos), und die Frauen etwas aufgedirnt (als wollten sie der Frivolität der Gäste, die das Spektakel bezahlen, ja keinen Abbruch tun), jedenfalls übertünchen sie die natürliche Anmut der Männer und Frauen, die sich auf dem Land oder in der Stadt nicht zieren, wenn sie ihre Lieder singen und ihre Tänze tanzen und so den Saft der Erde übermitteln. Ich sage nicht, dass es unter der sogenannten »Aristokratie« und der entwurzelten Mittelschicht dieser Dörfer nicht auch Leute gibt, die sich diesen Saft bewahrt haben. Doch fast alle machen sich zur Witzfigur durch die sozialen »Konventionen«, in diesem kunterbunten Unfug, in dem diese tuntigen »Huasos« auftreten, diese aufgedirnten Frauen, die sich so aufdirnen, damit aus den Tänzen dieses starken Volkes ein »angenehmes Nationalspektakel« wird. Verflucht noch mal, mein lieber Negro Gastiaburú! Arzt warst du, ein Doktor. Gemeinsam haben wir solche Dinge verflucht, die allesamt Machenschaften der Gringos sind, um Geld zu scheffeln. Und wenn es sie nicht mehr gäbe, diese unvermeidliche Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen? Würde sich das durch die Geschäftemacherei Verkitschte entkitschen, auch in der Literatur, in der Medizin, in der Musik, sogar in der Art und Weise, wie eine Frau sich dem Mann nähert? Kostproben für diese Erneuerung, für diese Entherabwürdigung, habe ich in Kuba erlebt. Das von Eitelkeit und Gewinnsucht Unberührte jedoch ist, wie die Sonne, allenfalls noch auf einigen Festen in den Bergdörfern Perus anzutreffen.
Ich sage das nicht, weil ich ein indigener Sektierer wäre. Gesehen und empfunden wie ich haben es auch Leute aus Paris, den Vereinigten Staaten, Italien und Lima, ob sie nun in verwurzelten oder sich entwurzelnden »Gesellschaften« aufgewachsen sind. Stimmt doch, oder, Gody, E. A. Westphalen, Jaqueline Weller …? Ich bin mir sicher, dass auch Don Alejo seine Freude an diesen Festen hätte, wenngleich er vermutlich ernst bleiben würde, wenig mitteilsam, und dabei innerlich ausbaldowern würde, welch subtile Verbindungen und Verknüpfungen bestehen zwischen diesem Fest und den Griechen, Assyrern, Javanesen und vielen anderen Völkern mit seltsamen, aber existierenden Namen. Carlos Fuentes hingegen würde nichts kapieren, glaube ich. Die Freunde von Fuentes, darunter Mario (Vargas Llosa), mögen mir verzeihen, und auch dieser Cortázar, der anspornt mit seiner »Genialität«, mit seiner feierlichen Überzeugung, dass das Wesen des Nationalen am besten zu verstehen ist aus den hohen Sphären des Supranationalen. So als würde ich, der ich als Kind einige Jahre unter den Leuten von Don Felipe Maywa aufgewachsen bin, am oqllo, der Brust der Indios selbst, wieder zurückkehren zur »supraindigenen« Sphäre, von der ich »herabgestiegen bin«, hinunter zu den Quechuas, und sagen, ich könne die Seele und den Appetit Don Felipes besser und weitaus tiefgründiger deuten als Don Felipe selbst. Mangel an Respekt und kein legitimer Gedanke! Nicht zu rechtfertigen! So würde dieser García Márquez nicht daherreden, der große Ähnlichkeiten aufweist zu Doña Carmen Taripha aus Maranganí, Cuzco. Carmen hat dem Priester, von dem sie aufgezogen wurde, endlose Geschichten erzählt über Füchse, Verdammte, Bären, Schlangen, Eidechsen; mit Leib und Stimme hat sie die Tiere imitiert. So gut imitiert, dass sich der Salon des Pfarrhauses in Höhlen, Berge, Punas und Schluchten verwandelte, wo es war, als kröchen Schlangen durch Gras und Gehölz, als spöttelte grausam der Fuchs, als spräche der Bär wie mit Teig im Mund und die Maus so scharf, dass sie sogar Schatten durchtrennt; und Doña Carmen ging wie ein Fuchs und wie ein Bär, bewegte die Arme wie eine Schlange und wie ein Puma, wedelte sogar mit dem Schwanz; und sie heulte wie Verdammte, die unersättlich Menschen verschlingen; der Salon des Pfarrhauses glich also den Seiten von Hundert Jahre Einsamkeit … wobei es in Hundert Jahre Einsamkeit nur Menschen gibt, die so gar nichts mehr von einem Tier haben, und in den Geschichten der Taripha Tiere die Natur des Menschen verdeutlichen in ihrem Anfang und ihrem Ende.
Mir scheint, ich rede nur deshalb so »tollkühn« daher, weil ich gemütskrank bin. Und nicht, weil ich davon ausgehe, dass diese Seiten erst dann veröffentlicht werden, wenn ich mich bereits erhängt oder mir die Schädeldecke weggeschossen habe, was ich, ehrlich gesagt, erst einmal tun muss. Es kann ja auch sein, dass ich hier, in Santiago, geheilt werde wie schon 1962, von einer Krankheit gleichen Kalibers und Ursprungs, wenngleich ich damals weniger schwer betroffen war und noch im besten Alter. Und wenn ich tatsächlich geheilt werde und ein Freund, den ich respektiere, mir sagt, dass diese Seiten zur Veröffentlichung taugen, dann werde ich sie auch veröffentlichen. Denn wenn ich nicht schreibe und veröffentliche, jage ich mir eine Kugel in den Kopf. In San Miguel de Obrajillo war ich sehr wohl versucht, weiterleben zu wollen, und sei es nur, um die Sonne dieses Dorfes zu spüren und den ganzen lieben Tag lang die herrenlosen Hunde und Schweine zu streicheln. Doch würde dieser Genuss nicht lange für Ausgleich sorgen. Obwohl ich mich sehr gut verstehe mit den Hunden dieser Bergdörfer, die auf Straßen und Feldern streunen und gut überlegen, was sie tun, würde diese uralte Freundschaft die tausend Ängste nicht besänftigen, die ein so aufgewühlter und ungeduldiger Mensch wie ich kultiviert und multipliziert. Ach, welcher Tod war meinem Freund Guimarães Rosa doch beschieden! Jeder hat da seine eigene Art. Diese Art von Schreiben bietet natürlich keinen Raum für Geistesblitze wie die eines Don Julio, auch wenn sie von Vorteil und Nutzen sind. Guimarães hat mir in Mexiko mal etwas anvertraut, als ich mich »deprimierter« als gewöhnlich fühlte aufgrund eines vorübergehenden Fiebers. Worum es ging, tut nichts zur Sache. Damals aber habe ich gespürt, dass dieser Respekt gebietende Botschafter mit mir sprach, weil er wie ich bis in die tiefsten Tiefen seines Volkes »hinabgestiegen« war, was bei ihm meiner Ansicht nach mehr wert ist, weil er »hinabgestiegen« ist und nicht »hinabgestiegen« wurde. Nachdem er mir seine Geschichte erzählt hatte, grinste er mich an wie ein Bub. Kein Freund aus der Stadt hat mich so sehr von gleich zu gleich behandelt, so inniglich wie in jenen Momenten dieser Guimarães; ich spreche hier von Schriftstellern und Künstlern; weder Gody Szyszlo noch E. A. Westphalen noch Javier Sologuren, und schon gar nicht die hoch angesehenen Ausländer. Ein bisschen vielleicht … Pepe Revueltas, aber anders. Guimarães war nicht bissig, das schien er nicht gelernt zu haben. Die Bissigkeit kenne ich von intelligenten Autoren, wenn sie wütend sind. So weit kommt es nicht, glaube ich, bei uns, bei denen stets das Erbarmen und die Kindheit lauern. Ich denke da an Nicanor Parra, der so weise ist, so zartfühlend und so skeptisch, und der sich einen Schutzpanzer zugelegt hat, der zwar alles hereinlässt, aber gefiltert, und den Kritik an seinem Werk trifft, nicht aus Eitelkeit, sondern als wäre da eine offene Wunde! Wie verbittert und wütend er deswegen werden kann! In der Stadt, liebe Freunde, in der Stadt habe ich, glaube ich, niemanden mehr geliebt als diesen Nicanor, und es ist mir niemand so sehr abhandengekommen wie er. Aber warum muss ich diese Sachen über Nicanor erzählen? Viel Stadt trug oder trägt er in sich, dieser gemischte, im Dorf geborene Caballero, der intelligenteste Mensch von allen, die ich in Städten kennengelernt habe. Was er alles erzählte, wusste und nicht wusste und weiß über die Frauen! Sein Bruder Roberto war mehr mein Bruder als sein Bruder, natürlich, denn mein Umgang mit Roberto lief immer über die gute Seite. Verzeihen Sie mir, wenn ich sage, dass dieser Roberto für immer und ewig mit Zärtlichkeit infiziert worden war in den unzähligen Bordellen Chiles, in denen er sang und die Gitarre spielte, und dass es mir genauso erging in den ayllus von Ayacucho, den Großfamilien, unter den Indiofrauen, die litten und sangen wie Kolibris, die zur Sonne fliegen, von ihr trinken und wieder zurückkehren. Im selben Zimmer haben wir geschlafen, Roberto und ich, bei Nicanor, in La Reina, als ich 1962 krank herkam. Ja, ich fange noch mal an mit dieser alten Leier; ja, für mich war Roberto wie ein jüngerer, zugänglicherer Felipe Maywa. Denn während Roberto mit der Stimme eines resignierten Menschen ohne viel Zukunft mit mir sprach, eher traurig und nach Wertschätzung heischend, streichelte mich Don Felipe in San Juan de Lucanas wie ein Kalb, das keine Mutter mehr hat. Er besaß die Ausstrahlung eines Indios, der durch langes Lernen und Überlieferung die Natur der riesigen Gebirge kennt, ihre Sprache und die der Insekten, der Wasserfälle und der großen wie kleinen Flüsse; auch wenn er der »Lakai« meiner Stiefmutter war oder manchmal, glaube ich, auch Kuhhirte, trat er ihr gegenüber auf wie jemand, der Schutz bieten kann, wie jemand, der tatsächlich Schutz bietet, obwohl er ein Diener ist. Meine ganze Zukunft und auch die meiner Stiefmutter, die ja die Herrin Don Felipes war, schien von Don Felipe Maywa abzuhängen. So kam es mir wenigstens vor, warum, weiß ich nicht; einen Grund dafür muss es gegeben haben. Wenn dieser Mann mir in der Küche oder im Kälberpferch den Kopf streichelte, legte sich nicht nur all meine Unruhe, sondern strömte in mich der Mut, es mit jeder Art von Feind aufzunehmen, und seien es Dämonen oder Verdammte. Und ich war wahrlich unruhig; war allein unter den indianischen Bediensteten, allein vor den gewaltigen Bergen und Abgründen der Anden, wo die Bäume und Blumen wehtun vor Schönheit, weil sich darin die Einsamkeit und Stille der Welt ballen. Dieser Roberto, der Bruder von Nicanor Parra, sang mit einer anderen, wenn auch ähnlichen Art von Einsamkeit; er spielte Cuecas auf der Gitarre, die irgendwie verzweifelt waren, erfüllt von einer mehr ängstlichen als genießenden Freude. Deshalb waren wir in La Reina so enge Freunde. Er erzählte mir von einem Freund, der einfach auf einem Stein sitzen geblieben war und gewartet hatte, mit einem bemalten Auge. Wie großartig ist doch das Leben gewesen bei Nicanor und Roberto Parra! Wie haben sie doch den Saft getrunken, diese beiden Brüder, die so unterschiedlichen Säfte der Welt! Ich sprach mit Roberto in einem Zustand der Vertrautheit, die eine der merkwürdigsten Formen des Glücks ist. Er erzählte mir von seinen Erlebnissen in den Bordellen und ich ihm Geschichten von Tieren und Verdammten, die meine Stärke sind. Roberto betrinkt sich bis zur Qual; und ich werde krank vor wahrscheinlich pathologischer Einsamkeit und unschuldiger Freude, »aus reinem Vergnügen«, weil ich von guten und schönen Menschen geliebt werde, wie zum Beispiel von meiner Frau. Aber irgendetwas wurde uns angetan, als wir am wehrlosesten waren; ich erinnere mich an vieles, doch am gefährlichsten, wie es heißt, ist das, woran wir uns nicht erinnern. So wird es sein. Und García Márquez? Von dem hat er, glaube ich, auch etwas berichtet. García Márquez erzählt vom Menschen auf diesem Kontinent, der von den europäischen Ansichten und Seinsweisen verseucht ist, erzählt mit der Fantasie und Gewissheit, mit der Carmen Geschichten über Bären und Schlangen erzählte. Absolut wahr und absolut erfunden. Fleisch und Blut und reine Illusion. Ich habe Gabriel nicht kennengelernt. Dafür war ich zu niedergeschlagen, als er nach Lima kam. Außerdem wusste ich, dass ihn die Neugierigen, die Kenner und die Bewunderer sehr in Beschlag nahmen. Das ist nur gerecht, er kann ja nicht so sein wie Don Alejo oder wie Juan; ob er womöglich eine Kombination ist aus Carpentier, Rulfo und Carmen Taripha in seiner Lebendigkeit? Angeblich weiß er zu fesseln, wie schön! Dann hat er bestimmt auch etwas vom Negro Gastiaburú.
15. Mai
Ich habe gestern Abend etwas getan, was nicht ratsam war, nicht ratsam für mich. Jeder nimmt ab und zu wissentlich Gift; und ich spüre die Wirkung immer sofort. In meiner Erinnerung hat die Sonne in dem hoch gelegenen Dörfchen San Miguel de Obrajillo sich wieder gelb gefärbt, gelb wie diese Blume, die aussieht wie ein Säuglingspantöffelchen, eine Blume, die nicht oder lieber nicht auf Feldern wächst, sondern auf den von Menschen erbauten Mauern, überall in den Bergdörfern Perus. Diese samtene Blume, an der sich die pechschwarzen Hummeln, die Huayronqos, gelb einstäuben und trotzdem schwärzer und stählerner wirken als auf weißen Lilien. Denn auf dieser kleinen Blume lässt sich die große Huayronqo nieder, gestikuliert, flattert, stopft sich voll. Die Oberfläche der Blume ist samten, die des Insekts schimmernd, so schwarz, dass es bläulich wirkt, wie die Mähne wirklich schwarzer Fohlen. Ich weiß nicht, ob es an der Form und der Farbe der Blume liegt, an der gierigen, irgendwie tödlichen Art, mit der die Hummel in die Krone drängt, zappelt und mit ihren begierigen Extremitäten den gelben Staub verschlingt; ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass diese Blume in meinem Dorf ayaq sapatillan heißt (Todespantöffelchen) und die Leiche symbolisiert. Man legt sie in Sträußen auf die Särge und auf den Totengrund neben die Leichen. Dass ich so sehr an die Huayronqo habe denken müssen, an diese Blumensträuße und an die Sonne von San Miguel de Obrajillo in der Abenddämmerung, ist kein gutes Zeichen. Ich hatte mich heiter dem Leben genähert, bis gestern. Heute fühle ich mich nicht des Todes, wie ich noch am Montag, den 11., schrieb. Würde ich dies behaupten, wäre dies in gewisser Weise die Bestätigung oder der Beweis für das Gegenteil. Jetzt, in diesem Augenblick, hat dieses Gelb, das nicht nur ein böses Vorzeichen ist, sondern die Materie des Todes selbst, dieses Gelb auf der Hummel, die man in meinem Dorf so einfach tötet, sich in meinem Gedächtnis eingenistet, in diesem schleichenden, hässlichen Nackenschmerz. Werde ich nie wieder schreiben können? Adios bis in einigen Tagen, vielleicht bis in einigen Stunden! Der Strom der lebendigen Welt war in mir wieder angeschwollen. Heute, gestern Abend, ließ ich mich dazu hinreißen, wie ein schuldiger Gewohnheitstrinker meine kleine Dosis Gift zu nehmen. Ich hatte beschlossen etwas zu Cortázars Diktum über den Berufsschriftsteller zu sagen. Ich bin kein Berufsschriftsteller, Juan ist kein Berufsschriftsteller, dieser García Márquez ist auch kein Berufsschriftsteller. Romane und Gedichte zu schreiben ist kein Beruf! Oder vielleicht verstehe ich mit meiner nationalen Erfahrung, in deren Ritzen noch einiges an Provinziellem steckt, das Wort Beruf provinziellerweise als ein Handwerk, das man gelernt hat und stolz und zufrieden ausübt, um Geld zu verdienen. In diesem Sinne bin ich ein provinzieller Schriftsteller; ja, mein bewunderter Cortázar; und so verstehe ich, irrtümlicherweise oder nicht, auch das, was Don João war und Don Juan Rulfo ist. Denn andernfalls dürfte Juan, der den Beruf bis ins Unendliche kennt, nicht arm sein. Ich musste Ethnologie studieren, um einen Beruf zu haben; der Botschafter war Arzt; Juan wählte das Angestelltendasein. Wir schreiben aus Liebe, Vergnügen und Notwendigkeit, nicht von Berufs wegen. Auf die Idee, einen Roman zu planen und auf Honorare zu spekulieren, scheinen mir eher Leute zu kommen, die sich spezialisiert haben. Ich lebe, um zu schreiben, und ich glaube, dass man unbedingungslos leben muss, um das Chaos und die Ordnung zu deuten.
Ah! Das letzte Mal, dass ich Carlos Fuentes gesehen habe, schrieb er wie ein Maurer, der im Akkord arbeitet. Er musste seinen Roman zu einem bestimmten Termin abgeben. Wir aßen schnell zu Mittag, bei ihm zu Hause. Er musste zurück an die Schreibmaschine. Angeblich ging es auch Balzac und Dostojewski so. Ja, aber für sie war es ein Unglück und nichts, worauf sie stolz waren. Oder hätten sie etwa das, was sie geschrieben haben, unter anderen Umständen nicht geschrieben? Wer weiß. Was hätten sie mit dem, was sie in der Brust hatten, denn sonst getan? Verzeiht, Freund Cortázar, Freund Fuentes, und auch du, Mario, der du in London lebst. Mir scheint, ich fasle dummes Zeug, dabei will ich das Gleiche wie ihr, das Gleiche, worüber ich mich hier so ärgere. Kann sein, dass ihr genauso oder nicht mehr und nicht weniger Recht habt als ich. Es gibt Schriftsteller, die erst dann zu arbeiten beginnen, wenn das Leben sie triezt, ein Triezen, das sie nicht freiwillig gewählt haben, sondern das ihnen auferlegt ist, und dann gibt es noch euch, die ihr, wie man sagen könnte, mehr von einem Berufsschriftsteller habt. Vielleicht ist euer Verdienst größer, aber ist es nicht natürlich, dass wir uns ärgern, wenn jemand behauptet, die Professionalisierung des Romanciers sei ein Zeichen des Fortschritts, einer größeren Perfektion? Vallejo war kein Berufsschriftsteller, Neruda ist einer; Juan Rulfo ist keiner. Ist García Márquez einer? Würde es ihm gefallen, wenn man ihn einen Berufsschriftsteller nennen würde? Von Molière könnte man sagen, dass er ein Berufsschriftsteller war, von Cervantes hingegen nicht.
(Der gelbe Staub der Hummel, der sich mir scheinbar auf die Knochen gelegt hatte, hat sich ein wenig gelöst. Schreibend gegen den Tod anzukämpfen ist kein Unglück. Ich glaube, die Ärzte haben Recht. Die, die mich behandeln, tun dies nicht als Berufsvertreter, sondern als Mitmenschen.)
16. Mai
Die Wirkung des Gifts hält an. Es ist, als wären meine Augen mit diesem gelben Pulver verklebt, das die Huayronqo mit ihrem schwarzen Leib umarmt. Ich habe in meinem Auge die Schwere dieses fliegenden Insekts, das mit seinem mineralischen Kopf gestikuliert, mit seinen Beinchen, die mit mikroskopisch kleinen Härchen überzogen sind und sich langsam bewegen, die aber dennoch, da sie aus einem breiten, metallisch schimmernden Panzer ragen, den Eindruck von Gier erwecken, die langsam befriedigt wird; mit jeder Bewegung, die triumphal wirkt, spitz, das Ergebnis der maximalen Anstrengung, der Explosion des Lebens in diesen Körpern, die, wenn man sie zertritt, wie Eierschale klingen, wie Lamellengerippe. Es hat schon seinen Grund, warum diese mit dem Keim der gelben Blume bestäubte Huayronqo bei den Quechuabauern gefürchtet ist als eine Seele, die sich ergötzt am Boden des samtenen Täschchens, das eine Leichenblume ist. Und auch der Flug der Huayronqo ist seltsam, eine Mischung aus Fliege und Kolibri. Es ist gerade mal fünfundvierzig Tage her, dass ich die Hummel in San Miguel de Obrajillo gesehen habe. Wie ein Helikopter und ein Kolibri und ein Turmfalke kann sie in der Luft schweben. Die Huayronqo hat einen riesigen Leib, der fast so sehr schimmert wie der eines Kolibris. Und in San Miguel fliegt sie noch höher als in den unzähligen Dörfern, in denen ich so aufmerksam und ausgiebig ihre Flugbahn verfolgt habe. Sie ist fast so wendig wie ein Kolibri, führt wie er äußerst ruckartige Manöver aus. Dabei ist sie ein Insekt! In San Miguel de Obrajillo fliegt sie zehn, wenn nicht gar zwanzig Meter hoch. Es ist eine Hummel, und in zwanzig Metern Höhe wirkt ihr vom eigentümlichen Flattern der transparenten Flügel in der Luft gehaltener Körper, als wäre er so weit weg, dass sich das Auge sehr anstrengen muss, um ihn zu sehen, um die eindringliche Bedeutung seiner hängenden, oft gelb gesprenkelten Beinchen und seines schildkrötengleichen Körpers in unser Leben aufzunehmen. Plötzlich, ganz blitzartig hebt sie ab, aber nicht so schnell, dass das Auge, das sie betrachtet, ihr nicht folgen könnte. Es folgt ihr, und diejenigen unter uns, die wissen, was sie ist, werden von dieser gepanzerten Hummel in den Bann gezogen. In diesem Moment spüre ich sie hinter meiner Stirn, wie sie mich langsam mit ihrem Friedhofsstaub berieselt und meine Krankheit verschärft. Aber keine Selbstmordwünsche mehr! Es ist im Gegenteil eine gewisse Härte im Körper meiner Augen, ein diffuser Schmerz, als wäre der Grund bösartig, als wäre er der gefürchtete, nicht erwünschte Tod. Ja, mein liebster João Guimarães Rosa, irgendwie werde ich dir schon erzählen, woraus mein Gift besteht. Es ist vulgär, und trotzdem erinnert es mich an deine Geschichte über diesen Mann, der mit seinem Boot losfuhr, auf einem Dschungelfluss, und der erwartet wurde, ewig erwartet … dabei war er, glaube ich, längst tot. Es muss eine Verbindung geben zwischen dem Flug der mit Friedhofspollen bestäubten Huayronqo, dem durch das Gift ausgelösten Druck überall in meinem Kopf und dieser Erzählung von Ihnen, João.
17. Mai
Sie war aus Ukuhuay gekommen, einem heißen Dorf. Es heißt, sie sei Chicha-Verkäuferin. Die Bäume in der engen Schlucht, auf deren Grund die Häuschen von Ukuhuay standen, waren von Parasiten befallen, die gut gediehen, und von »Spanischem Moos«. Von »Spanischem Moos«, das so leblos wirkt mit seinen langen, fadenartigen Blättern; sie verwurzeln sich in der Rinde der Bäume, die auf Felsvorsprüngen wachsen; sie sind hellgrau; Bewegung kommt erst dann in sie, wenn ein starker Wind weht, denn sie sind schwer, angereichert mit dichter pflanzlicher Essenz. Das »Spanische Moos« hängt über Abgründen, in denen der Gesang der Vögel, besonders der Wanderpapageien, widerhallt; ima sapra heißt das »Spanische Moos« auf Quechua. Das ima sapra fällt auf durch seine Farbe und seine Form; die Bäume strecken sich zum Himmel, das ima sapra zu den Felsen und zum Wasser; wenn eine Böe es trifft, schaukelt es schwerfällig