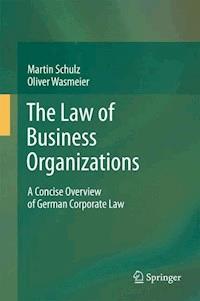12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch nie war die Europäische Union so umstritten: Nach fünf Jahren Krise gilt sie vielen als Auslaufmodell, als Inbegriff ausufernder Bürokratie, als Wohlstandsgrab. Der Euro steht auf dem Spiel, deutsche Zeitungen lästern über die «Pleite-Griechen», während im Süden das Bild vom hässlichen Deutschen wiederauflebt. Erstmals besteht die reale Möglichkeit, dass das Projekt Europa scheitert. Aber welche Folgen hätte ein Ende des Euro oder gar der Union? Martin Schulz, der ebenso streitbare wie respektierte Präsident des Europaparlaments, zeichnet ein realistisches und daher umso beunruhigenderes Szenario: Der europäische Binnenmarkt könnte zerfallen, die Arbeitslosigkeit weiter steigen, Europas Staaten wären den USA oder Schwellenländern wie China hoffnungslos unterlegen, während von innen ein neuer Rechtspopulismus droht. Auf provokante Weise räumt Martin Schulz mit den Illusionen der Europaskeptiker auf – und plädiert für eine echte europäische Demokratie, ein starkes Europa, dessen soziale Gerechtigkeit weiterhin weltweit als Vorbild gelten kann. Nur wenn wir unsere Errungenschaften selbstbewusst verteidigen, können wir unseren Wohlstand sichern und unseren Kontinent vor der Bedeutungslosigkeit bewahren. Eine Streitschrift, die zugleich einen Ausweg aus der Krise weist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Martin Schulz
Der gefesselte Riese
Europas letzte Chance
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Ein zu sicher geglaubter Friede
Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte ist das Scheitern der Europäischen Union ein realistisches Szenario. Dieses Scheitern ist nicht unabwendbar, aber es wird immer häufiger diskutiert und hat für manchen seinen Schrecken verloren. Vor ein paar Jahren wäre das noch unvorstellbar gewesen. Inzwischen hat sich die Stimmung radikal gewandelt, und die öffentliche Debatte wird von EU-kritischen Tönen dominiert. Darum schreibe ich dieses Buch. Es ist ein Buch, in dem ich die Idee der europäischen Einigung verteidigen will. Ich bin davon überzeugt, dass sie zu den wichtigsten Errungenschaften der vergangenen hundert Jahre gehört. Deshalb können die europäischen Bürger auch stolz darauf sein, dass dieses Aufbauwerk im Dezember 2012 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist.
Dass ich für die EU eintrete, wird erst einmal niemanden überraschen, schließlich bin ich als langjähriger Europaparlamentarier und als Präsident des Europäischen Parlaments Teil des europäischen Systems. Aber ich will es nicht bei einer schlichten Verteidigung der EU belassen. Auch ich bin unzufrieden und zornig über den Zustand, in dem sich die europäischen Institutionen befinden, und will deshalb nicht die EU verteidigen, wie sie momentan aussieht, sondern vielmehr beschreiben, wie sie aussehen könnte, wenn wir sie verändern und verbessern. Und ich will an die eigentlich selbstverständliche Tatsache erinnern, dass der Fortschritt jeden Tag aufs Neue erstritten werden muss. Das gilt für Europa genauso wie für unser alltägliches Miteinander. Die einfache Erkenntnis lautet, dass man sich nicht auf seinen Erfolgen ausruhen darf, sondern immer wieder darum kämpfen muss, sie zu bewahren und auszubauen. Sonst bröckelt der Putz von den Wänden, und das Dach wird undicht. Darum will ich mit diesem Buch ein Plädoyer für eine stärkere Integration Europas halten. Ein Plädoyer für den Angeklagten EU, der zum Teil zu Recht auf der Anklagebank sitzt und zum Teil zu Unrecht. Er ist ein Angeklagter, den man vielleicht in eine Besserungsanstalt schicken muss, der es aber nicht verdient hat, dass man ihn zum Tode verurteilt.
Manchmal scheint es mir, als habe die EU eine geradezu verblüffende Ähnlichkeit mit dem Scheinriesen Tur Tur aus dem wunderbaren Buch «Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer» von Michael Ende. Dieser Scheinriese stellt die Gesetze der Physik komplett auf den Kopf. Er wird nicht optisch kleiner, je weiter er sich entfernt, sondern immer größer, bis er aus weiter Distanz wie ein gewaltiger Riese erscheint. Aus der Nähe dagegen erkennt man, dass er einen zerschlissenen Rock trägt, eigentlich recht klein ist und auch sonst nicht sonderlich angsteinflößend aussieht. An diese Geschichte muss ich oft denken, wenn ich außerhalb der EU unterwegs bin. Denn je weiter man sich von Europa entfernt, umso größer ist die Faszination, die von der EU ausgeht: Frieden, Freiheit, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit sind Begriffe, die mit Europa verbunden werden. Das «Modell Europa» steht für viele Beobachter auf anderen Kontinenten für eine freie Presse, unabhängige Gerichte, eine Kranken- und Rentenversorgung für jedermann und Aufstiegschancen auch für Benachteiligte. Es ist ein Modell, um das uns viele Menschen weltweit beneiden – vor allem diejenigen, die in ihren Ländern weder Freiheit noch soziale Sicherheit genießen. Europa hat etwas geschaffen, das der amerikanische Vordenker Jeremy Rifkin den «europäischen Traum» nennt.
Vielerorts ist unser Kontinent ein Ort der Sehnsucht, und in einer Reihe von Regionen versucht man, etwas Ähnliches zu verwirklichen, sei es in wirtschaftlicher, sei es in politischer Hinsicht. So hat unser Binnenmarkt mittlerweile mehrere Nachahmer gefunden, etwa den Gemeinsamen Markt Südamerikas (Mercosur) und das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA). Zuletzt hat der Verband der südostasiatischen Staaten (ASEAN) beschlossen, einen Wirtschaftsraum nach europäischem Vorbild zu gründen. Sowohl der ASEAN als auch die Afrikanische Union bemühen sich darüber hinaus um eine stärkere politische Integration der beteiligten Staaten, und im Shanghaier Kooperationsbündnis versuchen China und Russland, sich mit ihren zentral- und mittelasiatischen Partnern besser abzustimmen. All diese Bündnisse sind zwar weit davon entfernt, einen Integrationsstand zu erreichen, der vergleichbar mit dem europäischen wäre, aber sie orientieren sich – mal mehr, mal weniger explizit – an der EU und versuchen, das Geheimnis des europäischen Erfolgs der letzten fünfzig Jahre zu ergründen.
Genau wie der Scheinriese Tur Tur, der von weitem so mächtig und aus der Nähe so schäbig, alt und heruntergekommen aussieht, erscheint allerdings auch die EU umso erbärmlicher, je näher man an ihr Zentrum heranrückt. Sowohl am Stammtisch als auch im Feuilleton ist das EU-Bashing zum Modesport geworden, und in allen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft sinken die Zustimmungswerte – auch bei uns in Deutschland, obwohl wir bislang zu den begeisterten Europäern zählten. Das Meinungsforschungsinstitut Emnid überraschte im Sommer 2012 mit der Meldung, fünfundsechzig Prozent der Deutschen glaubten, dass es ihnen ohne die europäische Gemeinschaftswährung besserginge, immerhin achtundvierzig Prozent meinten sogar, die deutsche EU-Mitgliedschaft an sich bringe ihnen persönliche Nachteile. Das sind die schlechtesten Zustimmungswerte für die EU, die in Deutschland je gemessen wurden. Entsprechend zeichnen die Schlagzeilen der Zeitungen ein düsteres Bild. Von «Abstieg», «Untergang» oder zumindest von «verlorenem Einfluss» Europas ist da zu lesen; der Buchmarkt wird derweil beherrscht von Titeln wie «Europa nach dem Fall», «Europa vor dem Crash» und «Europas harte Landung». Seit nunmehr fünf Jahren klingt uns dieser Dauersound der Krise in den Ohren – das bleibt nicht ohne Folgen. Wir sind es nicht gewohnt, als die Sorgenkinder der Weltwirtschaft betrachtet zu werden und plötzlich aus den USA oder aus China Ratschläge zu erhalten, was wir tun und was wir lassen sollen. Aus unserer Sicht waren immer die anderen die Sorgenkinder, nun registrieren wir verunsichert, wie sich mancherorts in die Bewunderung für die EU eine verhaltene Schadenfreude darüber mischt, dass nach der Asien-Krise in den achtziger Jahren und dem regelmäßig vorhergesagten Niedergang der USA jetzt auch Europa einmal Schwächen zeigt. Wir fühlen uns wie ein alter kranker Patient, der von den anderen gesagt bekommt, was richtig für ihn ist und was falsch.
Die Krise rührt an unserem Selbstbewusstsein, und sie tut weh. Die Schmerzen sind zwar nicht in allen EU-Staaten gleich schlimm, spürbar aber sind sie überall. Vor allem in den südlichen Mitgliedsländern der Gemeinschaft geht es ans Eingemachte, viele ihrer Bürger haben immer weniger Geld, können ihre Häuser nicht mehr abbezahlen, die Renten werden gekürzt, und die Jobaussichten sind miserabel. Hoffnungslosigkeit breitet sich aus, manche resignieren vollkommen. Doch auch bei denen, die noch nicht persönlich von der Krise betroffen sind, geht die Angst um, dass es ihnen bald deutlich schlechter gehen wird. Die Menschen sind verunsichert, das spürt man in Europa allerorts. Und es besteht die Gefahr, dass der Schmerz zu groß und der Wunsch übermächtig wird, die Krise möge doch endlich aufhören – egal, auf welchem Weg man das erreicht. Bitte keine Krise mehr, denken alle, und manche schreien es auf den Plätzen der europäischen Hauptstädte heraus und demonstrieren gegen die bestehenden Verhältnisse und für eine andere Politik.
Ich kann die Wut verstehen, die viele in sich tragen; ich empfinde sie auch. Gleichzeitig aber mache ich mir große Sorgen um unsere Gemeinschaft. Denn die Wut über eine verfehlte Politik in der Europäischen Union hat sich im Verlauf der Krise zunehmend gegen die EU als Institution gewandt und gefährdet nun ausgerechnet das, was man weltweit das «europäische Gesellschaftsmodell» nennt. Bezeichnenderweise ist das europäische Selbstbewusstsein gegenüber den aufstrebenden Staaten, die in den letzten Jahren beeindruckende Wachstumszahlen vorweisen konnten, mittlerweile auf Erbsengröße geschrumpft. Die Krise lässt uns mit unserem Föderalismus, unserem Wirtschaftssystem und sogar mit unserer Demokratie hadern. Selbst an unseren Erziehungsmethoden und unserem Schulwesen zweifeln wir und fragen uns, ob das asiatische Modell nicht vielleicht doch das bessere wäre. Plötzlich wird über die vermeintliche europäische Kuschelpädagogik gelästert und offen darüber diskutiert, ob ein harter Drill unserer Kinder die besseren Ergebnisse bringen würde – wobei mit besseren Ergebnissen «effizientere» Kinder gemeint sind, die in der Welt des 21. Jahrhunderts optimal funktionieren sollen. Wer jedoch meint, Europa gewinne an Wettbewerbsfähigkeit, indem wir unsere Kinder drillen, oder allgemeiner gefasst: indem wir Menschen und Ressourcen erbarmungslos ausbeuten, der hat die Idee der menschlichen Würde und der Erhaltung der Lebensgrundlagen auf unserem Planeten zugunsten einer knallharten Effizienzideologie aufgegeben. Das ist nicht die Welt, für die ich kämpfe. Ich glaube allerdings auch nicht, dass unsere Zukunft so aussehen muss – denn ich bin fest davon überzeugt, dass Europa etwas Besseres zu bieten hat.
Ich komme aus Würselen, einer Stadt mit knapp vierzigtausend Einwohnern bei Aachen, mitten im Dreiländereck. In meiner Kindheit und Jugend in den sechziger Jahren waren die Grenzen allgegenwärtig, die niederländische und belgische und nicht weit entfernt auch die luxemburgische. Bei Fußballländerspielen wurden die Übergänge nach Holland oft geschlossen, wenn die Emotionen hochkochten und es Krawall gab. Dennoch herrschte ein reger Grenzverkehr. Man besuchte Bekannte oder fuhr ins Nachbarland, um preiswert einzukaufen. Wenn wir das taten, hatten wir immer mehrere Portemonnaies dabei, eins mit der deutschen Mark, eins mit holländischen Gulden und eins mit belgischen Francs. Es war die Zeit, als der 1. FC Köln in der Fußballbundesliga noch oben mitmischte und 1962 und 1964 Deutscher Meister wurde. Da war Lukas Podolski noch gar nicht geboren. Alemannia Aachen spielte noch in der ersten Fußballbundesliga und wurde 1969 sogar Vizemeister. Bei uns in der Gegend herrschte damals Ausnahmezustand, weil bis in die Nacht gefeiert wurde. Staatsgrenzen hatten für die Menschen zu dieser Zeit noch eine viel größere Bedeutung: Wenn ein deutscher Fußballer ins Ausland wechselte, war das eine Sensation, allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne. Manche Fans hielten den 2012 verstorbenen großen Augsburger Fußballer Helmut Haller für einen Verräter, als er 1962 zum FC Bologna ging. Die meisten Zuschauer in Deutschland konnten mit ihren kleinen Fernsehern nur ARD, ZDF und ein regionales drittes Programm empfangen, das noch bis 1967 ausschließlich in Schwarzweiß ausgestrahlt wurde. Dafür guckte die ganze Nation zu, wenn Peter Frankenfeld oder Hans-Joachim Kulenkampff am Samstagabend auf Sendung waren. Kulenkampffs Spielshow EWG («Einer wird gewinnen»), die 1964 erstmals lief, war populärer als die mit demselben Kürzel versehene Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Was würden heutige Moderatoren für solche Einschaltquoten geben?
Die Sechziger waren auch die Zeit, in der die Dominanz der Konservativen zu bröckeln begann. Jahrzehntelang war Deutschland von der CDU regiert worden, 1966 saß dann die SPD zum ersten Mal mit am Kabinettstisch – wenn auch zunächst nur als Juniorpartner. Den frischen Wind, den dieser Wechsel in die politische Landschaft brachte, konnte auch ich in meiner Familie spüren. Meine Mutter, deren Eltern treue Wähler der katholisch-konservativen Zentrumspartei waren, hatte nach dem Krieg eine CDU-Ortsgruppe mitgegründet, mein Vater hingegen war als elftes Kind in eine Bergarbeiterfamilie hineingeboren worden und Sohn eines Mitbegründers des SPD-Ortsvereins Elversberg. An die abendlichen hitzigen Diskussionen bei uns am Küchentisch erinnere ich mich gut. Vor allem meine älteren Geschwister waren der Meinung, dass man sich jetzt mit Politik und Gesellschaft auseinandersetzen müsse. Sie fühlten sich endlich vom Staat ernst genommen und zum Mitmachen eingeladen. Und als Willy Brandt 1969 zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler gewählt wurde, war der Bundesrepublik das gelungen, was Demokratien auszeichnet: ein friedlicher Machtwechsel.
Die Europäische Gemeinschaft beschränkte sich damals noch auf sechs Mitgliedsstaaten: Belgien, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Italien und Deutschland. Die Staats- und Regierungschefs, die diese Zusammenarbeit initiierten, reisten noch überwiegend mit dem Zug, und sie schrieben sich gegenseitig lange Briefe, die sie ihren Sekretärinnen diktierten und dann auf Schreibmaschine tippen ließen. Viele aus meiner Generation denken, dass das eine gute, vielleicht eine bessere Zeit als heute war. Ich denke das nicht!
Wenn ich heute mit jungen Menschen über die damalige Zeit diskutiere, ist es ein bisschen so, als würde Opa vom Krieg erzählen. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass meine Generation eben nicht mehr aus der eigenen Erfahrung heraus vom sinnlosen Töten und Nächten im Bombenkeller erzählen kann: Ich habe diese furchtbaren Dinge, im Gegensatz zur Generation meiner Eltern und Großeltern, nicht erleben müssen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa endlich jene Entscheidungen getroffen worden sind, die verhindern, dass sich die Völker unseres Kontinents immer wieder in blutige Konflikte stürzen. Deswegen erzählt meine Generation ihren Kindern heute, was wir aus den Erfahrungen unserer Eltern gelernt haben und warum wir die europäische Einigung voranbringen müssen, auch wenn das oft zäh, nervig und frustrierend ist.
Viele Menschen scheinen aber zu glauben, dass es für die Situation, in der sie gegenwärtig leben, eine Art Ewigkeitsgarantie gibt. Das ist im besten Fall naiv und im schlimmsten Fall gefährlich. Wer sich mit der Geschichte beschäftigt, vor allem mit der europäischen und deutschen Historie, der erkennt sehr schnell, dass unser Kontinent über Jahrhunderte hinweg von Kriegen, Armut und Unterdrückung beherrscht wurde, während längere Phasen des Friedens und des Wohlstands die Ausnahme waren.
Vor zweihundert Jahren fand bei Leipzig die Völkerschlacht statt, bei der die europäischen Mächte sechshunderttausend Soldaten auf die Schlachtfelder schickten. Innerhalb von vier Tagen kam damals die unvorstellbar große Zahl von neunzigtausend Menschen ums Leben. Die darauffolgenden Waffengänge konnten weder durch den Wiener Kongress noch den Völkerbund verhindert werden; allein Frankreich und Deutschland fochten zwischen 1870 und 1945 in drei verheerenden Kriegen gegeneinander. Länger andauernden Frieden und Wohlstand genießen wir in West- und Mitteleuropa seit gerade einmal knapp siebzig Jahren. Griechenland, Portugal und Spanien wurden noch bis in die siebziger Jahre von faschistischen Diktatoren beherrscht, für die Völker in Osteuropa, einschließlich der Deutschen in der DDR, dauerte das Zeitalter der Unfreiheit sogar bis ins Jahr 1989 an, als die Menschen in Leipzig, Warschau und Prag endlich die kommunistischen Regime und den Eisernen Vorhang zu Fall brachten. Und trotz des bevorstehenden EU-Beitritts Kroatiens im Jahr 2013 und der Aussicht auf einen möglichen Beitritt Serbiens sollten wir nicht vergessen, dass die Kriege im ehemaligen Jugoslawien weniger als fünfzehn Jahre zurückliegen und im Kosovo noch immer internationale Schutztruppen ein Wiederaufflammen ethnischer Konflikte verhindern müssen.
Frieden, Freiheit und Wohlstand sind also nicht in der europäischen DNA verankert. Es waren vielmehr erhebliche Anstrengungen notwendig, die richtigen Schlussfolgerungen aus den Katastrophen der Vergangenheit zu ziehen. Wir sollten wissen, wo wir herkommen und warum Europa so aussieht, wie wir es heute kennen. Denn dieses Europa hat zwar so manche Fehler und ist oft schwer zu verstehen, aber es ist gleichzeitig schön und anmutig – weil es ein Friedens- und Wohlstandsprojekt ist. Es brauchte aber die von den Deutschen ausgelöste Tragödie des Zweiten Weltkriegs und das in der Geschichte beispiellose Verbrechen des Holocaust, um dieses historisch einmalige Wagnis anzugehen. Zwar hatte es auch schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder Initiativen gegeben, die «Vereinigten Staaten von Europa» zu gründen – zum Beispiel im Heidelberger Programm der SPD von 1925 –, eine wirkliche Dynamik entfaltete diese Idee jedoch erst nach 1945.
Mit der europäischen Integration ist zugleich das Gleichgewicht auf unserem Kontinent wiederhergestellt worden, das seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gestört war. Bereits nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, an den heute noch die Siegessäule am Großen Stern in Berlin erinnert, und der anschließenden Gründung des deutsches Kaiserreichs sorgten sich die europäischen Nachbarn über diesen in ihrer Mitte entstandenen Koloss. «Dieser Krieg», so warnte der britische Staatsmann Benjamin Disraeli schon 1871, unmittelbar nach dem Sieg der unter Führung Preußens kämpfenden deutschen Truppen, «bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die Französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts. … Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört.»[1] Die Sorge über ein möglicherweise zu mächtiges Deutschland inmitten Europas treibt so manche Nachbarn bis heute um, und es gibt in den europäischen Hauptstädten auch in unseren Tagen noch höchst unterschiedliche Meinungen darüber, welche Rolle unser Land spielen soll – sie reichen von der Mahnung, Deutschland solle sich zurückhalten und auf die Interessen kleinerer Staaten achten, bis zu der Forderung, Deutschland müsse die Führung auf unserem Kontinent übernehmen. Diese Mischung aus Furcht und Bewunderung müssen wir berücksichtigen, wenn wir europäische Politik machen, denn noch immer gilt: Deutschland ist zu groß für Europa und alleine zu klein für die Welt.
1914 entluden sich die innereuropäischen Spannungen in einem Krieg, der von vielen Politikern und Publizisten anfangs als eine Art reinigendes Gewitter begrüßt wurde, sich aber sehr schnell zum ersten industriell geführten Waffengang entwickelte, in den schrittweise immer mehr Staaten eingriffen. Die Bilanz dieses Ersten Weltkriegs war furchtbar. Erstmals kamen moderne Kriegsgeräte zum Einsatz, also Flugzeuge, Giftgas, U-Boote und Panzer, und am Ende lagen mehr als siebzehn Millionen Tote auf den Schlachtfeldern. Nur vierzehn Jahre nach dieser «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts», wie George F. Kennan diesen Krieg nannte, errang Adolf Hitler die Regierungsgewalt in Deutschland und nutzte sie sogleich, um den nächsten Krieg vorzubereiten. Der Zweite Weltkrieg forderte allein in Europa über fünfundvierzig Millionen Tote und hinterließ einen verwüsteten Kontinent.
Wie sollte man nun mit diesem Deutschland umgehen, das im Schatten seines Vernichtungskriegs gegen Polen und die Sowjetunion knapp sechs Millionen europäische Juden ermordet hatte? Was tun mit einem Deutschland, von dem viele meinten, es habe seit seiner Staatsgründung nur Schwierigkeiten verursacht? Der amerikanische Finanzminister Henry Morgenthau schlug in einem nach ihm benannten Plan vor, Deutschland in mehrere Kleinstaaten aufzuteilen und seiner Industrie zu berauben. Auch wenn dieses Vorhaben vom amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt schnell verworfen wurde, war es angesichts der deutschen Verbrechen doch nachzuvollziehen: Ein kleiner Agrarstaat, so die Idee, würde niemals mehr Angriffskriege führen und die Welt in die Katastrophe stürzen können. Dass die Westalliierten stattdessen eine ganz andere Politik gegenüber dem unterlegenen Aggressor verfolgten, kann man nur als großes Geschenk an die Deutschen begreifen (an dem sich über vier Jahrzehnte lang allerdings nur die Bewohner von Westdeutschland erfreuen durften). Deutschland sollte befriedet werden, indem man es in eine enge Kooperation mit seinen westlichen Nachbarn einband. Natürlich spielte bei dieser Planung auch das strategische Kalkül des Kalten Kriegs eine Rolle, entscheidend war aber eine grundsätzliche Erwägung: Staaten, Ökonomien und Völker, die wirtschaftlich und politisch miteinander verwoben sind und die sich gemeinsame, transnationale Institutionen geben, werden kaum mehr Krieg gegeneinander führen. Und so kam es zur Zusammenarbeit in den kriegsrelevanten Industrien, in Form einer Gemeinschaft für Kohle und Stahl, aus der sich im Laufe der Jahre erst die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann die Europäische Gemeinschaft und schließlich die Europäische Union entwickelte.
Den Grundgedanken für diese sich schrittweise vertiefende europäische Kooperation hatte der französische Außenminister Robert Schuman entwickelt – ein wahrhafter Europäer mit einer ungemein beeindruckenden Biographie. Geboren 1886 in Luxemburg und als «Reichsdeutscher» im Besitz eines deutschen Passes, hatte er in Berlin studiert und war während des Ersten Weltkriegs in einer deutschen Kreisverwaltung tätig, bis er 1919 französischer Staatsbürger wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er von den Deutschen verhaftet, konnte aber fliehen und schloss sich dem französischen Widerstand an. 1947 wurde er französischer Premierminister. Als französischer Außenminister stellte er am 9. Mai 1950 Pressevertretern den später sogenannten Schuman-Plan vor, in dem es heißt: «Wir schlagen vor, die gesamte deutsch-französische Kohle- und Stahlproduktion einer Hohen Behörde zu unterstellen, in einer Organisation, die den anderen Ländern Europas zum Beitritt offensteht. Dies wird ein Grundstein für eine europäische Föderation sein.»
Die deutsche Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer stimmte diesem Plan zu und tat damit einen wichtigen Schritt, um Westdeutschland die Rückkehr in die internationale Völkergemeinschaft zu ermöglichen. Der Schuman-Plan war die Antwort Europas auf die Frage, wie man mit dem deutschen Riesen in seiner Mitte umzugehen gedachte und zukünftige Kriege verhindern wollte. Diese Entscheidung, die das Prädikat «historisch einmalig» verdient, hat unseren Kontinent zu der reichsten, stabilsten und friedlichsten Region auf der ganzen Welt gemacht. «Wenn wir der endlosen Verhandlungen und bürokratischen Kompromisse in Brüssel überdrüssig sind», schreibt der britische Historiker Timothy Garton Ash mit Blick auf die Vergangenheit Europas, dann «sollten wir uns daran erinnern, dass das Palaver von Brüssel der Preis ist, den wir für den Frieden bezahlen.»[2]
Allerdings halte ich den negativen Unterton, der häufig mitschwingt, wenn von den «typischen Brüsseler Kompromissen» gesprochen wird, für unangemessen. Selbstverständlich sind politische Kompromisse in den seltensten Fällen rundum befriedigend, zuweilen sind sie sogar für alle Seiten schmerzhaft. Die Alternative jedoch wäre weiterhin in den Kategorien von Sieg und Niederlage zu denken, und hinzunehmen, dass Gewinnern immer auch Verlierer gegenüberstehen müssen. Wie katastrophal sich die Unfähigkeit auswirken kann, Kompromisse einzugehen, wissen die meisten sicher aus ihrem Privatleben: Wer einmal so richtig verloren hat, vielleicht sogar gedemütigt wurde, wartet auf die nächstbeste Gelegenheit, um sich zu revanchieren. Dieser ewige Kreislauf der Machtspielchen und Machoallüren hat die Politik in Europa über Jahrhunderte dominiert und ist erst durch die europäische Einigung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchbrochen worden. Nach und nach hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass Europa nur als Gemeinschaft gewinnen kann. Kurzfristig betrachtet mögen Kompromisse auf europäischer Ebene Missfallen erregen, langfristig erweisen sie sich als die einzige Möglichkeit, einen für alle Beteiligten vorteilhaften Interessenausgleich zu erreichen. Durch den europäischen Zusammenschluss geben zwar die einzelnen EU-Mitglieder Zuständigkeiten ab, müssen teilweise unbequeme Zugeständnisse machen und ihre nationalen Interessen zunächst zurückstellen – insgesamt aber gewinnen wir alle genau dadurch neue Gestaltungsspielräume und Handlungsmöglichkeiten, über die die einzelnen Staaten ohne die EU nicht mehr verfügen würden. Deshalb entspricht das gesamteuropäische Interesse weitgehend auch den nationalen Einzelinteressen. Im Gegensatz zum sogenannten Nullsummenspiel, bei dem der Gewinn des einen der Verlust des anderen ist, birgt die europäische Integration also die Möglichkeit eines Positivsummenspiels, bei dem alle Beteiligten die Chance haben zu gewinnen, ohne dass jemand verlieren muss.
Wenn man sich vergegenwärtigt, unter welchen Bedingungen unser Kontinent nach dem verheerenden Krieg gestartet ist, wie Europa heute dasteht und wie vergleichsweise gut es seinen Bürgern geht, dann erstaunt es umso mehr, dass die europäische Idee unter die Räder gekommen ist. Trotz aller Erfolge haben wir anscheinend die Lust auf Europa verloren. «Es nervt, über Europa zu reden», sagen mir junge Leute immer wieder. Vielleicht ist es aber auch einfach nur zu alltäglich geworden. Während die Schlagerindustrie bis in die siebziger Jahre noch gut davon lebte, die Sehnsucht nach den «Capri-Fischern», dem «Griechischen Wein» oder der «Ciao, ciao-Bambina» zu bedienen, ist eine Reise nach Südeuropa kein Abenteuer mehr. Mit einem Flug nach Spanien können Kinder heutzutage längst nicht mehr vor ihren Klassenkameraden punkten, dafür müssen sie mit ihren Eltern schon einen Trip nach Asien oder in die USA unternehmen. Mir kommt unser Europa manchmal wie ein altes Ehepaar vor, das vergessen hat, wie verliebt es einst war. Weil manche auch zu vergessen scheinen, welche praktischen Vorteile die europäische Gemeinschaft bringt, werden immer häufiger zentrale Erfolge der Einigungspolitik infrage gestellt. Im Sommer 2012 wurde in Finnland beispielsweise laut darüber nachgedacht, ob es nicht besser sei, den Euro aufzugeben. Und auch hierzulande hat sich die Europamüdigkeit inzwischen so weit ausgebreitet, dass sogar seriöse Zeitungen fragen, ob wir die ganze europäische Veranstaltung nicht absagen sollten. In England sind die Zweifler in der konservativen Partei so dominant geworden, dass sich die britischen Tories im Europäischen Parlament mittlerweile bei den Europaskeptikern und nicht mehr bei der konservativen Partei einreihen. Die Debatte, ob England weiterhin Mitglied der EU bleiben will und sollte, ist voll entbrannt.
Was ist geschehen, dass wir nicht mehr selbstbewusst und voller Stolz auf unsere Erfolge blicken, dass wir nicht mehr erkennen, wie großartig und historisch einzigartig die Einigung unseres Kontinents ist? Liegt vielleicht gerade im Erfolg des europäischen Projekts der Grund dafür, dass die EU in den Augen so vieler überflüssig, ärgerlich, ja nach Ansicht mancher sogar gefährlich ist? Sind wir ermüdet, nachdem es für unseren Kontinent siebzig Jahre kontinuierlich bergauf ging, nachdem wir Frieden geschlossen, Wohlstand aufgebaut und Grenzen eingerissen haben? Ist unsere Zeit abgelaufen, und geht es nun vielleicht nur noch darum, wie wir unseren eigenen Abstieg möglichst schmerzfrei managen, wie es der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider in einem seiner letzten Bücher vorausgesagt hat?[3] Oder nehmen wir die Zustände, in denen wir leben, als zu selbstverständlich hin und denken mittlerweile, dass es immer so sein wird?
Um zu erkennen, wie fragil Freiheit und Wohlstand sind, reicht es schon, sich die jüngsten Ereignisse vor Augen zu führen. Vergessen wir nicht die sozialen Unruhen, die in Griechenland, Spanien und anderswo im Zuge der Euro-Krise ausbrachen. Es gab Momente, in denen man angesichts der Fernsehberichte den Eindruck gewinnen konnte, in Europa könnten die Gesellschaften genauso implodieren, wie es in anderen Regionen der Welt immer wieder geschieht. Vergessen wir nicht die umstrittenen Verfassungsreformen, die der Ministerpräsident Viktor Orbán mit seiner Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament durchdrückte und mit denen er traditionelle Freiheitsrechte beschneiden wollte, was vor allem durch ein beherztes Eingreifen der EU verhindert wurde. Vergessen wir nicht den erbitterten innenpolitischen Machtkampf, der nur kurze Zeit später im Nachbarland Rumänien zwischen dem Ministerpräsidenten Victor Ponta und dem Präsidenten Traian Băsescu tobte, in dessen Verlauf Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Gerichte angegriffen wurden. Und vergessen wir nicht die anwachsenden rechtspopulistischen Bewegungen in vielen Ländern Europas, die mancherorts bereits in der Regierungsverantwortung stehen oder ausreichenden Einfluss haben, um die politische Tagesordnung diktieren zu können. Die meisten dieser Strömungen sind durch krude Anti-Islam-Hetze groß geworden, mit der sie die innenpolitische Stimmung in ihren Ländern aufgeheizt haben. Seit dem Beginn der Euro-Krise haben viele dieser populistischen Parteien auch die Europafeindlichkeit in ihr Programm aufgenommen. Man muss kein notorischer Pessimist sein, um zu erkennen, dass die Strömungen, die Europa schon einmal in den Abgrund gezogen haben, noch immer eine große Gefahr darstellen.
Ich bin davon überzeugt, dass Europa weiter zusammenwachsen muss, wenn es nicht scheitern will. Aus dem Mund eines Europapolitikers mag diese Forderung wenig überraschen – schließlich ist dem gelangweilten Publikum oft genug gepredigt worden, unsere Gemeinschaft funktioniere wie eine Fahrradfahrt: Höre man einmal mit dem Treten auf, falle das Fahrrad um. Aber so meine ich es nicht. Die europäische Integration muss nicht zwangsläufig immer weiter vorangetrieben werden, um ein Scheitern der EU zu verhindern. Es ist durchaus ein Zustand denkbar, den man als stabiles Endstadium der Einigung akzeptieren könnte. Dieser Zustand aber ist noch nicht erreicht. Das Mehr an Zusammenarbeit, das ich meine, fußt auf der schlichten Erkenntnis, dass wir an ein paar Stellen nicht sauber gearbeitet haben, als wir das europäische Gebäude errichteten. So verfügen wir etwa über eine gemeinsame Währung, nicht aber über eine gemeinsame Steuer- und Finanzpolitik. Das musste schiefgehen, und nun zeigen die viel zitierten Märkte jeden Tag, wie sich die Europäer aufgrund dieses Fehlers immer wieder gegeneinander ausspielen lassen. Auch bei der Ausgabenpolitik der EU haben wir eine falsche Weichenstellung vorgenommen. Anstatt in wichtige Zukunftsbereiche zu investieren, schütten wir unser Geld in Subventionsgräber und halten Branchen der Vergangenheit künstlich am Leben. Ebenso schlimm ist unsere geradezu babylonische Vielstimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, die uns international zur Lachnummer macht. Nicht zuletzt brauchen wir darüber hinaus mittelfristig eine institutionelle Klarheit in der EU, da selbst Fachleute mittlerweile Mühe haben, die eigentümlichen Zuständigkeiten zwischen dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, dem Kommissionspräsidenten, dem Ratspräsidenten und dem Präsidenten des Europäischen Rates auseinanderzuhalten. Was wir dringend brauchen, ist eine echte europäische Regierung, die parlamentarisch gewählt und kontrolliert wird.
Dass wir die Europäische Gemeinschaft, wie wir sie heute kennen, dringend reformieren müssen, ist für mich also selbstverständlich. Kritik an der EU halte ich deshalb keinesfalls für grundsätzlich antieuropäisch, im Gegenteil: Als Präsident des Europäischen Parlaments schmerzt es mich besonders, dass viele Kritiker recht haben, wenn sie dem Patienten EU einen schlechten Zustand attestieren. Jedoch will ich die EU und damit auch unser europäisches Gesellschaftsmodell bewahren, nicht abschaffen.
In der Debatte um mögliche Reformmaßnahmen sind Augenmaß und das Gespür dafür gefragt, welche Maßnahmen sich unter den aktuellen Bedingungen verwirklichen lassen und welche nicht. Wenn es um Europa geht, wird seit fast vierzig Jahren geschraubt, repariert oder gar Abriss und Neubau erwogen, unablässig justieren wir am Verhältnis zwischen nationalen Regierungen, europäischer Kommission und europäischem Parlament. Obwohl dies auch in Zukunft notwendig sein wird, um Europa für die bevorstehenden Herausforderungen fit zu machen, bezweifle ich, dass die gegenwärtige Euro-Krise der richtige Zeitpunkt ist, um eine europäische Verfassungsdebatte zu beginnen: Wenn das Haus brennt, sollte sich die Feuerwehr auf die Löscharbeiten konzentrieren, anstatt über das ideale Löschfahrzeug der Zukunft zu diskutieren. Eine neue Verfassung, die ja erst entworfen, zur Diskussion gestellt und danach in einem langen Prozess von allen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden muss, wird kaum dazu beitragen, unsere aktuellen Probleme zu lösen. Die Menschen wollen momentan nicht über Verfahren und Kompetenzen streiten, sondern darüber, wie Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden können sowie eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft erhalten bleiben kann. Die Krise hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wo die institutionellen Defizite der EU liegen. Wir tun aber gut daran, zwischen unmittelbar notwendigen und mittelfristig sinnvollen Maßnahmen zu unterscheiden, denn wir brauchen beides: eine Erneuerung der europäischen Institutionen und neue Lösungsansätze, um Jobs und soziale Sicherheit zu gewährleisten. All das will ich versuchen, in diesem Buch zu diskutieren, zumindest anzureißen.
Das Buch richtet sich nicht in erster Linie an die Experten, die in Büchern, Fachartikeln und auf Symposien noch jede kleinste Verästelung der EU-Verträge analysieren und über notwendige Veränderungen debattieren. Selbstverständlich sind diese Fachdebatten wichtig, weil sie wertvolle Impulse geben und die Grundlagen verbessern, auf denen politische Entscheidungen gefällt werden. Bei der Diskussion über die Zukunft Europas müssen wir jedoch mehr Menschen ins Boot holen, weil Entscheidungen von großer Tragweite anstehen, die Auswirkungen weit in die Zukunft hinein haben. Dieses Buch ist der Versuch, mit klarer Sprache deutliche Thesen zu formulieren. Ich will Tacheles reden.
Naturgemäß muss das vorliegende Buch eine Skizze bleiben. Es ist das Ergebnis eines ersten Nachdenkens, nachdem ich ein Jahr als Präsident des Europäischen Parlaments im Amt bin. Es war ein sehr intensives Jahr, denn noch nie stand die EU so im Fokus der Aufmerksamkeit und noch nie hatten ihre Akteure so viele Herausforderungen zu bewältigen. Ich will diese Skizze in den kommenden Jahren vervollständigen, die Leerstellen noch füllen. Wahrscheinlich werde ich manches revidieren müssen, anderes muss ich vielleicht weiter zuspitzen und radikaler denken. In jedem Fall aber will ich dazu einladen, dass wir unser Europa verbessern.
I. Europa in der Kritik
Die Europäische Union steht in der Kritik, und das zum Teil aus gutem Grund. Ich empfinde es nicht grundsätzlich als europafeindlich, wenn Vorwürfe gegen die Institutionen der EU erhoben werden. Wie alle Institutionen, die den Bürgern dienen sollen, müssen auch sie sich gefallen lassen, von der Öffentlichkeit beurteilt zu werden. Sie müssen Rechenschaft ablegen, und wenn sie dies nicht in angemessener Weise tun, dürfen sie sich nicht wundern, wenn ihre Zustimmungswerte sinken. Natürlich trifft nicht alles zu, was über die EU gesagt, an ihr kritisiert und verflucht wird, aber vieles enthält doch zumindest einen wahren Kern. Deshalb will ich beispielhaft auf einige Kritikpunkte eingehen, die gegen die EU erhoben werden. Nur wenn wir ihre Defizite kennen und klar benennen, werden wir diese auch beseitigen können. Daher will ich im Folgenden über die europäische Bürokratie, das Demokratiedefizit der EU-Institutionen, die oft kritisierte Erweiterungspolitik, das neoliberale Europa und Europas Versagen in der Krise sowie schließlich die Vielstimmigkeit in der europäischen Außenpolitik nachdenken.
Bürokratisches Monster EU
Brüssel – so lautet einer der Vorwürfe, die am häufigsten gegen die EU vorgebracht werden – sei wie ein Raumschiff, in dem ein Haufen von Bürokraten völlig abgekoppelt von den nationalen Debatten und Befindlichkeiten arbeite, besessen von der fixen Idee, noch das kleinste Detail in den europäischen Mitgliedsländern zu regulieren. Betrachtet man die Bürokratie der EU aus der Nähe, dann ist tatsächlich nicht zu leugnen, dass ihre Tätigkeitsfelder vielfach neu abgesteckt und ihre Strukturen dringend reformiert werden müssen. Vieles ist in den letzten Jahrzehnten aus dem Ruder gelaufen, daher ist es richtig, immer wieder zu überprüfen, welche Kompetenzen gut bei der EU aufgehoben sind und in welchen Fällen es besser ist, wenn sich die Institutionen der jeweiligen Staaten eines Problems annehmen.
Nicht selten sind die vielbeklagten bürokratischen Wucherungen jedoch auch eine Folge nationaler Befindlichkeiten. Das auffälligste Beispiel dafür ist die auf inzwischen siebenundzwanzig Mitglieder angeschwollene EU-Kommission – mit jedem neuen Land, das der EU beitrat, kam ein weiterer Kommissar dazu. Zwar sieht der Vertrag von Lissabon vor, die Zahl der Kommissare auf «zwei Drittel der Zahl der Mitglieder der Mitgliedsstaaten» zu beschränken, allerdings soll diese Vorgabe erst 2014 in die Realität umgesetzt werden, denn natürlich bedeutet dies, dass einzelne Mitgliedsstaaten zukünftig keinen Kommissar mehr stellen. Ich halte es trotzdem für sinnvoll, die Zahl der Kommissare zu verringern, schließlich gebietet es der politische Verstand, sich bei der Zusammensetzung der EU-Kommission daran zu orientieren, welche Aufgaben sie zu bewältigen hat, und nicht daran, ob jedes Land «seinen» Kommissar hat.
Es ist allerdings nicht so, dass die EU dem tatenlos gegenübersteht. So durchforstet eine Reformgruppe unter Leitung des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber seit einiger Zeit intensiv das europäische Recht, um aufgeblähte Bürokratie zu finden und Vorschläge zu machen, wie diese abgebaut werden kann. In einem Zwischenbericht, der 2012 vorgelegt wurde, hat Stoiber die bürokratiebedingten Kosten für europäische Unternehmen auf vierzig Milliarden Euro geschätzt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass er durch seine Arbeit für die EU sprichwörtlich vom Saulus zum Paulus wurde, vom Europaskeptiker zum glühenden EU-Befürworter, und er die nationalen Regierungen aufgefordert hat, sich gegenseitig ein Beispiel zu geben, wie man effizient und ohne große Bürokratie europäische Beschlüsse umsetzen kann. Erstaunt berichtete die Wochenzeitung «Die Zeit» von einem ganz «neuen Stoiber».
Neben der berechtigten Kritik an der EU, die wie jede staatliche Institution deutlich verbessert werden kann, haben sich manche Geschichten über die vermeintliche Abgehobenheit der EU jedoch längst verselbständigt und führen inzwischen ein skurriles Eigenleben. Zwar haben viele dieser Geschichten einen wahren Kern, doch werden sie bei jeder Überlieferung weiter zugespitzt und skandalisiert – eine Art stille Post in der Sphäre der Politik. Ob die Geschichten dann wirklich den Tatsachen entsprechen und ob diese Fälle tatsächlich als Beispiel für eine überbordende Bürokratie taugen, interessiert am Ende die wenigsten. Eine häufig geäußerte Klage lautet beispielsweise, die EU beschäftige viel zu viele Beamte, die sich aus schierer Langeweile immer neue Richtlinien ausdenken. Der vermeintliche Wasserkopf ist bei näherer Betrachtung jedoch längst nicht so groß, wie viele annehmen: In den Institutionen der EU arbeiten insgesamt vierzigtausend Menschen, während allein die Stadt München etwa dreißigtausend Beschäftigte hat. Nur knapp sechs Prozent ihres Jahreshaushalts gibt die EU für Personal, Verwaltung und die Instandhaltung ihrer Gebäude aus, während die deutschen Kommunen allein für das Personal gut ein Viertel ihres Etats ausgeben. Noch eine Zahl, die zu wenige kennen: Der Haushalt der EU entspricht lediglich einem Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts (BIP), also des Gesamtwerts aller Waren und Dienstleistungen, die in den siebenundzwanzig Mitgliedsländern erwirtschaftet werden. Dagegen liegt die Höhe des durchschnittlichen Haushalts der EU-Mitgliedsstaaten bei vierundvierzig Prozent des nationalen BIP.
Sehr häufig wird auch darüber geklagt, dass sich die Europäische Union in immer mehr Bereiche einmische, die sie nichts angingen. Tatsächlich erlässt die EU zur Regelung der unterschiedlichsten Lebensbereiche zahlreiche «Richtlinien» und «Verordnungen», wie die Gesetze in der EU-Sprache genannt werden, und selbstverständlich kann und sollte man bei jedem dieser Gesetzgebungsakte prüfen, ob er notwendig ist oder sich das Problem nicht auch anders lösen lässt. Im Unterschied zu den nationalen und regionalen Gesetzgebungsinstanzen unterstellen die meisten Leute der EU jedoch, dass sie die Dinge grundsätzlich überreguliert. Das berühmt-berüchtigte Beispiel ist die sogenannte Gurkenverordnung von 1988, mit der Güteklassen für Gurken festgelegt wurden, wobei eines der Qualitätskriterien deren Krümmungsgrad war. Eine Welle von Hohn und Spott ergoss sich über die EU – und das, obwohl die Verordnung auf Initiative des Handels und einiger Mitgliedsstaaten eingeführt worden war und sich an einer Empfehlung der Vereinten Nationen orientierte. Die EU hatte also eigentlich alles richtig gemacht, trotzdem zog die Kommission 2009 die Notbremse und setzte die Richtlinie außer Kraft. Bezeichnenderweise beklagten daraufhin viele EU-Mitgliedsländer und Handelsverbände, dass nun ein fester Qualitätsstandard fehle und die Vergleichbarkeit der Produkte nicht mehr gegeben sei (viele Gemüsegroßhändler verwenden die Vorgabe deshalb übrigens weiterhin als interne Norm). Das Beispiel der Gurkenverordnung geistert noch heute durch die öffentliche Debatte über Europa, und es gibt kaum eine Podiumsdiskussion, bei der meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament nicht für diese vermeintliche Überregulierung attackiert werden.
Es gibt noch eine Reihe weiterer Beispiele, die nach demselben Muster funktionieren. So wurde Mitte der neunziger Jahre in der EU über eine Richtlinie zum Schutz der europäischen Gewässer und des Grundwassers diskutiert. Zwar gestaltete sich das Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene schwierig, weil es zwischen Kommission, Parlament und Ministerrat unterschiedliche Positionen gab, doch wurde schließlich ein Kompromiss gefunden und die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vereinbart, die zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung kaum zwanzig Seiten umfasste. Diese Richtlinie musste nun aber – wie alle europäischen Richtlinien – in nationales Recht überführt werden. Das bedeutet konkret, dass das Europarecht in das Bundes- und Landesrecht integriert und von den regionalen Körperschaften noch um Ausführungsbestimmungen ergänzt werden muss. Dieses Verfahren durchlief nun auch die Wasserrahmenrichtlinie, und sowohl der Bund als auch die Länder und Bezirksregierungen fügten dem Urtext hinzu, was sie aus ihrer Sicht für notwendig hielten. Damals war ich nicht nur Abgeordneter im Europäischen Parlament, sondern auch ehrenamtlicher Bürgermeister in meiner Heimatstadt Würselen, und konnte somit nachverfolgen, in welcher Form die Richtlinie Brüssel verlassen hatte – und in welcher Form sie auf kommunaler Ebene landete. Als die Richtlinie in unserem Rathaus eintraf, sahen wir uns einem Gesetzeskonvolut gegenüber, das im Zuge der Umsetzungsbestimmungen der verschiedenen innerstaatlichen Ebenen deutlich an Komplexität zugelegt hatte und nun fast viermal so umfangreich war. Meine Kollegen in der Lokalpolitik waren entsetzt, was für eine unleserliche und voluminöse Rechtssetzung wir «da in Brüssel verbrochen» hatten, und trotz meiner hartnäckigen Widerrede gelang es mir nicht, sie davon zu überzeugen, dass das eigentliche Problem nicht in Brüssel lag.