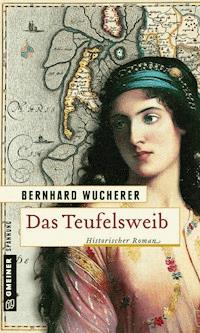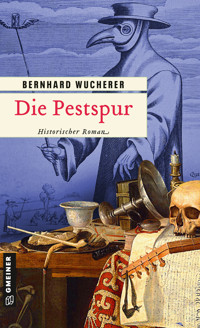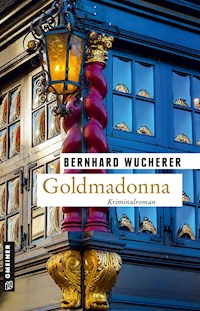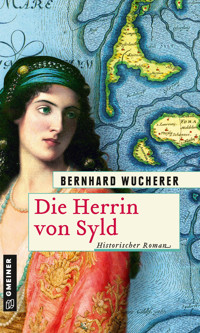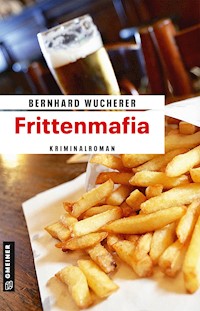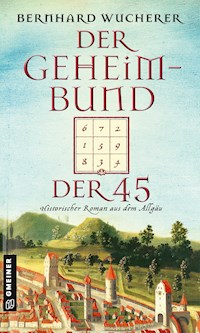
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Anno domini 1042. In Isny soll die erste Kirche geweiht werden. Der Bischof von Konstanz bringt als Weihgabe eine geheimnisvolle Münze in das beschauliche Dorf im Allgäu. Der Geistliche weiß nicht, dass die Münze das verloren gegangene Machtsymbol eines radikalen Geheimbundes ist, der sich dem Fortschritt der Wissenschaften verschrieben hat. Die Mitglieder der Gruppierung haben geschworen, jeden zu töten, der ihre Insignien entweiht. Als auf den Feierlichkeiten um die Kirchweihe Blut fließt, beginnt ein Krieg, der Isny fünf Jahrhunderte in Atem hält …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Wucherer
Der Geheimbund der 45
Historischer Roman aus dem Allgäu
Zum Buch
Finstere Mächte Isny 1042. Als der Bischof von Konstanz eine geheimnisvolle Münze zur Kirchweihe in das kleine Allgäuer Dorf bringt, ahnt er nicht, dass er damit den Zorn des rücksichtslosen Geheimbundes „Gladius Dei“ weckt. Die Münze zeigt auf der einen Seite eine arithmetische Raffinesse, auf der anderen das Bild eines toten Königs, dem die Organe entnommen wurden. Es handelt sich um das verloren gegangene Machtsymbol der Bruderschaft, die sich den freien Künsten und dem Fortschritt der Wissenschaft verschrieben hat. Die Großmeister des „Gladius Dei“ sind besessen davon, jeden zu töten, der ihr Insigne entweiht. Bereits auf der Kirchweihe kommt es zu einem Mord. Er ist der Auftakt zu einem Konflikt, der die Stadt für fast fünfhundert Jahre in Angst und Schrecken versetzen wird. Trotzdem gelingt es der kleinen Bauernsiedlung unter Führung der umsichtigen Patrizierfamilie Eberz im Laufe der Jahrhunderte zur Freien Reichsstadt aufzusteigen, in der Handel und Gewerbe florieren. Doch 1507 gerät die Familie Eberz selbst ins Visier der Verschwörer …
Bernhard Wucherer war 25 Jahre lang Leiter einer Werbe-, Marketing- und Eventagentur in Oberstaufen im Allgäu. Außerdem hat er sich bei Tätigkeiten als Burgmanager und Museumskurator auf alten Herrschaftssitzen im In- und Ausland das Rüstzeug zum Schreiben authentischer historischer Romane aneignen können. Er ist Autor etlicher Aufsätze, die auch Eingang in die geschichtswissenschaftliche Literatur gefunden haben. „Der Geheimbund der 45“ ist nach der erfolgreichen „Pesttrilogie“ und der bisher zweibändigen „Syld-Marokko-Saga“ sein sechster historischer Roman beim Gmeiner-Verlag.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isny_1737_img00.jpg
ISBN 978-3-8392-6674-8
Widmung
Für alle Isnyer, insbesondere auch für diejenigen, die lieber einen »Heimatroman« im klassischen Sinne oder ein Geschichtsbuch gehabt hätten.
Die historischen Inspirationsartefakte, um die sich im Roman alles dreht
Das in Isny entdeckte »Magische Amulett«
Das Amulett, um das sich in diesem Roman alles dreht, gibt es wirklich. 2018 wurde ein besonders bedeutungsvolles Exemplar bei Grabungsarbeiten auf dem alten Marktplatz in Isny gefunden, direkt beim dortigen »Prangerstein«, wo es beim großen Stadtbrand von 1631 oder schon zuvor in den Boden gelangte und die Zeiten überdauerte. 2019 wurde von Dr. Matthias Ohm vom Landesmuseum Württemberg bestimmt, dass es sich um einen sogenannten »Rechenpfennig« (auch als »Münzmeisterpfennig« oder in Süddeutschland als »Raitpfennig« bezeichnet) handelt, einen medaillenartigen Platzhalter, der im Mittelalter beim Rechnen auf der Linie (auf Rechenbrettern, -tischen oder -tüchern) verwendet wurde. Rait-, Rechen- oder Münzmeisterpfennige konnten daneben auch politische oder – wie im vorliegenden Fall und im Roman beschrieben – moralische Botschaften transportieren.
Die in Isny ausgegrabene Medaille besteht aus Buntmetall, also einer Kupferlegierung, wahrscheinlich Bronze, was sich allerdings erst bei einer Materialanalyse feststellen ließe. Sie hat einen Durchmesser von zwanzig Millimetern und wurde nachträglich gelocht, damit sie um den Hals getragen werden konnte, vermutlich, ohne dass deren Träger den ursprünglichen Zweck kannten. So entstehen Legenden wie die von »Gladius Dei«, dem »Geheimbund der 45«.
Avers
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart; Foto: Christoph Schwarzer
Auf der Vorderseite weist das in Isny gefundene Exemplar auf die Vergänglichkeit des Menschen hin (vanitas). Neben einigen Schriftzeichen und anderen noch nicht erkannten Darstellungen ist ein toter Mensch mit einer Krone auf dem Kopf zwischen zwei Leuchtern und insgesamt fünf Sternen zu erkennen. Des Weiteren sieht man zu beiden Seiten des toten Königs innere Organe: Lungenflügel, Nieren und dergleichen. Dies lässt darauf schließen, dass es zur Entstehungszeit der Medaille Kenntnisse über die menschliche Anatomie gegeben hat. Und das, obwohl Leichenöffnungen bei Todesstrafe verboten waren. Die Darstellung der Organe deutet auf eine Entstehung vor der Frühen Neuzeit hin. Sie entspricht einer Anatomie, wie sie in »De Arte Phisicali et de Cirurgia« des englischen Chirurgen Johannes von Arderne (1307–1392 n. Chr.) nach 1412 n. Chr. dargestellt wird. Eine Wende zur Wiedereinführung anatomischer Sektionen an menschlichen Körpern – die von der Kirche abgelehnt wurden – brachten erst das 13. und 14. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang darf der große Leonardo da Vinci (1452–1519 n. Chr.) genannt werden. Der bekannteste Künstler und Wissenschaftler der Renaissance führte selbst anatomische Präparationen durch und zeigte – anders als auf dem Amulett – realistische, detailgenaue und detailreiche anatomische Zeichnungen. Text: HODIE M(ihi) CR(as) TIBI A (bedeutet in etwa soviel wie: »Heute kommt der Tod für mich, morgen für dich«)
Revers
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart; Foto: Christoph Schwarzer
Das »Magische Quadrat« auf der Rückseite des in Isny gefundenen Exemplars erinnert an unser heutiges »Sudoku«, eine Gattung von Logikrätseln, die aus lateinischen Quadraten entstanden. Das in Isny gefundene »Magische Quadrat« sollte wohl Krankheiten und Tod abwehren. Es zeigt in neun einzelnen Quadraten die arabischen Ziffern 1 bis 9, die in der Summe aller Zeilen, Spalten und der beiden Diagonalen gleich sind. Diese Summe (15) wird als »Magische Zahl« des »Magischen Quadrates« auf dem »Magischen Amulett« bezeichnet. Rechnet man alle Zahlen zusammen, ergibt sich die Zahl 45. Das »Lo Shu« war schon zu Zeiten des legendären mythologischen Kaisers Yu (Regierungszeit von 2205–2147 v. Chr.) in China bekannt (wo es auch im Roman herkommt, weil es in Europa erst im 16. und 17. Jahrhundert beschrieben wird. Dies hat allerdings nichts mit dem in Isny gefundenen Exemplar zu tun). Im Westen hat sich unter anderem Adam Ries (1492 oder 1493–1559 n. Chr.) mit dem »Magischen Quadrat« beschäftigt. In seinem »Rechenbüchlin« gab er auf Seite 71 diese Aufgabe mitsamt der Lösung. Neben zwei Beispielen folgte: »Und darnach verwechsel mit den 8. und 2. also/ so hastu allenthalben 15. Denn alle Summen ergeben die Magische Zahl 15«. Text: »EK« für Egidius Krauwinckel, tätig in Nürnberg.
Die Motive beider Seiten werden im Roman vordergründig thematisiert und formen sich darin zu zwanghaften rituellen Handlungen, die im Codex des Geheimbundes »Gladius Dei« (lateinisch für »Schwert Gottes«) festgehalten sind. Dessen 45 Mitglieder haben sich bei der Gründung ihres mystischen Zirkels Anno Domini 1001 in der späteren Konzilstadt Konstanz aufgrund der Abbildungen auf dem Avers zum Ziel gesetzt, die bei Todesstrafe verbotenen und von der Kirche verfolgten anatomischen Präparationen zum Zwecke der Wissenschaft voranzutreiben. Und was das Revers des »Magischen Amuletts« betrifft, gibt der Codex dieses Bündnisses vor, talentierten, aber mittellosen Knaben aus dem Bereich und dem Umfeld des Bodensees, aus Westschwaben (dem heutigen Oberschwaben) und aus dem Allgäu zu ermöglichen, die Arithmetik oder andere Fächer der »artes liberales«, der »sieben freien Künste«, zu studieren. Grundsätzlich wäre es äußerst lobenswert, dass sich ein elitäres Bündnis von Adeligen, Gelehrten, Kaufleuten und Medizinern dieser Thematik annimmt … wenn es sich nicht selbst barbarischer Praktiken bedienen würde, die seinen hehren Zielen widersprechen.
Der in Isny ausgegrabene »Prangerstein«
Foto: Heinz Bucher, Isny
Der mächtige Prangerstein (1,7 Meter × 1,2 Meter) bot die Grundlage für die räumlichen beziehungsweise geografischen Beschreibungen in diesem Roman. Er stand an der exponiertesten Stelle Isnys, am Marktplatz, direkt am Alten Rathaus, dem früheren Amtshaus. Die ungewöhnliche Form mit den reliefartigen Linien erinnert an die städtebauliche Geometrie der Siedlungsgründung, die damit verbundene Gründungsachse und die Ummauerung, sowie die Handelsstraßen und die wichtigsten Stadttore. Die in den Stein gehauenen Zeichen zeigen links ein nach Norden orientiertes gleichseitiges Dreieck. Die Nordrichtung ist vertieft. Die drei Spitzen sind die Stadttore ohne das Obertor. Der Ausgrabungspunkt ist das Wassertor, rechts als Turm mit Spitzdach erkennbar. Die Nordrichtung ist astronomisch orientiert. Die Seitenlängen betragen jeweils tausend »Isnyer Fuß« (333,33 Meter). Da die Tore noch stehen und mit modernen Mitteln vermessen werden konnten, bestätigen sie den »Vermessungsstein« und den Baubeschluss aus der Klosterchronik. Straßen und Tore wurden von der Gründungsachse aus festgelegt. Sie beginnt am Wassertor (Tordurchgang Mitte, Innenseite Tor) und richtet sich zur gegenüberliegenden Dreiecksseite (Seitenhalbierungspunkt). Das vierte Tor (Obertor) ist vom Marktplatz aus nach der astronomischen Wintersonnenwende (22. bzw. 23. Dezember, kürzester Tag) ausgerichtet. Der »Isnyer Fuß« gibt auch die Länge (33,33 Zentimeter) für die ersten Ziegelsteine (Funde aus der Grabung am Marktplatz) vor. Der Maßstab auf dem interessanten Fundobjekt beträgt 1:500. Wie auch andernorts wurde der Pranger in Isny benutzt und war ein Strafwerkzeug in Form eines Pfahls oder einer Säule, an die Missetäter wegen einer als straf- oder verachtungswürdig empfundenen Tat eine gewisse Zeit lang angebunden oder angekettet stehen mussten und somit allgemeiner Verachtung und Spott ausgesetzt waren. Quelle: Roland Manz, Erhard Bolender, Heinz Bucher, März 2020.
Isny im Allgäu, Hauptort des Geschehens
Als mächtige Gletscher vor zehntausend Jahren das Allgäu bei Isny formen, bildet sich die reizvolle Landschaft aus, wie wir sie heute kennen und lieben. Damals entstehen das heute landschaftsprägende sanfte Gebirge der Adelegg mit Schwarzem Grat, der Eistobel mit Wasserfällen, Strudellöchern und gewaltigen Felswänden, die Moore mit Heideflächen, lichten Waldgebieten, Wiesen und Seen.
Bereits den Römern gefällt dieses Fleckchen Erde so gut, dass sie ein Kastell auf einem Moränenhügel im Tal der Argen unweit der heutigen Stadt Isny bauen. Erstmals urkundlich erwähnt wird Isny im 11. Jahrhundert. Als Freie Reichsstadt entwickelt sich Isny ab dem 14. Jahrhundert zur ersten großen Blüte. Die stattlichen Bürgerhäuser innerhalb des mittelalterlichen Ovals mit Toren und Türmen und die noch weitgehend erhaltene hohe Stadtmauer mit Wehrgang zeugen bis heute vom Reichtum der Stadt. Isny ist eine der ersten Städte, die protestantisch wird, nachdem Martin Luther persönlich den Stadtoberen einen Brief geschrieben hat. Die Besonderheit eines katholischen Klosters in der von evangelischem Bürgertum geprägten Stadt, ist nur einer der vielen Gegensätze und jahrhundertelangen Streitpunkte in der Stadtgeschichte. Bereits 1507 bekommt die Stadt als zweite im Bodenseeraum nach Konstanz das Münzrecht.
1365 wird Isny Freie Reichsstadt und damit nur dem Kaiser untertan. Der freiheitliche Geist bleibt den Isnyern bis heute erhalten. Inzwischen zählt die Stadt mit den vier eingemeindeten Orten Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf rund vierzehntausend Einwohner. Kunst und Kultur sind in Isny an vielen Ecken zu spüren und zu erleben. Ganz besonders im früheren Kloster und späteren Schloss, das seit Kurzem Kunsthalle, Städtische Galerie und Städtisches Museum unter einem Dach vereint. Aber auch in Isny-Großholzleute, denn dort im historischen Gasthof »Adler« logieren in früheren Zeiten Königinnen, befindet sich eine Station der Thurn-und-Taxis-Post und ist der Gründungsort der ersten Skischule weit und breit. Beim Treffen der »Gruppe 47« mit Preisträger Günter Grass wird dort Literaturgeschichte geschrieben, als Grass zum ersten Mal aus dem Manuskript seiner »Blechtrommel« liest. Besonders herausragend ist die seit Jahrhunderten original erhaltene Prädikantenbibliothek im Turm der Nikolaikirche. Sie enthält wertvolle Handschriften, Inkunabeln (Früh- oder Wiegendrucke) und weitere Kostbarkeiten. Im Rahmen der Stadtsanierung in den letzten Jahren fördern umfangreiche archäologische Ausgrabungen in der Isnyer Altstadt bedeutende Zeugnisse der Geschichte zutage. Neben alten Webstühlen, Tongefäßen und Gläsern sowie sehr mächtigen alten Fundamenten und dem »Prangerstein« wird 2018 auch der »Münzmeisterpfennig« ausgegraben, der in diesem Roman als »Magisches Amulett« die Hauptrolle spielt. Viel Freude beim Lesen dieses herausragend recherchierten historischen Romans!
Die Gründung des »Gladius Dei« – Geheimbund der 45
Konstanz – Anno Domini 1001
Ein grausamer Codex verbindet fünfundvierzig Verschwörer aus dem gesamten Allgäu, aus Westschwaben und rund um den Bodensee.
Es war eine laue Sommernacht. Der pralle Mond zog einen silbernen Streifen über das Mare Brigantium von Konstanz nach Buchhorn hinüber und von dort aus in gerader Linie weiter bis zu einer kleinen Allgäuer Siedlung, die man bald als villa Ysinensi, dann verkürzt als Ysinensi, später als Isine, Isne und etwa fünf Jahrhunderte darauf als Isny bezeichnen würde.
In Konstanz schien es so, als wenn der Mond vom See aus direkt auf die höchste Erhebung der kleinen Handelsmetropole leuchte und den bedeutendsten Sakralbau im Südwesten der deutschen Lande anstrahle. Trotz der mitternächtlichen Stunde war es fast taghell. So konnte niemand sehen, dass um diese unchristliche Zeit Kerzenlicht aus den Fenstern des Konstanzer Münsters flackerte. Aber auch ohne die Helligkeit hätte niemand etwas davon mitbekommen, was sich im Inneren des neuen Gebäudes abspielte, das anstelle der alten Bischofskirche errichtet worden war. Denn die abergläubischen Bewohner von Konstanz trauten sich nicht, den Mond anzusehen, wenn der sich in voller Pracht entfaltet hatte und ihnen den Schlaf raubte, wenn sie ihn ansahen. Der Anblick konnte großes Unheil über sie, ihre Familien und über ihr Vieh bringen. Deswegen hatten die meisten Menschen bei Vollmond ihre Fenster mit Holzbrettern oder eingefärbten Tierhäuten verdunkelt.
Die Bienenwachskerzen, die im Münster entzündet wurden, waren für einfache Menschen kaum bezahlbar. Aber in dieser Nacht hatten sich keine Männer des gemeinen Volkes zusammengefunden, die weder lesen und schreiben noch rechnen konnten. Vielmehr waren dies durchwegs Privilegierte, die sich das wohlriechende Bienenwachs leisten konnten und nicht den rußigen Gestank von Talgkerzen einatmen mussten. Adelige, Gelehrte, Kaufleute und Mediziner aus allen Landen rund um den See, aus Westschwaben und sogar aus dem oberen Allgäu waren herunter nach Konstanz gekommen, um sich zu verschwören. Zwei Jahre hatte es gedauert, bis sich fünfundvierzig gleichgesinnte Männer zusammengefunden und alles so organisiert hatten, dass sie ihren geheimen Zirkel gründen konnten. Zwei Jahre, in denen der Großmeister, den sie damals im Kanonissenstift in Lindau gewählt hatten, ganze Arbeit geleistet hatte. Damals waren sie nur fünfzehn Männer gewesen.
Beim Betreten des Sakralraumes, noch vor der gegenseitigen zeremoniellen Begrüßung, zeigte jeder von ihnen den anderen mit hocherhobenen Händen die Zahl, die auch in blutroter Farbe auf seinem weißen Kapuzenumhang zu sehen war. Dieser rituelle Zugehörigkeitsbeleg wurde stumm mit einem allseitigen Kopfnicken quittiert. Und gemäß der Zahl, die ein jeder zeigte, fanden sie sich zusammen und teilten sich in neun unterschiedlich große Gruppen auf, die in einem von neun mit Kreide auf den Boden gemalten Quadraten zusammenstanden. Alles zusammen ergab ein großes Quadrat, das außen herum durch genau einhundertfünfzig Kerzen gekennzeichnet war.
Der größte Haufen zählte neun Männer, in der Mehrzahl Kaufleute, deren größte Liebe dem Geld galt, weswegen sie sich der Arithmetik und der gesamten Mathematik verschrieben hatten. Acht Gelehrte befassten sich beruflich mit der Grammatik und anderen Wissenschaften, während die Leidenschaft weiterer sieben Männer vordergründig der Geometrie galt. Sechs Scholaren und Studiosen lagen ganz besonders die Rhetorik und die Schrift am Herzen, was sie mit fünf Klerikern teilten. Vier der allesamt in weißen Kutten steckenden und mit spitzen Hauben vermummten Männern war von den »sieben freien Künsten« die Dialektik am wichtigsten, während drei Mediziner verbotene Leichenöffnungen durchführten und sich nebenbei leidenschaftlich als Astronomen betätigten. Nur zwei Verschwörer befassten sich intensiv mit der Musik. Die Verschwörer waren Teil der geistigen und monetären Elite der Gegenden, aus denen sie stammten. Den fünfundvierzig Männern war gemein, dass ihnen die Vergänglichkeit des Menschen bewusst war und sie Krankheiten und Tod abwehren wollten. Auch wenn sie dies mit Hilfe der Wissenschaft oder für die Wissenschaft zu tun gedachten, waren ihnen doch alle Mittel recht.
Was die fünfundvierzig klugen Köpfe dieser neun Gruppen zudem einte, war die Leidenschaft zur Arithmetik, einem Teilgebiet der Mathematik, das sich mit bestimmten und allgemeinen Zahlen, der Reihentheorie, der Kombinatorik und der Wahrscheinlichkeitsberechnung befasste.
Ebenso hatte es ihnen die Erforschung der Anatomie des menschlichen Körpers angetan. Deswegen unterstützten und förderten sie trotz der drohenden Todesstrafe das Öffnen von Leichen zum Zwecke der Wissenschaft. Um ihr erlangtes Wissen über Jahrhunderte hinweg in die Welt hinaustragen zu können, bedurfte es auch künftig vieler weiterer kluger Köpfe, die dafür sorgten, dass nichts davon verloren ging und sich das einmal erworbene Wissen über Generationen hinweg halten konnte. Es war die Aufgabe des jeweiligen »Großmeisters«, alle Erkenntnisse, die sie beim Öffnen von Leichen erlangen würden, akribisch niederzuschreiben und Zeichnungen anzufertigen oder anfertigen zu lassen. Ihr Ziel war es, eines Tages Bücher daraus zu machen, die nicht nur für Mediziner, sondern auch für Laien hilfreiche Grundlagen zur Erkennung, Behandlung und Heilung von Krankheiten sein würden.
Die Atmosphäre wirkte beängstigend. Die vermummten Gestalten, das gedämpft flackernde Licht der Kerzen, die das äußere Quadrat markierten, und das leise, monotone, wortlose Gemurmel der vierundvierzig Männer, die unruhig auf ihren Großmeister warteten, verstärkte die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen von ihnen. Sie alle waren zum Zerreißen angespannt und mochten endlich wissen, was es war, das sich unter dem Tuch abzeichnete, das vor ihnen auf dem Altar lag. Mit Kerzen und einem Kreuz war er so drapiert worden, dass es den Anschein hatte, als wenn jeden Moment eine heilige Messe beginnen würde, was an Blasphemie nicht zu überbieten wäre.
Erst als Schritte durch das Gotteshaus hallten und sich eine weißgewandete Gestalt aus dem Dunkel eines kleinen Raumes schälte, um sich langsam auf das große Quadrat zuzubewegen, verstummte die Menge, während die innere Spannung der Gestalten anstieg.
Zum Zeichen ihrer Legitimation streckten wieder alle die Hände nach oben, um mit den Fingern »ihre« Zahl zu zeigen. Dieses Ritual hatte sich der erste Großmeister dieses geheimen Zirkels ausgedacht, um zu vermeiden, dass sich ein Unwissender in ihre Gemeinschaft einschleichen konnte. Wenn auch niemand etwas von ihrem Geheimbund und ihrem gesetzeswidrigen Treffen wissen konnte, war doch äußerste Vorsicht geboten. Durch diese Geste konnten sie sich gegenseitig kontrollieren, obwohl keiner je in das Gesicht des anderen gesehen, ja nicht einmal dessen Stimme richtig gehört hatte. Sie alle kannten nur die raue Stimme ihres Großmeisters, in dessen Gesicht aber niemand von ihnen je geschaut hatte und von dessen Namen ebenfalls niemand etwas wusste. Er allein war es, der die Herkunft, die Namen, das Alter, die Berufe, die Lebensumstände und die Charaktere all seiner vierundvierzig Mitglieder kannte.
Die Art und Weise, sich gegenseitig die Zugehörigkeit zu diesem namenlosen Zirkel ohne Worte zu zeigen, sollte sich in den folgenden Augenblicken ändern. Denn ohne etwas zu sagen, baute sich der Großmeister auf, nahm seine verschränkten Arme aus den breiten Ärmeln und reckte eine Hand mit gestrecktem Daumen nach oben. Obwohl eine blutrote Eins auf seinem weißen Umhang zu sehen war, konnten die anderen erst jetzt sicher sein, wer vor ihnen stand. Ein allseitiges stummes Kopfnicken, das von einem zufriedenen Grummeln begleitet wurde, bestätigte ihm, dass ihn die vierundvierzig Männer als ihren Großmeister erkannt und akzeptiert hatten.
Er nahm das um seinen Hals hängende Amulett ab und gab es einem Verschwörer mit einer Zwei auf seiner Kutte zur Begutachtung, dieser reichte es anschließend weiter. Einer nach dem anderen nickte und alle warteten auf die Worte ihres Großmeisters.
Der Großmeister setzte an: »Meine Brüder! Die Motive auf diesem Amulett werden uns in unserem Tun leiten! Es handelt sich um ein ›Lo Shu‹, das in einem fernen Land namens China schon seit über drei Jahrtausenden bekannt ist!«
Bevor er zur Erklärung der Motive kam, hielt er für einen bedeutungsvollen Moment inne. Dies sollte die Wichtigkeit dessen unterstreichen, was er nun zu sagen hatte: »Die Vorderseite zeigt neben Schriftzeichen und anderen Darstellungen einen toten Menschen mit einer Krone auf dem knochigen Schädel sowie die wichtigsten inneren Organe des menschlichen Körpers. Sie zeigt den toten Körper eines Königs oder Kaisers aus diesem fernen Land, dem nach dessen Tod die inneren Organe entnommen wurden, um ihn durch Balsamierung für alle Zeiten erhalten zu können. Damit weist sie auf die vanitas, die Vergänglichkeit des Lebens, hin, der wir mit all unserer Kraft, mit unserem Willen und Wissen … und mit unserem Vermögen entgegentreten müssen!«
Von einem zustimmenden Murmeln begleitet, sprach er weiter: »Unsere Bruderschaft hat sich zusammengefunden, um der Wissenschaft zu dienen, indem wir den Kanon der ›artes liberales‹ singen …« Ohne den begonnenen Satz zu unterbrechen, legte er mehr Kraft in seine ohnehin schon feste Stimme: »… und die Erforschung des menschlichen Körpers unterstützen! Wir werden all jenen mit größter Härte und mit dem Schwert Gottes begegnen, die uns daran hindern wollen!«
Weil keiner der vierundvierzig Geheimbündler verstanden hatte, was er mit dem »Schwert Gottes« gemeint haben könnte, brandete nur ein Raunen auf.
Der Großmeister gebot dem – allein schon aus Sicherheitsgründen – sofort Einhalt, indem er die zu allem entschlossenen Männer in strengem Ton daran erinnerte, dass ihre Gemeinschaft von einem gegenseitigen Schweigegelübde begleitet wurde, damit keiner den anderen erkennen und ihm somit schaden konnte.
Bevor das Geflüster lauter wurde, fuhr er fort: »Nun; wie sich die ersten fünfzehn von uns bei der ersten geheimen Zusammenkunft vor zwei Jahren in Lindau geschworen hatten, wird jeder für sich beizeiten einen vertrauenswürdigen Nachfolger suchen, der sich dann bei mir oder nach meinem Tod bei meinem Nachfolger vorstellen wird. Das heißt, dass unsere geheime Bruderschaft die Jahrhunderte ebenso überdauern wird wie jedes einzelne Organ in den Körpern jener Menschen, die nach ihrem Tod der Wissenschaft dienen werden!«
Er trat in das leerstehende Quadrat, das der Eins zugeordnet war, und erklärte den anderen, dass die Rückseite des Amuletts genau ein solches Quadrat darstellen würde wie das, auf dem sie standen. Es sollte Krankheiten und Tod abwehren und die zusammengezählte Summe der Zahlen aller Zeilen, Spalten und Diagonalen in den neun Feldern ergab die magische Zahl Fünfzehn. »Und alle darauf befindlichen Zahlen zusammengezählt ergeben fünfundvierzig! Deswegen sind wir fünfundvierzig Bundesbrüder! Es liegt an uns und unseren Nachfolgern, zu allen Zeiten dafür zu sorgen, dass dieses Amulett in den Händen des jeweiligen Großmeisters bleibt. Sollte es ihm – wie auch immer – abhandenkommen, werden seine Brüder alles dafür tun, um es wieder zurückzubekommen und dem Großmeister zu übergeben! Das heißt, dass es neben unseren eigentlichen Aufgaben unser vornehmliches Ziel ist, dieses ›Magische Amulett‹ mit allen Mitteln vor fremden Zugriffen zu schützen! Habt ihr das verstanden?«
Ein erneutes Kopfnicken zeigte dem charismatischen Mann, dass er weitersprechen konnte. »Dies wird im Laufe der Jahrhunderte nicht immer leicht sein; es wird Kriege geben, Brände, Krankheiten, vor allen Dingen aber immer wiederkehrende Seuchen wie den ›Lungenfraß‹, die Pest oder andere Epidemien, … stets einhergehend mit dem Tod. Dazu Diebstahl, Raub und Fehlgeleitete in unseren eigenen Reihen! Wenn sich jemand anderer dieses Amuletts bemächtigen sollte, wird er – und bei Notwendigkeit die Menschen in seinem Umfeld – ohne Gnade getötet! Der uns selbst auferlegte Codex verpflichtet uns dazu, dafür zu sorgen, dass sich unser Wissen um die Anatomie von hier aus über die ganze zivilisierte Welt verteilt und die ›artes liberales‹ ebenfalls Verbreitung finden! Ich gebiete und prophezeie euch, dass jedes Mal mehr Menschen zur Sühne sterben werden, wenn das Amulett verschwindet und wieder auftaucht! Sollte uns das Amulett abhandenkommen, stirbt eine Person. Sollte es erneut verloren gehen, zwei weitere.«
»… und letztlich so viele, bis die Fünfundvierzig erreicht ist«, unterbrach jemand wie aus dem Nichts heraus den Redner.
Nachdem die Versammelten festgestellt hatten, dass einer aus der Sechsergruppe gesprochen hatte, ging ein ungläubiges Flüstern durch die Reihen.
Anstatt den Zwischenruf einer Antwort zu würdigen, beendete der Großmeister das Thema mit den Worten: »Dieses Amulett darf uns allerhöchstens neunmal abhandenkommen! Ein zehntes Mal wird es nicht geben!« Seine Stimme zitterte. Dennoch fuhr er unbeirrt fort: »Es liegt also an den jeweiligen Großmeistern, auf das Amulett zu achten, und an seinen Mitbrüdern, ihn zu schützen und es wiederzubeschaffen, wenn es ihm abhandenkommen sollte!«
Nach einer kurzen Besinnungspause kam er zum nächsten Punkt, wozu er sein Quadrat mit einem Schritt über die Kerzen wieder verließ, um zum Altar zu gehen. Dort hielt er für einen Moment seine ausgestreckten Arme mit den geöffneten Handflächen so darüber, wie es Priester beim Gebet tun. Dann zog er das Tuch weg und bat einen der beiden Männer, die im Quadrat mit der Zwei standen, zu sich, um ihm in feierlichem Tonfall zu sagen: »Hiermit übergebe ich dir das, auf was wir über zwei Jahre hinweg sehnlichst gewartet haben: das Gladius Dei! Endlich hat uns ein reisender Händler über gute Beziehungen zu anderen Kaufmännern, die mit dem Schiff in die fernsten Länder fahren, fünfundvierzig dieser edlen Schwerter mitgebracht! Dieses sogenannte ›Jiàn‹ ist ein zweischneidiges Schwert aus dem Land, aus dem unser Amulett stammt!« Während er dies sagte, strich er sanft über die elegante Lederscheide. Anschließend hob er die Waffe hoch und warnte seine Brüder: »… wie viele Schwerter unserer Kultur, verbindet das ›Jiàn‹ Eleganz mit tödlicher Gewalt! In China wird dieses Schwert vom Kaiser bis zum ehrbaren Handwerker hinunter geführt, es ist ein Zeichen für den Rang der gesamten stolzen chinesischen Gesellschaft, ein Zeichen der Stärke. Und Stärke ist Leben. Und Schwäche heißt Tod! Fortan soll euch dieses Schwert stärken und auch das äußere Zeichen für unsere Bruderschaft sein, das es ebenso zu schützen gilt wie das ›Magische Amulett‹!«
Weil der Großmeister merkte, dass die Nummer zwei es nicht erwarten konnte, diese edle Waffe in die Hände zu bekommen, kam er zum fulminanten Ende seiner Ausführungen, indem er das Schwert mit gestrecktem Arm nach oben hielt und rief, so laut er konnte: »Dies ist Gladius Dei, das Schwert Gottes! … Es soll die Verbindung zu unserem Amulett sein! Achte gut darauf und gib es beizeiten an deinen Nachfolger weiter oder erkläre ihm ganz genau, wie er nach deinem Tod das Schwert in seine Hände bekommen kann!«
Nachdem der soeben Beschenkte wieder in seinem Quadrat stand und Ruhe eingekehrt war, streckte der Großmeister ein zweites Schwert in die Höhe und rief: »Auch dies hier ist das Schwert Gottes! … Es soll unserem geheimen Bund den Namen geben: ›Gladius Dei‹!«
Er hatte dies kaum ausgesprochen, als ihm auch schon ein vierundvierzigkehliges mehrfaches »Gladius Dei!« entgegenschallte.
Danach trat einer nach dem anderen aus seinem »Magischen Quadrat« und nahm stolz seine Waffe in Empfang. Als derjenige an die Reihe kam, der den Großmeister kurz zuvor unterbrochen hatte, wurde er von ihm aufgefordert, das Schwert aus der Scheide zu ziehen und es ihm zu geben. Kaum dass dies geschehen war, stieß er es ihm, ohne zu zögern, mitten ins Herz. Nun wusste auch der Letzte unter ihnen, was es hieß, eines der fünfundvierzig Mitglieder des Geheimbundes »Gladius Dei« zu sein. Und er würde bald auch wissen, wie nah Gut und Böse beieinanderliegen konnten.
Ein todbringendes Geschenk
Altshausen und villa Ysinensi – Anno Domini 1041 bis 1042
Die magische Zahl I
Kapitel 1
Ein Geräusch zerriss die Stille. Vielleicht ein Flügelschlagen. »Hörst du das auch?«, flüsterte Gerold Eberz, ein Ackerbauer und Sargmacher aus der kleinen Allgäuer Siedlung namens villa Ysinensi, an einem frühen Novembermorgen im Jahre des Herrn 1041 seinem Sohn Michael zu. Aber er bekam keine Antwort. Sein neunjähriger Spross saß ein ganzes Stück vom Vater entfernt auf dem Ast eines Baumes und konzentrierte sich auf das, was gleich direkt unter ihm geschehen würde. Denn während sein Vater am Ufer des kleinen Weihers im Norden ihrer beschaulichen Heimatsiedlung darauf wartete, dass ein Fisch anbiss, lauerte Michael darauf, dass ihm ein Kaninchen in die Drahtfalle ging, die sich jederzeit zusammenziehen konnte. Dabei musste er darauf achten, dass der gefrorene Ast sein Gewicht aushielt.
Während der Vater mit zusammengekniffenen Augen das Dunkel dieses Wintermorgens zu teilen versuchte, zupfte er immer wieder leicht an der Angelschnur, die im klaren Wasser des Weihers hing. Obwohl die Temperaturen hier gerade im Winter streng sein konnten, fror die Aachquelle nie zu. Daran, dass hier jemals ein fließendes Gewässer mit einer Eisschicht bedeckt gewesen war, konnte sich der Vater nicht erinnern, auch in diesem Winter nicht, obwohl es so ausnehmend frostig war, dass die Bevölkerung fror wie selten zuvor. Das Fällen von Bäumen als Brennmaterial war den geplagten Untertanen des Grundherrn, Wolfrad II. Graf von Altshausen, strikt untersagt worden. Lediglich Bruchholz durften sie einsammeln. Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, eines Tages erwischt zu werden, hatte es die hungernde und verhärmte Bevölkerung über Generationen hinweg riskiert, die Wälder ihrer Herren zu freveln, das Wild daraus zu jagen und in den gräflichen Gewässern zu fischen.
Was dies anbelangte, waren gerade die Menschen von villa Ysinensi im Laufe der Jahre einfallsreich geworden. Sie rotteten sich meist in den späten Herbsttagen zusammen, um in den Besitz von »Bruchholz« zu gelangen. Und dies spielte sich immer auf die gleiche Art ab: Während die Frauen von der Natur gegebenes Bruchholz und herumliegende Äste einsammelten, regelten die Männer den Rest. Ein paar von ihnen waren dafür zuständig, die anderen zu warnen, falls der gräfliche Forstverwalter mit seinen rauen Gehilfen auftauchen würde. Währenddessen schlugen die meisten von ihnen mit ihren Äxten die Stämme der sorgsam ausgewählten Bäume nur so weit an, dass die Zugkraft ihres einzigen Pferdes den Rest des Baumstamms knicken und zum Bersten bringen konnte. Die glatte Hälfte der Baumstümpfe bearbeiteten sie dann so, dass es aussah, als wären die Bäume vom letzten Sturm umgerissen worden. Danach etwas Walderde darübergestrichen und mit Glück ein bisschen Zeit bis zum nächsten Inspektionsrundgang des Forstverwalters gewonnen, so war der Waldfrevel bisher kaum einmal offenkundig geworden. Damit keiner den anderen beim Grafen anzeigen konnte, mussten sich sämtliche Männer der Siedlung daran beteiligen.
»Irgendwann kriegen sie uns!«, hatte Gerold Eberz mehr als einmal gewarnt. Der trotz seines niederen Standes kluge Urenkel eines Ackerbauern, Enkel eines Ackerbauern und Sohn eines Ackerbauern hatte sich in Ravensburg zum Sargtischler ausbilden lassen, weswegen er sich zwar den Ärger seiner Eltern, aber auch den Respekt seiner Mitmenschen und sogar den der Obrigkeit verdient hatte. Denn außer ihm war noch keiner von ihnen aus villa Ysinensi hinausgekommen. Er war von allen Männern der Siedlung derjenige, der am meisten von Holz und dessen Verarbeitung verstand. Deswegen lag es auch Jahr für Jahr an ihm, die Baumstümpfe so zu präparieren, dass sie glaubwürdig danach aussahen, als hätte sie ein Sturm umgerissen und dementsprechend zersplittert. Der gräfliche Forstverwalter war allerdings nicht dumm, weswegen ständig die Gefahr drohte, ihm auf den Leim zu gehen. Dennoch war in all den Jahren fast nichts schiefgelaufen. Nur wenige der Männer waren von den Schergen des Grundbesitzers so hart bestraft worden, dass sie nicht hatten weiterarbeiten können.
Aber Gerold Eberz war wohl bewusst, dass er und sein Sohn an diesem Wintermorgen etwas streng Verbotenes taten, das ihrer beider Leben kosten konnte. Deswegen war der äußerst wachsame Familienvater unruhig geworden. Ohne zu atmen, lauschte er ins morgendliche Halbdunkel hinein. Er konnte sich anstrengen, wie er mochte; das, was er zu hören glaubte, war nicht zu sehen. Und dies beunruhigte den abergläubischen Mann, der zusammen mit seinem Sohn mutig damit beschäftigt war, gleich zweifach gegen das vom Grundherrn herausgegebene »Jagdt- und Fischereyrechtt« zu verstoßen. Darauf stand offiziell die Todesstrafe und weil sich die gesamte Gegend im Besitz des Grafen von Altshausen befand, war dieses elende Gesetz lebensbedrohend – weniger wegen der drohenden Strafe bei Zuwiderhandlung, vielmehr wegen der Hungersnot bei Nichtzuwiderhandlung. Eine Todesstrafe drohte in Wirklichkeit vermutlich nicht, dafür waren die steuerzahlenden Arbeitskräfte zu wertvoll. Aber welchen Grundherrn scherten schon die Vermutungen seiner Untertanen?
Weil Eberz zehn Mäuler zu stopfen hatte, mussten die beiden weitermachen, ohne sich von irgendwelchen Gesetzen beirren zu lassen. Der alte Mann zog unverdrossen weiter an seiner Angelschnur, während sein Sohn ein Kaninchen entdeckte, das seinen Köder gerochen haben musste.
Im vergangenen Jahr war villa Ysinensi noch eine gänzlich schutzlos offene Siedlung gewesen. Seit die Siedler aber unter der fachkundigen Ägide von Gerold Eberz einen einfach geflochtenen Speltenzaun aus Weidenruten und geviertelten Holzstangen errichtet hatten, fühlten sie sich sicherer. Wenn diese primitive Ortsumschließung auch Lücken zwischen den Holzpflöcken aufwies, bot sie doch einen gewissen Schutz vor Wölfen und anderen Wildtieren. Das Wichtigste dabei war aber, dass es allein dieser Zaun vermochte, aus den vierundzwanzig Behausungen der ehemaligen Haufendorfsiedlung ein richtiges kleines Dorf zu machen, in dem zum gegenseitigen Schutz der Zusammenhalt noch mehr heraufbeschworen werden konnte als zuvor. Die ersten Hütten waren auf einer kleinen Erhebung um den Fronhof des Grafen herum errichtet worden, damit die hier lebenden Menschen bei Notwendigkeit auch den Schutz ihres Grundherrn in Anspruch nehmen konnten, aber auch, um ihm jederzeit schnell zur Verfügung zu stehen, falls er sich in villa Ysinensi aufhalten sollte … was allerdings in der Vergangenheit höchstens zweimal im Jahr vorgekommen war. Da hatte sich sein Abgabeneintreiber schon öfter blicken lassen.
Während Michael unbeirrt vom Baum herunter auf die Kaninchenfalle spähte, horchte sein Vater wieder konzentriert ins Nichts des aufziehenden Morgens. »Rabenvögel«, murmelte er seine Wahrnehmung leise in sich hinein. Nach genauerem Hinhören konnte er abschätzen, dass es mindestens ein Dutzend, wenn nicht gar drei Handvoll dieser Unglücksvögel waren, die sich inzwischen auf den umliegenden Bäumen niedergelassen hatten.
»Dreizehn!«, entfuhr es ihm bei diesem Gedanken so laut, dass die Schar erschrocken aufstob und laut krächzend davonflog. »Das ›Dutzend des Teufels‹ hat uns gesehen! Das ist kein gutes Zeichen! Lass uns abbrechen, Michael!«, rief er seinem Sohn zu, während er auch schon seine Angelschnur aus dem Wasser zog und hastig auf einen kurzen Stock rollte. Georg wusste aus trauriger Erfahrung, dass eine solche Menge dieser Vögel drohendes Ungemach ankündigen konnte.
Im Moment allerdings schienen sie zumindest Michael kein Pech gebracht zu haben; denn das Kaninchen war tatsächlich in seine Falle getappt. Trotzdem war der junge Eberz verärgert. »Ist dir klar, Vater, dass das Karnickel abgehauen wäre, wenn es deinen Ausschrei auch nur einen Moment vorher gehört hätte?« Während der im Grunde genommen überglückliche Knabe leise weiterschimpfte, kletterte er behände vom Baum, um nachzusehen, ob er einen Rammler gefangen hatte. »Scheiße, schon wieder eine Häsin!«, fluchte er. »Dann kommst du eben doch in Mutters Kochtopf!«
»Du wirst schon noch ein passendes Karnickel fangen, um mit deiner Zucht beginnen zu können. Deine ›Wuschel‹ muss sich in Gottes Namen noch ein wenig gedulden, um für Nachwuchs zu sorgen. Hauptsache, wir haben etwas zu essen! Ich gratuliere dir, mein Sohn! Ich bin stolz auf dich!«
Auf dem Nachhauseweg lag immer noch ein undurchdringliches Grau über ihnen, das sich bis über die Siedlung am Fuße des Schwarzen Grates zog, in der die beiden mit dem Rest ihrer Familie ein gottgefälliges Leben führten – sah man von dem täglichen Mundraub einmal ab. Michael schien hochzufrieden zu sein, doch fröstelte es seinen Vater. Er hatte das Gefühl, als wenn sich die Natur mit den unheilbringenden Vögeln verbündet hätte und ankündigen wollte, welch unbeschreibliches Elend auf die Bewohner von villa Ysinensi jetzt und in den bevorstehenden Jahrhunderten zukommen würde. Dass sich Gerold Eberz’ Vorahnung schon bald erfüllen würde, konnte er allerdings ebenso wenig wissen, wie er nicht im Entferntesten erahnen konnte, dass das kommende und über ganze fünf Jahrhunderte anhaltende Unheil von einem gut gemeinten Gastgeschenk ausgehen würde.
*
Zur selben Zeit hatte sich die gräfliche Familie in ihrer Residenz im knapp sechzig Meilen entfernten Altshausen mit dem dortigen Pfarrer, dem Beichtvater und Vertrauten der Grafenfamilie, zur ersten Mahlzeit des Tages zusammengefunden. Es war ein ganz besonderer Tag, denn mit am Tisch saß nicht nur Manegold, der leibliche Bruder des Herrn dieser fruchtbaren Gegend, sondern auch sein siebenundzwanzigjähriger Sohn Hermann, den man »den Lahmen« nannte. Wegen einer körperlichen Behinderung und eines Sprachfehlers hatte ihn der Vater bereits mit sieben Jahren dem Kloster Reichenau übergeben. Normalerweise hätte Hermann in diesem zarten Alter damit beginnen müssen, die hohe Schule zum Ritter zu durchlaufen. Hätte der an Muskelschwund erkrankte Knabe dies tun können, wäre er schon vor sechs Jahren in den Ritterstand erhoben worden. Der Vater hatte sich aber frühzeitig eingestehen müssen, dass er aus seinem Sohn keinen streitbaren Recken und schon gar keinen weltlichen Herrscher würde machen können. Stattdessen hatte Abt Berno von Reichenau erkannt, dass der Junge mehr mit geistigen Talenten gesegnet war, die es zu fördern galt. Deswegen hatte der Graf sich schweren Herzens dazu entschlossen, nach seinem viel zu früh verstorbenen zweiten Sohn Luitpold an dessen Stelle seinen leiblichen Bruder Manegold zum Nachfolger zu bestimmen.
Gräfin Hiltrud hatte wie gewohnt auftafeln lassen, was Küche und Keller hergegeben hatten. Während das Volk darben musste, standen schon in aller Herrgottsfrüh auf dem reich gedeckten Tisch ein kunstvoll getöpferter Bartmannskrug mit unverdünntem Bier und eine Glaskaraffe, die aus dem fernen Murano stammte und die dank der guten Handelsbeziehungen Westschwabens aus den italienischen Landen den Weg nach Altshausen gefunden hatte. Das von Meisterhand geschliffene Glas funkelte im Schein der vielen flackernden Holzspäne an den Wänden und der Kerzen auf dem Tisch, der blutrote Wein schimmerte darin und verführte trotz der frühmorgendlichen Stunde zum Trinken.
Zu essen gab es Haferschleim mit Honig vom Mare Brigantium, frisch gebackenes Brot und Gänseschmalz in kleinen Töpfchen, Käse, gebratene Eier, Schweinespeck und einiges mehr.
»Nun sagt mir endlich, was Euch bedrückt, mein Herr!«, eröffnete der dickwanstige Pfarrer das Gespräch, während er schmatzend an einem Hühnerbein herumnagte.
»Das kann ich gerne tun«, antwortete der Graf, während er seinem Sohn lächelnd in die Augen schaute. »Zunächst aber möchten Wir Unserer Freude darüber Ausdruck verleihen, dass sich Unser Sohn Hermann die Ehre gegeben hat, Uns zu besuchen! Seinen weisen Rat werden Wir sicher noch gut gebrauchen können!«
»Um was geht es denn, Vater?«, mochte Hermannus Contractus ebenfalls wissen, wie sich der Altshausener Spross seit seinem Eintritt in den Konvent der Reichenauer Benediktiner nannte.
Der Graf nahm einen kräftigen Schluck, wischte Hermann das Sekret, das ihm aus dem Mund troff, mit dem extra hierzu bereitliegenden Lappen weg und fuhr sich selbst mit dem Handrücken über den Bart. Dann hielt er seinem Mundschenk eines der zur Karaffe passenden Gläser hin.
Bevor er tief durchatmete, bekannte er, »sein Volk« nicht mehr richtig im Griff zu haben. »Die Bauern beginnen zunehmend zu rebellieren, insbesondere im Süden Unseres Herrschaftsgebietes! Außerdem hat Uns der gräfliche Forstverwalter berichtet, dass in den Wäldern um villa Ysinensi herum auffallend viele Holzbrüche zu verzeichnen sind und laut Aussage des dort eingesetzten Mairs eine Seuche viele Fische in den dortigen Teichen und Bächen dahingerafft haben soll. Wegen des ungemein hohen Schnees kann er beidem aber erst im Frühjahr nachgehen.«
Als er dies hörte, murmelte sein Sohn Hermann abschätzig: »Von wegen ›Holzbruch‹ und ›Fischsterben‹! Lasst Euch das von Eurem dortigen Ortsvorsteher ja nicht gefallen!«
»Wie meint Ihr das?«, fragte der Vater irritiert, bekam von Hermann aber lediglich zur Antwort, dass er ihm dies später erklären würde. »Erzählt uns erst weiter von dem, was Euch bedrückt.«
Der Graf nahm erneut einen Schluck, dann sagte er, was ihn schon seit längerer Zeit belastete: »Leider werden Wir nicht umhin kommen, immer strengere Maßnahmen zu ergreifen, um die Bauern zur Räson zu bringen! Wenigstens haben Wir die Handwerker und Kaufleute der größeren Dörfer und der Städte gut unter Kontrolle!«
»Das glauben Wir gerne«, bemerkte Hermann wegen seines Sprachfehlers schwer verständlich und begründete dies damit, dass die Bauern ihren Äckern in diesen kargen Zeiten trotz des guten Bodens zu wenig abzuringen vermochten, um auch noch ordentlich Abgaben zahlen zu können. Den Handwerkern und Kaufleuten hingegen ginge es verhältnismäßig gut.
»Dafür können Wir doch nichts! Das ist von Gott so gewollt«, entgegnete der Vater fast trotzig.
»Aber Ihr seid der Grundherr, mein Gemahl!«, mischte sich nun Hiltrud ins Gespräch, während sie an Hermanns Gewandung herumzupfte. Obwohl sie wissen sollte, dass Frauen zu schweigen hatten, wenn sich Männer unterhielten, wagte sie es ungeniert, sich am Gespräch zu beteiligen. Wegen ihres Sohnes, der in einem eigens für ihn angefertigten Spezialstuhl saß, hatte der Graf es ihr gestattet, bei diesem Gespräch mit dabei zu sein, damit sie sich um ihn kümmern konnte.
»Mutter hat recht!«, pflichtete Hermann ihr bei. »Es liegt allein an Euch, etwas dagegen zu tun!«
Der Graf stöhnte auf. »Aber was? Das ist hier die Frage.«
»Welche Bauern sind denn am aufmüpfigsten?«, interessierte indessen den Priester, während er sich zum dritten Mal Wein in den Becher schütten ließ.
Der Graf brauchte nicht lange zu überlegen, um zu antworten, dass es die ständig nörgelnde Bevölkerung von villa Ysinensi sei, die ihm arg zu schaffen mache. »… aber gleichzeitig sind die Menschen dort auch die gottesfürchtigsten!«
»Das ist gut!«, sprudelte es aus Hermann heraus, während sich auch schon ein breites Grinsen über sein schmales und blasses Gesicht zog.
»Selbstverständlich ist das gut!«, wunderte sich der Altshausener Geistliche über die Feststellung seines klösterlichen Gesinnungsbruders.
Hermann schwieg ein Weilchen, dann bemühte er sich um Worte, die allerdings nur schwerlich über seine Lippen kamen: »Ich wüsste da schon etwas!« Dabei rang er hörbar um einen triumphierend klingenden Tonfall.
Alle horchten auf, selbst der Priester hielt mit seiner ständigen Kauerei inne. Sämtliche Blicke waren auf den weisen Kleriker vom Mare Brigantium gerichtet, der es offenbar genoss, seinem ansonsten »allwissenden« Vater einen guten Rat erteilen zu dürfen.
»Spendiert Euren dortigen Untertanen einfach ein Gotteshaus, das wird ihnen die Münder stopfen und sie aus Dankbarkeit Euch gegenüber wieder gefügiger machen!«
»Eine Kirche?«, wunderte sich Manegold, während sich Wolfrad bereits Sorgen darüber machte, was dies kosten würde.
»Ja!«, antwortete Hermann und ließ auch schon seine weiteren Gedanken hierzu laut werden: »Und wir weihen sie dem heiligen Apostel Jakobus dem Älteren und dem heiligen Märtyrer Georg! Es muss ja nichts Großes sein!« Mühsam sprach er weiter: »Eine kleine Hütte aus gestrickten Balken vielleicht. Wenn Ihr Euch ganz besonders großzügig zeigen wollt, sogar mit einem kleinen Turm, der gleichzeitig als Warnturm dienen könnte. Die Glocke dazu kann ich stiften, weil ich weiß, dass in einem Schopf meines Klosters eine herumliegt, die nicht mehr gebraucht wird, … glaube ich zumindest.«
*
Hermanns Rechnung war aufgegangen: Als sein Vater Wochen später nach mehreren Besichtigungen und Planungsgesprächen mit seinem Baumeister, den Priestern der Umgebung und dem Ortsvorsteher von villa Ysinensi die dortige Bevölkerung zusammenrief, um sie von seinem Vorhaben in Kenntnis zu setzen, war die Freude übergroß. Um an den Kirchenbau gehen zu können, waren allerdings nicht nur Handlanger, sondern auch fachkundige Arbeiter nötig. Aber die waren in dem kleinen Dorf Mangelware.
»Auf keinen Fall setze ich hier meinen Hofbaumeister und die teuren Handwerker aus Altshausen oder aus Trauchburg ein!«, gab der Graf dem Mair die klare Marschrichtung vor und sollte – wie konnte es anders sein – damit durchkommen.
Weil es in villa Ysinensi keinen einzigen Bauarbeiter gab, der dieses Handwerk richtig gelernt hatte, wurde der Sargtischler Gerold Eberz kurzerhand zum Vorarbeiter über diejenigen Männer gemacht, mit denen er schon den Dorfzaun errichtet und mit zwei Toren versehen hatte.
»Stellt diesem Tischler irgendetwas in Aussicht! Dann wird er schon spuren«, empfahl der Graf seinem Geldverwalter, von dem alle wussten, dass ihm Eigennutz vor Gemeinwohl ging.
Dass der Graf ausgerechnet diesen hinterlistigen Denunzianten auf seine Geldschatulle gesetzt hatte, war kein Zufall gewesen. »Altshausen ist weit weg von villa Ysinensi«, hatte er ihm bereits vor dessen Amtseinführung in verschwörerischem Tonfall gesagt und ergänzt, dass er jemanden bräuchte, der ständig Informationen für ihn einholen würde. Auch wenn der Graf den kleinen dicken Mann nicht mochte, drückte er ihm zu dessen Freude ein paar Münzen in die verschwitzten Hände. Dass Eberz und seine Helfer keinen Pfennig davon zu sehen bekommen würden und sich der Geldverwalter dieses Geld mit dem ebenfalls hinterlistigen Mair von villa Ysinensi teilen würde, war ihm dabei klar. Hauptsache, der Kirchenbau würde so gut vorangehen, dass er das Bistum Konstanz bald über die Fertigstellung informieren konnte.
Es stellte sich rasch heraus, dass die Wahl des Grafen richtig gewesen war; denn Gerold Eberz verstand es offensichtlich nicht nur, meisterlich mit Holz umzugehen, sondern auch Menschen zu führen. Ohne einen Plan lesen zu können, gab er seinen Männern klare Anweisungen in Bezug auf das Fällen und Bearbeiten der von ihm und vom gräflichen Revierförster sorgsam ausgewählten Bäume, die er an den vier Ecken der Kirche so verzapfte, dass das Gebäude mit zunehmender Balkenhöhe stabiler wurde.
Die Arbeit ging gut voran, es hatte keine unangenehmen Vorkommnisse und keinen einzigen nennenswerten Unfall gegeben. Alles lief wie geplant. Es schien fast so, als wenn dieser Kirchenbau unter einem guten Stern stehen würde. Als sich aber eines Tages Rabenvögel auf den umliegenden Bäumen niederließen, um das Geschehen zu beobachten, kam Eberz wieder das »Dutzend des Teufels« in den Sinn. »Heilige Maria Mutter Gottes, erbarm dich unser«, flüsterte er von den anderen unbemerkt in sich hinein, während er hastig das Kreuz schlug. Danach ging ihm die Arbeit wieder ein wenig leichter von der Hand.
Als sie eine gewisse Höhe erreicht hatten, trat Eberz mit seinem Sohn Michael und einem anderen seiner Arbeiter in die Raummitte, streckte beide Arme von sich und sagte: »An diese Stellen hier kommt je ein Fenster, zwei Ellen im Quadrat groß. Dann trat er in den Altarraum vor, den er wie die Apsis einer »richtigen« Kirche etwas schmäler gehalten hatte als den Kirchenraum, der immerhin dreißig Fuß in der Breite maß, während die Länge des Hauptraumes stolze fünfzig Fuß betrug. Das hieß, dass sich zu beiden Seiten eines Mittelgangs jeweils sieben Sitzreihen mit je sieben Plätzen würden einbauen lassen. Dass es genau sieben sein mussten, hatte sich Hermannus Contractus gewünscht, weil dies die heilige Zahl schlechthin war.
»Diesen Teil hier …«, Eberz zeigte auf den festgestampften Lehmboden des Chorraumes, »… erhöhen wir um zwei Treppenstufen! Dann schaut das Ganze imposanter aus und der Pfaffe, der hoffentlich bald kommen wird, kann sich über uns erheben.« Spott schwang in seiner Stimme mit, obwohl er es mit seiner Arbeit im Dienste des Herrn sehr ernst und genau nahm.
Dafür, dass sie das ganze Frühjahr und über den Sommer hinweg bis in den Herbst hinein an der Kirche gefront hatten, waren sie von ihrem Grundherrn außerordentlich gut mit Lebensmitteln für sich selbst und für ihre Familien versorgt worden. Ansonsten hatte der Graf lediglich das Holz für den Kirchenbau gestiftet und sich zwischendurch persönlich nach dem Fortgang der Arbeiten erkundigt. Alles andere war in den Händen von Gerold Eberz und seinen Männern gelegen. Weil sie wussten, dass am Schluss allein der »wohledle« Spender, der Mair und der neue Pfarrer gut dastehen, sie selbst aber keines Lobes gewürdigt würden, gab es immer wieder Situationen, in denen der eine oder andere die Arbeit niederlegen wollte. Aber dem von allen respektierten Vorarbeiter war es immer wieder gelungen, seine maulenden Arbeiter zur Vernunft zu bringen. »Ihr und eure Familien habt doch noch nie so viel zu fressen bekommen wie jetzt, oder?«, hatte er dabei nicht nur einmal als Argument ins Feld geführt und die Männer damit zu Höchstleistungen angetrieben. Geholfen hatte ihm dabei, dass er die Familienväter unter ihnen heimlich auch Holz für ihre eigenen Behausungen hatte schlagen lassen, während er selbst mit dem Abfallholz zufrieden gewesen war. Dabei hatten alle gewusst, dass Eberz damit sein eigenes Todesurteil unterschreiben würde, falls sie denunziert oder beim Holzdiebstahl erwischt würden. Und dies rechneten sie ihrem allseits beliebten Vorarbeiter so hoch an, dass sie ihn auch über den Kirchenbau hinaus niemals im Stich lassen würden.
So war der Rohbau schon bald soweit fertig, dass sie das Dach decken und den Glockenturm errichten konnten.
»Kruzifix! Wo bleibt diese verdammte Glocke, die uns der Graf versprochen hat?«, schimpfte Eberz und handelte sich dadurch eine Rüge des neuen Pfarrers ein, der vor ein paar Tagen wie aus dem Nichts in der Abenddämmerung in villa Ysinensi aufgetaucht war und sich einmal mehr hinter ihn geschlichen hatte, um zu lauschen.
Der Geistliche hatte die gotteslästernde Flucherei mitgehört. »Fünfzehn Vaterunser!«, trug er dem Sargtischler als Sühne auf.
Anstatt darauf einzugehen, blaffte der längst selbstbewusst gewordene Vorarbeiter den Priester in der einfachen Sprache des Volkes an: »Was willst du hier, Pfaffe? Schleich dich und lass uns unsere Arbeit machen!«
»Wahrscheinlich möchte er einen von uns bei der Obrigkeit hinhängen!«, bekam Eberz Schützenhilfe von einem seiner Männer, die allesamt zu lachen begannen.
Der Priester konterte, dass es ihn freuen würde, Eberz und seine Leute bei solch guter Laune vorgefunden zu haben. »Zu eurer und zur Freude Gottes darf ich euch im Auftrag unseres Grundherrn etwas mitteilen!«
Nun war es still und auch die Letzten legten ihre Arbeitsgeräte ab, um nähertreten zu können. Schließlich mochten alle mitbekommen, was ihr noch nicht offiziell eingeführter Pfarrherr zu sagen hatte.
Weil der Pfaffe die Situation und seine vermeintliche Überlegenheit genoss, fuhr er nicht gleich fort.
Gerold Eberz nahm sich wieder das Wort: »Nun sag schon, was gibt es für Neuigkeiten?«
»Du betest deine Vaterunser?« Während er auf Eberz’ Antwort wartete, blitzten die Augen des Pfarrers gefährlich auf. Dann spuckte er eine unverhohlene Drohung aus: »Du weißt, was auf Gotteslästerung steht!«
»Schon gut, nach Feierabend werde ich Zwiesprache mit unserem Herrn halten und das Dreifache der von dir geforderten Gebete sprechen!«, wehrte Eberz mit erhobenen Händen ab. »Aber nun sag schon, was …«
Um coram publico zu demonstrieren, dass sich der studierte Pfarrherr das Wort nicht von einem unbelesenen Sargtischler erteilen lassen musste, unterbrach er dessen Frage und kam endlich zur Sache: »Euer Herr lässt ausrichten, dass … die Glocke noch vor St. Martini hier sein wird!«
Weil er diese frohe Botschaft verkündet hatte, war die kleine Stichelei schlagartig vergessen und es brandete ein solcher Jubel auf, wie es ihn zum letzten Mal in villa Ysinensi gegeben hatte, als die Bevölkerung erfahren hatte, dass ihnen der Graf ein Gotteshaus spendieren würde. Damals hatten die Fronarbeiter ja noch nicht gewusst, dass sie ihre Kirche selbst errichten mussten. Aber das war in diesem Moment des Glücks egal, sie freuten sich derart auf die Glocke, dass es ihnen Antrieb gab, das Gebäude rechtzeitig bis St. Nikolaus fertigzustellen.
Die Zeit drängte, denn über den Kirchenbau hinaus hatte der Graf in Auftrag geben lassen, so viele grob gearbeitete Bänke und Tische herzustellen, dass insgesamt etwa einhundertfünfzig Gäste Platz auf dem Gelände finden konnten, auf dem die Kirchweihe auch weltlich gefeiert werden sollte. »Die könnt ihr dann behalten und von mir aus verfeuern!«, hatte er gleichsam gönnerhaft wie spaßhalber zu Eberz gesagt.
Dabei hatte der Graf offensichtlich gewusst, dass der umsichtig denkende Eberz dafür sorgen würde, die bis dahin bearbeiteten Holzbretter niemals dem Feuer zu übergeben, sondern zum Bau der längst überfälligen Kornscheuer zu verwenden. Schon seit geraumer Zeit besprach der Graf solche Dinge mehr und mehr direkt mit dem Sargtischler, anstatt mit dem Mair, der eigentlich dafür zuständig gewesen wäre. Der Grund mochte wohl darin zu suchen sein, dass Eberz ein ernsthaftes Interesse am Vorwärtskommen seines Dorfes zeigte und die Dinge anpackte, während der Mair bei den meisten anfallenden Arbeiten durch Abwesenheit glänzte und sich mehr für Alkohol als für die Allgemeinheit zu interessieren schien.
Kapitel 2
Es war ein extrem frostiger und deswegen auch ungemütlicher Dezembertag des Jahres 1042. Aber dies hatte den Konstanzer Bischof Eberhard I. nicht davon abgehalten, die schwere Mühsal trotz des schlechten Wetters auf sich zu nehmen, mit großem Gefolge ins noch kältere Allgäu zu reisen, um dort eine wichtige Mission zu erfüllen. Aber kaum in villa Ysinensi angekommen, sollte sein Vorhaben so holprig beginnen, dass er dies sogar als unheilbringendes Omen betrachtete. Denn schon am oberen Tor, durch das er ins Dorf gelangen wollte, musste er aus seiner Kutsche heraus auf ein Pferd steigen – der hölzerne Durchlass war für das breite Gefährt zu schmal gewesen. Wegen seiner durch den Matsch nass gewordenen Beinlinge fluchte der hochrangige Mann Gottes still vor sich hin, anstatt den herzlichen Empfang der hiesigen Bevölkerung zu genießen und ihr würdig zuzuwinken.
»Gott, was sind das nur für einfache Bauern«, grummelte er seinem klugen Adlatus in despektierlichem Tonfall zu.
Der Konstanzer Diakon, der bei Reisen immer an der Seite des Bischofs war, nutzte die Gelegenheit, um seinen Herrn dahingehend aufzuklären, dass er den hiesigen Menschenschlag nicht unterschätzen dürfe. In dieser hügeligen Gegend wuchsen nicht nur Dinkel und Hafer, sondern zudem wurde äußerst erfolgreich Flachs angebaut und verarbeitet, weswegen gerade die Bauern gute Abgabenzahler seien. »Was glaubt Ihr, weswegen deren Grundherr eine Kirche gestiftet hat, obwohl er ein Potentat alter Schule ist?«
»Er wird schon gewusst haben, weshalb er dies getan hat. Wahrscheinlich sind die Abgaben entgegen Eurer Meinung doch nicht so hoch, dass sie ihn zufriedenstellen.«
»Oder die Leute hier begehren gerne auf. Die Allgäuer sind ja bekannt dafür, ein streitbares Völkchen zu sein«, mutmaßte der junge Geistliche, der die braune Kutte der Benediktiner trug.
»Schon gut, mein Freund! Lasst uns lieber dafür sorgen, dass wir uns schnellstens aufwärmen und unseren Hunger stillen können, bevor wir uns zu unseren Schlafstätten begeben. Für die morgige Zeremonie müssen wir ausgeruht sein! Die Reise war lang und anstrengend, außerdem ist es teuflisch kalt!«
»Aber, aber, Euer Exzellenz!«, rügte der treu ergebene Kirchenlehrer, der gleichzeitig auch Domschatzmeister war, den Bischof für das Unwort, das der soeben in den Mund genommen hatte.
*
Die geplante Kirchen- und Glockenweihe hätte eigentlich am Tag des heiligen Nikolaus stattfinden sollen. Aber wegen eines gewaltigen Schneesturms, der über das Mare Brigantium hinweggefegt war, hatte die Delegation des Bischofs von Konstanz ihre Abreise um vier Tage verschieben müssen – für die Bevölkerung von villa Ysinensi eine gefühlte Unendlichkeit. Letztlich waren sie aber froh gewesen, noch etwas Zeit gewonnen zu haben, um ihre Siedlung herausputzen und alles für die Gäste des Grafen vorbereiten zu können. Und dazu hatte gehört, dass über den größten baumlosen Platz der Siedlung Planen gespannt wurden, unter denen die etwa einhundert erwarteten Gäste verköstigt werden konnten. Und für diejenigen, die erst am Tag nach der kirchlichen und weltlichen Feier ihren Rückweg antreten würden, sollte ein Zeltdach zur Verfügung stehen, unter dem sie ihre Häupter niederlegen konnten.
Rundherum hatten reisende Händler aus nah und fern, die im Laufe des Jahres von dieser Kirchenweihe erfahren hatten, ihre rollenden Verkaufsbuden aufgestellt. Weil sich der feierliche Anlass auch unter anderen mehr oder weniger ehrlichen Berufsgruppen herumgesprochen hatte, war neben Gauklern, Komödianten und Musikanten auch ein Heer von Falschspielern und Taschendieben angelockt worden. Sogar ein paar wandernde Gunstgewerblerinnen erhofften sich mit Gottes Hilfe gute Geschäfte, weswegen auch sie dem Tross des Bischofs von Konstanz aus hinterhergereist waren – selbstverständlich in gebührendem Abstand. Um ihrem Gewerbe ungestört nachgehen zu können, hatten sie ihren weich gepolsterten und reichlich mit Schaffellen ausgestatteten Planwagen etwas abseits der anderen Fahrzeuge abgestellt.
So etwas hatten die Einheimischen noch nie miterleben dürfen. Kein Wunder also, dass sie irritiert und völlig aus dem Häuschen waren – insbesondere, weil sich der Himmel gnädig zu zeigen schien und zum ersten Mal seit mehreren Wochen wärmende Sonnenstrahlen durch die sich zunehmend teilende Wolkendecke schickte.
*
Anderntags war es endlich so weit und der kurzerhand zum Mesner bestallte Sargmacher durfte erstmals die von der Insel Reichenau stammende gusseiserne Kirchenglocke läuten, die Hermannus Contractus tatsächlich spendiert hatte. Dass auf der Glocke das Amtswappen des ehemaligen Reichenauer Abtes Pirminius mit eingegossen war, der das Inselkloster vor über dreihundert Jahren gegründet hatte, störte Gerold Eberz nicht im Geringsten. »Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul! Hauptsache, er wiehert gut«, hatte er zufrieden schmunzelnd von sich gegeben, nachdem ihm die Bedeutung dieses Wappens erklärt worden war.
Alles war vorbereitet, die Menschen hatten sich und ihre Siedlung ins bestmögliche Licht gesetzt und waren guter Laune. Sicherheitshalber hatten sie ihre Nutztiere eingesperrt. Damit wollten sie vermeiden, dass bei den auswärtigen Besuchern Begehrlichkeiten geweckt wurden und sie nach dem Ende dieses Spektakels nicht versehentlich eine Ziege mehr im Stall vorfinden würden.
Als der Bischof von Konstanz zusammen mit vierzehn Klerikern des Ordens vom Heiligen Benedikt feierlich in die Kirche einzog, erstrahlte das Gotteshaus in bescheidenem Glanz. achtundneunzig der wichtigsten Männer des Umlandes hatten die Kirchenbänke bis auf den letzten Platz gefüllt. Die allesamt gespannten Ehrengäste waren nicht nur aus den umliegenden Orten Christazhofen, Eisenharz, Engerazhofen, Enkenhofen, Friesenhofen, Leutkirch, Ratpoticella, Rohrdorf, Trauchburg, Urlau und Wangen gekommen, sondern waren auch aus den etwas ferneren Orten Aulendorf, Baienfurt, Ravensburg, Waldsee, Weingarten, Wurzach und natürlich auch aus Altshausen angereist wie Delegationen aus weiten Teilen des Allgäus und aus Lindau. Vom Grafen ausgesandte Boten zu Ross hatten dafür gesorgt, dass alle seiner Einladung Folge leisteten. Dementsprechend voll war die kleine Kirche, die nun ihre Bewährungsprobe bestehen musste.
Die ersten beiden Bankreihen waren dem Grundherrn, Wolfrad II. Graf von Altshausen und Herrn der Burg sowie des Landes Trauchburg, seiner Familie und deren Gefolgschaft vorbehalten. So war seine Gemahlin Hiltrud das einzige weibliche Wesen in der Kirche. Die Frauen der anderen mussten sich – ebenso wie die hiesige Bevölkerung – damit begnügen, sich vor der Kirchentür zu versammeln, die trotz der Kälte geöffnet war. Auf persönlichen Wunsch des Grafen und seiner gnädigen Gemahlin war die Weihe kurzfristig auf den Tag der Gedächtnisfeier zum Tod ihres kleinen Sohnes Luitpold gelegt worden, weswegen die Kirchenstifter der Zeremonie wohl mit gemischten Gefühlen beiwohnen würden.
Rechter Hand vor dem Altarraum hatte der Bischof einen mitgebrachten Katheder aufstellen lassen, wie ihn die Mönche in den Klöstern benutzten, um im Stehen Schriften zu vervielfältigen. Dieses wunderschöne und wertvolle Pult würde er als sein persönliches Geschenk für die Bevölkerung von villa Ysinensi in dem Gotteshaus zurücklassen, damit der hiesige Dorfpfarrer bei den Liturgien an Sonn- und Feiertagen darauf die Missale platzieren und vor der versammelten Kirchengemeinde daraus lesen oder die Manuskripte für seine Predigten drauflegen konnte.
Dieses Stehpult ist ein von meinem Adlatus wohldurchdachtes Geschenk, dachte sich der Bischof, nachdem er festgestellt hatte, dass das aus seiner Sicht primitive Gotteshaus über keine Kanzel verfügte. Allerdings fiel ihm auch auf, dass der Rest des bescheidenen Kircheninventars nicht zu diesem kunstvoll geschnitzten Katheder passte … oder umgekehrt.
Ungeachtet der Gedanken seines Bischofs hatte Pater Bernardus, einer der bischöflichen Kuttenträger, hinter dem Stehpult Aufstellung genommen, um mit frisch gespitztem Federkiel alles fein säuberlich mitschreiben zu können. Mit Bruder Bernardus hatte der Bischof seinen besten Schreiber ausgewählt, von dem er wusste, dass er alles akribisch Wort für Wort für die Ewigkeit festhalten würde. Seine Aufschriebe würden zur Lagerung in verschiedenen kirchlichen Bibliotheken vervielfältigt werden und er würde sie zudem auch noch eigenhändig mit kunstvoll gemalten Initialen verzieren.
Alle Kirchenbesucher einte, dass sie möglichst viel von dem mitbekommen wollten, was gleich passieren würde. So waren es denn verzaubernde Augenblicke, die sich nicht zuletzt auch Dank der aus Konstanz mitgebrachten Kerzen tief in die Herzen der Gläubigen gruben. Die blütenweiß gebleichte Leinendecke auf dem Altar, in die von mehreren Frauen die Symbole der Dreifaltigkeit in blutrotem Garn eingestickt worden waren, schien die Leuchtkraft der Kerzen zu verdoppeln. Ansonsten war das zu beiden Seiten des geschnitzten Herrgotts drapierte Tannenreisig der einzige Schmuck. Aber dies machte nichts; solch einen erhebenden Moment der inneren Einkehr hatte es in dem beschaulichen villa Ysinensi noch nie gegeben – dementsprechend glücklich waren die Bewohner an diesem großen Tag für ihre geliebte Heimat und für sich selbst. Und der Prunk städtischer Kirchen oder einer der Kathedralen, wie es sie auch in Konstanz oder im fernen Aachen gab, war den meisten von ihnen sowieso fremd.
*
Ein eigenartig gewandeter Mann, der in einem gewissen Abstand des Geschehens auf einer Anhöhe im Sattel seines Pferdes saß, betrachtete das Schauspiel mit einem Verlangen in den Augen, das die Mordgelüste in seinem Innersten widerspiegelte. Dass die vermummte Gestalt dem Bischof von Konstanz aus sicherer Entfernung hinter dem Planwagen der Gunstgewerblerinnen bis hierhergefolgt war, hatten nicht einmal die weltlichen Wachen des hochrangigen Klerikers bemerkt. Und weil die unheimliche Gestalt bis jetzt nicht gesehen worden war, konnte auch von niemandem bemerkt worden sein, dass sie nichts Gutes im Schilde führte. Weil alle Blicke in Richtung des neuen Gotteshauses gerichtet waren, nahm niemand Notiz davon, dass ihnen der Mann mit gezogenem Schwert eine zornige Verwünschung zurief, bevor er davonritt und im Nichts dieses Wintertages verschwand.
*
Nach dem Schlusssegen der ersten heiligen Messe im neuen Gotteshaus nahm sich der erst vor wenigen Tagen durch den Grafen bestallte neue Mair das Wort. Gerold Eberz war sichtlich stolz darauf, als erste Amtshandlung hier in der neuen Kirche von villa Ysinensi nicht nur zu den Seinen, sondern auch zu den hochrangigsten Leuten im großen Umkreis sprechen zu dürfen. Und dies tat er, ohne sich die innere Unruhe anmerken zu lassen, die ihn auf einen Schlag zu übermannen drohte. Zuerst begrüßte er im Namen der Bevölkerung von villa Ysinensi die Anwesenden, bevor er sich mit etwas zu schmalzig geratenen Worten beim Initiator und Finanzier dieses Kirchenprojektes bedankte.
Nachdem auch der »wohledle« Stifter eine Rede gehalten hatte, die allerdings mehr ein Aufruf an die Bevölkerung von villa Ysinensi gewesen war, auch im tiefsten Winter auf die Gesundheit zu achten, damit »… nach altem Brauch und Herkommen …« im Frühjahr die Arbeit auf den Feldern und an den Webstühlen wieder aufgenommen werden konnte, trat abermals der Bischof vor, um etwas zu sagen:
»Unsere lieben Mitbrüder und -schwestern im Herrn! Trotz der winterlichen Beschwernisse sind Wir im Dezember, der im römischen Kalender der zehnte Monat des Mondkalenders gewesen ist, gerne hierher ins kalte Allgäu und zu euch nach villa Ysinensi gekommen, um eure neue Kirche mitsamt der dazugehörenden Glocke einzuweihen und …«
*
Der liturgische Teil war bereits zuvor beendet und die Kirche den Heiligen Georg und Jakobus dem Älteren geweiht worden. Nach der bewegenden Rede des hochrangigen Kirchenmannes trauten sich jetzt die Menschen, ihren Glücksgefühlen freien Lauf zu lassen und sich beim Bischof und beim Grafen mit einem kräftigen Handgeklappere zu bedanken. In ihrer Begeisterung entwich dem einen oder anderen sogar ein lauter Pfiff, während anderen ein paar Tränen des Glücks herunterliefen.
Der Bischof ließ sie so lange gewähren, bis es ihm zu viel wurde und er wieder das Wort an sich zog: »Nun aber, meine lieben Gläubigen im Herrn, möchten Wir, Bischof Eberhard I. von Konstanz und von Gottes Gnaden, dem gottgefälligen Kirchenstifter für seine Großzügigkeit danken und ihm zum ewigen Zeichen unserer Verbundenheit etwas überreichen, das aus fernen Zeiten aus einem fernen Land den Weg nach Konstanz …« Er räusperte sich, bevor er weitersprach: »… und vermutlich nach vielen Irrwegen zu Uns gefunden hat! Tretet vor, edler Wolfrad Graf von Altshausen, und lasst Euch erklären, was Wir für Euch mitgebracht haben!«