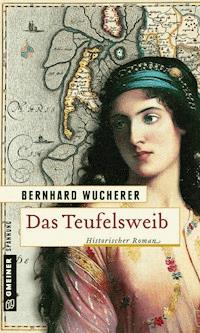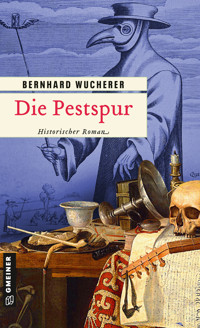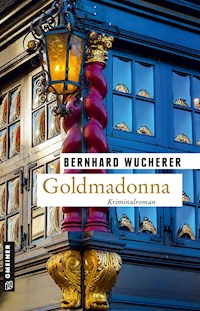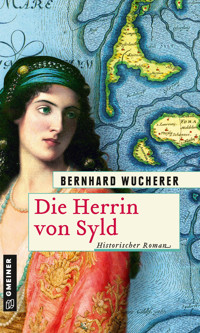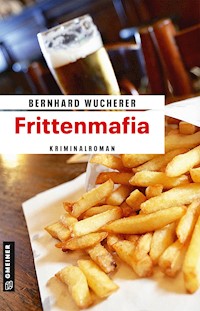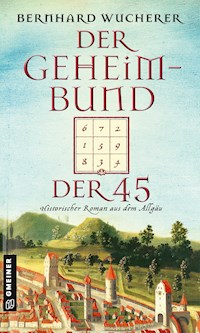Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trilogie um die Kastellansfamilie
- Sprache: Deutsch
Staufen in den Jahren 1649/1650. Nach Ende der Pest und des Dreißigjährigen Krieges möchte Reichsgraf Hugo zu Königsegg den ledigen Burschen eine wertvolle Fahne mitsamt Umzug und Festmahl stiften. Neid und Missgunst breiten sich aus, jeder möchte Fähnrich werden. Schon bald findet man den ersten grausam verstümmelten Leichnam. Und dann verschwindet auch noch eine junge Frau spurlos. Mit dem Tagelöhner Jockel Mühlegg ist schnell ein Schuldiger gefunden. Aber ist er wirklich der gesuchte »Gliedermörder«? Denn es treibt sich noch ein geheimnisvoller Unbekannter herum …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1771
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Wucherer
Die Säulen des Zorns
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edwaert_Collier_-_Vanitas_-_Still_Life_with_Books_and_Manuscripts_and_a_Skull_-_Google_Art_Project.jpg
ISBN 978-3-8392-4446-3
Widmung
Meinem väterlichen Freund und Berater,
dem 2012 verstorbenen und verdienten Chronisten
der »Staufner Fahnensektion«, Benedikt Josef Höss,
und all jenen Menschen gewidmet,
die offenen Herzens alten Bräuchen dienen,
dabei aber stets das Feuer der Tradition bewahren
und nicht deren Asche anbeten.
1649
Vierzehn Jahre nach der verheerenden Pest in Staufen und ein Jahr nach Ende des Dreißigjährigen Krieges
»Die Kirchen beiderley Seiten haben fil Jahr umm die Wett
gerüßtet unnd sindt den Kriegsherrn innichten nachgestanden.
Dabei haben die Pfaffen nicht gemerket daß das Volck ander Sorg
zu tragen hatt unnd jetzt immer noch elendiglich verhungert.«
Benedikt Reisinger, zeitgenössischer Chronist im September des Jahres 1649.
Prolog
1649. In jenem unseligen Jahr, in dem unsere Geschichte beginnt, ist das ganze Land verödet. Die Äcker liegen brach und der Nutztierbestand ist während der letzten Jahrzehnte auf null gesunken. Seit dem drei Jahrzehnte anhaltenden Krieg (von 1618 bis 1648 n. Chr.) liegen viele Höfe und Behausungen der verarmten und ausgeplünderten Bevölkerung in Schutt und Asche. Die Überlebenden der Pest und des Großen Krieges – den man bald auch den Dreißigjährigen nennen wird – leiden unermesslich große Not und befinden sich immer noch im Dauerzustand der Verzweiflung. Die Bevölkerung Europas ist gewaltig dezimiert worden. Während immer noch Abertausende Menschen verhungern, werden andere von zersprengten und marodierenden Söldnern grausam gequält und umgebracht. Es gibt nach wie vor Mädchen und Frauen, die von der verrohten Sodateska geschändet werden. Viele der bedauernswerten Geschöpfe, die dies alles überleben, werden ohne das Zutun der Kriegsauswüchse erschlagen, erstochen, erschossen … und im Allgäuer Marktflecken Staufen sogar systematisch vergiftet (siehe Die Pestspur, Gmeiner Verlag, 2012). So fallen dort im Jahre des Herrn 1634 sage und schreibe 69 Männer, Frauen und Kinder einer unglaublichen Giftmordserie des irregeleiteten Arztes Heinrich Schwartz, der diese einträglichen »Kräutermorde« zusammen mit dem Totengräber Ruland Berging geplant hatte, zum Opfer. Dazu kommen noch »Verwechslungsmorde« an den Blaufärbersöhnen Didrik und Otward Opser sowie mehrere weitere Tötungsverbrechen durch den damaligen Totengräber.
Ein Jahr später schlägt im selben Allgäuer Dorf die Pest wie ein wütendes Totenheer um sich und bringt 706 hilflosen Menschen einen grausamen Tod (siehe Der Peststurm, Gmeiner Verlag, 2013). Dadurch sind von den gut 1.000 Einwohnern Staufens nur noch geschätzte 300 am Leben. Dabei trifft es Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Staufner Bevölkerung braucht viele Jahre, um die damaligen Geschehnisse einigermaßen aufzuarbeiten. Auch Jahre später hat sie immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Vergessen können die bedauernswerten Geschöpfe Gottes diese unmenschlichen Verhältnisse wohl nie. Und da der Krieg erst 1648, also ein Jahr vor Beginn unserer Geschichte, durch den Westfälischen Frieden zu Münster und Osnabrück beendet wird, hat die Bevölkerung Staufens – wie allerorten – kaum Zeit, um sich richtig erholen zu können und die Felder ordentlich zu bestellen. Dies hat zur Folge, dass die Ernteerträge immer noch recht dürftig sind und bei Weitem nicht ausreichen, um die hungrigen Mäuler zu stopfen. Den ausgemergelten Menschen geht es zwar schon etwas besser als während des Krieges, für ein gesichertes Überleben reicht es aber noch längst nicht aus. Diesbezüglich ändert sich ebenso wenig wie an ihrer sowieso schon mehr als bescheidenen Lebensweise und der herrschaftlichen Struktur, der sie nach wie vor auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind.
Bis auf die frei erfundene Giftmordserie und die »Verwechslungsmorde« anno 1634 stimmt der bisher beschriebene historische Hintergrund ebenso wie dies im vorliegenden Roman der Fall ist. Dennoch vermischen sich nun Fiktion und Realität insofern, als die Grundlage dieser Geschichte der sogenannte Staufner Fasnatziestag ist, ein seit dem Historismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts schriftlich nachgewiesener Brauch eigenwilliger Prägung, der laut mündlicher Überlieferung bis auf die Zeit der Pest in Staufen anno 1635 zurückgehen soll, seinen Ursprung vermutlich aber bereits in grauer Vorzeit haben dürfte und allein schon deswegen wesentlich wertvoller ist als in der allgemeinen Wahrnehmung bisher verankert.
Die Überlieferung besagt, dass dieser Brauch 1635 – also noch im grausamen Pestjahr – vom damaligen Regenten, Hugo Reichsgraf zu Königsegg-Rothenfels, begründet wurde. Obwohl es nicht nur während der ersten – die Justinianische Pest (527 bis 565 n. Chr.) nicht berücksichtigt – kontinentalen Pestwelle (von 1347 bis 1352 n. Chr.), sondern insbesondere auch bei der zweiten Pandemie im 17. Jahrhundert europaweit zu »Pestgelübden« kam, kann dies aber – bei allem Wohlwollen – in diesem Jahr nicht gewesen sein, weil der hochreputierte Landesherr zu jener Zeit nachweislich selbst vor der Pest und dem Krieg geflohen war. Er hatte sich hinter die schützenden Mauern der Bodenseestadt Konstanz, in der sein Bruder Berthold Domscholaster und -schatzmeister war, geflüchtet, wo er sich mit seiner Gemahlin Maria Renata von Hohenzollern-Sigmaringen, ihren Kindern und einem Teil des Hofstaates im dortigen Verbrunnen-Hof in der heutigen Wessenbergstraße verschanzte, um nicht von der in der Residenzstadt Immenstadt und in anderen Orten des Allgäus wütenden Seuche gepackt oder von den Auswirkungen des Krieges erwischt zu werden.
Außerdem: »Von May bis Sanct Nicolaustag …« des Jahres 1635 soll die Pest gewütet haben, berichtet eine zeitgenössische Niederschrift des real existierenden Propstes Johannes Glatt, der das Pfarrmatrikel ganz besonders akribisch führte und zudem ein spezielles »Repertorium« (Anmerkung des Autors: eine merkwürdige Bezeichnung für profane Aufzeichnungen) verfasste. Darin stehen zwar die Pest oder das Verbot des Tabakverkaufs durch kirchlichen Einfluss beschrieben, und sogar Kleinigkeiten wie beispielsweise der Anbau eines »Heymlich Gemach« (Aborterker) an der Südseite des Schlosses Staufen werden genannt, über eine »Fahnenstiftung« im Jahr 1635 konnte der Autor aber beim besten Willen nichts finden, obwohl ihm dieses »Repertorium« ein ganzes Jahr im Original zur Verfügung gestanden hatte.
Außerdem bedeutet diese genaue zeitliche Einordnung der Pest in Staufen, dass das eine Drittel der überlebenden Bevölkerung Staufens (ca. 300 Personen) nach dem verbrieften Abklingen der Pest am 6. Dezember des Jahres 1635 gerade mal 25 Tage Zeit hatte, sich moralisch so aufzurichten, um ausgerechnet am letzten Tag der Fasnacht desselben Jahres ein Fest zu feiern und einen Umzug durch die Straßen des Marktes zu organisieren – ein Unding: denn wenn Fasnacht, dann wohl frühestens im Jahr darauf, also 1636!
Und der nachgewiesenermaßen nicht vor Ort weilende Regent hätte für die Herstellung einer Fahne – egal ob in einem Kloster gestickt oder von Künstlerhand gemalt – bis zum Ende des Jahres 1635 ebenfalls nur 25 Tage zur Verfügung gehabt. Wenn man zudem bedenkt, dass die Bevölkerung Staufens sicherlich nicht gleich am 6. Dezember gewusst hatte, dass sie justament die letzte Pestleiche zum Pestfriedhof nach Weissach brachten und eine ganze Zeit lang unsicher war, ob die Pest nun tatsächlich abgeebbt war oder möglicherweise doch wieder aufflackerte, kann dies 1635 einfach nicht gewesen sein … zudem zum Jahresende auch noch das Christfest anstand und »so ganz nebenbei« der Dreißigjährige Krieg in all seinen schrecklichen Facetten tobte.
Bei wohlwollendster Betrachtung konnte es also frühestens nach dem totalen Abklingen der Pest im damals rothenfelsischen Herrschaftsgebiet, insbesondere aber nach Beendigung des Großen Krieges und nach der sicherlich auch damit zusammenhängenden Rückkehr des Regenten gewesen sein, dass die Gräfliche Fahnenstiftung in der Form, wie der Gedenktag heute begangen wird, ins Leben gerufen wurde. Also belasse ich die Entstehung beim historisch verbrieften Pestjahr 1635, lege allerdings die erste Umsetzung des Staufner Fasnatziestages, wie dieser wunderschöne alte Brauch bezeichnet wird, in diesem Roman in die Jahre 1649/50. Ich denke, dass ich damit den gegenüber der historischen Wahrheit aufgeschlossenen Oberstaufener Brauchtumsfreunden entgegenkomme und wohlwollend eingestellte Brauchtumsforscher damit leben können.
Noch ein kleiner Tipp
Dieser in sich geschlossene Roman kann ohne Informationsverlust genossen werden, auch wenn die hochgeschätzte Leserschaft die beiden Vorgängerromane Die Pestspur (Gmeiner Verlag, 2012) und Der Peststurm (Gmeiner Verlag, 2013) nicht gelesen hat. Korrekterweise soll dennoch nicht verschwiegen werden, dass das Lesen des vorliegenden Romans evtl. noch mehr Freude bereiten könnte, wenn man die beiden zuvor genannten Romane kennt.
Obwohl sich im vorliegenden historischen Kriminalroman Die Säulen des Zorns etliche Personen der Handlung aus den beiden o. g. Romanen wiederfinden und die Locations größtenteils dieselben sind, liefern die dort noch dominierende Pestilenz und der Dreißigjährige Krieg lediglich die Grundlage für die jetzige Handlung, die kontinentalweit angesiedelt sein könnte – mehr nicht! Die Handlung im vorliegenden Roman ist mit ganz anderer – noch heißerer – Nadel gestrickt. Außerdem spielt der Plot 14 bis 16 Jahre später, – also weit nach der europaweit langsam erlöschenden Pest und auch nach dem unseligen Glaubenskrieg, der nach langjährigen und zähen Verhandlungen zwischen den Ständen, dem Militär und der Geistlichkeit beider Lager 1648 in Münster und in Osnabrück sein spätes, aber glückliches Ende genommen hatte.
Sollten Sie eine Erläuterung, einen Begriff oder ein Zitat nicht verstehen, finden Sie diese sicherlich ebenso bei den Erklärungen wie die Übersetzung lateinischer Phrasen oder Dialektworte.
Um den Lesefluss nicht zu stören, habe ich diese innerhalb des Romans nicht gesondert gekennzeichnet. Somit kann die verehrte Leserschaft selbst entscheiden, ob und was sie nachschlagen möchte.
In Kursiv habe ich lediglich alte, meist originale Redewendungen, Zitate usw. gehalten.
Nun aber wünsche ich Ihnen spannende Unterhaltung.
Ihr Bernhard Wucherer
Kapitel 1
Wie allen anderen Gaffern, die aus weiten Teilen des Allgäus und von jenseits der Iller, sogar vom Bodensee herauf, aus dem Vorarlbergischen und aus dem Oberschwäbischen ins rothenfelsische Immenstadt gekommen waren, sollte auch den Staufnern ein unvergessliches Ereignis in der 17 Meilen entfernten Residenzstadt geboten werden. Einige von ihnen hätte es auch ohne das außerordentliche Erlebnis in die kleine Handelsmetropole gezogen, weil sie sich schon vor längerer Zeit zur dortigen Leinwandschau angemeldet hatten. Andere waren aus reinem Zufall ausgerechnet an diesem Tag ins »Städtle« kutschiert, während neun Staufner extra deswegen gekommen waren, weil sie denjenigen, um den es gegangen war, von früher her gekannt hatten. Unter den Männern hatten sich auch ein paar junge Burschen befunden, die vom Staufner Ortsvorsteher Hermann Schädler mitgeschickt worden waren, um stellvertretend für die gesamte Burschenschaft des Dorfes mit anzusehen, was geschah, wenn die Gesetze ihres hochwohllöblichen Regenten, des Reichsgrafen Hugo zu Königsegg-Rothenfels, sträflich missachtet wurden. Und weiß Gott: Sie hatten etwas zu sehen bekommen; ein Spectaculum höchster Güte. Dabei war es um einen ehemaligen Staufner Landsmann gegangen, den die Burschen zwar nicht persönlich gekannt hatten, der aber nach unzähligen kleineren Vergehen in jungen Jahren in den oberen Teil des Allgäus abgehauen war und dort – vorwiegend in Sonthofen und auf dem Joch, später aber auch im tirolerischen Reutte und zeitweise sogar im fernen Innsbruck – lange Zeit unbemerkt ein Leben jenseits der reichsgräflichen und anderer Gesetze gelebt hatte. Für seinen gefährlichen Berufsstand hatte er ein bemerkenswert langes Leben geführt – allerdings nur so lange, bis man ihn nach einem Raubmord in Oberstdorf gefangen genommen und in rothenfelsisches Rechtsgebiet überstellt hatte. Dort war er im Alter von 49 Jahren dem Tode geweiht worden.
»Aufgrund der Schwere des Verbrechens und der brutalen Vorgehensweise wird Wolfgang Bertele zum Tode mittels vierer Pferde verurteilt«, hatte der in kürzester Zeit berüchtigt und gefürchtet gewordene Stadt- und Landrichter Michael Waldvogel, der dem gnadenlosen Richter Hannß Zwick aus Altersgründen im Amte gefolgt war und dessen raue Methoden er übernommen, ja sogar »verfeinert« hatte, nach einer tagelangen Peinlichen Befragung und einem für den grölenden Pöbel ausgiebig zelebrierten Prozess verkündet, bevor das eigentliche Spektakel losgegangen war und der Nachrichter Sebastian Deibler seines Amtes gewaltet hatte. Für den Carnifex, wie man den Henker speziell im rothenfelsischen Gebiet nannte, war es die allererste Vierteilung gewesen, die keinesfalls hätte misslingen dürfen. Genau genommen war sie aber zumindest missraten, obwohl das »Endergebnis« erreicht worden war. Da die Pferde ungleichmäßig angezogen hatten, war der Körper des Delinquenten trotz des »Blutkreuzes«, das ihm der Carnifex bis zur Offenlegung der Innereien bei lebendigem Leibe in den Oberkörper geschnitten hatte, nicht ordentlich in vier Teile gerissen worden. Stattdessen waren die Gliedmaßen einzeln und auch noch nacheinander vom Korpus getrennt worden, was normalerweise eine harte Strafe für den Verursacher dieses Murkses bedeutet hätte. Da es aber nach weit über zehnjähriger Abstinenz die erste Vierteilung in der gräflichen Residenzstadt Immenstadt gewesen war, weil sich zwischenzeitlich das schnellere Aufknüpfen und das noch leichter zu handhabende Köpfen bewährt hatten, war der ansonsten als absolut kompromisslos bekannte Richter Waldvogel ungewöhnlich gnädig gewesen. Nicht zuletzt auch, weil sich die diesbezüglich nicht mehr allzu verwöhnten Untertanen des Grafen trotz der misslungenen Vierteilung mehr als einverstanden gezeigt hatten.
Sebastian Deibler hatte das Glück gehabt, dass der mehr als gestrenge und äußerst penible Richter aufgrund der in allen anderen Bereichen – zu denen auch Gaukler, Musikanten und Fieranten gehörten – dieser ansonsten rundum gelungenen Veranstaltung zufrieden und deswegen gut aufgelegt gewesen war, weswegen er Verständnis für die allererste Vierteilung seines neuen Vollstreckers gezeigt und die Hinrichtung kurzum als gelungen erklärt hatte. Dass sich dabei gerade die älteren Gerichtsbeisitzer und die Ratsherren gegenseitig verwundert angesehen hatten, war ihm bei der öffentlichen Verkündung seiner persönlichen Meinung egal gewesen; Hauptsache, sie hatten seine unumstößliche Entscheidung schweigend zur Kenntnis genommen und das Schriftstück, das ihnen der ehedem aus Flandern stammende Gerichtsschreiber Ekkehard van der Heye vorgelegt hatte, ohne längere Diskussionen unterzeichnet. Diese senilen Säcke werden die nächste Vierteilung wohl noch erwarten können …, aber dazu muss nicht ausgerechnet mein neuer Carnifex ad persona herhalten, hatte er in sich hineingedacht und dabei ins Kalkül gezogen, dass in diesen rauen Zeiten gute Vollstrecker seiner Urteile rar waren und er trotz der seit Beginn des Dreißigjährigen Krieges andauernden »Henkersschwemme« wohl nicht so schnell einen gleichwertigen Ersatz bekommen würde. Ungeachtet dessen hatte er sich aber selbst schon darauf gefreut, den nächsten Schwerverbrecher zwischen vier Pferden liegen zu sehen und die erhitzten Gemüter der Bürger, Handwerker und Bauern zum Grölen zu bringen. »Es muss ja nicht unbedingt wieder ein Staufner sein«, hatte er versehentlich gut vernehmbar vor sich hingemurmelt und dabei hämisch gegrinst.
»Was?«, hatte der zu seiner Linken sitzende Beisitzer wissen wollen, der dies nicht verstanden hatte, weil er sowieso schlecht hörte.
»Ach, nichts!«
Als die Staufner nach der Hinrichtung mit einem unguten Gefühl im Bauch, aber auch nachdenklich geworden, auf einem alten Ladewagen gesessen hatten und aus dem »Städtle«, wie Immenstadt von den Allgäuern verniedlichend genannt wurde, obwohl es schon vor fast 300 Jahren mitsamt den dazugehörenden Rechten und Pflichten durch Kaiser Karl IV. zur Stadt erhoben und von den Montforter Grafen zur Residenzstadt ihres hiesigen Herrschaftsgebietes auserkoren worden war, kutschiert waren, um möglichst schnell nach Staufen zurückzukommen, hatten sie von diesen Überlegungen natürlich nichts gewusst.
Kapitel 2
Tags darauf war Sebastian Deiblers zumindest teilweise missratene Hinrichtung das Dorfgespräch in Staufen, dem Geburtsort Wolfgang Benteles, des aktuellsten Opfers rothenfelsischer Rechtsprechung. Diejenigen, die der mit allen Schikanen zelebrierten Vierteilung beigewohnt hatten, mussten den Daheimgebliebenen haarklein von ihrem Erlebnis im Städtle berichten. Insbesondere die Älteren, die den Raubmörder vor dessen gesetzeswidrigen Taten persönlich gekannt hatten, interessierten sich dafür.
»Und? Hat er geschrien?«, wollte ein betagter Mann gar wissen, bei dem Bentele dereinst gearbeitet hatte. »Wolfgang ist schon als Lernbursche eine verdorbene Kröte gewesen und hat meine ganze Schreinerei durcheinandergebracht«, bemerkte er noch in Erinnerung an so manchen Schabernack, den sein damaliger Schutzbefohlener sich erlaubt hatte.
»Nein! Er hat keinen Laut von sich gegeben. Er war unglaublich tapfer …, gerade so, als wenn er überhaupt nichts mitbekommen hätte«, bemerkte Siegfried, Sohn des Kronenwirtes Matheiß, fast etwas anerkennend.
»Im Städtle hat man gemunkelt, dass der neue Carnifex dem Bentele einen schmerzlindernden Trunk verabreicht haben soll, bevor er ans Aufschlitzen des Brustkorbes gegangen ist«, wusste ausgerechnet einer, der in der hintersten Reihe gestanden war und vom Geschehen auf dem Immenstädter Marktplatz fast nichts mitbekommen hatte.
»So eine Narretei! Warum sollte dies ausgerechnet derjenige tun, der sein Opfer zuvor schon gefoltert und danach gevierteilt hat?«, lachte ihn der junge Bertel Göhlin aus, dem es gelungen war, einen guten Platz in den vorderen Reihen zu ergattern.
»Josef hat recht!«, rief ein anderer dazwischen und bestätigte, dass der Delinquent beim Vierteilen nicht mehr geschrien habe, »… aber nicht weil er irgendeinen Trank bekommen hat, sondern weil er wegen der unerträglichen Schmerzen wahrscheinlich besinnungslos geworden ist, nachdem ihm der Carnifex die Brust aufgeschlitzt hat.«
»Aber beim Aufschlitzen hat er geschrien wie die Sau am Spieß!«, wusste ein Methusalem, der im Großen Krieg sogar in der extrem grausamen Schlacht von Nördlingen gedient hatte und deswegen in seinem Empfinden und in seiner Ausdrucksweise verroht war, zu berichten.
»Und Baltus Vögel hat ebenfalls wie eine abgestochene Sau herumgeschrien«, lästerte ein anderer Veteran und lenkte damit ungewollt vom Delinquenten ab und zu einem eigentlich uninteressanten Burschen hin.
»Warum das denn?«, interessierte eine Frau, die Baltus Vögel, dem allein lebenden Sohn des ehemaligen Dorfschmiedes, zwischendurch eine Suppe vorbeibrachte, damit auch er eine warme Mahlzeit hatte. Sie bekam aber nur achselzuckend zur Antwort, dass dies niemand wisse.
»An was mag es wohl gelegen haben, dass diese Hinrichtung Baltus ganz besonders mitgenommen hat?«, mischte sich jetzt der Staufner Pfarrherr, Propst Johannes Glatt, mit süffisantem Tonfall ein. Der inzwischen Dazugekommene regte mit dieser Frage die anderen zum Nachdenken an.
Man hörte ein Klatschen. Der Säckler Joram Kimpfler hatte sich auf die Stirn gehauen, bevor er sagte: »Na klar! Der Pfarrer hat recht: Vor knapp 15 Jahren, … ich glaube, es war im Frühjahr 1636, hat man Baltus’ Vater ebenfalls gevierteilt und den Knaben dabei zusehen lassen. Dem alten Vögel ist es seinerzeit gelungen, sein Verbrechen lange zu vertuschen. Er ist zwar im Südturm des Schlosses festgesetzt worden, aus Mangel an Beweisen hat man ihn aber wieder freilassen müssen. Aber irgendwann ist ihm Lodewig, der Sohn des Kastellans, der damals selbst in Verdacht geraten war, ein Frauenschänder und Mörder zu sein, auf die Schliche gekommen und hat ihn überführt.«
»Sicherlich hat Baltus dies alles immer noch nicht verarbeitet und es sitzt heute noch in dem bedauernswerten Burschen«, mutmaßte der inzwischen ebenfalls eingetroffene Medicus.
»Ja!«, bestätigte eine betagte Frau, die sich auch noch gut daran erinnern konnte, und ergänzte: »Wahrscheinlich hat der gemeine Weiberschänder und feige Mordbube Babtist Vögel damals aus Angst vor dem eigenen Tod geschrien?« Nachdem sie dies gesagt hatte, spuckte sie angewidert aus.
»Aber Wolfgang Bentele hat gestern keinen Laut von sich gegeben. Als die Pferde angezogen haben und seine Glieder vom Körper getrennt wurden, hat nur Baltus zu schreien begonnen. Man hat ihn kaum beruhigen können.«
»Das stimmt!«, bestätigte einer, der ebenfalls dabei gewesen war. »Mit Gewalt haben wir ihn vom Ort des Geschehens weg- und zum Fuhrwerk hingezerrt. Aber Baltus hat sich losgerissen und ist abgehauen. Er wollte unbedingt bei der Hinrichtungsstätte bleiben und ums Verrecken nicht mit nach Hause zurück.«
»Und da habt ihr den armen Burschen einfach im Städtle gelassen? Allein weiß sich der Narr doch nicht zu helfen! … Wo ist er jetzt überhaupt?«, empörte sich einer und sorgte mit seiner Frage dafür, dass sich alle intuitiv umdrehten, um nach Baltus Ausschau zu halten.
»Na, wo wohl?«, antwortete Bertel Schwabacher, einer der klügeren Burschen. »Der arme Kerl wird immer noch zu Fuß auf dem Weg vom Städtle nach Staufen sein!«
»Das hat noch niemanden umgebracht«, krächzte eine zahnlose alte Vettel und schwang dabei beinahe triumphierend ihren Krückstock.
»Na ja …«, stieg der junge Dorfmedicus, der sich aus fachlicher Sicht etwas genauer über die gestrigen Begebenheiten in Immenstadt erkundigen wollte, zaghaft in den Disput ein. »Baltus Vögel ist körperlich zwar ein Mann geworden, im Geiste aber ein Kind geblieben. Dementsprechend wird er sich auch wie ein Kind erschrocken … und verhalten haben! Allein schon aufgrund der damaligen Hinrichtung seines Vaters hätte ihn Hermann Schädler gestern überhaupt nicht mit nach Immenstadt schicken dürfen. Aber wahrscheinlich hat er sich keine Gedanken darüber gemacht … oder die damaligen Begebenheiten inzwischen vergessen«, nahm er den allseits beliebten Ortsvorsteher gleich wieder in Schutz.
»Nein!«, meldete sich ein Altersgenosse von Baltus. »Das ist nicht wahr. Hermann Schädler wollte ihn ursprünglich auch nicht mitlassen. Aber Baltus hat selbst darauf bestanden. Ich habe nämlich mitbekommen, wie er sich so lange wüst aufgeführt hat, bis der Ortsvorsteher ihm in Gottes Namen die Mitfahrt gestattet hat.«
»Dann ist es ja gut«, kommentierte der Medicus das Gehörte zufrieden.
Da aber nicht das merkwürdige Verhalten des 26 Jahre alten Dorfnarren das Wichtigste gewesen war, unterhielten sich die Leute noch ein ganzes Weilchen über die Hinrichtung selbst … und dies in allen Details. Darüber, und nicht über das Geschrei eines im Geiste schwachen Burschen, der sowieso nirgends gelitten war, wollten diejenigen, die nicht dabei waren, vom Verlauf des gestrigen Tages erfahren. Und so mussten die Dabeigewesenen auch alles über die Komödianten, das, was die Händler in ihren Bauchläden angeboten hatten, die vielen Menschen und die ganze Atmosphäre erzählen.
»Was? Der Graf war nicht persönlich anwesend, … obwohl er doch gerade hier im Allgäu weilt?«, konnte einer nicht glauben.
Erst nach einer guten Stunde war es wieder ruhig in den Gassen. Obwohl das Thema alle interessierte, hatten sich die Grüppchen so schnell aufgelöst, wie sie sich gebildet hatten. Diejenigen, die gehört hatten, was sie wissen wollten, hatten es plötzlich eilig gehabt, wieder nach Hause zu kommen, um die Neuigkeiten brühwarm ihren daheimgebliebenen Familienmitgliedern erzählen zu können. Und da außerdem der Winter ins Haus stand, mussten dringend letzte Vorkehrungen getroffen werden: Die zugigen Ritzen in den Außenwänden warteten ebenso darauf, abgedichtet zu werden, wie die Dächer, deren beschädigte oder fehlende Landern ersetzt werden mussten.
*
Wer gerade an seiner Behausung herumwerkelte, um sie winterfest zu machen, erschrak oder wunderte sich zumindest, während diejenigen, die sich auf der direkt zum Schloss Staufen führenden Straße befanden, keine Zeit hatten, sich Gedanken zu machen, weil sie damit beschäftigt waren, auf die Seite zu springen, um nicht überrannt zu werden. Der Reiter, der in wildem Galopp an ihnen vorbeistürmte, schien es brandeilig zu haben. Jedenfalls preschte er so ungestüm den Schlossbuckel hoch, dass ihn der Wachhabende Siegbert erst sah, als er schon kurz vor dem Tor war. Dadurch kam Siegbert nicht mehr dazu, ins Horn zu blasen. Sicherheitshalber holte er schnell seine Hellebarde, die er – wie immer, wenn es ruhig war – an einen Mauerfries gelehnt hatte, setzte die aus Eisenblech getriebene, mit Lammfell gepolsterte Schützenhaube auf und zupfte sich hastig das Lederwams zurecht. Aber er brauchte sich nicht auf Unannehmlichkeiten einzurichten. Als erfahrene Schlosswache konnte er beruhigt feststellen, dass von dem Reiter keinerlei Gefahr ausging.
Während Siegbert an der rot-gelben Uniform des Berittenen erkannte, dass es sich um einen Immenstädter Soldaten handelte, kamen schon sein Wachkamerad Rudolph und der Stallknecht Ignaz angerannt, um ihm bei Bedarf zu helfen, das Schloss zu sichern und nötigenfalls zu verteidigen. Da Siegbert sich noch gut und genau an denjenigen Boten erinnern konnte, der vor 14 Jahren die Kunde ins Schloss gebracht hatte, dass ein vom Grafen zuvor ausgesprochenes Marktverbot aufgehoben und der damalige Ortsmedicus, der seinerzeit fast 70 Menschen auf sein Gewissen geladen hatte, aufgehängt werden sollte, winkte er den beiden ab. »Lasst es gut sein. Es ist nur ein Kurier des gräflichen Oberamtes … Ich kenne ihn persönlich«, rief er ihnen, während er betont locker die Holztreppe von der Wehrmauer herunterstieg, zu.
»Gott zum Gruße, Kamerad. Weswegen bist du bei dieser Kälte von Immenstadt hierhergeritten? Ich hoffe, dass du auch heute solch gute Kunde bringst wie vor 14 Jahren … Oder hat dein Besuch etwas mit der gestrigen Hinrichtung in eurem schönen Städtle zu tun?«, wollte der groß gewachsene Wachhabende vom verschwitzten und erschöpft wirkenden Soldaten wissen, nachdem er ihm das Tor geöffnet hatte.
»Das weißt du noch?« Der gräfliche Kurier schüttelte ungläubig den Kopf. »Kaum zu glauben. Da ich damals kurz nach meinem Botenauftrag in den Innendienst versetzt worden bin, war ich seither nicht mehr außerhalb der Stadtmauer, geschweige denn in der Herrschaft Staufen. Dass ich heute wieder einmal den Boten spiele, ist eine Ausnahme, weil die meisten anderen die Scheißerei haben und kaum einer dazu in der Lage ist zu reiten. Die wenigen, die es nicht erwischt hat, müssen an den Stadttoren und auf der Ringmauer oder vor öffentlichen Gebäuden Dienst schieben«, zeigte sich der untersetzte Mann über das Gedächtnis seines Staufner Kameraden gleichsam überrascht und erfreut.
»Wenigstens kommen dadurch deren Pferde nicht zu Schaden. Ein Schimmel mit braunen Streifen auf den Hinterbacken und auf der Kruppe würde wohl komisch aussehen«, grinste Siegbert.
Während Ignaz dem Boten die Zügel abnahm, stützte sich dieser auf seine Knie, um zu verschnaufen.
»Ich habe in der Tat eine wichtige Botschaft für den Schlossverwalter des Grafen … Aber die hat nichts mit der gestrigen Hinrichtung zu tun«, brachte er hastig schnaufend heraus und zeigte auf eine der Satteltaschen, aus der er – nachdem er sich etwas erholt hatte – ein versiegeltes Sendschreiben herauskramte.
»Rudolph, bring dies zum Kastellan!«, rief Siegbert seinem kleineren und in den letzten Jahren recht feist gewordenen, nicht immer ganz zuverlässigen Wachkameraden zu, der mürrisch dreinschaute, weil er in seiner wachfreien Zeit aus der wohlverdienten Ruhe gerissen und von seiner Schnapskanne getrennt worden war.
»Nun geh schon! Du weißt, dass ich meinen Posten nicht verlassen darf«, drängte der stets auf die korrekte Einhaltung der Dienstvorschriften bedachte Siegbert, auf den man sich – im Gegensatz zu seinem etwas liederlichen Kameraden – in jeder Situation verlassen konnte, ungeduldig.
*
Nachdem Lodewig Dreyling von Wagrain, der Verwalter des Schlosses Staufen, den Brief in Empfang genommen und angeordnet hatte, dem Boten etwas Dünnbier zu bringen und dessen dampfendes Ross mit Stroh abzureiben, bevor es ebenfalls zu saufen und zudem Heu bekam, setzte er sich an den Küchentisch und las seinem Vater Hannß Ulrich, der sich gerade genüsslich ein Pfeifchen stopfte, das von Oberamtmann Conrad Speen verfasste Sendschreiben vor.
»Na endlich!«, kommentierte der junge Kastellan den Inhalt des Briefes zwar knapp, zeigte sich aber erfreut darüber.
»Warum freust du dich so, Vater?«, fragte sein Sohn Aurelius, den alle nur kurz und bündig Aurel nannten, der soeben mit seiner Mutter Sarah vom Feuerholzholen zurückgekommen war.
»Weil mir gerade mitgeteilt wird, dass unser hochwohllöblicher Regent endlich wieder in seinem Allgäuer Reich weilt und gedenkt, eine längere Zeit hierzubleiben«, verkündete der Kastellan so stolz, als wenn er selbst etwas dazu beigetragen hätte.
»Was meinst du? Wird er jetzt sein altes Versprechen einlösen?«, wollte sein 14-jähriger Sohn als Erstes wissen.
»Aber Aurel, das geht dich nichts an! Dafür bist du nun doch noch zu jung. Außerdem hat der Graf in der nächsten Zeit sicherlich anderes zu tun, als sich eines alten Gelöbnisses zu erinnern«, griff Sarah, seine kluge Mutter, ein.
»Du hast wie immer weise gesprochen, meine teure Gemahlin. Aber jetzt sei so lieb und bereite uns das Abendbrot.«
»Gerne, mein über alles erhabener Gebieter«, gab sie mit einem zärtlichen Lächeln, aber ebenfalls lästernd, zurück.
Als er sie an sich drückte, bekam der gräfliche Verwalter des Schlosses Staufen einen zarten Kuss auf die Wange. Dabei lächelte dessen Vater, der sich nur allzu gerne an die seltenen Küsschen seiner geliebten Konstanze erinnerte. Obwohl mein holdes Weib etwas kühl war und stets kränkelte, war ihr, genau wie meiner Schwiegertochter Sarah, keine Arbeit zu viel. Wenn sie vor sieben Jahren nicht an der Schwindsucht gestorben wäre, würden wir heute noch glücklich sein. Er seufzte kurz auf und nuckelte an seiner alten Tonpfeife, die ursprünglich einmal weiß gewesen war, mittlerweile farblich aber eher abgestandener Milch glich.
Wenigstens musste sie es nicht mitbekommen, als mir vor vier Jahren ein Baum die Füße zerschmettert hat und dass ich seither ein hilfloser Krüppel bin, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Stattdessen freut sie sich jetzt vielleicht da oben, dass es unserem Sohn Lodewig trotz der vielen andern Interessenten gelungen ist, mein Amt als hiesiger Schlossverwalter übernehmen zu können, sinnierte der ehemalige Schlosskastellan, dessen Lebensinhalt seit seinem Unfall war, Lodewig erwünschte Ratschläge zu erteilen und auf seine vier Enkel zu achten, weiter. Hannß Ulrich Dreyling von Wagrain, den man seit der Amtsübergabe an seinen Sohn allgemein als »Altkastellan« bezeichnete, wusste, dass ihn seine Familie niemals im Stich lassen würde und er hier mehr bekam als nur das Gnadenbrot. Seine Familie gab ihm stets das Gefühl, trotz seines Alters und seiner Behinderung gebraucht zu werden. Obwohl es den ehemals starken und aktiven Mann manchmal schmerzte, wenn er an seine geliebte Arbeit in den Diensten des Grafen dachte, wusste er, dass es ihm eigentlich ganz gut ging.
*
»Ja, ich werde wirklich gebraucht. Gerade meine jüngste Enkelin, die kleine Magdalena, weicht nicht von meiner Seite, insbesondere dann nicht, wenn ich ihr Geschichten aus Zeiten Kaiser Karls des Großen im fernen Aachen erzähle«, murmelte er trotz allem, was ihm im Laufe der vergangenen Jahre widerfahren war, irgendwie zufrieden vor sich hin. Immer wenn Hannß Ulrich Dreyling von Wagrain seinen Enkelkindern die Emmasage auftischte, musste er wehmütig an seinen jüngsten Sohn Diederich, dem er diese Mär gewiss hundertmal erzählt haben musste, denken. Wenn Diederich Anfang 1635 nicht durch die Hand des damaligen Totengräbers Ruland Berging zu Tode gekommen wäre, könnte er heute 23 Jahre alt und sicherlich ein schneidiger Bursche sein. Aber Diederich und sein Bruder Lodewig hatten seinerzeit ungewollt ein folgenschweres Gespräch zwischen dem Totengräber und dem Medicus Heinrich Schwartz mitgehört, weswegen beide in die Fänge einer der beiden Mordgesellen geraten waren. Dieser Mann war zuvor in Immenstadt so lange als Archivar geduldet worden, bis er eines Tages den Bogen überspannt und so großen Mist gebaut hatte, dass ihm nur noch die Flucht mit einem gestohlenen Pferd geblieben war, wenn er nicht mindestens eine seiner Hände im rechts neben dem Immenstädter Schloss stehenden Weidekorb, der direkt vor dem Hackstock des Carnifex gestanden war, hatte lassen wollen. Um fliehen zu können, hatte er sich das vor dem Goldenen Adler angebundene Pferd eines spanischen Augenlinsenhändlers unter den Nagel gerissen. Dieser dreiste Diebstahl hätte ihm mit Sicherheit eine höhere Strafe eingebracht, als nur eine seiner Hände im Körbchen zu lassen. Für den Fall, dass geköpft werden musste, hatten die Büttel des Grafen stets einen größeren Korb parat gehabt. Dadurch hatte verhindert werden sollen, dass der abgeschlagene Kopf – anstatt in den Korb – über das Pflaster rollte. Da dies ein böses Omen gewesen wäre, hätte für eine solch misslungene Hinrichtung der Murkser selbst bestraft werden müssen. Da der damalige Carnifex Hermann Leimer aber trotz seiner Sauferei ein ordentlicher Nachrichter gewesen und der Flüchtige sowieso nicht erwischt worden war, hatte dies nicht zur Debatte gestanden. Ungehindert war der Pferdedieb dorthin geritten, wohin er gewollt hatte. Und da er aufgrund seiner Arbeit im oberen Allgäu nur allzu bekannt gewesen war, hatte er dem entwendeten Gaul die Sporen in Richtung Westen gegeben. So war er schließlich in Staufen gelandet, wo er aufgrund seiner feinen Gewandung, des auffälligen Schimmels – es war ein Andalusier, also ein wertvolles spanisches Pferd, gewesen – und des messingbeschlagenen Zaumzeuges mitsamt dem brandgemusterten Sattel auf Anhieb Eindruck geschunden hatte. Es war ihm schnell bewusst geworden, dass ihn in Staufen niemand erkannt hatte und die einfältigen Bauern und Handwerker ehrfürchtig zu ihm hochgeschaut hatten. Die Gefahr, erkannt zu werden, hätte allenfalls durch den damaligen Schlossverwalter Hannß Ulrich Dreyling von Wagrain gedroht. Immerhin hatte der damalige Kastellan hin und wieder in der gräflichen Kanzlei mit Ruland Berging zu tun gehabt. Allerdings war dies zuvor schon längere Zeit nicht mehr der Fall gewesen. Um dennoch sicherzugehen und jegliches Risiko auszuschließen, hatte sich der ehemalige Archivar, der zwar ein durchtriebener Zeitgenosse, aber ein Meister im Lesen und Schreiben alter Handschriften gewesen war, einen Bart wachsen lassen und sich einen neuen Namen zugelegt. In Anlehnung daran, dass er im jenseits des Weißachbaches gelegenen Bergdorf Steibis geboren worden war, hatte er sich fortan Berging, Ruland Berging, genannt – sicher nicht sehr einfallsreich; aber dieser Name hatte ihm gefallen, weil er von seiner Herkunft abgeleitet war und auf seine damalige Situation hingewiesen hatte.
Der Ruhelose, oder besser gesagt, der Ruchlose vom Berg! Ja, das bin ich jetzt wirklich, hatte er sich – wohlwissend, dass er fortan ein nicht mehr zu bekehrender Gesetzesbrecher sein wollte, den man wohl den Rest seines Lebens gnadenlos jagen würde, wenn er entdeckt und enttarnt werden sollte, gedacht. Um den Zeitpunkt, an dem dies geschehen würde, möglichst weit hinauszuschieben, hatte er sich seiner Meinung nach bestens in die neue Rolle eingelebt. Jedenfalls hatte ihm die bisherige Tarnung so weit genützt, dass er dem damaligen Ortsvorsteher Hans Heimbhofer im Amte hatte folgen können, nachdem er diesem mit einem Stein von hinten den Schädel eingeschlagen und ihn in den Seelesgraben, einen am nördlichen Ortsrand Staufens vorbeilaufenden Bach, geworfen hatte. Da Ruland Berging allerdings auch dieses Amt missbraucht hatte, war er von Lodewigs Vater, der damals nicht nur gräflicher Schlossverwalter, sondern auch noch interimistischer Ortsvorsteher gewesen war, abgesetzt worden. Aber der solchermaßen Gedemütigte hatte das Glück gehabt, dass just zu dieser Zeit die Stelle des Totengräbers vakant geworden war, weswegen ihm der Kastellan unter Absprache mit dem Staufner Pfarrherrn Johannes Glatt diese minderbezahlte Stelle übertragen hatte.
Sicherlich keine feste Sprosse in meiner beruflichen Erfolgsleiter. Aber ich werde einen Weg finden, um Geld daraus zu machen, hatte er sich damals geschworen und tatsächlich auch dieses Amt für seine Zwecke ausgenützt, indem er sich mit dem versoffenen Medicus Heinrich Schwartz zusammengetan und einen perfiden Plan dahingehend ausgeheckt hatte, wie sie aus einer durch sie künstlich provozierten Pestepidemie Profit schlagen konnten.
Da aufgrund unglücklicher Umstände allerdings nicht er, sondern ausschließlich sein ärztlicher Kumpan die Früchte ihrer verwerflichen Arbeit geerntet hatte, bevor dieser zum Tode verurteilt und gehängt worden war, hatte Ruland Berging abermals eine Flucht in Erwägung ziehen müssen. Zuvor aber hatten ihn seine unbändigen Rachegelüste getrieben, sich an der Familie des Kastellans schadlos zu halten und die Zeugen des im Kirchhof stattgefundenen Gespräches zwischen ihm und dem Medicus aus dem Weg zu räumen. Diese Zeugen waren Lodewig und Diederich Dreyling von Wagrain, zwei der drei Söhne des Kastellans, gewesen. So hatte der verhasste Totengräber einen mörderischen Rundumschlag geplant und den damals acht Jahre alten Diederich den steilen Südhang des Schlosses hinuntergestoßen, nachdem er ihm zuvor nach bewährter Manier brutal den Schädel eingeschlagen hatte. Danach hatte er den neun Jahre älteren Lodewig in seine Gewalt gebracht. Der Totengräber hatte ihn zuerst in einer Höhle im tief gelegenen Weißachtal und dann in der dortigen Pestkapelle auf grausamste Art und Weise fast zu Tode gequält. Fabio, einem ehemals ortsbekannten Dieb und seinerzeitigen Hilfstotengräber, war es zu verdanken gewesen, dass wenigstens der mittlere Sohn des Schlossverwalters Hannß Ulrich Dreyling von Wagrain und seiner Frau Konstanze den Klauen des Totengräbers hatte gerade noch entrissen werden können. Aber der Kastellan hatte dafür einen hohen Preis bezahlen und den Totengräber entwischen lassen müssen, obwohl er ihn vom Allgäu aus quer durch halb Oberschwaben gejagt und auch aufgespürt hatte. Nachdem der Totengräber im Kloster Schussenried, in dem er sich hatte verstecken wollen, mehrere Mönche ermordet hatte und abermals geflohen war, hatte der damalige Kastellan aufgegeben und die wüste Drohung »Ich komme wieder, um mein Werk zu vollenden!« zur bitteren Kenntnis nehmen müssen. Vermutlich trieb Ruland Berging irgendwo im Oberschwäbischen oder am Bodensee immer noch sein Unwesen. Der Altkastellan durfte nicht daran denken, was wohl sein würde, wenn der Fiesling irgendwann wieder hier im rothenfelsischen Gebiet auftauchen würde. Auch wenn der alte Dreyling von Wagrain immer wieder an die schreckliche Vergangenheit denken musste und er für sich selbst keine nennenswerte Zukunft mehr sah, so gewöhnte er es sich doch an, den Blick nach vorne zu richten oder zumindest im Hier und Jetzt zu lassen.
Kapitel 3
Seit dem Tag des Jahres 1649, an dem bekannt geworden war, dass Hugo zu Königsegg, Regent der Grafschaft Rothenfels und der Herrschaft Staufen, nach vieljähriger Abwesenheit wieder in seinem Immenstädter Schloss weilte, herrschte große Aufregung unter den Resort leitenden Beamten, die allesamt nicht mit dessen unverhoffter Rückkehr gerechnet hatten.
Etliche seiner Amtsleiter erschraken insgeheim, weil sie die kleinen Schweinereien, mit denen sie hinter dem Rücken des alternden Oberamtsmannes Conrad Speen und auf Kosten des Grafen ihr jämmerliches Dasein lebenswerter gestalten konnten, gerne noch ein Weilchen fortgeführt hätten. Während das Volk darben musste, hatten es sich die sauberen Herren Beamten gut gehen lassen und sich genommen, was sie unbemerkt hatten kriegen können. Hierbei waren sie allesamt einfallsreich gewesen und brauchten nicht einmal ihre inneren Schweinehunde herauszulassen, um immer genau zu wissen, wie sie sich am geschicktesten bereichern konnten. Der Oberförster des Grafen hatte jede Art von Schalenwild gegen zahnfeste Währung getauscht. Dass seine Jagdhelfer klüger gewesen waren, als er dachte, und ihm nacheiferten, hatte er nicht einmal bemerkt, als er dem »Bunten Jakob«, einem undurchsichtigen Fahrenden Händler, der während des Krieges miese Geschäfte mit dem damaligen Totengräber Ruland Berging gemacht hatte, eine ganze zerlegte Wildsau hatte verkaufen wollen und zur Antwort bekommen hatte, dass dieser gerade eben hier in Immenstadt etliche Stücke Rotwild erworben hatte. Ekkehard van der Heye, Leiter der gräflichen Schreibstube, und sein hinterkünftiger Helfer hatten indessen wertvolle Inkunabeln an Stadtpfarrer Johannes Christoph Schwenk verkauft, während der Mann Gottes das Geld hierfür aufgetrieben hatte, indem er in seiner Art mehrfach vorhandenes Kirchensilber an den »Bunten Jakob«, den »Schacherer« oder an andere durchziehende Händler verscherbelt hatte. Dass der Priester nicht nach der Herkunft der wertvollen Drucke gefragt hatte, war schon etwas seltsam gewesen. Der Herrgott gibt, der Herrgott nimmt, dürfte er gedacht und die Sache dadurch für sich vereinfacht haben.
Wegen plündernder Schweden und kaiserlicher Truppen hatte Speen das gesamte Inventar der reich ausgestatteten Schlossbibliothek rechtzeitig an einen sicheren Ort gebracht. Zudem hatte er das gräfliche Tafelsilber, Vasen, andere wertvolle Gegenstände, Gemälde und sogar kleine Möbelstücke in versteckt gelegene Lagerräume bringen lassen, dabei aber nicht berücksichtigt, dass die Gefahr des Diebstahls auch aus eigenen Reihen drohen könnte. Da die zumeist dem eigenen Geschlecht zugeneigten Höflinge des Grafen während dessen Abwesenheit nichts anderes zu tun gehabt hatten, als das menschenleere Schloss in Schuss zu halten, war ihnen stets genügend Zeit zur Verfügung gestanden, sich auf gotteslästerliche Weise miteinander zu beschäftigen oder unbemerkt in die Lagerräume einzudringen, um scheibchenweise all das zu stehlen, was sich unbemerkt aus dem Schloss hatte schaffen lassen. Das Eintauschen des Diebesgutes gegen hochwertige Nahrungsmittel oder der Verkauf an professionelle Hehler, die es seit Ende des Großen Krieges zuhauf gab, stellte für die schleimigen Brüder kein nennenswertes Problem dar.
Da Speen während der Abwesenheit des Grafen das Sagen hatte, war es allein seine Sache, nicht nur für Ordnung innerhalb der Immenstädter Stadtmauer, sondern auch außerhalb – im ländlich geprägten Teil des gräflichen Herrschaftsgebietes – zu sorgen. Obwohl selbst mit allen Wassern gewaschen, hatte es ihm aufgrund der durch den Krieg, die immer wieder aufkommende Pestilenz und die durch allseitige Hungersnot hervorgerufenen ständigen Turbulenzen unmöglich gelingen können, allen Betrügereien und Diebstählen auf die Schliche zu kommen und ihnen nachzugehen, geschweige denn, sie zu ahnden. Wenn Speen ausnahmsweise einen Bösewicht ertappt hatte, dem er etwas Verbotenes hatte nachweisen können, hatte er ihn unverzüglich dem jüngeren Richter Michael Waldvogel, der sich zunehmend mit dem altgedienten Richter Hans Zwick abwechselte, übergeben.
Weshalb dieser ständige Amtswechsel vorgenommen wurde, wusste niemand so genau – nicht einmal der Regent, der sich so wenig wie möglich in die Gerichtsbarkeit einmischte, obwohl er selbst der höchste Richter im Lande war. Man wusste nur, dass die beiden eines verband: Zwick war nicht nur ein honoriger Vorsteher der Immenstädter Bürgerschaft und des Stadtrates gewesen, in dessen Fußstapfen Waldvogel gestiegen war, sondern hatte auch noch den Stab in Bezug auf die Gerichtsbarkeit an den jüngeren Richter übergeben. Beide pflegten keine Kompromisse zu machen und taten nichts lieber, als die Angeklagten der Peinlichen Befragung zu unterziehen. Wie gerade Richter Waldvogel mit den Missetätern umging, konnte man daran sehen, dass der städtische Kerker, der sich im Waaghaus befand, trotz täglicher Vergehen und wöchentlicher Verbrechen nie lange besetzt war.
Dass es tief unterhalb des Immenstädter Schlosses drei zusätzliche Kerkerzellen, einen Verhörraum und eine bestens ausgestattete Folterkammer gab, wussten bisher nur speziell vergatterte Eingeweihte. Allerdings wurde die Fronfeste, wie diese Räume von den wenigen, die davon wussten, genannt wurden, derzeit überhaupt nicht genutzt, weil sie gerade nach Meinung der jüngeren Ratsherren – die vom erfolgreichen Kaufmann Peter Immler angeführt wurden – aus Humanitätsgründen nicht mehr zeitgemäß und deren Unterhalt viel zu teuer war. Aber Waldvogel würde nicht der amtierende und – wie bereits sein Vorgänger – vom Volk hinter vorgehaltener Hand als »Richter Gnadenlos« bezeichnete Hüter über Recht und Ordnung sein, wenn er nicht dafür sorgen würde, die Fronfeste über kurz oder lang wieder ihrer alten Bestimmung zuzuführen und die vorhandenen Richtstätten fleißiger zu nutzen, als dies bisher der Fall gewesen war. Zweiteres tat er – obwohl er aufgrund der Nachkriegswirren kaum noch ordentliche Prozesse führen konnte –, so oft es nur ging. Leider waren Folterungen derzeit nur unter erschwerten Bedingungen möglich, was sich nach Waldvogels Meinung ebenfalls schleunigst ändern musste. Kraft seines Amtes stand ihm dies zu – da konnten die jungen, unerfahrenen und in seinen Augen unbrauchbaren Ratsherren sagen, was sie wollten. Im Grunde genommen musste er nicht einmal den Grafen fragen. Er konnte sich guten Gewissens auf das immer noch gültige Recht der Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit berufen, das Hugo Graf von Montfort 1447 von Kaiser Friedrich III. für das gesamte rothenfelsische Gebiet erhalten und das immer noch Gültigkeit hatte.
Das letzte Mal, dass hier vor dem Staufner Wolfgang Bentele jemand mit allem Brimborium peinlich befragt, gefoltert und auf dem Immenstädter Marktplatz hingerichtet worden war, dürfte im Frühjahr 1636, kein halbes Jahr nach Abklingen der Pestilenz in Staufen, gewesen sein. Damals war es auch schon ein Staufner gewesen, der sich zwischen vier Pferde hatte legen müssen. Zuvor war dem aus Staufen stammenden Delinquenten, dem allseits unbeliebten Huf- und Waffenschmied Babtist Vögel, der Mord mit vorausgegangener Schändung an einer jungen Frau nachgewiesen worden, was letztlich seinem damals ungefähr 13-jährigen geistig zurückgebliebenen Sohn Baltus das Herz und ihm selbst den ganzen Körper zerrissen hatte. Dass nach der Vierteilung des gewalttätigen Schmiedes dessen Torso mitsamt dem Kopf bereits spurlos verschwunden gewesen war, als die Arme und Beine des soeben Gevierteilten noch an den Seilen und die Seile noch an den Zugpferden befestigt waren, hatte die Bevölkerung zunächst als böses Omen gewertet und nicht als Diebstahl erkannt – zumal niemand etwas gesehen hatte, obwohl der Immenstädter Marktplatz voller Menschen gewesen war. Also hatten es nur die Mächte der Finsternis oder die Geister der durch Babtist Vögel geschändeten Frau gewesen sein können, die den Torso mit Sitz des Herzens und den Kopf mit Sitz des Gehirns zu sich geholt hatten. Ein normaler Mensch hätte es niemals gewagt, einen entehrten Körper überhaupt zu berühren. Und außerdem: Wer in Gottes Namen hätte mit einem übel zugerichteten Korpus ohne Arme und Beine etwas anfangen können? Dennoch waren die Gerüchte, dass dessen verwertbare Teile in einem Kochtopf der vielen hungernden Menschen verschwunden waren, aufgekommen und lange nicht verstummt. Oder waren sie gar auf dem Bratrost des »Herrn der Fliegen«, wie der Teufel auch genannt wurde, gelandet? »In der Not frisst der Teufel Fliegen« war ein wörtlich zu nehmender Spruch, der während der Pest und der Zeit des dreißig Jahre anhaltenden Krieges nicht nur in Immenstadt und im gesamten rothenfelsischen Gebiet, sondern europaweit die Runde gemacht und sich gehalten hatte. Da sich zu jener Zeit im Allgäu rudelweise Wölfe herumgetrieben hatten, war letztlich die zwar unmögliche, für das einfältige Volk dennoch glaubwürdigste aller Erklärungen vom sogenannten »Wolfshunger« geblieben.
Der damals tobende Richter Zwick konnte nur noch die Arme und Beine des Gevierteilten auf lange Pfähle spießen und an allen vier Enden des gräflichen Herrschaftsgebietes aufstellen lassen, bevor die grausige »Akte Vögel« für hoffentlich alle Zeiten hatte geschlossen werden können. Zuvor aber war Hermann Leimer, ein stadtbekannter Säufer und Vorgänger des heutigen Nachrichters Sebastian Deibler, einer Strafe zugeführt worden, wie sie eben nur hatte Zwick einfallen können. Der damals angetrunkene Carnifex war für seine alles andere als meisterliche Arbeit hart bestraft worden; er hatte es unterlassen, in den Körper des Verurteilten kurz vor dessen Vierteilung ein so tiefes Kreuz zu ritzen, dass beim Anziehen durch die Pferde nicht nur Arme und Beine herausgerissen, sondern der ganze Körper in vier gleich große Teile zerrissen worden wäre. Und diese Nachlässigkeit hatte sträfliche Konsequenzen gehabt. Denn hätte er seine Arbeit meisterlich angepackt, wäre der Torso nicht in einem Stück geblieben und hätte dementsprechend auch nicht am Stück spurlos verschwinden können.
*
Wie immer, wenn der Landesherr für längere Zeit abwesend gewesen war, sprach er schon wenige Tage nach seiner Rückkehr höchstpersönlich über diejenigen Recht, die Zwick oder Waldvogel während seiner Abwesenheit nicht stante pede zum Tode verurteilt hatten und die sich – anstatt das Herrschaftsgebiet zu verlassen – tatsächlich freiwillig bei Oberamtmann Speen gemeldet hatten, um dem Grafen gleich nach dessen Rückkehr reumütig ihre Version des jeweiligen Herganges der ihnen zur Last gelegten Taten erzählen zu können. War der Graf im Vergleich zu anderen Potentaten in dieser Hinsicht schon immer großmütig, zog er es nach seiner diesmaligen Rückkehr vor, alle Missetäter auf einmal zu sich zu beordern, um sie pauschal zu begnadigen. Zuvor aber hatte er den mehr als zwei Dutzend Strolchen und sieben Weibern, die allesamt keine Kapitalverbrechen begangen hatten, gehörig die Leviten gelesen. Er hatte ihnen auferlegt, ab sofort ein gottgefälliges Leben zu führen und der Königsegger Hausheiligen, der jungfräulichen Gottesmutter Maria, von Zeit zu Zeit eine Kerze hinzustellen.
»Na ja, vielleicht halten sie sich wenigstens an eines meiner Gebote«, hatte er augenzwinkernd zu Speen gesagt.
Um dem Volk zu zeigen, dass er sich wieder im Lande befand, statuierte der Regent allerdings auch dieses Mal ein Exempel, indem er zwei zänkischen Weibern die hölzerne Halsgeige verpassen und sie ausgerechnet am Markttag nördlich des Schlosses von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in aller Öffentlichkeit zum Gespött des Pöbels werden ließ. Dort konnten sich die zerstrittenen Hühner – deren Köpfe und Hände, sich gegenseitig zugewandt, in das hölzerne Foltergerät gesteckt waren – so lange anschreien, anspucken und anschnaufen, bis ihnen die Puste ausging und ihre Kehlen so trocken waren, dass ihr Atem noch mehr stank als zuvor.
Allen anderen hatte er angedroht, dass ihnen bei Nichtbefolgung der Auflagen – egal, weswegen sie schon wieder gefangen gesetzt werden mussten – ohne Prozess beide Hände abgehackt und sie der Grafschaft verwiesen würden, was einem Todesurteil gleichkommen würde. Da Achturteile fast so gefürchtet waren wie die Todesstrafe selbst, wirkte diese Drohung in den meisten Fällen. Entweder hielten sich die Begnadigten ab sofort einigermaßen an die Gesetze oder verließen doch noch die Grafschaft – mitsamt ihren Händen.
Das außerordentlich gnädige Verhalten des Regenten hatte einen Grund: Wegen der ohnehin schon gewaltig dezimierten Einwohnerzahl in seinem Reich konnte er es sich absolut nicht leisten, noch mehr Untertanen zu verlieren.
Vielleicht ist ja tatsächlich der eine oder andere dabei, der irgendwann Steuern zahlen wird, hatte er sich bei seiner Entscheidung gedacht und dem Oberamtmann gegenüber laut werden, aber nicht all zu viel Glaube in seine Hoffnung einfließen lassen.
Nachdem der alles andere als feierliche Begnadigungsakt erledigt war, ließ er von seinen Lakaien auftafeln, was Küche und Keller in diesen lausigen Zeiten herzugeben vermochten. Im Anschluss daran – nur unterbrochen von einem Mittagsschläfchen – ließ sich der merkbar erholte und gut gelaunte Regent von seinen Amtsleitern ausführlich Bericht erstatten. Danach prüfte er persönlich die Bücher, klärte Ungereimtheiten der merkwürdigsten Art und lieh auch noch den lästigen Honoratioren der Stadt sein geneigtes Ohr. So war er, der Königsegger: Mit der gleichen Inbrunst, wie er den schönen Dingen des Lebens frönte, ging er auch an seine Arbeit.
*
Um sich einen Gesamteindruck über die Stimmung in seinem weitläufigen Herrschaftsgebiet verschaffen zu können, gab er schon zwei Tage später einer Handvoll Bürgern, Handwerkern und Bauern aus allen größeren Orten der Grafschaft die Möglichkeit, Beschwerden vorzubringen oder Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.
Obwohl die meisten »Gesandten« dabei einen ungebührlichen, vereinzelt sogar harschen Ton anschlugen, hörte sich der Graf alles mit stoischer Würde an und versuchte, für deren Probleme Lösungen zu finden. Zumindest tat er alles, um diesen Eindruck zu erwecken.
Oberamtmann Speen musste einige von ihnen, die sich nicht als ernst zu nehmende Gesprächspartner, stattdessen aber als undisziplinierte und primitive Hitzköpfe erwiesen, mehr als einmal zur Ordnung rufen. Hätte der Graf kein Verständnis für die Situation der einfachen Leute geheuchelt und nicht gewusst, was sie und deren Familien in den letzten Jahrzehnten alles mitgemacht hatten, hätte er den einen oder anderen wohl festsetzen und mit der Sechsschwänzigen Katze – Waldvogels neuester Errungenschaft – auspeitschen lassen müssen. Aber wem hätte dies genutzt? Dabei wären nur unnötiges Verköstigungsgeld und Löhne für die Gerichtsweibel und den Carnifex mit seinen Henkersknechten draufgegangen.
Nachdem die Gesandten aus den nördlich der Residenzstadt gelegenen Ortschaften diesseits der Iller einigermaßen vernünftige Ansichten zu vertreten schienen und sogar etliche brauchbare Vorschläge zur Zukunftsbewältigung gemacht hatten, hatte sich der Graf von den aus Immenstädter Perspektive östlichen Gesandten aus Blaichach, Oberstdorf und sogar aus dem Kleinen Walsertal fast nur an wüste Beschimpfungen grenzende Beschwerden anhören müssen, dafür aber keinen einzigen brauchbaren Verbesserungsvorschlag zu hören bekommen. Dementsprechend gelangweilt wandte er sich seinem Adjudanten zu: »Sage er Uns, lieber Speen, ist das Unser Volk?« Er schüttelte den Kopf. »Und hat es sich während des Krieges wirklich in solch primitive Lümmel verwandelt oder waren Wir ganz einfach zu lange fort und haben kein Verständnis mehr für die ungehobelte Art und den schrecklichen Dialekt Unserer Untertanen?«
»Bleibt gelassen, Exzellenz. Bedenkt die politische Wichtigkeit, die darin liegt, dass sich je einer aus all den wichtigeren Orten Eures Herrschaftsgebietes bei Euch ausheulen darf und …« Im Zweifel daran, dass der immer wieder heraushörbare schwäbische Dialekt des Regenten besser klingen würde als jener, den die Allgäuer seit Jahrhunderten pflegten, sprach er nicht weiter. Immerhin benutzte auch er diesen Dialekt – wenn er nicht gerade ins grässliche Beamtendeutsch verfiel oder mit hochrangigen Menschen sprach.
»Bisher war das wohl eher ein ›Auskotzen‹, oder?«, bemerkte der Regent in einer Sprache, die wohl alle Stände verstanden.
»Ja, Euer Gnaden …« Aufgrund der ungewohnt derben Aussprache seines Herrn irritiert, hüstelte der feine Oberamtmann etwas unsicher, bevor er fortfuhr: »So nehmen die Männer wenigstens das Gefühl mit in ihre Dörfer zurück, dass sich ihr Herr persönlich um sie bemüht. Dadurch begehren sie nicht so schnell auf und geben wieder oder weiterhin Ruhe.«
»Er hat recht, guter Speen. Einen Aufstand könnten Wir jetzt nicht auch noch gebrauchen … Wer ist der Nächste?«, fragte der Graf noch, bevor er zu gähnen begann.
Der ranghöchste Beamte des rothenfelsischen Gebiets fuhr mit seinem Zeigefinger über ein Blatt groben Papiers und deutete danach dem Zeremonienmeister, den Leinweber Melchior Henne aus Staufen hereinzugeleiten.
»Aha, ein Staufner!«, entfuhr es dem Grafen, der sich innerlich schon auf die nächste Beschwerdeattacke eingestellt hatte. Er wusste nur allzu gut, dass die Staufner ein eigenes Völkchen waren, das sich nicht gerne etwas gefallen ließ. Dies hatte es in der Vergangenheit hinlänglich unter Beweis gestellt. Aber im Gegensatz zu seinen unbeholfenen und zum Teil sogar poltrigen Vorrednern trat der 31-jährige Handwerker gemessenen Schrittes nebst angemessener Haltung in den Raum und verneigte sich so, als wenn er dies an einem herrschaftlichen Hof gelernt hätte. Er wartete so lange, bis ihm der Graf das Wort erteilte.
»Ihre Durchlaucht …«, wollte er beginnen.
Als dies der Oberamtmann hörte, räusperte er sich rasch, neigte sich dem jungen Staufner entgegen und tuschelte ihm zu: »›Erlaucht‹. Es heißt ›Euer Erlaucht‹.«
»Entschuldigt.« Jetzt war es Melchior, der sich räusperte. »Euer Erlaucht«, fuhr er dennoch in einem würdevoll klingenden Ton fort, ohne sich anmerken zu lassen, dass er einen Fauxpas begangen hatte. »Darf ich Euch zuallererst im Namen des Verwalters Euer Staufner Schlosses, des verehrten Herrn Lodewig Dreyling von Wagrain, sowie unseres Ortsvorstehers Hermann Schädler, des Propstes Johannes Glatt und all Euer Staufner Untertanen grüßen und Euch gleichzeitig in der Heimat willkommen heißen? Einen ganz besonderen Gruß soll ich Euer Erlaucht und der gesamten gräflichen Familie vom ehemaligen Schlossverwalter, Hannß Ulrich Dreyling von Wagrain, ausrichten. Er lässt nachfragen, ob es Euer Gnaden und der hochwohllöblichen gnädigen Frau gut geht.«
Diese gepflegte Art des Benehmens und die bemerkenswert höfische Ausdrucksweise trotz des anfänglichen Versprechers und des zweifellos merkbaren Schleimes in Melchiors Stimme ließen den Grafen neugierig werden, weswegen er sich bei der heutigen Audienz zum ersten Mal vornahm, aufmerksam zuzuhören, und dem jungen Mann mit einem Kopfnicken deutete, weiterzusprechen.
»Der Kastellan – Äh …, entschuldigt, Euer Gnaden.« Melchior räusperte sich wieder gekonnt aus der Affäre. »Der Verwalter des Staufner Schlosses mit allen Zugehörten hat mir mit Einverständnis des Ortsvorstehers und des Propstes die hohe Ehre zugestanden, an seiner statt hier zu sein und Euch weniger die Sorgen und Nöte der Staufner Einwohnerschaft, sondern vielmehr ein paar Lösungsvorschläge für einige der anstehenden Aufgaben überbringen zu dürfen.«
Ob dieser geschliffenen Aussprache und des ungewöhnlichen Inhaltes des Gehörten sah der Graf den Oberamtmann, den Melchiors Auftritt nicht wunderte, weil er ihn bereits in anderer Angelegenheit kennengelernt hatte, beeindruckt an. Der Regent schürzte die Lippen und nickte leicht, während der Oberamtmann Melchior Henne anerkennend und aufmunternd zuzwinkerte.
»Respekt!«, unterbrach der Graf die momentane Stille und wollte von dem jungen Staufner wissen, weshalb er den Eindruck erweckte, als wenn er auf einem herrschaftlichen Sitz erzogen worden wäre.
So angesprochen, konnte sich der junge Leinweber ein Lächeln nicht verkneifen. Er berichtete in aller Sachlichkeit und ohne jeglichen Anflug von Angeberei, dass die Familie Henne einem – seit mindestens drei Generationen – alten Staufner Handwerkergeschlecht entstammte. Er selbst habe von seinem Vater das Handwerk zur Herstellung und zur Bearbeitung von grobem Leinen erlernt und arbeite seit Übernahme des Geschäftes von seinem Vater mit dem Feinweber Markus Hagspihl zusammen, dessen Mutter bei der Geburt gestorben und dessen Vater im vorletzten Kriegsjahr einem herumstreunenden Schwedenhaufen zum Opfer gefallen sei, als er eine Ladung Flachs von Missen hatte abholen wollen. Dabei erzählte Melchior auch noch, dass es Markus nicht leicht habe, die Weberei – so ganz allein auf sich gestellt – aufrechtzuerhalten, »… zumal er auch noch das elterliche Anwesen ohne Hilfe in Schuss halten muss. Außerdem gibt es in Staufen zudem auch noch einen anderen Weber, der allerdings bei Weitem nicht dazu in der Lage ist, so fein zu arbeiten, wie es Markus kann, und der auch nicht in der Lage ist, grobes Leinen für Wintergewandungen herzustellen. Auch wenn wir beide keine Konkurrenz in dem anderen Weber sehen, so müssen wir uns doch immer wieder mit dem alten Mann herumplagen. Umso mehr schätzen wir die Zusammenarbeit mit Matthiß Spindelhirn, dem einzigen Blaufärber Staufens. Mit ihm sind Markus und ich vor Kurzem eine Erfolg versprechende Verbindung eingegangen«, ergänzte Melchior noch mit leichtem Stolz in der flatternden Stimme.
»Hieß der Staufner Blaufärber nicht Osp… Hannes Osper?«, wollte der Regent wissen.
»Ja, Euer Erlaucht, Ihr habt wie immer recht. Der Blaufärber hat sich Hannß Opser geschrieben!«, schmeichelte Melchior dem Grafen, bevor er ihm berichtete, dass der alte Opser und dessen Weib Gunda das Verschwinden ihres jüngeren Sohnes Didrik und den Wassertod ihres älteren Sohnes Otward bedauerlicherweise nicht verkraftet hatten und daran zerbrochen waren.
»Was ist geschehen?«, fragte der Graf ernsthaft interessiert.
»Nachdem Gunda Opser eines natürlichen Todes – ich glaube mich zu erinnern, dass es Auszehrung gewesen sein soll – verstorben war, ertränkte sich ihr Mann noch vor deren Bestattung im Entenpfuhl, wo zwei Jahre zuvor auch sein älterer Sohn gestorben war. Wahrscheinlich wollte er ihm im Tode nahe sein. Jedenfalls hat man seine Leiche … und die seines Weibes – die er mit ins Wasser genommen und noch im Tode eng umschlungen gehalten hat – im Teich gefunden.«
»Das ist zwar schrecklich. Aber jetzt berichte Ihrer Exzellenz weiter von dir«, lenkte der Oberamtmann nicht besonders einfühlsam zum eigentlichen Thema zurück, um die verlorene Zeit für den Grafen aufzuholen.
»Was soll ich sagen?«, überlegte Melchior, bevor er weiter von sich erzählte. »Da ich schon der beste Freund des Kastellans gewesen bin, als Lodewig Dreyling von Wagrain noch ein Knabe und dessen Vater der Kastellan war, kenne ich diese Familie und das Schloss Staufen recht gut und …«
»Ja, ja. Aber warum ist Er so gewandt?«, interessierte den nicht gerade mit Geduld gesegneten Grafen.
»Obwohl es meine Eltern verboten haben, war es mir vergönnt, von Lodewig, in erster Linie aber von dessen Lehrer, Propst Glatt, etwas Lesen und Schreiben zu erlernen. Hier und da habe ich das Glück gehabt, sogar an seinem Lateinunterricht teilnehmen zu dürfen. Und die höfischen Umgangsformen hat mir Lodewigs verstorbene Mutter Konstanze beigebracht, Euer Erlaucht! … Auch das Essen mit Messer und Zweispitz«, fügte Melchior noch schnell hinzu, bevor er sich hastig bekreuzigte.
Vor dem Grafen hatte sich fürwahr ein strammer Bursche aufgebaut, der von adligem Blute hätte sein können. Offensichtlich war er nicht nur blitzgescheit und verfügte über herausragende Umgangsformen, er sah auch noch gut aus. Groß gewachsen, von kräftiger Statur, mit kantigen Gesichtszügen, klarem Blick und wallendem Haar stand er da und wartete darauf, endlich den Grund seines Hierseins erfüllen und seine Anregungen loswerden zu dürfen.
Nachdem der Graf und sein oberster Beamter ein Weilchen hin und her getuschelt hatten, baten sie den jungen Mann, seine Beschwerden vorzutragen.
Melchior schüttelte den Kopf. »Edler Herr, ich habe keine Beschwerden! Ihr wisst selbst, dass wir Staufner eine schreckliche Zeit hinter uns haben, für die Ihr, hoher Herr, nichts könnt. Ich bin nicht hier, um zu jammern, und schon überhaupt nicht, um im Zorn zurückzublicken …, auch wenn meine Eltern vor 15 Jahren durch die Hand eines fehlgeleiteten Arztes gestorben sind und ich im Jahr darauf die Pest erlebt … und, Gott sei Dank, auch überlebt habe.«
Spätestens nachdem Melchior sich bekreuzigt hatte, konnte er sich der vollen Aufmerksamkeit des Grafen gewiss sein. So wusste er ausführlich zu berichten, dass seit Ende des 30 Jahre anhaltenden Krieges auffallend viel Gesindel durch Staufen gezogen war und sich auch jetzt gerade eine besonders undurchsichtige Gestalt im Dorf herumtrieb. Er konnte auch berichten, dass es den Staufnern, wenngleich bei Weitem nicht so wie während des Krieges, aber dennoch sehr schlecht ging, weil Nahrungsmittel immer noch äußerst knapp und Brennholz unerreichbar waren.
Der kluge und an allem interessierte junge Mann benötigte fast eine geschlagene Stunde, um all seine Vorschläge für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben loszuwerden. »… aber dies nützt alles nichts, wenn Ihr Euer am Ende des Jahres 1635 gegebenes Versprechen nicht einlöst, edler Herr. Die Staufner haben schon an Euren Vater Georg geglaubt, obwohl dieser – Ihr mögt mir verzeihen – mit voller Härte gegen sie vorgegangen ist.« Melchior blickte den Grafen prüfend an, um feststellen zu können, ob er seine Worte zu forsch gewählt hatte. Nachdem er glaubte, dies verneinen zu können, fuhr er mutig fort: »Als Ihr die Herrschaft übernommen habt, sind die Staufner Untertanen Euer Erlaucht unverrückbar zu Euch gestanden. Selbst in härtesten Zeiten haben sie an Euch geglaubt. Auch als die Pest in Staufen ausgebrochen ist und Ihr – bitte verzeiht mir abermals …«, Melchior senkte verschämt seinen Blick, »nach Konstanz gereist seid.«
Bevor sich der Graf aufplustern konnte, um sich eindrucksvoll zu empören, kam in Melchior doch noch der einfach aufgewachsene Landbewohner durch, der sich nicht unterbrechen ließ und der, ohne zu warten, ob der Graf etwas sagen wollte, mit fester Stimme weitersprach: »Mein Herr! Zeigt den Staufnern, dass Ihr sie liebt und zu ihnen steht. Haltet Euer Versprechen von 1635 und lasst Euch irgendetwas einfallen, das uns die Schrecken der grausamen Pestilenz endlich vergessen lässt und uns mit unserem Herrschaftshaus für alle Zeiten verbindet, damit wir gemeinsam in eine bessere Zukunft blicken können … Für und Für!«
Obwohl den Grafen noch niemals jemand so direkt angesprochen hatte, geschweige denn ein einfacher Handwerker, lächelte dieser milde und raunte Speen ins Ohr: »Stelle Er sich vor, Unsere feigen Beamten und die wachsweichen Honoratioren Unserer Gemeinden würden so viel Schneid zeigen wie dieser junge Mann. Dann hätten Wir selbst bald nicht mehr viel zu sagen.«
Während Speen nicht wusste, ob er darüber lachen sollte – immerhin war auch er ein Beamter –, beschäftigte sich der Graf schon wieder mit Melchior. »Da Wir die Sache nicht vergessen haben und sehr wohl wissen, dass Wir den Staufnern noch etwas schulden, hatten Wir uns bereits damals im gräflichen Familienkreis besprochen und können den Staufnern einen Vorschlag unterbreiten«, redete der Graf zur Verwunderung seines Oberamtmannes nicht um den Brei herum und kam auch – ohne seinen höchsten Beamten zuvor informiert, geschweige denn sich mit ihm abgesprochen zu haben – gleich zur Sache: »Unsere liebreizende, leider längst verstorbene, aber 1635 noch mitregierende Gemahlin Maria Renata von Hohenzollern hat einen guten Gedanken gehabt, der ihr zum Gedenken, Uns zur Freude und den Staufnern zur Ehre gereichen wird.«
Während der Graf in Erinnerung an seine erste Gemahlin einen Moment schweigend verharrte, schauten sich Speen und der hinter seinem Katheder stehende Schreiber verwundert an.
»Euer Erlaucht?«, unterbrach Melchior, der wissen wollte, um was es ging, die Stille.
Aber dem Regenten war wohl noch nicht danach weiterzuerzählen oder gar danach, Melchior für dessen Unverfrorenheit zu rügen. Stattdessen rief er nach dem Mundschenk: »Fülle Er endlich Unser Glas!«, gebot er dem zuständigen Lakaien, der wie sein ebenfalls gepudertes Pendant wie eine kostümierte Salzsäule neben der Flügeltür stand.