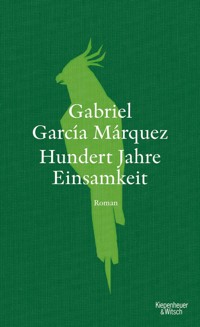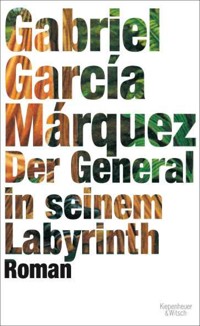
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Der General in seinem Labyrinth« – Gabriel García Márquez' meisterhafter Roman über das Leben und die letzte Reise des südamerikanischen Freiheitshelden Simón Bolívar. Simón Bolívar, der legendäre Libertador und Held des Unabhängigkeitskrieges gegen die spanische Krone, wird noch heute in ganz Lateinamerika verehrt. Der charismatische Bürgerssohn aus Caracas, der in den Salons seiner Zeit glänzte und unermüdlich für seine Vision eines befreiten und vereinten Südamerikas kämpfte, erlebte als Präsident des von ihm geschaffenen Staates Kolumbien die Höhen des Ruhms, aber auch die Niederungen der Macht und die Angriffe seiner Gegner. In seinem fesselnden Roman »Der General in seinem Labyrinth« beschreibt Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez die letzte Reise des schwerkranken Bolívar den Magdalena-Strom hinab zur Karibik. In einem spannungsreichen Geflecht historischer Ereignisse zeigt er den Menschen hinter dem Helden in seinem körperlichen und seelischen Verfall, im Labyrinth seiner Leiden und verlorenen Träume. Ein ergreifendes Porträt eines der bedeutendsten Protagonisten der lateinamerikanischen Geschichte, meisterhaft erzählt von einem der größten Schriftsteller unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Der General in seinem Labyrinth
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Er gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichen Schriftsteller der Welt. García Márquez starb am 17. April 2014 im Alter von 87 Jahren in Mexiko-Stadt.
Die Übersetzerin
Dagmar Ploetz, geboren 1946 in Herrsching, übersetzt seit 1983 aus dem Spanischen Autoren wie Isabel Allende, Julián Ayesta, Rafael Chirbes, Gabriel García Márquez, Juan Marsé, Manuel Puig und Juan Rulfo.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Símon Bolívar, Aristokrat und einer der reichsten Männer in Venezoela, befreite als siegreicher General die lateinamerikanischen Kolonien von der Herrschaft der spanischen Krone. Sein Traum von der Einheit Lateinamerikas aber ging nicht in Erfüllung …
Gabriel García Márquez zeigt den Menschen Símon Bolívar auf seiner letzten Reise, die einer Flucht gleicht. Er zeigt uns den Visionär, den unerbittlichen Krieger, den desillusionierten Staatsmann, den Romantiker, der Gedichte schrieb und die Frauen liebte – ein im Labyrinth seiner Träume umherirrender Mensch, der im Alter von 47 Jahren starb.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Danksagung
Simón Bolívar und seine Zeit
Karte
Für Álvaro Mutis, der mir die Idee für dieses Buch geschenkt hat.
»Es ist, als lenke der Teufel die Angelegenheiten meines Lebens.«
(Brief an Santander vom 4. August 1823)
José Palacios, sein ältester Diener, fand ihn in der Badewanne, nackt und mit offenen Augen im Heilwasser treibend, und glaubte, er sei ertrunken. Er wußte, dies war für ihn eine von vielen Möglichkeiten zu meditieren, der Zustand der Verzückung aber, in dem er da trieb, schien nicht mehr von dieser Welt zu sein. Er wagte nicht, näher heranzutreten, sondern rief ihn mit gedämpfter Stimme, getreu dem Befehl, ihn vor fünf Uhr zu wecken, damit man beim ersten Tageslicht aufbrechen könne. Der General löste sich aus dem Bann und sah in der Dämmerung die blauen durchscheinenden Augen, das krause eichhörnchenfarbene Haar und die unbeirrbare Hoheit, mit der sein Leibdiener die Tasse Feldmohntee mit Gummiarabikum trug. Der General hielt sich kraftlos an den Griffen der Badewanne fest, tauchte dann wie ein Delphin aus dem Heilwasser, unerwartet schwungvoll für einen derart abgezehrten Körper.
»Gehen wir«, sagte er. »Sofort, denn hier will uns keiner haben.«
José Palacios hatte das so oft von ihm gehört und bei ganz verschiedenen Gelegenheiten, daß er es noch nicht glauben mochte, obgleich die Lasttiere bepackt in den Ställen warteten und die offizielle Delegation sich bereits sammelte. Er half ihm, so gut es ging, beim Abtrocknen und zog ihm den Feldumhang über den nackten Leib, denn die Tasse zitterte in seinen Händen. Vor Monaten schon hatte der General, als er sich eine seit den babylonischen Nächten von Lima nicht mehr getragene Wildlederhose anzog, die Entdeckung gemacht, daß er, in dem Maße wie sein Gewicht abnahm, auch an Körpergröße verlor. Sogar seine Nacktheit war anders, denn sein Körper war bleich, Gesicht und Hände aber wie gedörrt von den Unbilden des Wetters. Im vergangenen Juli war er sechsundvierzig Jahre alt geworden, sein starres karibisches Kraushaar war jedoch schon aschfarben und seine Knochen durch den frühzeitigen Verfall in Unordnung geraten, der ganze Mann sah so erbarmungswürdig aus, daß man ihm nicht zutraute, bis zum nächsten Juli zu überdauern. Die entschiedenen Gebärden aber waren von einem anderen, den das Leben weniger mitgenommen hatte, und er lief unablässig um nichts herum. Vor seinen eigenen Wasserspuren auf den zerschlissenen Bodenmatten fliehend, trank er den Heiltee in fünf glühenden Schlucken, die ihm fast Blasen auf die Zunge trieben, und es war, als hätte er das Lebenselexier getrunken. Er sagte jedoch kein Wort, bis es von der nahen Kathedrale fünf schlug. »Sonnabend, der 8. Mai 30, Tag der Heiligen Jungfrau, Mittlerin aller Gnaden«, verkündete der Haushofmeister. »Es regnet seit drei Uhr morgens.«
»Seit drei Uhr morgens des 17. Jahrhunderts«, sagte der General mit einer noch vom sauren Atem der Schlaflosigkeit belegten Stimme. Und fügte ernst hinzu: »Ich habe die Hähne nicht gehört.«
»Hier gibt es keine Hähne«, sagte José Palacios. »Nichts gibt es«, sagte der General. »Ein gottloser Landstrich.«
Denn sie waren in Santa Fe de Bogotá, zweitausendsechshundert Meter über dem fernen Meer, und das riesige Zimmer mit den kahlen Wänden war eisigen Winden, die durch die schlecht schließenden Fenster drangen, ausgesetzt und damit für die Gesundheit von niemandem zuträglich. José Palacios stellte die Schale mit dem Schaum auf die Marmorplatte des Waschtischs, dazu das rote Samtetui mit den Barbierinstrumenten, allesamt aus vergoldetem Metall. Er stellte den Handleuchter mit der Kerze auf ein Sims nah dem Spiegel, damit der General ausreichend Licht hätte, und rückte das Kohlebecken heran, damit er warme Füße bekäme. Dann reichte er ihm eine Brille, ein feines Silbergestell mit quadratischen Gläsern, die er für ihn stets in der Westentasche trug. Der General setzte sie auf und begann sich zu rasieren, wobei er das Rasiermesser dank einer angeborenen Gabe ebenso geschickt mit der rechten wie mit der linken Hand führte, und das erstaunlich sicher, obwohl er doch vor wenigen Minuten kaum fähig gewesen war, die Tasse zu halten. Er rasierte sich blind fertig, während er weiter seine Runden durchs Zimmer machte, bestrebt, sowenig wie möglich in den Spiegel zu sehen, um seinen eigenen Augen nicht zu begegnen. Dann riß er sich ruckweise die Haare aus der Nase und den Ohren, polierte sich die vollkommenen Zähne mit Kohlepulver auf einer Seidenbürste mit Silbergriff, schnitt und polierte sich die Nägel an Händen und Füßen, legte zuletzt den Umhang ab, leerte eine große Flasche Kölnisch Wasser auf seinem Körper aus und rieb sich mit beiden Händen von oben bis unten ab, bis er erschöpft war. An diesem frühen Morgen hielt er die tägliche Reinlichkeitsmesse mit noch besessenerer Strenge ab als gewöhnlich, er versuchte, Körper und Seele von zwanzig Jahren nutzloser Kriege und von all den Enttäuschungen der Macht zu reinigen.
Als letzten Besuch hatte er am Abend zuvor Manuela Sáenz empfangen, eine kampferprobte Frau aus Quito, die ihn liebte, ihm aber nicht bis zum Tod folgen sollte. Sie blieb wie stets mit dem Auftrag zurück, den General über alles, was in seiner Abwesenheit geschah, gut informiert zu halten, denn er vertraute schon seit langem niemandem außer ihr. Er hinterließ in ihrer Obhut ein paar Dinge, deren einziger Wert darin bestand, ihm gehört zu haben, so wie einige seiner liebsten Bücher und zwei Truhen seines Privatarchivs. Am Tag zuvor hatte er bei dem kurzen förmlichen Abschied zu ihr gesagt: »Ich liebe dich sehr, werde dich aber noch mehr lieben, wenn du jetzt mehr Vernunft zeigst denn je.« Sie nahm es hin als eine weitere Huldigung von den vielen, die er ihr in acht Jahren glühender Liebe dargebracht hatte. Von allen, die ihn kannten, war sie die einzige, die es glaubte: Diesmal ging er wirklich fort. Sie war aber auch die einzige, die zumindest einen triftigen Grund hatte, auf seine Rückkehr zu hoffen.
Sie hatten nicht vor, sich vor der Abreise noch einmal zu sehen. Die Hausherrin wollte ihnen jedoch einen letzten heimlichen Abschied gewähren, setzte sich über die Vorurteile der frömmelnden Stadtgemeinde hinweg und ließ Manuela, die Reitkleidung trug, durch das Stalltor ein. Nicht weil die beiden heimlich ein Liebespaar gewesen wären, denn sie waren es vor aller Augen und zum öffentlichen Skandal, sondern weil die Gastgeberin um jeden Preis den guten Ruf des Hauses wahren wollte. Er war aber noch mehr auf Anstand bedacht, befahl José Palacios sogar, die Tür zur angrenzenden Halle nicht zu schließen, durch die das Hauspersonal gehen mußte und wo die wachhabenden Adjutanten bis lange nach Ende des Besuchs Karten spielten.
Manuela las ihm zwei Stunden lang vor. Sie war bis vor kurzem, als ihr Leib die Jahre einzuholen begann, jung gewesen. Sie rauchte eine Seemannspfeife, parfümierte sich wie die Offiziere mit Verbenenwasser, trug Männerkleidung und bewegte sich meist unter Soldaten, aber ihre heisere Stimme war immer noch gut im Dämmerlicht der Liebe. Sie las im spärlichen Schein des Handleuchters und saß dabei in einem Sessel, der noch das Wappen des letzten Vizekönigs trug, während der General in Hauskleidung und mit dem Vicuña-Umhang zugedeckt auf dem Bett lag und ihr zuhörte. Nur am Rhythmus seines Atems war zu erkennen, daß er nicht schlief. Das Buch hieß Almanach der Nachrichten und Gerüchte, die im Jahre des Heils 1826 in Lima umgingen, war geschrieben von dem Peruaner Noé Calzadillas, und sie las es mit einem theatralischen Pathos vor, das gut zum Stil des Autors paßte. Eine Stunde lang war dann nichts als ihre Stimme im schlafenden Haus zu hören. Nach der letzten Wachrunde explodierte plötzlich vielstimmiges Männergelächter, das die Hunde der Nachbarschaft in Aufruhr brachte. Er öffnete die Augen, eher neugierig als beunruhigt, und sie schloß das Buch auf ihrem Schoß, den Daumen zwischen den Seiten.
»Das sind Ihre Freunde«, sagte sie.
»Ich habe keine Freunde«, sagte er. »Und falls mir ein paar geblieben sind, dann nur noch für kurze Zeit.«
»Nun, da draußen sind sie und halten Wache, damit man Sie nicht umbringt«, sagte sie.
So erfuhr der General, was die ganze Stadt wußte: Nicht nur eins, sondern mehrere Attentate wurden gegen ihn vorbereitet, und seine letzten Anhänger wachten im Haus, um sie zu verhindern. Der Eingangsflur und die Gänge um den Innengarten waren von den Husaren und Grenadieren besetzt, die allesamt Venezolaner waren und ihm bis zum Hafen von Cartagena de Indias das Geleit geben sollten, wo er an Bord eines Segelschiffs nach Europa gehen würde. Zwei von ihnen hatten ihre Schlafmatten so ausgerollt, daß sie quer vor der Haupttür des Schlafzimmers lagen, und die Adjutanten würden im Nebenraum auch noch weiterspielen, wenn Manuela zu lesen aufgehört hatte. Aber es waren nicht die Zeiten, in denen man, umgeben von so vielen Soldaten ungewisser Herkunft und unterschiedlichen Schlags, irgend etwas für sicher halten konnte. Unberührt von der schlechten Nachricht forderte er Manuela mit einer Handbewegung auf weiterzulesen.
Er hatte den Tod stets für ein unvermeidliches Berufsrisiko gehalten. Alle seine Kriege hatte er vorn in der Gefechtslinie geführt, ohne eine Schramme abbekommen zu haben, und er bewegte sich im gegnerischen Feuer mit einer so unvernünftigen Gelassenheit, daß sich sogar seine Offiziere mit der einfachen Erklärung zufriedengaben, er halte sich für unverletzbar. Er hatte jedes Attentat, das gegen ihn ausgeheckt worden war, unversehrt überstanden und war mehrmals nur deshalb mit dem Leben davongekommen, weil er nicht in seinem Bett geschlafen hatte. Er bewegte sich ohne Eskorte, aß und trank unbesorgt, was man ihm, wo auch immer, anbot. Nur Manuela wußte, daß seine Gleichgültigkeit nicht Unbedachtheit oder Fatalismus entsprang, sondern der melancholischen Gewißheit, daß er in seinem Bett sterben sollte, nackt und arm und ohne den Trost öffentlicher Dankbarkeit.
Als einzige Veränderung im Ritual der Schlaflosigkeit fiel in jener Nacht vor der Abreise auf, daß er nicht sein warmes Bad nahm, bevor er ins Bett ging. José Palacios hatte es ihm schon früh bereitet und dann bei richtiger Temperatur gehalten, es sollte dem General, wenn er danach verlangte, kraft der Heilkräuter das Abhusten erleichtern und den Körper stärken. Aber er verlangte nicht danach. Er nahm zwei Abführpillen gegen seine übliche Verstopfung und gab sich, eingelullt vom galanten Klatsch aus Lima, dem Halbschlummer hin. Plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, überkam ihn ein Hustenanfall, der die Stützbalken des Hauses zu erschüttern schien. Die Offiziere im Nebenraum unterbrachen ihr Spiel. Einer von ihnen, der Ire Belford Hinton Wilson, schaute ins Schlafzimmer, ob er gebraucht werde, und sah, wie der General quer über dem Bett auf dem Bauch lag und versuchte, sein Eingeweide zu erbrechen. Manuela hielt seinen Kopf über eine Wanne. José Palacios, der einzige, dem es erlaubt war, das Schlafzimmer ohne Anklopfen zu betreten, blieb alarmiert neben dem Bett stehen, bis die Krise vorüber war. Der General atmete tief durch, die Augen voller Tränen, und wies auf den Waschtisch.
»Das kommt von diesen Grabmalblumen«, sagte er.
Wie immer, denn er fand stets einen unvermuteten Schuldigen für sein Unglück. Manuela, die das besser als jeder andere kannte, gab José Palacios einen Wink, die Vase mit den welken Narden vom Morgen hinauszubringen. Der General legte sich wieder mit geschlossenen Augen auf das Bett, und sie nahm im gleichen Tonfall wie zuvor die Lektüre wieder auf. Erst als sie meinte, er sei eingeschlafen, legte sie das Buch auf den Nachttisch, küßte ihm die fieberglühende Stirn und flüsterte José Palacios zu, sie werde ab sechs Uhr morgens für einen letzten Abschied an der Wegkreuzung Cuatro Esquinas warten, dort, wo die Landstraße nach Honda begann. Sie hüllte sich in eine Pelerine und verließ auf Zehenspitzen das Schlafzimmer. Da öffnete der General die Augen und sagte mit schwacher Stimme zu José Palacios:
»Sag Wilson, er soll sie heimbegleiten.«
Der Befehl wurde gegen Manuelas Willen durchgeführt, die glaubte, sie allein könne sich besser schützen als jede Ulaneneskorte. José Palacios ging ihr mit einem Leuchter zu den Ställen voraus, am Innengarten mit dem Steinbrunnen entlang, wo die ersten Narden der Morgendämmerung aufblühten. Der Regen machte eine Pause, und der Wind pfiff nicht mehr durch die Bäume, aber am eisigen Himmel war kein einziger Stern. Zur Beruhigung der Wachposten, die auf den Matten im Korridor lagen, wiederholte Oberst Belford Wilson die Parole der Nacht. Als sie am Fenster des großen Salons vorbeikamen, sah José Palacios, wie der Hausherr Kaffee an eine Gruppe von Militärs und Zivilisten ausschenkte, es waren jene Freunde, die bis zum Augenblick der Abreise wachen wollten.
Als er in das Zimmer zurückkam, lag der General im Delirium. Er hörte ihn wirre Sätze reden, die alle eines meinten: »Doch niemand hat etwas verstanden.« Der Körper glühte im Scheiterhaufen des Fiebers, übelriechende Blähungen brachen kollernd daraus hervor. Der General selbst würde am nächsten Tag nicht sagen können, ob er im Schlaf gesprochen oder wach phantasiert hatte, er würde sich an nichts erinnern. Es war das, was er »meine Anfälle von Irrsinn« nannte. Niemanden versetzten sie mehr in Unruhe, da er schon über vier Jahre daran litt und man ihn am nächsten Tag stets mit ungetrübtem Verstand aus seiner Asche auferstehen sah, ohne daß je ein Arzt sich an eine wissenschaftliche Erklärung gewagt hätte. José Palacios wickelte ihn in eine Decke, ließ die brennende Lampe auf der Marmorplatte des Waschtischs stehen und verließ das Zimmer, ohne die Tür zu schließen, um im Nebenraum weiter Wache zu halten. Er wußte, der General würde sich irgendwann bei Tagesanbruch erholen und sich dann in das erkaltete Wasser der Badewanne legen, um die im Grauen der Alpträume verzehrten Kräfte wiederherzustellen.
Es war das Ende eines hitzigen Tages. Eine Garnison von 789 Husaren und Grenadieren hatte sich unter dem Vorwand erhoben, ihren seit drei Monaten überfälligen Sold einfordern zu wollen. Der wahre Grund war ein anderer: Die meisten kamen aus Venezuela, und viele hatten in den Befreiungskriegen der vier Nationen gekämpft, in den letzten Wochen jedoch waren sie auf offener Straße so oft beschimpft und provoziert worden, daß sie nicht grundlos um ihr Leben bangten, wenn der General erst einmal das Land verlassen haben würde. Der Konflikt wurde behoben, indem man Reisegelder auszahlte sowie tausend von den siebzigtausend Goldpesos, die von den Aufständischen gefordert worden waren. Am Abend waren sie in Richtung Heimat abmarschiert, gefolgt von einem Troß Lastenträgerinnen samt Kindern und Haustieren. Die Trommeln und die Militärblaskapelle waren nicht laut genug, um das Geschrei des Pöbels zum Schweigen zu bringen, der Hunde auf die Soldaten hetzte und ihnen Knallfrösche vor die Füße warf, um sie aus dem Tritt zu bringen, was bei einer feindlichen Truppe noch nie gemacht worden war. Elf Jahre zuvor war nach drei langen Jahrhunderten spanischer Herrschaft der harte Vizekönig Juan Sámano durch eben diese Straßen geflohen, als Pilger verkleidet, aber die Truhen gefüllt mit goldenen Götzenbildern und ungeschliffenen Smaragden, heiligen Tukanen und Glasscheiben, in denen Schmetterlinge aus Muzo leuchteten. Und es hatte nicht an Menschen gefehlt, die ihm von den Balkonen aus nachweinten, ihm Blumen herunterwarfen und ihm von Herzen Meeresstille und eine glückliche Fahrt wünschten.
Der General hatte heimlich an der Beilegung des Konflikts mitgewirkt, ohne das Haus des Kriegs- und Marineministers, in dem er Gast war, zu verlassen. Schließlich hatte er José Laurencio Silva, seinen angeheirateten Neffen und vertrauenswürdigen Adjutanten, zu der rebellischen Truppe geschickt, als Garantie dafür, daß es bis zur Grenze von Venezuela keine neuen Unruhen geben würde. Den Vorbeimarsch unter seinem Fenster sah er nicht, aber er hatte die Trompeten und die Trommelschläger gehört, auch den Lärm der Menge, die sich auf der Straße drängte, die Rufe aber hatte er nicht verstehen können. Er nahm sie so wenig ernst, daß er währenddessen mit seinen Schreibern die liegengebliebene Post durchging und einen Brief an den Generalfeldmarschall Don Andrés de Santa Cruz, den Präsidenten von Bolivien, diktierte, in dem er ihm seinen Rückzug aus der Regierung mitteilte, sich aber nicht eindeutig darüber äußerte, ob seine Reise ins Ausland gehen würde. »Ich werde in meinem Leben keinen einzigen Brief mehr schreiben«, sagte er, als er diesen beendet hatte. Später, als er das Fieber der Siesta ausschwitzte, drang Getöse von einem fernen Tumult in seine Träume, und er schreckte von einer Knallerei auf, die sowohl von Aufständischen wie von Feuerwerkern kommen konnte. Als er nachfragte, antwortete man ihm, das sei das Fest. Einfach so: »Das ist das Fest, mein General.« Keiner, nicht einmal José Palacios, wagte ihm zu erklären, was für ein Fest das war.
Erst am Abend, als Manuela zu Besuch kam und berichtete, erfuhr er, daß es sich um die Anhänger seiner politischen Feinde handelte, die von der Demagogen-Partei, wie er sie nannte: Sie waren durch die Straßen gezogen und hatten mit Billigung der Ordnungskräfte die Handwerksbünde gegen ihn aufgewiegelt. Es war Freitag, also Markttag, was das Durcheinander auf der Plaza Mayor begünstigte. Bei Einbruch der Nacht hatte ein ungewohnt heftiger Regen mit Blitz und Donner die Unruhestifter zerstreut. Der Schaden aber blieb. Die Studenten des Colegio de San Bartolomé hatten die Kanzleien des Obersten Gerichtshofs gestürmt, sie wollten einen öffentlichen Prozeß gegen den General erzwingen und hatten mit Bajonetten sein lebensgroßes Bild, gemalt von einem ehemaligen Fähnrich der Befreiungsarmee, zerfetzt und vom Balkon geworfen. Der von Chicha trunkene Pöbel hatte die Geschäfte auf der Calle Real und die Vorstadtkneipen geplündert, die nicht rechtzeitig geschlossen hatten, und auf der Plaza Mayor war ein General aus Sägespänekissen füsiliert worden, der auch ohne die blaue Uniformjacke mit den Goldknöpfen von jedermann erkannt wurde. Sie beschuldigten ihn, der heimliche Drahtzieher des militärischen Ungehorsams zu sein, in einem späten Versuch, die Macht zurückzugewinnen, die der Kongreß ihm nach zwölf Jahren ständiger Ausübung einstimmig entzogen hatte. Sie beschuldigten ihn, die Präsidentschaft auf Lebenszeit anzustreben und als Nachfolger einen europäischen Fürsten einsetzen zu wollen. Sie beschuldigten ihn, eine Reise ins Ausland vorzutäuschen, während er sich tatsächlich zur venezolanischen Grenze begeben werde, um von dort als Führer der aufständischen Truppen zurückzukehren und wieder an die Macht zu gelangen. Die Mauern der öffentlichen Gebäude waren mit Papierwischen tapeziert, wie der Volksmund die beleidigenden Pasquille nannte, die gegen ihn gedruckt wurden, und seine bekanntesten Parteigänger hielten sich in fremden Häusern versteckt, bis die Gemüter sich beruhigt hatten. Die auf General Francisco de Paula Santander, seinen Hauptgegner, eingeschworene Presse, hatte sich das Gerücht zu eigen gemacht, seine unbekannte Krankheit, um die soviel Lärm gemacht wurde, sowie die nachdrücklichen Hinweise darauf, daß er gehe, seien schlichte politische Winkelzüge, damit man ihn bitte, nicht zu gehen. An jenem Abend, während Manuela Sáenz ihm Einzelheiten des stürmischen Tages berichtete, waren die Soldaten des Interimspräsidenten bemüht, eine mit Kohle an das erzbischöfliche Palais geschriebene Parole zu entfernen: »Weder geht er, noch stirbt er.« Der General seufzte auf.
»Es muß schon sehr schlecht um alles bestellt sein«, sagte er, »und schlechter noch um mich, wenn nur eine Straße weiter so etwas geschehen konnte und ich mir weismachen ließ, es sei ein Fest.«
Die Wahrheit war, daß selbst seine engsten Freunde nicht glaubten, daß er Abschied nehmen wollte, weder von der Macht noch vom Land. Die Stadt war zu klein und ihre Menschen zu große Topfgucker, um nicht die beiden klaffenden Lücken bei seiner vagen Reiseplanung zu kennen: Er hatte nicht genügend Geld, um mit einem so zahlreichen Gefolge irgendwohin zu gelangen, und er durfte als ehemaliger Präsident der Republik ohne Regierungserlaubnis nicht vor Ablauf eines Jahres das Land verlassen, wobei er nicht einmal listig genug gewesen war, ein Gesuch einzureichen. Der Befehl zu packen, den er derart auffällig gegeben hatte, daß ihn jeder, der wollte, hören konnte, wurde nicht einmal von José Palacios als eindeutiger Beweis angesehen, da der General bei anderen Gelegenheiten sogar soweit gegangen war, ein ganzes Haus leerzuräumen, um den Aufbruch vorzutäuschen, was sich dann jedesmal als ein geschicktes politisches Manöver erwiesen hatte. Seine Adjutanten spürten, daß die Anzeichen der Entmutigung im vergangenen Jahr überdeutlich geworden waren. Jedoch hatten sie schon in anderen Fällen erlebt, wie er, wenn sie es am wenigsten erwarteten, mit neuem Mut aufwachte und mit mehr Schwung als zuvor den Faden des Lebens wiederaufnahm. José Palacios, der diese unvorhersehbaren Umschwünge stets aus der Nähe verfolgen konnte, sagte es auf seine Weise: »Was mein Herr denkt, weiß nur mein Herr.«
Seine wiederholten Rücktritte waren in die Volkslieder eingegangen, seit jenem frühesten Rücktritt, den er mit einem zweideutigen Satz schon in seiner Antrittsrede als Präsident angekündigt hatte: »Mein erster Friedenstag wird mein letzter Tag an der Macht sein.« In den folgenden Jahren hatte er so oft und unter so verschiedenen Umständen abgedankt, daß man nie wissen konnte, ob es ihm ernst war. Der aufsehenerregendste Rücktritt hatte zwei Jahre zuvor stattgefunden, in der Nacht vom 25. September, als er unverletzt einem Komplott entging, bei dem er im Schlafzimmer des Regierungspalastes ermordet werden sollte. Eine Abordnung des Kongresses, die ihn am frühen Morgen aufsuchte, fand ihn, der sechs Stunden ohne Mantel unter einer Brücke gesessen hatte, in eine Wolldecke gehüllt vor, die Füße in einer Wanne mit heißem Wasser, doch weniger vom Fieber als von der Enttäuschung mitgenommen. Er erklärte, das Komplott werde nicht untersucht, niemandem werde der Prozeß gemacht und der für das neue Jahr vorgesehene Kongreß solle sofort zusammentreten, um einen neuen Präsidenten für die Republik zu wählen.
»Danach«, schloß er, »werde ich Kolumbien für immer verlassen.«
Dennoch fand eine Untersuchung statt, die Schuldigen wurden nach einem ehernen Gesetz verurteilt und vierzehn auf der Plaza Mayor füsiliert. Die verfassunggebende Versammlung vom 2. Januar kam erst sechzehn Monate später zusammen, und niemand sprach je wieder von Rücktritt. Doch gab es in jener Epoche keinen Besucher aus dem Ausland noch einen zufälligen Gast oder einen vorbeikommenden Freund, dem er nicht gesagt hätte: »Ich gehe, wohin man mich haben will.«
Die öffentlichen Verlautbarungen, er sei todkrank, wurden auch nicht als gültiger Hinweis darauf, daß er abreiste, angesehen. Niemand zweifelte an seinem Leiden. Im Gegenteil, bei seiner letzten Rückkehr aus den Kriegen im Süden hatte die Ahnung, daß er nur zum Sterben kam, jeden durchschauert, der ihn unter Blumenbögen einreiten sah. Statt auf Palomo Blanco, seinem legendären Pferd, saß er auf einem kahlgescheuerten Maultier mit Schilfschabracken, seine Haare waren ergraut und die Stirn unruhig umwölkt, die Uniformjacke schmutzig und eine Ärmelnaht aufgerissen. Der Ruhm hatte seinen Körper verlassen. Bei dem schweigsamen Empfang, der ihm an jenem Abend im Regierungspalast bereitet wurde, blieb er in sich gekehrt, und es wurde nie bekannt, ob er aus politischer Böswilligkeit oder aus schlichter Unachtsamkeit einen seiner Minister mit dem Namen eines anderen begrüßte.
Sein endzeitliches Gebaren genügte nicht, sie glauben zu lassen, daß er abtrat, da es nun schon seit sechs Jahren hieß, er liege in den letzten Zügen, während er unvermindert seinen Führungsanspruch aufrechterhielt. Die erste Nachricht hatte ein Offizier der britischen Marine mitgebracht, der ihm mitten im Befreiungskrieg des Südens zufällig in der Einöde von Pativilca, nördlich von Lima, begegnet war. Er fand ihn auf dem Boden einer elenden Hütte liegen, die als improvisiertes Hauptquartier diente, er war in einen Umhang aus Barchent gehüllt und hatte einen Lappen um den Kopf gewickelt, denn er ertrug die Kälte seiner Knochen in der Hölle des Mittags nicht und hatte nicht einmal Kraft genug, die Hühner zu verscheuchen, die um ihn herum pickten. Nach einem mühseligen Gespräch, das durchkreuzt war von Böen des Wahns, verabschiedete er den Besucher mit ergreifender Dramatik:
»Gehen Sie und erzählen Sie der Welt, wie Sie mich von Hühnern bekackt an diesem ungastlichen Gestade haben sterben sehen.«
Es hieß, er leide an einem vom Sengen der Wüstensonne verursachten Scharlachfieber. Später hieß es, er liege in Guayaquil im Sterben, dann in Quito, mit einem gastrischen Fieber, dessen beunruhigendes Symptom die Teilnahmslosigkeit gegenüber der Welt und völlige Ruhe des Geistes sei. Niemand erfuhr, auf welchen medizinischen Erkenntnissen solche Nachrichten fußten, da er stets ein Gegner der ärztlichen Wissenschaft gewesen war und sich selbst die Diagnosen und Rezepte ausstellte, gestützt auf La médicine à votre manière von Donostierre, ein französisches Handbuch der Hausmittel, das José Palacios überallhin mitnahm, gleichsam als Orakel, um jedwedes körperliche oder seelische Übel zu erkennen und zu heilen.
Wie auch immer, es hat kaum eine fruchtbarere Agonie als die seine gegeben. Denn während man glaubte, er sterbe in Pativilca, überquerte er ein weiteres Mal den Kamm der Anden, siegte in Junín, vollendete die Befreiung ganz Spanisch-Amerikas mit dem endgültigen Sieg in Ayacucho, schuf die Republik Bolivien und war dann noch in Lima so glücklich, wie er es im Siegestaumel nie gewesen war und nie wieder sein sollte. Daher waren die wiederholten Ankündigungen, er verzichte, da er krank sei, endlich auf die Macht und ginge außer Landes, nicht mehr als zwanghafte Reprisen eines Dramas, das zu oft gesehen worden war, um glaubhaft zu sein.
Wenige Tage nach seiner Rückkehr, am Ende einer heftigen Regierungssitzung, hatte er den Marschall Antonio José de Sucre am Arm genommen. »Sie bleiben bei mir«, sagte er zu ihm. Er führte ihn in sein persönliches Arbeitszimmer, in dem er nur wenige Auserwählte empfing, und zwang ihn fast, in seinem eigenen Sessel Platz zu nehmen.
»Dieser Platz gehört Ihnen bereits mehr als mir«, sagte er.
Der Generalfeldmarschall der Schlacht von Ayacucho, sein engster Freund, wußte genau über die Lage des Landes Bescheid, dennoch lieferte ihm der General einen detaillierten Überblick, bevor er auf seine Absichten zu sprechen kam. In wenigen Tagen sollte sich der verfassunggebende Kongreß versammeln, um den Präsidenten der Republik zu wählen und eine neue Verfassung zu verabschieden – ein später Versuch, den goldenen Traum von der kontinentalen Einheit zu retten. Peru, in der Hand einer rückschrittlichen Aristokratie, schien endgültig verloren. General Andrés de Santa Cruz hatte Bolivien an der Kandare und ging seinen eigenen Weg. Venezuela hatte eben unter der Herrschaft von General José Antonio Páez seine Autonomie erklärt. General Juan José Flores, Generalpräfekt des Südens, hatte Guayaquil und Quito zusammengeführt, um die unabhängige Republik Ekuador zu gründen. Die Republik Kolumbien, erste Keimzelle eines unermeßlich großen und einigen Vaterlands, blieb auf das ehemalige Vizekönigtum von Neugranada reduziert. Sechzehn Millionen Amerikaner, kaum ins freie Leben entlassen, waren der Willkür ihrer örtlichen Caudillos ausgeliefert.
»Kurz«, schloß der General, »alles, was wir mit den Händen aufgebaut haben, bringen die anderen mit den Füßen durcheinander.«
»Das ist der Hohn des Schicksals«, sagte Marschall Sucre. »Es sieht so aus, als hätten wir das Ideal der Unabhängigkeit so tief eingepflanzt, daß diese Völker jetzt versuchen, auch voneinander unabhängig zu werden.«
Der General reagierte vehement.
»Wiederholen Sie nicht das Geschwätz des Feindes«, sagte er, »selbst wenn es mal zutrifft wie hier.« Marschall Sucre entschuldigte sich. Er war intelligent, ordentlich, schüchtern und abergläubisch, und sein Gesicht war von einer Sanftheit, die auch die alten Pockennarben nicht mindern konnten. Der General, der ihn so liebte, hatte gesagt, er täusche Bescheidenheit vor, ohne sie zu haben. Er war der Held von Pichincha, Tumusla, Tarqui und hatte mit gerade neunundzwanzig Jahren die siegreiche Schlacht von Ayacucho angeführt, bei der die letzte spanische Bastion in Südamerika weggefegt wurde. Mehr noch als dieser Verdienste wegen zeichnete er sich aber durch seine Barmherzigkeit beim Siegen und durch sein Talent zum Staatsmann aus. Zu jener Zeit hatte er auf alle seine Ämter verzichtet und lief nun ohne militärisches Gehabe in einem knöchellangen schwarzen Tuchmantel herum, mit stets hochgeschlagenem Kragen, um sich besser vor den schneidenden Eiswinden von den nahen Bergen zu schützen. Seine einzige Verpflichtung der Nation gegenüber, und seinem Wunsch nach auch die letzte, war, als Abgeordneter von Quito an der verfassunggebenden Versammlung teilzunehmen. Er war gerade fünfunddreißig geworden, hatte eine eiserne Gesundheit und brannte vor Liebe zu Doña Mariana Carcelén, der Marquise von Solanda, einer schönen, sehr jungen und übermütigen Frau aus Quito, die er zwei Jahre zuvor durch Ferntrauung geheiratet und von der er eine sechsmonatige Tochter hatte.
Der General konnte sich für das Präsidentenamt der Republik keinen fähigeren Nachfolger als ihn vorstellen. Er wußte, daß Sucre noch fünf Jahre bis zum vorgeschriebenen Alter fehlten, aufgrund einer einschränkenden Bestimmung, die General Rafael Urdaneta in die Verfassung eingebracht hatte, um ihm den Weg zu versperren. Der General führte jedoch gerade vertrauliche Verhandlungen, um die Änderung zu ändern.
»Nehmen Sie an«, sagte er, »dann bleibe ich als Generalissimus und mache meine Runden um die Regierung wie ein Stier um die Kuhherde.«
Er sah hinfällig aus, doch seine Entschlossenheit überzeugte. Aber der Marschall wußte schon seit langem, daß der Sessel, auf dem er jetzt saß, nie der seine werden würde. Kurze Zeit zuvor, als ihm zum ersten Mal die Möglichkeit, Präsident zu werden, eröffnet wurde, hatte er gesagt, er werde nie eine Nation regieren, deren Regierungssystem und Kurs ihm immer verhängnisvoller erschienen. Seiner Meinung nach mußte der erste Schritt zur Besserung sein, das Militär von der Macht fernzuhalten. Darum wollte er dem Kongreß vorschlagen, daß in den kommenden vier Jahren kein General Präsident werden dürfe, vielleicht in der Absicht, Urdaneta den Weg zu versperren. Doch die stärksten Gegner dieser Gesetzesänderung würden auch die Stärksten sein: die Generäle selbst.
»Ich bin zu müde, um ohne Kompaß zu arbeiten«, sagte Sucre. »Außerdem wissen Sie so gut wie ich, Exzellenz, daß hier kein Präsident gebraucht wird, sondern ein Bändiger von Revolten.«
Er werde selbstverständlich an der verfassunggebenden Versammlung teilnehmen und würde auch die Ehre annehmen zu präsidieren, falls man ihm das anböte. Aber nichts mehr. Vierzehn Jahre Krieg hatten ihn gelehrt, daß es keinen größeren Sieg gab, als zu leben. Das Präsidentenamt in Bolivien, jenem weiten und unerforschten Land, von ihm gegründet und mit weiser Hand regiert, hatte ihn gelehrt, daß die Macht wetterwendisch war. Die Klugheit seines Herzens hatte ihn die Nutzlosigkeit des Ruhms gelehrt. »Deshalb, Exzellenz: Nein«, schloß er. Am 13. Juni, dem Tag des Heiligen Antonius, wollte er bei seiner Frau und seiner Tochter in Quito sein, um mit ihnen nicht nur diesen Namenstag zu feiern, sondern alle weiteren, die ihm das Schicksal gewähren würde. Denn sein Entschluß, für sie, nur für sie in den Wonnen der Liebe zu leben, war seit vergangener Weihnacht gefaßt.
»Das ist alles, was ich mir vom Leben wünsche«, sagte er.
Der General war bleich geworden. »Ich dachte, es könnte mich nichts mehr in Staunen versetzen«, sagte er. Und sah ihm in die Augen:
»Ist das Ihr letztes Wort?«
»Das vorletzte«, sagte Sucre. »Das letzte ist meine ewige Dankbarkeit für Ihre Güte, Exzellenz.«
Der General schlug sich auf den Schenkel, um sich selbst aus einem uneinlösbaren Traum zu wecken.
»Gut«, sagte er. »Sie haben gerade die letzte Entscheidung meines Lebens für mich getroffen.«
In jener Nacht setzte er seine Rücktrittserklärung auf, unter der demoralisierenden Wirkung eines Brechmittels, das ihm irgendein Arzt zur Beruhigung der Galle verschrieben hatte. Am 20. Januar eröffnete er die verfassunggebende Versammlung mit einer Abschiedsrede, in der er ihren Präsidenten, den Marschall Sucre, als den würdigsten der Generale rühmte. Das Lob löste im Kongreß eine Ovation aus, ein Abgeordneter aber, der in der Nähe von Urdaneta stand, flüsterte diesem ins Ohr: »Das heißt, es gibt einen General, der würdiger ist als Sie.« Der Satz des Generals und die Boshaftigkeit des Abgeordneten bohrten sich wie zwei glühende Nägel ins Herz von General Rafael Urdaneta.
Zu Recht. Wenn Urdaneta auch nicht die ungeheuren militärischen Verdienste Sucres noch dessen Überzeugungskraft hatte, so gab es doch keinen Grund zur Annahme, er sei weniger würdig. Seine Ruhe und seine Stete waren von dem General selbst hervorgehoben worden, seine Treue und Zuneigung zu ihm waren hinlänglich erprobt, und er war einer der wenigen Menschen, die den Mut hatten, ihm die Wahrheiten, vor denen er sich fürchtete, ins Gesicht zu sagen. Der General war sich des Ausrutschers bewußt und versuchte, ihn in den Druckfahnen zu korrigieren, statt der »würdigste der Generale« schrieb er eigenhändig »einer der würdigsten«. Die Verbesserung milderte nicht den Groll.
Tage später, bei einem Treffen des Generals mit befreundeten Abgeordneten, beschuldigte ihn Urdaneta, die Abreise nur vorzutäuschen, insgeheim aber eine Wiederwahl anzustreben. Drei Jahre zuvor war General José Antonio Páez im Departement Venezuela gewaltsam an die Macht gekommen, ein erster Versuch, das Territorium von Kolumbien zu trennen. Daraufhin hatte sich der General nach Caracas begeben, sich mit Páez unter Jubelgesängen und Glockengeläut öffentlich umarmt und versöhnt und ihm dann ein Ausnahmeregime nach Maß geschneidert, das Páez nach Laune zu herrschen erlaubte. »Das war der Anfang vom Ende«, sagte Urdaneta. Denn diese Willfährigkeit hatte nicht nur die Beziehungen zu den Granadinern endgültig vergiftet, sondern auch diese mit dem Keim der Trennung infiziert. Jetzt, schloß Urdaneta, war der beste Dienst, den der General dem Vaterland erweisen konnte, ohne Verzug vom Laster der Herrschsucht zu lassen und außer Landes zu gehen. Der General erwiderte mit gleicher Heftigkeit. Doch Urdaneta war ein rechtschaffener Mann, er redete flüssig und leidenschaftlich und hinterließ bei allen den Eindruck, den Untergang einer großen und alten Freundschaft miterlebt zu haben.
Der General bekräftigte seinen Rücktritt und ernannte Don Domingo Caycedo zum Übergangspräsidenten, bis der Kongreß den Amtsträger gewählt haben würde. Am ersten März verließ er den Regierungssitz durch den Dienstboteneingang, um nicht den Gästen zu begegnen, die seinen Nachfolger mit einem Glas Champagner willkommen hießen, fuhr in einer fremden Kutsche zu dem Landsitz Fucha, einem idyllischen Ruhesitz am Rande der Stadt, den der vorläufige Präsident ihm zur Verfügung gestellt hatte. Allein das Wissen, nur noch ein einfacher Bürger zu sein, verschärfte die verheerende Wirkung des Brechmittels. Im Wachtraum bat er José Palacios, ihm das Notwendige zu beschaffen, damit er seine Memoiren beginnen könne. José Palacios brachte ihm genug Tinte und Papier für vierzig Jahre Erinnerungen, und der General gab Fernando, seinem Neffen und Schreiber, Bescheid, ihm ab kommenden Montag um vier Uhr früh zur Verfügung zu stehen, da das für ihn die beste Uhrzeit zum Nachdenken war, dann, wenn die Bitterkeit aufbrach. Wie er dem Neffen mehrmals erklärt hatte, wollte er mit seiner ältesten Erinnerung beginnen, das war ein Traum, den er kurz nach seinem dritten Geburtstag auf der Hacienda San Mateo in Venezuela gehabt hatte. Er hatte geträumt, daß ein schwarzer Maulesel mit einem goldenen Gebiß ins Haus eingedrungen und, während die Familie und die Sklaven Siesta hielten, vom großen Salon bis in die Speisekammer gelaufen war: Er hatte ohne Hast alles gefressen, was ihm in den Weg gekommen war, bis er am Ende die Gardinen aufgefressen hatte, die Teppiche, die Lampen, die Vasen, das Geschirr und Besteck im Eßzimmer, die Heiligen von den Altären, die Kleiderschränke und Truhen mit allem, was darin war, die Töpfe in den Küchenräumen, die Türen und Fenster mit Scharnieren und Riegeln und alle Möbel von der Eingangshalle bis zu den Schlafzimmern; das einzige, was er unberührt ließ, war das Oval vom Toilettenspiegel seiner Mutter, es schwebte im Raum.
Er fühlte sich jedoch so wohl in dem Haus in Fucha, und die Luft war so sanft unter einem Himmel mit schnellziehenden Wolken, daß er nicht mehr von den Memoiren sprach, sondern die frühen Morgenstunden dazu nutzte, auf duftenden Pfaden durch die Grassteppe zu laufen. Wer ihn in den folgenden Tagen besuchte, hatte den Eindruck, er habe sich erholt. Vor allem die Militärs, seine treuesten Freunde, drängten ihn, im Präsidentenamt zu bleiben, und sei es durch einen Putsch. Er entmutigte sie mit dem Argument, Macht durch Gewalt sei seines Ruhms unwürdig, schien aber selbst die Hoffnung nicht aufzugeben, durch eine legitime Entscheidung des Kongresses im Amt bestätigt zu werden. José Palacios wiederholte: »Was mein Herr denkt, weiß nur mein Herr.«
Manuela wohnte weiterhin ein paar Schritte entfernt vom Palast San Carlos, dem Wohnsitz der Präsidenten, und hatte ein aufmerksames Ohr für die Stimmen auf der Straße. Sie erschien zwei- oder dreimal die Woche in Fucha, auch öfter, wenn etwas Dringendes vorlag, beladen mit Marzipan und warmem Gebäck aus den Klöstern und Schokoladenstangen mit Zimt für den Vier-Uhr-Imbiß. Nur selten brachte sie Zeitungen mit, denn der General war so empfindlich gegen Kritik geworden, daß irgendein banaler Einwand ihn aus dem Gleichgewicht brachte. Statt dessen berichtete sie ihm das Kleingedruckte der Politik, die Salonbosheiten, die Orakel der Gerüchteküchen, und er mußte sich all das mit verkrampften Gedärmen anhören, da sie der einzige Mensch war, dem er die Wahrheit zugestand. Wenn sie sich nicht viel zu sagen hatten, gingen sie die Korrespondenz durch, oder sie las ihm vor, oder sie spielten mit den Adjutanten Karten, zu Mittag aber aßen sie stets allein.
Er hatte sie vor acht Jahren in Quito kennengelernt, auf einem Galaball zur Feier der Befreiung, als sie noch die Frau von Doktor James Thorne war, eines Engländers, der gegen Ende des Vizekönigtums in die Aristokratie von Lima aufgenommen worden war. Abgesehen davon, daß sie die letzte Frau war, mit der ihn seit dem Tod seiner Frau vor siebenundzwanzig Jahren eine dauerhafte Liebe verband, war sie auch seine Vertraute, die Hüterin seiner Archive und seine gefühlvollste Vorleserin, außerdem gehörte sie im Rang eines Obersten seinem Generalstab an. Weit zurück lagen die Zeiten, in denen sie ihm bei einem eifersüchtigen Streit mit einem Biß fast ein Ohr verstümmelt hatte, aber ihre trivialsten Gespräche konnten sich immer noch zu den Haßausbrüchen und sanften Kapitulationen, die großer Liebe eigen sind, auswachsen. Manuela blieb nicht zum Schlafen. Sie ging beizeiten, um nicht, gerade in dieser Jahreszeit der flüchtigen Abenddämmerungen, unterwegs von der Nacht überrascht zu werden.
Ganz anders als damals auf dem Landhaus La Magdalena bei Lima, wo er sich Vorwände ausdenken mußte, um sie fernzuhalten, während er sich mit Damen der Gesellschaft vergnügte und mit anderen, die das eher nicht waren, zeigte er im Landhaus von Fucha Anzeichen, nicht ohne sie leben zu können. Er beobachtete lange den Weg, auf dem sie kommen mußte, machte José Palacios damit verrückt, daß er ihn jeden Augenblick nach der Uhrzeit fragte, ihn bat, den Sessel an einen anderen Platz zu rücken, das Feuer im Kamin anzufachen, zu löschen, wieder anzuzünden, er war ungeduldig und übellaunig, bis er die Kutsche hinter den Hügeln auftauchen sah und sein Leben licht wurde. Doch zeigte er Anzeichen der gleichen Unruhe, wenn der Besuch sich länger als vorhergesehen ausdehnte. Zur Siestazeit legten sie sich ins Bett, ohne die Türe zu schließen, ohne sich auszuziehen und ohne zu schlafen, und begingen mehr als einmal den Fehler, ein letztes Liebesspiel zu versuchen, denn er hatte nicht mehr den Körper, um seiner Seele zu genügen, und weigerte sich, das einzugestehen.
Seine hartnäckige Schlaflosigkeit war in jenen Tagen unberechenbar geworden. Er schlief zu jeder Tageszeit ein, mitten im Satz, wenn er Briefe diktierte, beim Kartenspiel, und er wußte selbst nicht genau, ob es sich um kurze Schlafstöße oder um flüchtige Ohnmachten handelte, legte er sich aber hin, fühlte er sich sofort wie geblendet von einem Anfall hellen Wachseins. Kaum war es ihm gelungen, im Morgengrauen in einen sumpfigen Halbschlaf zu fallen, da weckte ihn schon wieder der friedliche Wind in den Bäumen. Dann konnte er nicht der Versuchung widerstehen, das Diktat seiner Memoiren auf den nächsten Morgen zu verschieben und statt dessen einen einsamen Spaziergang zu unternehmen, der sich manchmal bis zum Mittagessen ausdehnte.
Er brach ohne Eskorte auf, ohne die beiden treuen Hunde, die ihn manchmal sogar bis aufs Schlachtfeld begleitet hatten, ohne eines seiner vielgerühmten Pferde, die bereits an das Husarenbataillon verkauft waren, um die Reisekasse aufzubessern. Zum nahen Fluß ging er über eine Decke aus modrigen Blättern der endlosen Alleen, vor den eisigen Steppenwinden schützte ihn sein Vicuña-Poncho, die Stiefel mit einem Innenfutter aus roher Wolle und die grüne Seidenmütze, die er früher nur zum Schlafen benutzt hatte. Er setzte sich in den Schatten der untröstlichen Weiden vor die kleine Brücke mit den losen Planken und sann lange nach, in das strömende Wasser vertieft, das er einmal mit dem Schicksal der Menschen verglichen hatte, ein Gleichnis ganz nach Art von Don Simón Rodríguez, dem Lehrmeister seiner Jugend. Unauffällig folgte ihm eine seiner Wachen, bis er vom Tau durchnäßt zurückkam, so wenig Atem in der Brust, daß er kaum noch die Stufen zum Portal schaffte, abgezehrt und verwirrt, doch mit den Augen eines glücklichen Toren. Er fühlte sich derart wohl bei der Flucht in diese Spaziergänge, daß die hinter Bäumen versteckten Wachen ihn Soldatenlieder singen hörten wie in den Jahren seiner legendären Siege und homerischen Niederlagen. Wer ihn besser kannte, fragte sich nach dem Grund seiner guten Laune, da selbst Manuela daran zweifelte, daß ihn noch einmal der verfassunggebende Kongreß, den er selbst vortrefflich nannte, als Präsident der Republik bestätigen würde.
Am Tag der Wahl sah er auf seinem morgendlichen Spaziergang einen herrenlosen Jagdhund, der zwischen den Hecken die Wachteln aufstöberte. Er pfiff ihn scharf an, und das Tier blieb auf der Stelle stehen, suchte mit gespitzten Ohren und entdeckte die Gestalt mit dem fast am Boden schleifenden Poncho und der Mütze eines florentinischen Prälaten, gottverlassen zwischen ungestümen Wolken und der unendlichen Ebene. Während er ihm das Fell mit den Fingerspitzen streichelte, beschnupperte der Hund ihn gründlich, sprang dann aber plötzlich beiseite, schaute ihm mit seinen goldenen Augen in die Augen, knurrte mißtrauisch und floh entsetzt. Der General folgte ihm auf einem unbekannten Pfad, verlor dabei die Orientierung und fand sich auf den matschigen Straßen eines Vororts zwischen Lehmhäusern mit roten Ziegeldächern wieder. Aus den Höfen stieg der Dunst vom Melken auf. Plötzlich hörte er den Ruf:
»Longanizo!«
Es blieb ihm keine Zeit, einem Kuhfladen auszuweichen, der aus irgendeinem Stall auf ihn geworfen wurde, das Geschoß platzte mitten auf seiner Brust und spritzte ihm bis ins Gesicht. Aber der Ruf und nicht die kotige Sprengladung weckte ihn aus der Betäubung, in der er sich befand, seitdem er das Haus der Präsidenten verlassen hatte. Er kannte diesen Spitznamen, den ihm die Granadiner gegeben hatten, der Spitzname eines stadtbekannten Trottels, der in seinen Talmi-Uniformen den Hanswurst spielte. Sogar ein Senator, einer von denen, die sich als liberal ausgaben, hatte ihn im Kongreß in seiner Abwesenheit so genannt, und nur zwei andere waren aufgestanden und hatten protestiert. Aber er hatte es nie am eigenen Leib erfahren. Er begann, sich das Gesicht mit dem Zipfel des Ponchos zu säubern, und war damit noch nicht fertig, als der Leibwächter, der ihm unbemerkt gefolgt war, zwischen den Bäumen mit blankem Degen hervorkam, um die Beleidigung zu ahnden. Der General versengte ihn mit einem cholerischen Blitz.
»Und was, zum Teufel, tun Sie hier?« fragte er.
Der Offizier salutierte.
»Ich erfülle Befehle, Exzellenz.«
»Ich bin nicht Ihre Exzellenz«, erwiderte er.
Er degradierte ihn und entband ihn so voller Zorn all seiner Pflichten, daß der Offizier sich glücklich schätzen konnte, weil härtere Repressalien nicht mehr in der Macht des Generals lagen. Sogar José Palacios, der ihn doch so gut verstand, fiel es schwer, diese Strenge zu begreifen.
Es war ein schlechter Tag. Den Vormittag über strich er mit der gleichen Unruhe durchs Haus, mit der er auf Manuela zu warten pflegte, doch blieb niemandem verborgen, daß er sich diesmal nicht nach ihr, sondern nach Neuigkeiten vom Kongreß verzehrte. Er versuchte, den Ablauf der Sitzung Minute für Minute genau nachzuvollziehen. Als José Palacios ihm antwortete, es sei zehn Uhr, sagte er: »Mögen die Demagogen auch noch soviel schnauben, der Wahlgang muß bereits begonnen haben.« Später, nachdem er lange überlegt hatte, fragte er sich laut: »Wer kann schon wissen, was ein Mann wie Urdaneta denkt?« José Palacios wußte, daß der General es wußte, denn Urdaneta hatte nicht aufgehört, allenthalben die Gründe und das Ausmaß seiner Verbitterung zu verkünden. Als José Palacios wieder einmal an ihm vorbeikam, fragte ihn der General beiläufig: »Was meinst du, für wen stimmt Sucre?« José Palacios wußte so gut wie er, daß Marschall Sucre nicht wählen konnte, weil er in jenen Tagen mit Hochwürden José María Estévez, dem Bischof von Santa Marta, nach Venezuela gereist war, um im Auftrag des Kongresses die Bedingungen für die Trennung auszuhandeln. Also blieb er gar nicht erst stehen: »Sie wissen das besser als jeder andere, Herr«, antwortete er. Der General lächelte zum ersten Mal, seitdem er von dem abscheulichen Spaziergang zurückgekehrt war.