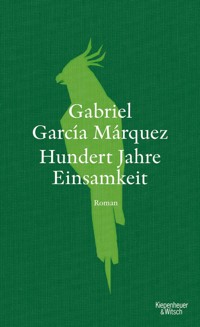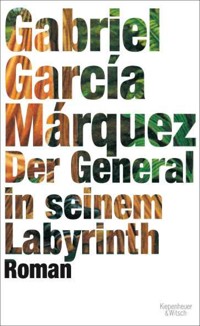19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über die Liebe, wie nur Gabriel García Márquez sie schreiben konnte. Jedes Jahr fährt Ana Magdalena Bach im August mit der Fähre zu einer Karibikinsel, um dort auf das Grab ihrer Mutter einen Gladiolenstrauß zu legen. Jedes Jahr geht sie danach in ein Touristenhotel und isst abends allein an der Bar ein Käse-Schinken-Toast. Dieses Mal jedoch wird sie von einem Mann zu einem Drink eingeladen. Es entspricht weder ihrer Herkunft oder Erziehung noch ihrer Vorstellung von ehelicher Treue, doch geht sie dennoch auf seine Avancen ein und nimmt den Unbekannten mit auf ihr Zimmer. Das Erlebnis hat sie und ihr Leben verändert. Und so fährt sie im August des kommenden Jahres wieder erwartungsvoll auf die Insel, um nicht nur das Grab ihrer Mutter zu besuchen. Wie immer bei Gabriel García Márquez faszinieren die kunstvolle Figurenzeichnung, die bilderreichen und atmosphärisch dichten Beschreibungen sowie die Musikalität der Sprache. »Wir sehen uns im August« ist ein kleines Kunstwerk, das sowohl García-Márquez-Fans als auch neue Leserinnen und Leser begeistern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Wir sehen uns im August
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Jurastudium zunächst als Journalist. García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Seit der Veröffentlichung von »Hundert Jahre Einsamkeit« gilt er als einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Schriftsteller der Welt. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez starb 2014 in Mexico City.
Dagmar Ploetz, geboren 1946 in Herrsching, übersetzt seit 1983 u.a. Werke von Isabel Allende, Julián Ayesta, Rafael Chirbes, Manuel Puig, Mario Vargas Llosa und Gabriel García Márquez. 2012 wurde sie mit dem Münchner Übersetzerpreis ausgezeichnet. 2010 erschien von ihr »Gabriel García Márquez. Leben und Werk« bei Kiepenheuer & Witsch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eine Geschichte über die Liebe, wie nur Gabriel García Márquez sie schreiben konnte.
Jedes Jahr fährt Ana Magdalena Bach im August mit der Fähre zu einer Karibikinsel, um dort auf das Grab ihrer Mutter einen Gladiolenstrauß zu legen. Jedes Jahr geht sie danach in ein Touristenhotel und isst abends allein an der Bar ein Käse-Schinken-Toast. Dieses Mal jedoch wird sie von einem Mann zu einem Drink eingeladen. Es entspricht weder ihrer Herkunft oder Erziehung noch ihrer Vorstellung von ehelicher Treue, doch geht sie dennoch auf seine Avancen ein und nimmt den Unbekannten mit auf ihr Zimmer.
Das Erlebnis hat sie und ihr Leben verändert. Und so fährt sie im August des kommenden Jahres wieder erwartungsvoll auf die Insel, um nicht nur das Grab ihrer Mutter zu besuchen.
Wie immer bei Gabriel García Márquez faszinieren die kunstvolle Figurenzeichnung, die bilderreichen und atmosphärisch dichten Beschreibungen sowie die Musikalität der Sprache. »Wir sehen uns im August« ist ein kleines Kunstwerk, das sowohl García-Márquez-Fans als auch neue Leserinnen und Leser begeistern wird.
Inhaltsverzeichnis
Signatur des Autors
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Anmerkung des Herausgebers
Vorwort
Der Gedächtnisverlust, unter dem unser Vater in seinen letzten Jahren litt, traf, wie man sich vorstellen kann, uns alle sehr hart. Vor allem für ihn war die Tatsache, dass dieser Verlust ihn daran hinderte, mit der gewohnten Sorgfalt und Stringenz zu schreiben, eine Quelle des Ärgers und der Verzweiflung. Er hat es uns einmal mit der Klarheit und Genauigkeit eines großen Schriftstellers gesagt: »Die Erinnerung ist zugleich mein Rohstoff und mein Werkzeug. Ohne sie ist alles dahin.«
Wir sehen uns im August ist das Ergebnis einer letzten Anstrengung, auch gegen Wind und Wetter weiterhin schöpferisch tätig zu sein. Der Schreibprozess war ein Wettlauf zwischen dem Perfektionismus des Sprachkünstlers und seinen schwindenden geistigen Kräften. Das lange Hin und Her der vielen Textversionen beschreibt unser Freund Cristóbal Pera in seinen Anmerkungen zu dieser Ausgabe sehr viel besser, als wir es könnten. Wir kannten damals nur Gabos abschließendes Urteil: »Dieses Buch taugt nichts. Es muss vernichtet werden.«
Wir haben es nicht vernichtet, wir haben es beiseitegelegt – in der Hoffnung, dass die Zeit darüber entscheidet, was zu tun ist. Fast zehn Jahre nach seinem Tod haben wir den Text erneut gelesen und entdeckt, dass er sehr viel und viel Genussreiches zu bieten hat. In der Tat fehlt ihm der Feinschliff von Gabos großen Büchern, er weist ein paar Stolperstellen und gewisse Unstimmigkeiten auf, nichts jedoch, was daran hindern würde, auch hier zu genießen, was Gabos Werk auszeichnet: seine Erfindungskraft, die Poesie der Sprache, das fesselnde Erzählen, sein Menschenbild und die Zuneigung, mit der er sich den Erlebnissen seiner Figuren und deren Missgeschicken, insbesondere in der Liebe, widmet. Die Liebe – vielleicht das zentrale Thema seines gesamten Werks.
Da wir das Buch nun sehr viel besser fanden als erinnerlich, kamen wir auf einen neuen Gedanken: Ebendie eingeschsränkten Fähigkeiten, die unserem Vater nicht erlaubten, das Buch zu einem Ende zu bringen, hinderten ihn auch daran zu erfassen, wie gut es ungeachtet seiner kleinen Mängel war. Es war ein Akt des Verrats, als wir beschlossen, über alle anderen Erwägungen die Freude seiner Leser zu stellen. Wenn es ihnen gefällt, wird Gabo uns womöglich verzeihen.
Rodrigo und Gonzalo García Barcha
1
AM 16. AUGUST NACHMITTAGS kam sie mit der Drei-Uhr-Fähre wieder einmal auf die Insel. Sie trug Jeans, eine Bluse im Schottenkaro, einfache, flache Schuhe ohne Strümpfe, einen Sonnenschirm aus Satin, ihre Handtasche und als einziges Gepäck ein Köfferchen. Vor der Schlange der Taxis am Kai steuerte sie direkt auf ein altes, vom Meersalz angefressenes Modell zu. Der Chauffeur begrüßte sie wie ein alter Freund und fuhr sie holpernd durch den ärmlichen Ort mit seinen Häusern aus Rohr und Lehm, den mit Palmwedeln gedeckten Dächern und dem glühenden Sand der Straßen vor einem Meer in Flammen. Der Fahrer musste zickzack fahren, um den unerschrockenen Schweinen und den nackten Kindern, die ihn mit Torero-Finten neckten, auszuweichen. Am Ende des Dorfes bog er in eine Allee aus Königspalmen, an der die Strände und die Touristenhotels zwischen dem offenen Meer und einer von blauen Reihern bevölkerten Lagune lagen. Endlich hielt er vor dem ältesten und schäbigsten Hotel.
Der Concierge wartete mit dem Schlüssel für das einzige auf die Lagune hinausgehende Zimmer des zweiten Stocks und dem ausgefüllten Anmeldebogen, den sie nur noch unterschreiben musste. Sie sprang die Treppe hinauf und betrat das einfache Zimmer, das fast völlig von dem riesigen Ehebett eingenommen war und nach frischem Insektenspray roch. Aus ihrer Tasche zog sie ein Necessaire aus Ziegenleder und legte auf den Nachttisch ein aufzuschneidendes Buch, in dem ein elfenbeinerner Brieföffner eine Seite markierte. Sie holte ein rosaseidenes Nachthemd heraus und schob es unter das Kopfkissen. Dann nahm sie ein mit tropischen Vögeln bedrucktes Seidentuch aus der Tasche, eine weiße kurzärmelige Bluse und ein paar alte Tennisschuhe und brachte alles ins Badezimmer.
Bevor sie sich frisch machte, nahm sie den Ehering ab und die Männeruhr, die sie am rechten Arm trug, und legte beides auf die Ablage über dem Waschbecken, spülte sich dann mit schnellen Bewegungen Wasser ins Gesicht, um den Staub der Fahrt abzuwaschen und die Siestamüdigkeit zu vertreiben. Nachdem sie sich abgetrocknet hatte, griff sie prüfend nach ihren Brüsten, die trotz der beiden Geburten rund und hoheitsvoll waren. Sie zog ihre Wangen mit den Handkanten nach hinten, zur Erinnerung daran, wie sie jung ausgesehen hatte. Über die Falten am Hals ging sie hinweg, da war eh nichts mehr zu machen, und wandte sich ihren makellosen, nach dem Mittagessen auf der Fähre frisch geputzten Zähnen zu. Sie rieb mit dem Deodorant die sauber rasierten Achseln ein und zog sich die Bluse aus kühler Baumwolle mit den auf die Tasche gestickten Initialen AMB an. Sie bürstete ihr bis zur Schulter reichendes indianisch glattes Haar, band es mit dem seidenen Vogeltuch zu einem Pferdeschwanz zusammen. Zum Schluss strich sie sich mit einem einfachen Vaselinstift über die trockenen Lippen, leckte die Zeigefinger an und glättete ihre zusammengewachsenen Brauen, tupfte sich das Duftwasser Orienthölzer hinter das eine und das andere Ohr und stellte sich schließlich ihrem Spiegelbild einer herbstlichen Frau und Mutter. Die Haut ohne jede Spur von Kosmetik hatte die Farbe und die Textur von Melasse, und ihre Topasaugen mit den dunklen portugiesischen Lidern waren wunderschön. Sie prüfte sich gründlich, urteilte ohne Erbarmen und fand sich fast so gut, wie sie sich fühlte. Erst als sie Ring und Uhr wieder anlegte, merkte sie, dass es schon spät war: nur noch sechs Minuten vor vier, trotzdem gönnte sie sich eine Minute der Nostalgie und betrachtete die Reiher, die reglos im Gleitflug über die glühende Hitze der Lagune strichen.
Das Taxi wartete unter den Bananenstauden am Eingang auf sie. Ohne Anweisungen abzuwarten, startete es und fuhr die Palmenallee bis zu einer Lichtung zwischen den Hotels, wo im Freien der lokale Markt stattfand, und hielt vor einem Blumenstand. Eine massige Schwarze, die auf einer Strandliege dämmerte, schreckte auf, erkannte die Frau auf dem Rücksitz des Wagens und übergab unter Gelächter und Geplapper den Gladiolenstrauß, den sie für sie bestellt hatte. Ein paar Straßen weiter bog das Taxi in einen kaum befahrbaren Weg, der über einen Felskamm mit spitzen Steinen führte. Durch die vor Hitze kristallisierte Luft sah man aufs offene karibische Meer, sah die Ausflugsyachten, aufgereiht am Touristenkai, die Vier-Uhr-Fähre, die zur Stadt zurückkehrte. Auf dem Gipfel des Hügels lag der armselige Friedhof. Ohne Mühe stieß sie das rostige Tor auf und betrat mit ihrem Blumenstrauß den Pfad, der durch die in Unkraut ertrunkenen Grabhügel führte. In der Mitte stand ein ausladender Ceibabaum, an dem orientierte sie sich, um das Grab ihrer Mutter zu finden. Die spitzen Steine taten durch die aufgeheizten Gummisohlen weh, und die grobe Sonne drang durch die Seide des Sonnenschirms. Ein Leguan tauchte aus dem Gestrüpp auf, verharrte reglos vor ihr, musterte sie einen Augenblick und floh dann in Panik.
Sie zog einen Gartenhandschuh aus ihrer Tasche, streifte ihn über und musste erst drei Grabsteine säubern, bis sie den gelblichen Marmor mit dem Namen ihrer Mutter und dem Todesdatum vor acht Jahren freigelegt hatte.
An jedem 16. August wiederholte sie diese Reise, zur gleichen Zeit, mit demselben Taxi und derselben Blumenfrau, unter der brennenden Sonne desselben ärmlichen Friedhofs, um einen Strauß frischer Gladiolen auf das Grab ihrer Mutter zu legen. Danach hatte sie nichts mehr zu tun bis neun Uhr am nächsten Morgen, wenn die erste Fähre zurückfuhr.
Sie hieß Ana Magdalena Bach, war sechsundvierzig Jahre alt und siebenundzwanzig Jahre glücklich verheiratet mit einem Mann, den sie liebte und der sie liebte, den sie geheiratet hatte, ohne das Studium der Künste und Literatur beendet zu haben, noch als Jungfrau und ohne vorherige Liebeleien. Ihre Mutter war eine berühmte Montessori-Grundschullehrerin gewesen, die, trotz aller Verdienste, bis zu ihrem letzten Atemzug nichts anderes als Lehrerin hatte sein wollen. Von ihr hatte Ana Magdalena das Leuchten der goldenen Augen geerbt, die Tugend der wenigen Worte und die Klugheit, ihr Temperament zu zügeln. Sie kam aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater war Klavierlehrer und vierzig Jahre lang Direktor des Konservatoriums der Provinz gewesen. Ihr Mann, ebenfalls Sohn von Musikern und selbst Dirigent, wurde sein Nachfolger. Sie hatten einen vorbildlichen Sohn, der mit zweiundzwanzig das erste Cello des Nationalen Symphonie Orchesters spielte und von Mstislaw Leopoldowitsch Rostropowitsch bei einer privaten Vorstellung beklatscht worden war. Die achtzehnjährige Tochter hingegen spielte mit einer geradezu genialischen Leichtigkeit jedwedes Instrument nach dem Gehör, was ihr aber nur als Vorwand diente, um nicht zu Hause zu schlafen. Sie hatte eine fröhliche Liebschaft mit einem hervorragenden Jazztrompeter, wollte jedoch entgegen den Erwartungen ihrer Eltern in den Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen eintreten.
Den Wunsch, auf der Insel begraben zu werden, hatte ihre Mutter drei Tage vor ihrem Tod geäußert. Ana Magdalena wollte zur Beerdigung fahren, doch das hielt niemand für vernünftig, da nicht einmal sie selbst glaubte, den Schmerz überleben zu können. Ihr Vater nahm sie am ersten Jahrestag mit auf die Insel, um den Stein zu setzen, der auf das Grab gehörte. Die fast vier Stunden dauernde Überfahrt in einem Kanu mit Außenbordmotor auf einem durchgehend aufgewühlten Meer versetzte sie in Angst und Schrecken. Sie bewunderte die Strände aus goldenem Mehl gleich am Rand des unberührten Urwalds, das Gekreisch der Vögel und den gespensterhaften Flug der Reiher über dem ruhigen Wasser der inneren Lagune. Traurig machte sie das Elend des Dorfes, wo man auf Hängematten, die an zwei Kokospalmen befestigt waren, im Freien schlafen musste, obgleich dies der Geburtsort eines Dichters und eines großsprecherischen Senators war, der fast Präsident der Republik geworden wäre. Sie war erschüttert von der Menge schwarzer Fischer mit verkrüppeltem Arm wegen einer vorzeitigen Explosion der Dynamitstäbe. Vor allem aber verstand sie den Wunsch der Mutter, als sie das Leuchten der Welt von der Höhe des Friedhofs aus sah. Es war der einzige einsame Platz, an dem sie sich nicht einsam fühlen konnte. Da fasste Ana Magdalena Bach den Vorsatz, die Mutter dort zu lassen und jedes Jahr einen Gladiolenstrauß auf ihr Grab zu legen.