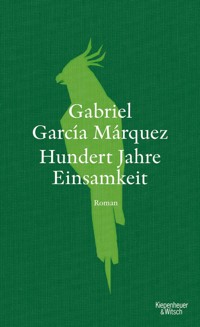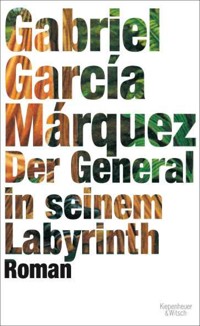8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Laubsturm« – Gabriel García Márquez' einzigartiges Debüt über das verlorene Dorf Macondo In seinem frühen Meisterwerk »Laubsturm« entwirft Gabriel García Márquez bereits die unverwechselbare Welt des karibischen Dorfes Macondo, das später in seinem weltberühmten Roman »Hundert Jahre Einsamkeit« Kultstatus erlangen sollte. Mit poetischer Kraft erzählt er von Bürgerkrieg, Bananenboom und Naturkatastrophen, die über das Dorf hinwegfegen, sowie von Nachbarschaftsfehden, die es erschüttern. Im Zentrum stehen ein alter Oberst, seine Tochter und deren kleiner Sohn, die von ihrer Verlorenheit in Macondo berichten. García Márquez gelingt es meisterhaft, ihre Geschichten mit dem Schicksal des Dorfes zu verweben und so ein eindringliches Porträt einer Gemeinschaft im Wandel der Zeit zu zeichnen. »Laubsturm« offenbart bereits in jungen Jahren das erzählerische Genie von Gabriel García Márquez. Ein berührender Roman über Traditionen, Umbrüche und menschliche Schicksale.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Laubsturm
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Er gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichen Schriftsteller der Welt. García Márquez starb am 17. April 2014 im Alter von 87 Jahren in Mexiko-Stadt.
Curt Meyer-Clason, geboren 1910 in Ludwigsburg, übersetzte herausragende lateinamerikanische Autoren wie Jorge Luis Borges, Pablo Neruda und Gabriel García Márquez. Sein Werk sowieso sein Engagement für die Vermittlung der lateinamerikanischen Literatur wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Curt Meyer-Clason starb 2012 in München.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ungläubig betrachten die Untertanen eines Karibikstaates den toten Diktator in seinem Palast, in den bereits die Geier eingedrungen sind. Uralt ist er geworden, und schon einmal hat er seinen Tod nur vorgetäuscht, um am dritten Tag desto herrschsüchtiger wieder aufzuerstehen. Gabriel García Márquez erzählt von despotischer Willkür, aber auch von der Einsamkeit und Angst der Mächtigen. In der Figur des Patriarchen vereint er die Diktatoren Lateinamerikas der letzten 150 Jahre und schafft – in einer phantastischen Bilderflut – eine unerhörte Parabel über die Macht.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Des Polyneikes armen Leichnam aber
Verbietet er den Bürgern öffentlich
Ins Grab zu bergen und ihn zu beweinen.
Als süße Beute, ohne Grab und Klage
Dien er den Vögeln, die den Fraß eräugen.
Der ehrenwerte Kreon läßt das dir
Und mir – mir auch, sag ich – verkündigen.
Gleich sei er hier, es denen, die’s nicht wissen,
Deutlich zu sagen, und er nehm die Sache
Nicht für gering. Nein, wer sich hier verfehlt,
Der soll gesteinigt werden öffentlich.
ANTIGONE (deutsch von Heinrich Weinstock)
Plötzlich, als hätte ein Wirbelwind Wurzeln geschlagen mitten im Dorf, kam die Bananengesellschaft, verfolgt vom Laubsturm. Und der Laubsturm war kunterbunt, zerzaust, zusammengefegt aus dem menschlichen und materiellen Abfall der anderen Dörfer, Ausschuß eines Bürgerkriegs, der immer ferner und unwahrscheinlicher schien. Der Laubsturm war unerbittlich. Er vergiftete alles mit seinem buntgewürfelten Geruch, Geruch von menschlichen Ausdünstungen und verstecktem Tod. In weniger als einem Jahr überschwemmte er das Dorf mit den Trümmern zahlreicher früherer Katastrophen und verstreute in dessen Straßen die wirre Ladung seines Abfalls. In rasender Hast, zum unvorhergesehenen wahnwitzigen Takt des Sturms löste sich dieser Abfall heraus und vereinzelte sich, bis er das, was eine Hauptstraße mit einem Fluß am einen und einem Gehege für die Toten am anderen Ende gewesen war, in ein völlig verschiedenes, verzwicktes Dorf verwandelte, gebildet aus dem Abfall der anderen Dörfer.
Und vermengt mit dem menschlichen Laubsturm, mitgerissen von seiner ungestümen Kraft, kam der Abfall der Kaufläden, der Krankenhäuser, der Vergnügungssalons, der Kraftwerke; Abfall von alleinstehenden Frauen und Männern, die ihren Maulesel an einen Hotelpfosten banden und als einziges Gepäck eine Holztruhe mitbrachten oder ein Kleiderbündel und nach wenigen Monaten ein eigenes Haus besaßen, zwei Konkubinen und den militärischen Rang, den man ihnen schuldig war, weil sie spät am Krieg teilgenommen hatten.
Sogar der Abfall trostloser Liebe kam mit dem Laubsturm aus den Städten und baute kleine Holzhäuser; zuerst richtete er drinnen, in einer Ecke, eine halbe Pritsche ein als dunkle Zuflucht für eine Nacht, später dann eine lärmende heimliche Straße und zuletzt, innerhalb des Dorfs, ein ganzes Dorf der Toleranz.
Inmitten dieses Gestöbers, dieses Gewitters von unbekannten Gesichtern, von Zelten auf der Hauptstraße, von Männern, die sich in den Gassen umzogen, von Frauen, die mit aufgespannten Regenschirmen auf ihren Truhen saßen, von Eseln und immer mehr Eseln, die vergessen im Stall des Hotels vor Hunger krepierten, waren die ersten, nämlich wir, die letzten; wir waren die Fremden, die Neuankömmlinge.
Nach dem Krieg, als wir nach Macondo kamen und die Qualität seines Bodens zu schätzen lernten, wußten wir, daß der Laubsturm einmal kommen würde, doch mit diesem Ungestüm hatten wir nicht gerechnet. Als wir daher die Lawine herandrängen fühlten, konnten wir nur eines tun: Wir stellten einen Teller mit Messer und Gabel hinter die Tür, setzten uns nieder und warteten geduldig, daß die Neuankömmlinge uns kennenlernen würden. Dann pfiff der Zug zum ersten Mal. Der Laubsturm machte kehrt und ging ihm zur Begrüßung entgegen, und mit der Kehrtwendung verlor er seinen Schwung, gewann aber an Einheit und Festigkeit, er durchlief den natürlichen Gärungsprozeß und gesellte sich zu den Keimen der Erde.
Macondo, 1909
1.
Zum ersten Mal habe ich eine Leiche gesehen. Es ist Mittwoch, aber mir kommt es vor, als sei Sonntag, weil ich nicht in die Schule gegangen bin und man mir diesen Anzug aus grünem Cordsamt angezogen hat, der mich irgendwo drückt. An Mamas Hand bin ich hinter meinem Großvater, der bei jedem Schritt mit seinem Stock tastet, um nicht an die Dinge zu stoßen (er sieht nicht gut im Halbdunkel und hinkt), am Wohnzimmerspiegel vorbeigegangen und habe mich ganz gesehen in meinem grünen Anzug und mit dieser gestärkten weißen Schleife, die mich an einer Seite des Halses drückt. Ich habe mich in dem runden fleckigen Spiegelglas gesehen und habe gedacht: Das bin ich, als wäre heute Sonntag.
Wir sind in das Haus gegangen, wo der Tote ist. Die Hitze in dem geschlossenen Raum ist erdrückend. Man hört das Summen der Sonne auf den Straßen, sonst nichts. Die Luft steht, ist zäh; man hat den Eindruck, als könne man sie biegen wie eine Stahlklinge. In dem Zimmer, wo der Leichnam liegt, riecht es nach Kleidertruhen, aber ich sehe nirgends welche. In der Ecke hängt eine Hängematte an einem ihrer Ringe. Es riecht nach Abfall. Ich glaube, die kaputten, fast zerfallenen Dinge ringsum sehen so aus, als müßten sie nach Abfall riechen, obgleich sie in Wirklichkeit einen anderen Geruch haben.
Ich hatte immer geglaubt, die Toten müßten einen Hut aufhaben. Jetzt sehe ich, daß es nicht so ist. Ich sehe, daß sie einen wächsernen Kopf haben und ein unter dem Kinn geknüpftes Taschentuch. Ich sehe, daß sie den Mund halb offen haben und daß man hinter den violetten Lippen die fleckigen unregelmäßigen Zähne sehen kann. Ich sehe, daß sie die zerbissene Zunge in einem Mundwinkel haben, dick und teigig und etwas dunkler als die Farbe des Gesichts, wie Finger, wenn man sie mit einem Hanfstrick zusammenpreßt. Ich sehe, daß sie die Augen offen haben, viel weiter offen als ein Mensch, verstört und aufgerissen, und daß die Haut aus festgestampfter feuchter Erde zu sein scheint. Ich habe geglaubt, ein Toter sehe aus wie eine stille, schlafende Person, nun sehe ich, daß das Gegenteil zutrifft. Ich sehe, daß er aussieht wie eine wache, von einem Streit wütende Person.
Auch Mama hat sich angezogen, als sei es Sonntag. Sie hat den alten Strohhut aufgesetzt, der ihre Ohren verdeckt, und trägt ein schwarzes, hochgeschlossenes Kleid mit Ärmeln bis an die Handgelenke. Da heute Mittwoch ist, kommt sie mir fern vor, unbekannt, und ich habe den Eindruck, daß sie mir etwas sagen will, während mein Großvater aufsteht, um die Männer zu empfangen, die den Sarg gebracht haben. Mama sitzt neben mir, mit dem Rücken zum verriegelten Fenster. Sie atmet mühsam und ordnet jeden Augenblick die Haarsträhnen, die unter ihrem hastig aufgesetzten Hut hervorquellen. Mein Großvater weist die Männer an, den Sarg neben das Bett zu stellen. Erst jetzt merke ich, daß der Tote hineinpaßt. Als die Männer die Kiste hereinbrachten, hatte ich den Eindruck gehabt, daß sie zu klein war für den Körper, der die ganze Länge des Betts einnimmt.
Ich weiß nicht, warum man mich mitgenommen hat. Ich bin nie in diesem Haus gewesen und habe es sogar für unbewohnt gehalten. Es ist ein großes Haus an einer Ecke, dessen Türen, glaube ich, nie geöffnet worden sind. Ich habe immer geglaubt, das Haus sei leer. Erst jetzt, nachdem Mama zu mir gesagt hatte: »Heute nachmittag gehst du nicht in die Schule« und ich mich nicht gefreut hatte, weil sie es mit ernster verhaltener Stimme gesagt hatte, und ich sie mit meinem Cordsamtanzug zurückkehren sah und sie ihn mir wortlos anzog und wir vor die Tür traten, um meinen Großvater zu treffen, und wir die drei Häuser weit gingen, die dieses von unserem trennen, erst jetzt merke ich, daß jemand an dieser Ecke gewohnt hatte. Jemand, der tot ist und der Mann sein muß, den meine Mutter meinte, als sie sagte: »Du mußt sehr artig sein bei der Beerdigung des Doktors.«
Beim Eintreten sah ich den Toten nicht. Ich sah meinen Großvater in der Tür, der mit den Männern sprach, und ich sah ihn nachher, als er uns weitergehen hieß. Nun glaubte ich, es sei jemand im Zimmer, aber beim Eintreten war es mir dunkel und leer vorgekommen. Die Hitze schlug mir vom ersten Augenblick an ins Gesicht, und ich spürte diesen Geruch nach Abfall, der anfangs greifbar war und hartnäckig, und jetzt wie die Hitze in Wellen kommt und schwindet. Mama führte mich an der Hand durch das dunkle Zimmer und setzte mich neben sich in eine Ecke. Erst nach einem Augenblick begann ich die Dinge zu unterscheiden. Ich sah, wie mein Großvater ein Fenster zu öffnen suchte, das wohl am Rahmen festklebte, sah ihn mit dem Stock gegen die Klinke schlagen; sein Rock wurde dabei voller Staub, der bei jedem Stoß herabfiel. Ich wandte das Gesicht dorthin, wo mein Großvater sich bewegte, als er erklärte, er sei außerstande, das Fenster zu öffnen, und erst jetzt sah ich, daß jemand auf dem Bett lag. Ein dunkler Mann lag da, ausgestreckt, reglos. Jetzt drehte ich das Gesicht zu Mama hin, die fern schien und ernst und auf eine andere Stelle des Zimmers blickte. Da meine Füße nicht auf den Boden reichten und eine Spanne darüber in der Luft hingen, schob ich die Hände unter die Schenkel, mit den Handflächen auf dem Sitz, und begann mit den Beinen zu baumeln, ohne an etwas zu denken, bis ich mich daran erinnerte, daß Mama zu mir gesagt hatte: »Du mußt sehr artig sein bei der Beerdigung des Doktors.« Jetzt fühlte ich etwas Kaltes im Rücken, drehte mich um und sah nur die trockene, rissige Holzwand. Doch es war, als habe jemand von der Wand her zu mir gesagt: »Bewege nicht die Beine, denn der Mann, der auf dem Bett liegt, ist der Doktor, und der ist tot.« Und als ich zum Bett blickte, sah ich ihn nicht mehr wie vorher. Ich sah ihn nicht mehr ruhend, sondern tot.
Seitdem, und ich mag mich noch so anstrengen, um ihn nicht anzublicken, habe ich das Gefühl, daß jemand meinen Blick in diese Richtung zwingt. Und obgleich ich mich anstrenge, auf andere Stellen des Zimmers zu blicken, sehe ich ihn dennoch irgendwo mit seinen weitaufgerissenen Augen und dem grünen, toten Gesicht in der Dunkelheit.
Ich weiß nicht, warum niemand zur Beerdigung gekommen ist. Gekommen sind nur mein Großvater, Mama und die vier Guajiro-Landarbeiter, die bei meinem Großvater arbeiten. Die Männer haben einen Sack Kalk mitgebracht und ihn in den Sarg geschüttet. Wäre meine Mutter nicht so fremd gewesen und abwesend, ich hätte sie gefragt, warum sie das tun. Ich verstehe nicht, warum sie Kalk in die Kiste streuen müssen. Als der Sack leer war, hat einer der Männer ihn über dem Sarg ausgeschüttet, und ein paar Flocken sind noch herausgefallen, die eher Sägemehl glichen als Kalk. Sie haben den Toten an Schultern und Füßen hochgehoben. Er trägt eine gewöhnliche Hose, in der Taille zusammengehalten von einem breiten schwarzen Riemen, und ein graues Hemd. Er hat nur den linken Schuh an. Er ist, wie Ada sagt, an einem Fuß König und am anderen Sklave. Der rechte Schuh liegt in einer Bettecke. Im Bett sah der Tote aus, als sei es ihm unbequem. Im Sarg wirkt er behaglicher, stiller, und das Gesicht, welches das eines lebendigen und nach einem Streit hellwachen Menschen war, hat entspannte, gelassene Züge angenommen. Das Profil wird weicher, und es ist, als fühle er sich dort, in der Kiste, an dem Ort, der ihm als Totem gemäß ist.
Mein Großvater hat sich im Zimmer umgetan. Er hat einige Gegenstände eingesammelt und sie in die Kiste gelegt. Ich habe wieder Mama angesehen in der Hoffnung, sie möge mir sagen, warum mein Großvater Gegenstände in den Sarg legt. Aber meine Mutter verharrt unerschütterlich in ihrem schwarzen Kleid und scheint bemüht, nicht dorthin zu blicken, wo der Tote ist. Auch ich möchte das tun, bringe es aber nicht fertig. Ich starre ihn an, mustere ihn. Mein Großvater legt ein Buch in den Sarg, gibt den Männern ein Zeichen, und drei von ihnen legen den Deckel über den Leichnam. Erst jetzt fühle ich mich von den Händen befreit, die meinen Kopf in diese Richtung zwingen, und beginne das Zimmer zu mustern.
Wieder sehe ich meine Mutter an. Zum ersten Mal, seit wir das Haus betreten haben, blickt sie mich an, mit gezwungenem Lächeln, ohne etwas darin; ich höre in der Ferne das Pfeifen des Zuges, der sich hinter der letzten Biegung verliert. Ich nehme ein Geräusch wahr in der Ecke, wo der Leichnam liegt. Ich sehe, daß einer der Männer ein Ende des Deckels hochhebt und daß mein Großvater den Schuh des Toten in den Sarg schiebt, den, der auf dem Bett vergessen worden war. Wieder pfeift der Zug, immer ferner, und plötzlich denke ich: Es ist halb drei. Und ich erinnere mich daran, daß zu dieser Stunde (wenn der Zug an der letzten Biegung des Dorfs pfeift) die Jungen in der Schule zum ersten Nachmittagsunterricht antreten.
Abraham, denke ich.
Ich hätte den Kleinen nicht mitbringen sollen. Dieses Schauspiel ist nichts für ihn. Selbst mir, die ich bald dreißig bin, schadet die von der Gegenwart des Toten verpestete Luft. Wir könnten jetzt gehen. Wir könnten Papa sagen, daß wir uns nicht wohl fühlen in einem Zimmer, in dem sich siebzehn Jahre lang die Reste eines Menschen angesammelt haben, der getrennt ist von allem, was man als Anhänglichkeit oder Dankbarkeit bezeichnen könnte. Vielleicht ist mein Vater der einzige Mensch, der Sympathie für ihn empfunden hat. Eine unbegreifliche Sympathie, die den Toten jetzt davor rettet, in diesen vier Wänden zu vermodern.
Mich beschäftigt die Lächerlichkeit von all dem. Mich beunruhigt der Gedanke, daß wir im nächsten Augenblick auf die Straße hinaustreten und hinter einem Sarg hergehen werden, der niemand etwas anderes einflößen wird als Schadenfreude. Ich stelle mir den Gesichtsausdruck der Frauen an den Fenstern vor, die meinen Vater vorbeigehen sehen, die mich mit dem Kleinen hinter einem Sarg einhergehen sehen, in dessen Innerem die einzige Person verfault, die das Dorf so zu sehen begehrte, in unerbittlicher Verlassenheit zum Friedhof gebracht, begleitet von den drei Personen, die sich bereit gefunden haben zu einem Werk der Barmherzigkeit, das der Anfang der eigenen Schande sein muß. Möglicherweise wird dieser Entschluß Papas der Grund dafür sein, daß morgen jemand bereit sein wird, unseren Leichenzug zu begleiten.
Vielleicht habe ich deshalb den Kleinen mitgebracht. Als Papa vor einem Augenblick zu mir sagte: »Du mußt mitkommen«, war mein erster Gedanke, den Kleinen mitzunehmen, um mich beschützt zu fühlen. Jetzt sind wir hier, an diesem beklemmenden Septembernachmittag, und es kommt uns vor, als seien die uns umgebenden Dinge die mitleidlosen Handlanger unserer Feinde. Papa braucht sich nicht zu sorgen. Tatsächlich hat er sein Leben damit zugebracht, dergleichen Dinge zu tun; er hat dem Dorf Steine zu beißen gegeben, hat seine belanglosesten Versprechen erfüllt, allen Gepflogenheiten zum Trotz. Seit fünfundzwanzig Jahren, als damals dieser Mann in unser Haus kam, mußte Papa (als er das absonderliche Gebaren des Besuchers feststellte) ahnen, daß sich heute im Dorf kein Mensch finden würde, der seine Leiche den Aasgeiern vorwerfen würde. Vielleicht hat Papa alle Hindernisse vorausgesehen, hat alle möglichen Unannehmlichkeiten bemessen und berechnet. Jetzt, fünfundzwanzig Jahre später, muß er wohl fühlen, daß dies nur die Erfüllung einer längst vorausbedachten Aufgabe ist, die er auf alle Fälle durchgeführt haben würde, und hätte er selbst den Leichnam durch Macondos Straßen schleppen müssen.
Trotzdem hat er zu gegebener Stunde nicht den Mut gehabt, es allein zu tun, und hat mich gezwungen, dieser unerträglichen Verpflichtung mit nachzukommen, die er lange Zeit bevor ich meinen Verstand gebrauchen konnte eingegangen sein muß. Als er zu mir sagte: »Du mußt mich begleiten«, ließ er mir keine Zeit, die Tragweite seiner Worte zu ermessen; ich konnte nicht das Ausmaß der Lächerlichkeit und Beschämung berechnen, das darin liegt, einen Menschen zu begraben, den alle Welt möglichst rasch in seinem Bau zu Staub verwandelt wissen wollte. Denn die Leute hatten nicht nur darauf gewartet, sie hatten sich auch darauf vorbereitet, daß die Dinge so geschähen, hatten es von Herzen erhofft, ohne Gewissensbisse und sogar mit der vorweggenossenen Befriedigung, eines Tages den durchs Dorf ziehenden, angenehmen Geruch seines Zerfalls zu spüren, ohne daß jemand ergriffen gewesen wäre, bestürzt oder ärgerlich, sondern Genugtuung empfunden hätte, die ersehnte Stunde nahen zu sehen, und wünschte, das Schauspiel möge sich so lange hinziehen, bis der schwelende Geruch des Toten auch den verstecktesten Groll gesättigt hätte.
Nun werden wir Macondo eines langersehnten Vergnügens berauben. Ich habe das Gefühl, als habe dieser unser Entschluß die Herzen der Leute weniger wegen eines vereitelten als wegen eines aufgeschobenen Vorhabens melancholisch gestimmt.
Ich hätte den Kleinen auch deshalb zu Hause lassen sollen, um ihn nicht in diese Verschwörung zu verwickeln, die nun gegen uns wüten wird, wie sie zehn Jahre lang gegen den Doktor gewütet hat. Der Kleine hätte aus dieser Verpflichtung herausgehalten werden müssen. Er weiß nicht einmal, warum er hier ist, warum wir ihn in dieses mit Trümmern angefüllte Zimmer gebracht haben. Er ist still, ratlos, als hoffe er, daß jemand ihm die Bedeutung von all dem erkläre; als warte er, während er dasitzt mit baumelnden Beinen und seinen auf den Stuhl gestützten Händen, daß jemand ihm dieses schreckliche Rätsel entziffere. Ich wäre gern sicher, daß das niemand tut, daß niemand diese unsichtbare Tür aufstößt, die ihn daran hindert, tiefere Einsichten zu gewinnen.
Mehrmals schon hat er mich angeblickt, und ich weiß, daß er mich fremd findet und unbekannt in diesem hochgeschlossenen Kleid und diesem altmodischen Strohhut, den ich aufgesetzt habe, um nicht von meinen eigenen Vorahnungen erkannt zu werden.
Wäre Meme am Leben, hier im Haus, vielleicht wäre alles anders. Man könnte meinen, ich sei ihretwegen gekommen. Man könnte meinen, ich sei gekommen, um an einem Schmerz teilzunehmen, den sie nicht hätte fühlen, aber heucheln, und den das Volk sich hätte erklären können. Meme ist vor rund elf Jahren verschwunden. Der Tod des Doktors macht die Möglichkeit zunichte, ihren Verbleib oder wenigstens den Verbleib ihrer Knochen zu erfahren. Meme ist nicht hier, aber wäre sie hier – sofern nicht passiert wäre, was passiert ist und nie aufzuklären war –, sie hätte die Partei des Dorfs ergriffen gegen den Mann, der sechs Jahre lang ihr Bett mit so viel Liebe und so viel Menschlichkeit gewärmt hat wie ein Maulesel.
Ich höre den Zug an der letzten Biegung pfeifen. Es ist halb drei, denke ich und kann den Gedanken nicht loswerden, daß in dieser Stunde ganz Macondo lauert, was wir in diesem Hause tun. Ich denke an Señora Rebeca; ausgemergelt und wie Pergament, in Blick und Kleidung ein scheußliches Gespenst, sitzt sie neben dem elektrischen Ventilator, das Gesicht beschattet vom Maschendraht ihrer Fenster. Während sie auf den Zug horcht, der hinter der letzten Biegung verschwindet, neigt Señora Rebeca den Kopf zum Ventilator, gequält von Hitze und Groll, die Flügel ihres Herzens kreisen wie die des Ventilators (doch in umgekehrter Richtung), und sie murmelt: »Der Teufel hat hier seine Hand im Spiel«, und sie erzittert, ans Leben gekettet durch die winzigen Wurzeln des Alltags.
Und Águeda, die Lahme, sieht Solita vom Bahnhof zurückkommen, wo sie sich von ihrem Verlobten verabschiedet hat; sie sieht, wie jene um die verlassene Ecke