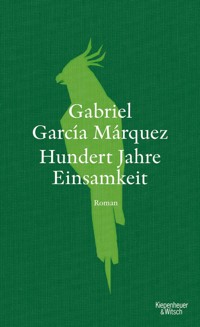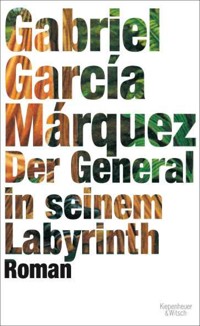9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großer Liebesroman, eine Geschichte voller Lebenskraft und Poesie – Nichts auf der Welt ist schwieriger als die Liebe. Das erleben und erleiden Fermina Daza und Doktor Juvenal Urbino tagtäglich in ihrer mehr als fünfzigjährigen Ehe. Und keiner erfährt das schmerzlicher als Florentino Ariza, Fermina Dazas Verehrer, der 51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage auf sie wartet. Schwärmerisch hat der Telegrammbote Florentino Ariza in poetischen Briefen um sie geworben, hat in aller Keuschheit ihr Herz gewonnen und wieder verloren, aber niemals aufgehört, sie zu lieben. An der Seite ihres Mannes, eines hochgeachteten Arztes, führt Fermina Daza nun ein großbürgerliches Leben. Florentino Ariza, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, wird ein gesellschaftlich anerkannter Mann und ein erfolgreicher, nimmermüder Schürzenjäger. Im Herzen jedoch ist er Fermina Daza immer treu geblieben, und noch am Abend der Beerdigung ihres Mannes erklärt er ihr erneut seine Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Die Liebe in den Zeiten der Cholera
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Er gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichen Schriftsteller der Welt. García Márquez starb am 17. April 2014 im Alter von 87 Jahren in Mexiko-Stadt.
Dagmar Ploetz, geb. 1946, übersetzt aus dem Spanischen, u.a. Werke von Rafael Chirbes, Gabriel García Márquez, Juan Marsé und Mario Vargas Llosa.
Das gesamte Werk von Gabriel García Márquez ist lieferbar bei Kiepenheuer & Witsch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nichts auf der Welt ist schwieriger als die Liebe. Das erleben Fermina Daza und Doktor Juvenal Urbino tagtäglich in ihrer mehr als fünfzigjährigen Ehe. Und niemand erfährt das schmerzlicher als Fermina Dazas ewiger Verehrer Florentino Ariza, der 51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage auf sie gewartet hat. Schwärmerisch hat er in poetischen Briefen um sie geworben, sie in aller Keuschheit gewonnen und wieder verloren, aber nie aufgehört, sie zu lieben. Während Fermina Daza an der Seite ihres Mannes, eines hoch geachteten Arztes, ein großbürgerliches Leben führt, bringt es Florentino Ariza durch beruflichen Erfolg zu großem Wohlstand. Er ist ein nimmermüder Schürzenjäger, im Herzen aber Fermina Daza immer treu geblieben, und noch am Abend der Beerdigung ihres Mannes erklärt er ihr erneut seine Liebe.
Ein großer Liebesroman, eine Geschichte voller Lebenskraft und Poesie.
»Ohne die reichen Bücher von García Márquez wäre unsere Welt entschieden ärmer.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Natürlich für Mercedes
In dieser Gegend geht’s voran:
die bekränzte Göttin zeigt es an.
Leandro Díaz
Es war unvermeidbar: Der Geruch von bitteren Mandeln ließ ihn stets an das Schicksal verhinderter Liebe denken. Doktor Juvenal Urbino hatte ihn sofort wahrgenommen, als er in das noch dämmrige Haus trat, wohin man ihn dringend gerufen hatte, damit er sich eines Falles annähme, der für ihn schon seit vielen Jahren nicht mehr dringlich war. Der Antillenflüchtling Jeremiah de Saint-Amour, Kriegsinvalide, Kinderfotograf und der nachsichtigste seiner Schachgegner, hatte sich mittels Goldzyaniddämpfen vor den Martern der Erinnerung in Sicherheit gebracht.
Er fand die Leiche, bedeckt mit einem Tuch, auf dem Feldbett vor, in dem der Mann immer geschlafen hatte, dicht daneben ein Schemel und darauf die Schale, in der das Gift verdampft war. Am Boden hingestreckt und an ein Bein des Bettes gebunden, lag der Kadaver einer großen Dänischen Dogge, schwarz mit schneeiger Brust. Daneben lagen die Krücken. Den unordentlichen, stickigen Raum, der zugleich Schlafzimmer und Labor war, erhellte gerade erst ein Schimmer des Morgenrots im geöffneten Fenster, das Licht reichte jedoch aus, um sofort die Autorität des Todes zu erkennen. Die übrigen Fenster waren, wie jede Ritze im Zimmer, mit Lappen verhängt oder mit schwarzer Pappe vernagelt, was den Eindruck beklemmender Enge verstärkte. Da war ein langer Tisch, vollgestellt mit Flaschen und Tuben ohne Etikett und zwei abgestoßenen Zinnschalen unter einer gewöhnlichen Glühbirne, die mit rotem Papier abgeschirmt war. Die dritte Schale, für das Fixierbad, befand sich neben der Leiche. Überall stapelten sich alte Zeitungen, Zeitschriften und Fotoplatten, beschädigte Möbel standen herum, doch eine fürsorgliche Hand hatte das alles vor Staub bewahrt. Obwohl durch das geöffnete Fenster frische Luft ins Zimmer gedrungen war, lag für den, der ihn zu erkennen wußte, noch immer der laue Bittermandelgeruch gescheiterter Liebe im Raum. Doktor Juvenal Urbino hatte ohne bestimmte Vorahnung mehr als einmal gedacht, daß dies nicht der rechte Ort sei, um in der Gnade des Herrn zu sterben. Doch mit der Zeit hatte er es schließlich für möglich gehalten, daß diese Unordnung einem geheimen Beschluß der göttlichen Vorsehung gehorchte.
Ein Polizeikommissar war vor ihm eingetroffen, zusammen mit einem sehr jungen Arzt, der sein gerichtsmedizinisches Praktikum an der städtischen Poliklinik machte. Sie hatten, während er noch unterwegs war, das Zimmer gelüftet und die Leiche zugedeckt. Mit ihrer feierlichen Begrüßung bezeugten sie ihm diesmal eher ihr Beileid als ihre Ehrerbietung, denn seine Freundschaft mit Jeremiah de Saint-Amour war jedermann bekannt. Der vortreffliche Meister drückte beiden die Hand, wie er es seit jeher bei seinen Schülern vor der täglichen Vorlesung zur Allgemeinmedizin gehalten hatte, dann griff er den Saum der Decke, als sei er eine Blume, zwischen Daumen und Zeigefingerspitzen und enthüllte nach und nach mit sakraler Gemessenheit den Leichnam. Der Mann war vollkommen nackt, starr und verkrümmt, die Augen offen, der Körper blau und seit dem vergangenen Abend um fünfzig Jahre gealtert. Seine Pupillen waren durchsichtig, Bart und Haare gelblich, und über den Bauch zog sich eine alte Narbe, wie von einem Sacknäher zusammengeflickt. Weil er sich so lange an Krücken abgemüht hatte, erinnerten die Spannbreite seiner Arme und sein Oberkörper an einen Galeerensklaven, seine wehrlosen Beine hingegen an ein Waisenkind. Doktor Juvenal Urbino betrachtete ihn einen Augenblick lang, und ihm war weh ums Herz wie selten in den langen Jahren seines fruchtlosen Kampfes gegen den Tod.
»Idiot«, sagte er zu ihm, »das Schlimmste war doch schon überstanden.«
Er deckte ihn wieder zu und gewann seine akademische Überlegenheit zurück. Im Jahr zuvor hatte er seinen achtzigsten Geburtstag mit einer dreitägigen offiziellen Jubiläumsfeier begangen und in seiner Dankesrede wieder einmal die Versuchung abgewehrt, in den Ruhestand zu treten. Er hatte gesagt: »Zum Ausruhen habe ich Zeit genug, wenn ich tot bin, aber diese Möglichkeit beziehe ich noch nicht in meine Pläne ein.« Obwohl er auf dem rechten Ohr immer schlechter hörte und sich beim Gehen auf seinen Stock mit dem Silberknauf stützte, um die Unsicherheit seiner Schritte zu überspielen, war sein Auftreten im Leinenanzug mit der Uhrkette über der Weste immer noch das seiner jungen Jahre. Der Pasteur-Bart war perlmuttfarben wie das Haar, das er schön glatt gekämmt und mit einem sauber gezogenen Mittelscheitel trug, getreulicher Ausdruck seines Wesens. Der immer beunruhigenderen Erosion seines Gedächtnisses begegnete er, soweit möglich, mit hastig auf Zettel geschriebenen Notizen, die am Ende in seinen vielen Taschen durcheinandergerieten, wie auch die Instrumente, die Arzneifläschchen und so vieles andere in seinem vollgestopften Arztkoffer. Er war nicht nur der älteste und angesehenste Arzt, sondern auch der gepflegteste Mann der Stadt. Dennoch brachten ihm seine allzu offen zur Schau gestellte Gelehrsamkeit und die alles andere als unschuldige Art, mit der er den Einfluß seines Namens geltend machte, weniger Zuneigung ein, als er verdient hätte.
Die Anweisungen an den Kommissar und den Assistenzarzt kamen präzise und schnell. Eine Autopsie sei nicht nötig. Der Geruch im Hause genüge vollkommen, um die Todesursache zu bestimmen: Emanationen von Zyanid, das in der Schale mittels einer fotografischen Säure aktiviert worden sei, und Jeremiah de Saint-Amour habe sich zu gut damit ausgekannt, als daß es sich um einen Unfall handeln könne. Eine skeptische Äußerung des Kommissars konterte er auf seine Weise: »Vergessen Sie nicht, ich unterschreibe den Totenschein.« Der junge Arzt war enttäuscht: Noch nie hatte er das Glück gehabt, die Wirkungen von Goldzyanid an einer Leiche zu untersuchen. Doktor Juvenal Urbino war überrascht gewesen, ihn nicht vom Medizinischen Institut her zu kennen, doch das leichte Erröten des jungen Mannes und sein Andenakzent lieferten ihm sogleich die Erklärung: Wahrscheinlich war er neu in der Stadt. Er sagte zu ihm: »Es wird sich hier schon irgendein Liebestoller finden, der Ihnen nächstens den Gefallen tut.« Während er das aussprach, fiel ihm auf, daß unter den unzähligen Selbstmorden, an die er sich erinnerte, dies der erste mit Zyanid war, der nicht seinen Grund im Liebesleid hatte. Daraufhin änderte sich sein Ton.
»Wenn Sie auf einen stoßen, sollten Sie auf etwas achten«, sagte er zu dem Assistenzarzt, »diese Leute haben gewöhnlich Sand im Herzen.«
Dann wandte er sich an den Kommissar wie an einen Subalternen. Er befahl ihm, alle Instanzen zu übergehen, damit die Beerdigung am selben Nachmittag und in größter Diskretion stattfinden könne. Er sagte: »Ich spreche mit dem Bürgermeister.« Er wußte, daß Jeremiah de Saint-Amour von einer primitiven Genügsamkeit gewesen war und daß ihm seine Kunst weit mehr eingebracht hatte, als er zum Leben brauchte, sodaß in irgendeiner Schublade im Haus reichlich Geld für die Begräbniskosten sein mußte.
»Und wenn Sie es nicht finden, macht das auch nichts«, sagte er. »Ich übernehme alles.«
Er ordnete an, den Zeitungen mitzuteilen, der Fotograf sei eines natürlichen Todes gestorben, obwohl er glaube, die Nachricht werde sie eh nicht interessieren. Er sagte: »Wenn nötig, spreche ich mit dem Gouverneur.« Der Kommissar, ein ernsthafter und bescheidener Beamter, wußte, daß die staatsbürgerliche Gewissenhaftigkeit des Meisters sogar seine engsten Freunde zur Verzweiflung brachte, und war daher überrascht, mit welcher Leichtigkeit er sich, um die Beerdigung zu beschleunigen, über den vorgeschriebenen Amtsweg hinwegsetzte. Das einzige, worauf der Arzt sich nicht einließ, war mit dem Erzbischof zu reden, damit Jeremiah de Saint-Amour in geweihter Erde begraben werden könne. Der Kommissar bereute seinen vorlauten Vorschlag und versuchte, sich zu rechtfertigen.
»Es hieß, dieser Mann sei ein Heiliger«, sagte er.
»Etwas noch Selteneres«, sagte Doktor Urbino, »ein ungläubiger Heiliger. Aber das geht nur Gott etwas an.« Aus der Ferne, vom anderen Ende der aus der Kolonialzeit stammenden Altstadt, erschallten die Glocken der Kathedrale und riefen zum Hochamt. Doktor Urbino setzte sich die goldgefaßte Halbmondbrille auf und sah auf die zierliche Taschenuhr, deren feiner Deckel von einer Feder geöffnet wurde: Er war im Begriff, die Pfingstmesse zu verpassen.
Im Wohnraum stand ein riesiger Fotoapparat auf Rädern, wie er in öffentlichen Parks benutzt wird, auf einer Leinwand war in Anstreicherfarben ein Sonnenuntergang am Meer als Kulisse gemalt, und die Wände waren mit Kinderfotos von denkwürdigen Tagen tapeziert: erste Kommunion, das Kaninchenkostüm, der glückliche Geburtstag. Doktor Urbino hatte die allmähliche Verkleidung der Wände verfolgt, Jahr um Jahr, während er sich an den Schachabenden dem Grübeln hingab, und oftmals hatte er in einer Anwandlung von Mutlosigkeit gedacht, daß diese Galerie der zufälligen Bildnisse den Keim der künftigen Stadt in sich trug, die, von jenen unsicheren Kindern regiert und verdorben, nicht einmal mehr die Asche seines Ruhms bewahren würde.
Auf dem Schreibtisch, neben einem Topf mit ein paar Kapitänspfeifen, stand das Schachbrett mit einer unbeendeten Partie. Doktor Juvenal Urbino konnte trotz seiner Eile und seiner düsteren Stimmung nicht der Versuchung widerstehen, die Partie zu studieren. Er wußte, daß es die der vergangenen Nacht war, da Jeremiah de Saint-Amour an jedem Abend der Woche und mindestens mit drei verschiedenen Gegnern spielte, doch stets führte er das Spiel zu Ende und legte danach das Brett und die Steine in ihre Schachtel und die Schachtel in eine Schublade des Schreibtischs. Der Arzt wußte, daß er immer mit Weiß spielte, und es war offensichtlich, daß er dieses Mal nach vier weiteren Zügen unrettbar geschlagen gewesen wäre. »Hätte es sich um ein Verbrechen gehandelt, wäre das hier eine gute Fährte«, sagte er sich. »Ich kenne nur einen Mann, der fähig ist, einen solch meisterhaften Hinterhalt zu legen.« Er hätte nicht weiterleben mögen, ohne später in Erfahrung bringen zu können, warum dieser unbezwingbare Kämpfer, der stets bereit war, sich bis zum letzten Blutstropfen zu schlagen, bei der Endschlacht seines Lebens nicht bis zum Schluß durchgehalten hatte.
Um sechs Uhr morgens, auf seiner letzten Runde, hatte der Nachtwächter das Schild gesehen, das an die Eingangstür geheftet war: Treten Sie ein, ohne zu läuten, und verständigen Sie die Polizei. Kurz darauf kam der Kommissar mit dem Assistenzarzt, und beide durchsuchten das Haus nach irgendeinem Hinweis, der gegen den unverwechselbaren Hauch der bitteren Mandeln sprach. In den wenigen Minuten aber, die für die Analyse der unvollendeten Partie nötig waren, entdeckte der Kommissar dann einen Umschlag zwischen den Papieren auf dem Schreibtisch, der an Doktor Juvenal Urbino adressiert und mit soviel Siegellack gesichert war, daß man ihn zerfetzen mußte, um den Brief herauszunehmen. Der Arzt zog, um mehr Licht zu haben, den schwarzen Vorhang am Fenster beiseite, warf zuerst einen schnellen Blick auf die elf Bogen, die beidseitig mit gefälligen Schriftzügen beschrieben waren, und begriff, nachdem er den ersten Absatz gelesen hatte, daß er bereits die Kommunion verpaßt hatte. Er las atemlos, blätterte mehrere Seiten zurück, um den verlorenen Faden wiederzufinden, und schien, als er fertig war, nach einer langen Zeit von weither zurückzukehren. Seine Niedergeschlagenheit war sichtbar, obwohl er sie zu verbergen suchte: Seine Lippen hatten die gleiche bläuliche Färbung wie die Leiche angenommen, und er konnte nicht das Zittern seiner Hände verhindern, als er den Brief wieder zusammenfaltete und in der Westentasche verwahrte. Dann erinnerte er sich des Kommissars und des jungen Arztes und lächelte ihnen aus den Nebeln seines Trübsinns zu.
»Nichts Besonderes«, sagte er. »Es sind seine letzten Verfügungen.« Das war die halbe Wahrheit, aber sie glaubten sie ganz, als er sie anwies, eine lose Fliese am Boden hochzuheben. Dort fanden sie ein abgenutztes Kontobuch, in dem die Zahlenkombination für die Geldkassette stand. Es war nicht so viel Geld da, wie sie vermutet hatten, doch mehr als genug, um die Kosten des Begräbnisses und andere kleine Verpflichtungen zu begleichen. Doktor Urbino war nun klar, daß er nicht vor dem Evangelium zur Kathedrale kommen würde.
»So weit ich zurückdenken kann, ist dies das dritte Mal, daß ich die Sonntagsmesse versäume«, sagte er. »Aber Gott hat Verständnis.« So blieb er lieber noch einige Minuten länger, um alle Einzelheiten zu klären, obwohl er kaum das Verlangen beherrschen konnte, seiner Frau die Enthüllungen des Briefes mitzuteilen. Er verpflichtete sich, die zahlreichen Flüchtlinge aus der Karibik, die in der Stadt lebten, zu benachrichtigen, damit sie demjenigen die letzte Ehre erweisen konnten, der sich als der achtbarste, aktivste und radikalste unter ihnen hervorgetan hatte, selbst dann noch, als allzu offenkundig wurde, daß er dem Sog der Ernüchterung erlegen war. Er wollte auch den Schachfreunden Bescheid geben, unter ihnen berühmte Akademiker, aber auch namenlose Handwerker, sowie anderen, weniger engen Freunden, die aber möglicherweise an der Beerdigung teilnehmen wollten. Bevor er den Abschiedsbrief kannte, war er entschlossen gewesen, der erste Trauergast zu sein, als er ihn aber gelesen hatte, war alles ungewiß geworden. Wie auch immer, er würde einen Gardenienkranz schicken, für den Fall, daß Jeremiah de Saint-Amour eine letzte Minute der Reue gehabt haben sollte. Das Begräbnis wurde für fünf Uhr angesetzt, das war in den Hitzemonaten die günstigste Zeit. Falls man ihn brauche, ab zwölf Uhr mittags sei er im Landhaus seines lieben Schülers, Doktor Lácides Olivella, zu erreichen, der an diesem Tag mit einem Galaessen sein silbernes Berufsjubiläum begehe.
Doktor Juvenal Urbinos Tagesablauf gehorchte, seit seine Sturm-und-Drang-Jahre vorüber waren und er einen Ruf und eine Respektabilität erlangt hatte, die in der Provinz ihresgleichen suchten, einer leicht einsehbaren Routine. Er stand mit den ersten Hähnen auf, und zu dieser Stunde begann er auch seine geheimen Medizinen einzunehmen: Bromkali, um die Stimmung zu heben, Salycilate gegen die Knochenschmerzen in Regenzeiten, Roggenkeim-Tropfen gegen die Benommenheit, Belladonna, um gut zu schlafen. Er schluckte jede Stunde etwas und immer heimlich, da er sich in seinen langen Jahren als Arzt und Lehrer stets dagegen gewehrt hatte, Palliativa gegen das Alter zu verschreiben: Es fiel ihm leichter, die fremden Schmerzen zu ertragen als die eigenen. Er hatte immer ein kleines Riechkissen mit Kampfer in der Tasche, und wenn ihn niemand beobachtete, atmete er ihn tief ein, um die Angst vor soviel durcheinandergemengten Arzneimitteln abzuwehren.
Eine Stunde lang hielt er sich in seinem Arbeitszimmer auf, wo er die Vorlesung für Allgemeinmedizin vorbereitete, die er bis zum Vortag seines Todes täglich montags bis samstags um Punkt acht Uhr im Medizinischen Institut hielt. Er war auch ein aufmerksamer Leser literarischer Neuerscheinungen, die ihm sein Pariser Buchhändler mit der Post schickte oder die sein Buchhändler am Ort für ihn aus Barcelona bestellte, allerdings verfolgte er die spanischsprachige Literatur nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit wie die französische. Jedenfalls las er nie morgens, sondern eine Stunde lang nach der Siesta und abends vor dem Schlafen. Vom Arbeitszimmer ging er ins Bad, wo er fünfzehn Minuten lang vor dem offenen Fenster Atemübungen machte, wobei er sich immer der Richtung zuwandte, aus der die Hähne krähten, denn von dort kam die neue Luft. Dann badete er, bürstete seinen Backenbart und wichste den Schnurrbart, alles in einem von Kölnisch Wasser – dem echten Farina Gegenüber – gesättigten Raum, und kleidete sich nun in weißes Leinen, mit Weste, weichem Hut und Halbschuhen aus Korduanleder. Mit seinen einundachtzig Jahren hatte er sich die formlose Umgangsart und die muntere Geistesverfassung aus der Zeit bewahrt, als er, kurz nach der großen Choleraepidemie, aus Paris zurückgekehrt war. Auch das wohlgekämmte Haar mit dem Mittelscheitel glich immer noch dem seiner Jugend, sah man von dem metallischen Farbton ab. Er frühstückte mit der Familie, hielt sich jedoch an seine eigene Diät: Ein Aufguß aus Wermutblüten für das Wohlbefinden des Magens und eine Knoblauchknolle, deren Zehen er Stück für Stück schälte und dann mit einer Scheibe Brot gewissenhaft kaute, um den Erstickungsanfällen des Herzens vorzubeugen. Nur selten hatte er nach der Vorlesung nicht irgendwelche Verpflichtungen im Zusammenhang mit seinen staatsbürgerlichen Initiativen, seinem katholischen Engagement oder seinen künstlerischen und sozialen Aktivitäten.
Er aß fast immer daheim zu Mittag und hielt eine zehnminütige Siesta, zu der er sich auf die Terrasse zum Innenhof setzte, und hörte in seinen Träumen die Lieder der Dienstmädchen unter dem Laubwerk der Mangos, hörte die Ausrufer auf der Straße, das Dröhnen der Schiffsmotoren in der Bucht, deren Ausdünstungen an den heißen Nachmittagen flügelschlagend durch das Haus zogen, wie ein Engel, der zur Fäulnis verdammt ist. Dann las er eine Stunde lang die neuen Bücher, vor allem Romane und historische Studien, und gab dem zahmen Papageien, der seit Jahren eine lokale Attraktion war, Unterricht in Französisch und Gesang. Um vier Uhr, nachdem er eine große Kanne geeister Limonade getrunken hatte, machte er sich auf den Weg zu seinen Kranken. Trotz seines Alters weigerte er sich, die Patienten in seine Praxis kommen zu lassen. Er versorgte sie weiterhin in ihren eigenen Häusern, wie er es stets seit jener Zeit gehalten hatte, als die Stadt noch so überschaubar war, daß man überallhin zu Fuß gehen konnte.
Nach seiner ersten Rückkehr aus Europa ließ er sich in dem von zwei Goldfüchsen gezogenen Landauer der Familie fahren. Als dieser ausgedient hatte, tauschte er ihn gegen eine leichte einspännige Kutsche, die er mit einer gewissen Verachtung für die Mode auch dann noch benutzte, als die Kutschen langsam aus der Welt verschwanden und die letzten noch in der Stadt verbliebenen allein dazu dienten, Touristen auszufahren und Kränze zu den Beerdigungen zu bringen. Er weigerte sich, in den Ruhestand zu gehen, obwohl ihm bewußt war, daß er nur noch zu den hoffnungslosen Fällen gerufen wurde, aber er hielt auch dies für eine Form der Spezialisierung. Es genügte ihm, einen Kranken zu sehen, um zu wissen, was ihm fehlte. Immer stärker mißtraute er den Standardarzneien und verfolgte beunruhigt das Umsichgreifen der Chirurgie. »Das Chirurgenmesser ist der beste Beweis für das Scheitern der Medizin«, sagte er gerne. Er war der Meinung, daß – strenggenommen – jedes Medikament Gift sei und daß siebzig Prozent der üblichen Nahrungsmittel den Tod beschleunigten. »Das wenige, was man über das Heilen von Kranken weiß«, pflegte er bei der Lehrveranstaltung zu sagen, »wissen in jedem Fall nur einige wenige Ärzte.« Seine jugendliche Begeisterung hatte einer Haltung Platz gemacht, die er selbst als fatalistischen Humanismus bezeichnete: »Jeder ist seines Todes Schmied, und wenn ihre Stunde gekommen ist, können wir den Menschen nur dabei helfen, ohne Angst und Schmerzen zu sterben.« Doch trotz dieser extremen Ansichten, die schon zur medizinischen Folklore der Stadt gehörten, holten seine ehemaligen Schüler auch dann noch seinen Rat ein, wenn sie schon angesehene Ärzte waren, denn sie schrieben ihm das zu, was man damals den klinischen Blick nannte. Auf alle Fälle war er immer ein teurer und exklusiver Arzt gewesen, und seine Klientel wohnte vorwiegend im herrschaftlichen Viertel der Vizekönige.
Er hatte einen so geregelten Tagesablauf, daß seine Frau wußte, wohin sie ihm eine Botschaft schicken mußte, wenn etwas Dringendes während der nachmittäglichen Hausbesuche vorfiel. In seinen jungen Jahren kehrte er, bevor er nach Hause fuhr; noch ins Café de la Parroquia ein und perfektionierte dort zusammen mit den Kumpanen seines Schwiegervaters und einigen Flüchtlingen aus der Karibik sein Schachspiel. Seit dem Anbruch des neuen Jahrhunderts war er jedoch nicht wieder ins Café de la Parroquia gegangen und versuchte stattdessen nationale Meisterschaften unter der Schirmherrschaft des Club Social zu organisieren. Das war die Zeit, in der Jeremiah de Saint-Amour bereits mit toten Knien, doch noch kein Kinderfotograf, in die Stadt kam. Bevor drei Monate vergangen waren, kannte ihn jedermann, der einen Läufer bewegen konnte, denn es war niemandem gelungen, Saint-Amour in einer Partie zu schlagen. Für Doktor Juvenal Urbino war diese Begegnung wie ein Wunder, gerade eben, als ihm das Schachspiel zur unbeherrschbaren Leidenschaft geworden war, aber nur noch wenige Gegner blieben, um diese zu stillen.
Dank seiner Hilfe konnte Jeremiah de Saint-Amour das werden, was er bei uns war. Doktor Juvenal Urbino entwickelte sich zu seinem bedingungslosen Gönner, er bürgte für alles und machte sich nicht einmal die Mühe, erst in Erfahrung zu bringen, wer sein Schachpartner war, was er tat oder aus welchen ruhmlosen Kriegen er in diesem Zustand der Invalidität und Verstörung gekommen war. Schließlich lieh er ihm Geld, damit er das Fotoatelier aufmachen konnte, und Jeremiah de Saint-Amour zahlte es ihm mit der Gewissenhaftigkeit eines Bortenwirkers von dem Augenblick an, da er das erste vom Magnesiumblitz erschreckte Kind abgelichtet hatte, nach und nach bis auf den letzten Heller zurück.
Alles für das Schachspiel. Anfangs spielten sie um sieben Uhr abends, nach dem Essen, mit einer angemessenen Vorgabe für den Arzt wegen der deutlichen Überlegenheit des Gegners, dann von Mal zu Mal mit kleineren Vorgaben, bis sie einander ebenbürtig waren. Später, nachdem Don Galileo Daconte das erste Kino aufgemacht hatte, wurde Jeremiah de Saint-Amour zu einem seiner regelmäßigsten Kunden, und die Schachpartien beschränkten sich auf die Abende, an denen keine Erstaufführungen stattfanden. Damals war er schon so gut Freund mit dem Arzt, daß dieser ihn ins Kino begleitete, allerdings immer ohne Frau, teils weil diese nicht die Geduld aufbrachte, den Faden komplizierter Handlungen zu verfolgen, teils weil er schon immer gespürt hatte, daß Jeremiah de Saint-Amour kein guter Umgang war.
Juvenal Urbinos besonderer Tag war der Sonntag. Er besuchte das Hochamt in der Kathedrale, kehrte dann nach Hause zurück, blieb dort, ruhte sich aus und las auf der Terrasse des Patios. Nur selten machte er an einem Feiertag einen Krankenbesuch, es mußte sich schon um einen ausgesprochenen Notfall handeln, und seit vielen Jahren kam er auch keiner gesellschaftlichen Verpflichtung mehr nach, es sei denn, sie wäre zwingend gewesen. An jenem Pfingsttag fielen durch einen außerordentlichen Zufall zwei seltene Begebenheiten zusammen: der Tod eines Freundes und das Jubiläum eines hervorragenden Schülers. Statt jedoch, nachdem er den Tod von Jeremiah de Saint-Amour beurkundet hatte, ohne Umweg nach Haus zu fahren, wie er es vorgehabt hatte, ließ er sich von der Neugier forttreiben.
Sobald er in die Kutsche gestiegen war, überflog er noch einmal den Abschiedsbrief und wies den Kutscher an, ihn zu einer schwer erreichbaren Adresse irgendwo im alten Sklavenviertel zu fahren. Dieser Entschluß paßte so gar nicht zu seinen sonstigen Gewohnheiten, daß der Kutscher sich vergewisserte, ob kein Irrtum vorlag. Nein, die Adresse war eindeutig, und derjenige, der sie geschrieben hatte, hatte guten Grund, sie genau zu kennen. Doktor Urbino widmete sich dann wieder der ersten Seite und tauchte erneut in diese Quelle der unliebsamen Offenbarungen ein, die sein Leben sogar jetzt, im hohen Alter noch, hätten ändern können, wäre er nur sicher gewesen, daß es sich nicht um die Delirien eines Aufgegebenen handelte.
Der Himmel hatte sich schon früh eingetrübt, jetzt war er bedeckt und die Luft kühl, aber vor Mittag drohte kein Regen. Der Kutscher versuchte den Weg abzukürzen und begab sich auf die Kopfsteinpflastergassen der alten Kolonialstadt. Mehrmals mußte er im Gedränge der Schulklassen und religiösen Kongregationen, die von der Pfingstliturgie zurückkehrten, anhalten, damit das Pferd nicht scheute. Die Straßen waren voller Papiergirlanden, Musik und Blumen, und von den Balkons verfolgten Mädchen unter ihren bunten, mit Musselinvolants besetzten Sonnenschirmen den Festzug. Nach der Messe stauten sich die Automobile auf der Plaza de la Catedral, wo die Statue des Befreiers kaum zwischen afrikanischen Palmen und neuen Straßenlaternen auszumachen war, und in dem ehrwürdigen und lauten Café de la Parroquia war nicht ein Platz mehr frei. Die einzige Pferdekutsche war die von Doktor Urbino, und sie fiel unter den wenigen, die es in der Stadt überhaupt noch gab, auf, weil das Lacklederverdeck seinen Glanz bewahrt hatte, die Messingbeschläge nicht vom Salpeter zerfressen waren und man Räder und Speichen rot angestrichen und mit Goldschnörkeln verziert hatte wie für einen Galaabend an der Wiener Oper. Während die vornehmsten Familien sich damit zufriedengaben, daß ihre Kutscher ein sauberes Hemd trugen, verlangte er von seinem die Livree aus mattem Samt und den Zylinder eines Zirkusdompteurs, was nicht nur anachronistisch war, sondern in der Bruthitze der Karibik auch als Mangel an Barmherzigkeit galt.
Trotz seiner geradezu manischen Liebe zu der Stadt und obwohl er sie so gut wie kein anderer kannte, hatte Doktor Juvenal Urbino nur selten wie an jenem Sonntag Anlaß gehabt, sich ohne Vorbehalt in das Getümmel des alten Sklavenviertels zu wagen. Der Kutscher mußte mehrere Runden drehen und nachfragen, bis er die Adresse gefunden hatte. Doktor Urbino erkannte von nahem die Schwermut der Sumpflagunen wieder, ihre unheilvolle Stille, diese Blähungen eines Ertrunkenen, die so oft in schlaflosen Morgenstunden vermischt mit den Düften der Jasminsträucher im Hof bis zu seinem Zimmer aufstiegen und die er vorbeistreichen spürte wie einen Wind von gestern, der nichts mit seinem Leben zu tun hatte. Doch jene vom Heimweh oft verklärte Pestilenz hatte plötzlich eine unerträgliche Gegenwärtigkeit, als der Wagen durch die Schlammpfützen der Straßen zu rumpeln begann, wo die Geier sich um die von Ebbe und Flut mitgeschleiften Schlachthofabfälle stritten. Im Unterschied zu der Stadt der Vizekönige mit ihren Steinbauten waren hier die Häuser aus verblichenem Holz errichtet und hatten Weißblechdächer. Die meisten standen auf Pfählen, damit bei Hochwasser nicht die Abwässer aus den offenen Kloaken, einem Erbe der Spanier, hereingespült würden. Alles machte einen ärmlichen und verwahrlosten Eindruck, aber aus den schäbigen Kneipen donnerte Parrandamusik, dort feierten die Armen ohne Gott und Gesetz ihr Pfingstfest. Als endlich die Adresse gefunden war, wurde die Kutsche schon von Banden nackter Kinder verfolgt, die sich über die theatralische Aufmachung des Kutschers lustig machten, weshalb dieser sie mit der Peitsche zu vertreiben suchte. Doktor Urbino, der sich auf einen vertraulichen Besuch eingestellt hatte, begriff, daß es keine gefährlichere Naivität als die seines Alters gab.
Das Äußere des Hauses ohne Nummernschild unterschied sich in nichts von den weniger glücklichen, einmal abgesehen von einem Fenster mit Spitzengardinen und dem Portal, das aus irgendeiner alten Kirche herangeschafft worden war. Der Kutscher betätigte den Türklopfer, und erst als er sich davon überzeugt hatte, daß es sich um die richtige Adresse handelte, half er dem Arzt aus der Kutsche. Die Tür hatte sich geräuschlos geöffnet, und in der Dämmerung des Innenraums stand eine Frau mittleren Alters, ganz in Schwarz und mit einer roten Rose hinter dem Ohr. Trotz ihrer Jahre, wohl mindestens vierzig, war sie immer noch eine stolze Mulattin, die Augen golden und grausam und das Haar wie ein Helm aus Stahlwolle fest um den Schädel gelegt. Doktor Urbino erkannte sie nicht, obwohl er sie mehrmals im Nebel der Schachpartien bei dem Fotografen gesehen hatte und ihr gelegentlich ein Rezept für Chinin gegen Wechselfieber ausgeschrieben hatte. Er streckte ihr die Hand entgegen, und sie nahm sie zwischen ihre beiden, weniger um ihn zu begrüßen, als um ihm beim Hereinkommen zu helfen. Im Raum war die Luft und das unsichtbare Raunen eines Waldes, er war vollgestellt mit Möbeln und Nippes, alles stimmig angeordnet. Doktor Urbino erinnerte sich ohne Bitterkeit an das Lädchen eines Antiquars in Paris, an einen Herbstmontag des vergangenen Jahrhunderts in der Rue Montmartre 26. Die Frau setzte sich ihm gegenüber und sprach ihn in einem ungelenken Spanisch an.
»Fühlen Sie sich wie zu Hause, Doktor«, sagte sie. »Ich hatte Sie nicht so schnell erwartet.«
Doktor Urbino fühlte sich verraten. Er sah sie mit den Augen seines Herzens, bemerkte ihre strenge Trauer, die Würde ihres Leids und erkannte, daß dies ein überflüssiger Besuch war, weil sie über all das, was in Jeremiah de Saint-Amours Abschiedsbrief ausgesprochen und gerechtfertigt worden war, mehr wußte als er. So war es: Bis wenige Stunden vor seinem Tod hatte sie ihn begleitet, wie sie ihn ein halbes Leben lang begleitet hatte, mit einer Hingabe und einer unterwürfigen Zärtlichkeit, die allzusehr der Liebe ähnelten, ohne daß es jemand in dieser schläfrigen Provinzhauptstadt, wo doch selbst Staatsgeheimnisse allgemein bekannt waren, gewußt hätte. Sie hatten sich in einer Wandererherberge in Port-au-Prince kennengelernt, wo sie geboren war und er seine erste Flüchtlingszeit verbracht hatte, und sie war ihm ein Jahr später für einen kurzen Besuch hierher gefolgt, obwohl beide, ohne es abgesprochen zu haben, wußten, daß sie gekommen war, um für immer zu bleiben. Sie übernahm es, einmal die Woche das Atelier zu putzen und aufzuräumen, doch sogar die Nachbarn mit den üppigsten Hintergedanken hielten den Anschein nicht für die Wahrheit, weil sie wie jedermann davon ausgingen, daß Jeremiah de Saint-Amours Invalidität nicht nur aufs Gehen beschränkt war. Selbst Doktor Urbino nahm das aus fundierten medizinischen Gründen an und wäre nie auf den Gedanken gekommen, daß der Fotograf eine Frau gehabt haben könnte, hätte jener es nicht selbst im Brief enthüllt. Auf jeden Fall fiel es ihm schwer zu begreifen, daß zwei ungebundene Erwachsene ohne Vergangenheit und abseits der Vorurteile einer selbstgerechten Gesellschaft das Wagnis der verbotenen Liebe gewählt hatten. Sie erklärte es ihm: »Es war sein Wunsch.« Außerdem hielt sie selbst die mit diesem Mann, der nie ganz der ihre gewesen war, geteilte Heimlichkeit, in der sie mehr als einmal die jähe Explosion des Glücks erfahren hatten, beileibe nicht für einen reizlosen Zustand. Im Gegenteil: Das Leben hatte ihr bewiesen, daß er vielleicht vorbildlich war.
In der vergangenen Nacht waren sie ins Kino gegangen, jeder für sich und auf getrennten Sitzen, wie sie das mindestens zweimal im Monat taten, seitdem der italienische Einwanderer Don Galileo Daconte ein Kino in den Ruinen eines Klosters aus dem siebzehnten Jahrhundert eingerichtet hatte. Der Film war nach einem Buch gedreht worden, das im Jahr zuvor Mode gewesen war und das auch Doktor Urbino gelesen hatte, das Herz voll Gram ob der Barbarei des Krieges: Im Westen nichts Neues. Später hatten sie sich im Atelier getroffen. Er wirkte abwesend und elegisch auf sie, und sie dachte, es sei wegen der brutalen Szenen mit den Verwundeten im Morast. Um ihn abzulenken, forderte sie ihn zu einer Partie Schach auf, und er tat ihr den Gefallen, spielte aber unkonzentriert, mit Weiß, natürlich, bis er noch vor ihr bemerkte, daß er in vier weiteren Zügen schachmatt sein würde, und sich ehrlos ergab. Da begriff der Arzt, daß sie und nicht, wie er angenommen hatte, General Jerónimo Argote der Gegner der letzten Partie gewesen war. Erstaunt murmelte er:
»Es war eine meisterhafte Partie!«
Sie bestand darauf, daß das nicht ihr Verdienst gewesen sei, vielmehr habe Jeremiah de Saint-Amour, der sich schon in den Nebeln des Todes verloren hatte, die Figuren lieblos gezogen. Als er die Partie unterbrach, etwa um Viertel nach elf, die Musik der öffentlichen Tanzfeste war schon verklungen, bat er sie, ihn alleinzulassen. Er wollte einen Brief an Doktor Juvenal Urbino schreiben, den er für den achtbarsten Mann hielt, dem er je begegnet war, und zudem für einen Seelenfreund, wie er gern sagte, obwohl ihre einzige Gemeinsamkeit das Laster des Schachspiels war, das sie als Dialog der Vernunft und nicht als Wissenschaft betrachteten. Da hatte sie gewußt, daß Jeremiah de Saint-Amour am Ende seiner Agonie angelangt war und ihm gerade noch soviel Zeit zum Leben blieb, um diesen Brief zu schreiben.
Der Arzt wollte es nicht glauben.
»Sie wußten es also!« rief er aus.
Sie hatte es nicht nur gewußt, sondern ihm auch mit der gleichen Liebe geholfen, die Agonie zu ertragen, mit der sie ihm geholfen hatte, das Glück zu entdecken. Denn das waren seine letzten elf Monate gewesen: eine grausame Agonie.
»Es wäre Ihre Pflicht gewesen, das anzuzeigen«, sagte der Arzt.
»Das hätte ich ihm nicht antun können«, sagte sie empört. »Ich liebte ihn zu sehr.«
Doktor Urbino, der glaubte, bereits alles gehört zu haben, hatte dergleichen noch nie gehört, und schon gar nicht auf so einfache Weise gesagt. Er schaute sie geradeheraus an, mit all seinen fünf Sinnen, um sie sich so einzuprägen, wie sie in jenem Augenblick war: Sie glich einer Flußgottheit, unerschrocken in ihrem schwarzen Kleid, mit den Augen einer Schlange und der Rose hinter dem Ohr. Vor sehr langer Zeit, an einem einsamen Strand von Haiti, wo beide nach der Liebe nackt ruhten, hatte Jeremiah de Saint-Amour auf einmal geseufzt: »Ich werde nie alt.« Sie deutete das als heroischen Vorsatz, einen unerbittlichen Kampf gegen die zerstörerische Vergänglichkeit zu führen, doch er wurde noch deutlicher: Er habe die unumstößliche Absicht, sich mit sechzig das Leben zu nehmen.
Tatsächlich war er am dreiundzwanzigsten Januar dieses Jahres sechzig geworden, und damals hatte er sich als letzten Termin den Tag vor Pfingsten gesetzt, dem höchsten Fest in dieser der Anbetung des Heiligen Geistes geweihten Stadt. Es gab nicht die geringste Kleinigkeit in der vergangenen Nacht, die sie nicht schon im vorhinein gekannt hätte, oft hatten sie darüber gesprochen und gemeinsam die unwiederholbare Sturzflut der Tage, die weder er noch sie aufhalten konnten, über sich ergehen lassen. Jeremiah de Saint-Amour liebte das Leben mit einer ziellosen Leidenschaft, er liebte das Meer und die Liebe, liebte seinen Hund und liebte sie, und je näher das Datum rückte, holte ihn die Verzweiflung ein, als sei sein Tod nicht der eigene Entschluß, sondern ein unentrinnbares Schicksal.
»Als ich ihn gestern nacht alleinließ, war er schon nicht mehr von dieser Welt«, sagte sie.
Sie hatte den Hund mitnehmen wollen, doch er hatte ihn angeschaut, wie er dösend neben den Krücken lag, und ihn mit den Fingerspitzen gestreichelt. Er sagte: »Tut mir leid, aber Mister Woodrow Wilson geht mit mir.« Er bat sie, das Tier, während er schrieb, an ein Bein des Feldbetts zu binden. Sie tat es, knüpfte aber einen falschen Knoten, damit es sich befreien könne. Das war der einzige Akt der Untreue, den sie begangen hatte, und er war gerechtfertigt durch den Wunsch, in den Winteraugen des Hundes die Erinnerung an seinen Herrn zu bewahren. Aber Doktor Urbino unterbrach sie und erzählte, daß der Hund sich nicht befreit habe. Sie sagte: »Dann hat er es nicht anders gewollt.« Und sie freute sich, weil sie doch lieber des Geliebten so gedenken wollte, wie er es in der vergangenen Nacht von ihr erbeten hatte, als er den schon begonnenen Brief unterbrach, um sie ein letztes Mal anzusehen.
»Denk mit einer Rose an mich«, hatte er gesagt.
Kurz nach Mitternacht war sie heimgekommen. Sie legte sich dann angezogen aufs Bett und rauchte, zündete eine Zigarette an der anderen an, um ihm Zeit zu geben, den Brief, von dem sie wußte, daß er lang und schwierig war, zu beenden, und kurz vor drei, als die Hunde zu heulen begannen, stellte sie das Wasser für den Kaffee auf den Herd, kleidete sich ganz in Trauer und schnitt im Hof die erste Rose des Morgengrauens. Doktor Urbino war schon bald klargeworden, wie sehr ihm die Erinnerung an diese nicht zu erlösende Frau zuwider sein würde, und er glaubte den Grund dafür zu kennen: Nur eine prinzipienlose Person konnte den Schmerz so willig empfangen.
Bis zum Ende seines Besuchs lieferte sie ihm dafür noch weitere Argumente. Sie werde nicht zur Beerdigung gehen, weil sie es ihrem Geliebten so versprochen habe, obgleich Doktor Urbino Gegenteiliges aus einem Absatz des Briefes entnommen zu haben glaubte. Sie werde keine Tränen vergießen, und sie werde die ihr verbleibenden Jahre nicht im fauligen Saft ihrer Erinnerungen schmoren, sie werde sich in diesen vier Wänden nicht lebendig begraben, um, wie es von den einheimischen Witwen erwartet wurde, ihr Leichentuch zu nähen. Sie wollte Jeremiah de Saint-Amours Haus, das jetzt, wie es der Brief bestimmte, mit allem Inventar ihr gehörte, verkaufen und klaglos wie immer weiterleben, wo sie glücklich gewesen war, in diesem Sterbequartier der Armen.
Dieser Satz verfolgte Doktor Juvenal Urbino auf seinem Heimweg: »Dieses Sterbequartier der Armen.« Das war keine unverdiente Bezeichnung. Denn die Stadt, seine Stadt, war die gleiche geblieben am Rande der Zeit: die gleiche glühende und ausgedörrte Stadt seiner nächtlichen Ängste und der einsamen Lüste der Pubertät, wo die Blumen oxydierten und das Salz sich zersetzte, eine Stadt, der in vier Jahrhunderten nicht mehr eingefallen war, als langsam zwischen welkem Lorbeer und fauligen Gewässern zu altern. Im Winter überschwemmten reißende Platzregen die Kloaken und verwandelten die Straßen in ekelerregende Kotpfade. Im Sommer drang ein unsichtbarer Staub, rauh wie glühende Kreide, sogar durch die gesichertsten Ritzen der Imagination, aufgestört von wahnsinnigen Winden, die Häuser abdeckten und Kinder in die Lüfte wirbelten. Jeden Samstag verließ das Bettelvolk der Mulatten im Tumult seine Hütten aus Dachpappe und Wellblech am Ufer der Moraste und nahm samt Haustieren und allem Drum und Dran zum Essen und Trinken im Jubelsturm die steinigen Strände der Kolonialstadt. Bis vor wenigen Jahren konnte man noch ein paar alte Männer sehen, die das mit glühenden Eisen eingebrannte Sklavenzeichen auf der Brust trugen. Das Wochenende über tanzten alle gnadenlos, besoffen sich tödlich mit hausgebranntem Schnaps, gaben sich der freien Liebe zwischen dem Icaco-Gestrüpp hin und lösten sonntags um Mitternacht ihre eigenen Fandangos in blutigen Schlägereien auf, in denen dann jeder gegen jeden kämpfte. Es war die gleiche ungestüme Menschenmenge, die sich den Rest der Woche über mit fliegenden Ständen von allem, was nur irgendwie kauf- und verkaufbar war, auf den Plätzen und Gäßchen der Altstadt drängte und dieser toten Stadt die Tollheit eines Menschenmarktes verlieh, der nach gebackenem Fisch roch: ein neues Leben.
Die Unabhängigkeit von der spanischen Herrschaft und später dann die Abschaffung der Sklaverei beschleunigten die ehrenhafte Dekadenz, in der Doktor Juvenal Urbino geboren und groß geworden war. Die vormals mächtigen Familien tauchten in das Schweigen ihrer ungeschützten Stadtburgen. In den verwinkelten Kopfsteinpflastergassen, die sich bei Kriegsüberfällen und bei den Landungen der Freibeuter als so vorteilhaft erwiesen hatten, wuchs das Unkraut über die Balkone herunter und sprengte selbst bei den gepflegtesten Häusern Risse in die festgemauerten Wände, und um zwei Uhr nachmittags waren die schleppenden Klavierübungen im Dämmer der Siesta das einzige Lebenszeichen. Drinnen in den kühlen, weihrauchgesättigten Schlafzimmern schützten sich die Frauen vor der Sonne wie vor einer schändlichen Ansteckung, und sogar bei den Frühmetten deckten sie das Gesicht mit einer Mantilla ab. Ihre Liebesgeschichten waren langsam und verwickelt, oft gestört von düsteren Voraussagen, und das Leben erschien ihnen endlos. Wenn der Abend kam und der Straßenverkehr beklemmend wurde, erhob sich aus den Sümpfen eine Gewitterwolke blutgieriger Mosquitos, und ein zarter Dunst von Menschenscheiße, lau und trist, wühlte im Seelengrund die Todesgewißheit auf.
Denn das Eigenleben der kolonialen Altstadt, das der junge Juvenal Urbino in seinen Pariser Melancholien gern verklärt hatte, war zu jener Zeit eine bloße Illusion der Erinnerung. Im achtzehnten Jahrhundert war die Stadt das blühende Handelszentrum der Karibik gewesen, insbesondere wegen des unrühmlichen Privilegs, der größte Umschlagplatz für afrikanische Sklaven in beiden Amerikas zu sein. Außerdem pflegten die Vizekönige von Neu Granada hier zu residieren, da sie lieber mit Blick auf den Weltozean regierten als in der fernen und eisigen Hauptstadt, wo der Nieselregen von Jahrhunderten ihnen den Sinn für die Wirklichkeit verrückte. Mehrmals im Jahr sammelten sich in der Bucht die Galeonenflotten, beladen mit den Schätzen aus Potosí, Quito und Veracruz, das war die glorreiche Zeit der Stadt. Am Freitag, dem 8. Juni 1708 um vier Uhr nachmittags, wurde die Galeone San José, die eben mit einer Fracht von Edelsteinen, Gold und Silber Kurs auf Cádiz genommen hatte, vor der Hafeneinfahrt von einem englischen Geschwader versenkt, und zwei lange Jahrhunderte später war sie noch nicht geborgen worden. Der Schatz ruhte mit dem in der Kommandobrücke seitlich treibenden Kapitän auf Korallengründen und wurde von den Geschichtsschreibern gern als Emblem dieser in Erinnerungen ertrunkenen Stadt beschworen.
Auf der anderen Seite der Bucht, im Villenviertel La Manga, stand das Haus von Doktor Juvenal Urbino in einer anderen Zeit. Es war groß, kühl, einstöckig und hatte auf der Außenterrasse einen Portikus mit dorischen Säulen, von dem aus man das stehende Gewässer der Bucht mit seinen Krankheitskeimen und all dem Schiffbruchsmüll überblickte. Der Boden war von der Eingangstür bis in die Küche im Schachbrettmuster schwarzweiß gefliest, was oft auf die alles beherrschende Leidenschaft des Doktor Urbino zurückgeführt worden war, ohne dabei zu bedenken, daß es sich um eine verbreitete Schwäche der katalanischen Maurermeister handelte, die dieses Viertel der Neureichen zu Anfang des Jahrhunderts gebaut hatten. Der Salon war weitläufig, hatte wie das ganze Haus hohe Decken und sechs Türfenster zur Straße; vom Eßzimmer war er durch eine riesige mit Weinlaub und Trauben verzierte Glastür getrennt, auf deren Gitter sich Jungfrauen in einem Bronzehain von den Hirtenflöten der Faune verführen ließen. Die Möbel des Salons, einschließlich der Pendeluhr, die etwas von der Präsenz einer leibhaftigen Wache hatte, stammten aus dem viktorianischen England, die Hängelampen waren Lüster aus Bergkristall, und überall standen Krüge und Vasen aus Sèvres sowie Alabasterstatuetten mit heidnischen Idyllen. Doch diese europäische Stimmigkeit verlor sich im übrigen Haus, wo die Korbsessel sich unter Wiener Schaukelstühle und Lederhocker aus heimischen Werkstätten mischten. In den Schlafzimmern gab es neben den Betten prächtige, von bunten Fransen gesäumte Hängematten aus San Jacinto, auf die mit Seide und in gotischen Lettern der Name des Besitzers gestickt war. Den ursprünglich für Galadiners vorgesehenen Raum neben dem Eßzimmer nutzte man als kleinen Musiksaal, dort wurden, wenn berühmte Interpreten kamen, Konzerte im kleinen Kreis gegeben. Um die Akustik des Raumes zu verbessern, hatte man die Fliesen mit bei der Pariser Weltausstellung gekauften türkischen Teppichen bedeckt, ein Grammophon befand sich neben einem Regal wohlgeordneter Platten, und in einer Ecke stand, mit einem Übertuch aus Manila bedeckt, das Klavier, auf dem Doktor Urbino seit vielen Jahren nicht mehr gespielt hatte. Im ganzen Haus war die Vernunft und die Umsicht einer Frau zu spüren, die mit beiden Beinen auf der Erde stand.
Kein anderer Platz offenbarte jedoch eine so pedantische Feierlichkeit wie die Bibliothek, die Doktor Urbinos Allerheiligstes gewesen war, bevor ihn das Alter einholte. Dort, um den Nußbaumschreibtisch seines Vaters und die lederbezogenen Polstersessel, ließ er die Wände und sogar die Fenster mit verglasten Bücherschränken vollstellen, in denen er, in einer fast irrwitzigen Ordnung, dreitausend identisch eingebundene Bücher mit seinem Monogramm in Gold auf dem Kalbslederrücken verwahrte. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern, die den Verwüstungen und dem fauligen Atem des Hafens preisgegeben waren, bewahrte die Bibliothek stets den Geruch und die Verschwiegenheit einer Abtei. Geboren und aufgewachsen im karibischen Aberglauben, durch das Öffnen von Fenstern und Türen eine Frische einzulassen, die es in Wirklichkeit nicht gab, hatten Doktor Urbino und seine Frau in geschlossenen Räumen zunächst Herzbeklemmungen verspürt. Sie überzeugten sich jedoch schließlich von den Vorteilen der römischen Methode zur Abwehr der Hitze, die darin besteht, die Häuser vor der Bruthitze des August geschlossen zu halten, um die glühende Luft von der Straße nicht eindringen zu lassen, und dann den Nachtwinden Fenster und Türen zu öffnen. Von da an war ihr Haus das kühlste unter der wilden Sonne von La Manga, und es war beglückend, in den schattigen Schlafzimmern Siesta zu halten und sich gegen Abend in den Portikus zu setzen, um die Frachtdampfer aus New Orleans aschgrau und schwer vorbeiziehen zu sehen, sowie die Flußdampfer, die mit ihren hölzernen Schaufelrädern hellerleuchtet durch die Dämmerung fuhren und mit einer Musikschleppe die stille Müllbrühe der Bucht reinigten. Es war auch das bestgeschützte Haus, wenn von Dezember bis März die Passatwinde aus dem Norden die gedeckten Dächer aufrüttelten und die Nacht über wie hungrige Wölfe um das Haus strichen, auf der Suche nach einem Spalt, durch den sie eindringen könnten. Niemand kam je auf den Gedanken, daß es für eine Ehe, die auf solche Fundamente gesetzt war, irgendeinen Grund geben könnte, nicht glücklich zu sein.
Doktor Urbino war es jedenfalls nicht, als er an jenem Morgen kurz vor zehn heimkam, verstört nach den beiden Besuchen, die ihn nicht nur um die Pfingstmesse gebracht hatten, sondern ihn auch in seinem Alter noch, wo alles schon hinter ihm zu liegen schien, zu verändern drohten. Er hatte vor, eine morgendliche Hundesiesta zu halten, bis die Zeit zum Festmahl bei Doktor Lácides Olivella kam, fand aber ein aufgeregtes Personal vor, das versuchte, den Papagei einzufangen, der, als man ihn aus dem Käfig geholt hatte, um ihm die Flügel zu stutzen, auf den höchsten Ast des Mangobaums entflogen war. Es war ein gerupfter und launischer Papagei, der nicht sprach, wenn man ihn dazu aufforderte, dafür aber bei den unverhofftesten Gelegenheiten, und dann mit so viel Klarheit und Verstand, wie sie auch bei menschlichen Wesen ungewöhnlich sind. Er war von Doktor Urbino persönlich abgerichtet worden, und das hatte ihm Privilegien eingebracht, die niemand in der Familie je gehabt hatte, nicht einmal die Kinder, als sie noch klein waren.
Er war seit über zwanzig Jahren im Haus, und niemand wußte, wie lange er schon davor gelebt hatte. Jeden Nachmittag nach der Siesta setzte sich Doktor Urbino mit ihm auf die Patioterrasse, den kühlsten Ort des Hauses, und scheute in seiner pädagogischen Leidenschaft auch nicht die mühseligsten Wege, um dem Papagei Französisch beizubringen, bis der wie ein Akademiemitglied sprach. Danach brachte er ihm, da er nun schon mal dabei war, die Messe auf lateinisch bei und einige ausgewählte Stücke aus dem Matthäusevangelium, vergeblich versuchte er dann, ihm eine mechanische Kenntnis der vier arithmetischen Operationen einzutrichtern. Von einer seiner letzten Europareisen hatte er den ersten Phonographen mit Schallmuschel mitgebracht, etliche Modeplatten und einige mit der Musik seiner klassischen Lieblingskomponisten. Tag für Tag, wieder und wieder, ließ er den Papagei mehrere Monate lang die Lieder von Yvette Gilbert und Aristide Bruant, die das Frankreich des vergangenen Jahrhunderts entzückt hatten, hören, bis der sie auswendig kannte. Er sang sie mit Frauenstimme, wenn es ihre Passagen waren, und im Tenor, wenn es seine waren, und endete mit einem wüsten Gelächter, das meisterhaft das der Dienstmädchen wiedergab, wenn sie ihn französisch singen hörten. Der Ruhm seiner Künste reichte so weit, daß manchmal distinguierte Reisende, die mit den Flußdampfern aus dem Landesinnern kamen, darum baten, ihn sehen zu dürfen. Bei einer Gelegenheit hatten einige von den vielen englischen Touristen, die zu jener Zeit auf den Bananenschiffen von New Orleans reisten, ihn für jeden Preis kaufen wollen. Der Tag seines größten Ruhms war jedoch, als der Präsident der Republik, Don Marco Fidel Suárez, mit allen Ministern seines Kabinetts ins Haus kam, um sich persönlich davon zu überzeugen, daß dieser Ruhm begründet war. Sie kamen etwa um drei Uhr nachmittags an, fast erstickt unter den Zylinderhüten und den Gehröcken aus schwerem Tuch, die sie während des dreitägigen offiziellen Besuchs unter einem glühenden Augusthimmel nicht ausgezogen hatten, mußten dann aber so neugierig gehen, wie sie gekommen waren, denn der Papagei weigerte sich zwei verzweifelte Stunden lang, auch nur Piep zu sagen, trotz der flehentlichen Bitten, der Drohungen und der öffentlichen Schmach des Doktor Urbino, der, entgegen den weisen Ratschlägen seiner Frau, auf der tollkühnen Einladung bestanden hatte.
Die Tatsache, daß der Papagei auch nach diesem historischen Affront noch seine Privilegien behielt, war der letzte Beweis für seine sakrale Sonderstellung. Kein anderes Tier war im Haus erlaubt, außer der Erdschildkröte, die drei oder vier Jahre, nachdem man sie endgültig verloren geglaubt hatte, wieder in der Küche aufgetaucht war. Sie aber wurde nicht als Lebewesen angesehen, sondern eher als mineralischer Glücksbringer, von dem man nie genau wußte, wo er sich gerade befand. Doktor Urbino weigerte sich zuzugeben, daß er Tiere haßte, und vertuschte das durch alle möglichen wissenschaftlichen Fabeln und philosophischen Ausreden, die viele, nicht aber seine Frau, überzeugten. Er sagte, daß wer Tiere übertrieben liebe, zu den größten Grausamkeiten gegenüber Menschen fähig sei. Er sagte, daß Hunde nicht treu, sondern unterwürfig seien, Katzen opportunistisch und verräterisch, daß Pfauen Herolde des Todes, Makais nicht mehr als hinderliche Dekorationsstücke seien, daß Kaninchen die Habgier förderten, Kapuzineraffen das Fieber der Wollust übertrügen und die Hähne verdammt seien, weil sie sich dazu hergegeben hätten, daß Christus dreimal verleugnet wurde.
Seine Frau Fermina Daza hingegen, die damals zweiundsiebzig Jahre alt war und schon den Gang einer Hindin früherer Zeiten verloren hatte, war eine irrationale Anbeterin von äquatorialen Blumen und von Haustieren und hatte zu Anfang der Ehe die Neuheit der Liebe genutzt, um sehr viel mehr davon ins Haus zu bringen, als der gesunde Menschenverstand empfahl. Als erste kamen drei Dalmatiner mit den Namen römischer Imperatoren, die sich gegenseitig um die Gunst eines Weibchens zerfleischten, das seinem Namen Messalina alle Ehre machte, da sie länger dazu brauchte, neun Welpen zu werfen, als weitere zehn auszutragen. Dann kamen die abessinischen Katzen mit ihrem Adlerprofil und den pharaonischen Manieren, die schielenden Siamkatzen, höfische Perserkatzen mit orangefarbenen Augen, die wie Geisterschatten durch die Zimmer glitten und in den Nächten mit den Schreien ihres Liebessabbats Aufruhr stifteten. Einige Jahre lang hatte sie einen amazonischen Kapuzineraffen, der um den Bauch herum an den Mangobaum im Hof gekettet wurde und der so etwas wie Mitleid weckte, da er das trübselige Antlitz, die Unschuldsaugen und beredten Hände des Erzbischofs Obdulio y Rey hatte, doch nicht deswegen entledigte sich Fermina Daza seiner, sondern weil er die schlechte Angewohnheit hatte, sich in Gegenwart der Damen zu befriedigen.
In den Gängen gab es Käfige mit den verschiedensten Arten von Vögeln aus Guatemala, dazu wachsame Rohrdommeln, Sumpfreiher mit langen gelben Beinen und einen Junghirsch, der sich in die Fenster hineinreckte, um die Anthurien aus den Vasen zu fressen. Kurz vor dem letzten Bürgerkrieg, als zum ersten Mal von einem möglichen Besuch des Papstes die Rede war, hatte Fermina Daza aus Guatemala einen Paradiesvogel kommen lassen, der, als bekannt wurde, daß die päpstliche Reise eine Erfindung der Regierung gewesen war, um die gegen sie verschworenen Liberalen zu schrecken, schneller wieder in sein Land zurückgelangte, als es gedauert hatte, ihn herbeizuschaffen. Ein anderes Mal kaufte sie auf einem Segelschiff der Curaçao-Schmuggler einen Drahtkäfig mit sechs duftenden Raben, ganz ähnlich jenen, die Fermina Daza als Kind im Elternhaus gehabt hatte und die sie nun als verheiratete Frau wieder haben wollte. Doch niemand konnte das ständige Geflatter ertragen, das nun das Haus mit einer Ausdünstung wie von Totenkränzen erfüllte. Auch eine vier Meter lange Anakonda wurde angeschafft, eine schlaflose Jägerin, deren Seufzer die Dunkelheit der Schlafzimmer aufstörte; allerdings erreichten sie mit ihr das Gewünschte: Ihr todbringender Atem vertrieb die Fledermäuse und Salamander und die vielfältigen Arten schädlicher Insekten, die in den Regenmonaten ins Haus eindrangen. Doktor Urbino, damals von seinem Beruf sehr gefordert und zudem abgelenkt von seinen staatsbürgerlichen und kulturellen Initiativen, gab sich mit der Vermutung zufrieden, daß, inmitten von so vielen abscheulichen Kreaturen, seine Gattin nicht nur die schönste Frau im karibischen Raum war, sondern auch die glücklichste. An einem regnerischen Nachmittag jedoch, nach einem aufreibenden Arbeitstag, fand er in seinem Haus eine Katastrophe vor, die ihn in die Wirklichkeit zurückholte. In der Empfangshalle und so weit der Blick reichte, trieb in einer gewaltigen Blutlache eine Unzahl toter Tiere. Die Dienstmädchen waren auf die Stühle geklettert und wußten nicht, was tun, sie hatten sich von der Panik des Gemetzels noch nicht erholt.
Tatsache war, daß eine der Deutschen Doggen aufgrund eines plötzlichen Tollwutanfalls durchgedreht war und jedwedes Tier, das ihr in den Weg kam, zerfleischt hatte, bis der Gärtner des Nachbarhauses Mut gefaßt hatte, sich ihr entgegenstellte und sie mit Machetehieben zerstückelte. Man wußte nicht, wie viele Tiere der Hund gebissen oder mit seinem grünen Geifer angesteckt hatte, sodaß Doktor Urbino befahl, die Überlebenden zu töten und die Kadaver auf einem abgelegenen Feld einzuäschern. Auch bat er den Außendienst des Hospital de la Misericordia um eine gründliche Desinfektion des Hauses. Die einzige, die sich rettete, weil niemand an sie gedacht hatte, war die männliche Glücksschildkröte.
Fermina Daza gab erstmals in einer häuslichen Angelegenheit ihrem Mann recht und hütete sich lange Zeit davor, von Tieren zu sprechen. Sie tröstete sich mit den Farbtafeln aus der Naturgeschichte von Linné, die sie einrahmen und an die Wände im Salon hängen ließ, und hätte vielleicht am Ende die Hoffnung verloren, je wieder ein Tier im Haus zu sehen, wenn nicht eines Tages bei Morgengrauen Räuber ein Badezimmerfenster eingedrückt und das über fünf Generationen vererbte Silberbesteck mitgenommen hätten. Doktor Urbino brachte Doppelschlösser an den Ringen der Fenster an, verwahrte die wertvollsten Gegenstände im Geldschrank und nahm verspätet die Kriegsgewohnheit an, mit dem Revolver unter dem Kopfkissen zu schlafen. Aber er widersetzte sich der Anschaffung eines scharfen Hundes, ob geimpft oder nicht, freilaufend oder an der Kette, selbst wenn ihn die Diebe bis auf die Haut ausrauben sollten.
»Es kommt mir nichts ins Haus, das nicht sprechen kann«, sagte er.
Er sagte es, um den Spitzfindigkeiten seiner Frau ein Ende zu setzen. Diese hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, wieder einen Hund zu kaufen, und er ahnte nicht, daß seine voreilige Verallgemeinerung ihn einmal das Leben kosten sollte. Fermina Daza, deren schroffer Charakter sich mit den Jahren abgeschliffen hatte, griff die sprachliche Leichtfertigkeit des Gatten wie im Flug auf: Ein paar Monate nach dem Diebstahl ging sie wieder zu den Seglern aus Curaçao und kaufte einen Königspapagei aus Paramaribo, der nur Matrosenflüche rufen konnte, diese aber mit einer so menschlichen Stimme hervorbrachte, daß er allemal den überhöhten Preis von zwölf Centavos wert war.
Es war einer von der guten Sorte, leichtgewichtiger als er aussah, mit gelbem Kopf und einer schwarzen Zunge, das einzige, woran man ihn von den Manglero-Papageien unterscheiden konnte, die nicht einmal mit Terpentinzäpfchen zum Sprechen zu bringen sind. Doktor Urbino war ein guter Verlierer, er beugte sich der Findigkeit seiner Frau und war selbst überrascht von dem Vergnügen, das ihm die Fortschritte des von den Dienstmädchen in Atem gehaltenen Papageien bereiteten. An Regennachmittagen, wenn sich diesem vor Freude über die eingeweichten Federn die Zunge löste, sagte er Sätze aus anderen Zeiten, die er nicht im Haus aufgeschnappt haben konnte und die vermuten ließen, daß er noch älter war, als er zu sein schien. Die letzten Vorbehalte des Arztes brachen in sich zusammen, als eines Nachts wieder einmal Diebe durch eine Luke der Dachterrasse einzubrechen versuchten und der Papagei sie mit dem Gebell einer Bulldogge vertrieb, das, wäre es echt gewesen, kaum so glaubhaft geklungen hätte, und dann schrie er noch: Haltet den Dieb, haltet den Dieb, zwei rettende Kunststückchen, die er nicht im Haus erlernt hatte. Damals hatte sich Doktor Urbino seiner angenommen, er ließ unter dem Mangobaum einen Bügel mit einem Wassernapf und einer Schale für reife Bananen anbringen und dazu noch ein Trapez zum Turnen. Von Dezember bis März, wenn die Nächte kälter wurden und es draußen wegen der Nordwinde nicht mehr auszuhalten war, holten sie ihn in dem mit einem Tuch bedeckten Käfig ins Haus, obwohl Doktor Urbino argwöhnte, daß sein chronischer Rotz für die Atemwege der Menschen gefährlich sein könnte. Viele Jahre lang stutzte man ihm die Flügel und ließ ihn frei, damit er mit seinem Gang eines alten Reiters nach Laune herumlaufen konnte. Eines Tages aber begann er akrobatische Kunststückchen auf den Küchenbalken zu vollführen und fiel mit dem maritimen Schrei Mann über Bord in den Fleischtopf, hatte dabei aber viel Glück, denn der Köchin gelang es, ihn mit der Schöpfkelle herauszuholen, verbrüht und federlos, aber noch lebend. Von da an ließen sie ihn gegen den Volksglauben, daß eingesperrte Papageien das Gelernte vergessen, auch tagsüber im Käfig und holten ihn nur um vier Uhr, wenn es frischer wurde, für die Lektionen von Doktor Urbino auf die Patioterrasse heraus. Niemand hatte rechtzeitig bemerkt, daß seine Flügel zu lang gewachsen waren, und als man sie ihm an jenem Morgen dann schneiden wollte, war er auf die Spitze des Mangobaumes entflogen.
Es war nach drei Stunden noch nicht gelungen, ihn einzufangen. Die Dienstmädchen des Hauses, unterstützt von anderen aus der Nachbarschaft, versuchten ihn auf jede nur mögliche Weise herunterzulocken, doch er blieb unbeirrt auf seinem Platz, lachte lauthals und schrie: Es lebe die Liberale Partei, es lebe die Liberale Partei, Carajo! – ein wagemutiger Ruf, der schon mehr als vier harmlosen Trunkenbolden das Leben gekostet hatte. Doktor Urbino konnte den Vogel kaum zwischen dem Laub ausmachen, er versuchte ihn auf spanisch und französisch, ja sogar auf lateinisch zu überreden, und der Papagei antwortete jeweils in derselben Sprache, mit der gleichen Emphase und in der gleichen Stimmlage, rührte sich aber nicht von seinem Zweig. Davon überzeugt, daß es niemand im Guten schaffen würde, befahl Doktor Urbino, die Feuerwehr zu Hilfe zu holen, die sein neuestes gemeinnütziges Spielzeug war.
Bis vor kurzem waren in der Tat die Brände von Freiwilligen gelöscht worden, die mit von irgendwoher angeschleppten Wassereimern auf Maurerleitern standen, und das Durcheinander bei den Löscharbeiten war so groß gewesen, daß diese zuweilen mehr Verheerung als die Brände anrichteten. Seit dem vergangenen Jahr aber gab es dank einer Geldsammlung, angeregt von der Gesellschaft für den Ausbau öffentlicher Einrichtungen, deren Ehrenpräsident Juvenal Urbino war, eine Berufsfeuerwehr und einen Löschwasserwagen mit Sirene, Glocke und zwei Hochdruckschläuchen. Die Feuerwehr war der letzte Schrei, sodaß, immer wenn die Kirchenglocken Sturm läuteten, in den Schulen sogar der Unterricht unterbrochen wurde, damit die Kinder sich den Kampf gegen das Feuer ansehen konnten. Anfangs war Löschen das einzige, was die Feuerwehr tat. Doch Doktor Urbino erzählte den städtischen Behörden, daß er in Hamburg gesehen habe, wie Feuerwehrleute ein Kind wiedererweckten, das sie nach einem dreitägigen Schneesturm erfroren in einem Keller gefunden hatten. In einer neapolitanischen Gasse hatte er sie auch dabei beobachtet, wie sie von einem Balkon im zehnten Stock einen Sarg mit dem Toten herabließen, da die Treppen des Gebäudes derart verwinkelt waren, daß es die Familie nicht geschafft hatte, ihn auf die Straße herunterzubringen. So kam es, daß die örtlichen Feuerwehrleute lernten, auch andere Notdienste zu leisten, sie brachen Schlösser auf oder töteten giftige Schlangen, und im Medizinischen Institut war für sie ein spezieller Lehrgang in Erster Hilfe bei kleineren Unfällen abgehalten worden. Es war also keine Zumutung, sie um den Gefallen zu bitten, den Papagei vom Baum zu holen, dessen Verdienste nicht geringer waren als die eines Caballeros. Doktor Urbino sagte: »Richtet ihnen aus, daß ich darum bitte.« Dann ging er ins Schlafzimmer, um sich für das Festmahl umzukleiden. In Wahrheit ließ ihn, den der Brief von Jeremiah de Saint-Amour bedrückte, das Schicksal des Papageien im Augenblick kalt.
Fermina Daza hatte ein seidenes Hängerkleid angezogen, weit, locker und mit tiefsitzender Taille, sie hatte eine echte Perlenkette in sechs unregelmäßigen Reihen umgehängt und ein Paar hochhackige Atlasschuhe an, die sie nur bei sehr feierlichen Gelegenheiten trug, da ihr die Jahre solche Unvernunft nicht mehr erlaubten. Diese modische Aufmachung schien einer ehrwürdigen Großmutter kaum angemessen, paßte jedoch zu ihrem langknochigen Körper, der noch gerade und schlank war, zu ihren geschmeidigen Händen ohne Altersflecken, zu ihrem stahlblauen Haar, das auf Wangenhöhe schräg geschnitten war. Alles, was noch an ihr Hochzeitsbild erinnerte, war das Leuchten in ihren mandelbraunen Augen und die angeborene stolze Haltung, doch was ihr von alters wegen abging, glich sie reichlich durch Charakter und überreichlich durch Umsicht aus. Sie fühlte sich wohl: Weit zurück lagen die Jahrhunderte der Eisenkorsetts, der eingeschnürten Taillen, der kraft Stoffarrangements hochsitzenden Hüftpartien. Die befreiten Körper atmeten nach Lust und zeigten sich, wie sie waren. Auch noch mit zweiundsiebzig Jahren.
Doktor Urbino sah sie vor dem Toilettentisch unter den langsamen Flügeln des elektrischen Ventilators sitzen und den glockenförmigen Hut aufsetzen, den Veilchen aus Filz schmückten. Das Schlafzimmer war geräumig und licht, ein englisches Bett mit einem feinmaschigen rosa Moskitonetz stand darin, durch die zwei zu den Bäumen des Innenhofs offenen Fenster drang das Dröhnen der Zikaden herein, die von dem sich ankündigenden Regen aufgestört waren. Seit der Rückkehr von ihrer Hochzeitsreise wählte Fermina Daza die Kleidung ihres Mannes je nach Gelegenheit und Wetterlage aus und legte sie am Abend geordnet auf einen Stuhl, damit er, wenn er morgens aus dem Bad kam, alles bereit fand. Sie erinnerte sich nicht mehr daran, wann sie begonnen hatte, ihm auch beim Anziehen zu helfen, und wann sie dazu übergegangen war, ihn ganz anzuziehen, sie war sich aber dessen bewußt, daß sie es erst aus Liebe getan hatte, seit etwa fünf Jahren aber hatte sie keine andere Wahl, da er sich nicht mehr allein ankleiden konnte. Sie hatten gerade ihre