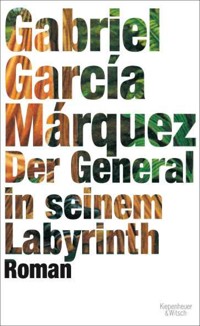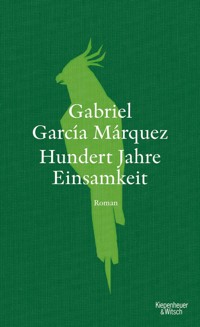
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Jahrhundertbuch in Neuübersetzung. Ein Klassiker, den zu lesen sich lohnt: immer noch und immer wieder. Mit seinem Roman »Hundert Jahre Einsamkeit«, der sich weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkaufte, gelang Gabriel García Márquez 1967 der Durchbruch als Schriftsteller. Die Familiensaga um das kolumbianische Dorf Macondo gehört inzwischen zu den modernen Klassikern der Weltliteratur. »Hundert Jahre Einsamkeit« erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Niedergang der Familie Buendía und des von ihr gegründeten Dorfes Macondo, das zunächst wie das Paradies erscheint. Durch Sümpfe und Urwald, durch eine undurchdringliche Sierra von der Außenwelt abgeschnitten, ist Macondo der einzigartige Schauplatz einer Welt, in der sich geschichtliche Entwicklungen, alle Träume, Alpträume und Entdeckungen des Menschen noch einmal wiederholen. Erzählt wird vom Leben und Sterben der Buendías, von ihrer Abenteuerlust und ihrer Erfindungsgabe, von ihren Triumphen und Niederlagen, von Wahnvorstellungen, von der unbändigen, aber auch fatalen Vitalität ihrer Männer und der Klugheit ihrer Frauen. Phantastische und realistische Elemente stehen unmittelbar nebeneinander, Mythos und Wirklichkeit verschmelzen. Im Mikrokosmos Macondo enthüllt Gabriel García Márquez die geschichtliche Wirklichkeit Lateinamerikas und die Tragödie seiner Verlorenheit und Einsamkeit. Stärker als die bisherige deutsche Fassung arbeitet die Neuübersetzung der vielfach ausgezeichneten Übersetzerin und García-Márquez-Spezialistin Dagmar Ploetz die unterschiedlichen stilistischen Ebenen des Romans heraus: pathetisch, witzig, lapidar, episch, poetisch. So gelingt ein Blick auf die Welt, der auch den Erfahrungen des 21. Jahrhunderts noch mühelos standhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Hundert Jahre Einsamkeit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, begann ein Jurastudium, arbeitete dann aber bald als Journalist und Schriftsteller und schuf ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk. Seit der Veröffentlichung von »Hundert Jahre Einsamkeit« gilt er weltweit als einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Autoren. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Marquez starb 2014 in Mexico City.
Posthum erschien 2024 der Roman »Wir sehen uns im August«.
Dagmar Ploetz, geboren 1946 in Herrsching, übersetzt seit 1983 u.a. Werke von Juan Rulfo, Isabel Allende, Rafael Chirbes, Manuel Puig, Juan Marsé und Gabriel García Márquez. 2005 wurde sie mit dem Jane-Scatcherd-Preis, 2012 mit dem Münchner Übersetzerpreis ausgezeichnet. 2010 veröffentlichte sie bei Kiepenheuer & Witsch »Gabriel García Márquez. Leben und Werk«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Hundert Jahre Einsamkeit« – ein Jahrhundertroman. 1967 gelang Gabriel García Márquez mit diesem Buch der Durchbruch. Zum 50. Jahrestag der Erstveröffentlichung und anlässlich des 90. Geburtstags seines Autors liegt der Roman nun in einer neuen Übersetzung von Dagmar Ploetz vor.
García Márquez erzählt vom Aufstieg und Niedergang der Familie Buendía und des von ihr gegründeten Dorfs Macondo. Abgeschnitten vom Rest der Welt durch Sümpfe, Urwald und eine undurchdringliche Sierra, ist es der Ort, an dem sich alle Träume, Alpträume und Entdeckungen des Menschen wiederholen. Üppig und bildkräftig, aber auch lakonisch und poetisch lässt García Márquez im Mikrokosmos Macondo ein Stück kolumbianischer Geschichte erstehen, erzählt von den Verstrickungen und Obsessionen der Buendías, von der unbändigen, aber auch fatalen Vitalität ihrer Männer und der störrischen Klugheit ihrer Frauen. Ein großer epischer Atem und kunstvolle anekdotische Miniaturen kennzeichnen diesen Roman, in dem Mythos und Wirklichkeit zu einem Universum verschmelzen, das dem Leser zugleich fern und nah ist.
Der Roman wurde in 37 Sprachen übersetzt und hat sich bisher mehr als 30 Millionen Mal verkauft.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Viele Jahre später
Als der Seeräuber
Pilar Terneras Sohn
Das neue Haus
Aureliano Buendía
Oberst Aureliano Buendía
Im Mai
Amaranta,
Oberst Gerineldo Márquez
Jahre später
Die Ehe wäre
Geblendet von
In der Wirrnis
Memes letzte Schulferien
Die Ereignisse
Es regnete
Úrsula musste
Aureliano verließ
Amaranta Úrsula kehrte
Pilar Ternera starb
Nachbemerkung
Für Jomí García Ascot und María Luisa Elío
Viele Jahre später, vor dem Erschießungskommando, sollte Oberst Aureliano Buendía sich an jenen fernen Nachmittag erinnern, als sein Vater ihn mitnahm, das Eis kennenzulernen. Macondo war damals ein Dorf von zwanzig Häusern, aus Lehm und Pfahlrohr am Ufer eines Flusses gebaut, dessen glasklares Wasser dahinschoss in einem Bett glatt polierter Steine, weiß und riesig wie prähistorische Eier. Die Welt war so neu, dass viele Dinge noch keinen Namen hatten, und wer von ihnen sprechen wollte, musste mit dem Finger auf sie zeigen. Jahr für Jahr im Monat März schlug eine zerlumpte Zigeunerfamilie ihr Zelt in Dorfnähe auf und kündigte unter großem Tamtam von Pfeifen und Trommeln die neuesten Erfindungen an. Zuerst brachten sie den Magneten mit. Ein stämmiger Zigeuner mit wildem Bart und den Krallen eines Sperlings stellte sich als Melquíades vor und schritt zur schauerlichen Vorführung dessen, was er als achtes Weltwunder der weisen Alchimisten aus Mazedonien anpries. Zwei Metallbarren hinter sich her schleifend, zog er von Haus zu Haus, und alle Welt verfiel in Angst und Schrecken, als Kessel, Bratpfannen, Zangen und Kohlebecken von ihrem Platz polterten, Nägel und Schrauben sich verzweifelt aus dem ächzenden Holz zu winden suchten, sogar Langvermisstes gerade dort auftauchte, wo man es am meisten gesucht hatte, und nun alles in wilder Auflösung hinter den magischen Eisen des Melquíades herrumpelte. »Die Dinge haben ein Eigenleben«, verkündete der Zigeuner mit hartem Akzent, »es geht nur darum, ihre Seele zu wecken.« José Arcadio Buendía, dessen rabiate Einbildungskraft immer über den Scharfsinn der Natur hinausging, ja noch Wunder und Magie übertraf, meinte, man könne sich dieser nutzlosen Erfindung bedienen, um der Erde das Gold zu entreißen. Melquíades, der ein ehrlicher Mann war, warnte ihn: »Dafür taugt sie nicht.« Doch José Arcadio Buendía glaubte zu jener Zeit nicht an die Ehrlichkeit der Zigeuner, also tauschte er sein Maultier und ein paar junge Ziegenböcke gegen die Magneteisen. Úrsula Iguarán, seine Frau, die damit rechnete, das kümmerliche Haushaltsbudget mit diesen Tieren aufzubessern, konnte es ihm nicht ausreden. »Bald haben wir Gold genug, um auch noch das Haus damit zu pflastern«, erwiderte ihr Mann. Mehrere Monate lang bemühte er sich, die Richtigkeit seiner Mutmaßungen zu beweisen. Stück für Stück erkundete er die Gegend, sogar den Grund des Flusses, indem er die zwei Eisenbarren hinter sich her zog und dabei laut die Zauberformel des Melquíades aufsagte. Zutage förderte er jedoch nur eine Rüstung aus dem 15. Jahrhundert, deren Einzelteile durch eine Rostkruste verschweißt waren und aus deren Innerem es wie aus einem riesigen, mit Steinen gefüllten Kürbis hallte. Nachdem es José Arcadio Buendía und den vier Männern seiner Expedition gelungen war, die Rüstung zu zerlegen, fanden sie darin ein verkalktes Gerippe, das ein Kupfermedaillon mit einer Frauenlocke um den Hals trug.
Im März kamen die Zigeuner wieder. Diesmal hatten sie ein Fernrohr dabei und eine trommelgroße Lupe, die sie als letzte Entdeckung der Amsterdamer Juden präsentierten. Sie setzten eine Zigeunerin ans andere Ende des Dorfes und bauten das Fernrohr am Eingang des Zeltes auf. Nach Zahlung von fünf Reales durften die Leute durch das Fernglas schauen und sahen die Frau zum Greifen nah. »Die Wissenschaft hat die Entfernungen aufgehoben«, posaunte Melquíades. »In Kürze wird der Mensch alles sehen können, was irgendwo auf der Erde geschieht, ohne aus dem Haus zu müssen.« An einem glühend heißen Mittag fand eine erstaunliche Vorführung der riesigen Lupe statt: Ein Haufen Heu wurde mitten auf die Straße geschafft und durch die Bündelung der Sonnenstrahlen in Brand gesetzt. José Arcadio Buendía, der den Misserfolg mit den Magneten noch nicht verwunden hatte, kam auf die Idee, diese neue Erfindung als Kriegswaffe zu nutzen. Wieder versuchte Melquíades, ihm das auszureden. Am Ende jedoch überließ er ihm die Lupe im Tausch für die zwei Magnetbarren und drei Münzen aus der Kolonialzeit. Úrsula weinte fassungslos. Das Geld stammte aus einer Schatulle mit Goldstücken, die ihr Vater im Laufe eines entbehrungsreichen Lebens angehäuft und die sie in Erwartung einer Gelegenheit, sie gut anzulegen, unter dem Bett vergraben hatte. José Arcadio Buendía machte nicht einmal den Versuch, sie zu trösten, so sehr ging er in seinen Experimenten zur Kriegstaktik auf, die er, auch bei Gefahr um Leib und Leben, mit der Selbstlosigkeit eines Wissenschaftlers betrieb. Um zu beweisen, was die Lupe bei feindlichen Truppen anrichten konnte, setzte er sich selbst den gebündelten Strahlen aus und erlitt dabei Brandverletzungen, die zu Geschwüren wurden und erst nach langer Zeit abheilten. Unter dem Protest seiner Frau, die über einen derart gefährlichen Erfindungseifer besorgt war, hätte er beinahe das Haus in Brand gesteckt. Er verbrachte lange Stunden in seinem Zimmer, stellte Berechnungen über die strategischen Möglichkeiten seiner neuartigen Waffe an, bis er ein Handbuch von erstaunlicher didaktischer Klarheit und zwingender Überzeugungskraft verfasst hatte. Er ergänzte es durch zahlreiche persönliche Erfahrungsberichte sowie mehrere Bögen erläuternder Zeichnungen und schickte es an die Behörden durch einen Boten, der die Bergkette überquerte, durch endlose Sümpfe irrte, sich wilde Flüsse stromaufwärts quälte und fast ein Opfer der Raubtiere, der Verzweiflung und der Pest geworden wäre, bevor er einen Verbindungsweg zur Maultierpost erreichte. Obwohl eine Reise in die Hauptstadt zu jener Zeit so gut wie unmöglich war, wollte José Arcadio Buendía, sobald die Regierung das befehle, den Versuch wagen, um den Militärs seine Erfindung praktisch vorzuführen und sie höchstpersönlich in die komplizierte Kunst des solaren Kriegs einzuweisen. Mehrere Jahre lang wartete er auf eine Antwort. Müde des Wartens, beklagte er schließlich bei Melquíades das Scheitern seiner Initiative, worauf der Zigeuner einen überzeugenden Beweis seiner Anständigkeit lieferte: Er gab José Arcadio Buendía die Dublonen im Tausch für die Lupe zurück und überließ ihm zudem einige portugiesische Landkarten und mehrere Navigationsinstrumente. Eigenhändig schrieb er ihm eine knappe Zusammenfassung der Studien des Mönchs Hermann auf, damit er das Astrolabium, den Kompass und den Sextanten bedienen konnte. José Arcadio Buendía verbrachte die langen Regenmonate in einem Zimmerchen, das er hinten an das Haus angebaut hatte, auf dass niemand seine Experimente störe. Nachdem er die häuslichen Verpflichtungen nunmehr völlig vernachlässigte, verbrachte er ganze Nächte im Hof, um den Lauf der Sterne zu beobachten, und holte sich fast einen Sonnenstich bei dem Versuch, eine Methode zur exakten Bestimmung des Mittags zu entwickeln. Als er sich sachkundig in Gebrauch und Anwendung seiner Instrumente gemacht hatte, gewann er eine Vorstellung des Raums, die ihm erlaubte, unbekannte Meere zu befahren, nicht bewohnte Gebiete zu erkunden und mit prächtigen Geschöpfen Umgang zu pflegen, ohne sein Kabinett verlassen zu müssen. Damals gewöhnte er sich an, völlig in sich versunken durchs Haus zu wandern und Selbstgespräche zu führen, während Úrsula und die Kinder sich im Garten krumm arbeiteten, Bananen- und Malangastauden anbauten, Yukka und Kürbis, Yamswurzeln und Auberginen. Plötzlich, ohne jede Ankündigung, fand seine fieberhafte Aktivität ein Ende und machte einer Art Staunen Platz. Mehrere Tage lang war er wie unter einem Bann, murmelte unablässig eine Litanei erstaunlicher Mutmaßungen vor sich hin, ohne den eigenen Folgerungen Glauben zu schenken. Endlich, an einem Dienstag im September, brach mit einem Schlag alles, was ihn quälte, aus ihm heraus. Die Kinder sollten sich für den Rest ihres Lebens an den feierlich erhabenen Ernst erinnern, mit dem ihr Vater sich an das Kopfende des Tisches setzte und ihnen, vor Fieber zitternd, gezeichnet von langen Nachtwachen und einer unerbittlichen Fantasie, seine Entdeckung offenbarte:
»Die Erde ist rund wie eine Orange.«
Úrsula verlor die Geduld. »Wenn du wahnsinnig werden musst, dann bitte allein«, schrie sie. »Und wehe du trichterst den Kindern deine Zigeunerideen ein.« José Arcadio Buendía blieb gleichmütig, ließ sich von der Verzweiflung seiner Frau, die in einem Wutausbruch das Astrolabium auf dem Boden zerschmetterte, nicht einschüchtern. Er baute sich ein neues, versammelte die Männer des Dorfes in seinem Zimmer und bewies ihnen anhand von Theorien, die keiner verstand, dass man nur immer gen Osten segeln musste, um wieder den Ausgangspunkt zu erreichen. Das ganze Dorf war davon überzeugt, dass José Arcadio Buendía den Verstand verloren hatte, bis Melquíades kam und die Dinge zurechtrückte. Er pries öffentlich die Intelligenz eines Mannes, der allein durch astronomische Spekulation eine Theorie entwickelt hatte, die durch die Praxis schon belegt, aber noch nicht bis nach Macondo vorgedrungen war, und machte ihm, als Zeichen seiner Bewunderung, ein Geschenk, das entscheidenden Einfluss auf die Zukunft des Dorfes haben sollte: ein alchimistisches Labor.
Melquíades war bestürzend schnell gealtert. Bei seinen ersten Besuchen hatte er ebenso alt wie José Arcadio Buendía gewirkt. Während dieser jedoch sein ungeheuere Kraft bewahrte und immer noch ein Pferd an den Ohren packen und zu Boden werfen konnte, schien den Zigeuner ein hartnäckiges Leiden zu verzehren. In Wirklichkeit handelte es sich um Nachwirkungen vieler seltener Krankheiten, die er sich auf seinen unzähligen Reisen um die Welt zugezogen hatte. Wie er José Arcadio erzählte, während er half, das Labor aufzubauen, war ihm allerorten der Tod auf den Fersen, schnüffelte an seinen Hosen, entschloss sich aber nicht zum letzten Prankenschlag. Melquíades war schon jedweden Seuchen und Katastrophen entkommen, die das Menschengeschlecht heimgesucht hatten. Er überlebte die Pellagra in Persien, den Skorbut auf dem malaiischen Archipel, die Lepra in Alexandrien, Beriberi in Japan, den Schwarzen Tod in Madagaskar, das Erdbeben von Sizilien und einen Schiffbruch mit zahllosen Opfern in der Magellanstraße. Dieses Wunderwesen, das den Schlüssel des Nostradamus zu besitzen behauptete, war ein düsterer, von einer traurigen Aura umgebener Mensch, dessen asiatischer Blick die andere Seite der Dinge zu kennen schien. Er trug einen Hut, schwarz und groß wie die ausgebreiteten Schwingen eines Raben, dazu eine mit dem Grünspan der Jahrhunderte patinierte Samtweste. Doch trotz seiner unermesslichen Weisheit und seiner geheimnisvollen Ausstrahlung hatte er eine menschliche Schwere, eine irdische Beschaffenheit, die ihn an die kleinsten Probleme des täglichen Lebens gekettet hielt. Er klagte über Altersbeschwerden, litt unter höchst unbedeutenden Geldnöten, und das Lachen war ihm schon seit Langem vergangen, da der Skorbut ihm die Zähne gezogen hatte. An dem stickig heißen Mittag, als Melquíades seine Geheimnisse offenbarte, war sich José Arcadio Buendía gewiss, dass dies der Anfang einer wunderbaren Freundschaft war. Die Kinder staunten über Melquíades’ fantastische Geschichten. Aureliano, der damals höchstens fünf Jahre alt war, sollte ihn bis an sein Lebensende so erinnern, wie er ihn an jenem Nachmittag gesehen hatte, im metallisch strahlenden Gegenlicht vor dem Fenster, die dunkelsten Gebiete der Fantasie mit seiner tiefen Orgelstimme erleuchtend, während ihm in der Hitze das Haarschmalz von den Schläfen troff. José Arcadio, Aurelianos älterer Bruder, sollte dieses wundersame Bild seiner gesamten Nachkommenschaft als Erinnerung vererben. Úrsula hingegen blieb ein schlechter Nachgeschmack von jenem Besuch, war sie doch in dem Augenblick ins Zimmer gekommen, als Melquíades in seiner Zerstreutheit ein Fläschchen mit Quecksilberchlorid zerbrach.
»Das ist der Geruch des Teufels«, sagte sie.
»Keineswegs«, korrigierte Melquíades. »Erwiesenermaßen hat der Teufel schwefelige Eigenschaften, und das hier ist nur ein bisschen Ätzsublimat.«
Belehrend wie immer, holte er zu einem tiefgründigen Vortrag über die teuflischen Eigenschaften des Zinnobers aus, aber Úrsula hörte nicht zu und führte die Kinder fort zum Beten. Dieser beißende Geruch sollte ihr für immer im Gedächtnis bleiben und verband sich mit der Erinnerung an Melquíades.
Das rudimentäre Labor bestand – neben allerlei Tiegeln, Trichtern, Retorten, Filtern und Sieben – aus einem primitiven Ofen, dem Athanor, einer Phiole mit langem engen Hals, die dem Philosophischen Ei nachgebildet war, und einem Destillator, den die Zigeuner nach den modernen Beschreibungen des Dreihalskolbens von Maria der Jüdin selbst gebaut hatten. Außer diesen Gegenständen ließ Melquíades Proben der sieben Metalle zurück, die den sieben Planeten zugeordnet waren, dazu die Formeln von Moses und Zosimus für die Doppelung des Goldes sowie eine Reihe von Notizen und Zeichnungen über die Prozesse beim Großen Werk, die demjenigen, der sie zu deuten wüsste, einen Weg weisen würden, den Stein der Weisen herzustellen. Verführt von der Einfachheit der Formeln zur Golddoppelung, umgarnte José Arcadio Buendía Úrsula mehrere Wochen lang, sie möge ihm erlauben, ihre aus der Kolonialzeit stammenden Münzen auszugraben und sie so oft zu vermehren, wie das Quecksilber teilbar wäre. Úrsula gab, wie immer, der unbeugsamen Hartnäckigkeit ihres Mannes schließlich nach. So schüttete José Arcadio Buendía dann dreißig Dublonen in eine Kasserolle und schmolz sie mit Kupferspänen, Arsenblende, Schwefel und Blei ein. Er ließ alles über lebhaftem Feuer in einem Kessel Rizinusöl kochen, bis er einen zähen, übel riechenden Sirup erhielt, der eher nach gewöhnlichem Karamell als nach prächtigem Gold aussah. Nach waghalsigen und verzweifelten Destillationsprozessen, der Verschmelzung mit den sieben planetarischen Metallen, einer Bearbeitung mit hermetischem Quecksilber und Kupfersulfit und erneutem Kochen in Schweineschmalz, da es an Rettichöl mangelte, blieb von Úrsulas kostbarem Erbe nur noch ein verkohlter Klumpen, der nicht mehr vom Boden des Kessels zu lösen war.
Als die Zigeuner zurückkehrten, hatte Úrsula den ganzen Ort gegen sie aufgebracht. Doch die Neugier war stärker als die Angst; während die Zigeuner unter ohrenbetäubendem Lärm von allerlei Musikinstrumenten durchs Dorf zogen, kündigte der Ausrufer die Vorführung eines sagenhaften Fundes aus Nazianz an. Also strömten alle zum Zelt und konnten für einen Centavo Eintritt einen jugendlichen Melquíades bewundern, erholt, faltenlos und mit einem neuen, strahlenden Gebiss. Wer sich an sein vom Skorbut zerfressenes Zahnfleisch, seine eingefallenen Wangen und welken Lippen erinnerte, dem schauderte angesichts dieses schlagenden Beweises für die übernatürlichen Kräfte des Zigeuners. Aus der Angst wurde Panik, als Melquíades die Zähne, makellos in Zahnfleisch eingepasst, herausnahm und sie kurz dem Publikum zeigte – ein flüchtiger Augenblick, in dem er wieder zum hinfälligen Greis der vergangenen Jahre wurde –, sie sich dann wieder einsetzte und erneut im vollen Glanz seiner wiederhergestellten Jugend lächelte. Sogar José Arcadio Buendía meinte, dass Melquíades’ Fähigkeiten bedenkliche Grenzen überschritten, erlebte aber eine freudige Überraschung, als der Zigeuner ihm unter vier Augen den Mechanismus seines künstlichen Gebisses erklärte. Der erschien ihm zugleich so einfach und großartig, dass er über Nacht jedes Interesse an seinen alchimistischen Forschungen verlor; erneut verfiel er in Übellaunigkeit, aß nicht mehr regelmäßig und spazierte den ganzen Tag lang durchs Haus. »Auf der Welt geschehen unglaubliche Dinge«, sagte er zu Úrsula. »Selbst hier, auf der anderen Seite des Flusses, gibt es magische Apparate jeglicher Art, nur wir leben immer noch wie die Esel.« Wer ihn aus der Gründungszeit von Macondo kannte, staunte, wie sehr er sich unter dem Einfluss von Melquíades verändert hatte.
Anfangs war José Arcadio Buendía so etwas wie ein jugendlicher Patriarch gewesen, der Anweisungen für die Aussaat und Ratschläge für die Aufzucht von Kindern und Tieren gab und sich zum Wohl der Gemeinschaft überall einbrachte, auch bei der körperlichen Arbeit. Da sein Haus von Anfang an das beste im Dorf war, wurden die anderen nach diesem Vorbild geschaffen. Es hatte einen großen, lichtdurchfluteten Wohnraum, eine Terrasse mit farbenfrohen Blumen als Esszimmer, zwei Schlafzimmer, einen Hof mit einem riesigen Kastanienbaum, einen gut bestellten Gemüsegarten und ein Gehege, in dem Ziegen, Schweine und Hühner in friedlicher Gemeinschaft lebten. Verboten war nur die Haltung von Kampfhähnen, sowohl in seinem Haus wie in der ganzen Siedlung.
Úrsula stand ihrem Mann an Arbeitseifer nicht nach. Klein, energisch, streng, schien diese Frau mit den eisernen Nerven, die man zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens hatte singen hören, von morgens früh bis spät in die Nacht überall zu sein, stets gefolgt vom leisen Rascheln ihrer Leinenröcke. Dank ihr waren die Böden aus fest gestampfter Erde, die ungekalkten Lehmwände und die selbst gefertigten rustikalen Möbel stets sauber, und die alten Truhen, in denen die Wäsche verwahrt wurde, atmeten lauen Basilikumduft aus.
José Arcadio Buendía – das Dorf sollte nie einen Mann mit größerem Unternehmungsgeist erleben – hatte die Häuser so angeordnet, dass man von allen leicht den Fluss erreichte und sich mit Wasser versorgen konnte, auch hatte er die Straßen so klug geführt, dass in der größten Hitze kein Haus mehr Sonne als die anderen abbekam. In wenigen Jahren war Macondo ein weit ordentlicheres und arbeitsameres Dorf als alle anderen, die seine dreihundert Einwohner bisher kennengelernt hatten. Es war ein wahrhaft glückliches Dorf, in dem keiner älter als dreißig und noch niemand gestorben war.
Schon in der Gründungszeit hatte José Arcadio Buendía Fallen und Käfige gebaut. Schnell füllte er nicht nur das eigene Haus, sondern auch alle anderen im Dorf mit Trupialen, Kanarienvögeln, Blauracken und Rotkehlchen. Das Konzert der vielen unterschiedlichen Vögel wurde schließlich so betäubend, dass Úrsula sich Bienenwachs in die Ohren stopfte, um nicht den Sinn für die Wirklichkeit zu verlieren. Als Melquíades mit seinem Clan zum ersten Mal kam und Glaskugeln gegen Kopfschmerzen verkaufte, waren alle erstaunt darüber, dass die Zigeuner dieses im schläfrigen Sumpfland verlorene Dorf überhaupt gefunden hatten, worauf diese bekannten, sie hätten sich vom Gesang der Vögel leiten lassen.
Der Geist des gemeinschaftlichen Aufbruchs wich binnen Kurzem dem Fieber der Magneten, den astronomischen Berechnungen, den Transmutationsträumen und dem Verlangen, die Wunder der Welt kennenzulernen. Der unternehmungsfreudige, propere José Arcadio Buendía verwandelte sich in einen Mann, der wie ein Tagedieb aussah, nachlässig gekleidet und mit einem wilden Bart, den Úrsula gerade einmal mit dem Küchenmesser stutzen konnte. Manche hielten José Arcadio Buendía sogar für das Opfer eines rätselhaften Zaubers. Doch selbst diejenigen, die von seinem Wahnsinn fest überzeugt waren, verließen Arbeit und Familie und folgten ihm, als er das Holzfällerwerkzeug schulterte und alle aufrief, eine Schneise zu schlagen, die Macondo mit den großen Erfindungen verbinden sollte.
José Arcadio Buendía hatte keine Ahnung von der Geografie der Gegend. Er wusste nur, nach Osten hin lag die undurchdringliche Sierra und jenseits der Sierra die sehr alte Stadt Riohacha, wo in vergangenen Zeiten – wie ihm sein Großvater, der erste Aureliano Buendía, erzählt hatte – Sir Francis Drake einen Sport daraus machte, mit Kanonen auf Kaimane zu schießen, die er dann wieder zusammenflicken und mit Stroh ausstopfen ließ, um sie Königin Elizabeth mitzubringen. In seiner Jugend hatten José Arcadio Buendía und seine Männer mit Frauen und Kindern und Tieren und allem möglichen Hausgerät auf der Suche nach einem Zugang zum Meer die Berge überquert, nach sechsundzwanzig Monaten jedoch das Unternehmen abgebrochen und Macondo gegründet, um nicht den Rückweg antreten zu müssen. Also kam diese Route für ihn nicht infrage, konnte sie doch nur in die Vergangenheit führen. Im Süden lagen die Sümpfe, von einer ewigen Pflanzenhaut bedeckt, und das weite Universum der Ciénaga Grande, der großen Sumpflagune, die nach dem Zeugnis der Zigeuner grenzenlos war. Die Ciénaga verschwamm im Westen mit einer Wasserfläche ohne Horizont, wo zarthäutige Meeressäuger mit dem Kopf und dem Oberkörper einer Frau lebten und mit dem Zauber ihrer ungeheuren Brüste den Seefahrern zum Verhängnis wurden. Die Zigeuner befuhren sechs Monate lang diesen Wasserweg, bevor sie den Festlandgürtel erreichten, auf dem die Maultierpost verkehrte. Nach José Arcadio Buendías Berechnungen bot nur die Nordroute die Möglichkeit, in Kontakt mit der Zivilisation zu treten. Also rüstete er dieselben Männer, die ihn bei der Gründung von Macondo begleitet hatten, mit Werkzeug zum Holzfällen und Jagdwaffen aus, packte Landkarten und Navigationsinstrumente in einen Tornister und machte sich zu dem waghalsigen Abenteuer auf.
In den ersten Tagen stießen sie auf kein nennenswertes Hindernis. Sie wanderten flussabwärts das steinige Ufer entlang bis zu der Stelle, an der sie Jahre zuvor die Ritterrüstung gefunden hatten, und drangen dort auf einem Pfad zwischen wilden Orangenbäumen in den Urwald ein. Nach der ersten Woche erlegten sie einen Hirsch und brieten ihn, begnügten sich aber mit der Hälfte des Fleisches und salzten den Rest für die kommenden Tage ein. Mit dieser Vorkehrung wollten sie den Zeitpunkt hinausschieben, an dem sie wieder Guacamayas essen mussten – das blaue Papageienfleisch schmeckte streng nach Moschus. Dann sahen sie zehn Tage lang die Sonne nicht. Der Boden wurde feucht und weich wie Vulkanasche, immer heimtückischer die Vegetation, immer ferner klangen die Vogelschreie und das Kreischen der Affen, und die Welt wurde auf immer traurig. In diesem Paradies der Feuchtigkeit und Stille vor dem Sündenfall, wo die Stiefel in dampfenden Öllachen versanken und die Macheten blutige Lilien und goldene Salamander zerfetzten, wurden die Männer der Expedition von ihren ältesten Erinnerungen eingeholt. Eine Woche lang rückten sie, fast ohne zu sprechen, wie Schlafwandler durch ein Universum der Schwermut vor, beleuchtet nur vom schwachen Widerschein der Leuchtkäfer, die Lungen erschöpft von stickigem Blutdunst. Zurück konnten sie nicht, da die Schneise, die sie schlugen, sich schnell wieder mit neuer Vegetation schloss, der sie beim Wachsen förmlich zusehen konnten. »Macht nichts«, sagte Arcadio Buendía. »Wichtig ist nur, nicht die Orientierung zu verlieren.« Immer auf den Kompass achtend, führte er seine Männer weiter auf einen unsichtbaren Norden zu, bis sie aus dem verwunschenen Gebiet herausfanden. Die Nacht war dicht, sternenlos, doch die Dunkelheit war von einer neuen, sauberen Luft erfüllt. Erschöpft von dem langen Marsch befestigten sie ihre Hängematten und schliefen zum ersten Mal seit zwei Wochen tief und fest. Als sie aufwachten, die Sonne stand schon hoch, erstarrten sie vor Staunen. Vor ihnen lag, von Farnen und Palmen umrahmt, weiß und staubig im schweigsamen Licht des Morgens, eine riesige spanische Galeone. Leicht nach Steuerbord geneigt, die Masten unbeschädigt, hingen schmutzige Fetzen der Segel von der mit Orchideen bekränzten Takelage. Der Rumpf, von einem glatten Panzer aus versteinerten Saugfischen und zartem Moos bedeckt, steckte tief im steinigen Boden. Das Ganze schien einen ureigenen Raum zu beanspruchen, einen Raum der Einsamkeit und des Vergessens, der den Lastern der Zeit und den Gewohnheiten der Vögel verwehrt blieb. Im Schiffsbauch, den die Männer der Expedition mit unterdrückter Erregung erkundeten, fand sich nichts als ein dichter Blumenwald.
Der Fund der Galeone, ein Hinweis auf die Nähe des Meeres, brach José Arcadio Buendías Schwung. Er hielt es für einen Streich seines spitzbübischen Schicksals, dass er unter Opfern und unzähligen Mühen das Meer gesucht hatte, ohne es zu finden, und dieses ihm nun, da er es gefunden hatte, ohne es zu suchen, als unbezwingbares Hindernis im Weg lag. Viele Jahre später, als dort schon eine reguläre Postverbindung bestand, durchquerte Oberst Aureliano Buendía erneut die Region und fand nur noch das verkohlte Gerippe des Schiffs inmitten eines Mohnfelds vor. Nun erst davon überzeugt, dass diese Geschichte nicht eine Ausgeburt der Fantasie seines Vaters war, fragte er sich, wie die Galeone so tief ins Festland vorgedrungen sein konnte. José Arcadio Buendía jedoch hatte diese Frage nicht beschäftigt, als er, nach vier weiteren Tagen und zwölf Kilometer von der Galeone entfernt, das Meer fand. Hier, vor diesem aschfarbenen, schmutzig schäumenden Meer, das nicht die Gefahren und Opfer seines Abenteuers wert war, fanden seine Träume ihr Ende.
»Verdammte Scheiße!«, schrie er. »Macondo ist auf allen Seiten von Wasser umgeben.«
Die Vorstellung von einer Halbinsel Macondo hielt sich lange, inspiriert von der willkürlichen Landkarte, die José Arcadio Buendía nach der Rückkehr von seiner Expedition zeichnete. Er entwarf diese Karte voller Wut, übertrieb böswillig die schlechten Verbindungsmöglichkeiten, wie um sich selbst für sein völliges Versagen bei der Wahl des Ortes zu bestrafen. »Wir werden nie irgendwohin kommen«, jammerte er Úrsula vor. »Hier werden wir bei lebendigem Leib verfaulen, ohne die Wohltaten der Wissenschaft zu erfahren.« Diese Gewissheit, mehrere Monate im kleinen Laborzimmer wiedergekäut, brachte ihn auf die Idee, Macondo an einen günstigeren Ort zu verpflanzen. Doch diesmal kam Úrsula seinen fiebrigen Absichten zuvor. Still und heimlich, mit dem unerbittlichen Fleiß einer Ameise, brachte sie die Frauen gegen die Launen ihrer Männer auf, die sich schon auf den Umzug vorzubereiten begannen. José Arcadio Buendía erfuhr nicht, wann und aufgrund welcher Gegenkräfte seine Pläne in einem Gewirr von Vorwänden, Zwischenfällen und Ausweichmanövern hängen blieben, bis sie nur noch eine reine, schlichte Illusion waren. Úrsula beobachtete ihn mit unschuldiger Aufmerksamkeit und empfand sogar etwas Mitleid mit ihm, als sie ihn eines Morgens in seinem kleinen Hinterzimmer dabei überraschte, wie er zwischen den Zähnen von seinen Umzugsträumen brabbelte und dabei die einzelnen Teile des Laboratoriums in die Originalschachteln verpackte. Sie ließ ihn machen. Ließ ihn die Kisten zunageln und mit einem in Tinte getauchten Pinsel seine Initialen daraufmalen, ohne jeden Vorwurf, wusste sie doch, dass er wusste (das hatte sie aus seinen tauben Monologen herausgehört), dass die Männer des Dorfes ihm bei seinem Vorhaben nicht zur Seite stehen würden. Erst als er begann, die Tür des Zimmerchens auszubauen, wagte Úrsula zu fragen, warum er das mache, woraufhin er mit einer gewissen Bitterkeit antwortete: »Da keiner gehen will, gehen wir allein.« Úrsula blieb ruhig.
»Wir gehen nicht«, sagte sie. »Wir bleiben hier, weil wir hier einen Sohn bekommen haben.«
»Noch haben wir keinen Toten«, sagte er. »Man gehört nirgendwohin, solange man keinen Toten unter der Erde hat.«
Úrsula erwiderte mit sanfter Entschiedenheit: »Wenn es nötig ist, dass ich sterbe, damit ihr hierbleibt, dann sterbe ich.«
José Arcadio Buendía glaubte nicht an den unbeugsamen Willen seiner Frau. Er versuchte, sie mit dem Zauber seiner Fantasie zu verführen, mit der Verheißung einer wunderbaren Welt, wo man nur einige magische Flüssigkeiten auf die Erde zu schütten brauchte, damit die Pflanzen nach des Menschen Willen Früchte trugen, und wo man zu Spottpreisen alle möglichen Apparate gegen den Schmerz kaufen konnte. Aber Úrsula war nicht ansprechbar für seine Hellseherei.
»Statt deinen neumodischen Hirngespinsten nachzuhängen, solltest du dich lieber um deine Kinder kümmern«, erwiderte sie. »Schau sie an, sie sind sich selbst und dem Schicksal überlassen wie die Esel.«
José Arcadio Buendía nahm die Aufforderung seiner Frau wörtlich. Er blickte durchs Fenster und sah die beiden barfüßigen Jungen im sonnigen Gemüsegarten, und es war ihm, als hätten sie erst in diesem Augenblick zu existieren begonnen, erschaffen durch Úrsulas Beschwörung. Und dann geschah etwas in seinem Inneren; etwas Geheimnisvolles und Endgültiges, das ihn aus seiner gegenwärtigen Zeit riss und ihn in eine unerforschte Region der Erinnerungen treiben ließ. Während Úrsula weiter das Haus fegte, nun sicher, dass sie es für den Rest ihres Lebens nicht verlassen würde, blickte er noch immer gedankenverloren auf die Kinder, bis ihm die Augen feucht wurden und er sie, einen tiefen Seufzer der Resignation ausstoßend, mit dem Handrücken abwischte.
»Gut also«, sagte er. »Ruf sie, sie sollen mir helfen, die Kisten auszupacken.«
José Arcadio, der ältere Sohn, war gerade vierzehn geworden. Wie sein Vater hatte er einen viereckigen Schädel, störrisches Haar und einen ausgeprägten Willen. Auch er zeigte die Anlage zu körperlicher Größe und Kraft, doch war schon damals ersichtlich, dass es ihm an Fantasie mangelte. Er war während der mühevollen Überquerung der Sierra gezeugt und geboren worden, noch vor der Gründung Macondos, und seine Eltern dankten dem Himmel, als sie feststellten, dass er kein tierisches Organ aufwies. Aureliano, der erste Mensch, der in Macondo zur Welt kam, sollte im März sechs werden. Er war still und scheu. Im Bauch seiner Mutter hatte er geweint und war mit geöffneten Augen zur Welt gekommen. Als die Nabelschnur durchtrennt wurde, bewegte er den Kopf hin und her, erkannte die Gegenstände im Zimmer und musterte die Gesichter der Leute mit einer Neugier ohne Staunen. Dann fixierte er, gleichgültig gegenüber jenen, die herantraten, um ihn kennenzulernen, das Dach aus Palmstroh, das unter dem enormen Druck des Regens einzubrechen drohte. Úrsula dachte nicht mehr an diesen eindringlichen Blick, bis der kleine Aureliano, nun dreijährig, eines Tages in die Küche kam, als sie gerade einen Topf mit kochender Brühe vom Feuer nahm und auf den Tisch stellte. Der Sohn stand gebannt in der Tür und sagte: »Der fällt runter.« Der Topf stand fest in der Mitte des Tisches, bewegte sich aber, sobald der Junge die Ankündigung gemacht hatte, wie von einer inneren Dynamik getrieben, unwiderruflich auf den Rand zu und zerbrach am Boden. Úrsula war besorgt und erzählte ihrem Mann von dem Vorfall, doch dieser deutete ihn als ein natürliches Phänomen. So war er immer, dem Dasein seiner Kinder fern, teils weil er die Kindheit für eine Zeit geistiger Unzulänglichkeit hielt, teils weil er zu sehr in den eigenen spekulativen Hirngespinsten befangen war.
Doch seit dem Nachmittag, an dem er die Jungen gerufen hatte, ihm beim Auspacken der Laborsachen zu helfen, widmete er ihnen seine besten Stunden. In dem abgelegenen Zimmerchen, dessen Wände sich nach und nach mit märchenhaften Drucken und den unwahrscheinlichsten Landkarten füllten, brachte er ihnen Lesen, Schreiben und Rechnen bei und erzählte ihnen von den Wundern der Welt, wobei er nicht nur so weit ging, wie seine Kenntnisse reichten, sondern die Grenzen seiner Einbildungskraft ins schier Unmögliche dehnte. Also lernten die Kinder, dass an der Südspitze Afrikas Menschen lebten, die so intelligent und friedliebend waren, dass Stillsitzen und Nachdenken ihr einziges Vergnügen war, oder dass man zu Fuß das Ägäische Meer überqueren konnte, wenn man von Insel zu Insel bis zum Hafen von Saloniki hüpfte. Diese den Atem verschlagenden Sitzungen prägten sich so tief ins Gedächtnis der Kinder ein, dass viele Jahre später, eine Sekunde bevor der Offizier des regulären Heers dem Erschießungskommando den Feuerbefehl gab, Oberst Aureliano Buendía noch einmal den lauen Märznachmittag durchlebte, an dem sein Vater die Physikstunde unterbrach und gebannt, mit erhobener Hand und starren Augen auf die fernen Pfeifen und Trommeln und Schellen der Zigeuner horchte, die wieder einmal ins Dorf einzogen und die letzte, staunenswerte Entdeckung der Weisen von Memphis verkündeten.
Es waren neue Zigeuner. Junge Männer und Frauen, die nur ihre eigene Sprache kannten, wunderschöne Geschöpfe mit geölter Haut und klugen Händen, deren Musik und Tänze in den Straßen einen panischen Freudenwirbel entfesselten; sie kamen mit ihren farbenfrohen Papageien, die italienische Romanzen rezitierten, und dem Huhn, das zum Takt des Tamburins hundert goldene Eier legte, und dem abgerichteten Affen, der Gedanken lesen konnte, der vielseitigen Maschine, die gleichermaßen Knöpfe annähen und das Fieber senken konnte, dem Apparat, der schlechte Erinnerungen vergessen machte, dem Pflaster, das die Zeit auslöschte, und mit tausend anderen Erfindungen mehr, so unerhört und scharfsinnig, dass José Arcadio Buendía eine Gedächtnismaschine hätte entwickeln mögen, um sich alle merken zu können. Im Handumdrehen veränderten die Zigeuner das Dorf. Die Bewohner Macondos, benommen von dem Jahrmarktsauftrieb, fühlten sich auf einmal in ihren eigenen Straßen wie verloren.
Ein Kind an jeder Hand, damit er sie nicht im Trubel verlor, stieß José Arcadio Buendía auf Gaukler mit goldgepanzerten Zähnen, auf sechsarmige Jongleure, erstickte fast am undurchdringlichen Geruch nach Dung und Sandelholz, den die Menge ausdünstete, und suchte wie ein Getriebener nach Melquíades, auf dass der ihm die unendlichen Geheimnisse dieses märchenhaften Albtraums verrate. Er befragte mehrere Zigeuner, die seine Sprache nicht verstanden. Schließlich kam er an den Platz, wo Melquíades sein Zelt aufzuschlagen pflegte, und traf dort auf einen düsteren Armenier, der auf Spanisch einen unsichtbar machenden Sirup anpries. Er hatte ein Glas der bernsteinfarbenen Flüssigkeit auf einen Zug geleert, als José Arcadio Buendía sich mit den Ellbogen einen Weg durch die gebannt dem Spektakel folgende Gruppe bahnte und gerade noch seine Frage stellen konnte. Der Zigeuner umhüllte ihn mit der vielsagenden Aura seines Blickes, bevor er zu einer Pfütze übel riechenden, dampfenden Teers zerfloss, über der das Echo seiner Antwort schwebte: »Melquíades ist gestorben.« Verstört von der Nachricht verharrte José Arcadio Buendía bewegungslos am Ort, versuchte seiner Bestürzung Herr zu werden, bis die Gruppe sich, von anderen Trickkünstlern angezogen, auflöste und die Pfütze des düsteren Armeniers vollends verdunstete. Später bestätigten ihm andere Zigeuner, dass Melquíades tatsächlich in den Dünen von Singapur dem Fieber erlegen sei und man seinen Körper an der tiefsten Stelle der Javasee versenkt habe. Den Kindern war diese Nachricht einerlei. Sie bestanden darauf, dass ihr Vater sie zur fabelhaften Neuigkeit der Weisen aus Memphis brachte, die am Eingang eines Zeltes angekündigt wurde, welches angeblich König Salomon gehört hatte. Sie drängten so sehr, dass José Arcadio Buendía die dreißig Reales zahlte und sie in die Mitte des Zeltes führte, wo ein Riese mit stark behaartem Oberkörper und kahl rasiertem Schädel, einem Kupferring in der Nase und einer schweren Eisenkette am Knöchel eine Piratentruhe bewachte. Als der Riese den Deckel öffnete, stieg ein eisiger Hauch aus der Truhe. Nur ein wuchtiger, durchsichtiger Block lag darin, im Inneren durchzogen von unendlich vielen Nadeln, an denen sich das letzte Tageslicht in bunten Sternen brach. Verblüfft und wohl wissend, dass die Kinder eine sofortige Erklärung erwarteten, wagte José Arcadio Buendía zu murmeln:
»Das ist der größte Diamant der Welt.«
»Nein«, korrigierte der Zigeuner, »das ist Eis.«
José Arcadio Buendía begriff nicht, streckte die Hand nach der Eisscholle aus, doch der Riese schob ihn weg: »Anfassen kostet fünf Reales mehr.« José Arcadio Buendía zahlte, legte dann die Hand aufs Eis, ließ sie dort ein paar Minuten liegen, während ihm, in Berührung mit dem Mysterium, das Herz vor Angst und Jubel schwoll. Ohne zu wissen, was er sagen sollte, zahlte er weitere zehn Reales, auch seine Söhne sollten diese wundersame Erfahrung machen. Der kleine José Arcadio weigerte sich, das Eis zu berühren. Aureliano dagegen trat einen Schritt vor, legte die Hand darauf und zog sie schnell wieder zurück. »Das kocht ja«, rief er erschrocken. Doch sein Vater hörte nicht hin. Berauscht von dem offenkundigen Wunder vergaß er in diesem Augenblick das Scheitern seiner wahnwitzigen Unternehmungen und die dem Appetit der Kraken preisgegebene Leiche des Melquíades. Er zahlte weitere fünf Reales und rief, die Hand auf der Eisscholle, als schwöre er im Zeugenstand auf die Heilige Schrift:
»Das ist die wichtigste Erfindung unserer Zeit.«
Als der Seeräuber Francis Drake im 16. Jahrhundert Riohacha überfiel, verlor die Urahnin von Úrsula Iguarán bei Sturmläuten und Kanonendonner vor Schreck die Nerven und setzte sich auf eine offene Feuerstelle. Die Brandwunden machten aus ihr eine zeitlebens untaugliche Ehefrau. Sie konnte nur noch halbseitig, auf Kissen gestützt, sitzen, und ihr Gang war wohl seltsam geworden, denn sie zeigte sich nie wieder zu Fuß in der Öffentlichkeit. Sie verzichtete auch auf jede Art von Geselligkeit, weil sie die wahnhafte Vorstellung hatte, dass ihr Körper Brandgeruch verströmte. Das Morgengrauen überraschte sie im Patio, wo sie nicht einzuschlafen wagte, weil sie des Öfteren träumte, dass die Engländer mit ihren scharfen Kampfhunden durch das Schlafzimmerfenster einfielen und sie mit glühenden Eisen schändlichen Martern unterwarfen. Ihr Mann, ein Kaufmann aus Aragón, von dem sie zwei Kinder hatte, verpfändete seinen halben Laden für Medikamente und Zeitvertreib im Bemühen, ihr Grauen zu lindern. Am Ende löste er das Geschäft auf, zog mit der Familie vom Meer fort in ein Hüttendorf friedlicher Indios an den Ausläufern der Sierra, wo er seiner Frau ein Schlafzimmer ohne Fenster baute, auf dass die Piraten aus ihren Albträumen nicht bei ihr eindringen konnten.
In der versteckten Siedlung lebte schon seit Langem ein Tabakpflanzer, der Kreole José Arcadio Buendía, mit dem sich Úrsulas Urahn derart erfolgreich zusammentat, dass die beiden binnen wenigen Jahren ein Vermögen machten. Mehrere Jahrhunderte später heiratete der Ururenkel des Kreolen die Ururenkelin des Aragonesen. Wenn also Úrsula wegen der Verrücktheiten ihres Mannes in die Luft ging, übersprang sie dreihundert Jahre Zufälligkeiten und verfluchte die Stunde, in der Francis Drake Riohacha überfallen hatte. Das war nur ein Mittel, sich Luft zu machen, denn in Wahrheit waren die beiden durch ein stärkeres Band als die Liebe bis zum Tod aneinander gebunden: durch gemeinsame Gewissensbisse. Sie waren blutsverwandt. Waren zusammen in der ehemaligen Hüttensiedlung aufgewachsen, aus der beider Vorfahren mit ihrer Arbeit und ihrem leuchtenden Vorbild eines der hervorragenden Städtchen der Provinz gemacht hatten. Ihre Ehe war seit beider Geburt voraussehbar gewesen, als sie aber den Wunsch zu heiraten kundtaten, versuchten sogar die eigenen Verwandten dies zu verhindern. Man befürchtete, dass die gesunden Endtriebe zweier jahrhundertelang durchmischter Geschlechter sich womöglich der Schande aussetzten, Leguane zu zeugen. Es gab einen ungeheuerlichen Präzedenzfall. Eine Tante von Úrsula, verheiratet mit einem Onkel von José Arcadio Buendía, hatte einen Sohn bekommen, der sein Lebtag weite Pumphosen trug und am Ende verblutete, nachdem er zweiundvierzig Jahre im Zustand reinster Jungfräulichkeit gelebt hatte, da er mit einem knorpeligen Ringelschwänzchen, das in einem Haarpinsel endete, geboren und aufgewachsen war. Ein Schweineschwanz, den er keine Frau je sehen ließ und der ihn das Leben kostete, als ein befreundeter Metzger ihm den Gefallen tat, das Teil mit einem kleinen Hackebeil abzutrennen. Mit der Leichtfertigkeit seiner neunzehn Jahre löste José Arcadio Buendía das Problem in einem einzigen Satz: »Es macht mir nichts aus, Ferkel zu bekommen, solange sie sprechen können.« Also heirateten sie, feierten drei Tage lang mit Musikkapelle und Feuerwerk. Von nun an hätten sie glücklich sein können, hätte die Mutter von Úrsula diese nicht mit allerlei finsteren Voraussagen über ihre Nachkommenschaft derart in Angst und Schrecken versetzt, dass sie den Vollzug der Ehe verweigerte. In der Furcht, ihr stämmiger und triebstarker Mann könne sie im Schlaf vergewaltigen, zog sich Úrsula vor dem Schlafengehen eine Art Hose an, die ihre Mutter aus Segeltuch gefertigt und mit überkreuzten Riemen verstärkt hatte und die vorne mit einer breiten Eisenschnalle geschlossen wurde. So ging es ein paar Monate lang. Am Tag kümmerte er sich um seine Kampfhähne und sie saß mit ihrer Mutter am Stickrahmen. In der Nacht rangen sie in heftiger Begierde stundenlang miteinander, was schon fast ein Ersatz für den Liebesakt zu sein schien, bis die Leute intuitiv witterten, dass etwas nicht in Ordnung war, und das Gerücht aufkam, Úrsula bewahre ein Jahr nach der Hochzeit immer noch ihre Unschuld, weil ihr Mann impotent sei. José Arcadio Buendía war der Letzte, dem das Gerücht zu Ohren kam.
»Da siehst du, Úrsula, was die Leute sagen«, sagte er sehr ruhig zu seiner Frau.
»Lass sie reden«, sagte sie, »wir beide wissen, dass es nicht stimmt.«
Also blieb es weitere sechs Monate beim Gleichen, bis zu dem tragischen Sonntag, an dem José Arcadio Buendía bei einem Hahnenkampf Prudencio Aguilar besiegte. Wütend, vom Blut seines Tieres aufgereizt, trat der Verlierer beiseite, die ganze Arena sollte hören, was er José Arcadio Buendía zu sagen hatte.
»Ich gratuliere«, schrie er. »Mal sehen, ob dieser Hahn es endlich deiner Frau besorgt.«
José Arcadio Buendía nahm in aller Ruhe seinen Hahn. »Ich komme gleich wieder«, sagte er an alle gewandt. Und dann zu Prudencio Aguilar: »Und du, geh nach Hause und bewaffne dich, denn ich werde dich töten.«
Zehn Minuten später kam er mit der bewährten Lanze seines Großvaters zurück. Am Eingang der Hahnenkampfarena, wo sich das halbe Dorf drängte, wartete Prudencio Aguilar auf ihn. Es blieb ihm keine Zeit, sich zu wehren. Die Lanze von José Arcadio Buendía, mit der Kraft eines Stiers geschleudert und mit ebender Treffsicherheit, mit der einst der erste Aureliano Buendía die Jaguare in der Region ausgerottet hatte, durchbohrte Prudencio Aguilars Hals. In jener Nacht, während in der Hahnenkampfarena die Totenwache gehalten wurde, kam José Arcadio Buendía ins Schlafzimmer, als seine Frau gerade die Keuschheitshose anzog. Er schwang die Lanze vor ihr und befahl: »Zieh das aus.« Úrsula zweifelte nicht an der Entschlossenheit ihres Mannes. »Du bist verantwortlich für die Folgen«, flüsterte sie. José Arcadio Buendía stieß die Lanze in den Erdboden.
»Wenn du Leguane gebären sollst, werden wir Leguane aufziehen«, sagte er. »Aber es wird deinetwegen keinen Toten mehr in diesem Dorf geben.«
Es war eine schöne, frische Juninacht, der Mond schien, und sie tobten im Bett herum, wach bis zum Morgengrauen, gleichgültig gegen den Wind, der, aufgeladen mit dem Wehklagen von Prudencio Aguilars Angehörigen, durchs Zimmer strich.
Das Vorgefallene wurde als Ehrenduell betrachtet, lastete jedoch beiden auf dem Gewissen. Eines Nachts, als Úrsula nicht schlafen konnte, ging sie in den Patio zum Wassertrinken und sah Prudencio Aguilar neben dem großen Tonkrug stehen. Er war bleich, hatte einen tieftraurigen Gesichtsausdruck und versuchte, mit einem Bündel Espartogras das Loch in seiner Kehle zu stopfen. Angst löste er nicht bei ihr aus, nur Mitleid. Sie ging zurück ins Zimmer, um ihrem Mann zu erzählen, was sie gesehen hatte, doch der nahm sie nicht ernst. »Tote gehen nicht spazieren«, sagte er. »Uns drückt nur das Gewissen.« Zwei Nächte später sah Úrsula von Neuem Prudencio Aguilar, er wusch sich im Badezimmer das am Hals geronnene Blut mit dem Espartobüschel ab. In einer anderen Nacht sah sie ihn im Regen einherwandeln. José Arcadio Buendía, ungehalten über die Halluzinationen seiner Frau, ging, mit der Lanze bewaffnet, in den Hof. Dort stand der Tote mit seiner traurigen Miene.
»Verschwinde!«, schrie José Arcadio Buendía. »Auch wenn du noch so oft zurückkehrst, ich töte dich wieder.«
Prudencio Aguilar verschwand nicht, und José Arcadio Buendía wagte auch nicht, die Lanze zu werfen. Von da an konnte er nicht mehr ruhig schlafen. Ihn quälte die ungeheure Trostlosigkeit, mit der ihn der Tote aus dem Regen angesehen hatte, diese tiefe Sehnsucht nach den Lebenden, die Unruhe, mit der er das Haus nach Wasser durchsuchte, um seinen Stopfen aus Espartogras anzufeuchten. »Er muss arg leiden«, sagte er zu Úrsula. »Er ist sehr allein, das sieht man.« Sie war so bewegt, dass sie, als sie den Toten das nächste Mal die Deckel von den Töpfen auf der Ofenplatte heben sah, begriff, was er suchte, und ihm von da an überall im Haus Wassernäpfe aufstellte. Eines Nachts, als José Arcadio Buendía ihn in seinem eigenen Zimmer die Wunde waschen sah, wurde es ihm zu viel.
»Schon gut, Prudencio«, sagte er. »Wir ziehen aus dem Dorf weg, so weit weg wie irgend möglich, und wir kehren nie zurück. Und nun geh in Frieden.«
So kam es, dass sie zur Überquerung der Sierra aufbrachen. Mehrere Freunde José Arcadio Buendías, jung wie er und abenteuerhungrig, räumten ihre Häuser und machten sich mit Frauen und Kindern auf in das Land, das ihnen keiner verheißen hatte. Vor dem Aufbruch vergrub José Arcadio Buendía die Lanze im Hof und köpfte, einen nach dem anderen, seine stolzen Kampfhähne, im Vertrauen darauf, dass er Prudencio Aguilar damit ein wenig Frieden verschaffte. Úrsula nahm nur die Truhe mit ihrer Aussteuer mit, ein wenig Haushaltsgerät und die Schatulle mit den Goldstücken, die sie von ihrem Vater geerbt hatte. Sie legten keine Reiseroute fest, versuchten nur, in die Riohacha entgegengesetzte Richtung zu ziehen, um keine Spur zu hinterlassen und nicht auf Bekannte zu stoßen. Es war eine absurde Reise. Nach vierzehn Monaten und mit einem von Affenfleisch und Schlangenbrühe angegriffenen Magen gebar Úrsula einen Sohn, der nur menschliche Körperteile aufwies. Die Hälfte des Weges hatte sie in einer von zwei Männern an einer Stange getragenen Hängematte zugebracht, da ihre Beine von Schwellungen entstellt waren und die Krampfadern wie Blasen platzten. Auch wenn die Kinder mit ihren aufgeblähten Bäuchen und den matten Augen ein Bild des Jammers abgaben, überstanden sie die Reise besser als ihre Eltern und hatten die meiste Zeit sogar Spaß dabei. Eines Morgens, nach fast zwei Jahren Gewaltmarsch, waren sie die ersten Sterblichen, die den Westhang der Sierra erblickten. Vom wolken-umhangenen Gipfel aus betrachteten sie die maßlose Wasserfläche der Ciénaga Grande, die sich bis zum anderen Ende der Welt dehnte. Doch das Meer fanden sie nicht. Eines Nachts, nachdem sie monatelang durch die Sümpfe geirrt waren, weit weg schon von den letzten Indios, denen sie auf ihrem Weg begegnet waren, kampierten sie am Ufer eines steinigen Flusses, dessen Wasser einem Sturzbach aus vereistem Glas glich. Jahre später, während des zweiten Bürgerkrieges, wollte Oberst Aureliano Buendía dieselbe Route einschlagen, um Riohacha mit einem Überraschungsangriff einzunehmen, begriff aber nach sechs Tagen Marsch, dass dies Irrsinn war. Zwar sahen die Leute seines Vaters, als sie nachts am Ufer kampierten, nach rettungslos verlorenen Schiffbrüchigen aus, doch ihre Zahl war auf dem Weg gewachsen, und alle waren sie entschlossen, alt zu sterben (was ihnen auch gelang). In jener Nacht träumte José Arcadio Buendía, dass sich an ebendiesem Ort eine laute Stadt aus Häusern mit Spiegelwänden erhob. Er fragte, was für eine Stadt das sei, und man sagte ihm einen Namen, den er noch nie gehört, der keinerlei Bedeutung hatte, im Traum aber einen übernatürlichen Hall auslöste: Macondo. Am Tag darauf überzeugte José Arcadio Buendía seine Männer davon, dass sie das Meer niemals finden würden. Er befahl ihnen, Bäume zu schlagen, um nah dem Fluss, an der kühlsten Stelle des Ufers, eine Lichtung zu schaffen, und genau dort gründeten sie das Dorf.
José Arcadio Buendía gelang es nicht, den Traum von den Häusern mit den Spiegelwänden zu deuten, bis zu dem Tag, als er das Eis kennenlernte. Nun glaubte er, den tieferen Sinn erfasst zu haben. Er dachte, in naher Zukunft werde es möglich sein, ausgehend von einem so alltäglichen Stoff wie Wasser, Eisblöcke in großen Mengen herzustellen und mit ihnen die neuen Häuser im Dorf zu bauen. Macondo würde nicht länger ein glühend heißer Ort sein, wo Türangeln und Riegel in der Hitze verbogen, sondern sich in eine winterliche Stadt verwandeln. Er zeigte nur deshalb keine Ausdauer bei seinen Plänen für den Bau einer Eisfabrik, weil er sich zu jener Zeit für die Erziehung seiner Söhne regelrecht begeisterte, speziell für die Aurelianos, der von Anfang an eine seltene Gabe für die Alchimie gezeigt hatte. Das Labor war entstaubt worden. Sie gingen in aller Ruhe, diesmal ohne die Erregung über das Neuartige, Melquíades’ Notizen durch und versuchten in ausgedehnten und geduldigen Sitzungen, Úrsulas Gold aus dem am Kesselboden klebenden Klumpen herauszulösen. Der junge José Arcadio beteiligte sich kaum. Während der Vater mit Leib und Seele bei seinem Athanor war, verwandelte sich der draufgängerische Erstgeborene, der schon immer zu groß für sein Alter gewesen war, in einen kolossalen Jüngling. Er kam in den Stimmbruch. Auf seiner Oberlippe spross erster Flaum. Eines Abends betrat Úrsula das Zimmer, als er sich gerade zum Schlafen ausgezogen hatte, und sie überkam ein seltsames Gefühl von Scham und Mitleid: Er war, nach ihrem Gatten, der erste Mann, den sie nackt sah, und er war so gut fürs Leben ausgestattet, dass sie das nicht für normal hielt. Úrsula, zum dritten Mal schwanger, durchlebte noch einmal ihre Ängste als frischgebackene Ehefrau.
In jener Zeit kam eine fröhlich freche und aufreizende Frau zu ihnen, die im Haushalt half und die Zukunft aus den Karten lesen konnte. Úrsula sprach mit ihr über den Sohn, meinte, dass dessen Übermaß etwas ebenso Unnatürliches war wie der Schweineschwanz seines Vetters. Die Frau brach in überschwängliches Gelächter aus, das wie zerscherbendes Glas im ganzen Haus widerhallte. »Im Gegenteil«, sagte sie. »Er wird glücklich sein.« Um die Vorhersage zu bestätigen, brachte sie einige Tage später ihre Karten mit und zog sich mit José Arcadio in einen Getreideschuppen neben der Küche zurück. In aller Ruhe legte sie die Karten auf einer alten Tischlerbank aus, sprach über dies und jenes, während der Junge neben ihr eher gelangweilt als neugierig wartete. Plötzlich streckte sie die Hand aus und berührte ihn. »Mannomann!«, rief sie wahrhaft erschrocken, und das war alles, was sie über die Lippen brachte. José Arcadio spürte, dass sich seine Knochen mit Schaum füllten, eine angstvolle Mattigkeit ihn überkam und er am liebsten geheult hätte. Die Frau machte keine aufreizenden Andeutungen. Dennoch suchte José Arcadio sie die ganze Nacht lang im Rauchgeruch ihrer Achseln, der ihm unter die Haut gegangen war. Er wollte nur noch mit ihr zusammen sein, wollte sie zur Mutter, wollte, dass sie beide für immer in dem Kornschuppen blieben, sie sollte zu ihm sagen, Mannomann, ihn erneut berühren und erneut sagen, Mannomann. Eines Tages hielt er es nicht länger aus und suchte sie zu Hause auf. Er stattete ihr einen unbegreiflichen, förmlichen Besuch ab, saß im Wohnzimmer und sagte kein Wort. In jenem Augenblick begehrte er sie nicht. Sie war ihm fremd, dem Bild ganz fern, das ihr Geruch heraufbeschwor, als sei sie eine andere. Er trank den Kaffee und verließ niedergeschlagen das Haus. In der Nacht aber, im Grauen der Schlaflosigkeit, verlangte er wieder nach ihr mit brutaler Begierde, da wollte er sie aber nicht mehr so, wie sie im Getreideschuppen gewesen war, sondern so wie an jenem Nachmittag.
Tage später rief ihn die Frau unvermutet zu sich ins Haus, wo sie mit ihrer Mutter allein war, und führte ihn unter dem Vorwand, ihm einen Kartentrick zu zeigen, ins Schlafzimmer. Dann berührte sie ihn so ohne alle Scham, dass er nach der ersten Erregung enttäuscht war, eher Angst als Lust empfand. Sie bat ihn, nachts wiederzukommen. Er sagte zu, um aus der Klemme zu kommen, wusste aber, er würde nicht fähig sein, zu ihr zu gehen. In der Nacht jedoch, in seinem glühenden Bett, begriff er, dass er zu ihr musste, selbst wenn er nicht dazu fähig war. Blind tastend zog er sich an, hörte den gemächlichen Atem seines Bruders, den trockenen Husten seines Vaters im Nebenzimmer, das Asthma der Hühner im Hof, das Sirren der Moskitos, das Trommeln seines Herzens und das unmäßige Lärmen der Welt, das er bislang nicht wahrgenommen hatte, und ging hinaus auf die schlafende Straße. Er wünschte von ganzem Herzen, die Tür möge verriegelt und nicht einfach angelehnt sein, wie sie ihm versprochen hatte. Doch sie war offen. Er stieß sie mit den Fingerspitzen an, und die Scharniere gaben einen düsteren, gedehnten Klagelaut von sich, der in seinen Eingeweiden eisig nachhallte. Gleich als er sich, bestrebt, keinen Lärm zu machen, seitlich hineinschob, schlug ihm der Geruch entgegen. Er stand im kleinen Wohnzimmer, in dem die drei Brüder der Frau ihre Hängematten anbrachten, wo, wusste er nicht und konnte es im Finsteren auch nicht erkennen, er musste also blind tappend den Raum durchqueren, die Tür des Schlafzimmers aufstoßen und sich dort zurechtfinden, damit er nicht im falschen Bett landete. Es gelang ihm. Er berührte die Seile der Hängematten, die tiefer hingen, als er vermutet hatte, und ein Mann, der bis dahin geschnarcht hatte, wälzte sich im Schlaf herum und sagte irgendwie enttäuscht: »Es war Mittwoch.« Als José Arcadio die Schlafzimmertür aufdrückte, konnte er nicht verhindern, dass sie am unebenen Boden entlangscharrte. Plötzlich, in absolute Dunkelheit getaucht, begriff er in hoffnungsloser Wehmut, dass er völlig die Orientierung verloren hatte. In dem engen Raum schliefen die Mutter, eine andere Tochter mit Mann und zwei Kindern sowie diese Frau, die ihn womöglich nicht erwartete. Er hätte sich von dem Geruch leiten lassen können, wenn der Geruch nicht überall im Haus gewesen wäre, so trügerisch und zugleich so eindeutig, wie er immer auf seiner Haut gewesen war. Lange blieb er reglos stehen, fragte sich verwundert, was er getan hatte, um in diesen Abgrund der Hilflosigkeit zu geraten, als eine Hand, die mit gespreizten Fingern in der Finsternis herumtastete, an sein Gesicht stieß. Er war nicht überrascht, hatte er doch, ohne es zu wissen, darauf gewartet. Dann vertraute er sich dieser Hand an und ließ sich in einem schrecklichen Zustand der Erschöpfung an einen unbestimmbaren Ort bringen, wo man ihn auszog, wie einen Kartoffelsack schüttelte, nach rechts und links wendete, in einer unergründlichen Dunkelheit, in der seine Arme überflüssig waren, wo es nicht mehr nach Frau, sondern nach Ammoniak roch und wo er versuchte, sich an ihr Gesicht zu erinnern, und das Gesicht von Úrsula fand, sich konfus dessen bewusst war, dass er etwas machte, von dem er seit Langem wünschte, man könne es machen, von dem er aber nie geahnt hatte, dass man es tatsächlich machen konnte, ohne zu wissen, wie er es gerade machte, denn er wusste nicht, wo die Füße waren, wo der Kopf, noch wessen Füße das waren und wessen Kopf, und er spürte, dass er dem eisigen Rumoren seiner Nieren und der Luft in seinem Gedärm nicht mehr standhalten konnte, auch nicht der Angst und dem unbeholfenen Verlangen, zu fliehen und zugleich für immer dort zu bleiben, in dieser erbitterten Stille und dieser entsetzlichen Einsamkeit.
Sie hieß Pilar Ternera. Sie hatte an dem in der Gründung von Macondo gipfelnden Exodus teilgenommen, mitgeschleppt von ihrer Familie, um sie von dem Mann zu trennen, der sie mit vierzehn vergewaltigt hatte und sie, bis sie zweiundzwanzig war, weiter liebte, sich aber nie entschloss, die Beziehung öffentlich zu machen, da er einer anderen gehörte. Er versprach, ihr bis ans Ende der Welt zu folgen, aber erst später, wenn er seine Angelegenheiten geregelt hätte, und sie war müde geworden, auf ihn zu warten, während sie ihn stets in den großen und kleinen, blonden und dunklen Männern erkannte, die ihr die Spielkarten auf Land- und Seewegen versprachen, in drei Tagen, drei Monaten oder drei Jahren. Beim Warten hatte sie die Kraft der Schenkel, die Festigkeit der Brüste, die Gewohnheit der Zärtlichkeit verloren, aber ihr verrücktes Herz war davon unberührt geblieben. Mit verwirrten Sinnen ob dieses wunderbaren Spielzeugs suchte José Arcadio nun Nacht für Nacht ihre Spur im Labyrinth des Schlafzimmers. Einmal fand er die Tür verriegelt vor und klopfte mehrmals, weil er wusste, wenn er den Mut aufgebracht hatte, das erste Mal zu klopfen, musste er bis zum letzten Mal durchhalten, und nach einer unendlich langen Wartezeit öffnete sie ihm die Tür. Tagsüber, wenn er vor Müdigkeit fast umfiel, schmeckte er insgeheim den Erinnerungen der vergangenen Nacht nach. Wenn sie aber ins Haus kam, fröhlich, gleichmütig, mit lockerem Mundwerk, kostete es ihn keine Mühe, seine Anspannung zu verbergen, da diese Frau, deren explosives Lachen die Tauben aufscheuchte, nichts mit der unsichtbaren Macht zu tun hatte, die ihn lehrte, nach innen zu atmen und seinen Herzschlag zu beherrschen, und durch die ihm verständlich wurde, warum Männer Angst vor dem Tod haben. Er war so in sich gekehrt, dass er nicht einmal die allgemeine Freude begriff, als Vater und Bruder das Haus mit der Nachricht auf den Kopf stellten, es sei ihnen gelungen, den metallischen Klumpen aufzubrechen und Úrsulas Gold herauszulösen.
Nach tagelanger, schwieriger und ausdauernder Arbeit waren sie tatsächlich erfolgreich gewesen. Úrsula war überglücklich, dankte sogar Gott für die Erfindung der Alchimie, während die Leute aus dem Dorf sich im Labor drängten, ihnen zur Feier des Wunders Kekse mit Guavenpaste gereicht wurden und José Arcadio Buendía den Schmelztiegel mit dem geretteten Gold herumzeigte, als hätte er es gerade selbst erfunden. So landete er auch bei seinem Erstgeborenen, der in letzter Zeit kaum noch im Labor vorbeischaute. Er hielt ihm die bröselige gelbliche Masse vor die Nase: »Na, wie sieht das aus?« José Arcadio gab eine ehrliche Antwort:
»Wie Hundekacke.«
Der Vater verpasste ihm mit dem Handrücken einen heftigen Schlag auf den Mund, sodass Blut und Tränen spritzten. In der Nacht legte Pilar Ternera, im Dunkeln Fläschchen und Watte ertastend, José Arcadio Arnikakompressen auf die Schwellung und tat alles, was er wollte, ohne dass er sich mühen musste, um ihn zu lieben, ohne ihm wehzutun. Das schuf ein solches Maß an Intimität, dass sie sich gleich danach, ohne es zu merken, flüsternd unterhielten.
»Ich möchte mit dir allein sein«, sagte er. »Und bald erzähle ich allen alles, und das Versteckspiel hat ein Ende.«
Sie versuchte nicht, ihn zu beschwichtigen.
»Das wäre gut«, sagte sie. »Wir lassen, wenn wir allein sind, die Lampe brennen, damit wir uns richtig sehen können, und ich kann schreien, so viel ich will, und keiner kann sich einmischen, und du sagst mir alle Schweinereien ins Ohr, die dir einfallen.«
Dieses Gespräch, der nagende Groll, den er gegen seinen Vater verspürte, und die Aussicht auf hemmungslose Liebe machten ihn mutig und gelassen. Aus freien Stücken und ohne jede Vorbereitung erzählte er alles seinem Bruder.
Zunächst erfasste der kleine Aureliano nur das Wagnis, die ungeheure Gefahr, die das Abenteuer seines Bruder bedeutete, der Reiz des Vorhabens erschloss sich ihm aber nicht. Doch nach und nach wurde er von José Arcadios Verlangen angesteckt. Er ließ sich alle Einzelheiten erzählen, identifizierte sich mit Leid und Lust seines Bruders, war erschrocken und glücklich. Er wartete auf ihn, blieb wach bis zum Morgengrauen, wie auf glühenden Kohlen in dem einsamen Bett, und dann redeten sie weiter, schlaflos, bis Zeit zum Aufstehen war, sodass sie bald an der gleichen Schläfrigkeit litten, die gleiche Geringschätzung für die Alchimie und die Weisheit ihres Vaters empfanden und in der Einsamkeit Zuflucht suchten. »Diese Kinder sind wie beduselt«, sagte Úrsula. »Wahrscheinlich haben sie Würmer.« Sie bereitete ihnen einen widerwärtigen Trunk aus gestampften Gänsefußblättern, den beide unerwartet stoisch schluckten, und sie setzten sich dann, elf Mal an einem einzigen Tag, gleichzeitig auf ihre Nachttöpfe und stießen rosige Parasiten aus, die sie überall mit großem Jubel herumzeigten, erlaubten diese ihnen doch, Úrsula über den Ursprung von beider Zerstreutheit und Mattigkeit in die Irre zu führen. Aureliano konnte inzwischen die Erfahrungen seines Bruders nicht nur begreifen, sondern sie als eigene nachempfinden, denn als dieser ihm einmal mit vielen Einzelheiten den Mechanismus der Liebe erklärte, war er ihm ins Wort gefallen und hatte gefragt: »Was fühlt man?« José Arcadios Antwort kam auf der Stelle:
»Es ist wie ein Erdbeben.«
An einem Donnerstag im Januar, um zwei Uhr früh, wurde Amaranta geboren. Bevor noch jemand ins Zimmer durfte, untersuchte Úrsula sie sorgfältig. Das Kind war leicht und wässrig wie eine Eidechse, doch alle seine Glieder waren menschlicher Natur. Aureliano merkte erst etwas von dem Ereignis, als er hörte, wie sich das Haus mit Menschen füllte. Im allgemeinen Durcheinander machte er sich unbemerkt auf die Suche nach seinem Bruder, der seit elf Uhr nicht mehr in seinem Bett lag. Es war ein so impulsiver Entschluss, dass Aureliano sich gar nicht erst fragte, wie er es denn anstellen könne, José Arcadio aus dem Schlafzimmer von Pilar Ternera zu holen. Er strich mehrere Stunden um das Haus, pfiff private Erkennungsmelodien, bis der Sonnenaufgang nahte und ihn zur Heimkehr zwang. Im Zimmer seiner Mutter stieß er auf José Arcadio, der, ganz heilige Unschuld, mit dem neugeborenen Schwesterchen spielte.
Úrsula hatte kaum die vierzig Tage Wochenbett hinter sich, als wieder die Zigeuner kamen. Es waren dieselben Gaukler und Jongleure, die das Eis gebracht hatten. In kurzer Zeit erwies sich, dass sie, im Unterschied zu Melquíades’ Clan, nicht Herolde des Fortschritts waren, sondern fliegende Händler des Zeitvertreibs. Selbst das Eis hatten sie nur als Zirkuskuriosität vorgeführt, statt auf seine Nützlichkeit im menschlichen Leben hinzuweisen. Diesmal brachten sie neben allerlei Blendwerk einen fliegenden Teppich mit. Sie boten ihn aber nicht als wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Transportwesens, sondern als Freizeitvergnügen an. Und die Leute gruben natürlich ihre letzten Goldstückchen aus, um einen kurzen Flug über die Dorfdächer zu genießen. Geschützt von der köstlichen Straflosigkeit im allgemeinen Durcheinander verlebten José Arcadio und Pilar zwanglose Stunden. Sie waren ein glückliches Liebespaar in der Menschenmenge, und es kam ihnen sogar der Verdacht, dass die Liebe ein tieferes und gelasseneres Gefühl sein konnte als das wilde, aber kurze Glück ihrer heimlichen Nächte. Pilar brach jedoch den Zauber. Ermuntert davon, wie sehr José Arcadio ihre Gesellschaft genoss, wählte sie die falsche Form und die falsche Gelegenheit und bürdete ihm mit einem Schlag die Welt auf. »Jetzt bist du ein Mann«, sagte sie zu ihm. Und da er nicht begriff, was sie damit sagen wollte, klärte sie ihn buchstäblich auf.
»Du bekommst ein Kind.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: