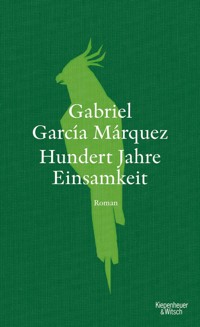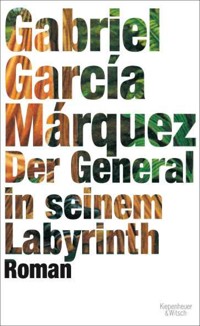14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Leben voller bewegender Worte – Gabriel García Márquez' ergreifende Reden Gabriel García Márquez, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und Literaturnobelpreisträger, hatte sich einst geschworen, nie eine Rede zu halten. Doch das Schicksal wollte es anders und so fand er sich immer wieder auf den Podien der Welt wieder. In »Ich bin nicht hier, um eine Rede zu halten« sind seine schönsten und bewegendsten Reden versammelt, die der Autor selbst für dieses Buch zusammengestellt hat. Von seiner ersten Ansprache beim Schulabschluss 1944, über die unvergessliche Nobelpreisrede 1982, bis hin zur anrührenden Rede anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seines Meisterwerks »Hundert Jahre Einsamkeit« im Jahr 2007 - diese Sammlung umspannt ein ganzes Leben. García Márquez gewährt uns tiefe Einblicke in seine Gedankenwelt und zeigt die vielen Facetten seiner Person: den leidenschaftlichen Literaturliebhaber, den politisch engagierten Bürger seines Landes, den couragierten Journalisten und nicht zuletzt den erfolgreichen Autor und Nobelpreisträger. Lebendig, anekdotenreich und packend laden diese Reden dazu ein, den faszinierenden Kosmos des Gabriel García Márquez zu entdecken. Eine Hommage an die Macht des Wortes und an einen der größten Schriftsteller unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Ich bin nicht hier, um eine Rede zu halten
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Er gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichen Schriftsteller der Welt. García Márquez starb am 17. April 2014 im Alter von 87 Jahren in Mexiko-Stadt.
Silke Kleemann, geboren 1976, lebt als literarische Übersetzerin, Lektorin und Autorin in München. Sie übersetzt hauptsächlich Romane und Lyrik aus dem Spanischen, u. a. Juan Filloy, Alejandro Jodorowsky, Alberto Fuguet und Sor Juana Inés de la Cruz.
Curt Meyer-Clason, geboren 1910 in Ludwigsburg, übersetzte herausragende lateinamerikanische Autoren wie Jorge Luis Borges, Pablo Neruda und Gabriel García Márquez. Sein Werk sowieso sein Engagement für die Vermittlung der lateinamerikanischen Literatur wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Curt Meyer-Clason starb 2012 in München.
Dagmar Ploetz, geboren 1946 in Herrsching, übersetzt seit 1983 u.a. Werke von Isabel Allende, Julián Ayesta, Rafael Chirbes, Manuel Puig, Mario Vargas Llosa und Gabriel García Márquez. 2012 wurde sie mit dem Münchner Übersetzerpreis ausgezeichnet. 2010 erschien von ihr »Gabriel García Márquez. Leben und Werk« bei Kiepenheuer & Witsch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der ganze Kosmos Gabriel García Márquez‘ im Spiegel seiner erfrischend unakademischen Reden
Er hatte sich geschworen, nie eine Rede zu halten, aber dann steht er doch sein Leben lang auf den Podien der Welt. Gabriel García Márquez, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und Literaturnobelpreisträger, weiß, was für eine Macht das Wort, sein Wort, haben kann. Die von ihm selbst eigens für dieses Buch zusammengestellten Reden sind wunderschöne, bewegende Beispiele dafür und unvergleichlich.
Literatur, Journalismus, Film und Politik, nicht zu vergessen die Freundschaften, sind die großen Themen im öffentlichen Leben von Gabriel García Márquez. Und darum geht es in diesen Reden – von der ersten, die er 1944 bei seinem Schulabschluss hielt, über die Nobelpreisrede 1982 bis zu jener anrührenden Ansprache 2007 in Cartagena de Indias bei der Vierzigjahr-Feier von »Hundert Jahre Einsamkeit«. Die Texte, die ein Leben umspannen, zeigen Gabriel García Márquez in vielen Facetten: den politisch engagierten Bürger seines Landes, den Literaturliebhaber, den erfolgreichen Autor und Nobelpreisträger, den Filmfan, der eine Akademie gründet, den couragierten Journalisten. Sie sind lebendig, anekdotenreich und packend. Man wünscht sich beim Lesen, die Stimme von Gabriel García Márquez zu hören.
Inhaltsverzeichnis
Die Akademie der Pflicht
Wie ich zu schreiben begann
Euretwegen
Noch eine Heimat, eine andere
Die Einsamkeit Lateinamerikas
Ein Hoch auf die Poesie
Worte für ein neues Jahrtausend
Damoklesschwert
Eine unzerstörbare Idee
Vorwort für ein neues Jahrtausend
Ich bin nicht hier
Zu Ehren von Belisario Betancur anlässlich seines siebzigsten Geburtstags
Mein Freund Mutis
Der Argentinier, der es schaffte, von allen geliebt zu werden
Lateinamerika gibt es wirklich
Ein anderes Naturell in einer Welt, die anders ist als die unsere
Journalismus: der beste Beruf der Welt
Flaschenpost für den Gott der Wörter
Hoffnungen für das 21. Jahrhundert
Das geliebte, wenn auch ferne Vaterland
Ein offenes Herz für Botschaften auf Spanisch
Nachbemerkung des Herausgebers
Anmerkungen zu den Reden
Die Akademie der Pflicht
Zipaquirá, Kolumbien, 17. November 1944
Gewöhnlich wird für solche Veranstaltungen jemand bestimmt, der eine Rede halten soll. Diese Person sucht sich dann ein passendes Thema aus und erörtert es vor den Anwesenden. Ich bin nicht hier, um eine Rede zu halten. Ich konnte mir für den heutigen Tag das noble Thema Freundschaft wählen. Was aber sollte ich euch über die Freundschaft sagen? Ich hätte ein Paar Seiten mit Anekdoten und Sentenzen füllen können, die mich am Ende jedoch nicht zum gewünschten Ziel geführt hätten. Ihr selbst müsst, jeder für sich, eure eigenen Gefühle erkunden, die einzelnen Gründe dafür, dass ihr eine einzigartige Vorliebe für jenen Menschen fühlt, in den ihr euer ganzes Vertrauen gelegt habt, und dann werdet ihr den Sinn dieses Festakts erkennen.
Mit dieser Gruppe junger Männer, die sich heute hinaus ins Leben begeben, verbindet uns unverbrüchlich die Fülle des alltäglich Erlebten – das macht Freundschaft aus. Genau dies hätte ich heute ausgeführt. Aber, wie gesagt, ich bin nicht hier, um eine Rede zu halten; ich möchte euch vielmehr zu Geschworenen bei einem Prozess ernennen und euch dann auffordern, gemeinsam mit den Schülern dieses Jahrgangs den schmerzlichen Augenblick des Abschieds zu teilen.
Hier stehen, aufbruchbereit, Henry Sánchez, der sympathische d’Artagnan des Sports, und seine drei Musketiere, Jorge Fajardo, Augusto Londoño und Hernando Rodríguez. Hier stehen Rafael Cuenca und Nicolás Reyes, der eine dem andern wie sein Schatten verbunden. Hier stehen Ricardo González, der Ritter des Reagenzglases, und Alfredo García Romero, gefürchtet bei allen Diskussionen; beide zusammen: Vorbilder echter Freundschaft. Hier sind Julio Villafañe und Rodrigo Restrepo, Mitglieder unseres Parlaments und unserer Redaktion. Hier stehen Miguel Ángel Lozano und Guillermo Rubio, zwei Apostel der Genauigkeit. Hier Humberto Jaimes und Manuel Arenas, Samuel Huertas und Ernesto Martínez, Konsuln der Aufopferung und des guten Willens. Hier steht Álvaro Nivia mit seiner guten Laune und seinem Scharfsinn. Hier sind Jaime Fonseca und Héctor Cuéllar und Alfredo Aguirre, drei ganz unterschiedliche Menschen mit einem einzigen, wahren Ideal: dem Sieg. Hier Carlos Aguirre und Carlos Alvarado, verbunden durch den gleichen Namen und den gleichen Wunsch, dem Vaterland zum Stolz zu gereichen. Hier Alvaro Baquero und Ramiro Cárdena und Jaime Montoya, drei unzertrennliche Bücherfreunde. Und zum Schluss sind da noch Julio César Morales und Guillermo Sánchez, zwei lebende Säulen, die auf ihren Schultern die Verantwortung für meine Worte tragen, wenn ich sage, dass diese Gruppe junger Männer dazu bestimmt ist, auf den besten Daguerreotypien Kolumbiens zu überdauern. Sie alle sind auf der Suche nach dem Licht, geleitet von ein und demselben Ideal.
Nachdem ihr gehört habt, welche Qualitäten jeder Einzelne besitzt, fälle ich das Urteil, über das ihr als Geschworene entscheiden müsst: Im Namen des Liceo Nacional und der Gesellschaft erkläre ich nach Ciceros Worten diese jungen Männer zu ordentlichen Mitgliedern der Akademie der Pflicht und zu Bürgern der Intelligenz.
Ehrenwerte Zuhörer, der Prozess ist hiermit beendet.
Deutsch von Dagmar Ploetz
Wie ich zu schreiben begann
Caracas, Venezuela, 3. Mai 1970
Zuallererst bitte ich zu entschuldigen, dass ich im Sitzen spreche, aber wenn ich aufstehe, riskiere ich, vor Angst umzufallen. Wirklich. Dabei habe ich immer geglaubt, dass ich die schrecklichsten fünf Minuten meines Lebens in einem Flugzeug verbringen würde, allenfalls vor zwanzig oder dreißig Personen, aber nicht vor zweihundert Freunden wie jetzt. Zum Glück erlaubt mir nun dieser Umstand, gleich von meinem Schreiben zu sprechen, denn gerade habe ich gedacht, dass ich auf die gleiche Weise Schriftsteller geworden bin, wie ich dieses Podium bestiegen habe: gezwungenermaßen. Ich gestehe, dass ich alles Mögliche getan habe, um nicht an dieser Versammlung teilzunehmen: Ich versuchte, krank zu werden, bemühte mich, eine Lungenentzündung einzufangen, ging zum Barbier in der Hoffnung, dass er mir die Kehle durchtrennt, und verfiel zuletzt darauf, ohne Jackett und Krawatte zu erscheinen, um bei einer so förmlichen Veranstaltung wie dieser schon am Eingang abgewiesen zu werden, aber ich hatte vergessen, dass ich in Venezuela bin, wo man überall im Hemd auftauchen kann. Ergebnis: Hier bin ich und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel erzählen, wie ich zu schreiben begann.
Der Gedanke, Schriftsteller zu werden, war mir nie gekommen; ich war Student, als Eduardo Zalamea Borda, der Leiter der Literaturbeilage von El Espectador in Bogotá, einen Artikel veröffentlichte, in dem er beklagte, dass die neue Autorengeneration nichts zu bieten habe, dass er nirgends einen neuen Erzähler oder Romancier entdecken könne. Und er schloss mit der Bemerkung, dass man ihn dafür tadele, in seiner Zeitung nur bekannte Namen zu publizieren, nur ältere Autoren und keine jungen, aber es gebe eben einfach keine jungen Leute, die schrieben.
Da überkam mich ein Gefühl der Solidarität mit meinen Altersgenossen, und ich beschloss, eine Erzählung zu schreiben, nur um Eduardo Zalamea Borda das Maul zu stopfen, er war ein guter Freund, oder wurde es zumindest später. Ich habe mich hingesetzt und die Erzählung geschrieben und sie dem Espectador zugeschickt. Der Schreck war groß, als ich am Sonntag darauf die Zeitung aufschlug und eine ganze Seite mit meiner Geschichte sah, dazu eine Notiz von Eduardo Zalamea Borda, in der er zugab, sich geirrt zu haben, denn ganz offensichtlich gebe sich »mit dieser Erzählung das Genie der kolumbianischen Literatur zu erkennen«, oder etwas in der Art.
Das machte mich damals richtig krank und ich sagte mir: »In was für eine Bredouille habe ich mich gebracht! Was soll ich jetzt machen, um Zalamea Borda nicht zu blamieren?« Weiterschreiben, war die Antwort. Mein Problem sind immer die Themen gewesen: Ich musste die Geschichte suchen und finden, um sie schreiben zu können.
Und das erlaubt mir, Ihnen etwas anzuvertrauen, was ich jetzt, nachdem ich fünf Bücher veröffentlicht habe, feststelle: Das Handwerk des Schriftstellers ist vielleicht das einzige, das immer schwieriger wird, je länger man es ausübt. Die Leichtigkeit, mit der ich mich damals hinsetzte und jene Geschichte an einem Abend schrieb, ist nicht zu vergleichen mit der Mühe, die es mich heute kostet, eine einzige Seite zu füllen. Und meine Arbeitsmethode entspricht durchaus dem hier Gesagten. Ich weiß nie, wie viel und was ich schreiben werde. Ich warte darauf, dass mir etwas einfällt, und habe ich eine Idee, die mir gut erscheint, dann wälze ich sie im Kopf herum und lasse sie wachsen. Wenn sie ausgereift ist (und darüber vergehen manchmal Jahre, wie bei Hundert Jahre Einsamkeit, darüber habe ich neunzehn Jahre lang nachgedacht), wenn die Idee also ausgereift ist, dann setze ich mich hin, um sie niederzuschreiben, und damit beginnt der schwierigste Teil der Arbeit und der für mich langweiligste. Denn das Köstlichste an einer Geschichte ist, sie zu erfinden, sie allmählich auszuführen und abzurunden, indem man sie wieder und wieder im Kopf umwälzt, sodass sie, wenn man sich schließlich hinsetzt, um sie aufzuschreiben, einen selbst nicht mehr sonderlich interessiert, mich zumindest interessiert sie nicht mehr besonders; es ist der Einfall, der mich umtreibt.
Ich kann Ihnen zum Beispiel von einer Idee erzählen, die mir seit Jahren durch den Kopf geht und bei der ich vermute, dass sie schon ziemlich abgerundet ist. Ich erzähle Ihnen davon jetzt, damit Sie einst, wenn ich die Geschichte einmal, wer weiß wann, niederschreibe, sehen, dass es eine ganz andere Geschichte geworden ist, und nachvollziehen können, wie sie sich entwickelt hat. Stellen Sie sich ein sehr kleines Dorf vor, in dem eine ältere Frau mit zwei Kindern lebt, einem siebzehnjährigen Sohn und einer jüngeren, vierzehnjährigen Tochter. Sie macht den Kindern gerade das Frühstück und wirkt dabei sehr besorgt. Die Kinder fragen, was sie denn habe, und sie antwortet: »Ich weiß nicht, aber ich bin mit dem Gedanken aufgewacht, dass etwas Schlimmes in diesem Dorf geschehen wird.«
Die Kinder lachen sie aus, sagen, das seien Altweibervorahnungen, so etwas komme vor. Der Junge geht zum Billardspielen, und als er gerade eine ganz einfache Karambolage stoßen will, sagt sein Gegner zu ihm: »Ich wette einen Peso drauf, dass du es nicht schaffst.« Alle lachen, er lacht, er stößt die Karambolage an und schafft es nicht. Er zahlt den Peso und wird gefragt: »Was war denn los, das war doch so ein einfacher Stoß?« Er sagt: »Stimmt, aber ich war in Sorge über das, was meine Mutter heute Morgen gesagt hat: Es wird etwas Schlimmes im Dorf passieren.« Alle lachen ihn aus, und der Gewinner des Pesos geht nach Hause, und da sitzt seine Mutter mit einer Cousine oder einer Enkelin oder irgendeiner Verwandten. Glücklich über seinen Peso sagt er: »Diesen Peso habe ich Dámaso ganz leicht abgenommen, nur weil er ein Dummkopf ist.« »Warum ist er denn ein Dummkopf?« Er antwortet: »Ach, der hat eine ganz einfache Karambolage nicht geschafft, weil es ihn bedrückte, dass seine Mutter heute mit der Vorstellung aufgewacht ist, etwas Schreckliches werde in diesem Dorf passieren.«
Da sagt seine Mutter: »Spotte nicht über die Vorahnungen der alten Leute, die treffen manchmal ein.« Die Verwandte hört das und geht Fleisch einkaufen. Sie sagt zum Metzger: »Geben Sie mir ein Pfund Fleisch«, und als er schon schneidet, fügt sie hinzu: »Geben Sie mir lieber zwei Pfund, denn es heißt, dass etwas Schlimmes passieren wird, und da ist man besser vorbereitet.« Der Metzger gibt ihr das Fleisch, und als eine andere Frau kommt und ein Pfund Fleisch kaufen will, sagt er zu ihr: »Nehmen Sie lieber zwei Pfund, hier kommen die Leute in den Laden und sagen, dass etwas Schlimmes passiert; sie wollen vorbereitet sein und kaufen alles Mögliche ein.«
Daraufhin sagt die Alte: »Ich habe mehrere Kinder, geben Sie mir lieber vier Pfund.« Sie nimmt die vier Pfund, und um die Geschichte nicht zu lang zu machen – in einer halben Stunde hat der Metzger sein ganzes Fleisch verkauft, schlachtet noch eine Kuh, die er auch ganz verkauft, während das Gerücht sich weiter verbreitet. Dann kommt ein Moment, in dem alle im Dorf darauf warten, dass etwas passiert. Die Arbeit ruht, und plötzlich um zwei Uhr nachmittags, es ist wie immer heiß, sagt irgendjemand: »Habt ihr gemerkt, wie heiß es ist?« »Aber in diesem Dorf war es doch schon immer heiß.« So heiß, dass die Musiker des Dorfs, die alle mit Pech geflickte Instrumente hatten, immer im Schatten spielten, weil sie ihnen in der Sonne auseinandergefallen wären. »Ja«, sagt einer, »aber noch nie war es zu dieser Stunde so heiß.« »Doch, aber nicht ganz so heiß wie jetzt.« In das leere Dorf, auf die leere Plaza fliegt plötzlich ein kleiner Vogel, und es geht von Mund zu Mund: »Ein kleiner Vogel sitzt auf der Plaza.« Und alle laufen erschrocken herbei, um den kleinen Vogel zu sehen.
»Aber, liebe Leute, es sind doch schon immer Vögelchen ins Dorf geflogen.« »Ja, aber noch nie zu dieser Stunde.« Die Spannung im Dorf nimmt immer mehr zu, alle sind verzweifelt und alle wollen nur eins: weg, aber keiner traut sich. »Ich bin Manns genug«, schreit einer, »ich hau ab.« Er packt seine Möbel, seine Kinder, seine Tiere, lädt sie auf einen Karren und überquert damit die Hauptstraße, wo ihn das ganze arme Dorf sieht. Und plötzlich sagen alle: »Wenn der sich traut, dann gehen wir auch«, und sie beginnen das Dorf buchstäblich zu schleifen. Sie nehmen ihre Sachen mit, die Tiere, alles. Und einer der Letzten, der das Dorf verlässt, sagt: »Das Unglück soll nicht treffen, was von unserem Haus noch bleibt«, und er zündet sein Haus an, und andere zünden andere Häuser an. Alle fliehen in echter, ungeheurer Panik, ein Exodus wie in Kriegszeiten, und mittendrin, schreiend, die Frau mit der Vorahnung: »Ich hab doch gesagt, dass etwas Schlimmes passiert, und alle haben mich für verrückt gehalten.«
Deutsch von Dagmar Ploetz
Euretwegen
Caracas, Venezuela, 2. August 1972
Nun, da wir allein sind unter Freunden, möchte ich euch um euren Beistand bitten, denn ihr müsst mir helfen, die Erinnerung an diesen Abend zu ertragen, an das erste Mal in meinem Leben, dass ich leibhaftig und im Vollbesitz meiner Kräfte dastehe, um gleich zwei Dinge zu tun, die niemals zu tun ich mir geschworen hatte: einen Preis entgegenzunehmen und eine Rede zu halten.
Ich habe – im Gegensatz zu anderen, durchaus ehrenwerten Meinungen – immer geglaubt, dass wir Schriftsteller nicht auf der Welt sind, um bekränzt zu werden, und viele von euch wissen zudem, dass jede öffentliche Ehrung der Anfang der Einbalsamierung ist. Ich habe also immer geglaubt, dass wir nicht aus eigenem Verdienst Schriftsteller sind, sondern weil wir unglücklicherweise nichts anderes sein können, und dass unsere einsame Arbeit nicht mehr Belohnung und Privilegien verdient als die des Schusters, der Schuhe anfertigt. Glaubt jedoch nicht, dass ich mich für mein Kommen entschuldigen will oder dass ich die Auszeichnung gering schätze, die mir heute unter dem wegweisenden Namen eines großen und unvergesslichen Mannes der amerikanischen Literatur zuteilwird. Ganz im Gegenteil, ich bin gekommen, um diese öffentliche Veranstaltung zu genießen, denn mir ist ein Grund eingefallen, der meine Prinzipien untergräbt und meine Skrupel erstickt: Ich stehe hier, Freunde, schlicht und einfach wegen meiner alten und unerschütterlichen Zuneigung zu diesem Land, in dem ich einmal jung, unbekannt und glücklich war, bin hier aus Liebe und aus Solidarität mit meinen Freunden in Venezuela, tolle Freunde und großherzige Feinde des tierischen Ernstes bis in den Tod. Ihretwegen stehe ich hier, und das heißt, euretwegen.
Deutsch von Dagmar Ploetz
Noch eine Heimat, eine andere
Mexiko-Stadt, Mexiko, 22. Oktober 1982
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: