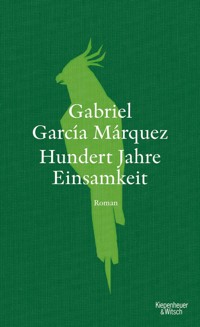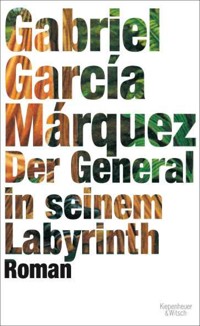9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der erste Teil der Memoiren von Gabriel García Márquez – »Leben, um davon zu erzählen« ist ein großes Buch, das nicht nur bewegt und begeistert, sondern Lust macht, die Romane und Erzählungen des Nobelpreisträgers zu lesen oder wieder – und wieder – zu lesen. »Nicht was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.« Und so erzählt Gabriel García Márquez diesem Motto seines Buches folgend vom Leben seiner Eltern, denen er in »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« ein Denkmal setzte, von der eigenen Kindheit und Jugend. Er erzählt von großer Armut und wilden Liebesabenteuern, von Freunden fürs Leben und der Leidenschaft für die Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 891
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Leben, um davon zu erzählen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Er gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichen Schriftsteller der Welt. García Márquez starb am 17. April 2014 im Alter von 87 Jahren in Mexiko-Stadt.
Dagmar Ploetz, geboren 1946 in Herrsching, übersetzt seit 1983 aus dem Spanischen Autoren wie Isabel Allende, Julián Ayesta, Rafael Chirbes, Gabriel García Márquez, Juan Marsé, Manuel Puig und Juan Rulfo.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der erste Teil der Memoiren von Gabriel García Márquez sind ein Welterfolg. Die Erstauflage von über einer Million Exemplaren war in der spanischsprachigen Welt schnell vergriffen. Die deutsche Ausgabe stand sofort auf allen Bestsellerlisten. Leben, um davon zu erzählen ist ein großes Buch, das nicht nur bewegt und begeistert, sondern Lust macht, die Romane und Erzählungen des Nobelpreisträgers zu lesen oder wieder – und wieder – zu lesen. »Nicht was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.« Und so erzählt Gabriel García Márquez diesem Motto seines Buches folgend vom Leben seiner Eltern, denen er in Die Liebe in den Zeiten der Cholera ein Denkmal setzte, von der eigenen Kindheit und Jugend. Er erzählt von großer Armut und wilden Liebesabenteuern, von Freunden fürs Leben und der Leidenschaft für die Literatur.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Vivir para contarla
Copyright © 2002 by Gabriel García Márquez
All rights reserved
Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz
© 2002, 2003, 2004, 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn, Köln
ISBN978-3-462-30865-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Karten
Nicht was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.
1
Meine Mutter bat mich, sie zum Verkauf des Hauses zu begleiten. Sie war morgens in Barranquilla eingetroffen, kam aus dem fernen Städtchen, in dem die Familie wohnte, und hatte keine Ahnung, wie sie mich finden sollte. Sie fragte hier und dort bei Bekannten nach, und man gab ihr den Hinweis, in der Buchhandlung Mundo oder in den Cafés der Umgebung zu suchen, wo ich mich zweimal täglich mit meinen Schriftstellerfreunden zu treffen pflegte. Der das sagte, warnte sie: »Nehmen Sie sich in Acht, die sind völlig durchgedreht.« Punkt zwölf war sie da. Mit ihrem leichtfüßigen Schritt bahnte sie sich den Weg durch die Büchertische, stand vor mir, schaute mir mit dem schalkhaften Lächeln ihrer besten Tage in die Augen und sagte, noch bevor ich reagieren konnte:
»Ich bin deine Mutter.«
Etwas an ihr hatte sich verändert, was mir nicht erlaubte, sie auf den ersten Blick zu erkennen. Sie war fünfundvierzig Jahre alt. Zählt man die elf Geburten zusammen, war sie fast zehn Jahre lang schwanger gewesen und hatte mindestens noch einmal so lang ihre Kinder gestillt. Sie war vor der Zeit vollständig ergraut, die Augen wirkten größer und erstaunt hinter ihrer ersten Bifokalbrille, und sie trug strenge Trauer wegen des Todes ihrer Mutter, hatte jedoch die römische Schönheit ihres Hochzeitsfotos bewahrt, die eine herbstliche Aura nun mit Würde umgab. Zuallererst, noch bevor sie mich umarmte, sagte sie in ihrer gewohnt zeremoniösen Art:
»Ich bin gekommen, weil ich dich um den Gefallen bitten möchte, mich zum Verkauf des Hauses zu begleiten.«
Sie musste nicht sagen, wohin, noch um welches Haus es sich handelte, denn für uns gab es nur eins auf der Welt: das alte Haus der Großeltern in Aracataca, in dem geboren zu werden ich das Glück hatte und in dem ich seit meinem achten Lebensjahr nicht mehr gewohnt habe. Ich hatte gerade die juristische Fakultät nach sechs Semestern verlassen, die ich vor allem dazu genutzt hatte, alles, was mir in die Hände kam, zu lesen und die unvergleichliche Poesie des spanischen Siglo de Oro auswendig zu rezitieren. Ich hatte damals bereits alle Bücher in Übersetzung ausgeliehen und gelesen, die genügt hätten, um die Technik des Romanschreibens zu erlernen, und hatte in Zeitungsbeilagen sechs Erzählungen veröffentlicht, die meine Freunde begeisterten und ein paar Kritiker aufmerken ließen. Im nächsten Monat sollte ich dreiundzwanzig werden, hatte gegen die Wehrpflicht verstoßen, war bereits Veteran zweier Gonorrhöen und rauchte ohne böse Vorahnungen täglich sechzig Zigaretten üblen Tabaks. Meine Freizeit teilte ich zwischen Barranquilla und Cartagena de Indias an der kolumbianischen Karibikküste auf, schlug mich mit dem durch, was man mir bei El Heraldo für meine täglichen Beiträge zahlte, also mit so gut wie nichts, und schlief, möglichst in angenehmer Begleitung, dort, wo mich die Nacht überraschte. Als sei es mit meinen ungewissen Bestrebungen und dem chaotischen Lebenswandel noch nicht genug, wollten wir, eine Gruppe unzertrennlicher Freunde, gerade ohne Geld eine waghalsige Zeitschrift herausbringen, die Alfonso Fuenmayor schon seit drei Jahren plante. Was mehr konnte ich wünschen?
Eher aus Not denn aus Überzeugung eilte ich der Mode um zwanzig Jahre voraus: wild wuchernder Schnurrbart, aufgewühlte Mähne, fragwürdig geblümte Hemden zu Jeans und Jesuslatschen. In der Dunkelheit eines Kinos sagte eine damalige Freundin, nicht wissend, dass ich in der Nähe saß, zu jemandem: »Der arme Gabito ist ein aussichtsloser Fall.« Als meine Mutter mich also fragte, ob ich sie begleitete, um das Haus zu verkaufen, stand einem Ja nichts im Wege. Sie gab zu bedenken, dass sie nicht genug Geld habe, und aus Stolz sagte ich, dass ich für meine Kosten selbst aufkäme.
Doch bei der Zeitung, für die ich arbeitete, war das Geldproblem nicht zu lösen. Sie zahlten mir drei Pesos für die tägliche Glosse und vier für einen Meinungsbeitrag, wenn einer der zuständigen Redakteure fehlte, doch das reichte kaum. Ich versuchte es mit einem Vorschuss, aber der Geschäftsführer erinnerte mich daran, dass ich bereits mit über fünfzig Pesos in der Kreide stand. An jenem Abend wagte ich einen Vorstoß, zu dem keiner meiner Freunde fähig gewesen wäre. Aus dem Café Colombia kommend, gleich neben dem Buchladen, holte ich den alten katalanischen Lehrer und Buchhändler Don Ramón Vinyes ein und bat ihn, mir zehn Pesos zu leihen. Er hatte nur sechs.
Natürlich konnten weder meine Mutter noch ich damals ahnen, wie bestimmend dieser harmlose zweitägige Ausflug für mich sein sollte, sodass auch das längste und arbeitsamste Leben nicht ausreichen würde, erschöpfend davon zu erzählen. Jetzt, mit mehr als fünfundsiebzig wohlbemessenen Jahren, weiß ich, dass die Entscheidung zu dieser Reise die wichtigste war, die ich in meiner Laufbahn als Schriftsteller zu treffen hatte. Das heißt: in meinem ganzen Leben.
Bis in die Adoleszenz hinein interessiert sich das Gedächtnis mehr für die Zukunft als für die Vergangenheit, daher waren meine Erinnerungen an Aracataca noch nicht durch Nostalgie verklärt. Ich erinnerte mich so daran, wie es gewesen war: ein Ort, in dem es sich gut leben ließ, wo jeder jeden kannte, am Ufer eines Flusses mit kristallklarem Wasser, das dahinschoss durch ein Bett mit polierten Steinen, weiß und riesig wie prähistorische Eier. Gegen Abend, besonders im Dezember, wenn der Regen vorüber war und die Luft sich in Diamant verwandelte, schien die Sierra Nevada de Santa Marta mit ihren weißen Bergspitzen bis an die Bananenplantagen am anderen Ufer heranzurücken. Von hier aus konnte man die Arhuaco-Indios wie Ameisen in Reihen über die Bergpfade der Sierra eilen sehen, sie hatten Ingwersäcke auf dem Buckel und kauten Cocakugeln, um das Leben abzulenken. Wir Kinder träumten damals davon, aus dem ewigen Weiß Schneebälle zu formen und damit in den glutheißen Straßen Schlachten auszutragen. Die Hitze war so unglaublich, vor allem in der Siestazeit, dass die Erwachsenen darüber klagten, als handele es sich um eine täglich neue Überraschung. Ich habe von meiner Geburt an ständig wiederholen gehört, dass die Eisenbahnstrecke und die Lager der United Fruit Company nachts gebaut werden mussten, weil es unmöglich gewesen sei, tagsüber das sonnenheiße Werkzeug anzufassen.
Die einzige Möglichkeit, von Barranquilla nach Aracataca zu gelangen, war ein klappriges Motorschiff, das auf einem in der Kolonialzeit von Sklavenhand ausgehobenen Kanal fuhr, dann durch ein weites, sumpfiges Gewässer, trüb und trostlos, bis zur rätselhaften Ortschaft Ciénaga. Dort bestieg man einen Bummelzug, der ursprünglich der beste des Landes gewesen war, und fuhr, mit vielen müßigen Unterbrechungen in staubglühenden Dörfern und an einsamen Bahnhöfen, die letzte Strecke durch unermessliche Bananenplantagen. Auf diesen Weg machten meine Mutter und ich uns am Samstag, dem 18. Februar 1950 um sieben Uhr abends – es war der Vorabend des Karnevals –, unter einem sintflutartigen Platzregen außerhalb der Zeit und mit einer Barschaft von zweiunddreißig Pesos, die knapp für die Rückfahrt reichen würden, falls das Haus sich nicht zu den erwarteten Konditionen verkaufen ließ.
Die Passatwinde wehten an jenem Abend so heftig, dass es schwierig war, meine Mutter am Flusshafen dazu zu überreden, an Bord zu gehen. Sie hatte gute Gründe. Die Schiffe waren verkleinerte Versionen der Flussdampfer von New Orleans, hatten aber Benzinmotore, die alles an Bord in ein böses, fiebriges Zittern versetzten. Es gab einen kleinen Salon mit Pfosten, an denen man auf verschiedenen Ebenen Hängematten befestigen konnte, und mit Holzbänken, auf denen jeder unter Einsatz der Ellenbogen einen Platz zu ergattern suchte, für sich und das übermäßige Gepäck, Säcke mit Waren oder Körbe mit Hühnern oder sogar mit lebenden Schweinen. Es gab ein paar stickige Kabinen mit jeweils zwei Feldbetten, fast immer von armseligen Hürchen belegt, die während der Fahrt Notdienste erwiesen. Da wir spät dran waren und keine Kabine mehr frei fanden, auch keine Hängematten dabeihatten, besetzten meine Mutter und ich überfallartig zwei Eisenstühle im Mittelgang und richteten uns dort für die Nacht ein.
So wie meine Mutter es befürchtet hatte, beutelte der Sturm das wagemutige Schiff, als wir den Magdalena überquerten, der, so kurz vor der Mündung, das Temperament eines Ozeans hat. Ich hatte mich am Hafen reichlich mit den billigsten Zigaretten eingedeckt, schwarzer Tabak und ein Papier, das schon fast an Lumpen erinnerte, und begann nach meiner damaligen Art zu rauchen, ich zündete eine Zigarette am Stummel der letzten an, während ich wieder einmal Licht im August von William Faulkner las, der damals der treueste meiner Schutzdämonen war. Meine Mutter klammerte sich an ihren Rosenkranz wie an eine Handwinde, die einen festgefahrenen Traktor aus dem Schlamm hätte ziehen oder ein Flugzeug in der Luft halten können, und, wie gewöhnlich, erflehte sie nichts für sich selbst, sondern Glück und ein langes Leben für ihre elf Waisenkinder. Ihr Gebet muss erhört worden sein, denn der Regen wurde sanfter, als wir in den Kanal einfuhren, und die Brise wehte so leicht, dass sie gerade einmal die Moskitos aufscheuchte. Daraufhin steckte meine Mutter den Rosenkranz ein und beobachtete eine ganze Weile lang schweigend das tosende Leben um uns herum.
Sie war in einem bescheidenen Haus geboren worden, wuchs aber in der flüchtigen Herrlichkeit des Bananenbooms auf, wodurch ihr immerhin die gute Erziehung einer höheren Tochter am Colegio de la Presentación de la Santísima Vírgen in Santa Marta blieb. In den Weihnachtsferien stichelte sie damals mit ihren Freundinnen am Stickrahmen, spielte Klavichord auf Wohltätigkeitsbasaren und besuchte mit einer Tante als Anstandsdame die höchst sittsamen Tanzfeste der gottesfürchtigen lokalen Aristokratie, doch von irgendeinem Verehrer hatte noch niemand gehört, als sie gegen den Willen der Eltern den Telegrafisten des Ortes heiratete. Ihre offenkundigsten Tugenden waren seit jener Zeit ihr Sinn für Humor und ihre eiserne Gesundheit, denen auch die Ränke des Schicksals in ihrem langen Leben nichts anhaben konnten. Ihre erstaunlichste, gleichwohl am wenigsten auffällige Eigenschaft war aber die besondere Gabe, über ihre ungeheuerliche Willensstärke hinwegzutäuschen: ein perfekter Löwe. Das hatte ihr erlaubt, eine matriarchalische Herrschaft zu errichten, die sich bis auf weit entfernte Verwandte an ungeahnten Orten erstreckte, so etwas wie ein Planetensystem, über das sie von ihrer Küche aus regierte, mit leiser Stimme und ruhigem Blick, indes sie den Bohneneintopf kochte.
Ich sah, wie sie ungerührt diese brutale Reise über sich ergehen ließ, und fragte mich, wie es ihr möglich gewesen war, derart schnell und mit so viel Haltung die Prüfungen der Armut zu bestehen. Nichts war so geeignet wie diese böse Nacht, um sie auf die Probe zu stellen. Die blutgierigen Moskitos, die Hitze, schwer und übel riechend vom Schlamm der Kanäle, den das Boot auf seiner Fahrt aufwirbelte, das Gewühl der schlaflosen Passagiere, denen es in ihrer Haut nicht wohl war, alles schien aufgeboten, um auch das abgehärtetste Gemüt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Meine Mutter ertrug es unbewegt auf ihrem Stuhl, während die mietbaren Mädchen, als Männer oder Spanierinnen verkleidet, in den nahen Kabinen die Ernte des Karnevals einfuhren. Eine von ihnen war mehrmals aus der Tür gleich neben dem Sitzplatz meiner Mutter herausgekommen und wieder dahinter verschwunden, immer mit einem anderen Kunden. Ich dachte, meine Mutter hätte sie nicht bemerkt. Doch beim vierten oder fünften Mal innerhalb einer knappen Stunde folgte ihr mitleidiger Blick dem Mädchen bis zum Ende des Ganges.
»Arme Mädels«, seufzte sie. »Was die zum Überleben machen müssen, ist schlimmer als arbeiten.«
So hielt sie sich bis Mitternacht, als ich, zu müde, um bei dem unerträglichen Beben des Schiffes und den geizigen Lichtern im Gang weiterzulesen, mich neben sie setzte und rauchend aus dem Treibsand von Yoknapatawpha County aufzutauchen versuchte. Ich war im vergangenen Jahr von der Universität mit der waghalsigen Hoffnung desertiert, vom Journalismus und der Literatur leben zu können, ohne beides erst erlernen zu müssen, und ermutigt von einem Satz, den ich bei Bernard Shaw gelesen zu haben glaube: »Schon als kleiner Junge musste ich meine Erziehung unterbrechen, um zur Schule zu gehen.« Ich fühlte mich nicht imstande, darüber mit irgendjemandem zu diskutieren, weil ich, ohne es erklären zu können, spürte, dass meine Gründe nur für mich selbst gültig waren.
Der Versuch, meine Eltern, die so viele Hoffnungen in mich gesetzt und so viel Geld, das sie nicht besaßen, dafür ausgegeben hatten, von einem solchen Irrsinn zu überzeugen, war Zeitverschwendung. Besonders bei meinem Vater, der mir alles verziehen hätte, nur nicht, dass ich kein wie immer geartetes akademisches Diplom, das ihm versagt geblieben war, an die Wand hängen konnte. Der Kontakt brach ab. Fast ein Jahr war vergangen, und ich hatte noch immer vor, ihn zu besuchen, um ihm meine Gründe darzulegen, als meine Mutter auftauchte und mich bat, sie zum Hausverkauf zu begleiten. Sie erwähnte die Angelegenheit jedoch nicht, erst nach Mitternacht muss sie auf dem Schiff so etwas wie eine übernatürliche Offenbarung verspürt haben, dass nun endlich die günstige Gelegenheit gekommen war, mir das zu sagen, was zweifellos der tatsächliche Grund ihrer Reise war, und sie begann in der Art und dem Ton und mit den genau bemessenen Worten, die sicher in der Einsamkeit ihrer schlaflosen Nächte gereift waren, lange vor Antritt der Reise.
»Dein Papa ist sehr traurig«, sagte sie.
Da war sie also, die ach so gefürchtete Hölle. Meine Mutter begann wie immer dann, wenn man es überhaupt nicht erwartete, und in einem sedierenden Tonfall, den nichts aus der Ruhe bringen würde. Allein des Rituals wegen, denn die Antwort kannte ich nur zu gut, fragte ich:
»Und warum?«
»Weil du das Studium aufgegeben hast.«
»Ich habe es nicht aufgegeben, ich habe nur eine andere Laufbahn eingeschlagen«, sagte ich.
Der Gedanke an eine grundsätzliche Diskussion machte sie munter.
»Dein Papa sagt, das ist dasselbe«, sagte sie.
Ich wusste, dass der Vergleich hinkte, sagte aber:
»Auch er hat aufgehört zu studieren, um Geige zu spielen.«
»Das ist nicht das Gleiche«, erwiderte sie lebhaft. »Die Geige spielte er nur auf Festen oder bei Ständchen. Das Studium hat er abgebrochen, weil er nicht einmal genug Geld zum Essen hatte. Aber in einem knappen Monat hat er die Telegrafie erlernt, das war damals ein guter Beruf, besonders in Aracataca.«
»Ich lebe auch vom Schreiben für Zeitungen«, sagte ich.
»Das sagst du, damit ich mich nicht gräme«, sagte sie. »Aber in welch schlechter Lage du bist, sieht man dir schon von Weitem an. In der Buchhandlung habe ich dich nicht einmal erkannt.«
»Ich habe dich auch nicht erkannt«, sagte ich.
»Aber aus einem anderen Grund. Ich dachte, du wärst ein Bettler.« Sie schaute auf meine ausgetretenen Sandalen und fügte hinzu: »Und keine Strümpfe.«
»Das ist bequemer«, sagte ich. »Zwei Hemden und zwei Unterhosen, eine auf dem Leib, die andere auf der Leine. Was braucht man mehr?«
»Ein kleines bisschen Würde«, sagte sie, milderte das aber sogleich durch einen anderen Ton ab: »Ich sag es nur, weil wir dich so lieben.«
»Das weiß ich«, sagte ich. »Aber sag doch mal, würdest du an meiner Stelle nicht das Gleiche tun?«
»Das würde ich nicht«, sagte sie, »nicht, wenn ich damit meine Eltern verärgern würde.«
Ich dachte daran, mit welcher Zähigkeit sie den Widerstand der Familie gegen ihre Heirat gebrochen hatte, und lachte:
»Wag es, mir in die Augen zu sehen.«
Sie blieb ernst und wich mir aus, weil sie nur zu gut wusste, was ich dachte.
»Ich habe nicht geheiratet, solange ich nicht den Segen meiner Eltern hatte«, sagte sie. »Ich habe ihn erzwungen, das stimmt, aber ich hatte ihn.«
Sie unterbrach das Gespräch, nicht weil meine Argumente sie geschlagen hätten, sondern weil sie auf die Toilette wollte und deren hygienischem Zustand misstraute. Ich fragte den Bootsmann, ob es nicht vielleicht einen gesünderen Ort gäbe, er erklärte jedoch, dass auch er den allgemeinen Abort benutze, und schloss, als habe er gerade Conrad gelesen: »Auf dem Meer sind wir alle gleich.« Also unterwarf sich meine Mutter dem allgemeinen Gesetz. Als sie wieder herauskam, konnte sie, anders als ich befürchtet hatte, das Lachen kaum unterdrücken:
»Stell dir nur vor, was sich dein Papa denkt, wenn ich mit einer Geschlechtskrankheit zurückkomme.«
Nach Mitternacht lagen wir drei Stunden fest, weil die im Kanal klumpenden Seeanemonen sich in der Schiffsschraube verfangen hatten und wir in einem Mangrovengestrüpp aufgelaufen waren, sodass viele Passagiere das Schiff vom Ufer aus an Hängematteleinen freizerren mussten. Hitze und Stechmücken wurden unerträglich, aber meine Mutter rettete sich mit kleinen Schläfchen darüber hinweg, in die sie ebenso plötzlich versank, wie sie daraus wieder erwachte, und die in der Familie berühmt waren, da sie meiner Mutter erlaubten auszuruhen, ohne den Faden des Gesprächs zu verlieren. Als das Schiff Fahrt aufnahm und eine frische Brise hereinwehte, war sie wieder hellwach.
»Wie auch immer«, seufzte sie, »irgendeine Antwort muss ich deinem Papa bringen.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagte auch ich voller Unschuld. »Ich komme im Dezember und werde ihm dann alles erklären.«
»Bis dahin sind es noch zehn Monate«, sagte sie.
»An der Universität kann man in diesem Jahr sowieso nichts mehr regeln«, meinte ich.
»Versprichst du, wirklich zu kommen?«
»Ich verspreche es«, sagte ich. Und nahm zum ersten Mal eine gewisse Unruhe in ihrer Stimme wahr:
»Kann ich deinem Papa sagen, dass du dich in seinem Sinne entscheiden wirst?«
»Nein«, erwiderte ich schroff. »Das nicht.«
Offensichtlich suchte sie einen anderen Ausweg. Aber ich ermöglichte ihr keinen.
»Dann ist es besser, dass ich ihm gleich die ganze Wahrheit sage. Damit es nicht nach Täuschung aussieht.«
»Gut«, sagte ich erleichtert. »Sag ihm die Wahrheit.«
So verblieben wir, und wer meine Mutter nicht gut kannte, hätte meinen können, damit sei nun alles beendet, ich aber wusste, dass es sich nur um eine Pause handelte, um wieder Atem zu schöpfen. Kurz darauf schlief sie fest. Eine leichte Brise verscheuchte die Stechmücken und erfüllte die neue Luft mit Blumenduft. Das Schiff fuhr anmutig wie unter Segeln dahin.
Wir waren auf der Ciénaga Grande, einem weiteren Mythos meiner Kindheit. Ich hatte sie mehrmals befahren, wenn mein Großvater, Oberst Nicolás Ricardo Márquez Mejía, den nur wir Enkel Papalelo nannten, mich von Aracataca nach Barranquilla brachte, um meine Eltern zu besuchen. »Vor der Ciénaga muss man keine Angst haben, wohl aber Respekt«, hatte er mir gesagt, als er von den unvorhersehbaren Launen des Gewässers sprach, das sich wie ein Teich, aber auch wie ein nicht bezähmbarer Ozean gebärden konnte. In der Regenzeit war die Lagune den Stürmen von der Sierra ausgesetzt. Von Dezember bis April, wenn das Wetter eigentlich zahm sein sollte, fielen die Passatwinde aus dem Norden so heftig über die Ciénaga her, dass jede Nacht zum Abenteuer wurde. Meine Großmutter mütterlicherseits, Tranquilina Iguarán, genannt Mina, wagte die Überfahrt nur in Notfällen, nachdem sie eine Fahrt des Grauens erlebt hatte, bei der man bis Tagesanbruch in der Mündung des Riofrío hatte Schutz suchen müssen.
In dieser Nacht war die Ciénaga Grande zum Glück ein ruhiges Gewässer. Von den Bugfenstern aus, wo ich vor Morgengrauen ein wenig Luft schnappte, sah man die Lichter der Fischerboote wie Sterne im Wasser schweben. Es waren unzählige, und die unsichtbaren Fischer unterhielten sich wie bei einem Treffen, da ihre Stimmen auf der Ciénaga gespenstisch weit trugen. Auf das Geländer gestützt, versuchte ich die Konturen der Sierra zu erspähen, und plötzlich überraschte mich der erste Prankenschlag der Nostalgie.
An einem anderen frühen Morgen wie diesem hatte mich Papalelo, als wir die Ciénaga überquerten, schlafend in der Kabine zurückgelassen und war in die Bar gegangen. Ich weiß nicht, wie spät es gewesen sein mag, als aufgeregter Lärm von vielen Menschen das Surren des rostigen Ventilators und das Klappern der Bleche in der Kabine übertönte und mich weckte. Ich war kaum älter als fünf und sehr erschrocken, da aber schnell wieder Ruhe eintrat, dachte ich, es sei vielleicht nur ein Traum gewesen. Gegen Morgen, schon am Anlegeplatz in Ciénaga, rasierte sich mein Großvater mit dem Messer bei offener Tür vor dem Spiegel, der am Türrahmen hing. Eine genaue Erinnerung: Er hatte das Hemd noch nicht angezogen, aber seine ewigen Hosenträger, breit und grün gestreift, spannten sich über dem Unterhemd. Während er sich rasierte, unterhielt er sich mit einem Mann, den ich noch heute auf den ersten Blick wiedererkennen würde. Er hatte das unverwechselbare Profil eines Raben, eine Seemannstätowierung auf der rechten Hand und trug um den Hals mehrere schwere Goldketten, dazu, ebenfalls aus Gold, Armbänder und Reifen an beiden Handgelenken. Ich hatte mich gerade angekleidet und zog mir auf dem Bett sitzend die Schnürstiefel an, als der Mann zu meinem Großvater sagte:
»Kein Zweifel, Oberst, die wollten Sie ins Wasser werfen.«
Mein Großvater lächelte, ohne mit dem Rasieren aufzuhören, und erwiderte auf seine hochfahrende Art:
»Sie waren gut beraten, das nicht zu wagen.«
Erst da begriff ich den Tumult der vergangenen Nacht und war sehr beunruhigt bei dem Gedanken, dass jemand den Großvater in die Lagune hätte werfen können.
Die Erinnerung an diesen nie aufgeklärten Vorfall überfiel mich an jenem Morgen, als ich mit meiner Mutter unterwegs war, das Haus zu verkaufen, und den Schnee der Sierra betrachtete, der sich im ersten Sonnenlicht blau abzeichnete. Die Verzögerung in den Kanälen erlaubte uns, bei Tageslicht die leuchtende Sandbarriere zu sehen, die notdürftig das Meer von der Lagune trennte; dort gab es Fischerdörfer und Netze, die zum Trocknen am Strand ausgelegt waren, und verwahrloste, magere Kinder, die mit Lumpenbällen Fußball spielten. Es war beklemmend, auf den Straßen viele Männer mit versehrten Armen zu sehen, Fischer, die nicht rechtzeitig die Dynamitstäbe geworfen hatten. Als das Schiff vorüberfuhr, sprangen die Kinder ins Wasser und tauchten nach den Münzen, die ihnen die Passagiere zuwarfen.
Es war kurz vor sieben, als wir in einem übel riechenden Sumpf nah der Ortschaft Ciénaga ankerten. Trupps von Lastenträgern, bis zu den Knien im Schlamm, nahmen uns in die Arme und trugen uns inmitten eines Wirbels von Hühnergeiern, die sich die Abfälle im Morast streitig machten, platschend an Land. Wir frühstückten gemächlich am Hafen, aßen die köstlichen Ciénaga-Fische mit gebratenen Bananenscheiben, als meine Mutter in ihrem Privatkrieg wieder in die Offensive ging.
»Dann sag mir ein für alle Mal«, sagte sie, ohne den Blick zu heben, »was soll ich deinem Papa sagen?«
Ich versuchte, Zeit zum Nachdenken zu gewinnen.
»Über was?«
»Über das Einzige, was ihn interessiert«, sagte sie etwas irritiert, »über dein Studium.«
Ich hatte das Glück, dass ein aufdringlicher Gast, der sich über die Heftigkeit des Gesprächs wunderte, meine Gründe wissen wollte. Die sofortige Antwort meiner Mutter schüchterte mich nicht nur ein wenig ein, sondern überraschte mich auch bei ihr, die so eifersüchtig über ihr Privatleben wachte.
»Er will Schriftsteller werden«, sagte sie.
»Ein guter Schriftsteller kann gutes Geld verdienen«, erwiderte der Mann ernsthaft. »Besonders wenn er für die Regierung arbeitet.«
Ich weiß nicht, ob meine Mutter aus Diskretion oder aus Angst vor den Argumenten des unverhofften Gesprächspartners das Thema fallen ließ, jedenfalls beklagten schließlich beide einmütig die Unsicherheiten bei meiner Generation und teilten Erinnerungen an bessere Zeiten. Als sie am Ende nach gemeinsamen Bekannten suchten, entdeckten sie, dass wir sowohl vonseiten der Cotes als auch der Iguaráns miteinander verwandt waren. In jener Zeit widerfuhr uns das fast bei jedem Zweiten, den wir an der Karibikküste trafen, doch meine Mutter feierte es stets als unerhörtes Ereignis.
Zur Bahnstation fuhren wir in einer einspännigen Viktoria, vielleicht dem letzten Exemplar einer legendären Spezies, die im Rest der Welt schon ausgestorben war. Meine Mutter blickte gedankenversunken auf die unfruchtbare, vom Salpeter verbrannte Ebene, die hinter dem morastigen Hafen begann und in den Horizont überging. Für mich war das ein historischer Ort: Eines Tages, ich war wohl drei oder vier Jahre alt, hatte mich mein Großvater an der Hand durch diese glühende Ödnis geführt; er lief schnell und sagte mir nicht warum, und plötzlich standen wir vor einer weiten Fläche grünen Wassers mit Schaumrülpsern, auf der eine ganze Gesellschaft von ertrunkenen Hühnern trieb.
»Das ist das Meer«, sagte er.
Enttäuscht fragte ich ihn, was es am anderen Ufer gebe, worauf er ohne jeden Zweifel antwortete:
»Auf der anderen Seite gibt es kein Ufer.«
Heute, nachdem ich so viele Meere vorwärts und rückwärts gesehen habe, denke ich immer noch, dass dies eine seiner großen Antworten war. Jedenfalls entsprach keines der Bilder, die ich mir zuvor gemacht hatte, diesem schäbigen Ozean, an dessen steinigem Strand man wegen all der verfaulten Mangrovenzweige und Muschelsplitter nicht laufen konnte. Es war grauenvoll.
Meine Mutter musste über das Meer von Ciénaga ähnlich denken, denn sobald sie es links von der Kutsche auftauchen sah, seufzte sie:
»Kein Meer ist wie das von Riohacha!«
Bei dieser Gelegenheit erzählte ich ihr von meiner Erinnerung an die ertrunkenen Hühner, und, wie allen Erwachsenen, schien auch ihr das eine Kindheitsfantasie. Sie betrachtete jeden Platz, an dem wir vorbeikamen, und an ihrem unterschiedlichen Schweigen erkannte ich, was sie über jeden einzelnen dachte. Wir fuhren am Rotlichtviertel vorbei, das jenseits der Bahnstrecke liegt, bunte Häuschen mit verrosteten Dächern und den alten Papageien von Paramaribo, die von ihren an den Vordächern hängenden Reifen aus die Kunden auf Portugiesisch ankrächzten. Wir fuhren an der Tränke der Lokomotiven vorbei, dem riesigen Eisengewölbe, in dem Zugvögel und verirrte Möwen zum Schlafen Schutz suchten. Wir fuhren am Rand der Stadt entlang, ohne uns hineinzubegeben, sahen aber die breiten, verlassenen Straßen und die Häuser aus der alten Glanzzeit, sie waren einstöckig, mit bis zum Boden reichenden Fenstern, aus denen von frühmorgens an pausenlos die immer gleichen Klavierübungen ertönten. Plötzlich zeigte meine Mutter mit dem Finger auf etwas.
»Schau«, sagte sie, »dort ist die Welt untergegangen.«
Ich folgte ihrem Zeigefinger und sah den Bahnhof: ein Gebäude aus schartigem Holz, mit Satteldächern aus Zink und umlaufenden Balkonen, und davor eine leere, kleine Plaza, auf der allenfalls zweihundert Personen Platz gefunden hätten. Dort hatte, wie meine Mutter an jenem Tag präzisierte, das Heer 1928 eine nie geklärte Zahl von Tagelöhnern der Bananengesellschaft erschossen.
Ich kannte diese Episode, als hätte ich sie selbst erlebt, da ich sie, seitdem ich mich erinnern konnte, tausendmal von meinem Großvater erzählt bekommen hatte: Der Offizier liest das Dekret vor, in dem die streikenden Landarbeiter zu einer Horde von Übeltätern erklärt werden; dreitausend Männer, Frauen und Kinder regungslos unter der barbarischen Sonne, nachdem der Offizier ihnen eine Frist von fünf Minuten gegeben hat, um den Platz zu räumen; der Feuerbefehl, das Geknatter der Salven, weißglühendes Spucken, die Menschenmenge in Panik zusammengepfercht, während man sie Zug um Zug mit der methodischen und unersättlichen Sense der Maschinengewehre niedermäht.
Die Bahn erreichte Ciénaga um neun Uhr morgens, sammelte die Passagiere der Schiffe ein und jene, die aus der Sierra kamen, und fuhr eine viertel Stunde später in das Innere der Bananenregion weiter. Meine Mutter und ich kamen nach acht am Bahnhof an, der Zug hatte jedoch Verspätung. Dennoch waren wir die einzigen Passagiere. Sie bemerkte es, als sie in den leeren Waggon stieg, und rief fröhlich aus:
»Was für ein Luxus! Wir haben den ganzen Zug für uns!«
Ich habe mir immer gedacht, der Jubel sei vorgetäuscht gewesen und habe ihre Ernüchterung überspielen sollen, denn schon am Zustand der Waggons ließen sich die Verheerungen der Zeit auf den ersten Blick erkennen. Es waren die alten Wagen der zweiten Klasse, doch nun ohne Sitze aus Strohgeflecht, ohne die Fenster, die man hoch- und hinunterschieben konnte, jetzt gab es nur Holzbänke, die von den warmen, flachen Gesäßen der Armen gegerbt waren. Verglichen mit früheren Zeiten, war nicht nur der Waggon, sondern der ganze Zug ein Gespenst seiner selbst. Einst hatte er drei Klassen gehabt. Die dritte Klasse, in der die Ärmsten reisten, bestand aus den gleichen Bretterwagen, in denen die Bananen oder das Schlachtvieh transportiert wurde, und war für die Passagiere mit langen Längsbänken aus rohem Holz ausgestattet. In der zweiten Klasse gab es strohgeflochtene Sitze mit Messingrahmen. Die erste Klasse, in der die Regierungsbeamten und hohe Angestellte der Bananengesellschaft reisten, hatte Läufer in den Gängen und mit rotem Samt bezogene Sessel, bei denen man die Position der Rücklehnen verstellen konnte. Wenn der Beauftragte der Gesellschaft oder seine Familie oder vornehme Gäste auf die Reise gingen, hängte man ans Ende des Zuges einen Luxuswaggon mit getönten Scheiben und vergoldeten Gesimsen und einer offenen Plattform mit Tischchen, auf der man während der Fahrt Tee trinken konnte. Ich kenne keinen Sterblichen, der diese fantastische Karosse je von innen gesehen hat. Mein Großvater war zweimal Bürgermeister, hatte im Übrigen ein lockeres Verhältnis zum Geld, zweiter Klasse reiste er aber nur, wenn eine Frau der Familie dabei war. Und wenn er gefragt wurde, warum er selbst dritter Klasse fahre, antwortete er: »Weil es keine vierte gibt.« Am erinnerungswürdigsten war jedoch die Pünktlichkeit. Die Uhren der Ortschaften wurden nach der Einfahrt des Zuges gestellt.
An jenem Tag fuhr er aus diesem oder jenem Grund mit anderthalb Stunden Verspätung ab. Als er sich sehr langsam und mit einem kläglichen Quietschen in Gang setzte, bekreuzigte sich meine Mutter, kehrte aber sogleich in die Wirklichkeit zurück.
»Dieser Zug braucht Öl für die Federung«, sagte sie.
Wir waren die einzigen Passagiere, womöglich im ganzen Zug, und bis zu diesem Zeitpunkt hatte nichts wirklich mein Interesse geweckt. Unablässig rauchend tauchte ich in die Schwüle von Licht im August ein, schaute nur gelegentlich kurz auf, um zu sehen, welche Orte wir hinter uns ließen. Mit anhaltendem Pfeifen durchquerte der Zug das Sumpfgebiet und raste mit voller Geschwindigkeit in eine erbebende Schlucht aus roten Felsen, in der das Donnern der Waggons unerträglich wurde. Doch nach etwa fünfzehn Minuten drosselte er das Tempo und fuhr mit vorsichtigem Schnauben in das frische Dämmerlicht der Plantagen, die Zeit verdichtete sich, und die Meeresbrise war nicht mehr zu spüren. Ich musste die Lektüre nicht unterbrechen, um zu wissen, dass wir in das hermetische Reich der Bananenregion gelangt waren.
Die Welt veränderte sich. Rechts und links von den Gleisen gingen die endlosen symmetrischen Plantagenwege ab, auf denen Ochsenkarren, beladen mit grünen Bündeln, unterwegs waren. Plötzlich, auf überraschend unbepflanzten Flächen, tauchten Siedlungen aus rotem Ziegel auf, Büros mit Segeltuchmarkisen an den Fenstern und Ventilatoren an den Decken und ein einsames Hospital in einem Mohnfeld. Jeder Fluss hatte sein Dorf und seine Eisenbrücke, über die der Zug aufheulend fuhr, und die Mädchen, die im eiskalten Wasser badeten, sprangen wie die Maifische hoch, um mit flüchtig aufscheinenden Brüsten den Reisenden aus der Ruhe zu bringen.
In Riofrío stiegen mehrere schwer beladene Arhuaco-Familien zu, die Rucksäcke bis zum Rand gefüllt mit Avocados aus der Sierra, den schmackhaftesten des Landes. Sie hüpften durch den Waggon hin und her, auf der Suche nach Sitzplätzen, doch als der Zug wieder anfuhr, waren nur noch zwei weiße Frauen mit einem Neugeborenen und ein junger Priester übrig geblieben. Das Kind hörte die ganze Fahrt über nicht auf zu weinen. Der Priester trug Stiefel, einen Tropenhelm, eine Sutane aus grobem Leinen mit quadratischen Flicken, wie ein Schiffssegel, und redete, während das Kind schrie, und immer so, als stehe er auf der Kanzel. Gegenstand seiner Predigt war die mögliche Rückkehr der Bananengesellschaft. Seitdem diese abgezogen war, sprach man in der Region von nichts anderem, und die Meinung war geteilt zwischen denen, die eine Rückkehr wünschten, und jenen, die sie nicht wünschten. Alle aber glaubten daran. Der Priester war dagegen und drückte es mit einem Urteil aus, das so persönlich war, dass es den Frauen unsinnig erschien:
»Die Gesellschaft hinterlässt überall den Ruin.«
Es war das einzig Originelle, was er sagte, aber er konnte es nicht erklären, und die Frau mit dem Kind verwirrte ihn mit dem Argument, dass Gott nicht mit ihm einverstanden sein könne.
Wie immer hatte die Nostalgie die schlechten Erinnerungen gelöscht und die guten verherrlicht. Niemand bleibt davon verschont. Vom Zugfenster aus sah man die Männer in ihren Haustüren sitzen, und es genügte, ihnen ins Gesicht zu blicken, um zu wissen, auf was sie warteten. Die Waschfrauen an den steinigen Stränden sahen dem Zug mit der gleichen Hoffnung nach. Jeder Fremde, der mit einem Aktenkoffer erschien, war für sie der Mann von der United Fruit Company, der kam, um die Vergangenheit wieder herzustellen. Bei jedem Treffen, jedem Besuch, jedem Brief tauchte früher oder später der unvermeidliche Satz auf: »Man sagt, die Gesellschaft kommt zurück.« Niemand wusste, wer das wann oder weshalb gesagt hatte, aber niemand zog es in Zweifel.
Meine Mutter glaubte, von alldem geheilt zu sein, da sie nach dem Tod ihrer Eltern jede Verbindung zu Aracataca abgebrochen hatte. Doch ihre Träume verrieten sie. Zumindest wenn sie etwas geträumt hatte, das ihr interessant genug erschien, um es beim Frühstück zu erzählen, hatte das immer etwas mit ihren wehmütigen Erinnerungen an die Bananenregion zu tun. Sie überstand die härtesten Zeiten, ohne das Haus zu verkaufen, weil sie hoffte, das Vierfache dafür zu bekommen, wenn die Gesellschaft zurückkehrte. Doch schließlich hatte der unerträgliche Druck der Realität meine Mutter besiegt. Als sie aber den Priester sagen hörte, die Rückkehr der Gesellschaft stehe unmittelbar bevor, machte sie eine trostlose Gebärde und flüsterte mir ins Ohr:
»Jammerschade, dass wir nicht noch ein bisschen warten können, um mehr Geld für das Haus zu bekommen.«
Während der Priester redete, fuhren wir an einem Ort vorbei, in dem sich unter drückender Sonne eine Menschenmenge auf der Plaza versammelt hatte und eine Kapelle muntere Militärmusik spielte. Für mich war immer ein Städtchen wie das andere gewesen. Wenn Papalelo mich in das gerade eröffnete Kino Olympia von Don Antonio Daconte mitnahm, fiel mir auf, dass die Bahnstationen in den Westernfilmen denen unseres Zuges ähnelten. Später, als ich Faulkner zu lesen begann, schienen mir auch die Städtchen seiner Romane genau wie die unseren zu sein. Und das war nicht weiter überraschend, denn auch diese waren in dem heilbringenden Geist der United Fruit Company erbaut worden und hatten den gleichen provisorischen Charakter von Feldlagern. Ich erinnerte mich an all diese Orte mit der Kirche an der Plaza und den kleinen Häuschen wie aus dem Märchenbuch, in den Grundfarben gestrichen. Ich erinnerte mich an die Trupps schwarzer Tagelöhner, die in der Abenddämmerung sangen, an die Schuppen der Fincas, vor die sich die Landarbeiter setzten, um die Frachtzüge vorbeifahren zu sehen, an die Wege zwischen den Anpflanzungen, auf denen nach dem Samstagstrubel morgens enthauptete Macheteros lagen. Ich erinnerte mich an die Privatstädte der Gringos in Aracataca und Sevilla; jenseits der Bahngleise gelegen, waren sie wie riesige elektrifizierte Hühnerställe mit Maschendraht umzäunt, der an den kühlen Sommertagen morgens schwarz von verbrutzelten Schwalben war. Ich erinnere mich an Pfaue und Wachteln auf bedächtigen blauen Wiesen, an die Residenzen mit roten Dächern und vergitterten Fenstern, auf den Terrassen runde Tischchen und Klappstühle, wo man umgeben von Palmen und staubigen Rosenbüschen essen konnte. Manchmal waren durch den Drahtzaun schöne, schmachtende Frauen zu sehen, sie trugen Musselinkleider und große Gazehüte und schnitten mit goldenen Scheren die Blumen in ihren Gärten.
Schon in meiner Kindheit war es nicht leicht gewesen, die Ortschaften voneinander zu unterscheiden. Zwanzig Jahre später war es noch schwieriger, weil vom Portikus der Bahnhöfe die Schilder mit den idyllischen Namen abgefallen waren – Tucurinca, Guamachito, Neerlandia, Guacamayal – zudem alles trostloser wirkte als in der Erinnerung. Der Zug hielt gegen halb zwölf Uhr vormittags fünfzehn endlose Minuten lang in Sevilla, wo man die Lokomotive auswechselte und Wasser tankte. Dort begann die Hitze. Als die Fahrt wieder aufgenommen wurde, bescherte uns die neue Lokomotive bei jeder Kurve einen Schwall von Kohlenstaub, der in die scheibenlosen Fenster drang und uns mit schwarzem Schnee bedeckte. Der Priester und die Frauen waren, ohne dass wir es bemerkt hatten, an irgendeinem Ort ausgestiegen, und das verstärkte meinen Eindruck, dass wir allein in einem Niemandszug reisten. Meine Mutter saß vor mir, blickte aus dem Fenster, war zwei- oder dreimal eingenickt, wurde aber auf einmal munter und stellte mir ein weiteres Mal die gefürchtete Frage:
»Also, was sag ich nun deinem Papa?«
Ich dachte, sie würde auf der Suche nach einer Flanke, an der sie meine Entschlossenheit durchbrechen konnte, nie aufgeben. Kurz zuvor hatte sie Formeln für einen Kompromiss vorgeschlagen, die ich ohne Begründung ablehnte, wohl wissend, dass ihr Rückzug nicht von langer Dauer sein würde. Dennoch überraschte mich dieser neue Vorstoß. Auf eine weitere fruchtlose Schlacht vorbereitet, erwiderte ich ruhiger als die anderen Male:
»Sag ihm, ich will im Leben nur eins, ich will Schriftsteller sein, und ich werde es.«
»Er hat nichts dagegen, dass du das wirst, was du möchtest«, sagte sie, »vorausgesetzt, du schließt irgendein Studium ab.«
Sie sprach, ohne mich anzusehen, tat, als interessiere sie unser Gespräch weniger als das Leben, das am Wagenfenster vorbeizog.
»Ich weiß nicht, warum du derart insistierst, du weißt doch, dass ich nicht nachgeben werde«, sagte ich.
Sofort sah sie mir in die Augen und fragte verwundert:
»Warum glaubst du, dass ich das weiß?«
»Weil du und ich uns gleichen«, sagte ich.
Der Zug hielt an einer Bahnstation ohne Dorf und fuhr kurz darauf an der einzigen Bananenplantage vorbei, an deren Portal ein Name stand: Macondo. Das Wort war mir schon bei meinen ersten Reisen mit dem Großvater aufgefallen, doch erst als Erwachsener entdeckte ich, dass mir sein poetischer Klang gefiel. Ich hatte es nie wieder gehört, mich nicht einmal gefragt, was es bedeutete, es jedoch bereits in drei Büchern als Name für ein imaginäres Dorf verwendet, als ich zufällig in einer Enzyklopädie entdeckte, dass es sich um einen tropischen, der Ceiba ähnlichen Baum handelt, der weder Blüten noch Früchte entwickelt und dessen schwammiges Holz zum Bau von Kanus und zum Schnitzen von Küchengerät verwendet wird. Später entdeckte ich in der Encyclopaedia Britannica, dass es in Tanganjika den Nomadenstamm der Makondos gibt, und dachte, das könnte der Ursprung des Wortes sein. Dem bin ich aber nie nachgegangen, habe auch den Baum nie gesehen, weil mir keiner Auskunft geben konnte, obwohl ich in der Bananenregion oft danach gefragt habe. Vielleicht hat es den Baum nie gegeben.
Der Zug passierte um elf Uhr die Finca Macondo und hielt zehn Minuten später in Aracataca. An dem Tag, als ich mit meiner Mutter zum Hausverkauf fuhr, hatte er anderthalb Stunden Verspätung. Ich war auf der Toilette, als er beschleunigte, und durch das Fenster drang ein glutheißer, trockener Wind, verwirbelt mit dem Getöse der uralten Waggons und dem entsetzten Pfeifen der Lokomotive. Mein Herz schlug an die Rippen, und eisige Übelkeit ließ meine Eingeweide erstarren. Ich stürzte hinaus, getrieben von Panik, als hätte die Erde gebebt, und sah meine Mutter, die unbeirrbar auf ihrem Platz saß. Laut zählte sie die Örtlichkeiten auf, die sie durchs Fenster vorbeiziehen sah, wie flüchtige Fetzen eines Lebens, das gewesen war und nie wieder sein würde.
»Das sind die Grundstücke, die sie deinem Vater mit dem Märchen, dort gebe es Gold, angedreht haben.«
Wie ein Hauch glitt das Haus der Adventistenschule vorbei, ein blühender Garten und am Portal ein Schild: The sun shines for all.
»Das war das Erste, was du auf Englisch gelernt hast«, sagte meine Mutter.
»Nicht das Erste«, sagte ich. »Das Letzte.«
Die Zementbrücke glitt vorbei und der Graben mit seinem trüben Wasser, der aus der Zeit stammte, als die Gringos sich des Flusses bemächtigt hatten, um ihn auf ihre Plantagen zu leiten.
»Das Viertel der Dirnen, wo die Männer noch frühmorgens mit brennenden Geldbündeln statt Kerzen Cumbiamba tanzten«, sagte sie.
Die Bänke an der Promenade, die von der Sonne rostigen Mandelbäume, der Garten der kleinen Montessori-Schule, in der ich lesen lernte. Einen Augenblick lang erglänzte im Fenster die Gesamtansicht des Dorfes, das im strahlenden Licht des Februarsonntags dalag.
»Der Bahnhof!«, rief meine Mutter. »Wie muss sich die Welt verändert haben, dass niemand mehr auf den Zug wartet.«
Dann hörte die Lokomotive auf zu pfeifen, verlangsamte die Fahrt und blieb mit einem langgezogenen Klagelaut stehen. Zuerst fiel mir die Stille auf. Eine körperhafte Stille, die ich mit verbundenen Augen von jeder anderen Stille der Welt hätte unterscheiden können. Die Rückstrahlung der Hitze war so stark, dass man alles wie durch gewelltes Glas sah. Die kleine gepflasterte Plaza hatte nicht einmal eine barmherzige Erinnerung an die dreitausend von der Staatsgewalt niedergemetzelten Arbeiter bewahrt. Denn so weit der Blick reichte, gab es keine Spur von menschlichem Leben und nichts, auf dem nicht wie Tau der glutheiße Staub lag. Meine Mutter blieb noch ein paar Minuten auf ihrem Platz sitzen, schaute auf das tote, zwischen verlassenen Straßen hingestreckte Dorf und rief schließlich voller Grauen:
»Oh mein Gott!«
Das war alles, was sie sagte, bevor sie ausstieg.
Solange der Zug noch dort stand, hatte ich den Eindruck, dass wir nicht völlig allein waren. Als er aber mit einem kurzen und herzzerreißenden Pfeifen anfuhr, blieben meine Mutter und ich schutzlos unter der infernalischen Sonne zurück, und die ganze Schwermut des Ortes lastete auf uns. Aber wir sagten nichts. Der alte Bahnhof aus Holz, mit seinem Zinkdach und dem umlaufenden Balkon, war so etwas wie die tropische Version der Bahnhöfe, die wir aus den Cowboyfilmen kannten. Wir durchquerten den verlassenen Bahnhof, dessen Fliesen bereits unter dem Druck des Unkrauts zu springen begannen, und tauchten, immer den Schutz der Mandelbäume suchend, in die Mattigkeit der Siesta-Zeit ein. Wir beeilten uns, denn die Zeit war knapp, um das Geschäft unter Dach und Fach zu bringen. Früher hätte sie nicht ausgereicht, da der Zug um zwei Uhr mittags zurückkehrte, aber seit ein paar Jahren fuhr er dank der Unordnung der neuen Zeiten erst gegen Abend zurück, allerdings nicht zu einer festen Uhrzeit.
Schon als Kind hatte ich diese trägen Siestas verabscheut, weil wir nicht wussten, was wir solange tun sollten. »Seid still, wir schlafen«, flüsterten die Schläfer, ohne aufzuwachen. Die Kaufläden, die Behörden, die Schule, sie alle schlossen um zwölf Uhr und wurden erst kurz vor drei wieder geöffnet. Die Wohnräume schwebten dann in einem Limbus der Benommenheit. In einigen Häusern war die Luft so unerträglich, dass man die Hängematten in den Patio hängte oder Hocker an die Mandelbäume lehnte, auf denen man dann, mitten auf der Straße, im Schatten schlief. Nur das Hotel am Bahnhof, die dazugehörige Bar und der Billardsalon sowie das Telegrafenamt hinter der Kirche blieben geöffnet. Alles war genau wie in der Erinnerung, nur kleiner und ärmlicher und vom Sturmwind des Schicksals gestreift: die gleichen verfallenen Häuser, die rostdurchlöcherten Zinkdächer, die kleine Promenade mit den bröckelnden Granitbänken und die traurigen Mandelbäume, alles entrückt durch diesen unsichtbaren, glutheißen Staub, der die Augen täuschte und die Haut sengte. Das Privatparadies der Bananengesellschaft jenseits der Bahngleise war, nun ohne Elektrozaun, ein weites, zugewuchertes Areal ohne Palmen, mit zerstörten Häusern zwischen blühendem Mohn und dem Schutt des niedergebrannten Hospitals. Keine Tür, kein Mauerriss, keine menschliche Spur, die nicht einen übernatürlichen Widerhall in mir ausgelöst hätte.
Meine Mutter ging sehr aufrecht mit schnellem Schritt, schwitzte kaum in ihrem Trauerkleid und schwieg, aber ihre tödliche Blässe und ihr scharfes Profil verrieten, was in ihr vorging. Am Ende der Promenade sahen wir das erste menschliche Wesen: Eine kleine, verarmt aussehende Frau tauchte an der Ecke Jacobo Beracaza auf und ging mit einem Zinntöpfchen an uns vorbei, dessen falsch aufgelegter Deckel zu ihren Schritten den Takt schlug. Meine Mutter flüsterte mir, ohne sie anzusehen, zu:
»Das ist Vita.«
Ich hatte sie erkannt. Sie hatte von Kindesbeinen an in der Küche meiner Großeltern gearbeitet, und so sehr wir uns auch verändert haben mochten, sie hätte uns erkannt, wenn sie uns eines Blickes gewürdigt hätte. Aber nein: Sie ging in einer anderen Welt vorbei. Noch heute frage ich mich, ob Vita nicht lange vor jenem Tag gestorben war.
Als wir um die Ecke bogen, brannten meine Füße vom Staub, der durch das Geflecht der Sandalen drang. Ich konnte das Gefühl der Verlassenheit kaum noch ertragen. Mich selbst und meine Mutter sah ich auf einmal so, wie ich als Kind die Mutter und die Schwester des Diebes gesehen hatte, den María Consuegra eine Woche zuvor mit einem Schuss getötet hatte, als er versuchte, die Tür ihres Hauses aufzubrechen.
Um drei Uhr morgens hatte sie ein Geräusch geweckt, jemand versuchte von außen die Eingangstür aufzustemmen. Sie stand auf, ohne Licht zu machen, tastete im Kleiderschrank nach einem archaischen Revolver, den seit dem Krieg der Tausend Tage keiner mehr abgefeuert hatte, ortete im Dunkeln nicht nur die Tür, sondern auch die genaue Höhe des Schlosses. Dann nahm sie den Revolver mit beiden Händen, zielte, schloss die Augen und drückte ab. Sie hatte noch nie geschossen, doch die Kugel traf durch die Tür ihr Ziel.
Es war der erste Tote, den ich sah. Als ich um sieben Uhr morgens auf dem Schulweg vorbeikam, lag der Körper noch in einer getrockneten Blutlache ausgestreckt auf dem Gehsteig, das Gesicht von der Bleikugel zerstört, die seine Nase zerfetzt hatte und aus einem Ohr wieder ausgetreten war. Er trug ein bunt gestreiftes Matrosenhemd und eine einfache Hose, statt Gürtel eine Schnur, und er war barfuß. Neben ihm auf dem Boden fand man den zünftigen Dietrich, mit dem er das Schloss hatte öffnen wollen.
Die Notabeln des Städtchens eilten in María Consuegras Haus, um ihr Beileid auszusprechen, weil sie den Dieb getötet hatte. Ich bin am Abend mit Papalelo hingegangen, und da saß sie in einem Manilasessel, der aussah wie ein riesiger Pfau aus Strohgeflecht, und war umgeben von der Inbrunst ihrer Freunde, die sich die tausendmal wiederholte Geschichte anhörten. Alle waren mit ihr der Meinung, dass sie aus bloßer Angst abgedrückt hatte. Da fragte mein Großvater, ob sie denn nach dem Schuss noch etwas gehört habe, und sie antwortete, dass da zunächst eine große Stille gewesen sei, dann das metallische Geräusch des Dietrichs, der auf den Zementboden fiel, und gleich darauf eine kleine, schmerzvolle Stimme: »Ach, Mutter!« Offensichtlich war María Consuegra diese erschütternde Klage nicht ins Bewusstsein gedrungen, bis mein Großvater ihr die Frage stellte. Erst jetzt begann sie zu weinen.
Das war an einem Montag geschehen. Am Dienstag der folgenden Woche zur Siestazeit spielte ich gerade mit meinem allerersten Freund Luis Carmelo Correa Kreisel, als wir davon überrascht wurden, dass die Schläfer vorzeitig erwacht waren und aus den Fenstern schauten. Da sahen wir auf der leeren Straße eine Frau in strenger Trauerkleidung und ein etwa zwölfjähriges Mädchen mit einem Strauß welker Blumen, der in eine Zeitung gewickelt war. Vor der sengenden Sonne schützten die beiden sich mit einem schwarzen Regenschirm und schienen völlig unberührt von den aufdringlichen Blicken der Leute, die ihnen nachschauten. Die Mutter und die Schwester des toten Diebes waren gekommen, um Blumen für das Grab zu bringen.
Dieses Bild verfolgte mich noch jahrelang, als ein einhelliger Traum, den das ganze Dorf an den Fenstern hatte vorbeiziehen sehen, bis es mir gelang, ihn durch eine Erzählung auszutreiben. Doch das Drama der Frau und des Kindes und deren unbeirrbare Würde waren mir erst an dem Tag wirklich bewusst geworden, an dem ich mit meiner Mutter das Haus verkaufen wollte und überrascht feststellte, dass ich durch dieselbe einsame Straße ging, zur gleichen tödlichen Stunde.
»Man fühlt sich, als wäre man der Dieb«, sagte ich.
Meine Mutter verstand mich nicht. Und als wir an dem Haus von María Consuegra vorbeigingen, schaute sie nicht einmal auf die Tür, an der man noch im Holz sah, wo das Loch ausgebessert worden war, das der Schuss gerissen hatte. Jahre später, als wir gemeinsam dieser Reise gedachten, stellte ich fest, dass meine Mutter sich sehr wohl an die Tragödie erinnerte, aber alles dafür gegeben hätte, sie zu vergessen. Eine Regung, die offensichtlich wurde, als wir an dem Haus vorbeikamen, in dem Don Emilio, besser bekannt als der Belgier, gewohnt hatte, ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, dessen beide Beine in einem Minenfeld der Normandie versehrt worden waren und der sich an einem Pfingstsonntag mittels Goldzyaniddämpfen vor den Martern der Erinnerung in Sicherheit gebracht hatte. Ich war damals höchstens sechs Jahre alt, erinnere mich aber, als sei es gestern gewesen, an den Wirbel, den diese Nachricht um sieben Uhr morgens auslöste. Das Ereignis war so denkwürdig, dass meine Mutter, als wir in den Ort zurückkehrten, um das Haus zu verkaufen, nach fast zwanzig Jahren endlich ihr Schweigen brach.
»Der arme Belgier«, seufzte sie. »Wie du gesagt hast, er hat nie wieder Schach gespielt.«
Wir hatten vorgehabt, direkt zum Haus zu gehen. Als aber nur noch ein Block fehlte, blieb meine Mutter plötzlich stehen und bog eine Ecke vorher ab.
»Wir gehen besser hier lang«, sagte sie. Und als ich wissen wollte warum, antwortete sie: »Weil ich Angst habe.«
So wurde mir auch der Grund für meine Übelkeit klar: Es war Angst, nicht nur die Angst, meinen Gespenstern zu begegnen, sondern Angst vor allem. Also gingen wir eine Parallelstraße entlang, ein Umweg, der sich nur damit erklären ließ, dass wir nicht an unserem Haus vorbeiwollten. »Ich hätte nicht den Mut gehabt, es zu sehen, bevor ich nicht mit jemandem gesprochen hatte«, sollte sie mir später sagen. So war es. Ohne irgendeine Vorwarnung schleifte sie mich in die Apotheke von Doktor Alfredo Barboza, ein Eckhaus, keine hundert Meter von dem unseren entfernt.
Adriana Berdugo, die Frau des Arztes, nähte so gedankenversunken an ihrer einfachen mit einer Handkurbel betriebenen Domestic-Maschine, dass sie nicht hörte, wie meine Mutter auf sie zuging und dann, flüsternd fast, sagte:
»Gevatterin.«
Adriana hob die Augen, die von dicken Gläsern für die Alterssichtigkeit entstellt waren, nahm die Brille ab, zögerte einen Augenblick und sprang dann auf, mit offenen Armen und einem Klagelaut:
»Ach, Gevatterin!«
Meine Mutter war schon hinter der Theke und ohne noch etwas zu sagen, umarmten sich beide, um gemeinsam zu weinen. Ich sah sie von der anderen Seite der Theke aus, wusste nicht, was tun, erschüttert von der Gewissheit, dass diese lange Umarmung stiller Tränen etwas Endgültiges war, das mein Leben für immer prägen würde.
Die Apotheke war zu Zeiten der Bananengesellschaft die erste am Platz gewesen, aber nun standen in den schmalen Schränken nur noch ein paar golden beschriftete Keramiktiegel. Die Nähmaschine, der Mörser, der Äskulapstab, die noch tüchtige Pendeluhr, der Druck mit dem Eid des Hippokrates, die altersschwachen Schaukelstühle, es waren noch all die Dinge, die ich als Kind gesehen hatte, und sie standen an ihrem alten Platz, der Rost der Zeit hatte sie jedoch verwandelt.
Adriana selbst war ein Opfer. Obwohl sie wie früher ein Kleid mit großen tropischen Blumen trug, war ihr nichts von der Lebhaftigkeit und dem Schalk anzumerken, für die sie bis weit in ihre reifen Jahre berühmt gewesen war. Unverändert war nur der Baldriangeruch, der sie umgab, er machte die Katzen verrückt und blieb für mich lebenslang mit einem Gefühl von Schiffbruch verbunden.
Als Adriana und meine Mutter keine Tränen mehr hatten, war ein zähes, kurzes Husten hinter der Holzwand zu hören, die uns von dem Hinterzimmer trennte. Adriana gewann etwas von ihrem Charme aus früheren Zeiten zurück und rief, um hinter der Trennwand gehört zu werden:
»Rat mal, wer da ist, Doktor.«
Die narbige Stimme eines harten Mannes fragte von der anderen Seite her gleichgültig:
»Wer?«
Adriana antwortete nicht, sondern gab uns ein Zeichen, ins Hinterzimmer zu gehen. Ein Grauen aus der Kindheit lähmte mich augenblicklich, mein Mund füllte sich mit galligem Speichel, doch ich trat mit meiner Mutter in den vollgestopften Raum, der, früher das Labor der Apotheke, jetzt zu einem Notschlafzimmer hergerichtet war. Dort lag Doktor Alfredo Barboza, älter als alle alten Menschen und alten Tiere zu Lande oder zu Wasser in seiner ewigen geknüpften Hängematte, ohne Schuhe und mit seinem legendären Schlafanzug aus grober Baumwolle, der eher an den Kittel eines Büßers erinnerte. Er blickte starr zur Decke, als er uns aber eintreten hörte, drehte er den Kopf und heftete seine durchsichtigen gelben Augen auf uns, bis er schließlich meine Mutter erkannt hatte.
»Luisa Santiaga!«, rief er. Mit der Erschöpftheit eines alten Möbelstücks setzte er sich in der Hängematte auf, wurde wieder ganz Mensch und begrüßte uns mit einem kurzen, heißen Händedruck. Er nahm mein Erschrecken wahr und sagte:
»Seit einem Jahr habe ich chronisch Fieber.« Dann verließ er die Hängematte, setzte sich aufs Bett und sagte in einem Atemzug:
»Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir hier durchgemacht haben.«
Dieser einzelne Satz, der ein ganzes Leben zusammenfasste, genügte, damit ich ihn als das sah, was er vielleicht immer gewesen war: ein einsamer, trauriger Mann. Er war groß, hager, hatte eine wunderbare metallische Mähne, die achtlos geschnitten war, und gelbe, intensiv blickende Augen, die der größte Schrecken meiner Kindheit gewesen waren. Nachmittags, wenn wir aus der Schule kamen, kletterten wir, vom Kitzel der Angst getrieben, zum Fenster seines Schlafzimmers hinauf. Dort lag er in der Hängematte und schaukelte sich mit kräftigen Stößen, um die Hitze zu lindern. Das Spiel bestand darin, ihn anzustarren, bis er es merkte, sich plötzlich umwandte und uns mit seinen glühenden Augen anblickte.
Mit fünf oder sechs Jahren hatte ich ihn zum ersten Mal gesehen, als ich mich eines Morgens mit anderen Schulkameraden in seinen Garten geschlichen hatte, um die riesigen Mangos von seinen Bäumen zu klauen. Plötzlich öffnete sich die Tür des Aborts, der aus Brettern gebaut in einer Ecke des Hofs stand, und heraus kam der Doktor, die Leinenunterhosen festzurrend. Ich sah ihn wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt, bleich und knochig in einem weißen Krankenhausnachthemd, sah diese gelben Augen eines Höllenhundes, die mich für immer anblickten. Die anderen machten sich durch die Hinterpforte davon, aber ich war wie versteinert von seinem starren Blick. Er sah auf die Mangos, die ich gerade vom Baum gepflückt hatte, und streckte die Hand aus.
»Gib sie her!«, befahl er, sah mich von oben bis unten mit großer Verachtung an und fügte hinzu: »Böser kleiner Patio-Dieb.«
Ich warf ihm die Mangos vor die Füße und flüchtete in Panik.
Er war mein persönliches Gespenst. Wenn ich allein unterwegs war, machte ich einen großen Bogen um sein Haus. Wenn ich mit Erwachsenen zusammen war, wagte ich kaum einen flüchtigen Blick auf die Apotheke. Ich sah Adriana, die lebenslänglich an die Nähmaschine hinter der Theke gefesselt war, und ich sah ihn durch das Schlafzimmerfenster, wie er sich heftig in der Hängematte schaukelte, und bekam schon beim bloßen Anblick eine Gänsehaut.
Er war zu Anfang des Jahrhunderts in den Ort gekommen, einer der zahllosen Venezolaner, denen es gelang, vor dem grausamen Regime von Juan Vicente Gómez über die Grenze nach La Guajira zu fliehen. Der Doktor war einer der Ersten gewesen, die von zwei unterschiedlichen Kräften getrieben wurden: von der Grausamkeit des Regimes in seinem Land und der Hoffnung auf den Bananen-Wohlstand in unserem. Seit seiner Ankunft empfahl er sich durch seinen klinischen Blick – wie man damals sagte – und sein höfliches Wesen. Er war einer der Freunde, die besonders häufig zu Gast bei meinen Großeltern waren, wo immer der Tisch gedeckt war, auch wenn man nicht wusste, wer mit dem Zug kam. Meine Mutter war die Patin seines ältesten Sohnes, und mein Großvater lehrte diesen, flügge zu werden. Ich bin unter ihnen aufgewachsen, so wie ich später unter den Exilierten des spanischen Bürgerkriegs erwachsen wurde.
Die letzten Spuren der Angst, die mir jener vergessene Paria als Kind einjagte, verflüchtigten sich, während meine Mutter und ich, neben seinem Bett sitzend, die Einzelheiten der Tragödie hörten, von der die Ortschaft heimgesucht worden war. Er hatte eine solche Gabe, die Dinge zu vergegenwärtigen, dass alles, was er erzählte, in dem von der Hitze durchdrungenen Raum sichtbar zu werden schien. Der Ursprung allen Unglücks war natürlich das Massaker an den Arbeitern durch die Staatsgewalt gewesen, wenngleich Zweifel über die historische Wahrheit blieben: drei Tote oder dreitausend? Vielleicht seien es nicht so viele gewesen, sagte der Doktor, aber jeder habe die Zahl dem eigenen Schmerz gemäß hochgesetzt. Jetzt sei die Gesellschaft für immer und ewig fortgezogen.
»Die Gringos kommen nie zurück«, schloss er.
Sicher war nur, dass sie alles mitgenommen hatten: das Geld, die Dezemberwinde, das Brotmesser, den Drei-Uhr-nachmittags-Donner, den Duft des Jasmins, die Liebe. Geblieben waren allein die staubigen Mandelbäume, die flirrende Hitze in den Straßen, die Holzhäuser mit ihren verrosteten Zinkdächern und wortkargen Bewohnern, verwüstet von Erinnerungen.
Das erste Mal an jenem Nachmittag wurde der Doktor auf mich aufmerksam, als er mein Staunen über das Knistern bemerkte, das sich wie ein Regen aus einzelnen, über das ganze Zinkdach verteilten Tropfen anhörte. »Das sind die Hühnergeier«, sagte er zu mir, »die laufen den ganzen Tag über die Dächer.« Dann zeigte er mit einem matten Zeigefrager auf die geschlossene Tür:
»Schlimmer ist es nachts, dann hört man die Toten, die auf den Straßen frei herumlaufen.«
Er lud uns zum Mittagessen ein, wogegen nichts sprach, da der Hausverkauf nur noch eine Formalität war. Die Mieter waren die Käufer, und die Einzelheiten waren telegrafisch abgesprochen worden. Würden wir genug Zeit haben?
»Reichlich«, sagte Adriana. »Man weiß heute ja nicht einmal, wann der Zug zurückkommt.«
Also teilten wir mit ihnen ein kreolisches Gericht, dessen Einfachheit nichts mit Armut zu tun hatte, sondern eine Diät der Mäßigung war, die der Arzt nicht nur bei Tisch befolgte und predigte, sondern für alle Lebensbereiche empfahl. Als ich die Suppe kostete, schien eine schlafende Welt in meinem Gedächtnis zu erwachen. Geschmäcker der Kindheit, verloren, seitdem ich das Dorf verlassen hatte, stellten sich unbeschädigt mit jedem Löffel wieder ein und machten mir das Herz schwer.
Seit Beginn des Gesprächs fühlte ich mich dem Arzt gegenüber genauso alt wie damals, als ich ihn durch das Fenster geärgert hatte, daher war ich eingeschüchtert, als er sich an mich mit eben der Ernsthaftigkeit und Zuneigung wandte, mit denen er zu meiner Mutter sprach. In meiner Kindheit hatte ich die Angewohnheit, in schwierigen Situationen meine Verwirrung durch schnelles und anhaltendes Zwinkern zu überspielen. Dieser unbeherrschbare Reflex meldete sich plötzlich wieder, als der Doktor mich ansah. Die Hitze war unerträglich geworden. Ich hielt mich eine Weile aus dem Gespräch heraus und fragte mich, wie dieser freundliche, wehmütige Greis einmal der Schrecken meiner Kindheit gewesen sein konnte. Plötzlich, nach einer langen Pause und aufgrund irgendeines banalen Hinweises, sah er mich mit einem großväterlichen Lächeln an.
»Du bist also der große Gabito«, sagte er. »Was studierst du?«
Ich überspielte meine Verwirrung mit einer spektralen Übersicht über meine Studien: gutes Abitur an einem Staatsinternat, zwei Jahre und ein paar Monate chaotischer Juristerei, empirischer Journalismus. Meine Mutter hörte mir zu und suchte sogleich die Unterstützung des Arztes.
»Stellen Sie sich vor, Gevatter, er will Schriftsteller werden.«
Die Augen des Doktors begannen zu glänzen.