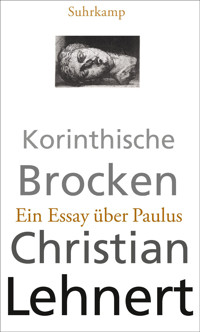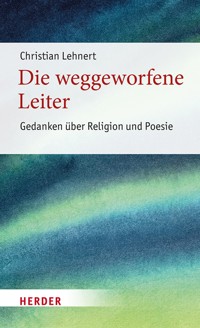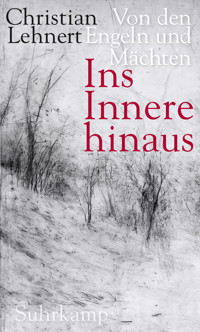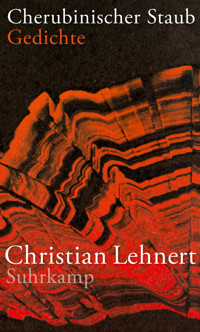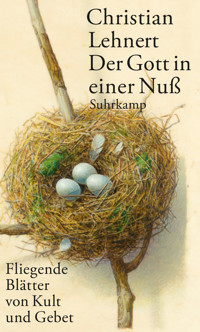
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Für seine Annäherung an kultische Handlungen wählt Christian Lehnert, selbst Theologe, einen besonderen Weg: den des Dichters. In der für ihn typischen Gattungsmischung von Reflexion, Schau und Erzählung, bei der die verschiedensten sprachlichen Register von kristallklarer bis hin zu expressiver Prosa gezogen werden, nähert sich Lehnert den festgefügten Formen des kultischen Vollzugs: Kyrie, Gloria, Glaubensbekenntnis, Abendmahl … Kritisch und polemisch fordert Lehnert dabei den Konservativismus und seine erstarrte Religionspraxis ebenso heraus wie die charismatischen, liberalen oder esoterischen »Bewegungen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Sinn und Aufbau der kultischen Handlungen und Texte, die als Gottesdienst oder Messe im Zentrum religiöser Praxis des Christentums stehen, ist viel geschrieben und spekuliert worden – meistens in theoretisch-theologischer Absicht. Christian Lehnert, selbst Theologe, wählt für seine Annäherung an dieses kultische Zentralgeschehen einen besonderen, seinen eigenen Weg: den des Dichters. In der für ihn typischen Gattungsmischung von Reflexion, Schau und Erzählung, bei der die verschiedensten sprachlichen Register von kristallklarer bis hin zu expressiver Prosa gezogen werden, nähert sich Lehnert den festgefügten Formen des kultischen Vollzugs, deren Bedeutung vielen längst verlorengegangen ist: Kyrie, Gloria, Glaubensbekenntnis, Abendmahl … Auf diesem Weg führen seine Beobachtungen und Meditationen in eine energetische Erfahrung der »Leere«, die sich auf mystisches Gotteserlebnis zurückbesinnt und landläufige Verständnisroutinen durchbricht. Kritisch bis durchaus polemisch fordert Lehnert dabei den Konservatismus und seine erstarrte Religionspraxis ebenso heraus wie die charismatischen, liberalen oder esoterischen »Bewegungen«, die glauben, das Christentum auf dessen »Totenfeld« beerben zu können.
Christian Lehnert, geboren 1969 in Dresden, ist Dichter und Theologe. Zur Zeit leitet er das Liturgiewissenschaftliche Institut an der Universität Leipzig. Seine bislang sieben Gedichtbücher und ein Essay über Paulus erschienen im Suhrkamp Verlag. 2012 erhielt Lehnert den Hölty-Preis für sein lyrisches Gesamtwerk, 2016 den Eichendorff-Literatur-Preis. Zuletzt im Suhrkamp Verlag erschienen:
Korinthische Brocken. Ein Essay über Paulus, 2013
Windzüge. Gedichte, 2015
Christian Lehnert
Der Gott in einer Nuß
Fliegende Blätter vonKult und Gebet
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017.
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2017.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagabbildungen: Michael Triegel, Nest (Umschlagvorderseite); Nüsse (Umschlagrückseite), © VG Bild-Kunst, Bonn 2016
eISBN 978-3-518-75093-3
www.suhrkamp.de
Der Gott in einer Nuß
Fliegende Blätter von Kult und Gebet
»Willst du wider ein fliegend Blatt so ernstlich sein,und einen dürren Halm verfolgen?« (Hiob 13,25)
I
Im Namen des Vaters und des Sohnesund des Heiligen Geistes.
Einzelnes Blatt
Das Labyrinth. – Ich kroch durch einen schulterbreiten Gang, der mich zu immer neuen Drehungen zwang. Ich war gehetzt. Wovon? Ich mußte eingestehen, daß ich vergessen hatte, was ich suchte. Ich hatte es nie genau gewußt und nicht beständig. Das änderte nichts daran, daß ich getrieben war. Ich hatte wohl etwas gehört. Ich hatte eine Art reflektorische Bestimmung wahrgenommen – wie eine Mistel wachsen muß, wie ein Myzel sich fortpflanzt. So war ich hierhergekommen. Als wäre eine laute Stimme durchs Gestein gezogen und von irgendeiner fernen Stelle zurückgehallt: Das war ich, im Echo. Kroch, im Echo.
Triefnaß die Flechten, das Moos, ich hatte die Arme vorgestreckt, krallte die Finger in glitschige Gewebe, in Wurzeln, Getier und kristalline Gebilde, die ich mir nicht vorstellen konnte, nur wie stets vollkommen neu ertastete. Nichts war wiederzuerkennen, nichts wurde vertraut. Jeder Griff – ein neuer Eindruck, weiche Kuppen wie Felsfinger oder Scharten, schleimige Nässe, scharfe Grate, Löcher, Krater … aber keine Erfahrung, keine Wirklichkeit. Ich kroch. Ich wurde ins Ungewisse geschraubt. Die einzige Kontinuität, die sich meinem nervösen Hirn darstellte, war der Gang.
Ich dachte an meine kleine Tochter, deren Blick Tiere herankommen ließ, sichtbar gegen den Instinkt, aber sie folgten ihr. Vor Todesangst zitternde Eichhörnchen, die sie streichelte, und die scheuen Wesen sprangen nicht weg. Sie verharrten in einem Kraftfeld, das niemand erklären konnte, wie hypnotisiert, und bald schienen die Tiere doch das Unausweichliche zu mögen. Sie warteten auf das Kind.
Ich kroch, und mir erschien es immer deutlicher so, als sei mein Körper erfaßt von einer Strömung – nicht bestimmbar an einen Stoff gebunden, kein Luftzug also, kein Gefälle, eher war es, als formierte sich ein neuer Raum, ein verändertes Allzeit-und-Überall. Ich kroch dumpf vor mich hin, oder sagen wir so: Amorphes Dasein krallte sich in Fels oder Fleisch, und es war doch (und bald immer von neuem und beglückend, wie ein grundloses Lachen): Ich.
Zweites Blatt
Das Wort »Gott«. – Das Wort »Gott« erscheint auf dem Bildschirm, als sei es nichts weiter als eine Kombination von Zeichen, eine Silbe, Abbild einer Lautgestalt, die hart und kurz klingt – vor allem in Ohren, die nicht auf die deutsche Sprache gestimmt sind. Die Buchstaben »G«, »o« und zweimal »t« stehen zusammen mit anderen in einer Reihe auf der hellen Fläche: Wartende vor den Augen des Lesers, und sie verlangen Eintritt … Wer sind sie? Was bringen sie mit?
Eine Zeile wächst sich aus, deren Länge das Computerprogramm bestimmt. Doch steht dieses Wort »Gott« nicht einfach in einer Ansammlung Gleicher, nicht wie ein Bürger vor der Wahlurne. In meinen Augen und in meinem Gehör hat das Wort einen besonderen Innenraum. Es steht wie ein Tempel im »Fruchtbaren Halbmond« – jener von Wüsten und vom Mittelmeer begrenzten Landbrücke zwischen dem Zweistromland und Ägypten – auf einem Hügel: Bauwerk, das zunächst keinen anderen Zweck hat als die Darstellung seiner selbst, und es bildet mit seinen sorgfältig behauenen Steinen, den gebrannten Ziegeln und groben Zinnen oder Säulen doch erst den Bezugspunkt, von dem her die Landschaft sichtbar wird.1 Das Gebäude ist ihr Zellkern, ihr Seelenfunken – in seinem Umkreis wurde aus Gestein und Sand und Salzen ein benennbarer, faßlicher Raum. Frühe Menschen schufen sich eine Gegend, indem sie einen Tempel bauten – und eine Gottheit legte von dort her ihren Machtbereich über die natürlichen Dinge. Wir mögen heute sagen: Wirklichkeit wurde geformt, Erfahrung ermöglicht. Denn hier gab es nun eine gewisse Mitte, um die weiten Dünen, die gewundenen Wadis und die Geröllflächen als Lebensraum zu verstehen und zu nutzen. Wege wurden denkbar dort, wo Rauch von Opfertieren in den Himmel stieg, wo Mauern ein Heiliges schützten.
Tell Arad, nah am Toten Meer; die Wüste verdichtet sich im Bannkreis des Jahwe-Tempels zu einem Namen: Negev … kriechender und wehender Staub, während die Ruinen ruhen. Ich setze mich in den Schutt und lehne den Rücken an die Reste einer Kasemattenmauer aus der Eisenzeit. Hinter Schotterhügeln, an flachen, pilzförmig ausgeblasenen Kegeln von Mergel, an roten Gesteinsbrocken auf der Ebene und vereinzelten Dornenbüschen bilden sich im Windschatten kleine Sanddünen. Dort, so weiß ich, hausen Insekten und Reptilien.
Ich erinnere mich, und das bedeutet: Das Bild vor meinen Augen hat keine absolute Chronologie. Es wandert mit der Gegenwart mit, war mit mir in Kaufhäusern und in Kirchen, in kalten nordischen Wintern und lag unter Federbetten, geträumt.
Die alte Stadt Arad hat eine bedeutsame Geschichte in der Zeit der ersten judäischen Könige. Deren Ahnen hatten den Gott mitgebracht aus dem Süden, wohl vom Sinai – einen bildlosen, unsteten Gott, der lange nur ein Zelt als Wohnstatt in menschlicher Umgebung akzeptierte. Die Landschaft wurde in seiner Aura zur durchwanderten Wüste, zu einem verborgenen Wegesystem, und das menschliche Dasein zum Nomadentum.
Tell Arad, ein kegelförmiger Asche- und Schutthügel, ist in Zerstörungen und Wiederaufbau und wieder Zerstörungen gewachsen um einen Tempel dieses flüchtigen Gottes. Die Kasemattenmauer ist noch bis heute erkennbar sorgsam gebaut und verfugt. Die über andere Steine geschichteten, die aufgerichteten Steine scheinen zu fragen: Was gibt es um mich herum? Warum gibt es etwas? Und die Antwort dämmert im Stadtinnern, in der Tempelruine, über verdichteten Lehmböden und den Fundamenten des Allerheiligsten: Stille … Rätsel eines unbekannten Kultes, von dem nur noch der Grundriß der Tempelanlage zeugt und die gesichts- und erinnerungslosen Gestalten zweier Mazeben, jener im semitischen Raum so häufigen Verkörperungen von Gottheiten als rohe, kaum bearbeitete Steinsäulen.
Dazu in der Überlieferung ein Name, vier Buchstaben: JHWH. Wer ist dieser Gott, benannt vermutlich nach einer nicht sicher zu lokalisierenden Wüstenlandschaft irgendwo im Süden oder Südosten von Judäa und behaftet mit einer vulkanischen Biographie?
Niemand. Keiner, dem ein Name oder eine Biographie oder eine geschichtliche Herkunft zugedacht werden könnten … Er – oder gar es – entzieht sich jeder Habhaftwerdung in der Sprache. Als er sich Mose in einem brennenden Dornbusch in der Wüste zeigte und dieser ihn nach seinem Namen fragte, antwortete der »Gott«: »Ich werde sein, der ich sein werde.« (Exodus 3,14) Was ist das? Namenlosigkeit. Niemand heißt so. Der Name bleibt den Israeliten eine Leerstelle: vorhanden, aber nur durch Schweigen zu füllen. Man sagte später und las, wo immer die Bibel das Tetragramm, die vier Zeichen JHWH schrieb, in aller Unbestimmtheit: mein Herr, Adonai.
In diese Offenheit dringt ein Jahrtausend später, sondierend, der Evangelist Johannes und schreibt die ersten Worte seiner Jesus-Verkündigung: »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.« (Johannes 1,1) Dieser Satz hat es in sich, die einfache grammatische Oberfläche schillert in allen denkbaren Farben.
Eine schnelle Kreisbewegung: Das Wort »Gott« gibt, so heißt es, den Sinn des Wortes »Wort« wieder, durch welches sagbar wird, daß dieses Wort »Gott« etwas bedeutet und was Sagbarkeit überhaupt sei. Gesagt wird, in einer tautologischen Tiefenbohrung des Sagens: »Im Anfang war das Wort … und Gott war das Wort.« Was geht hier wem voraus? Vorgeordnet dem »Wort« scheint das Wort »Gott«, der alles Benennbare und alle Namen aus sich entläßt. Aber er ist doch selbst ein Name und »Wort«, und nur so steht er »im Anfang« und am Anfang eines Satzes …2
Diese ersten Verse des Johannesevangeliums drehen sich um sich selbst und führen in immer neue Widersprüche. Denn zugrunde liegt ein Ereignis, das sich nicht in kausale oder finale oder logische oder zeitliche Zusammenhänge fügt, das Ereignis »Gott«: »Ich werde sein, der ich sein werde.« Weder läßt es sich benennen, noch läßt sich etwas daraus schlußfolgern, aber es ist nicht einfach irrelevant, denn es eröffnet überhaupt erst den Grund, um von Ursache und Wirkung, von Anfang und Ende, von Name und Sagen zu sprechen. Es folgt nicht aus einer wie auch immer verstandenen Struktur, fußt auf keinen Voraussetzungen – es errichtet selbst vielmehr das Maßwerk des Verstehens. (Und noch dort, wo das Wort »Gott« ganz in Vergessenheit geraten ist, hallt es unscheinbar und doch bestimmend nach: als Glaube an eine wie auch immer geartete Verständlichkeit der Welt etwa, an einen Anfang oder an eine ewige Materie, an eine Wirklichkeit, die uns umfängt und sich uns zeigt und sagbar wird, an einen verläßlichen und haltbaren Sinn in den Worten oder sei es auch nur an einen beständigen alltäglichen Fortgang dessen, was »ist« …)
Wenn am Anfang der christlichen Liturgie oder auch des muslimischen Gebetes die Anrufung eines Namens steht, eine Benennung, dann im Sinne einer Frage nach dem Ursprung und nach der Berechtigung jedes sprachlichen Ausdrucks des Ereignisses »Gott«.
»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Was nach dieser ersten Benennung im Kult auch immer folgt, führt in einen unabschließbaren Zirkel: daß einerseits Gott sich sagen ließe von uns Menschen und daß aber dieses Sagen zugleich erst die Vorstellung »Gott« aus dem Wort hervorbringt. Jeder »Gottes«-dienst und jedes Gebet sind doppeldeutig: Sie schaffen »Gott« in der Sprache, und sie sind Geschöpfe Gottes, der ihre Sprachkraft erst begründet. Im Gebet geschieht eine Explosion subjektiver Vorstellungsinhalte und zugleich eine Implosion von unsagbarer, göttlicher Fremde in einer Bewegung. Die Liturgie ist eine Gottesgebärerin und zugleich eine Gottesgeburt, und das eine gibt es nicht ohne das andere: Im Abgrund der fragwürdigsten Subjektivität ruht das Geheimnis der Offenbarung.
Die Klammer (mit unbekanntem Vorzeichen) um alles kultische Tun ist diese merkwürdige Selbsterklärung Gottes, mit der er sich jeder Verfügung entzieht: »Ich werde sein, der ich sein werde.« Als Name untauglich, weil unabgegrenzt und je unvorhersehbar im Ereignis, spricht sich Gott darin doch aus, stellt sich vor – als Negation aller Vorstellung, und doch vor alles andere gestellt … Und ob der »Gottes«-dienst ihn hereinholt? Ob es IHN darin geben wird?
Drittes Blatt
Am Tor. – Ich ging zum Hof jenes Bauern, dessen Frau am Vorabend blutig geschlagen an der Rampe zum Getränkekontor hockte. Ich hatte ihr notdürftig eine Platzwunde versorgt. Nun wollte er mit mir sprechen – eine Ankündigung, gelallt im Dunkeln über die Mauer des Pfarrhofs.
So klopfe ich jetzt ans Tor und lausche, ob jemand kommt. Irgendwo öffnet sich eine Tür, fern im Inneren des Hofes. Schlurfen von Gummistiefeln, das ich zunächst für ein Windgeräusch halte, wird klarer erkennbar, lauter, dann plötzlich, ganz nah schon … Stille. Auch der Hund im Haus verstummt. Kein Geräusch.
Das Sandsteinportal, unter dessen winzigem Vordach ich warte, hat zwei grüne Holzflügel, die neu gezimmert und gebeizt sind.
Nach einer Weile klopfe ich nochmals ans Tor. Niemand kommt näher. Es geht wohl nicht näher: Zwei stehen diesseits und jenseits der grünen Bretter, legen ihre Hände ans Holz. Ich spüre keine Scharten, keine Unebenheiten. Die Oberfläche ist hart und sehr glatt geschliffen: Ist es Buchenholz? Ungewöhnlich wäre das: Buchenholz für ein Tor? Ist es nicht zu teuer und zu schwer?
Ich klopfe erneut, keine Antwort.
Ich überlege, wie es richtig zu sagen wäre: Ob das Tor hinein- oder ob es hinausführt? Denn drinnen ist ein großflächiger Hof, in den Ecken und vor der Scheune bestimmt voller Gerümpel. Ferner beginnt eine Wiese und eine Weite, die ich aus meinen Zimmern und Stuben, aus Büros und Fluren nicht kenne. Bäuerliche Weite. Ein Streifen Land bis zum Wald am Horizont. Draußen ist …
Unruhe, ich klopfe.
Ich warte nun schon zu lange, wende mich zum Gehen, zögere und warte dann doch noch ein wenig …
Ich hatte die Hand schon auf die Klinke gelegt und sie niedergedrückt. Das Tor war offen, das spürte ich. Dann ließ ich die Klinke doch los. Sie schnappte nach oben, erleichtertes Metall.
Mein Schatten fiel auf die Straße. Ich ging ihm zielstrebig nach.
Ich hatte meine Lektion gelernt. Es brauchte nichts weiter, als hier einige Minuten vergeblich zu warten. Die anderen waren alle Zeugen an den Fenstern: Sie konnten bestätigen, wie ich unversehrt davonging. Sie sahen das ganz unbestechlich: Ich war der Pfarrer, der nun – schneller als manche Vorgänger – verstanden hatte. Ich würde tun, was Pfarrer im Dorf schon immer getan haben. Es gab für mich Funktionen, keine Seelen …
Viertes Blatt
Stillgebet. – Das langsame Kreisen der Kugellampen aus geriffeltem Glas läßt helle Flecken an der Kirchendecke tanzen, wirr und doch geordnet. Die Heizung unter den Bänken knackt laut, während die Orgel einsetzt zum Präludium. Widrige Umstände – wie soll ich hier etwas empfinden können von »Gott«? Und dennoch verändere ich mich, eingeklemmt in die Kirchenbank, im Gebet …
»Was bist du mir? Erbarme dich, daß ich reden kann!«3
Subjektivität des Suchens, »Gott«, vermutet in mir selbst, die spiegelbildliche Wiederkehr des Sehnens im Ersehnten. Ich dränge auf Einlaß ins Offene … Und ich muß dabei zwangsläufig zurücklassen, was ich suche. Wenn ich betend anklopfe, habe ich einen bestimmten Willen nach »etwas«, ein Begehr. Wenn mir geöffnet wird, sei’s ein vager Spalt, ist dies bereits unverständlich geworden. Ich weiß nicht mehr, was ich eben suchte. Weit entfernt liegen dann die Fragen, wie ich fassen könne, was ich da ersehnte, wie der Gott in mir geschehen solle oder wie er, undenkbar, außerhalb sei, wie überhaupt »da« … Indem ich nichts mehr erwarte, beginnt sich etwas zu regen. Ich habe eine Dynamik in Gang gesetzt (genauer wohl: zugelassen), die ich nicht mehr beherrschen kann.
»Gott«, das bedeutet jetzt: Es lauscht und wartet.
»Nichts also wäre ich, mein Gott, ja gar nicht wäre ich, wenn Du nicht wärst in mir.«4
Am Anfang jeder Kulthandlung fragt uns, unhörbar, der »Gott«, wie er heißen soll. Wer nun vorn steht, im Priestergewand oder im Talar, derjenige, der vor allen anderen ungeschützt im Bannkreis der fragenden Gottheit steht, spricht es aus, daß ER genannt sein solle mit dem Namen: »des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes«. Und »Gott« antwortet stumm: »Ich werde sein, der ich sein werde.« (Exodus 3,14)
Fünftes Blatt
Unentschiedenheit. – Wann immer ich einen Gottesdienst besuche, empfinde ich nach wenigen Minuten eine sonderbare innere Gespaltenheit: Enttäuschung mischt sich mit einer Beseelung, die einem Heimweh gleicht. Ich singe die alten Lieder, die mich teils tief berühren, teils museal befremden, ich bete mit den vorgesprochenen Worten, die mich fortnehmen in ihren Fluß oder mich kopfschüttelnd allein lassen mit ihren stilistischen Mißgriffen, hohlem Pathos oder der geistigen Unbedarftheit des Pfarrers. Die Atmosphäre eines Gottesdienstes hängt zumindest im evangelischen Raum in einer unguten Weise an der Ausstrahlungskraft des Zelebranten, und meist führt das nicht hinein in ein Mysterium, sondern auf eine Oberfläche, an der ich gezwungen bin, distanziert Fehler und verquere Gedankengänge zu bewerten und mich dagegen abzugrenzen – eine erbärmliche Gemütslage in einer Kirche. Ich sehe dann tausend Dinge, die man anders (und ich sage bei mir heimlich: besser) machen könnte. Oft fängt es schon mit der Raumgestaltung an, mit geschmacklosen Lampen, billigen Glaskugeln ähnlich gekrümmten Toilettenfenstern, mit wahllos vollgestellten Altarräumen, mit abgelegten Mappen und Ringbüchern neben den Abendmahlsgeräten, mit nachlässigen Bewegungen der Geistlichen, deren schlechtem Schuhwerk. Die Gebete höre ich vollgepackt mit abgegriffenen Metaphern und jener unsäglichen Leier von »Laß uns …«, »Gib uns …«, »Guter Gott …«, die kaum noch erträglich ist, wie klebriger Zuckerguß über fauligem Konfekt, zähes Rinnsal einer völlig kontaminierten religiösen Sprache. Alles strömt träg dahin wie die Elbe meiner Kindheit: aufgewirbelter Schlamm, Müll, Schaumkronen, Modergeruch, nur der Erinnerung nach noch ein natürliches Gewässer. Die Gemeinde verharrt dabei zahm in gnadenloser Einfalt, in blinder Vereinswärme, die über alles hinwegsehen läßt … Kirche als ein kollektives Überredungsritual, ein kuschelig-gemeinsames Augenschließen, das noch gegen die Wahrnehmungen von innen immunisiert.
Aber das ist nur die eine Seite: Gleichzeitig (und sie ist eben besonders merkwürdig, diese Gleichzeitigkeit) bin ich hineingenommen in einen Raum, der mich selbst weit überragt. Ich habe das Gefühl, zu flirren in einem grellen Licht oder zu brummen in einer tiefen Resonanz, deren Grund mir nicht erkennbar ist, oder zu vibrieren in einem schweren Rhythmus oder zu tagträumen, leichthin zu schweben … Unabhängig von allem, was ich wahrnehme, besser: durch alles hindurch, was ich wahrnehme, ist eine andere Aktivität am Werk. Ein Agens, das ich nicht identifizieren kann, erfaßt mich. Ich bin nur sein Stoff, sein Schwingungskörper. Es arbeitet an etwas anderem, womöglich auch in mir. Was ich denke und fühle, ist nicht relevant für das, was da geschieht. Und so kann ich kopfschüttelnd konstatieren, wie der Pfarrer lässig am Altar lehnt und sich wie ein Fernsehmoderator anbiedernd in Pose wirft, und zugleich entsteht in meinem Schädel ein Gesang, eine Rührung, die zur Sehnsucht wird. Ist es die Orgel, die das auslöst? Ist es der erinnerungsgesättigte Raum? Sind es der Hochaltar mit seinen Tafelbildern und die Gegenwart des Sakraments? Nichts, was ich weiß, löst die Veränderung in mir aus. Ich kann sie nicht begründen. Ich kann auch nicht sagen, wohin sie mich führt. Ich lege die mir überkommene religiöse Sprache darum wie einen dicken Wintermantel: »Komm Du in mir wohnen …«
Am liebsten verschweige ich übrigens meine kritischen Beobachtungen, denn zwangsläufig folgt die entlarvende Frage: Wie besser? Und diese Frage führt zu nichts. Technische Vervollkommnung – was könnte sie bringen? Wenn ich beschreiben soll, was eigentlich ein gelungener Gottesdienst für mich ist, komme ich ja schon ins Stottern. Die Melange der Eindrücke, Enttäuschung und Ergriffenheit in eins, führt in eine gegenseitige Abstoßungsreaktion sprachlicher Felder, unüberwindlich wie die Pole eines Magneten, und ich ringe um Worte: Will ich einstimmen in einen Lobpreis? Oder soll ich technisch und ästhetisch dessen Gestalt kritisieren?
Würden beispielsweise die klare liturgische Präsenz und ausgewogene Gesten der Zelebrierenden, eine kultivierte und ausdrucksstarke Sprache, dazu Musik hoher Qualität helfen? Das alles kann einen Gottesdienst natürlich besser machen. Aber schon stocke ich wieder: Besser? Gemessen an welchen Maßstäben? Denen der Theaterästhetik? Der Rhetorik? Der Performance? Gemessen an den Erwartungen einer konsumierenden oder Bestätigung suchenden Gemeinde? Muß ein Gottesdienst, der perfekt choreographiert ist, gelungen sein? Oder ein Gottesdienst, der zu Tränen rührt? Ist es nicht hochgradig verdächtig, wenn die meisten in den Bänken »toll« finden, was da vorn passiert?
Ich habe Messen größter musikalischer, liturgischer und sprachlicher Ausdruckskraft erlebt, Feste der Sinne in strahlenden Kirchen, und ich habe dabei irgendwann, leer im Herzen, nur noch die Ornamente der Deckenbemalung verfolgt und bin herausgegangen, so wie ich hineingekommen bin. Es gibt das Gegenteil: Dorfgottesdienste, wo die Pfarrerin in aller Eile einen Gottesdienst abarbeitet. Er darf nicht länger als vierzig Minuten dauern, weil dann schon der nächste im Nachbardorf ansteht. Sie spricht zu schnell, man bemerkt in jedem Detail, jeder Lesung, jedem Gebet und Lied das Bestreben, abzukürzen und zu verdichten, und ich bin doch am Ende plötzlich wie verzaubert von dem, was am Altar geschieht, und empfange, taumelnd fast, das Sakrament …
Liegt also die Wahrheit des Gottesdienstes im eigenen Erleben? In den momentanen Erwartungen, in einer religiösen Überspanntheit vielleicht und in den merkwürdigen seelischen Mustern, die überhaupt eine religiöse Frage notwendig erscheinen lassen? Ist in dem Moment, wo ich die Kirche betrete, eigentlich schon klar, was geschehen wird?
Vermutlich. Aber damit ist noch nicht viel gesagt. Daß ich innerlich gespalten bin, muß mit dem Gottesdienst »in mir« und »vor mir« gleichermaßen zusammenhängen. Es kommt mir ja etwas entgegen. Es wirkt dabei so, als würden sich in Gesang und Gebet Ebenen überlagern, die nur zum Teil meinem Bewußtsein zugänglich und auch nur partiell als seelische Vorgänge und Erfahrungen zu beschreiben sind. Das Wesentliche geschieht außerhalb meiner Wahrnehmung – vielleicht wie eine Strahlung, die ich nicht spüre und die doch folgenreich ist (ein unscharfer Vergleich, gewiß, denn wie sich das, was da geschieht, nicht subjektiv fassen läßt, so auch nicht objektiv, als sei da »etwas«). Was sich da ereignet, ist nicht sicher vorhersehbar und nicht abzurechnen. Ich kann es nicht Gefühlen oder Eindrücken zuordnen, es gerinnt nur vage zu Erfahrung. Am ehesten könnte man sagen: Es verändert sich die Art meiner Anwesenheit, sie wird fester und zugleich durchlässiger. Ich ahne die Fragilität meiner selbst, und zugleich (immer so ein zugleich) verfestigt sich ein ureigener und mir doch fremder Kern …
Hilflos, Wortschlieren: Es will mir nicht gelingen, das alles sprachlich einzuzirkeln. Nichts als ein paar blasse Andeutungen, einige Metaphern, die ganz unbedarft einen trüben Raum ertasten … Das ordnende Bewußtsein, das subjektive Erleben und die eigenen religiösen Bedürfnisse stellen eben nur einen ganz oberflächlichen Teilaspekt dessen dar, was der Kult mit mir macht. (Ich meine dabei – noch einmal sei das gesagt – nicht, daß man von einer Objektivität der Messe reden könne, als geschähe »etwas« am Menschen wie an einem Werkstück, sitzt nur der Bohrer richtig, etwa im Futter des lateinischen Ritus. Der liturgische Fundamentalismus in manchen katholischen Kreisen entspricht dem Bibelfundamentalismus bestimmter protestantischer Milieus. Diese Denkweisen kranken beide an derselben Fehlfunktion, wie alle Fundamentalismen: der eines mangelnden Gefühls für die Unverfügbarkeit Gottes, für das Nebeneinander seines Geschehens und seiner Entzogenheit. Sie leiden gewissermaßen an einer Störung des spirituellen Gleichgewichtsinns, was das Orientierungsvermögen im Numinosen gefährlich beeinträchtigt.)
Innen und Außen, Objektivität und Subjektivität – solche Begriffspaare bleiben weit unterhalb dessen, was den Gottesdienst strömen läßt. Wer nicht erfaßt ist von seinem Fluß, sieht ohnehin nichts. Faktisch, wissenschaftlich beschreibend, summiert man hier nur Fehlanzeigen, Nußschalen ohne Kern. Wenn ich also den Versuch unternehme, dem Kult einen sprachlichen Ausdruck zu geben, der mehr ist als eine Maske, bin ich gezwungen, mit den mir eigenen Bildern, Assoziationen, mit Beobachtungen, geschichtlichen Tiefenbohrungen und genauen Kartierungen von verwirbelten Formen, mit Erzählungen und Metaphernfügungen mich selbst hineinzubegeben, tiefer hinein, bewußter hinein, unbewußter hinein, in …
Etwas, das sich entzieht.
Habhaftwerden – ein Irrtum.
Klares Benennen – eine irrige Erwartung.
Das zumindest ist eine erste grundsätzliche Vermutung: Christlicher Kult ist seiner Natur nach innerlich zerrissen, er gleicht auf den ersten Blick einem Trümmerfeld, einer hektischen und verstörten Suchbewegung. Denn immer schon war der Gott da, ist auf vielerlei Art gesagt worden und gewesen, doch jetzt ist er nicht faßlich, er wird erhofft. Priester sind Statthalter, sie agieren an einer leeren Stelle. Wenn Gott anwesend sein wird, braucht es keine Kirche mehr. Und vielleicht ist das eine erste Erklärung meiner Gespaltenheit: Wenn ich Gott ersehne, ist er ja nicht da. Jede Erwartung, wenn ich eine Kirche betrete, trifft nur auf Spuren – und eine Spur gibt es nur dort, wo etwas fehlt. Enttäuschung liegt in der Natur der Sache. Die Liturgie ist wie eine Fährte im Schnee – flüchtiges Zeugnis eines anwesend-abwesenden Gottes. Noch die in der Theologie allgegenwärtige Verheißung einer kommenden Einheit mit Gott, einer Erfüllung allen Sehnens, ist ja in gewisser Weise nur eine sprachliche Überlieferung, und sie ragt fremd herüber in die kleine Dorfkirche, wo ich gerade sitze, und der Pfarrer, so volltönend seine Stimme auch ist, spricht gegen den Augenschein. Das ist seine Rolle.
Aber, und so falle ich mir ins Wort … auch damit ist wieder noch nicht alles, ja eigentlich erst wenig gesagt (wie das so ist in der Theologie): Die Wirklichkeit Gottes liegt auch jenseits des Wortpaares anwesend – abwesend. Das ist eine Erfahrung vieler gläubiger Menschen, daß Gott ihnen gerade dort am stärksten gegenwärtig sein kann, wo er schmerzlich vermißt ist. Die Frage nach »Gott« ist vielleicht bereits die deutlichste Form seiner Gegenwart, und wo er vollmundig bekannt wird, kann er ferner sein denn je.
Sechstes Blatt
Keine Nähe! – Im Nachbarhaus zum Pfarrhof lebte eine alte Polin, die sich an einer Krücke fortbewegte, langsam im Gang, nicht übergewichtig, aber schwer. Auch wie sie sprach, war schwer, die Zunge lahmte, und die Konsonanten gerieten ihr ungelenk wie Dachse im deutschen Wald. Sie war die einzige, die mich je in diesem Dorf in der Liturgie unterbrochen hat – indem sie umfiel, krachend auf die Bank, und das war Willkür, getarnt mit dem verzeihlichen Sekundenschlaf einer Achtzigjährigen. Sie erklärte es mir am Nachmittag, als sie lange um den Pfarrhof schlich, weil sie mich treffen wollte: »Was haben Sie da gesagt? Nähe? Sie beteten um Gottes Nähe? Er soll nah sein? Wissen Sie, was Sie da wollen?«
Ihre Hand lag nun auf meinem Arm, eine große Hand, durchzogen von blauen Adern, in der Farbe wie die Matten der blassen Krokusse, die im Garten vor der hohen Südwand der Scheune zu Hunderten blühten. Und sie erzählte abrupt, ohne sich meines Interesses auch nur kurz zu vergewissern:
»Ich lag in einem Erdriß, im Herbst 1939. Die deutsche Wehrmacht zog heran. Mein Vater meinte angesichts des grollenden Geschützdonners, ich solle noch in dieser einen Furche die Rüben nachlesen und dann schnell nach Hause kommen … Plötzlich sah ich vom Waldrand her die Panzer heranrollen wie stählerne Tiere. Sie bewegten sich viel schneller, als ich mir vorgestellt hatte. Ich warf mich hin, legte mich flach in das teils schon aufgepflügte Feld und betete, betete um Bewahrung, um Gottes Nähe, um seine rettende Hand. Und ich fühlte plötzlich eine seltsame innere Sicherheit – wie ein warmes Licht, das mich einschloß. Gott ist nah, dachte ich, fühlte ich tief in mir. Wie entrückt war ich dem bedrohlichen Lärm, hörte nichts, sah nichts, war geborgen in einem Trost, der nicht von dieser Welt war. Niemand sah mich, niemand fand mich. Die Front zog über unsere Äcker hinweg wie ein Wolkenschatten … Immer wieder«, so hauchte sie mir ins Gesicht, »habe ich mich später gefragt, was dieser Moment gefühlter Gottesnähe bedeutete. Naivität? War Gott mir damals wirklich nah? Aber was ist das dann für ein Gott? Auf dem Nachbarhof fanden wir am nächsten Tag alle Bewohner mit der Zunge an den Küchentisch genagelt und mit einem Genickschuß getötet, darunter meine beste Freundin … Warum lebte ich noch und die anderen nicht? Wie konnte es sein, daß ich in der Ackerfurche lag in tief empfundener Gottesnähe, während die anderen, wenige Hundert Meter weiter …
Und nun bin ich hier? Wenn Gott nah ist, geschehen Dinge, die den Menschen übersteigen. Gott ist zuviel für uns … Keine Nähe! Hören Sie? Niemals SEINE Nähe!«
Siebentes Blatt
Als Person. – Oft habe ich gesagt, Gott sei mehr als eine Person. Aber worin besteht dieses »mehr«? Liegt sein ironisch versteckter Sinn nicht doch in einem »weniger«? Ist eine unpersönliche Größe, beschrieben als Lebenskraft oder auratische Gravitation, als Allgegenwart oder spiritueller Sog mehr oder weniger als eine Person? Persona, das ist lateinisch die Maske: Durch jede Person zieht sich ein Riß zwischen einem demonstrierten Außen und einem versteckten Innen. Außen die Rolle, innen Unverfügbares. Jede Person wird erst sie selbst, indem sie als sie selbst angesehen wird und sich von dem Bild zugleich in einem nie aufzulösenden Widerspruch unterscheidet. Die Wurzel des Personenbegriffs liegt im Theater: Der einzelne Schauspieler tritt einem Chor gegenüber und legt dazu eine Maske an. Sie bezeichnet ein einsames, meist tragisches Schicksal. Im Sehen, im Augenlicht wird der Einzelne wirklich, und das heißt auch: von Blicken allseits bedroht oder geborgen.
»Tagwesen. Was aber ist einer? Was aber ist einer nicht?
Der Schatten Traum, sind Menschen. Aber wenn der Glanz
Der gottgegebene kommt,
Leuchtend Licht ist bei den Männern
Und liebliches Leben.«5
Gott als Person? Folgt man Anselm, der im hohen Mittelalter Gott im Sinne einer sprachlichen Grenzziehung definierend in die Worte faßte: majus quam cogitari possit [größer als das, was gedacht werden kann]6, dann zeigt sich über dem messenden Vergleich doch wieder ein Raum kultureller Bedingungen: Ist Größeres als eine Person denkbar? Die Antworten werden differieren zwischen Chinesen und Deutschen, zwischen Amazonas-Indianern und US-Bürgern. Faßbar wird Gott eben nicht in der Substanz, sondern in der Relation – so wird er den einen »Person« sein, den anderen nicht. Die Metapher der »Person« erzeugt für abendländische Sinne eine besondere Pointe. Sie bezeichnet eine Unterscheidung in der Gottheit selbst – eben die zwischen Maske und Unverfügbarkeit, zwischen Bild und verborgenem Inneren, zwischen Offenbarung und Wesen. Auch Gott ist als Person nie mit sich identisch.
Achtes Blatt
Introitus. – Der Einzug des Klerus war schon im frühen Mittelalter im Frankenreich und anderswo in den abendländischen Kirchen verwoben in ein opulentes deutendes Begleitprogramm. Man hatte das aus Rom: Während der Papst dort in einer der sogenannten Stationskirchen zu Beginn der Messe zum Altar schritt, rituell gestützt und langsam (vermutlich in derselben statischen Gangart, mit der hohe religiöse Würdenträger bis heute schweben, schwergewichtig mit ruhenden Oberkörpern, wie Fahrzeuge auf einer Magnetbahn), vor ihm der Subdiakon mit dem Weihrauchfaß, dazu sieben Akoluthen, junge Männer, die brennende Kerzen trugen, während er dann den hohen Steintisch mit den eingelassenen Reliquien begrüßte, an dessen Apsisseite niederkniete und betete, sangen zwei Halbchöre zu beiden Seiten des Altarraumes den aus Psalmenversen bestehenden Eingangsgesang, den Introitus. Das stille Gebet des Papstes war ein Schuldbekenntnis, ein sogenanntes Confiteor – wohl ein ganz schlichter Grundreflex, wenn der Mensch die Sphäre des Heiligen betritt, in eine Art kultische Durchleuchtung gerät, in die gnadenlose Klärung des eigenen Zustands im Licht der Gottheit. Die Distanz des Weges zum Altar ist ja enorm – vom Gehenden her gesehen führt er auf ein unerreichbares Ziel zu. Fühlbar wird dieser Abstand als Schuld: Wer darf denn zu dem Altar treten? Niemand. Aber der Gott gewährt die Verwandlung.
Doch dem allem noch voran stand, als erste Handlung der Messe, die schlichte Formel: »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« (In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.) Zu diesen Worten, dem kurzen Anlaut des Kultes, bekreuzigten sich der Papst oder der Bischof oder später der Priester – und das geschieht so bis heute. Handlung und Worte verbinden sich, klingen zusammen. Wie die ersten Buchstaben in mittelalterlichen Handschriften zugleich Bilder sind, Drachen und Kobolde, üppige Pflanzen, Engel oder märchenhafte Paläste, so wird auch hier das unerklärliche Geheimnis des Anfangs in mehr als eine Ausdrucksform gelegt. Das Wuchern der Riten und festlichen Untermalungen ist an dieser Stelle, wo die Liturgie im Augenblick entsteht, so wie sich ein Mensch nach dem Schlaf am Morgen zum ersten Mal seiner bewußt wird, nur zu erklärlich: Stehen hier auch Papst oder Bischof, so sind sie doch ganz anfängliche, ihrer selbst noch unsichere, durchlässige Wesen – wie Kinder, bei denen jede seelische Regung, jedes gesprochene Wort noch den ganzen Körper erfaßt, und sie staunen mit jeder Faser über das, was ist. So ist auch diese erste Wort-Geste.
Kaum etwas, so habe ich es immer empfunden, ist für den Liturgen schwerer als der folgende Weg durch den Mittelgang zum Altar. Das Gehen ist ein Gebet der Beine und des Blicks. Immer folgt ein allererster Schritt dem allerersten Schritt, wie oft man auch schon die Strecke gegangen ist. Alle Wiederholung, sei’s seit Jahren, alle Routine hilft nichts (es sei denn, man ist ganz abgestumpft): Was folgt, ist noch unbestimmt, ein Anfang, ein Nahen auf den Gott zu. Und ich habe einen Satz von Kafka im Ohr: »Der entscheidende Augenblick der menschlichen Entwicklung ist immerwährend. Darum sind die revolutionären Bewegungen, welche alles Frühere für nichtig erklären, im Recht, denn es ist noch nichts geschehen.«7
»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Heilsame Formel, die den Anfang bewahrt vor den überall lauernden Diskursen! Heilsamer Augenblick, wenn der Name genannt wird, dem nichts vorausgeht!
Neuntes Blatt
Deformation. – Die freie Begrüßung des Pfarrers nach der Weise: »Herzlich willkommen …« ist der erste subtile Übergriff des Kontrollsystems »Kirchenorganisation« auf den einzelnen. Lernziele werden festgeklopft. Aussagen werden eingeblendet, damit sie später wiedererkannt werden können. Der Gottesdienst geschieht nicht mehr, er wird gemacht. Er wird zum Gegenstand – wie Kiefernholz in einer Monokultur, angepflanzt, gefällt, zerspannt, zu Platten gepreßt.
Zehntes Blatt
Weiches, schwarzes Haar. – Er hatte keinen Namen. Die Erinnerung an sein Gesicht und seine Erscheinung ist mir jedoch ganz lebendig: Große Augen standen ihm ungewöhnlich eng und hoch im Gesicht, verschoben zur Stirn, was die schmale Nase verlängerte in aristokratischer Strenge. Den dunklen Glanz dieser Augen konnte ich immer nur kurz, wie beiläufig, oder von der Seite her sehen, denn er schaute nie jemanden an. Wie er ohnehin auf seine Umgebung nur mit ganz unscheinbaren Gesten reagierte, die man nicht ohne weiteres erkennen und schon gar nicht schnell entschlüsseln konnte. Man mußte mit ihm lange vertraut sein, um sie zu verstehen. Es konnte sein, daß er einfach die Steinchen, die er unablässig von der einen Hand in die andere legte, etwas länger zwischen den Fingern hielt, wenn ich zu ihm trat. Ich verstand das als einen Gruß: Hallo. Da bist du ja.
Wollte er doch plötzlich sprechen, will man das, was dann folgte so nennen, und es war auch nie klar, woher der Impuls kam, ließ er fallen, was er gerade in Händen hielt, nicht indem er es wegstieß, sondern er tat das bedächtig, als wolle er zwar hinderlichen Ballast abwerfen, aber nichts und niemanden verletzen, und wurde dann allmählich starr. Fest wie ein Brett, vom Mund her wuchs die Härte in seinen Körper, in den Hals und in die Gliedmaßen. Er schwankte. Er verzog sein Gesicht, schob den Unterkiefer vor und begann mit den Zähnen im Leeren zu reiben. Die Backenknochen schienen hervorzuwachsen, dann zogen sich plötzlich seine Lippen breit. Atemstöße, Reiblaute … als ratterte ein Fahrrad über Betonschwellen. Der Moment vor dem Sprechen, bevor noch eine Silbe entstand, dehnte sich lang bis ins Hecheln, ins Röcheln, bis er plötzlich wieder ganz ruhig wurde und die Dinge am Boden aufnahm, eins nach dem andern. Es war vollbracht.
Er spielte meist allein im Sandkasten. Er ließ stundenlang den gelben Kies durch die Finger rinnen und schien die Berührung zu genießen, die Zärtlichkeit der Kristalle. Die Steinchen waren ihm näher verwandt als alles Fleisch. Oder er zählte sie, rieb sie blank und drehte dazu seinen Oberkörper wie eine Kurbel.