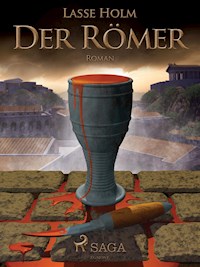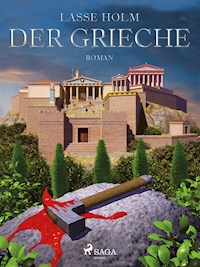
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Athen, 63 Jahre vor Zeitrechnung. Die Leiche eines Jungen wird in einem Lagerhaus in Piräus gefunden. Der Arzt Demetrios wird zu dem Fall gerufen. Schnell befindet er sich mitten in einer Affäre, die ihn und seine Familie zu zerstören droht. Alle Spuren führen nach Rom woraus er auf Lebenszeit verbannt worden war."Der Grieche" ist die Fortsetzung des Buches "Der Römer" von Lasse Holm, ein Politthriller aus der Antike, der vom Niedergang Roms erzählt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lasse Holm
Der Grieche
Lust
Der Grieche Übersetzt von Kirsten Krause OriginaltitelGrækeren Copyright © 2015, 2019 Lasse Holm und LUST
All rights reserved
ISBN: 9788711587423
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von LUST gestattet.
PERSONENVERZEICHNIS
Römische Familien – besonders die adeligen – konnten nur zwischen einer Handvoll Vornamen (Pränomen) wählen, wenn sie einen männlichen Nachkommen benennen sollten. Jede Familie hatte ihre Favoriten, aber Marcus, Quintus und Titus waren sehr populär. Überdies wurde der erstgeborene Sohn traditionellerweise nach seinem Vater benannt, der wiederum nach seinem Vater benannt worden war, usw.
Was weibliche Nachkommen betraf, waren die Möglichkeiten noch beschränkter. Eine Tochter erhielt – unabhängig von der Anzahl ihrer Schwestern – die weibliche Form des Familiennamens des Vaters (Nomen). So hießen alle Töchter der Familie Julius Julia. Einen Nachnamen im eigentlichen Sinn bekam die Frau erst, wenn sie verheiratet wurde. Bis dahin trug sie den Beinamen (Cognomen) ihres Vaters.
Das nachstehende Personenverzeichnis soll Missverständnissen vorbeugen. Die Namen sind in alphabetischer Reihenfolge und in Großbuchstaben aufgeführt unter dem/den Namen, unter dem/denen die Personen erstmals auftreten. Personen mit nur einem Namen sind Sklaven. Griechen – für die bei der Namensgebung andere Regeln galten – gehören zu den Plebejern, dem niedrigsten Stand in der römischen Republik.
RÖMISCHE MONATE UND ZEITANGABEN
Januar: Ianuarius
Februar: Februarius
März: Martius
April: Aprilis
Mai: Maius
Juni: Iunius
Juli: Quintilis
August: Sextilis
September: September
Oktober: October
November: November
Dezember: December
Kalendae: Der erste Tag des Monats
Nonae: Der fünfte bzw. siebte (im März, Mai, Juli, Oktober) Tag des Monats
Idus: Der dreizehnte bzw. fünfzehnte (im März, Mai, Juli, Oktober) Tag des Monats
PROLOG
Athen, Kalenden des Martius, im Jahre 63 v. Chr.
Mein lieber Sohn, deine Mutter wurde ermordet. Ich fand sie in den Ruinen, bis zur Unkenntlichkeit entstellt durch den Brand, der dein Elternhaus verzehrt hat. Ihre Leiche lag festgeklemmt unter dem Türpfosten. In dem verbrannten Holz war es noch möglich, Striche und Daten zu erkennen, die wir über die Jahre eingeschnitzt hatten, um deine Größe und dein Alter festzuhalten.
Nie wieder werde ich die Liebe in ihrem Gesicht sehen, um die ich mich während mehr als zwanzig Jahren Ehe versucht habe verdient zu machen. Die Haut war schwarzverbrannt und klebte an der kantigen Form des Schädels. Die Augen waren geschmolzen und am Boden der Höhlen wie Wachs festgebrannt, die Lippen zu einer unheimlichen, verzerrten Grimasse erstarrt.
Als ich ihren Körper aus der Asche hob, bemerkte ich eine Wunde an ihrer rechten Schläfe; eine Läsion von einem harten Schlag mit einem spitzen Gegenstand. Der Mörder hat deine Mutter tot oder sterbend in der Türöffnung zurückgelassen und versucht, die Spuren seiner Untat zu kaschieren, indem er das Haus anzündete.
Ich weiß, dass du Aelia nicht länger als deine Mutter anerkennst. Doch obwohl sie dich nicht selbst geboren hat, hat sie dich immer wie ihr eigenes Kind geliebt. Ich bitte dich, unsere Unstimmigkeiten zu vergessen, nach Hause nach Athen zurückzukehren und mir zu helfen, das Verbrechen aufzuklären.
Ich erwarte deine Antwort bei Sarpedon im Piräus.
Grüße von deinem Vater Demetrios
ERSTES BUCH
Athen, der 10. Tag des Martius, im Jahre 63 v. Chr.
I
Der Junge konnte nicht älter als vierzehn sein. Seine Haut war wachsartig weiß und schien halb durchsichtig zu sein. Am Hals hatte er Spuren eines Sklavenhalsrings. Auf der linken Seite seines Brustkorbs war ein griechisches ρ tätowiert, das dem lateinischen R entspricht.
Auf dem gesamten, dürren, nackten Körper befand sich nur eine einzige Wunde. Sie zog sich durchgängig vom Brustbein bis zum Schritt. Die langen, geraden Wundränder der Bauchhaut fielen nach innen. Um die Knöchel verlief eine bläuliche Verfärbung.
»Habt ihr die Eingeweide gefunden?«, fragte ich. Die hochgewachsenen Männer wandten mir ihre bleichen Gesichter zu und konnten nur mit einem Kopfschütteln antworten.
Ich war bei Sarpedon in seinem kleinen Häuschen im Piräus zu Besuch gewesen. Wir hatten auf der Bank in der Essecke der gemütlichen, niedrigen Stube gesessen, jeder seinen Becher Wein vor sich, als ein beharrliches Klopfen meinen alten Freund an die Tür gerufen hatte. Ein Mann, dem das Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand, hatte berichtet, dass ihm von den Ortsansässigen geraten worden war, mich aufzusuchen. Er hatte uns gebeten, ihm hinunter zum Hafen zu folgen, wo man – so formulierte er es – einen menschlichen Körper gefunden habe. Ich habe oft dabei geholfen, die Betrunkenen, Verwundeten und Armen aus den Hafentavernen zu betreuen. Damals hatte ich auch nichts Verkehrtes darin gesehen, ihnen zu helfen.
Wir waren dem Mann den Kai entlang gefolgt, wo Sklaven und Seeleute unter der Sonne schwitzten, während sie Kisten und Amphoren zwischen den Schiffen und den länglichen Säulenhallen der Stoa hin- und hertrugen.
Die Hafengeräusche und das Möwengeschrei verstummten, als wir durch die offene Pforte in das kühle Innere eines Lagerhauses traten. Eine kleine Gruppe von Männern umringte ein Segeltuch in der Mitte des Fußbodens.
»Wo ist die Leiche?«
Alle zeigten auf das Segeltuch. Keiner machte Anstalten, es zu entfernen. Ich verstand sie, als ich es persönlich wegzog.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte ich jetzt.
Ein bärtiger Riese meldete sich.
»Lag er hier, unter dem Segeltuch? Habt ihr ihn angefasst?«
Der Mund des Riesen bewegte sich. Ihm versagte die Stimme.
»Das Segel haben wir über ihn gelegt«, flüsterte ein anderer. »Aber ansonsten haben wir ihn nicht angerührt. Er lag hier. Mitten auf dem Boden.«
»Was habt ihr hier drinnen gemacht?«
Ein kleinerer, dunkel gekleideter Mann ergriff das Wort.
»Ich bin der Kapitän des Schiffes Melpomene. Ich soll all das hier nach Rom verschiffen, sobald der Wind günstig ist.«
Er sah auf die vielen Kisten, große und kleine, längliche und quadratische, die sich im Halbdunkel des Lagerhauses stapelten. Die Deckel saßen locker oder waren an die Seiten der Kisten gelehnt, auf dem Boden war Sägemehl verteilt.
»Es sieht aus, als hätte man die Ladung auf den Kopf gestellt. Wie lange ist es her, dass jemand hier drinnen war?«
Alle sahen zu einem kleinen Mann mit krummem Rücken. Es war der Lagerhausverwalter. »Die Tür war verschlossen, seit die Fracht vor fünf Tagen aus Athen hierhergebracht wurde«, berichtete er. »Der Besitzer hat sich für mein Lagerhaus entschieden, weil man es abschließen kann. Aber obwohl die Kisten geöffnet wurden, fehlt nichts. Ich habe die Frachtliste zwei Mal kontrolliert.«
»Also ist jemand eingebrochen, hat die Ladung untersucht, ohne etwas mitzunehmen, und eine Leiche hinterlassen?«
Der kleine Lagerhausverwalter zuckte die Schultern. Er verstand es auch nicht.
»Wem gehören all die Kisten?«
Er zögerte, schaute sich um und flüsterte: »Pomponius Atticus.«
Die Reaktion der Seeleute zeugte davon, dass Atticus vermutlich der einzige beliebte Römer in Griechenland war, aber auch von der Diskretion, mit der er seine Ladung behandelt wissen wollte. Nur der Kapitän grunzte bestätigend.
»Was lässt Atticus nach Rom schicken?«, erkundigte ich mich.
»Das darf ich nicht verraten. Das ist ein Bestandteil des Vertrags.«
»Und hat Atticus selbst Schlüssel hierfür?«
»Nein«, antwortete der Lagerhausverwalter, »den habe ich zurück an seinen Platz in meinem Kontor gehängt.«
Das Kontor erwies sich als ein baufälliger Außenanbau auf der Rückseite des Lagerhauses. Der Schlüssel hing an einem Nagel an der Innenseite der Tür.
»Und das ist der einzige Schlüssel?«
»So wahr, wie ich dieses Lagerhaus seit fünfzehn Jahren verwalte. Es gibt keinen Zweitschlüssel und er hängt immer hier im Kontor. Bei mir kommt kein Unbefugter rein!«
Hier hätte ich darauf hinweisen können, dass jedenfalls ein Unbefugter hineingekommen war. Doch die Erfahrung hatte mich gelehrt, dass die Piräer keinen Sinn für Sarkasmus hatten.
Wir kehrten zu der Leiche zurück.
»Sarpedon, hast du etwas zum Schreiben?«
Ich sah mich um. Mein alter Freund war verschwunden. Einer der Seemänner fand ihn in einer Ecke, wo er seinen Mageninhalt über den gestampften Lehmboden entleert hatte.
»Entschuldigung.« Sarpedon wischte sich den Mund trocken und reichte mir die Wachstafel und den Stylus, die er immer dabeihatte. »Schreib los. Wenn ich nur diesen armen Jungen nicht nochmal anschauen muss.«
»Darf ich den Stylus benutzen, um eine Läsion an der linken Schläfe der Leiche zu untersuchen? Es sieht so aus, als hätte man ihn mit einem spitzen Gegenstand niedergeschlagen, bevor er aufgeschlitzt wurde.«
Sarpedon verzog sich schnell wieder in seine Ecke.
II
Wenn du den Brief erhalten hast, in dem ich von Aelias Tod berichtet habe, bitte ich dich, von dessen Inhalt abzusehen, mein Sohn. Er wurde kurz nach dem Brand vor zehn Tagen geschrieben. Mittlerweile habe ich vieles erfahren, das meine Auffassung der Ereignisse fundamental verändert hat.
Ich verstehe nun, dass die ganze Misere ihren Anfang mit dem unheimlichen Fund nahm, den ich gerade beschrieben habe. Er wurde an dem Tag gemacht, als du unser Haus im Zorn verlassen hast. Soll ich Klarheit über den komplizierten Vorgang schaffen, der zu dieser Katastrophe führte, die unser Heim zerstörte, muss ich dies als Ausgangspunkt nehmen. Ich bitte dich, getreulich weiter zu lesen, auch wenn du vielleicht über scheinbar bedeutungslose Details im Text verwirrt sein magst. Ich versichere dir, alles, was in diesen hektischen Tagen passiert ist, sollte große Bedeutung für unsere gesamte kleine Familie bekommen.
Nach der Leichenschau im Lagerhaus folgte Sarpedon mir durch die rechtwinklige Gassen des Piräus und an den Überresten der alten Schiffshangars des Kriegshafens Zea vorbei, die um das ramponierte Hafenbecken herumlagen wie entblößte Rippen eines abgenagten Kadavers. Die wenigen Menschen, die wir trafen, strebten von uns weg in den Schatten.
»Jetzt wissen es alle«, flüsterte Sarpedon. »Wir sind durch das Blut unrein.«
Einer nach dem anderen waren die Zeugen verschwunden, während ich meine Untersuchung abschloss. Zuletzt hatte nur der Lagerhausverwalter, der die Türen nicht unverschlossen hinterlassen konnte, uns und der Jungenleiche widerwillig Gesellschaft geleistet. Die Seeleute hatten das Gerücht darüber, was passiert war, im Rest der Hafenstadt verbreitet.
»An der Leiche war nicht ein Tropfen Blut«, sagte ich. »Der Rigor mortis hatte schon nachgelassen. Der Junge ist vor mehr als vierundzwanzig Stunden gestorben. Niemand kann uns unrein nennen.« Sarpedon hielt inne. Seine hagere Gestalt krümmte sich über dem kleinen Spitzbauch. Die Verfärbung durch die Verbrühung, wegen der ich ihn einmal in Rom behandelt hatte, glühte unter dem zottigen Bart.
»Ich glaube trotzdem, dass ich mit dir nach Athen komme. Dann kann ich mich einem Reinigungsritual in der Akropolis unterziehen. Wenn ich ein paar Tage damit warte heimzukommen, wissen meine Nachbarn, dass sie wieder mit mir sprechen können.« Mit einem verklärten Gesichtsausdruck richtete er sich auf. »Diese furchtbare Geschichte wird mich vielleicht endlich zur Heimkehr bewegen.«
Die Möglichkeit, jederzeit an Bord eines Schiffes gehen zu können, war immer ein wichtiger Fixpunkt in Sarpedons Leben gewesen. Im letzten Winter hatte eine Woche Schneefall das Heimweh ausgelöst. Im Sommer war es die Hitze. Im Herbst die Stürme. Seit zehn Jahren hatte Sarpedon davon gesprochen, heim nach Lykien zu reisen.
»Aelia und ich werden dich vermissen«, sagte ich.
»Ich werde euch auch vermissen. Und Demetrianus.«
Dein Name war Salz in einer unverheilten Wunde, die das Gespräch abrupt beendete. Schweigend passierten wir das Kronos-Tor und gingen zwischen den verwitterten Mauerresten weiter zum Athener Weg. Sarpedon wechselte das Thema.
»Was willst du für den ermordeten Jungen tun?«
»Ich kann ihm nicht helfen. Er ist mausetot.«
»Aber du hast doch den Tatort so gründlich untersucht.«
Meine Gründlichkeit hatte ihren Grund. Ich wollte sichergehen.
»Das Lagerhaus war nicht der Tatort. Die Zerstückelung hätte eine Blutspur hinterlassen, die man nicht vom Erdboden hätte abwaschen können – genau wie der Fleck, den du in der Ecke hinterlassen hast.«
Sarpedon nahm das zur Kenntnis, ohne beleidigt zu sein.
»Also hat der Mörder den Jungen im Lagerhaus zurückgelassen, weil er keine andere Stelle hatte, um ihn loszuwerden?«
Man hätte die Leiche in einen Sack mit Steinen stecken und sie in tiefem Wasser versenken können. Sie in einer Schiffsladung verstecken können, wo sie erst auf offener See oder bei der Ankunft entdeckt worden wäre und die Besatzung sie hätte verschwinden lassen, um nicht selbst verdächtigt zu werden. Die Möglichkeiten, im Piräus eine Leiche loszuwerden, waren unzählig.
»Nein«, widersprach ich. »Jemand sollte ihn finden.«
»Wieso?«
»Wenn ich das wüsste, könnte ich dir sicher auch sagen, wer der Mörder war. Eines ist sicher: Er wusste, wo der Schlüssel zum Lagerhaus hing. Niemand hätte in diesem kleinen, baufälligen Schuppen danach gesucht.«
»Also war es der Besitzer der Ladung? Pomponius Atticus?«
»Das glaube ich nicht. Eine Reinigungszeremonie durchführen zu lassen wird ihn ein kleines Vermögen kosten. Und wenn er das Geld nicht opfert, wird kein einziger Schiffer seine Ladung an Bord nehmen.«
»Vielleicht hat der Mörder versucht, Atticus zu schaden, indem er seine Ladung mit Blut besudelt hat?«, schlug Sarpedon vor.
»Warum? Alle mögen Atticus.«
»Reichtum weckt immer Neid.«
Wir gingen schweigend weiter, während uns die Nachmittagssonne den Rücken wärmte. Vier Meilen weiter im Landesinneren leuchtete die farbenprächtige Zitadelle der Akropolis in der staubig-grünen Landschaft auf. Zikaden sangen zwischen den überwucherten Ruinen der Mauern, die einst Athen mit dem Piräus zu einer zusammenhängenden, uneinnehmbaren Festung verbunden hatten, die nicht einmal die Spartaner hatten einnehmen können. Schließlich fand Sarpedon den Mut, nach dem zu fragen, was ihn wirklich interessierte.
»Du hast eine Wunde an der Schläfe des Jungen erwähnt?«
Ich zeigte ihm, wo die kleine Vertiefung gesessen hatte: Zwei Finger breit über dem Ohr, direkt hinter dem Haaransatz.
»Die Spitze deines Stylus stieß an die Seiten der Wunde, bevor sie den Boden erreichte«, erklärte ich. »Die Mordwaffe war geformt wie ein gekrümmter Finger. Der Eintrittswinkel deutet darauf hin, dass der Mörder hinter seinem Opfer gestanden hat. Und dass er einen Kopf größer war als ich. Es sei denn, der Junge hätte gekniet. Übrigens war er noch am Leben, als er kopfüber aufgehängt wurde. Wie ein Schlachtschwein. Er hatte Schürfungen an den Knöcheln, um die das Seil gewickelt war.«
Sarpedon musste sich nach meiner forensischen Ausführung sammeln. Wir hatten uns der Stadt eine halbe Meile weiter genähert, bevor er wieder sprach.
»Der Mörder ist also ein Feind von Atticus und sechs Fuß groß. Das kann auf kaum mehr als etwa zwanzig Menschen in Athen und im Piräus zutreffen.«
»Niemand sagt, dass der Mörder immer noch hier ist. Er hatte schon einen ganzen Tag, um sich aus dem Staub zu machen.«
»Willst du versuchen herauszufinden, wer es getan hat?«
»Athen hat ein Polizeikorps«, entgegnete ich. »Ich gebe ihnen meine Notizen. Der Rest ist ihre Sache.«
Seine stumme Missbilligung ließ mich weiter ausholen.
»Hast du etwa vergessen, wie es das letzte Mal lief, als ich versucht habe, einen Mord aufzuklären?«
»Es hat doch geklappt. Du hast den Mörder des Volkstribunen Marcus Livius Drusus entlarvt.«
»Dafür wurde ich lebenslänglich ins Exil geschickt. Ich kann nie wieder nach Rom zurückkehren.«
Sarpedons bärtiges Gesicht öffnete sich wie ein Fächer. Wenigstens in einem Punkt fand er meine Bitterkeit übertrieben.
»Du kannst doch ohne Weiteres nach Hause gehen. Das ist mehr als zwanzig Jahre her. Keiner erinnert sich mehr an die Exilstrafe.«
»Dass ich hier nach Athen gekommen bin, ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist«, erwiderte ich zornig. »Ich bin kein Römer mehr. Mein Vater stammte aus Mazedonien. Also bin ich Grieche.«
III
Sarpedon und ich erreichten das Haus in Koile bei Sonnenuntergang. Der kleine Garten hinter dem Lattenzaun der niedrigen Mauer, von wo sich die Pflanzen über das Pergola-Vordach wanden, war in die letzten Strahlen goldenen Lichts getaucht. Die Blätter des Oleanders raschelten in der Brise, die rotvioletten Blüten nickten mir zu. Mit einem Kloß im Hals nahm ich den Anblick in mich auf. Vielleicht ahnte ich damals bereits die Katastrophe, die unser Zuhause zerstören und unser Leben vernichten sollte.
Philomela saß auf der Bank. Ich rief ihr zu, sie solle hineinlaufen und euch erzählen, dass wir beim Abendessen einen Gast hätten. Sie erhob sich, blieb jedoch stehen.
»Freust du dich nicht, Sarpedon zu sehen, Philo?«
»Vater, nun hör doch mal auf, mich Philo zu nennen. Das ist ein Jungenname.«
Ich hatte mich noch nicht an diese fixe Idee gewöhnt, die deine Schwester seit weniger als einem Monat dazu veranlasst hatte, gegen den Kosenamen zu protestieren, den sie seit ihrer Geburt trug. Wenn Mädchen sich dem heiratsfähigen Alter nähern, durchlaufen sie seelische und körperliche Veränderungen, bei denen man als Vater nur schwer mitkommt. Eine Unsicherheit, die andere als Trotz gedeutet hätten, ließ sie die nussbraunen Haare zurückwerfen, die kleine, sommersprossige Nase rümpfen und die blauen Augen zusammenkneifen.
»Nun hol deine Mutter«, sagte ich.
»Das kannst du selbst machen. Mama spricht nicht mit mir.«
»Was hast du denn diesmal angestellt?«
»Sie ist auf dich sauer.«
»Was habe ich getan?«
»Woher soll ich das wissen? Mir erzählt ja keiner was.«
Ich schaute zu Sarpedon. Er nickte und wartete draußen mit Philomela, während ich über die Türschwelle trat.
Im Halbdunkel der Stube traf ich jedoch nicht auf die wütenden Vorwürfe deine Mutter, sondern auf ihr tränennasses Gesicht. Aelia warf sich mir an den Hals und erklärte, dass wir dich nun endgültig verloren hätten, du uns niemals vergeben würdest und es ihr Fehler sei, weil sie die Bücher behalten und versteckt hätte, anstelle sie zu verbrennen.
»Welche Bücher?«, fragte ich und legte die Wachstafel mit meinen Notizen auf den Tisch.
Du musst verstehen, mein Sohn, es war Jahre her, seit ich zuletzt an die vier Bücher gedacht hatte, die ich im Laufe des halben Jahres meiner Gefangenschaft in Rom geschrieben hatte. Die Anklage gegen mich war falsch gewesen. Die Beweise erfunden. Und wie Sarpedon mich gerade erinnert hatte, war ich nicht zum Tode verurteilt, sondern nur ins Exil geschickt worden. Es war mit anderen Worten nicht die Scham, die mich dazu gebracht hatte Aelia zu bitten, die Pergamentrollen zu verbrennen, die ich dir während meiner Gefangenschaft sorgfältig geschrieben hatte, sondern die Erkenntnis, dass sie jegliche Relevanz verloren hatten. Das Bedürfnis, dir von den Umständen zu erzählen, die uns getrennt hatten, existierte nicht länger. Ich war am Leben und hielt dich in meinen Armen. Die Vergangenheit erschien mir bedeutungslos. Ich hatte sie seelenruhig den Flammen überlassen.
»Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die Bücher zu verbrennen«, fuhr deine Mutter fort. »Es war zu viel von dir darin. Zu viel von unserer gemeinsamen Geschichte. Ich habe sie hinter einer Abdeckung in meinem Schminkschränkchen versteckt. Demetrianus hat wohl nach irgendetwas gesucht, um den Kater zu bekämpfen, und dann hat sich die Holzverkleidung gelockert.«
Man sagt, dass niemand Geheimnisse vor einem durstigen Trinker hat. Sokrates war keine Ausnahme von dieser Regel. Diogenes wohnte in einem Weinfass. Du befindest dich in guter Gesellschaft, mein Sohn.
Das Gemüt zögert damit, Aussagen aufzunehmen, die die Welt in ein neues Licht rücken. Unglaube erzeugt Leugnung. War das möglich? Konnten die Bücher, deren Existenz ich seit Langem abgeschrieben hatte, wirklich noch vorhanden sein?
Meine erste Frage galt der Zeugenaussage meines Vaters über die Gracchus-Brüder. All die Jahre war meine einzige Reue gewesen, dass Vaters Buch über die beiden Reformatoren, die der Senat als Aufrührer ausgerufen hatte, mit den übrigen in Flammen aufgegangen war. Daran hättest du Freude haben können. Es hätte dich etwas über Prinzipientreue und Ehre lehren können. Ich bekam nun einen widersinnigen Drang, es erneut zu lesen.
»Demetrianus hat alle Rollen mitgenommen«, erwiderte Aelia.
»Hätte er mir doch nur Zeit gegeben, es zu erklären. Aber er ist zur Tür hinausgestürmt. Er wollte nicht auf mich hören.«
Ihre dunklen Augen betrachteten mich mit diesem Blick, der mir Atemnot und kalte Zehen verursachte. Sie merkte, dass sie etwas weiter ausholen musste.
Nicht alles in unserer Vergangenheit erträgt genauere Forschung. Das weißt du besser als jeder andere, mein Sohn. Als ich dir vor zweiundzwanzig Jahren schrieb, war ich der festen Überzeugung, dass du und ich uns nie wiedersehen würden. Sonst wäre ich vermutlich etwas weniger offenherzig gewesen. Sowohl was mein Verhältnis mit dem jungen Adelsfräulein Servilia Drusa als auch meinen Aufenthalt bei Volumnia als ihr unfreiwilliger Sexsklave betrifft. Meine Absicht war damals, dass du deinen Vater im Guten wie im Schlechten kennenlernen solltest.
»Dazu ist er dann auch gekommen«, bemerkte Aelia trocken. »Er will niemanden von uns wiedersehen. So lange er lebt. Er wird nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen.«
Ihre Parodie deines jugendlichen Melodramas, dass wir beide so gut kannten, ließ uns trotz allem lächeln. Sobald ein Säugling das erste Mal die Brustwarze im Mund hat, arbeitet er unbewusst daran sich loszureißen. Diese grundlegenden Lebensbedingungen kannten wir beide.
»Ich verstehe nicht, wie das mein Fehler gewesen sein kann.«
Wir kannten uns schon zu lange, als dass ich so leicht aufgegeben hätte. Ihr Gesicht war wieder ernst, ihr Blick scharf wie ein Skalpell. Ich wartete auf das Donnerwetter.
»Ihr wart beide gleich dumm und starrköpfig«, hielt Aelia fest. »Er ist jung und rebellisch, aber du solltest es besser wissen. In den letzten Jahren hast du seine Trinkerei als Entschuldigung benutzt, um ihn auf Abstand zu halten, damit du nicht einsehen musstest, wie unglücklich er war.«
Die Diskussion war genauso alt wie du – oder annähernd.
In der ersten Zeit in Athen waren wir beide gute Freunde, obwohl du dich nicht daran erinnerst. Du hast mich nicht enttäuscht, bis du etwa sechs bis sieben Jahre als warst und ich ernstlich die Verantwortung für deine Erziehung übernahm. Bis dahin warst du ein wunderbares Kind.
»Ich habe nur versucht ihm zu helfen«, verteidigte ich mich. »Es ist nicht meine Schuld, dass Demetrianus einen schwachen Charakter hat.«
Sie fuhr hoch, verletzt und verteidigungsbereit.
»Meine ganz gewiss auch nicht. Das machen deine Bücher sehr deutlich. Was glaubst du eigentlich, ist in Demetrianus vorgegangen, als er herausfand, dass ich nicht seine Mutter bin?«
Du musst wissen, dass Aelia dich immer wie ihren eigenen Sohn betrachtet hat. Nichtsdestotrotz ist es wahr, dass du das unerwartete Resultat einer einzigen Nacht bist, die ich mit einer Sklavin namens Rachel verbracht habe. Und dass deine Mutter dich adoptierte, als Rachel zum Haus des Diktators Sulla bei Cumae weggebracht wurde. Es ist auch wahr, dass der Mann, den ich bis zu meinem Tod Vater nennen werde, nicht mein biologischer Vater war. Dass ich selbst das Ergebnis einer illegitimen Verbindung zwischen dem großen Kriegsheld General Marius, der als Einziger sieben Mal Konsul von Rom war, und seiner Geliebten Sempronia bin, die nach der Geburt ihren Arztsklaven darum bat, sich um mich zu kümmern. Um Gerede und Skandale zu vermeiden. Und bestimmt auch, um den Verpflichtungen zu entgehen, die die Mutterschaft mit sich bringt. Das sind Tatsachen. Es ist verblüffend, wie wenig sie darüber erzählen, wie sich die Dinge wirklich verhalten.
»Was hat Demetrianus zu dir gesagt, bevor er weggelaufen ist?« Meine Stimme klang belegt und fremdartig.
»Eine Menge Dinge, die er wohl bereuen wird. Aber in einem Punkt hat er Recht: Wir hätten es ihm längst sagen müssen. Doch vielleicht ist es nicht zu spät. Wenn du nur einmal vernünftig mit ihm sprechen könntest, kannst du ihn vielleicht dazu bringen, nach Hause zu kommen.«
Unsere Vorgeschichte in Betracht gezogen war das äußerst zweifelhaft. Ich hatte außerdem keine Ahnung, wo ich suchen sollte. Das übernahm Aelia. Dafür hattest du Sorge getragen.
»Er sagte, er würde Atticus um ein Darlehen bitten, um nach Rom zu reisen.«
»Wieso Atticus? Und warum ausgerechnet Rom?«
»Was glaubst du denn?«, sagte sie und stemmte die Hände in die Hüften.
»Demetrianus will natürlich versuchen, seine biologische Mutter zu finden. Und seinen Stiefbruder Tiro, von dem er durch deine Bücher zum ersten Mal gehört hat. Tiro, der Sekretär des berühmten Advokaten Cicero ist. Cicero, der ein Jugendfreund von Pomponius Atticus ist.«
IV
Atticus’ Heim war in der Abenddämmerung von unzähligen Lampen erleuchtet. Man hätte auf die Idee kommen können, dass der Mäzen nicht nur eine Abendgesellschaft, sondern ein großartiges Fest abhielt.
Du hast es geschafft, zehn Tage bei Atticus zu wohnen, mein Sohn. Du kennst besser als ich die Größe des Hauses, seinen prachtvollen Garten und die Aussicht auf die Akropolis. Von dem Platz vor der Haustür aus konnte man den Halbkreis der Sitzplätze des Dionysostheaters erahnen, die bis zu dem Urgestein der rauen Felsen reichten. Ganz oben glühten die Farben des Parthenonfrieses im letzten Licht des Tages.
»Es ist peinlich, mit einem solchen Anliegen zu einem derart vornehmen Mann zu kommen«, fand ich, und bereitete mich darauf vor, wieder zu gehen.
»Unsinn. Atticus ist der nobelste Mann Athens.« Das Einzige, was Sarpedon wahrnahm, war seine eigene, brodelnde, kitzelnde Neugierde. »Alle, die ihn besucht haben, berichten, dass sein Zuhause das eleganteste in Griechenland ist.«
»Glaubst du nicht, er hat Demetrianus abgewiesen? Einen armen Jungen, den er noch nie getroffen hat?«
Für einen Augenblick kamen Sarpedon Zweifel. Dann fand er zu seiner Überzeugung zurück, die ihm mit größter Wahrscheinlichkeit Zutritt zu Pomponius Atticus’ elegantem Heim verschaffen würde.
»Man sagt, dass kein Athener vergeblich zu Atticus geht mit einem Wunsch, den zu erfüllen in seiner Macht steht.«
Es hieß ganz richtig, dass Atticus’ Freigebigkeit außergewöhnlich groß gewesen war, seit er im Herbst von einem seiner Aufenthalte in Rom zurückgekehrt war. Deine Bitte um Reisehilfe war sicher bescheiden im Vergleich zu den Forderungen, die er im Laufe des Winters erhalten hatte.
Den Nachnamen Atticus hatte er selbst gewählt, als er im Alter von 27 Jahren nach Athen gezogen war. Seine früheste Kindheit und das erste Schuljahr hatte er hier verbracht, und nachdem er das gewaltige Vermögen seiner Familie geerbt hatte, wünschte er sich nichts anderes als das unruhige Italien hinter sich zu lassen und sich in die Lehre, die Philosophie und das reiche Geistesleben zu vertiefen. Die harte Realität in einer Stadt, die halb aus Ruinen bestand, musste ein jähes Erwachen gewesen sein. Zu Atticus’ Lob muss gesagt werden, dass er trotz allem hier wohnen blieb und mithalf, den Wiederaufbau zu finanzieren.
Der Türsklave, gut gekleidet und höflich, ließ uns nicht auf der Bank drinnen warten, sondern führte uns sofort durch den großen, nach Süden gelegenen Garten zum Prothyron des Hauses. Sarpedon war überwältigt von den farbenprächtigen Statuen in der Vorhalle. Ich selbst wurde von einem anderen Wunder angezogen.
Wie um den unerhörten Reichtum des Hausherrn zu unterstreichen, hing an der Wand ein Spiegel, der groß genug war, um das Gesicht und die Schultern des Betrachters zu zeigen. Von seiner blankpolieren Silberfläche starrte mir ein blauäugiger Mann mittleren Alters mit einem grauen Stich in dem rotblonden Haar und Sonnenfalten in den Augenwinkeln entgegen. Wie gebannt blieb ich vor dem Spiegel stehen, außerstande mich loszureißen.
Atticus kam persönlich nach draußen und nahm uns in Empfang. Er war Ende vierzig und einen halben Kopf größer als wir beide. Ein blonder Vollbart lag wie ein Schleier auf seinen Wangen. Er strahlte freundliches Entgegenkommen aus, das signalisierte, dass wir in keiner Weise ungelegen kamen.
»Nun treffen wir uns endlich, Demetrios«, begrüßte er mich herzlich. »Ich habe viel von dir gehört.«
Schlagartig wurde mir klar, woher Athens Wohltäter von meiner Existenz wusste. »Ich bitte um Verzeihung«, begann ich, »falls mein Sohn den Herrn mit seinen Klagen belästigt hat.«
Atticus verneinte mit einer abwehrenden Geste, dass du auch nur im Geringsten eine Last gewesen wärest.
»Ich habe von dem Arzt Demetrios gehört, lange bevor dein Junge an meine Tür klopfte. Und das hier ist wohl Sarpedon, der Pädagoge vom Piräus? Meine Freunde loben euch in den höchsten Tönen. Ich habe weder Kinder noch gesundheitliche Probleme, daher habe ich eure Expertise nie benötigt.«
Atticus meisterte die schwere Kunst, alle zufriedenzustellen.
In seinen tadellosen weißen Chiton gekleidet führte er uns in den hübsch dekorierten Andron hinein, wo sieben Abendgäste lagen, jeder auf einem eigenen Diwan, hufeisenförmig um einen Tisch aus dunklem Holz verteilt, mit Essen im Überfluss, angerichtet in Schüsseln und auf feinen Silberplatten. Das Schweigen in diesem hohen Speisezimmer war auffallend. Zu der Versammlung zählte eine Handvoll der Spitzen der Stadt – außer zweien, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Auf einer Wandmalerei war Apoll zu sehen, der die Gäste mit einem milden Blick bedachte.
»Leider kommt ihr zu spät, um die Gedichtrezitation zu hören«, bedauerte Atticus. »Aber eine Mahlzeit kann ich noch anbieten.«
Ich versicherte, dass wir nicht beabsichtigten, seine Gastfreundschaft zu strapazieren, sondern nur gekommen waren, um meinen Sohn zur Heimkehr zu überreden.
»Ein kleiner Happen wäre doch nicht übel«, wandte Sarpedon ein. »Wir sind den ganzen Weg vom Piräus gelaufen ohne etwas zu essen oder zu trinken zu bekommen.«
»Das ist aber auch wahr.« Atticus klatschte in die Hände, als ob Sarpedon ihn an eine Frage erinnert hätte, mit der er sich lange herumgeschlagen hatte. »Wir sprachen gerade über diesen schrecklichen Todesfall, der sich am Hafen ereignet hat. Meine Gäste und ich sind erpicht darauf, etwas Neues zu hören. Legt euch nun zu Tisch, ihr beiden. Dein Sohn läuft nicht weg, Demetrios.«
V
Sarpedon und ich legten uns auf einen Diwan zur Rechten unseres Gastgebers. Dessen vorherigen Inhabern bot er stattdessen einen Platz am anderen Ende des Tisches an. Sie beklagten sich nicht über diese Degradierung, aber der größere, dessen kurzgeschnittene, schwarze Haare und Bart ein ebenmäßiges Gesicht einrahmten, musterte mich, als ob ich der neue Geliebte seiner geschiedenen Frau wäre. Die Augen, durchscheinend hellgrau, waren von dunklen Wimpern umkränzt. Der Blick schien wie eine Fackel in einer Höhle zu brennen. Der Körper war stark und markant. Er war eine beinahe überirdische, maskuline Schönheit.
»Nun erzähl, Demetrios«, forderte Atticus mich auf.
»Dieses Thema eignet sich nicht für eine Abendgesellschaft. Die Leiche war fürchterlich zugerichtet.«
»Wir haben uns allesamt satt gegessen«, sagte der Schwarzbärtige von seinem neuen Platz. Seinem ansonsten perfekten Griechisch war ein deutlicher lateinischer Akzent anzumerken. »Und wie du sehen kannst, sind keine Frauen anwesend. Zumindest keine, die sich rein physisch identifizieren lassen.«
Für einen Moment genoss er die Verärgerung der Einheimischen über seine beleidigende Spitze. Dann fuhr er fort: »Wie lange willst du Atticus noch im Ungewissen lassen, Demetrios? Er wird vor Nervosität wegen seiner Schiffsladung noch vergehen.«
Atticus zuckte mit den Schultern und lächelte entschuldigend. Auch wenn er es vorgezogen hätte, dass das ungesagt geblieben wäre, galt seine größte Sorge der Schiffsladung. Ich berichtete von dem Einbruch, den Beteuerungen des Lagerhausverwalters und danach vom Zustand der Leiche.
»Das klingt mehr nach einem Opferritual als nach einem Mord«, bemerkte ein Immobilienspekulant, der ein Vermögen mit dem Vermieten von Bruchbuden in Skambonidai verdiente. Letzten Monat hatte ich ihn wegen eines lästigen Ausschlags im Schritt behandelt.
Ein anderer Gast räusperte sich und wechselte die Position.
»Die Eingeweide herausgenommen. Die Leiche gründlich gereinigt. Das klingt ganz richtig danach, dass der Junge das Opfer bei einer Lykaia-Zeremonie gewesen ist.«
Die tiefe Stimme mit der sorgfältigen Diktion gehörte Chryses, einem meiner Stammpatienten und Hohepriester des Tempels der Pallas Athene in der Akropolis. Während meiner Konsultationen klagte er routinemäßig über die vielen Festessen, an denen teilzunehmen er durch sein hohes Amt verpflichtet war. In einer Stadt, die sich oft am Rande der Hungersnot befand, dienten diese häufigen Klagen dazu, seine privilegierte Position zu unterstreichen. Doch nun arbeitete er auf eine andere Pointe hin.
»Jeder Grieche, der mit dieser Art von Abscheulichkeiten in Verbindung gewesen ist, tut klug daran, eine Reinigung zu durchlaufen, damit andere keine Verunreinigung durch das Blut zu befürchten haben. Ich nehme mich dieser Aufgabe für eine ganz bescheidene Summe an.« Er räusperte sich erneut. »30 Drachmen pro Mann.«
Ein Jahreslohn war ein hoher Preis für eine Zeremonie, die nicht nur aufgrund des gesunden Menschenverstandes, sondern auch der modernen Gesetzeslage zufolge überflüssig war.
»Das wird nicht nötig sein«, meinte ich. »Der Junge war seit mindestens vierundzwanzig Stunden tot.«
Dieses Angebot kam dem am nächsten, was Chryses unter Entgegenkommen verstand – doch eher von Notwendigkeit als Freundlichkeit diktiert. Die Mixturen anderer Ärzte halfen nicht gegen seine Verstopfungen. Er überspielte seine Verunsicherung mit einem plötzlichen Themenwechsel.
»Die Lykaia war ein Ritual, das in der Vorgeschichte auf dem südlichen Gipfel des Lykaion Oros stattfand. Oder dem Wolfsberg, für unsere römischen Gäste.«
Chryses musterte den Schwarzhaarigen und dessen Freund am Tischende und rümpfte seine Habichtsnase. Für einen Moment schien er abzuwägen, ob es weise war, Geschichten aus Griechenlands primitiver Vorzeit zum Besten zu geben. Der Gelegenheit, seine Umgebung über ein Thema zu belehren, von dem seine Wissensspeicher nur so überfloss, konnte er jedoch nicht widerstehen.
»Der Gott des Berges forderte ein Menschenopfer in Form eines Epheben, hrm-hrm.« Wenn Chryses sich räusperte, war es eher dem Bedürfnis geschuldet, eine Pointe zu unterstreichen als den Hals zu freizumachen.
»Also ein Junge an der Schwelle zum Mannesalter. Der Geograph Theophrastos meinte, das Ritual sei mit dem Opfer der Karthager an ihren Gott Moloch verwandt. Aber die Lykaia hatte auch einen Hauch von Kannibalismus.«
Zufrieden stellte er fest, dass er die ungeteilte Aufmerksamkeit der Gesellschaft genoss. Nur die Schmatzgeräusche von Sarpedons Platz an meiner Seite unterbrachen die gespannte Stille im Speisezimmer.
»Platon berichtet, wie sich ein Stamm, der in der Nähe des Berges wohnte, jedes neunte Jahr versammelte, um das Fleisch eines Wolfes mit den Eingeweiden eines Jungen zu mischen. Derjenige, der von dieser Mischung aß, wurde ganz buchstäblich selbst zu einem Wolf. Der berühmte Faustkämpfer Damarchus durchlief diese Zeremonie und wurde erst neun Jahre später wieder zu einem Menschen. Hrm-hrm. Platon meinte jedoch, dass dies ein Märchen sei.«
»Natürlich ist das ein Märchen«, mischte sich ein reicher Kaufmann vom Piräus ein und erschauderte. »Es wird wohl niemanden geben, der seinen Sohn solchen Göttern opfern will.«
»Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Zeremonien stattfanden«, widersprach der Hohepriester. »Platon zweifelte lediglich an der Wirkung. Hrm-hrm. Aber das Opfer war in der Regel ein Sklave, kein Bürgersohn. Die Familie des Besitzers war in den neun Jahren, die bis zur nächsten Zeremonie vergingen, vor Krankheiten und Tod geschützt. Das Glück würde ihnen für den Rest des Lebens hold sein.«
»Deine gute Gesundheit ist allgemein bekannt, Atticus«, lächelte der schwarzbärtige Römer. »Und niemand zweifelt daran, dass das Glück hier in Athen auf deiner Seite war. Vielleicht warst du ja da draußen mit dem Messer?«
An dem Schweigen der anderen erkannte ich, dass die subtilen Beleidigungen des Römers ein wiederkehrender Zug bei den Gesprächen des Abends gewesen waren. Selbst jetzt, als er den Gastgeber herausgefordert hatte und den Gastregeln zufolge nur weggeschickt werden konnte, blieb Atticus die Freundlichkeit in Person.
»Das Wohlwollen, das die Götter mir geschenkt haben«, sagte er, »ist sicher der Tatsache geschuldet, dass sie mehr Gefallen an dem, der auf seine Gesundheit achtet, finden, als an einem Fresssack, der sie unaufhörlich mit Gebeten belästigt. Außerdem behandele ich meine Geschäftspartner gut. Das können sicherlich alle hier bezeugen.«
Der Kaufmann vom Piräus bestätigte Atticus’ Rechtschaffenheit. Chryses pries den Gastgeber für seinen generösen Beitrag zu der Restaurierung des Pantheon-Frieses. Der führende Getreidehändler der Stadt, dessen Fußwarzen ich behandelt hatte, erzählte anschließend, wie das Volk hätte hungern müssen, wenn nicht Atticus während der Hungersnot Brot verteilt hätte. Der Römische Staat hatte jedenfalls nichts getan, um die Prüfungen der Athener zu erleichtern.
»Aber dafür gab es doch einen Grund, liebe Freunde.« Der schwarzbärtige Römer hatte sich aufgesetzt und lächelte in die Runde. »Ihr habt den Feind hineingelassen, während Rom von einem Bürgerkrieg in Atem gehalten wurde, der uns hätte auslöschen können.«
Als Rom 150 Jahre zuvor nach dem Niedergang des mazedonischen Königshauses die Macht in Griechenland übernommen hatte, hatte Athen einen Sonderstatus als Freistaat erhalten. Das Talent der Einwohner für politische Inkompetenz hatte das gute Verhältnis zerstört, das über Generationen hinweg zu einer angestrengten Waffenruhe degeneriert war. Zuletzt hatte Athen dann Mithridates’ Aufstand gegen Rom unterstützt und war zur Strafe mit Katapulten bombardiert worden. Seitdem war ganz unverhohlen die Rede von einer Besetzung gewesen.
»Die Besetzten sind selten loyal den Besatzern gegenüber«, wandte Chryses ein und räusperte sich wieder.
»Ihr Köter seid ja nicht mal euch selbst gegenüber loyal.« Mit dem vorgetäuscht freundlichen Ton des schwarzhaarigen Römers war nun endgültig Schluss. »Wenn wir euch nicht in Zucht halten würden, würdet ihr fortwährend miteinander im Krieg liegen.«
»Erklär mir«, sagte Chryses, »wie wir diese Aussage ernst nehmen sollen, wenn sie von einem Mann kommt, der sich gerade über den Bürgerkrieg in Italien beklagt hat.«
Der Römer kam auf die Beine und lehnte sich über den Tisch. Sein großer, muskulöser Körper strahlte die Form von Brutalität aus, die sowohl erschreckend als auch anziehend auf wurzellose junge Männer und Frauen jeden Alters wirkt. In der gegenwärtigen Gesellschaft kam sie nicht an.
»Das war ein Überlebenskampf gegen einen Feind, der uns auszulöschen versuchte«, entgegnete der Römer. »Ihr Griechen seid Kinder, die sich um Spielsachen prügeln statt zu teilen.«
»In dem Fall ist Rom wohl der gierige große Bruder, der alles für sich haben will?« Chryses fixierte den Römer mit seinen schmalen Augen. »Wenn die Unterdrückten zahlreich genug werden, sind sie stark. Selbst wenn Aufruhr das Einzige ist, worauf sie sich einigen können.«
Ein schneller Blick in die Runde im Speisezimmer überzeugte den Römer davon, dass der Hohepriester für die meisten der kleinen Versammlung sprach. Unter den schwarzen Augenbrauen leuchtete ein wilder Blick in den hellgrauen Augen. Der Mann an seiner Seite legte eine Hand auf seinen Arm. Er war Ende dreißig, groß und hager mit einem markanten Gesicht und blonden Haaren, die am Haaransatz etwas lichter wurden. Seine wachen, dunkelbraunen Augen hatten die Diskussion aufmerksam verfolgt.
»Atticus, du musst Catilina vergeben«, sagte er mit einer Stimme wie eine schnurrende Katze. »Du warst viel zu geduldig mit ihm. Hier hast du uns Obdach und Essen gegeben und dann kommen wir und beleidigen deine Gäste. Ich hoffe, du wirst diese vorbehaltlose Entschuldigung annehmen. Nun ziehen wir uns lieber zurück. Gute Nacht, meine Herren. Danke für die gute Gesellschaft.«
Alle schwiegen, bis die Tür des Gästehauses auf der anderen Seite des Hofes ins Schloss gefallen war.
VI
»Jetzt, da deine römischen Gäste gegangen sind«, bemerkte der Getreidehändler und manövrierte seinen runden Körper vom Diwan hoch, »ist es vielleicht möglich, einen ordentlichen Stuhl zu bekommen, Atticus?«
Der Gastgeber hatte diesen Wunsch vorausgesehen. Auf sein Signal hin begannen zwei Sklaven, die Liegen an die Wand zu schieben. Auch Sarpedon und mir wurden Stühle angeboten.
»Wir sind wie gesagt nur gekommen, um meinen Sohn zu holen«, sagte ich und blieb stehen. »Wir wollen uns nicht länger aufdrängen.«
Atticus sah die übrigen Gäste an, die eben noch von den Sklaven platziert wurden. Er fasste einen schnellen Entschluss.
»Wenn ihr mich entschuldigen wollt, liebe Freunde. Ich bin sofort zurück.«
Er geleitete uns durch einen Flur zum hintersten Zimmer des Hauses. Wo du, mein einziger Sohn, dich weigertest, mich einzulassen, sodass ich durch die Tür mit dir sprechen musste. Ich glaube doch immer noch daran, dass das Gespräch in einer Art Versöhnung hätte enden können, wenn du etwas weniger respektlos aufgetreten wärest und ich selbst den Rat der stoischen Philosophen bezüglich erhabener Ruhe und Selbstbeherrschung beherzigt hätte. Aber wie du weißt, ließ ich die Gefühle mit mir durchgehen, und obwohl ich es seitdem mehrfach bereut habe, bin ich immer noch wütend darüber, dass du mir in Gegenwart von Zeugen die Irrtümer vorgeworfen hast, die deine Mutter und ich in unserer Jugend begangen haben, und die du selbst hundertfach überboten hast. Ich muss hinnehmen, dass du mich hasst, aber du kannst Aelia nicht vorwerfen, dass sie eine Wahrheit verborgen hielt, die zu erzählen ihr das Herz gebrochen hätte.
Zuletzt mussten Atticus und Sarpedon mich fortziehen, denn da war ich bereit, die Tür mit meinen bloßen Fäusten niederzureißen. Nach einem Becher Wein unter einem der Bäume im Garten fragte Sarpedon, ob es nicht doch eine gute Idee wäre, dich nach Rom ziehen zu lassen.
»Wie kannst du das vorschlagen?«, rief ich. »Mein Sohn soll nicht um die Welt reisen und sich in Lebensgefahr begeben!«
»Einem jungen Mann seines Alters tut ein Abenteuer nur gut«, wandte Atticus ein. »Und es muss ihn nicht in Gefahr bringen. Die Piraterie, die das Mittelmeer vor zehn Jahren zu einem unsicheren Gewässer gemacht hat, ist so gut wie ausgerottet. Demetrianus kann mit dem gleichen Schiff wie meine Ladung fahren. Der Schiffer ist ein grundehrlicher Mann. Ich werde ein Empfehlungsschreiben an Cicero verfassen, sodass dein Sohn seinen Stiefbruder treffen kann.«
Sein tiefer, aufrichtiger Blick traf meinen. Ich verstand, wie viel du ihm bereits anvertraut hattest. Und weshalb.
»Ich muss sagen, ich war verblüfft von dieser Verbindung zu hören«, fuhr er fort. »Sich vorzustellen, dass du, ein mazedonischer Arzt, der Stiefvater des Sekretärs meines besten Freundes bist. Wie kann es sein, dass Cicero dich nie erwähnt hat?«
Ich trank aus und betrachtete den Boden des Bechers, während ich überlegte, wie viel ich erzählen sollte.
»Es ist bald eine halbe Ewigkeit her, seit wir uns gesehen haben«, bemerkte ich nur. Man konnte sich vorstellen, dass ein schlechtes Gewissen den berühmten Advokaten davon abgehalten hatte, mich zu erwähnen. Seine Freundschaft hatte nämlich nicht für den Versuch gereicht, meine Exilstrafe zu verhindern. In seinen Augen hatte er jedoch sicher längst sein Versagen wiedergutgemacht. Hatte er vielleicht nicht meine lebensgefährlichen Nachforschungen unterstützt, weit über die Grenzen des Zumutbaren hinaus? Hatte ich nicht seine zukünftige Karriere in Gefahr gebracht, indem ich ihn zu dem Versuch überredet hatte, den Mörder des Volkstribunen zu entlarven? War es nicht mein eigener Übermut, der mich zu Fall gebracht hatte? Der Meister der Argumente hatte mit knapper Not seinen eigenen Freispruch erwirken können.
»Wer sagt im Übrigen, dass er sich nach zweiundzwanzig Jahren noch an mich erinnert?«, fragte ich.
Atticus zuckte die Achseln in einer umfassenden Geste.
»Cicero vergisst nie einen Freund. Wir kennen uns, seit wir Philosophie bei dem Akademiker Philon und Jurisprudenz bei dem Auguren Scaevola studiert haben. Meine Schiffsladung ist gerade an Cicero adressiert. Sie enthält meine besten Möbel und alle meine Bücher. Die würde ich nicht an jemanden schicken, dem ich nicht vertraue.«
»Wie kannst du deine Bücher entbehren?« Der Schullehrer Sarpedon war schockiert. »Und wieso deine Möbel nach Rom schicken?«
Atticus ärgerte sich einen Moment über seinen Versprecher. Dann fasste er einen Entschluss. Die Wahrheit würde ohnehin bald bekannt werden.
»Ich gebe mein Leben hier in Athen auf. Ich kehre in meine Geburtsstadt zurück.«
»Aber das kannst du nicht«, unterbrach Sarpedon, als ob die Abreise des Mäzens eine persönliche Beleidigung wäre.
Für einen Augenblick umgab den freundlichen Mann eine Aura aus Müdigkeit. Dann nahm er sich zusammen und lächelte wieder.
»Genau diese Reaktion ist der Grund dafür, dass ich die Reise geheim gehalten habe. Die Athener werden sicher versuchen, mich zum Bleiben zu überreden. Aber die Umstände zwingen mich. Cicero braucht alle Hilfe, die er kriegen kann.«
»Wofür?«, erkundigte ich mich.
»Weißt du nicht, dass er Konsul geworden ist?«
Sarpedon hatte das frische Gerücht vom Kai im Piräus im Herbst serviert. Mir war es schwergefallen zu verstehen, wieso ein erfolgreicher Advokat eine lukrative Karriere für die Fallgruben des Senats aufgeben wollte.
»Catilina, den du hier heute Abend getroffen hast, war letzten Sommer Ciceros Gegenkandidat«, erklärte Atticus. »Dieses Jahr lässt er sich wieder aufstellen. Sein einziges Wahlversprechen ist eine universelle Schuldensanierung. An verschuldeten Armen mangelt es nicht, daher ist es möglich, dass er dieses Mal gewinnt. Cicero ist davon überzeugt, dass es eine Katastrophe werden würde, wenn Catilina den mächtigsten Posten Roms bekommt. Man sagt, dass er sowohl seine Frau als auch seinen Sohn und seinen Schwager ermordet hat. Er soll sogar seine eigene Tochter vergewaltigt haben.«
Atticus ließ die Hand über den blonden Vollbart gleiten. Er starrte hinaus ins Nichts mit einem Blick, als ob er die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern trüge.
»Wie kannst du einen solchen Mann unter deinem Dach beherbergen?«, fragte Sarpedon.
Atticus lächelte und schüttelte den Kopf.
»Von hier aus ist es schwer zu entscheiden, wie viel Wahrheit in den Gerüchten aus Rom liegt. Unter allen Umständen habe ich es zu einer Regel gemacht, meine Gäste mit der gleichen Freundlichkeit zu behandeln, wie sie mir die Athener entgegengebracht haben.«
Das war eine einstudierte Phrase, die er tausende Male zuvor aufgesagt hatte. Ich verspürte ein widersinniges Bedürfnis, sie zu ergänzen.
»Und das hat dir die Möglichkeit gegeben, dir selbst eine Meinung über den Rivalen deines Freundes zu bilden.«
Atticus betrachtete mich mit einem neuen Blick, der gleichermaßen Überraschung wie Respekt beinhaltete.
»Wenn ihr keine weiteren Fragen habt«, sagte er, »würde ich gerne zu meinen Gästen zurückkehren.«
»Ich habe eine«, sagte ich.
»Was weißt du über Catilinas blonden Kameraden mit den braunen Augen?«
»Nichts, außer dass er einer der vornehmsten Adelsfamilien Roms entstammt. Sein Name ist Julius Caesar.«
VII
Wir bereuten es, Atticus’ Angebot ausgeschlagen zu haben, uns von einem seiner Sklaven mit einer Fackel eskortieren zu lassen. Obwohl Sarpedon und ich die schmalen Gassen kannten, mussten wir uns durch die Nacht tasten. Als wir nach Hause kamen, begegnete uns ein kopfloser Daimon, der zwanzig Zoll über der Erde schwebte, wenige Schritte von meiner Haustür entfernt. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich der Geist als die weiße Amtstracht eines breitschultrigen Polizisten. Die Dunkelheit hatte für einen Moment sein sonnengebräuntes Gesicht und seine Gliedmaßen mit der Hausmauer verschmelzen lassen.
»Wer von euch ist der Arzt Demetrios?«
Der breite skythische Akzent des Polizisten war unüberhörbar. Das Mondlicht enthüllte eine breite, unförmige Nase, die wie ein Klumpen Lehm von einem talentlosen Bildhauer in das sonst wohlproportionierte Gesicht einer Statue gepflanzt worden war.
»Ich bin Polizeihauptmann Skyros«, fuhr er fort, »die Eskorte für Richter Khitaides vom Areopag. Stimmt es, dass du heute einen ermordeten Jungen in einem Lagerhaus am Hafen untersucht hast?«
»Woher kannst du das wissen?«, erkundigte ich mich.
»Die Gerüchte haben den Areopag am frühen Abend erreicht. Richter Khitaides begab sich umgehend hierhin.«
Die Klatschlust meiner Mitbürger verblüffte mich nach wie vor. Ich griff nach der Türklinke. Der Polizeihauptmann legte die Hand darüber, um mich zu stoppen. Für einen Augenblick wirkte er unentschlossen, als überlegte er, mich zu warnen. Schließlich öffnete er die Tür für uns.
»Der Richter wartet.«
Im Schein der Öllampe hatte ein übergewichtiger Mann seinen schweren Körper meinem besten Stuhl anvertraut. Die farbenprächtigen Falten seines plissierten Chitons fielen in Wellen über die Armlehnen. Die Mundwinkel schoben die rotbackigen Wangen zu einem kühlen Lächeln, als er uns erblickte. Aelia und Philomela hatten anscheinend den vornehmen Gast Lydias Obhut überlassen und waren in die Küche verschwunden.
»Na, da bist du ja.« Lydia betrachtete mich mit einem höhnischen Lächeln. »Das wurde auch Zeit. Aber du kommst und gehst ja, wie du willst. Ich hatte dem Richter überhaupt nichts anzubieten. Wir haben ja nichts im Haus. Aber jetzt, wo du endlich zurück bist, werde ich ins Bett gehen.«
»Schlaf gut, Lydia.«
Der Richter verfolgte ihren Rückzug mit einer überraschten Grimasse. »Wie kannst du es zulassen, dass deine Sklavin so mit dir spricht? Und dann auch noch auf Latein!«
»Lydia ist keine Sklavin«, begann Sarpedon, »und sie stammt tatsächlich aus Rom.«
Der Richter ignorierte ihn demonstrativ.
»Dieses hässliche Weib ist doch wohl nicht deine Geliebte?«, fragte er mich.
»Lydia ist seit über zwanzig Jahren ein Teil unserer Familie«, entgegnete ich. »Sowohl meine Frau als auch mein Sohn verdanken ihr ihr Leben. Wir erlauben ihr, hier im Haus ihre Muttersprache zu sprechen. Ansonsten sprechen wir alle griechisch.«
Der Richter schüttelte den Kopf über diesen überflüssigen Strom an Auskünften und kam auf sein Anliegen zurück.
»Ich bin gekommen, um zu hören, wo ich den Verbrecher finden kann.«
»Was meinst du?«, fragte ich.
»Nicht so vertraulich. Du vergisst mein hohes Amt.«
Seine hochmütige Miene ließ keinen Zweifel daran, dass er das ernst meinte.
»Vergebt mir meine Ruchlosigkeit. Womit kann ich der Gerechtigkeit dienen, Euer Ehren?«
Ironie war an Richter Khitaides vergeudet.
»Das habe ich doch gesagt. Ich weiß bereits, dass du diese Jungenleiche untersucht hast, die heute im Piräus gefunden wurde.« Der Richter schien mir kein feinfühliger Mann zu sein. Trotzdem dämpfte er abrupt die Stimme, damit die Frauen in der Küche nicht die blutigen Details hören mussten. »Ich weiß, dass du die schreckliche Wunde des Opfers nicht für die Todesursache hältst, sondern einen Schlag gegen die Schläfe mit einem spitzen Gegenstand. Ich weiß, dass der Tatort nicht das Lagerhaus war, wo er gefunden wurde. Und ich weiß, dass der Mörder ein sechs Fuß großer Mann war. Nicht wahr?«
Einen Augenblick lang hatte er mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Hinter mir schnappte Sarpedon überrascht nach Luft.
»Woher kann der Richter das wissen?«
Khitaides lächelte selbstzufrieden und wechselte die Position. Der Stuhl knarrte unter seinem Gewicht. Er wedelte mit der Wachstafel, die ich auf dem Tisch liegen gelassen hatte.
»Wenn du nicht willst, dass Fremde deine Gedanken kennen, ist es unklug, sie aufzuschreiben, nicht wahr? Wie lautet der Name des Mörders?«
Die Informationen waren am nächsten Morgen auf seinem Tisch gelandet. Für meine Verunsicherung gab es keinen Grund. Trotzdem ließ sie mich nicht los.
»Keine Ahnung«, erwiderte ich.
»Lass die Polizei ihn finden.«
»Du hast dir doch wohl nicht vorgestellt, dass die Polizei einen Mord aufklären soll?« Richter Khitaides ließ diesen widersinnigen Satz einen Moment in der Luft hängen, bevor er fortfuhr: »Wir können doch nicht einen Haufen Ex-Sklaven Nachforschungen bezüglich guter athenischer Bürger anstellen lassen.«
Der Richter belehrte mich darüber, dass das Polizeikorps, das aus freigelassenen, ausgeschlossenen Existenzen bestand, um Ruhe und Ordnung zu sichern, verbannte Verbrecher zur Stadtgrenze brachte und die zum Tode Verurteilten bewachte. Einmal war ihre wichtigste Aufgabe gewesen, widerwillige Bürger zu Volksversammlungen in der Pnyx zu zwingen, aber diese Zeit war längst vorbei.
»Dann will der Richter die Nachforschungen also persönlich leiten?«
Er schüttelte den Kopf, sodass sein Doppelkinn bebte.
»Ich bin viel zu beschäftigt, um mich mit so etwas zu befassen. Jeden Monat werden etliche Gerichtsverhandlungen abgehalten. Diese Arbeit übersteigt bereits die Zeit, die ich zur Verfügung habe, nicht wahr? Soll ich das so verstehen, dass du die Identität des Mörders nicht kennst?«
»Die Leiche wurde erst heute Morgen gefunden. Es war Zufall, dass ich dazugerufen wurde.«
»Warum befandest du dich im Piräus?«
»Ich habe meinen Freund Sarpedon besucht.«
»Das ist vermutlich er dort?«
»Ich bin Pädagoge aus Lykien«, antwortete Sarpedon, »und Eigentümer der besten Schulstuben der Hafenstadt.«
Es erleichterte mich, dass Khitaides seine Aufmerksamkeit auf ihn richtete.
»Du bist Ausländer? Und du kanntest den Ermordeten? War er einer deiner Schüler?«
»Ich habe den Jungen noch nie zuvor gesehen, Euer Ehren.«
»Das Opfer stammt nicht unbedingt vom Piräus«, unterbrach ich.
»Außerdem nimmt Sarpedon nur die Söhne freier Bürger als Schüler an. Der Junge im Lagerhaus war ein Sklave.«
»Wie kannst du das wissen?« Die schmalen Augen des Richters musterten mich aufmerksam.
»Das Opfer trug Spuren von einem Sklavenhalsring, der sicher entfernt wurde, um seine Identität zu verbergen. Das konnte der Richter nicht wissen, da ich vergaß, es in meine Notizen zu schreiben.«
Khitaides fegte die Wachstafel mit einem Knall vom Tisch. Seine Geduld war erschöpft.
»Nachdem es deutlich ist, dass du ein einfacher Mann ohne die geringste Ahnung von allgemeinen Rechtsprinzipien bist, werde ich Gnade vor Recht ergehen lassen. Dieses Mal. Aber wenn du meine Zeit nochmals mit Bagatellen vergeuden solltest, werde ich meine Polizisten bitten, sich liebevoll um dich zu kümmern.«
»Bagatellen?«, wiederholte ich. »Jemand hat den Jungen aufgeschlitzt und seine Eingeweide ausgeräumt.«
»Das kann der Besitzer gewesen sein, der es für angemessen hielt, seinen Sklaven auf diese Weise zu bestrafen. Was sein gutes Recht ist, nicht wahr? Falls ein anderer den Jungen totgeschlagen hat, ist die Rede von einer Verletzung des Eigentumsrechts. In diesem Fall ist das Heliaia-Gericht dafür zuständig, über die Schadensersatzklage zu befinden. Aber für einen Sklavenmord kann nie das heilige Blutgericht des Areopags zuständig sein.«
VIII
Mit einem Schlag klatschte die Gerstengrütze in meinen Teller.
Aelia hatte meine Unterhaltung mit Richter Khitaides am Abend zuvor mit angehört und war immer noch verärgert. Darüber hinaus hatte die Mitteilung, dass es mir nicht gelungen war, dich zu überreden in Athen zu bleiben, sie hart getroffen. Lydias Ansage, dass sie sich einen halben Tag frei nehmen müsse, um sich von dieser unzumutbaren Nachtwache zu erholen, hatte auch dem letzten Rest der guten Laune deiner Mutter den Garaus gemacht.
Ich sah die Frau an, mit der ich seit über zwanzig Jahren zusammenlebte. Die Nase zeichnete immer noch einen anmutigen Bogen, wie eine Brücke zwischen Gedanken und Lippen. Die Lachfalten in den Wangen waren zu länglichen Furchen geworden, während die Gesichtshaut nach den vielen Jahren Hausarbeit drinnen blass und dünn wie Pergament schien. Das dicke, dunkle Haar, durch das mit den Fingern zu fahren ein Vergnügen gewesen war, war nun grausträhnig und im Nacken zu einem strammen Zopf geflochten.
»Wo ist Sarpedon?«, fragte ich.
»Er ist bei Tagesanbruch zur Akropolis gegangen«, antwortete sie. »Er wollte eine Reinigung kaufen.«
Ich hatte ihr von dem Angebot des Hohepriesters Chryses berichtet, als wir am Abend zueinandergekrochen waren. Es sah Sarpedon gar nicht ähnlich, das Angebot anzunehmen, wenn andere Priester ein Zehntel verlangten.
»Du müsstest das Gleiche tun.« Ihr Ratschlag klang wie ein Befehl.
»Ich habe diesen toten Jungen kaum angerührt«, widersprach ich.
»Das spielt keine Rolle, wenn die Leute glauben, dass du unrein bist. Es ist dumm, sich gegen die Bräuche der Athener zu stellen. Das weiß ich nur zu gut.« Sie wechselte das Thema, bevor ich dazu kam, ihre Erfahrungen zu kommentieren. »Du hast übrigens einen Patienten.«
»Nur einen?«
Ihr Blick sprach Bände. »Er ist Römer. Und er ist neugierig. Ich hatte ihn gerade erst in den Hofgarten gebeten, da begann er schon, Konversation zu betreiben. Das ist gewiss das beste Wort dafür. Eine lange Zeit verging, bis ich merkte, dass er mich ausfragte. Er wirkt auch nicht weiter krank. Und nun sitzt er dort draußen mit unserer Tochter.«
»Wieso hast du ihn nicht reingerufen?«
»Es wäre unhöflich gewesen, ihn allein sitzen zu lassen.«
Durch das Guckloch konnte ich sie auf der Bank unter der Pergola sehen. Der Gast saß mit dem Rücken zu mir. Er und Philomela waren in ein Gespräch über den Diktator Sulla und seine Belagerung der Stadt vor zweiundzwanzig Jahren vertieft.
»Alle hier hassen Sulla«, meinte sie. »Sie sagen, er sei die schlimmste aller Plagen Athens.«
»Ach, ich weiß ja nicht.« Nun erkannte ich die Stimme des Gastes vom Abend zuvor. »Sulla war einfach ein alter Mann mit mehr Macht, als er handhaben konnte.«
»Bist du ihm begegnet?«
»Nur ein paar Mal. Er wollte, dass meine Frau und ich uns scheiden lassen, damit er mich in seine Familie einheiraten lassen konnte. Aber das hätte meine Freunde zu meinen Feinden gemacht. Daher habe ich abgelehnt. Zu guter Letzt musste er aufgeben.«
»Also bist du immer noch verheiratet?«
Die Enttäuschung in der Stimme meiner Tochter ließ mich den Griff um den Riegel auf der Innenseite verstärken. Bevor ich das Gespräch in dem kleinen Garten unterbrach, wollte ich jedoch verstehen, was der Gast zu erreichen versuchte.
»Meine erste Frau ist leider im Wochenbett gestorben«, sagte er. »Aber ich habe erneut geheiratet. Pompeia, Sullas Enkelin.«
»Also hat der Diktator trotzdem seinen Willen bekommen?«
»Kann man so sagen. Aber erst zu einem Zeitpunkt, als es für mich günstig war. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?« Die Stimme des Mannes wurde zu einem vertraulichen Flüstern. »Ich traue Pompeia nicht. Sie hat den gleichen schwachen Charakter wie ihr Großvater. Vielleicht ist sie gerade jetzt, zu Hause in Rom, mit einem anderen Mann zusammen.«
»Dann musst du doch die Scheidung fordern!«
»Das würde mich zu viele Unterstützer im Senat kosten. Es ist praktischer so zu tun, als ob nichts wäre.«
Philomela legte den Kopf schräg und kniff die Augen zusammen.
»Du hast dich also geweigert, in die Familie des Diktators einzuheiraten, solange er am Leben war. Aber nach seinem Tod hast du seine Enkelin geheiratet, weil es deiner Karriere dienlich war. Und jetzt bist du an sie gebunden.«
»So etwas in dieser Richtung«, bestätigte er, überrascht über diese scharfe Analyse. »Du bist doch ein kluges Kind.«
»Ich bin kein Kind. Ich werde im Herbst vierzehn. Mein Vater sagt, dass ich für mein Alter sehr vernünftig bin. Viel zu vernünftig, um mir von Fremden eine Menge Blödsinn aufschwatzen zu lassen.«
Der Mann beugte sich vor. Als die Morgensonne ihn traf, war durch das dünne, blonde Haar deutlich die braungebrannte Kopfhaut zu sehen. Innerhalb von zehn Jahren würde er der Inhaber einer hübschen kleinen Glatze sein. Er legte eine breite, sehnige Hand auf Philomelas Wange. Unwillkürlich schmiegte sie sich hinein.
»Ich bin kein Fremder«, schnurrte er. »Wir beide haben uns jeweils ein Geheimnis erzählt. Du kannst ruhig glauben, was ich sage. Weil du mir doch vertraust. Oder?«
»Philomela, hilfst du deiner Mutter bitte, den Tisch abzuräumen?«
Deine Schwester zuckte, als sie mich in der Tür erblickte. Ich schloss sie heftig hinter ihr. Der Gast betrachtete mich einen Augenblick mit schräggelegtem Kopf, bevor er aufstand, die rechte Hand gegen die Brust schlug und sie zu einem römischen Gruß hob.
»Welches Geheimnis hat meine Tochter dir erzählt, Caesar?«, fragte ich auf Latein.
Die Kiefermuskeln spannten sich in dem scharfgezeichneten Gesicht an. Er verbarg seine Überraschung mit einem Husten.
»Deine Tochter hat mir nichts gesagt, was ich nicht schon wusste, Demetrios. Nur, dass ihr Bruder von zu Hause weggelaufen ist und sich bei Atticus versteckt hat und dass du ihn nicht verhauen und nach Hause gezwungen hast, wie es ein römischer Pater familias getan hätte. Ihr Griechen seid ein Quell steter Verwunderung. Ich bin auch überrascht von dem Aussehen der Stadt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass Athen eine pulsierende Metropole wäre. Aber keines der Häuser ist mehr als zwei Stockwerke hoch und die berühmte Agora erinnert an einen Baugrund.«
»Die Erdbebengefahr hindert uns daran hoch zu bauen. Und mit deiner Bekanntschaft zu Sulla weißt du sicher, dass er das ganze Viertel um den Marktplatz zerstört hat, als er die Stadt eingenommen hat. Du würdest weniger Zeit vergeuden, wenn du dich damit begnügen würdest, die Fragen zu stellen, auf die du in Wirklichkeit eine Antwort haben möchtest, Caesar.«
Sein warmes Lächeln machte es mir schwer, meinen Widerwillen aufrecht zu erhalten.
»Mein Kamerad Catilina und ich hätten heute mit Atticus’ Schiff nach Hause reisen sollen. Der tote Junge im Piräus hat unsere Abreise verzögert. Wer wohl diese Untat begangen haben kann? Und weshalb?«
Ich betrachtete ihn schweigend, während ich über eine Antwort nachdachte.
»Vom Motiv mal abgesehen ist der Mörder sicher längst über alle Berge.«
»Warum glaubst du das?«
»Weil es dumm wäre, hier zu bleiben, nachdem man so ein Verbrechen begangen hat.«
Caesar nickte langsam und streckte schließlich die Hand zum Abschied aus.
»Du hast zweifelsohne Recht, Demetrios. Du musst entschuldigen, dass ich dich und deine Familie behelligt habe. Pace.«
»Komm gerne wieder, wenn deine Gesundheit zu schwächeln beginnt, Caesar. Aber so lange du gesund und munter bist, würden wir Wert darauf legen, in Frieden gelassen zu werden.«
Es klopfte an der Gartentür. Als ich öffnete, starrte mir Sarpedon mit einem wilden Blick in die Augen.
»Sie haben noch einen toten Jungen gefunden«, keuchte er atemlos. »In Kerameikos.«