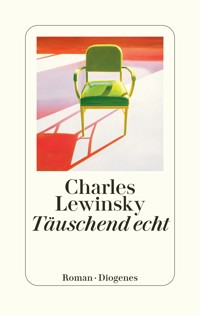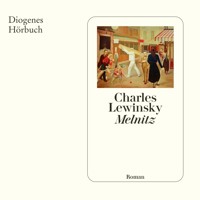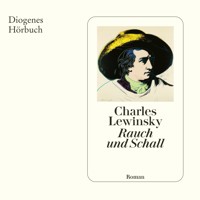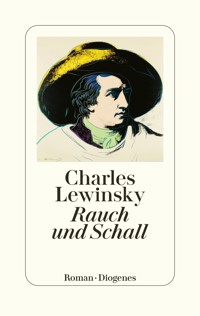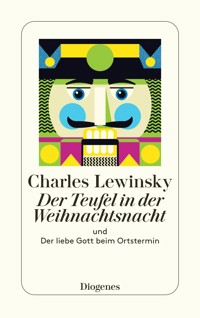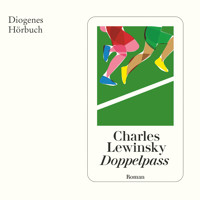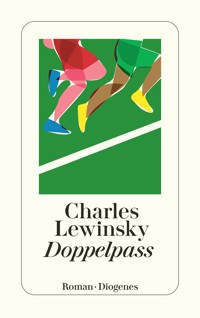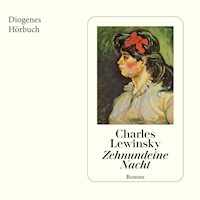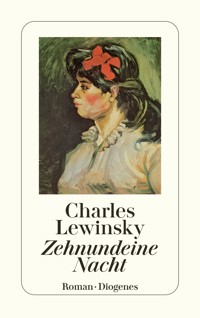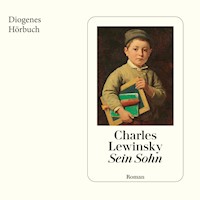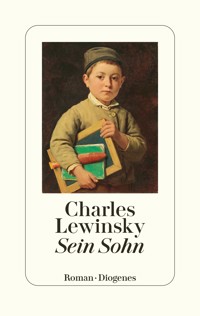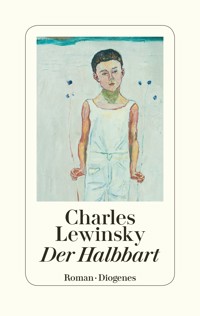
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Sebi ist nicht gemacht für die Feldarbeit oder das Soldatenleben. Viel lieber mag er Geschichten. Im Jahr 1313 hat so einer es nicht leicht in einem Dorf in der Talschaft Schwyz, wo Engel kaum von Teufeln zu unterscheiden sind. Vom Halbbart, einem Fremden von weit her, erfährt er, was die Menschen im Guten wie im Bösen auszeichnet – und wie man auch in rauen Zeiten das Beste aus sich macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charles Lewinsky
Der Halbbart
Roman
Diogenes
Für meinen Bruder Robert,
mit dem ich das Fabulieren
schon früh geübt habe
He must have a long spoon
that must eat with the devil.
William Shakespeare,
Comedy of Errors
Das erste Kapitel
in dem der Halbbart ins Dorf kommt
Wie der Halbbart zu uns gekommen ist, weiß keiner zu sagen, von einem Tag auf den anderen war er einfach da. Manche glauben sicher zu wissen, man habe ihn am Palmsonntag zum ersten Mal gesehen, andere behaupten steif und fest: Nein, am Karfreitag sei es gewesen. Sogar zu einer Schlägerei ist es deshalb einmal gekommen.
Nach der Fastenzeit wollen die Leute den angesparten Durst loswerden, und so hat der Kryenbühl Martin einem Säumer zwei Fässer Wein abgekauft, ein kleines mit Malvasier und ein großes mit Räuschling, und in diesem Räuschling, habe ich berichten hören, sei der Fremde versteckt gewesen, habe sich zusammengerollt, klein wie ein Siebenschläfer, wenn der sich tagsüber in einem toten Baum verkriecht, und sei dann um Mitternacht durch das Spundloch hinausgeschloffen und wieder zu seiner vollen Größe angeschwollen, mit einem Geräusch, wie wenn ein Sterbender sich den letzten Atem abpresst. Aber der das erzählt hat, war der Rogenmoser Kari, der nach dem fünften Schoppen auch schon gesehen hat, wie der Teufel aus dem Ägerisee aufstieg mit feurigen Augen. Andere sagen, der Fremde sei vom Berg heruntergekommen, damals beim kleinen Felssturz, und sei dann ein ganzes Jahr in dem Steinhaufen liegen geblieben, von keinem bemerkt, vom Staub zugedeckt wie ein Wintergrab vom Schnee. Mitten zwischen den Felsbrocken sei er die Fluh heruntergepoltert, sagen sie, und habe sich dabei wie durch ein Wunder keinen einzigen Knochen gebrochen, nur das Gesicht habe es ihm vertätscht, die rechte Hälfte, darum sehe er so aus, wie er aussieht. Mit eigenen Augen hat es keiner von denen gesehen, die darauf schwören, aber eine gute Geschichte hört man immer gern, wenn die Nächte lang sind und das Teufels-Anneli in einem anderen Dorf.
Ich glaube ja, er ist ganz gewöhnlich zu Fuß gekommen, nicht gerade auf dem breiten Weg von Sattel herunter, aber an den Abhängen sind genügend Steige, auf denen man von niemandem gesehen wird, das wissen bei uns nicht nur die Schmuggler. Natürlich, für einen Fremden sind solche Pfade nicht leicht zu finden, aber wenn er wirklich ein Flüchtling ist, wie es heißt, dann wird er eine Nase dafür haben. Wenn einer lang genug hat weglaufen müssen, dann versteckt er sich mit der Zeit ganz von selber, wie eine Katze, der die Buben Steine nachwerfen, und die darum Umwege macht, über die Dächer oder durchs Gebüsch.
Woher er geflohen ist und warum, das weiß keiner. Irgendwann war er einfach da, im Dorf und doch nicht im Dorf, exakt an der Grenze von innerhalb und außerhalb. Ein Flüchtling, denke ich, bekommt mit der Zeit ein Gschpüri für Grenzen und erkennt sie, auch wenn da keiner steht und den Wegzoll einfordert. Ich meine, jeder Mensch kann besondere Fähigkeiten entwickeln, ohne dass es immer gleich Zauberei sein muss. Die Iten-Zwillinge, die man immer nur zusammen sieht, brauchen an einer trächtigen Kuh nur zu riechen und können unfehlbar sagen, ob es ein Stierkalb oder ein Kuhkalb geben wird. Manche Leute lassen die beiden auch kommen, wenn die eigene Frau in der Hoffnung ist; so ein Bauer, der schon fünf Kinder hat und noch immer keinen Erben, will Bescheid wissen, wenn es wieder nur ein Mädchen werden soll, damit er rechtzeitig nach Ägeri zur Kräuterfrau schicken kann; die weiß nicht nur, wie man Kinder zur Welt bringt, sondern auch das Gegenteil. Als kleine Buben sind wir vor ihr weggelaufen, weil es geheißen hat, mit ihren letzten Zähnen kann sie einen totbeißen, aber heute denke ich: Sie ist eine ganz gewöhnliche Frau, nur eben eine mit Erfahrungen.
Wie gesagt, eines Tages war der Halbbart da. Er hat sich, ohne jemanden zu fragen, den richtigen Ort ausgesucht, einen Plätz, der niemandem die Mühe wert ist, darum zu streiten. Direkt am Rand vom oberen Klosterwald, dort wo der Hang stotzig wird und höchstens die Geißenhirten oder die alten Weiblein beim Holzsammeln vorbeikommen, hat er auf zehn Fuß die Brombeersträucher und den Liguster ausgerissen, mit bloßen Händen, sagt man, was ich aber nicht glaube, man hätte ihn sonst bluten sehen müssen wie die zehntausend Märtyrer nach dem Sturz in die Dornen. Wie auch immer, er hat sich dort etwas hingebaut, nicht länger als ein Strohsack und nicht breiter als ein Mann mit ausgebreiteten Armen. Beim Geißenhüten haben wir auch solche Unterstände aufgestellt, gegen den Regen mit Zweigen abgedeckt. Lang hat man für so einen nicht gebraucht, aber keiner von uns wäre auf den Gedanken gekommen, dort zu wohnen. Ihm scheint es zu genügen, auch wenn er dort im Winter bestimmt friert wie ein armer Sünder. Ein Feuer kann er nur draußen machen, und dann muss er noch aufpassen, dass es ihm nicht seine Hütte abbrennt.
Der Steinemann Schorsch hat seinen Hungerhof weiter unten am Hang, und einmal, an einem eisigen Tag, hat er den Fremden zur Hilfe holen müssen, weil genau in der Stunde, als seine Frau das erste Kind bekam, auch die Kuh hat kalbern wollen. Es wird nicht exakt so gewesen sein, aber hinterher hat er erzählt, er habe den Fremden steifgefroren angetroffen, hart wie ein Brett, und habe ihn den Hang hinunter hinter sich herziehen müssen wie einen Schlitten. Zum Auftauen habe er ihn bei sich zu Hause an den Tisch gelehnt, direkt vor dem großen Suppenkessel, und es habe gar nicht lang gedauert, da habe er sich schon wieder bewegt und auch zugepackt, und zwar wie einer, der sich auskennt, es könne nicht das erste Mal gewesen sein, dass er bei einer Geburt geholfen habe. Hinterher, sagt der Steinemann, sei der Halbbart vor der Feuerstelle gekniet und habe sich nicht nur gewärmt, sondern die Hand tief in das Feuer hineingestreckt, so dass es richtig Blateren gegeben habe. Aber das hat bestimmt nur so ausgesehen, und Krusten an der Hand wird er auch schon vorher gehabt haben.
Er ist ein komischer Vogel, der Halbbart. Es sagen ihm alle so; seinen richtigen Namen kennt keiner. Im Dorf haben fast alle einen Übernamen. Wenn man vom Eichenberger Meinrad redet, sagt man immer »der kleine Eichenberger«, weil er drei ältere Schwestern hat, alle schon in anderen Dörfern verheiratet, und er ist als Nachzügler gekommen, als sein Vater schon nicht mehr daran geglaubt hat, er könne doch noch einen Sohn bekommen, der Gisiger Hänsel, der so gut trommeln kann, heißt Schwämmli, weil er seit einer Schlägerei so ein komisches Ohr hat, und mir sagen sie Stündelerzwerg, nur weil ich einmal ein paar Wochen lang jeden Tag zur Messe nach Sattel hinaufgelaufen bin, aber das war nicht wegen der Frömmigkeit, sondern wegen dem Hasler Lisi. Die hat mir gefallen, aber ich ihr nicht; mit kleinen Buben wolle sie nichts zu tun haben, hat sie gesagt. Ich habe ihr vorgeschlagen zu warten, bis ich zwölf sei, aber das wollte sie nicht und hat mich ausgelacht. Als ihr dann der dicke Hauenstein ein Kind gemacht hat, bin ich nicht mehr hingegangen.
Also, der Halbbart. Man nennt ihn so, weil ihm der Bart nur auf der einen Seite des Gesichts wächst, auf der anderen hat er Brandnarben und schwarze Krusten, das Auge ist dort ganz zugewachsen. Am Anfang haben ihn manche Leute Melchipar genannt, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Der Name kam daher: Wenn der Halbbart nach links schaut, und man von seinem Gesicht nur die Hälfte mit dem Bart sieht, dann erinnert er an den Melchior auf dem gestickten Banner mit den heiligen drei Königen, das in der Prozession zu Epiphanias mitgetragen wird. Wenn er aber den Kopf in die andere Richtung dreht, und man sieht die Hälfte ohne Bart, die mit den schwarzen Krusten, dann denkt man an den Negerkönig Caspar. Halb Melchior und halb Caspar, deshalb Melchipar. Aber der Name war zu kompliziert, und man hat sich auf Halbbart geeinigt. Ich würde gern wissen, wie solche Entscheidungen eigentlich getroffen werden. Ich frage mich auch, was so ein Name mit dem Menschen macht, dem er angehängt wird. Ich selber zum Beispiel: Seit man mich den Stündelerzwerg nennt, denke ich daran, einmal ins Kloster zu gehen, nicht aus besonderer Frömmigkeit, aber als Mönch hat man ein sicheres Auskommen, und wirklich hart arbeiten muss man dort auch nicht, glaube ich. Und bei der Profess bekommt man vom Abt einen neuen Namen. Mein Taufname hat mir nie gefallen. Eusebius – das war so eine Spinnerei von meinem Vater. Er hat den Namen in einer Predigt aufgeschnappt und sich gemerkt. Ich kann mir Sachen auch gut merken; so etwas geht manchmal auf die nächste Generation über. Meine älteren Brüder heißen Origenes und Polykarp, aber es sagt ihnen keiner so, sonst bekommt er aufs Maul, vor allem vom Poli; der prügelt sich gern, ganz anders als ich. Wenn der Vater sich damals nicht auf der Gemsjagd das Genick gebrochen hätte, würde er eine Schwester Perpetua genannt haben, sagt unsere Mutter, das hatte er sich schon ausgedacht.
Dem Halbbart ist es egal, wie man ihn nennt, das hat er mir selber gesagt. Man kann ganz normal mit ihm reden, auch wenn manche Leute im Dorf behaupten, ihm sei auch die halbe Zunge weggebrannt, und er könne nur lallen wie der Tschumpel-Werni, der keinen richtigen Verstand hat, sich vor allen Leuten zum Scheißen hinhockt und dann in die Hände klatscht und stolz auf die Sauerei zeigt, die er gemacht hat. Der Halbbart kann sogar sehr gut reden, er tut es nur nicht gern und schon gar nicht mit jedem. Ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen, weil ich einmal beim Pilzen zufällig gesehen habe, wie er Heckenkirschen gepflückt hat. Weil ich gemeint habe, er will sie essen, bin ich hingerannt und habe sie ihm aus der Hand geschlagen, weil sie giftig sind. Ich habe zu spät überlegt, dass ich ihn auch mit Worten hätte warnen können; selbst wenn ihm die Zunge wirklich weggebrannt wäre, hätte ihn das ja nicht am Hören gehindert. Er ist aber nicht wütend geworden, sondern hat verstanden, dass ich es gut gemeint habe, und hat sich sogar bedankt. Das mit dem Gift habe er gewusst, gerade darum habe er die Heckenkirschen gepflückt, er habe seit ein paar Tagen nicht mehr richtig seichen können, und da hülfen sie dagegen. Er spricht ein bisschen kurlig, nicht so, wie man es bei uns gewohnt ist, aber man versteht ihn.
Ich glaube, er kann auch lesen, er wäre der Einzige im Dorf. Im Kloster bringen sie es einem bei, was auch wieder ein Grund wäre, dort einzutreten. Latein müsste man allerdings auch noch lernen, denn außer der Bibel und dem Psalter gibt es, soweit ich weiß, keine Bücher. In der Kirche oben in Sattel sieht man den Halbbart nur am Sonntag, wenn alle hingehen müssen, und er steht immer ganz zuhinterst, bei den Bettlern und den Schorfigen. Aber die Bibel scheint er trotzdem zu kennen. Nicht, dass er mir das gesagt hätte, er erzählt nicht gern von sich, aber einmal hat er sich verschnäpft. Ich habe ihn gefragt, ob es ihn nicht stört, dass ihn die Leute Halbbart nennen, er hat gelacht, dieses kaputte Lachen, das er immer hat, und hat gesagt: »Es gibt zu viele Namen und zu wenig Menschen dafür. Aber du kannst den Leuten sagen, ich komme aus einer berühmten Familie. Irad zeugte Mahujael, Mahujael zeugte Methusael, Methusael zeugte Lamech.« Verstanden habe ich das nicht, aber mir gemerkt, so wie sich mein Vater die Namen für seine Kinder gemerkt hat. Unsere Mutter sagt, mein Gedächtnis ist noch besser als seines.
Wegen der seltsamen Namen habe ich nach der Messe den Herrn Kaplan gefragt, ob er sie schon einmal gehört hat oder ob sie einfach nur Blödsinn sind, und er hat kaum glauben können, dass ich sie noch wusste. Er habe sie einmal in einer Taufpredigt aus der Bibel vorgelesen, das sei aber mehr als ein Jahr her, und dass ich sie immer noch im Kopf habe, das sei eine Begabung, und ich müsse dem lieben Gott dafür dankbar sein. Er hat mir über die Haare gestrichen, was mir nicht angenehm war, weil ich wieder einmal Läuse hatte. Dann hat er mich noch gefragt, warum man mich nicht mehr so oft in der Kirche sieht, außer am Sonntag, und ich konnte ihm ja nicht gut sagen, dass es wegen dem Hasler Lisi ist und wegen dem Kind, das ihr der Hauenstein gemacht hat. Zum Glück hat er nicht weiter nachgefragt, sondern hatte mir nur einen Vorwurf machen wollen und gar keine Antwort erwartet.
Ich besuche den Halbbart gern, aber es ist nicht so, dass wir Freunde wären. Der alte Eichenberger, der schon über fünfzig ist und seine Familie immer noch regiert wie ein Junger, hatte mal einen Hund, der gehorchte ihm aufs Wort, apportierte einen Stock oder bellte einen Fremden in die Flucht. Das Tier hat sich vom Eichenberger schlagen lassen, ohne sich zu wehren, nur wenn der ihn streicheln wollte, hinter den Ohren kraulen oder so, dann hat der Hund die Zähne gezeigt. Ich weiß auch nicht, warum ich beim Halbbart daran denken muss.
Das zweite Kapitel
in dem der Sebi das Roden schwänzt
Heute Abend werde ich verprügelt, das ist normal, denke ich, wenn man zwei ältere Brüder hat. Ich muss nur aufpassen, dass es der Geni ist, der mich erwischt, und nicht der Poli. Der Geni ist der Älteste von uns dreien, auch der Vernünftigste, bei ihm kann man sicher sein, dass er einem nicht einen Zahn aus dem Maul haut oder noch Schlimmeres; manchmal blinzelt er mir sogar zu, während er mich schlägt. Er kommt in seiner Art nach dem Vater, sagt unsere Mutter, der habe auch immer bei allem zuerst nachgedacht und dann erst die Sachen angefangen. Einmal hat mir der Geni ein Wasserrad geschnitzt, da hat er vorher ganz lang überlegt, wie er es machen muss, aber dann hat es sich wirklich gedreht im Bach. Wenn dagegen der Poli das Prügeln anfängt, dann sieht er rot, er hat es selber einmal so beschrieben, und hört mit Zuschlagen nicht auf, bis der andere sich nicht mehr rührt, und auch dann nicht immer. Für die anderen Buben im Dorf ist er deshalb ein Held; sie wollen sein wie er und machen alles, was er sagt, die einen aus Angst und die anderen aus Bewunderung. Am allermeisten bewundert ihn der Gisiger Hänsel, obwohl der Poli doch schuld ist an dem seinem Schwämmliohr. Wenn es zu einer Schlägerei kommt, im Dorf oder gegen die aus Sattel oder Ägeri, dann ist der Poli immer der Vorderste. Unsere Mutter hat schon mehr als einmal gesagt: Wenn sie ihn eines Tages tot nach Hause bringen, dann hat er noch Glück gehabt, weil wenn sie ihm die Knochen so kaputtschlagen, dass er nicht einmal mehr den Pflugsterz festhalten kann, dann wäre es besser für ihn, er hätte gleich das Viaticum bekommen. Der Poli lacht dann nur und sagt, er denke nicht daran, sein Leben lang als Ackerknecht den Rücken krumm zu machen, er gehe einmal zu den Soldaten, da könne man ein lustiges Leben führen, und wenn er dann ins Dorf zurückkomme, bringe er einen Sack Geld mit, und zwar nicht Batzen, sondern Dukaten. Sein Vorbild ist der Onkel Alisi, der jüngere Bruder unserer Mutter, der auch Soldat geworden ist und schon in vielen Ländern gekämpft hat. Als ich noch ganz klein war, ist er einmal für ein paar Tage ins Dorf zurückgekommen; die Leute reden heute noch davon, wie groß und stark er gewesen sei und dass er seine Batzen verstreut habe wie der Sämann das Korn. Ich selber kann mich nur erinnern, dass er mich in die Luft geworfen und wieder aufgefangen hat. Nach Schweiß hat er gerochen und nach Branntwein, und mir hat er Angst gemacht. Dann ist er in den nächsten Krieg gezogen, und wir wissen nicht, ob er noch lebt. Bei Soldaten kann man da nie sicher sein.
Dass ich heute Prügel bekomme, ist so sicher wie der Winter nach dem Herbst. Ich bin nicht zum Roden mitgegangen, obwohl bekanntgegeben wurde, dass das ganze Dorf hinmüsse, die Männer und die Buben, auch die jüngeren. Man sieht hier zwar selten einen von den Klosterleuten, »hinter den Bergen sind die Herren am schönsten«, sagt man; wir sind keine Eigenleute, aber der Wald gehört ihnen, auch wenn wir ihn nutzen dürfen, und wenn sie rufen, müssen wir kommen. Wenn ein Befehl zur Waldarbeit gegeben wird, kann man zwar herumschimpfen, aber machen muss man es trotzdem, dafür dürfen wir im Wald die Schweine weiden und die Klosterochsen, die eigentlich nur für die Waldarbeit da sind, zum Pflügen der eigenen Felder benutzen, das ist die Abmachung, nicht aufgeschrieben, aber gültig. Dass die Mönche ihren Wald roden lassen, sei etwas Neues, sagt unsere Mutter, früher habe es das nicht gegeben. Sie wollten dort wohl eine Weide für Kühe machen, denn die seien in den letzten Jahren so wertvoll geworden, als ob sie goldene Fladen scheißen würden, und wer mehr Kühe zum Verkaufen haben wolle, müsse eben auch mehr Weiden haben und also weniger Wald.
Mit der Reuthaue Wurzelstöcke ausgraben, das ist nichts für mich. Ich finde, wenn sie einem schon immer sagen, man sei ein Finöggel, dann darf man sich auch benehmen wie einer; den Spott haben und den Schaden dazu, das wäre nicht gerecht. Wenn ich wirklich einmal Mönch werde, will ich im Kloster nicht im Stall arbeiten müssen, sondern das Schreiben lernen. Ein noch besseres Leben, hat man mir erzählt, haben dort nur die Sänger, aber seitdem meine Stimme angefangen hat, sich zu verändern, muss ich an so etwas gar nicht denken. Der Geni sagt, ich sei gar kein Mensch mehr, sondern ein Rabe. Er lacht aber, wenn er so etwas sagt, und meint es nicht böse.
Überhaupt habe ich den Halbbart wieder einmal besuchen wollen. Es hat lang geregnet, und da kann er so viel Zweige oben draufgelegt haben, wie er will, es wird in seinem Unterstand trotzdem gewesen sein, als ob er mit der Kutte über dem Kopf unter einem Wasserfall hockt. Heute ist das Wetter zum ersten Mal wieder schön und warm. Meinen Brüdern habe ich gesagt, dass mir ganz fest gschmuuch im Bauch sei, ich wisse nicht woher, dass ich vor dem Roden noch einmal gründlich scheißen müsse, sie sollten schon einmal ohne mich vorausgehen, ich würde sie schon einholen. Und bin dann in die andere Richtung gelaufen. Wenn das ganze Dorf am selben Ort arbeitet, habe ich mir überlegt, kann einen keiner erwischen, wenn man woanders ist.
Auf dem Weg habe ich Walderdbeeren gesammelt, rote und weiße, in dem Körbchen, das der Geni einmal aus Schilfblättern geflochten hat. Der Geni kann alles.
Wie ich näher zu seiner Beinahe-Hütte gekommen bin, habe ich den Halbbart singen hören, ein Lied, wie es sonst keiner im Dorf singt, mit einer seltsamen Melodie, als ob jeder einzelne Ton falsch wäre und nur alle zusammen richtig. Die Worte habe ich nicht verstanden, und der Halbbart hat auch ganz schnell mit Singen aufgehört. Dabei hat er eine schöne Stimme, im Kloster könnten sie ihn sicher brauchen. Er ist in der Sonne auf dem Boden gesessen, hatte überkreuzte Striche in die Erde gemacht, und in die Felder hatte er Kieselsteine gelegt, viele gewöhnliche graue und ein paar von den farbigen, die man manchmal am Seeufer findet oder in einem Bach. Die Steine hatten eine Ordnung, das konnte man sehen, die grauen mehr in einer Reihe und die anderen verteilt, aber als ich mich genähert habe, hat er sie schnell auf einen Haufen zusammengewischt, als ob er Platz für mich machen wollte. Aber er hat es sorgfältig gemacht, so dass man gemerkt hat: Er braucht die Steine noch. Er hat gesehen, dass ich gwundrig wurde, und hat gesagt: »Das sind keine Kiesel, sondern Elefanten und Pferde und Soldaten und Könige. Ganz viele Soldaten, wie das überall ist auf der Welt, aber nur zwei Könige, und sie geben keine Ruhe, bis einer von ihnen tot ist.« Vielleicht haben die Leute recht, wenn sie sagen, dass er ein bisschen verrückt ist.
Was ein Elefant ist, weiß ich nicht genau. Ein Tier, glaube ich, das es bei uns aber nicht gibt.
Weil mir schien, dass er heute gesprächiger war als sonst, habe ich ihn etwas gefragt, das mich schon lang wundernimmt, was mir aber noch niemand hat erklären können: warum es bei den Walderdbeeren zwei verschiedene Farben gibt, Rot und Weiß, obwohl es doch dieselbe Pflanze ist, man kann keinen Unterschied sehen. Der Schwämmli, der mein Freund ist, hat einmal behauptet, dass die roten die Männer von den Beeren sind und die weißen die Frauen, aber das glaube ich nicht, Beeren sind ja keine Tiere. Der Halbbart hat zurückgefragt, welche davon mir besser schmecken. Da habe ich nicht nachdenken müssen. »Die weißen«, habe ich gesagt, und er hat gelacht, aber so, dass es kein Auslachen war. Ich solle die Augen zumachen, hat er gesagt, hat mir eine Beere nach der anderen in den Mund gesteckt, und ich musste raten, welche Farbe sie hat. Ich habe aber keinen Unterschied gemerkt. »Du meinst nur, dass die weißen besser schmecken«, hat er mir erklärt, »weil sie anders zu sein scheinen als die anderen. Den Fehler machen die Menschen, seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Sobald einer ein bisschen anders aussieht, eine andere Haarfarbe oder eine größere Nase, denken sie gleich, dass er etwas Besonderes sein muss, besser oder schlechter, und dabei sind alle gleich.« Ich habe ihm widersprechen wollen, weil zum Beispiel der Geni und der Poli sind nun wirklich nicht gleich, aber man widerspricht dem Halbbart nicht, schon gar nicht, wenn man so viel jünger ist als er. Bei seinem verbrannten Grind kann man zwar nicht richtig sehen, wie viele Runzeln er hat, aber älter als unsere Mutter ist er bestimmt, und die ist schon fast vierzig.
Er hat keine von den Erdbeeren gegessen, obwohl ich sie doch extra für ihn gepflückt hatte, und ich habe ihn gefragt, ob er sie nicht gernhat. Doch, hat er gesagt, eigentlich schon, aber er habe einmal jemanden gekannt, der sie noch lieber gehabt habe, und jetzt schmeckten sie ihm nicht mehr, sondern machten ihn traurig, weil er diesen Jemand nämlich verloren habe. Ich fand es seltsam, wie er das gesagt hat, einen Menschen kann man ja nicht verlieren wie einen Zahn oder einen Schuh, wenn man damit in den Sumpf trampt und ihn nicht mehr herausbekommt.
Ich habe die Erdbeeren dann selber gegessen.
Eine ganze Weile sind wir gesessen, ohne etwas zu sagen. Dann hat er mich gefragt, ob ich ihm eine Schaufel besorgen kann oder ein starkes Grabscheit, er brauche sie nur für ein paar Stunden. Er habe es ohne probiert, aber in dem Boden hier oben habe es zu viele Steine, und er müsse eine Grube ausheben. Ich habe zuerst gedacht, er will sich ein Abortloch graben, aber er hat gesagt, so etwas brauche er nicht, der Wald sei groß genug. Es war eine dumme Frage von mir, ich habe schon mehr als einmal beobachtet, dass er sich zum Seichen nie einfach an ein Gebüsch stellt, sondern so tief in den Wald hineingeht, dass man ihn nicht mehr sehen kann. Wie groß die Grube werden solle, habe ich ihn gefragt, und er hat gesagt: »Wie ein Grab für mehrere Leute.«
Mit Gräbern, und wie man sie macht, kenne ich mich aus. Der alte Laurenz, der mit dem Privilegium, hat einen krummen Rücken und auch sonst keine Kraft mehr, und darum hat er mich angestellt, damit ich die Gräber für ihn aushebe. Das Zuschaufeln macht er dann wieder selber, weil da ja Leute dabei sind, und dass er nicht mehr kann, darf keiner wissen, obwohl es jeder weiß. Bis jetzt hat uns niemand verrätscht. Der Laurenz bekommt vier Batzen für jedes Grab, und wenn man die Arbeit für ihn macht, gibt er einem die Hälfte davon ab. Bei Kindergräbern ist es nur ein Batzen für jeden, aber weil Kinder so oft sterben, lohnt es sich doch. Am einträglichsten sind die, die direkt nach der Geburt ins Grab kommen, da ist das Loch gemacht wie nichts und das Geld leicht verdient. Eine schöne Arbeit ist es nicht, aber besser als Frondienst schon. Es neidet mir auch niemand den Lohn, obwohl es genügend junge Leute gäbe, die es besser könnten als ich und auch schneller. Der Laurenz hat sie vor mir gefragt, aber es wollte keiner, weil sie Angst hatten, auch die sonst Tapferen. Es wird nämlich erzählt, wenn man mit der Schaufel aus Versehen alte Knochen trifft, dann wacht der Tote auf und verfolgt den Störer von da an jede Nacht im Traum, und am siebten Neumond danach ist der dann auch tot. Ich habe aber nachgedacht, und wenn das stimmen würde, wäre der Laurenz bestimmt nicht so alt geworden. Außerdem waren auch schon sein Vater und sein Großvater Totengräber, das Privilegium wird in seiner Familie vererbt, und keiner von denen ist jung gestorben, ich habe mich erkundigt. Von den verdienten Batzen habe ich noch keinen ausgegeben, und den Beutel mit dem Ersparten habe ich im Grab von der Hunger-Kathi versteckt, weil es von der immer geheißen hat, sie sei eine Zauberin. Ich denke: Aberglaube ist sicherer als ein Wachhund.
Von Gräbern verstehe ich etwas, und mehr als einen Menschen in ein und dasselbe Grab packen, das ist eine Sünde und nur bei schlimmen Seuchen erlaubt, das weiß ich vom Laurenz, weil sonst nämlich bei der Auferstehung die Körper durcheinanderkommen. Ich habe das dem Halbbart auch gesagt, und er hat mir erklärt, dass er kein Grab machen will, sondern nur eine Grube, und wenn einer hineinfällt und ist tot, dann ist das dem seine Sache. Ich habe ihn gewarnt, dass es ihm gehen könnte wie dem Nussbaumer Kaspar, der hinter seinem Haus einen Brunnen hat graben wollen, aber er hat das Loch nicht richtig abgesperrt, und sein Nachbar, der Bruchi, ist hineingefallen und hat sich beide Beine gebrochen. Daraufhin hat er den Nussbaumer beim Landammann verklagt, und der Beschluss war, dass der Nussbaumer ihm alle Arbeiten auf seinem Hof machen muss, bis die Beine wieder ganz sind. Sie waren aber so gebrochen, dass der Bruchi nie wieder richtig hat laufen können, und der Nussbaumer hätte für den Rest seines Lebens sein Leibknecht bleiben müssen. Darum ist er dann eines Tages mit seiner ganzen Familie aus dem Dorf verschwunden, man hat nie wieder etwas von ihnen gehört, und sein Haus ist am Zerfallen. Der Halbbart könne nicht wollen, dass ihm so etwas auch passiere, habe ich gesagt.
Er hat gemeint, ich sei ein gescheiter junger Mann und solle mir das Nachdenken nur nie abgewöhnen. Aber die Schaufel will er trotzdem haben. Ich müsse es auch nicht um Gotteslohn tun, sagt er, sondern wenn ich sie ihm bringe, würde er mir dafür ein Geheimnis verraten, nämlich warum Steine Pferde und Elefanten sein können und wie man mit ihnen ein Spiel spielen kann. Ich habe mir schon immer gern Geschichten ausgedacht; ein Spiel, bei dem man sich vorstellen muss, dass ein Stein eigentlich ein Tier ist, interessiert mich, und darum habe ich ja gesagt.
Ich werde dem Halbbart die Schaufel vom alten Laurenz bringen, die hat ein starkes Eisenblatt, mit dem man auch in den härtesten Boden hineinkommt. Das heißt: Eigentlich gehört die Schaufel gar nicht dem Laurenz, sondern ist ein Teil von seinem Privilegium. Aber solang es an dem Tag keinen frischen Toten gibt, wird sie niemand vermissen, und selbst wenn der Laurenz etwas merkt, wird er mich nicht verraten, denn eigentlich ist es nicht erlaubt, dass jemand anderes seine Arbeit macht, sonst verfällt das Privilegium. Der alte Laurenz hat keinen Sohn, dem er es vererben könnte, seine Frau, das ist aber schon ewig her, ist im Kindbett gestorben, und er hat beide, Mutter und Kind, selber begraben müssen.
Ich werde dem Halbbart die Schaufel vielleicht schon morgen bringen, aber zuerst muss ich mich verprügeln lassen.
Das dritte Kapitel
in dem es dem Geni schlechtgeht
Ich sollte doch besser kein Mönch werden.
Man muss dafür berufen sein, sagt der Herr Kaplan, und das bin ich nicht, das habe ich heute gemerkt. In dem Moment, wo ich einmal wirklich Grund zum Beten gehabt hätte, habe ich zwar die Worte noch gewusst, das Paternoster und das Ave Maria, aber sie haben nichts mehr bedeutet, so wie man sich im Herbst bei den Blumen noch daran erinnert, wie bunt sie im Sommer gewesen sind, aber die Farben sind verschwunden und kommen nicht mehr zurück. Oben in Sattel, in St. Peter und Paul, steht eine Madonna mit ganz leeren Augen, sie seien einmal blau gewesen, sagen die alten Leute, aber mit den Jahren sind sie dann immer mehr verblasst, und jetzt sieht es aus, als ob man sie ihr ausgestochen hätte, und dabei ist sie doch keine Märtyrerin, sondern die Muttergottes. Genau so war es bei mir mit dem Paternoster und dem Ave Maria, verblüht und verblasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Gebete beim lieben Gott etwas bewirken; er bekommt jeden Tag so viele zu hören und wird sich die farbigsten aussuchen.
Es war mir auch gar nicht ums Beten. Viel lieber hätte ich etwas kaputtgehauen, egal was, so wie das der Poli macht; einmal hat er in einem Wutanfall so heftig mit dem Fuß gegen die Wand geginggt, dass es ein Loch gegeben hat. Der Geni hat es geflickt, aber wenn der Wind vom Berg herunterbläst, spürt man dort immer noch einen Luftzug, so oft wir die Stelle auch mit Moos ausgestopft haben.
Heute war der Poli so still, dass man mehr Angst bekommen hat, als wenn er gesiracht hätte, und unsere Mutter hat geweint, aber nicht so, wie wenn sie an den Vater denkt und an sein gebrochenes Genick, nicht einfach ein paar Tränen mit dem Ärmel weggewischt, sondern laut, wie es sonst nur die kleinen Kinder tun, man kann sie dann schaukeln, so viel man will, sie hören nicht auf. Ich habe solche Töne vorher nur einmal gehört, da war es aber kein Mensch, der so geheult hat, sondern eine Sau, die vom alten Eichenberger gemetzget wurde, und das Messer ist ihm ausgeschlipft.
Auf dem Heimweg vom Halbbart hatte ich mir eine Ausrede für mein Wegbleiben ausgedacht, mein Bauchweh sei schlimmer geworden, vielleicht von einem falschen Pilz, sogar Krämpfe hätte ich gehabt und mich fast nicht mehr bewegen können. Aber dann habe ich schon von weitem die Stimmen gehört und gesehen, dass die Tür von unserem Haus offen stand. Das erlaubt unsere Mutter sonst nicht, weil sonst der Rauch vom Feuer in die falsche Richtung zieht, dass einem die Augen brennen und man nicht mehr atmen kann. Wie ich hineingeschaut habe, war alles voller Leute, das halbe Dorf war da, und außerdem einer in einem schwarzen Habit; jetzt hinterher weiß ich, dass es der vom Kloster war, der das Roden überwacht hat. Seine Lippen haben sich in einem Gebet bewegt, aber weil die Leute alle durcheinandergeredet haben, konnte man die Worte nicht hören. So, wie er ein Gesicht dazu gemacht hat, haben seine Gebete schon lang keine Farbe mehr.
Niemand hat mich bemerkt, sondern sie haben alle zum Tisch geschaut. In dem Gedränge habe ich nur einen Arm erkennen können, der auf der Seite herunterhing, dann habe ich gesehen, dass auf dem Tisch der Geni lag, auf dem Rücken und ohne sich zu bewegen. Ich musste mich zu ihm durchkämpfen; wenn es etwas zu sehen gibt, wollen alle Leute zuvorderst sein. Unsere Mutter saß an dem Platz, wo sie immer sitzt, als ob sie darauf wartete, dass ihr jemand das Essen bringt; sie hatte auch die Hände gefaltet, als ob sie das Du gibst ihnen ihre Speise sprechen wollte. Aber sie hat nur gegreint, mit offenem Mund, man hätte nicht sagen können, ob es Tränen waren, die ihr übers Kinn liefen, oder der Sabber. Dabei presst sie sonst immer die Lippen aufeinander, damit die Leute nicht sehen sollen, wie viel Zähne ihr schon fehlen. Neben ihr stand der Poli, mit einem so leeren Blick, wie ihn die Madonna in Sattel hat, die linke Hand hatte er unserer Mutter auf die Schulter gelegt, und die rechte hat eine Faust gemacht und sich wieder ausgestreckt, eine Faust und wieder ausgestreckt, als ob er jemanden schlagen wollte, aber nicht wüsste, wen. Und auf dem Tisch vor ihnen lag der Geni.
Sein Gesicht war bleich wie das Wachs von einer Wandlungskerze, und unter dem Knie, dort wo niemand ein Gelenk hat, war sein linkes Bein abgebogen, und etwas hat herausgeschaut, weiß wie ein Stück Käse, es war aber ein Knochen. Es ist auch Blut aus ihm herausgeflossen und über den Tischrand auf den Boden getropft, und unter dem Tisch saß dem Kryenbühl Martin sein Hund, der mit den Lampi-Ohren, der auf Befehl Männchen macht. Saß da und leckte das Blut auf. Und niemand hat ihn verjagt, weil sie alle nur auf den Geni geschaut haben, oder vielleicht haben sie gedacht, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an.
Da habe ich rotgesehen, ich verstehe jetzt, wie das beim Poli sein muss, ich bin auf den Hund losgegangen und wollte ihn totschlagen, aber er hat den Schwanz eingezogen und ist zwischen den vielen Beinen hindurch aus dem Haus hinaus, und auf dem Boden war immer noch diese Pfütze und war dem Geni sein Blut. Unsere Mutter hat mich angesehen und doch nicht gesehen und hat gerufen: »Er ist tot! Er ist tot!« Aber in diesem Moment hat der Geni einen Grochser gemacht, und man hat gemerkt, dass er noch am Leben ist.
Einen Bader haben wir im Dorf nicht, einen Physicus schon gar nicht, aber die Iten-Zwillinge waren da, und wer sich mit dem Vieh auskennt, ist die Meinung, der kann auch einem Menschen helfen. Man hat ihnen Platz gemacht, und sie sind an den Tisch herangetreten, eng nebeneinander wie immer, sie haben an der Wunde gerochen, so wie sie an den trächtigen Kühen riechen, und dann haben sie miteinander geflüstert, und alle andern sind so still geworden, dass man jetzt das Gebet von dem Benediktiner gehört hat. Was er gebetet hat, weiß ich nicht, weil es lateinisch war, aber ein paar Worte habe ich mir dem Klang nach gemerkt; ich muss dem lieben Gott für das Talent dankbar sein, sagt der Herr Kaplan. »Proficiscere anima christiana de hoc mundo«, hat der Mönch gebetet.
Es hat ewig gedauert, bis die Iten-Zwillinge aufgehört haben, miteinander zu flüstern, aber dann war es doch so weit, und sie haben im Takt genickt. Einen Moment lang hat es in meinem Kopf gedacht, gleich werden sie »Kuhkalb« sagen oder »Stierkalb«, aber das war natürlich Unsinn. Einer von ihnen – man weiß nie, welcher von beiden es ist, und es ist auch egal, weil man sie sowieso immer nur zusammen antrifft –, einer von ihnen hat gesagt: »Einen Teig machen«, und der andere: »Hirse und Wasser und das Weiße von Eiern«. »Von sieben Eiern«, hat wieder der erste gesagt, und der andere: »Genau sieben.« Sie haben sich beim Reden abgewechselt, aber der Eindruck war, als ob nur einer gesprochen hätte oder beide im Chor. »Einen Sud ansetzen«, haben sie gesagt, »Wallwurz und Spießkraut und eine Unze Schwalbenkot, aufgekocht und in den Teig geknetet. Auf die Wunde packen und sieben Tage drauflassen.«
»Und beten«, hat sich der Benediktiner eingemischt, »es muss Tag und Nacht einer neben ihm sitzen und Gott bitten, dass er ihn heilt.« Die Zwillinge haben genickt, wieder beide gleichzeitig, und haben gesagt, wer das mache, solle aber die Gebetsschnur nur mit der einen Hand halten, und mit der anderen die Fliegen von der Wunde vertreiben. Unsere Mutter ist zu ihnen hingerannt und wollte ihnen die Hände küssen, aber die Iten-Zwillinge haben es nicht gern, wenn man sie anfasst, und haben sich hinter den anderen Leuten versteckt.
Bevor man mit dem Teig beginnen konnte, musste noch der Knochen gerichtet werden, damit er richtig zusammenwachsen kann. Solche Sachen macht bei uns im Dorf der Züger Meinrad, der fast ein Zimmermann ist und weiß, wie man einen morschen Balken ersetzen kann, ohne das ganze Haus abzureißen. Damals, als der Bruchi sich beide Beine gebrochen hat, war es auch der Züger, der sie gerichtet hat; man sagt, dass der Bruchi ohne seine Hilfe nie mehr einen Schritt gemacht hätte. Hinken tut er zwar immer noch, aber man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Es hat schon mancher auf einen Hirsch gewartet und das Rebhuhn vor der Nase verpasst.
Der Züger Meinrad ist an den Tisch hingegangen und hat das kaputte Bein abgetastet, und der Geni hat einen Schrei gemacht, wie ich es noch nie von ihm gehört habe. Der Züger hat seine blutigen Hände an meinem Bruder seinem Kittel abgewischt und hat gesagt, dass er zwei starke Männer braucht, die den Geni festhalten, während er ihm den Knochen richtet; wenn er vor Schmerzen zappelt, geht es nicht. Es haben sich viele gemeldet, weil sich die Leute gern wichtigmachen, aber gewonnen haben Vater und Sohn Eichenberger, was zu erwarten gewesen war, schließlich ist der Vater der Reichste im Dorf. Die beiden haben den Geni an den Armen gepackt und gegen die Tischplatte gedrückt, aber das war dann gar nicht nötig, weil der war schon wieder ohnmächtig und hat nichts mehr gespürt.
Ich hoffe, dass er nichts mehr gespürt hat. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.
Die Leute haben alle den Atem angehalten, oder es ist mir doch so vorgekommen, und wie der Züger das Bein geradegerichtet hat, konnte man hören, wie etwas darin geknackt hat. Dem Züger seine Hände waren schon wieder voll Blut.
Der Benediktiner hat ein kleines silbernes Fläschchen aus der Tasche geholt und wollte dem Geni das Viaticum auf die Lippen tropfen. Wie er das gesehen hat, ist der Poli aufgewacht, man kann es nicht anders sagen, als ob er vorher geschlafen hätte mit offenen Augen. »Nein!«, hat er geschrien, und diesmal ist seine Faust eine Faust geblieben. Die Leute haben ihn festgehalten, sonst hätte er dem Mönch etwas angetan, und einen Geistlichen schlagen ist eine große Sünde. Der Benediktiner hat ganz schnell »Dominus vobiscum« gesagt und ist hinaus, der Kryenbühl hinterher. Von draußen konnte man hören, wie er sich für den Poli entschuldigt hat, der sei sonst ein Friedlicher, es sei nur wegen der Aufregung und wegen der Sorge um seinen Bruder gewesen, man dürfe ihm das nicht übelnehmen. Der Kryenbühl steht gern mit allen Leuten gut, wenn sie ihn nicht mögen, kaufen sie ihm seinen Wein nicht ab. Obwohl: Die vom Kloster haben ihren eigenen Wein. Die anderen sind dann nach und nach auch gegangen, bis am Schluss nur noch der alte Laurenz da war, der wollte den Anfang machen mit Beten und Fliegen-Vertreiben.
Der Poli hat befohlen, dass wir jetzt ganz schnell mit dem Teig anfangen sollten, so wie die Iten-Zwillinge es gesagt hatten, und hat mich losgeschickt, die Kräuter besorgen. Er weiß, dass ich mich mit diesen Dingen auskenne und nicht lang überlegen muss, wo man Wallwurz findet oder Spießkraut. Wo die Schwalben ihre Nester haben, das weiß ich sowieso.
Ich war froh, dass ich etwas für den Geni tun konnte. Auf dem Weg habe ich mich gefragt, wo wir die sieben Eier hernehmen sollten, wo wir doch keine eigenen Hühner haben, aber als ich zurückgekommen bin, war unsere Mutter schon am Rühren. Die Leute aus dem Dorf seien einer nach dem andern zurückgekommen, hat sie erzählt, und jeder habe ein Ei mitgebracht, manche sogar zwei. Es gebe eben doch gute Leute, hat sie gemeint, und hat auch nicht mehr geweint. Von dem Eigelb, das für den Teig nicht gebraucht wird, dürfe ich einen großen Löffel voll essen, hat sie gesagt, aber ich habe es nicht getan; es wäre mir vorgekommen, als ob ich dem Geni etwas wegnehme.
Der Poli hat mich gelobt, dass ich alles richtig gebracht hatte. Er lobt mich sonst nie, und es ist wohl nur gewesen, weil er den Geni vertreten wollte. Er war so mild, dass man sich gar nicht mehr vorstellen konnte, dass er gerade noch auf den Mann aus Einsiedeln losgegangen war. Ich wollte das Blut unter dem Tisch aufwischen, aber es war schon in die gestampfte Erde hineingesickert, und man konnte den Fleck fast nicht mehr sehen.
Der Geni lag unterdessen auf seinem Strohsack, dort, wo wir alle schlafen, sie hatten ihm ein löchriges Hemd, noch vom Vater her, um das Bein gebunden, und man konnte ihn laut atmen hören, was mich beruhigt hat. Der alte Laurenz saß daneben, einen Buchenzweig gegen die Fliegen in der Hand, und hat ein Paternoster nach dem anderen aufgesagt. Jedes Mal, wenn er mit »Sed libera nos a malo« fertig war, hat unsere Mutter »Amen« gerufen.
Das vierte Kapitel
in dem ein Unfall beschrieben wird
Der alte Laurenz behauptet, wenn ein Mensch exakt so viele Paternoster aufsagt, wie er Haare auf dem Kopf hat, dann kann er damit eine Gnade erzwingen. Ich glaube das aber nicht, es gibt ja auch Leute, die überhaupt keine Haare mehr haben, die hätten es mit dem Zählen leicht und könnten jeden Tag einen Topf mit Gold finden, oder was sie sich sonst wünschen. Für den Geni sind unterdessen bestimmt schon mehrere Köpfe Paternoster gesagt worden, aber es hat nichts genützt und das Mittel von den Iten-Zwillingen auch nicht. Er hat Schmerzen wie unser Herr Jesus am Kreuz und überhaupt keine Kraft mehr. Und unter dem Teig kommt ein ekelhafter Geruch heraus.
Unsere Mutter will tapfer sein und versucht, nicht zu weinen. Sie hat sich schon so oft auf die Lippen gebissen, dass die ganz blutig sind. Und der Poli ist nicht mehr mild, wie er es im ersten Schreck war, sondern wird jede Stunde zorniger, man könnte meinen, es versprengt ihm den Kopf. Ich versuche, ihn zu beruhigen, indem ich ihn immer wieder erzählen lasse, wie das Unglück passiert ist. Unterdessen weiß ich Bescheid, als ob ich selber dabei gewesen wäre.
Mit dem Sonnenaufgang haben sich die Männer aus dem Dorf versammelt, so wie es befohlen war, und der Abgesandte aus Einsiedeln hat den Ort bestimmt, wo sie mit dem Roden anfangen sollten: im unteren Klosterwald, in dem Teil, dem man bei uns Fichteneck sagt. Ich finde es schade, dass gerade der wegkommt, weil wo Fichten sind, findet man im Herbst Steinpilze, und es gibt nichts auf der Welt, was mir besser schmeckt. Aber wenn ich dem Geni damit helfen könnte, würde ich noch heute ein Gelübde ablegen, dass ich mein Leben lang nie mehr einen Steinpilz essen will, überhaupt nie mehr etwas Gutes, so wahr mir Gott helfe.
Im Fichteneck haben sie zuerst den heiligen Sebastian angerufen, dass er sie bei der Arbeit beschützen soll und seine Hand über sie halten. Ich habe vorher nicht gewusst, dass der Sebastian auch für die Waldarbeiter zuständig ist, sondern habe immer gedacht, er ist nur für die Jäger da, weil man doch mit Pfeilen auf ihn geschossen hat. Aber im Kloster kennen sie sich natürlich besser aus mit solchen Sachen. Ich stelle mir vor, dass dort einer sitzt, ein ganz alter Mönch vielleicht, der weiß alle Heiligen auswendig und ihre Zuständigkeit für die Berufe und die Gsüchti. Wenn zum Beispiel einer sagt: »Ich habe Kopfschmerzen«, dann muss er nicht lang nachdenken, sondern sagt sofort: »Achatius von Byzanz.« Den Namen weiß ich, weil unsere Mutter auch einmal starke Kopfschmerzen hatte, die wollten überhaupt nicht mehr weggehen, und da hat ihr der Herr Kaplan diesen Nothelfer empfohlen.
Nach dem Gebet hat dann der Züger die Arbeit eingeteilt; er weiß Bescheid bei allem, was mit Holz zu tun hat. Er hat also bestimmt, wer Wurzelstöcke ausgraben muss oder Gebüsch abholzen und wer schon einmal mit Schwenden anfangen soll, also die Rinde von den Bäumen abmachen, damit sie vertrocknen und später leichter umzuhauen sind. Der Geni ist zu den Baumfällern gekommen, was das Schwierigste von allem ist. Der Züger hat ihn dafür bestimmt, weil er in die Sachen nicht kopfvoran hineinrennt, sondern immer erst überlegt, bevor er etwas anfängt. Beim Bäumefällen ist das besonders wichtig, weil man jedes Mal ausrechnen muss, in welche Richtung sie umfallen werden, damit man nicht von ihnen getroffen wird. Wenn man nämlich so einen Stamm auf den Kopf bekommt oder in den Rücken, dann kann auch der heilige Sebastian nicht mehr helfen. Der Geni ist sogar zum Biber bestimmt worden, das ist der Mann, der mit der Axt den ersten Schlag macht und bestimmt, wo der Keil hineingetrieben werden muss. Man sagt ihm so, weil Biber auch Bäume fällen, und sie wissen von Natur aus, wie sie es machen müssen, damit ihnen nichts passiert. Man hat noch nie einen Biber gesehen, der von einem Baum erschlagen wurde.
Jeder hat die Arbeit gemacht, die ihm aufgetragen war, und der Züger hat aufgepasst, dass keiner faulenzt. Der Frater aus Einsiedeln ist im Schatten gesessen und hat zugeschaut. Schnell ist es nicht vorangegangen, sagt der Poli, bei so einer Arbeit ist das auch nicht möglich.
Wie die Sonne am höchsten stand, haben sie Pause gemacht, und es hat für alle von dem Bier gegeben, das sie im Kloster trinken; der Cellerarius hatte ein Fass davon geschickt. Wenn sie einen zur Herrschaftsarbeit rufen, müssen sie einen auch verpflegen, das ist der Brauch. Das Bier war dann mitschuldig an dem Unglück, sagt der Poli, es gibt zwar Kraft, aber gleichzeitig macht es auch müde. Weil die Leute vom Arbeiten durstig waren, haben alle zu viel davon getrunken, am meisten natürlich der Rogenmoser.
Am späteren Nachmittag hat der Züger dann gefragt, ob man nicht für heute mit dem Roden Schluss machen solle und nur noch die Klosterochsen aus dem Stall vom Eichenberger holen und die gefällten Bäume aus dem Wald schaffen. Aber der Mönch hat bestimmt, dass bis zum Eindunkeln weitergearbeitet werden müsse, alles andere hieße dem Herrgott den Tag stehlen.
An dieser Stelle muss ich den Poli immer ganz schnell etwas fragen und ihn so über die Erinnerung hinweglupfen, sie macht ihn jedes Mal von neuem wütend. Er ist fest davon überzeugt, dass der Unfall nur deshalb passiert ist, weil sie haben weitermachen müssen, obwohl alle erschöpft waren und deshalb unvorsichtig, aber ich denke, vielleicht war es auch einfach nur ein gewöhnliches Unglück und hätte auch schon beim ersten Baum am Morgen passieren können. Im Wald arbeiten ist immer gefährlich, das weiß man, und man kann nicht erwarten, dass sich der heilige Sebastian um jeden Einzelnen kümmert, da hätte er viel zu tun. Manche sagen, dass das Unglück eine Strafe vom Himmel war, aber es gibt keinen Grund, warum der Geni bestraft werden sollte. Ich will auch gar nicht darüber nachdenken. Der Halbbart hat einmal gesagt: Wenn man für alles einen Grund finden will, wird man verrückt.
So ist es passiert: Sie hatten einen Baum gefällt, und er ist auch in die Richtung umgefallen, die der Geni bestimmt hatte, oder doch fast, aber dann hat sich seine Spitze in der Astgabel von einem anderen verkeilt. Unten war der Stamm noch nicht ganz abgebrochen, und oben hing er fest, also hat der Züger befohlen, der Geni solle hinaufklettern und mit seinem Gertel die Spitze lösen. Der Poli sagt, dass er dem Züger deswegen keinen Vorwurf macht, man habe den Baum ja nicht halb und halb stehen lassen können. Man musste auch keine Angst haben, der Geni ist ein guter Kletterer; wenn er in einem Baum ein Bienennest sieht und er will den Honig haben, dann ist er oben wie nichts, und wenn ihn die Bienen stechen, dann lacht er nur. Die Höhe stört ihn überhaupt nicht. Der Geni hat mindestens so viel Mut wie der Poli, wenn er es auch nicht ständig zeigt. Er ist also den Baumstamm hinaufgeklettert, ganz bequem, als ob die Äste die Stufen von einer Treppe gewesen wären oder die Sprossen von einer Leiter. Wie er dort angekommen ist, wo der Baum eingeklemmt war, hat er einen Schlag mit dem Gertel gemacht, »nur einen einzigen Schlag«, sagt der Poli immer wieder, und dann ist etwas passiert, mit dem hat niemand gerechnet. Es muss ausgesehen haben wie ein Wunder, aber ein abverheites. Der Stamm war durch das Umfallen und das Einklemmen nämlich gespannt wie die Sehne an einer Armbrust, und wie der Geni diesen Axtschlag getan hat, hat sich die Spannung gelöst, und es hat ihn weggespickt.
Der Poli sagt, der Geni ist durch die Luft geflogen wie ein Vogel. Ich stelle mir das vor wie in der Geschichte, die das Teufels-Anneli einmal erzählt hat, wo der reiche Mann von weitem einen großen Kristall sieht, ganz oben am Berg, dort wo auch der beste Kletterer nicht hinkommt, den will er unbedingt haben, und deshalb verkauft er dem Teufel seine Seele, damit der macht, dass er fliegen kann. In dem Moment, wo er eingeschlagen hat und der Vertrag gültig ist, kommt eine riesige Fledermaus geflogen, packt ihn mit den Krallen und hebt ihn hoch in die Luft. Aber er bekommt den Kristall nicht, wie er das gewollt hat; als er danach fassen will, lässt die Fledermaus ihn fallen, und das Letzte, was er hört, bevor er in die Felsen stürzt, ist dem Teufel sein Lachen. Dem Geni muss es ähnlich gegangen sein, nur ohne den Teufel, zuerst ist er geflogen – jedes Mal, wenn der Poli es erzählt, wird die Entfernung größer –, aber dann ist er gegen einen anderen Baum gekracht und von dort auf den Boden gestürzt, zum Glück nicht in tausend Stücke zerschmettert wie in der Geschichte, aber sein Bein war kaputt, und man hat sofort gesehen, dass es schlimm war, wegen dem Blut und allem.
Sie haben schnell eine Bahre gezimmert, Holz war ja genug da, und den Geni nach Hause getragen. »Die Leute haben sich darum gestritten, wer mittragen darf«, sagt der Poli, »nur der Benediktiner hat immer nur gebetet und überhaupt nicht geholfen.« Aber ich denke, wenn einer aus dem Kloster kommt, dann ist Beten die Art, wie er helfen will, obwohl ich nicht sicher bin, dass man damit etwas erreicht. All die Paternoster, die man für den Geni gesagt hat, haben auf jeden Fall nicht geholfen, da war der Fliegenwedel noch nützlicher. Es kann sein, dass es an der Andacht gefehlt hat, der Herr Kaplan sagt, wenn man Gebete nur mit den Lippen sagt und nicht mit dem Herzen, dann nützen sie nichts, man muss auch das Vertrauen dabei haben und keine Zweifel.
Ich will nicht, dass der Geni stirbt, ich will es einfach nicht. Man muss doch etwas machen können, und wenn es ein Wunder braucht, dann muss eben ein Wunder passieren, wozu hat man sonst eine Religion? Unser Herr Jesus Christus hat so viele Kranke geheilt, die bestimmt alle noch schlimmer dran waren als der Geni, ein Taubstummer hat wieder reden können und ein Blinder sehen, sogar Tote hat er zum Leben erweckt, und auch die Heiligen können Wunder tun und die Jungfrau Maria sowieso – man müsste nur wissen, wie man einen von ihnen, nur einen einzigen, auf den Geni aufmerksam macht und auf sein Bein, dann kann es trotz allem noch gut kommen.
Ich finde: Einen Bruder verlieren ist fast noch schlimmer als selber sterben. Damals, als sich der Vater das Genick gebrochen hat, war ich noch klein und hatte mich noch nicht daran gewöhnt, einen Vater zu haben. Aber wie ich ohne den Geni leben soll, das weiß ich nicht.
Aber ich bin jetzt nicht wichtig, nur der Geni. Es gibt so viele Gründe, warum er es verdient, dass man ihm hilft. Beim Heuen lässt er immer einen Bund Gras liegen, als ob er ihn vergessen hätte, damit ein Armer seine einzige Geiß durch den Winter füttern kann; er will keinen Dank dafür, und wenn man ihn darauf anspricht, sagt er, er habe das Gras nur aus Versehen nicht mitgenommen. Die scheusten Tiere haben keine Angst vor ihm; einmal hat er ein Rehkitz aufgezogen, und noch lange Zeit nachdem es ausgewachsen war, ist es manchmal aus dem Wald gelaufen gekommen und hat ihn mit der Schnauze geschubst. Und mir hat er das Wasserrad geschnitzt, einfach so, weil ich mir das gewünscht hatte. So einer darf nicht krank sein, sondern muss aufrecht stehen, auf beiden Beinen, alles andere passt nicht zu ihm. Er ist doch der Geni, heilige Muttergottes! Und jetzt liegt er da und stinkt nach Verwesung, jeder Atemzug fällt ihm so schwer, als ob er ihn zu Fuß aus einem fremden Land holen müsse, und der alte Laurenz hat zu mir gesagt, ich soll schon einmal die Stelle aussuchen, wo ich meinem Bruder das Grab schaufeln will.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin doch der Jüngste in unserer Familie, da müssen mir doch die anderen sagen, was zu tun ist. Aber unsere Mutter beißt sich nur auf die Lippen und bringt immer wieder Wasser, wo der Geni doch gar nicht mehr trinken kann, sie will es ihm in den Mund leeren, aber es läuft ihm nur über die Backen, die Haut ist dort so dünn geworden wie die Flügel von einer Libelle. Und der Poli gibt mir keine Antwort, auch nicht, wenn ich ihn bitte, er soll mir den Unfall noch einmal erzählen, er tut nichts als die Faust schütteln und sagen, wenn der Geni stirbt, dann schlägt er den Mönch tot oder zündet gleich das ganze Kloster an. Ich habe Angst um den Poli, mit solchen Reden macht man sich bei den Heiligen bestimmt nicht beliebt.
Ich überlege die ganze Zeit und bin jetzt auf die Idee gekommen, ganz allein nach Einsiedeln zu pilgern, barfuß, oder noch besser: mit spitzigen Kieselsteinen in den Schuhen, wie man das bei einer Bußwallfahrt macht, und dann vor der Muttergottes so lang auf den Knien zu bleiben, bis sie mein Gebet erhört. Aber wenn der Geni stirbt, während ich nicht bei ihm bin, das würde ich nicht ertragen.
Ich glaube, der Einzige, der mir einen Rat geben kann, ist der Halbbart.
Das fünfte Kapitel
in dem ein Bein abgeschnitten wird
Ich hatte Angst, dass er vielleicht gar nicht mehr mit mir reden will, weil ich ihm doch eine Schaufel versprochen habe und dann nicht gebracht, aber er hat nicht danach gefragt. Seine Grube hat er ohne Werkzeug angefangen, mit bloßen Händen; weit ist er nicht gekommen und schon gar nicht tief, aber man sieht doch, wie groß sie werden soll: die ganze Breite von seinem Unterstand.
Von dem Unfall hatte er noch nichts gehört; die Neuigkeiten aus dem Dorf kommen nicht zu ihm. Ich musste ihm alles erzählen: wie der Geni durch die Luft geflogen ist, wie sein Bein kaputtgegangen ist und wie weder das Beten geholfen hat noch der Schwalbenkot. Der Halbbart hat mich reden lassen, ohne mich ein einziges Mal zu unterbrechen, das ist etwas, das nicht viele Leute können. Den Kopf hatte er in eine Hand gestützt, so dass man fast nur die Narben gesehen hat, aber sein anderes Auge ist nicht verbrannt, und an ihm hat man gemerkt, dass er zuhört. Als ich von dem ekelhaften Geruch erzählt habe, ist das Auge groß geworden, und der Halbbart hat einen Ton von sich gegeben, als ob ihm etwas weh tut; gesagt hat er aber nichts. Erst als ich von ihm wissen wollte, ob er auch der Meinung sei, eine Wallfahrt nach Einsiedeln könne helfen, hat er gefragt: »Wie lang brauchst du bis dorthin?« – »Etwa vier Stunden«, habe ich gesagt, »aber mit Kieselsteinen in den Schuhen natürlich länger.« Er hat den Kopf geschüttelt und gemeint: »So viel Zeit hat dein Bruder nicht. Ich weiß vielleicht ein Mittel, das ihn retten kann, aber das muss sofort angewandt werden. Wenn ihr damit wartet, ist es, als ob ihr ihm die Kehle abdrücken würdet, mit jeder Stunde fester.« An dem Ton, in dem er das gesagt hat, hat man gemerkt: Er kennt sich aus und hat so etwas schon einmal erlebt.
»Ist das ein sicheres Mittel?«, habe ich ihn gefragt. Nein, hat er geantwortet, sicher sei es nicht, aber wenn einer am Ertrinken sei, müsse man ihm jedes Seil zuwerfen, das man zur Hand habe, auch wenn man nicht wissen könne, ob er noch die Kraft habe, sich daran festzuhalten.
Er hat mir erklärt, dass dem Geni sein Bein am Verfaulen ist, so wie ein Ei schlecht wird, wenn die Schale angeschlagen ist. Das komme daher, dass durch eine offene Wunde schlechte Luft in einen Menschen hineinkrieche und ihn von innen heraus vergifte, mit einem Gift, das so hohes Fieber macht, dass man fast verbrennt davon, und darum nennt man es Wundbrand. Es passiere nicht bei jeder Verletzung, warum bei der einen und nicht bei der anderen, das habe noch niemand herausgefunden; es würde dem Geni auch nichts nützen, wenn man es wüsste, weil alle Wissenschaft doch nichts mehr ändern könne. Was einmal verfault sei, das bleibe verfault, das könne der gelehrteste Doktor nicht wieder gesundmachen. Ich müsse mir das so vorstellen, dass ein wildes Tier dem Geni ein Stück Bein nach dem anderen abfrisst, Biss um Biss, und was es einmal gefressen hat, das kann niemand und nichts zurückbringen. Dieses wilde Tier könne kein Jäger töten oder verjagen, das Einzige, was man probieren könne, sei, ihm sein Fressen wegzunehmen. Und dann hat er mir beschrieben, was man machen muss und wie.
In Sattel hat einmal ein Praedicatorenmönch aus Zofingen die Predigt gehalten und hat beschrieben, was mit einem Menschen, der in Todsünde gestorben ist, in der Hölle passiert. Es sind lauter schreckliche Dinge, zum Beispiel: Er wird in einem Topf mit Blut und Eiter gekocht, oder wenn er aus einer Kirche die Reliquie gestohlen hat, wird ihm vom Teufel die Hand abgeschnitten, noch mal und noch mal, sie wächst immer wieder nach, und jedes Mal tut es ihm mehr weh. Mir ist damals ganz gschmuuch geworden, ich kann mir solche Sachen so gut vorstellen, dass mir schwindlig davon wird. Und jetzt sagt der Halbbart, dass wir genau dasselbe beim Geni machen müssen, nur bei ihm nicht die Hand abschneiden, sondern das Bein. Er sagt auch, wenn wir zu lang herumdenken, kann es sein, dass der Geni das Warten nicht überlebt.
Ich will nicht daran schuld sein, dass mein Bruder stirbt.
Den ganzen Heimweg bin ich gerannt und dabei über eine Wurzel gestolpert und hingefallen. Mein Knie war hinterher aufgeschürft, und ein Arm tut mir immer noch weh, aber wo es meinem Bruder so schlechtgeht, ist es mir gerade recht, wenn mir jetzt auch etwas fehlt.
Wie ich ins Haus gekommen bin, habe ich gleich gehört, dass der Geni noch mehr um Luft hat kämpfen müssen als vor einer Stunde, als ob der Felsbrocken auf seiner Brust immer schwerer würde, und er müsse ihn mit jedem Atemzug in die Höhe stemmen. Und seine Stirne war wie Feuer. Unsere