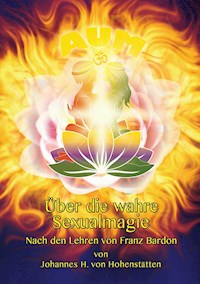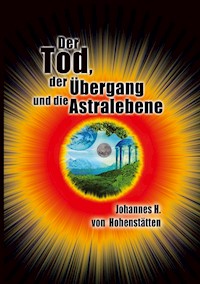Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
„Der hermetische Bund teilt mit“ ist die einzig magisch-mystische Zeitschrift, welche vollständig auf die universelle Lehre von Franz Bardon begründet ist. Sie hält sich strikt an die Gesetze des 4-poligen Magneten und erteilt Wissen sowie Hinweise für die Praxis, damit der Leser die Möglichkeit hat, sicher auf seinem heiligen Pfad voranzuschreiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Dank geht an Peter Windsheimer für das Design des Titelbildes.
Des Weiteren an Ariane und Michael Sauter.
Inhaltsangabe:
1.Biografien über die bekanntesten Yogi-Meister
2.Luzifer – Ein Gedicht von P. Windsheimer
3.Verkehr mit den Welten
Anhang: Eine mentale Reise zum Mars
4.Ein wahres Tantra
5.Der Philosoph
6.Behebung der Blutüberfüllung
1. Biografien über die bekanntesten Yogi-Meister
Hohenstätten
Ich habe mich entschlossen, einige Biografien der bekanntesten YogaMeister im „Der hermetische Bund teilt mit“ zu veröffentlichen, um aufzuzeigen, inwieweit diese berechtigt sind, den Titel „Meister“ oder „Guru“ erhalten zu dürfen. Ich werde auch versuchen, mich auf das Wesentlichste zu beschränken. Über den bekannten Yogi Sivananda haben wir bereits in der 3. Ausgabe der Zeitschrift ausführlich geschrieben. Ich möchte hier nur kurz erwähnen, dass fast alle Übungen aus seinen zahlreichen Büchern – wie aus sämtlichen anderen Yoga-Werken – aus dem universellen Tantra-Buch „Shiva Samhita“ entnommen und falsch wiedergegeben wurden. Das lässt sich leicht und einfach nachweisen!
Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass diese Biografien ohne Vorurteile verfasst sind und ich damit weder einen verletzen will, noch möchte ich die Autorität eines Yogis herabsetzen. Mir geht es bloß um die Wahrheit!
Die meisten Yogis wollen nicht schweigsam ihren Weg der Vollendung gehen, sondern sie wollen Anerkennung und Verehrung. Deshalb sagte David-Neel, die ihre Erfahrungen in Indien höchstpersönlich machte, dass die, die sie kennenlernte, sich gerne als Gurus verehren ließen. David-Neel ist zwar keine kompetente Frau in Sachen Hermetik, aber bei diesem Problem trifft sie den Nagel auf den Kopf. Den Namen Guru definierte sie in ihrem Buch „Mein Indien“ so: Im Sanskrit beinhaltet der Begriff Guru etwas „Herausragendes“, im Sinne von verehrungswürdig, mächtig, wird aber, wie gesagt, vor allem auf einen spirituellen Meister angewandt. Weiteres sagt sie zu recht: „Einen Meister zu verehren oder sich als Meister verehren zu lassen, scheint den Indern ein angeborenes Bedürfnis zu sein, und sie haben eine geradezu unglaubliche Fähigkeit, sich über den Charakter und die Verdienste ihrer erkorenen spirituellen Führer Illusionen zu machen.“ Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für westliche Länder, genauso wie im östlichen Himalaya, wo die Gurus dicke, träge alte Männer sind, die sich gerne von jungen Frauen „ver(=be)sorgen“ lassen.
Kommen wir nun zu den eigentlichen Gurus. In ihrem Buch gibt sie interessante Beispiele: „Ein europäisch gebildeter indischer Rechtsanwalt hatte mir gegenüber die hohen geistigen Fähigkeiten und die tiefgründige Weisheit seines Gurus vehement gepriesen. Bei seiner Intelligenz und Bildung hatte ich angenommen, dass der von ihm zum spirituellen Führer Erkorene seine Meriten haben musste. Und so folgte ich bereitwillig der Einladung zu einem Gespräch mit diesem hervorragenden Mann. Ich fand ihn in einem hübsch inmitten eines Gartens gelegenen kleinen Pavillon. Der Guru, ein Mann in reiferen Jahren, gab sich als Dichter zu erkennen. Er las mir eigene Verse über ein ziemlich abgedroschenes Thema vor, nämlich den Tod, der uns alle erwartet. An diesen Versen war nichts bemerkenswert, aber ihr Verfasser bekundete klar und deutlich, dass er sie erhaben finde. Er bemühte sich, mir ihren Sinn zu erläutern, der auf der Hand lag: Wir müssen alle sterben und dürfen uns dieser Wahrheit nicht verschließen.
Als er merkte, dass sich meine Bewunderung trotz der Komplimente, die ich ihm machte, in Grenzen hielt, er also als Dichter Schiffbruch erlitten hatte, versuchte er, seine kontemplative Spannweite zu demonstrieren. Samadhi, ein Bewusstseinszustand, der über Wachen, Träumen und Tiefschlaf hinausgeht und in dem das Denken aufhört, wird von den Indern als Zeichen für einen hohen Grad an spiritueller Perfektion gewertet. Das stimmt, aber Samadhi kann auch durch keineswegs spirituelle Vorgänge ausgelöst werden. Die sichtbarsten äußeren Anzeichen für diesen Zustand geistiger Konzentration sind (nach indischer Meinung) völlige Unbeweglichkeit, deutliche Verringerung der Atemtätigkeit und des Herzschlags. Nun sitzt der Guru reglos da, gerade aufgerichteter Oberkörper, starre Augen unter halbgeschlossenen Lidern. So verharrt er, einer Statue gleich. Ich errate, dass er auf den Augenblick wartet, in dem ich mich ihm zu Füßen werfe, um ihm zu huldigen, oder schweigend den Raum verlasse. Wir sind nicht allein, sondern zusammen mit drei Schülern des „heiligen Mannes“.
Auch ich bewege mich nicht mehr: Meine Augen blicken starr, ohne das geringste Lidflattern, ich atme langsam, flach, unmerklich. Boshaft, wie ich bin, sagt meine innere Stimme: „Nur zu, Freundchen, du wirst als erster schlappmachen!“
Die Zeit vergeht. Die Schüler sind einigermaßen perplex. Es dunkelt. Der Guru verzichtet schließlich darauf, weiterhin den steinernen Gastgeber zu spielen, vielleicht ist es auch Essenszeit für ihn. Er streckt sich, steht auf und entschwindet. Ich rühre mich immer noch nicht. Eine gute halbe Stunde später strecke auch ich mich, schaue mich um und stehe auf. „Unser Guru hat Sie in einen Zustand von Samadhi versetzt, während er sich selbst darin befand“, teilen mir die Schüler mit.
Der Glaube, dass ein Meister bei den während seiner Versenkung Anwesenden einen völlig absorbierten Bewusstseinszustand herbeiführen kann – absichtlich oder nicht –, ist in Indien weit verbreitet. Er basiert auf wahren und einwandfrei festgestellten Tatsachen, aber so war es in meinem Fall nicht; doch ich hütete mich wohlweislich zu gestehen, dass ich den Guru hinters Licht führen wollte wegen seiner mir zu dick aufgetragenen Effekthascherei. Ich glaube übrigens, dass er auf meine kleine Komödie ebenso wenig hereingefallen ist, wie ich auf seine.“
Eine andere Geschichte belegt das überhebliche Verhalten eines Gurus: „Vor einer Weile hatte Ram Dass mir von den tiefen Erkenntnissen vorgeschwärmt, die sein Meister über die verschiedenen Zweige der Vedanta-Philosophie gewonnen habe, und ich hatte tatsächlich den Wunsch geäußert, mich mit diesem gelehrten Guru zu unterhalten. Die Puja hatte mich einigermaßen ernüchtert; die hohle Selbstgefälligkeit, die er bei der Zeremonie zur Schau trug, erweckte in mir Zweifel an seinem Auffassungsvermögen für intellektuelle oder spirituelle Inhalte. Trotzdem konnte ich den freundlichen Jungen, der mir einen Gefallen erweisen wollte, nicht vor den Kopf stoßen. Also kehrte ich zum angegebenen Zeitpunkt in das Haus zurück. Ich durchquerte den Garten, ohne einem Menschen zu begegnen; ich stieg die kleine Freitreppe hoch und konnte mir das Anklopfen ersparen, denn die Haustür stand offen und gab den Blick frei auf eine groteske Szene. In einem schmalen Korridor lag der Guru der Länge nach ausgestreckt auf einer Matte. Das Kopfkissen war mit Bananenblättern belegt, die einen breiten grünen Heiligenschein bildeten. Unter seine Lenden waren ebenfalls Blätter gebreitet, die seine einzige Bekleidung, einen überaus kurzen Schurz aus dünner, weißer Baumwolle, markant hervorhoben. Die nackten Füße des Gurus schließlich ruhten auf weiteren Blättern, die kunstvoll zu einer Lotosblüte angeordnet waren. Ein junger Mann kauerte in Kopfhöhe dieses lebenden Götzenbildes, ein anderer neben den Füßen. Beide fächelten mit einem Palmenzweig ihrem Meister Kühlung zu. Mein erster Gedanke war, es könne sich nur um einen Toten handeln, den man derart dekoriert aufgebahrt hatte. Irrtum, die Brust hob sich leicht; der Guru schlummerte oder tat so. Er hatte den Termin für unser Gespräch festgesetzt, musste mich also erwarten; hatte er es vergessen? Kaum anzunehmen, die ganze Inszenierung war wohl eigens für mich ersonnen, um mir zu imponieren. In dem Fall hatte sie freilich ihr Ziel verfehlt. Der Jüngling, der den Füßen des Meisters Kühlung zufächelte, wies auf einen niedrigen Hocker in der Türöffnung und bedeutete mir stumm, mich darauf niederzulassen. Von dort hätte ich den Anblick in aller Ruhe genießen können. Und das natürlich so lange, bis der Meister die Augen zu Öffnen und meine Gegenwart zu bemerken geruhte. Als ich mir das ausmalte, begann ich zu prusten und ergriff, von einem Lachkrampf geschüttelt, schleunigst die Flucht.“
Aber auch mit Männern wie Rabindranath Tagore, Sohn von Devendranath und bedeutendster indischer Dichter der Neuzeit, traf sich die Französin. Geboren am 7. Mai 1861 in Kalkutta; gestorben 7. August 1941 in der selben Stadt, war ein bengalischer Dichter, Philosoph, Maler, Komponist, Musiker und Brahmo-Samaj-Anhänger, der 1913 den Nobelpreis für Literatur erhielt und damit der erste asiatische Nobelpreisträger war. Seine beiden Werke „Sadhana“ und „Persönlichkeit“ bestechen durch seine hermetischen Grundsätze und bilden eine der wenigen indischen Perlen. Er ist aus der Familie Tagore als ein weiterer bedeutender Guru hervorgegangen. Wie alle Gurus hatte auch er einen Kreis von Schülern um sich versammelt, doch sein Hauptanliegen war es, seine Lehren unter der Jugend zu verbreiten. Im Wesentlichen ging es dabei um die im Brahmacharya (sexuelle Reinheit!) enthaltenen Grundsätze, die Rabindranath Tagore modernen Bedingungen anzupassen vermochte. Auf einem riesigen Gelände gründete Rabindranath Tagore 1901 eine Hochschule, die er Shantiniketan (Wohnstatt des Friedens) nannte. Bedingt durch die Lage fernab von den großen Städten, war sie als Internat konzipiert, und zwar nach der Regel des Brahmacharya: Zusammenleben von Schüler und Lehrer. In Shantiniketan sollte nicht nur eine moderne Ausbildung vermittelt werden, sondern zugleich eine Generation von Indern heranwachsen, die einerseits umfassende wissenschaftliche Kenntnisse besaß, andererseits aber die spirituelle Tradition des alten Indien bewahrte. „Ich habe in Shantiniketan jene ganz besondere Atmosphäre innerer Sammlung gespürt,“ sagt David-Neel, „in die alles getaucht war. Vorlesungen fanden im Schatten großer Bäume statt, und danach ergingen sich die Studenten, ein Buch in der Hand, im Park. Die Umgebung war wie geschaffen für Studium und Reflexion. Die Dozenten wohnten in kleinen Häusern auf dem Universitätsgelände oder in unmittelbarer Nähe; ihre Unterkünfte waren ebenso einfach und nüchtern wie alles übrige. Die Zulassung von Studentinnen stellte einen kühnen Emanzipationsversuch dar in einer Zeit, in der Frauen sich, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, zu Hause aufhalten mussten und sich vor keinem Mann zeigen durften, Ehegatte und nahe Verwandte ausgenommen. Der Tag begann in Shantiniketan mit einer Andacht, die in einem völlig schmucklosen, weiträumigen Saal stattfand. Auch Hochschulinsassen waren dort versammelt, sangen Hymnen oder lauschten einer kurzen Lesung. Ähnliche Versammlungen wurden abends oder gelegentlich zu religiösen Festen abgehalten.
Tagore (Thakur) revolutionierte in einer als „Bengalische Renaissance“ bekannten Zeit die bengalische Literatur mit Werken wie Ghare baire (dt. Das Heim und die Welt) oder Gitanjali und erweiterte die bengalische Kunst mit einer Unzahl von Gedichten, Kurzgeschichten, Briefen, Essays und Bildern. Als engagierter Kultur- und Sozialreformer sowie Universalgelehrter modernisierte er die Kunst seiner Heimat durch den gezielten Angriff auf deren strikte Struktur und klassische Formensprache. Zwei seiner Lieder sind heute die Nationalhymnen von Bangladesch und Indien: Amar Shonar Bangla und Jana Gana Mana. Thakur wurde als Gurudeb bezeichnet, ein Ehrentitel, der sich auf Guru und Deva bezieht.
*
„Aurobindu Gosche besitzt fraglos höchst bemerkenswerte intellektuelle Fähigkeiten, aber er ist auch ein gefährlicher Mann. Ihm haben wir es zu verdanken, dass Mr. Ash einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist.“
Ich hatte noch nie etwas von Mr. Ash gehört, vermutlich ein britischer Beamter.
Ich antworte lediglich, dass es mir höchst unwahrscheinlich vorkomme, diesen Philosophen als Mörder zu verdächtigen.
„Er hat Mr. Ash mit Sicherheit nicht eigenhändig umgebracht, sondern ihn töten lassen“, entgegnet der Polizeichef.
Dazu konnte und wollte ich mich nicht weiter äußern, und so endete unser Gespräch“, berichtet uns David-Neel.
Jedoch nimmt nach ihr Shri Aurobindo eine Sonderstellung ein. „Er wurde“, schreibt sie weiteres im Buch „Mein Indien“, „am 15. August 1872 in Kalkutta geboren als Sohn des Arztes Krishna Dhan Ghose, der dem Brahmo-Samaj nahestand und sich ganz am abendländischen Denken orientierte. Im Alter von sieben Jahren wird Aurobindo mit seinen beiden Brüdern nach England geschickt, wo er die renommierte St.-Pauls-Schule besucht und später aufgrund seiner außergewöhnlichen Begabung ein Stipendium am King's College in Cambridge erhält. Hier studiert er Latein, Griechisch, Französisch und Deutsch und erwirbt eine umfassende humanistische Bildung.
Als sein Vater 1893 stirbt, kehrt er nach Indien zurück, wo er Professor für englische Sprache und Literatur am Baroda College und später Leiter des National College wird. Wie schon in England engagiert er sich für die Befreiung Indiens von der britischen Kolonialherrschaft, gründet zur Unterstützung dieses Kampfes eine Zeitschrift und wird schließlich wegen seiner Aktivitäten im Untergrund verhaftet. Nach einjähriger Untersuchungshaft wird er 1909 freigesprochen und entkommt 1910 in die französische Enklave Pondicherry, um sich einer neuerlichen Verhaftung zu entziehen.
Eine entscheidende Entwicklung trat in seinem Leben ein, als er im Dezember 1907 mit dem Guru Vishnu Bhaskar Lele aus Maharashtra zusammentraf. Durch dessen Hilfe vertieften sich seine Kenntnisse und Erfahrungen der Yoga-Inhalte so sehr, dass er fortan seiner eigenen Idee der Yoga-Entwicklung folgte.
Seine endgültige Konversion vom aktiven Nationalisten zum Hindu-Weisen und Seher geschah während des einen Jahres, in dem er im Gefängnis in Alipur bei Kolkata inhaftiert war. Dort las und meditierte er über die Bhagavad Gita, was ihn zu folgender Aussage über das Wesen der HinduReligion brachte: „Das ist die Religion, die zum Heil der Menschheit in der Abgeschlossenheit dieses Landes seit alters wertgehalten worden ist. Diese Religion zu vermitteln, dazu erhebt sich Indien. Indien erhebt sich nicht, wie andere Länder es tun, um seiner selbst willen oder um die Schwachen niederzutreten, wenn es stark geworden ist. Indien erhebt sich, um das ewige Licht, das ihm anvertraut ist, über die Welt auszubreiten.“
David-Neel berichtet von einem Treffen mit dem „Guru“: „Dort habe ich ihn in einem kleinen, an eine Mönchszelle erinnernden Raum der Mission gesehen, wo er zusammen mit einigen befreundeten Schülern lebte. Seine umfassende Kenntnis indischer und abendländischer Philosophie trat sofort zutage, was mein Interesse jedoch weit mehr erregte, war seine magnetische Persönlichkeit und der hypnotische Einfluss, den er auf seine Gefährten ausübte. Das Zimmer, in dem wir uns befanden, enthielt lediglich einen Tisch mit zwei Stühlen an den Längsseiten. Sri Aurobindo saß mit dem Rücken zu einem großen, geöffneten Fenster, das Aussicht bot auf den weiten opalgrünen Himmel Indiens. Er bildete den Hintergrund, von dem sich die Gestalt des Gurus abhob – kein Bauwerk, kein Baum beeinträchtigten die Wirkung. Ob es sich hier um eine bewusste Inszenierung handelte, vermag ich nicht zu beurteilen, auch wenn manche Berichte von Besuchern dafür sprechen. Ihnen zufolge zeigte sich Shri Aurobindo zwar in seinen letzten Lebensjahren nur noch vor seinen engsten Vertrauten, ließ sich aber ein- bis zweimal jährlich hinter einem Vorhang nieder, unter dem nur seine Füße hervorschauten. Seine Bewunderer durften dann vorbeidefilieren und sich niederwerfen, um den Füßen des Meisters ihre Verehrung zu bekunden. Diese Darstellung entspräche zumindest dem in Indien Gurus gegenüber gepflogenen Brauch, den ich schon erwähnte. Unterwürfige Gesten dieser Art mögen Außenstehende zwar peinlich berühren, für die meisten, die sie ausführen, sind sie jedoch eine bloße Formsache, etwa dem Hutziehen vergleichbar.
Während sich Sri Aurobindo mit mir unterhielt, standen vier junge Leute an einer Tischecke, anbetend, ekstatisch. Hochgewachsen, stämmig, reglos, die Augen unverwandt auf den Meister gerichtet, glichen sie einer Gruppe von Standbildern. An einer bestimmten Stelle hätte ich Shri Aurobindo gern ein paar detailliertere Fragen gestellt und wünschte mir im Innern, allein mit ihm zu bleiben. Ob er meinen Gedanken erriet oder den gleichen Wunsch hatte, weiß ich nicht, aber plötzlich, ohne ein Wort oder eine Geste von ihm, marschierten alle vier gleichzeitig ab, stumm, steifbeinig – wie Marionetten.
Eine Kleinigkeit, die man nicht überbewerten sollte. Die Entstehung des Ashram ist der Tatkraft von Mira Alfassa zu verdanken, die aus einer türkisch-ägyptischen Familie stammt, in Frankreich aufgewachsen ist und ab 1920 zur ständigen Weggefährtin Sri Aurobindos wurde, von den Schülern nur „Die Mutter“ genannt. Ich habe sie während ihrer Pariser Jahre gut gekannt und die gemeinsamen Spaziergänge im Bois de Boulogne, die anregenden Abende in ihrer Wohnung in denkbar bester Erinnerung. Unsere freundschaftlichen Beziehungen sind über die Jahre hinweg erhalten geblieben.“
Nach dem Tod von Shri Aurobindo am 5. Dezember 1950 übernimmt die „Mutter“ auch die spirituelle Führung der Schüler, die ihr großes Vertrauen und Verehrung entgegenbringen. Manche von ihnen behaupten, der Meister sei nach wie vor spürbar gegenwärtig im Ashram, seine Gegenwart und sogar die der „Mutter“ seien identisch. Diesen Gedanken dokumentiert auch ein von der „Mutter“ verfasstes „Gebet“?!
„In den Trauerkundgebungen bei Sri Aurobindos Tod offenbaren sich die Gefühle, mit denen man auch im modernen Indien den großen Gurus begegnet: Staatstrauer, überschwengliche Beileidsbekundungen vom Präsidenten der Republik, von Pandit Nehru und vielen hochrangigen Repräsentanten des Öffentlichen Lebens. Schätzungsweise 60.000 Menschen kamen aus allen Teilen Indiens nach Pondicherry, um an dem Toten vorbeizudefilieren, der auf einem mit weißem Satin bespannten Bett aufgebahrt lag, mit einem spitzenumsäumten seidenen Überwurf und wegen der Räucherstäbchen ständig erneuertem Blumenschmuck. Viele Gläubige erwarteten, dass sich um das Totenbett Wunder ereignen würden. Es geschah nichts dergleichen! Lediglich einige Schüler haben behauptet, leuchtende Ausstrahlungen am Leichnam ihres Meisters wahrgenommen zu haben“, wie beim Auftritt eines jugoslawischen Heilers in Hall in Tirol, wo jeder Zweite behauptete, er habe einen goldenen Schein um den Heiler strahlen gesehen. Eher hat die schweigsame Erscheinung des Mannes im eine „Aura von Gold“ eingebracht, sagte meine Mutter, welche bei dieser Vorführung anwesend war.