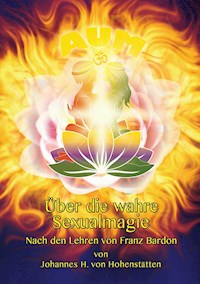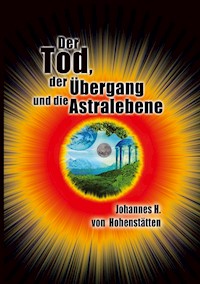Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses mehrbändige Werk ist eine Sammlung der besten und wahren okkulten Kurzgeschichten, Romane, Aufsätze, Berichte und Erlebnisse, wie sie die hermetische Literatur uns bieten kann. Diese Geschichten sind heutzutage nicht auffindbar. Es ist uns eine Freude, diese Perlen der okkulten Literatur der Öffentlichkeit vorzustellen. Für jeden ist etwas dabei, was ihn in großes Erstaunen versetzen, ihn unterhalten und sein Wissen bereichern wird. Vorwort 1. Ein Vortrag von Dr. Georg Lomer 2. Stunde der Besinnung 3. Der Graf Gagilostro 4. Das Selbst 5. Abenteuer des Dr. Faustus 6. Geschichten aus Indien 7. D. D. Home 8. Die weiße Dame 9. Das Gespenst im Gasthaus 10. Die letzte Sitzung 11. Das Haus des Dr. Faust 12. Der Vampir 13. Marschalls von Bassompierre 14. Der Golem des Rabbi 15. Die Golemsage 16. Der Golem in der Rabbinischen Kabbala 17. Golem-Geschichten um Rabbi Löw 18. Metamorphosen 19. Die Affenpfote 20. Die flüsternde Mumie 21. Der Poltergeist 22. Das Grauen von den Sternen 23. Kosmische Bewusstsein 24. Astralwanderung 25. Mann und Frau 26. Eine Biografie über Dr. Franz Hartmann 27. Magie im Alltag 28. Der Fall Drost 29. Aus meinen Erfahrungen 30. Der Tod und die Schätze der Inkas 31. Fotografie der Geister 32. Die Methoden der Hypnose
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Dank geht an Peter Windsheimer für das Design des Titelbildes.
Für Schäden, die durch falsches Herangehen an die Übungen an Körper, Seele und Geist entstehen könnten, übernehmen Verlag und Autor keine Haftung.
Inhaltsangabe:
Vorwort
Ein Vortrag von Dr. Georg Lomer
Stunde der Besinnung
Der Graf Gagilostro
Das Selbst
Abenteuer des Dr. Faustus
Geschichten aus Indien
D. D. Home
Die weiße Dame
Das Gespenst im Gasthaus
Die letzte Sitzung
Das Haus des Dr. Faust
Der Vampir
Marschalls von Bassompierre
Der Golem des Rabbi
Die Golemsage
Der Golem in der Rabbinischen Kabbala
Golem-Geschichten um Rabbi Löw
Metamorphosen
Die Affenpfote
Die flüsternde Mumie
Der Poltergeist
Das Grauen von den Sternen
Kosmische Bewusstsein
Astralwanderung
Mann und Frau
Eine Biografie über Dr. Franz Hartmann
Magie im Alltag
Der Fall Drost
Aus meinen Erfahrungen
Der Tod und die Schätze der Inkas
Fotografie der Geister
Die Methoden der Hypnose
Vorwort:
Da Anion immer wieder sagte, dass manchmal okkulte Geschichten am besten irgendwelche hermetischen Probleme beleuchten, haben wir uns entschlossen, eine wirklich gute Sammlung von okkulten Geschichten und wirklich interessanten und wahren Berichten zu veröffentlichen. Vorab muss ich noch sagen, dass es leider nur sehr wenig okkulte Literatur gibt, die aussagekräftig wäre. Manch ein Buch wird zur Zeit publiziert. Aber unsere kleinen Romane, Kurzgeschichten und Tatsachenberichte würden leider untergehen, da sie großteils unbekannt sind. Sie wurden in den frühen 20igern in okkulten Zeitschriften wie „Psyche“, „Zentralblatt für Okkultismus“, „Prana“, „Weiße Fahne“ und anderen veröffentlicht und wer kann heutzutage schon behaupten, er hat sich da durchgelesen. Wohl die Wenigsten. Aus diesem Grund veröffentlichen wir alle die Geschichten, die gut, sinnreich und die wir gefunden haben. Ich hoffe, unser Leser ist mit dem 13. Band dieser Reihe der Literatur zufrieden.
1. Ein Vortrag von Dr. Georg Lomer.
,Das „Hannoversche Tageblatt“ brachte folgenden Bericht über einen Vertrag des bekannten Nervenarztes: Ein Blick in die Zukunft! Allerlei vom Wahrsagen. Dieses Thema behandelte am Sonnabend abend im dichtgefüllten Beethovensaale der Stadthalle der bekannte hannoversche Nervenarzt und Vorsitzende der hiesigen Arbeitsgemeinschaft okkultistischer Vereinigungen Dr. Georg Lomer. Auf das Altertum zurückgreifend, ging der Vortragende zunächst auf die Astrologie ein, von der er betonte, dass man hier keineswegs von einer sog. Spekulationswissenschaft reden könne, sondern dass es sich bei ihr um eine auf festen Füßen stehende Erfahrungswissenschaft handele. Heute scheine eine neue Blütezeit der durch die Vervollkommnung der Astronomie jetzt erheblich gefestigten Astrologie zu kommen. Diese Wissenschaft, von deren richtigen Berechnungen der Redner manches Beispiel gab, dürfe und könne aber nur von Fachgelehrten ausgeübt werden. Man müsse nur die Augen offenhalten, dann finde man in manchen alten Wahrsagungen und Gebräuchen einen tiefen Sinn, der mit Aberglauben durchaus nichts zu tun hat. Was die Handlesekunst betreffe, so könne er sagen, dass ein Kenner sich nur die Hand anzusehen brauche, um zu erkennen, wes Geistes Kind er vor sich habe. Zweckmäßig sei die Ausübung der Handlesekunst besonders bei Kindern zur Feststellung von Talenten und Intelligenzen. Die Prophetie sei eine Wissenschaft, die jeder sich erst mit viel Geschick und zäher Ausdauer aneignen müsse. Stets komme es dabei auch sehr auf die Persönlichkeit des Ausübenden und seine mediale Eignung an. Niemals sollte man die Prophetie – ganz gleich welcher Art – zum Gesellschaftsspiel herabwürdigen. Maßhalten sei unbedingt erforderlich, kritiklose Hingabe erwiesenermaßen und unter allen Umständen gesundheitsschädlich. Der künstliche Weg zur Erlangung prophetischer Fähigkeiten sei voller Schwierigkeiten und Gefahren, fraglos der beste sei der natürliche, vom Weltengeist geführte Weg. Hier sei insbesondere das Gebiet der Wahrträume und der symbolischen Vorzeichen zu beachten, aus denen man nicht nur auf die Zukunft einzelner, sondern oft auch auf die Zukunft der Völker schließen könne. Eine ganze Reihe von Vorzeichen über die Gestaltung der Völkerschicksale liege vor. Der Vortragende erwähnte hier u. a., dass Australien und Kanada sich – ohne blutige Kämpfe – vom Mutterlande England, trennen würden. Man sollte nie den Kontakt mit der Oberleitung verlieren; denn das ganze Leben sei parallel anzusehen zum Willen des großen Weltenlenkers. Diese Auffassung kam auch zum Ausdruck in den Versen, mit denen der Vortragende seine mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Ausführungen schloss und an deren Schluss es hieß: „Der Himmel weiß viel mehr als alle Philosophen!“
2. Stunde der Besinnung!
Peryt Shou
Die innere Rastlosigkeit der Gegenwart erhält durch die Besinnung ihr notwendiges Gegengewicht. Wenn der Anspannung des Tages die rechte Entspannung folgt, so vollzieht sich, physiologisch gesehen, ein für unsere körperlich-seelische Gesundheit, genauer gesagt, für die Ausbalancierung unserer inneren Seelenkräfte bemerkenswerter Akt! Wir versuchen in das Gleichgewicht, in die Äquilibrität (Aufhebung des inneren Spannungszustandes) unserer Seelenwaage, mit der wir nicht nur uns selbst wägen, sondern auch gewogen werden, zurückzupendeln!
Es ist hier zunächst das Unbewusste, das, wie vielfach im Leben ausgleichend in unser Dasein eingreift. In der Philosophie wie in der neueren Psychotherapie erfährt es, wie bei E. von Hartmann, Herbart, Freud und Jung, seine besondere Bewertung. Die Sucht nach Selbstbetäubung, mit anderen Worten ein süchtig gewordener Organismus kann die innere Waage zum Versagen bringen: sie pendelt nicht mehr, gleichsam sich selbst aus balancierend, sondern wird gehemmt. Ein im medizinischen Sinne süchtig gewordener Organismus wird dem Einbruch biologisch negativer Komplexe offen.
Aber die Besinnung kann uns retten! Sie wacht an der Grenze der lichten und dunklen Weltsphäre! Ihre Entwicklung setzt voraus, dass zwei Kräfte im Gleichgewicht gehalten werden. Und dies bedeutet, auf den Menschen selbst angewendet, dass er die Polarität seiner Natur in Denken und Leidenschaft meistert, im Walten der beiden Pole seines Wesens, des Logos und Bios!
Dr. Herbert Fritzsche hat in seinem Werk: „Der Erstgeborene“ auf das, was unserer Lebensbestimmung als gleichsam transzendentaler Impuls zugrunde liegt, aber für die Harmonisierung unserer Natur in Zeiten schwierigster Lebenslage besonders wichtig ist, eindringlich hingewiesen: Bios und Logos, in das rechte Gleichgewicht gesetzt, bieten sich der Überwelt, dem Geistgebiet, demutsvoll an; „sie ermöglichen es dem Menschen, seine Sinne, die in Verbindung mit dem Hirn der Weltwahrnehmung dienen, in Stunden der Stille zur Überwelt zu erheben!“ Dann, heißt es weiter: „Der Sympathikus (als Sitz des Bios) ist nicht nur Vorgänger, sondern geradezu Vorbereiter des Hirns (als Sitz des Logos). Aber älter als beide ist die Überwelt, aus der alle Schöpfungsimpulse stammen. Älter als alle ist Gott!“
Wir können diesen Sympathikus mit einer Waage vergleichen, deren Zünglein richtig und auf die Mitte einzustellen wir uns bemühen. In dieser Mitte liegt der Gleichgewichtspunkt für die Ausbalancierung unseres Ichs, nachdem es bisher durch die Bewegungen des Bios aus dem Gleichtakt mit dem Logos herausgerüttelt war. Das Gleichgewicht der Kräfte ist erreicht. Es tritt ein sog. „Indifferenz“-Zustand ein, d. i. ein Zustand, in welchem die beiden Dynamiden, die beiden Pole unseres Wesens, der „zerebrospinale“, d. i. der Bewusstseins-Apparat, und das unbewusste oder vegetative Lebenszentrum ins Gleichgewicht getreten sind. In diesem sog. Indifferenz-Zustand kann ein Drittes, für unsere Entwicklung als Mensch, als Glied einer totalen Schöpfung Unentbehrliches sich einschalten, aktiv werden: Wir werden offen für das, was nicht nur wir, sondern was die Natur in ihrem Gesamtaspekt, von dem wir ja letzthin nur ein Teil sind, mit uns vorhat! Dies sog. „Indifferenzfeld“ spielt auch in der neueren Physik, besonders im Reich der Atombombe eine bedeutsame Rolle. Gibt es nun jenseits unseres Denkens und Fühlens eine Erlebnissphäre des göttlichen Wortes? Hegel und Schelling nannten diese Erlebnissphäre den Logos! Sie griffen zurück auf Heraklit und Plato, und zwar findet sich das Logos-Erlebnis in seiner ältesten Prägung bei Heraklit: „Der Logos kann nicht begriffen werden, bevor er nicht vernommen wird“, ist gleichsam der Grundsatz dieses Erlebnisses. Das Vernehmungsvermögen, die Ur-Vernunft ist bei Heraklit zugleich Sinn! Und das ist entscheidend. Wir sind sinnverbunden an das All und seine Ordnung. Vernunft ist keine abstrakte Welt, aus der die Ideen hervorgehen. Sondern wir sind fühlend, mitschwingend, sinnen wach auch von innen her dem Gesamtsein, der Welt verbunden! Hinhörend auf das Wesen der Welt vernehmen wir die göttliche Ordnung! Das ist der höchste Gewinn der Besinnung in den Stunden der Stille!
3. Der Graf von Cagliostro.
Wieland brachte in seinem „Teutschen Merkur“ März 1781 unter dem Titel „Ein neuer Thaumaturg“ den nachfolgenden Bericht, der als zeitgenössisch und unbefangen wohl von Interesse ist:
„Von Straßburg wird geschrieben, dass sich daselbst seit einigen Monaten ein Fremder aufhalte, der, ohne Arzt zu sein, sich gleichwohl als solcher die erstaunlichste Reputation macht. Er nennt sich einen Grafen von Cagliostro und man sagt, er besitze chymische Geheimnisse, die ihn in den Stand setzen, Wunderdinge zu tun. Er hat bereits über 300 Kranke unter Händen, von welchem ihm noch kein einziger gestorben ist, und worunter sich einige in Umständen befinden, worin man sonst keine Rettung mehr für möglich hält. Einer von diesen, der ohnlängst in einer Konsultation von vier Ärzten und Wundärzten verurteilt war, an den Folgen eines fürchterlichen Krebses längstens binnen zweimal vierundzwanzig Stunden zu sterben, nahm in dieser Not seine Zuflucht zu unserm Fremden. Der Herr Graf von Cagliostro gab ihm einige Tropfen ein und siehe da, der Sterbende geriet in einen starken Schweiß. Das von Krebs angegriffene Glied begann wieder aufzuleben und nach fortgesetztem Gebrauch der Milch von Ziegen, in deren Futter der Graf verschiedene Zubereitungen mischt, ist der Kranke mit dem bloßen Verlust einiger Knöchel an den Zehen soweit hergestellt, dass die Wunden sich bereits geschlossen haben. Man kann sich nach dieser Probe vorstellen, wie viel wunderbare Dinge von diesem neuen Äskulap erzählt werden. Viele wollen ihn für keinen Italiener halten. Andere vermuten, dass er ein Franzose sei und der Erbe der Geheimnisse des berühmten Adepten, der unter dem Namen Graf St. Germain schon lange in Europa gesehen worden ist und kraft eines geheimnisvollen Elixiers wirklich schon über 200 Jahre alt sein soll. Wie es nun damit auch sein mag, soviel ist gewiss, dass der Herr Graf Cagliostro ein sehr gutes Haus und eine Menge Bedienten hält und sich für seine Kuren schlechterdings unter keinerlei Benennung nichts bezahlen lässt. Ein Umstand, der nicht wenig dazu beiträgt, den Nimbus des Wunderbaren, der sich um eine so außerordentliche Person zu verbreiten pflegt, zu vergrößern.“
4. Das Selbst
Karl Heise
Es gibt gar nichts Einfacheres in der Welt von Manas (göttliches Gemüt) – in der Welt der höheren Wahrnehmungen und der Empfindung göttlichen Lebens –, als zum folgerechten Begriff des „Selbst“ zu gelangen, jenes Erhabenen „Etwas“, von dem die Veden sagen, dass es Atman, d. i. „Höchster Geist“, sei, das die Hindus das „Brahman“ oder „Para-Brahman“ nennen, die esoterischen (wirklichen) Christen als „Christus“ verehren, und von welchem Gautama Siddartha (der Buddha) nach dem 160. Verse des Dhammapada sagt: „Selbst ist der Herr des Selbstes, wer könnte sonst wohl sein Herr sein?“
So leicht aber auch die Erkenntnis dieses „Selbst“ möglich ist, so wenig wird es doch in seiner wahren Wirklichkeit erkannt. „Ehe nicht der Erkenner das Erkannte wird, fehlt ihm die Fähigkeit der Erkenntnis“, möchte man sagen, wenn man nicht das Bibelwort anwenden will: „Es sei denn, dass Ihr werdet wie die Kinder“, einfach in Eurem Denken, alles in Liebe umfassend, nichts sezierend und zerstückelnd, denn: „So (wie Ihr jetzt seid) werdet Ihr das „Reich Gottes“ (das Selbst) nicht sehen“.
Um des „Selbsts“ teilhaft zu werden, um ganz hinter dessen Bedeutung für das universale Weltgeschehen und das individuelle Leben zu kommen, lehrt der Buddha: „Der Weise soll aus seinem Selbst (dem [irdischen, persönlichen] Denken und Handeln) alle Unreinheit entfernen, wie der Schmied das Silber von den Schlacken läutert, allmählich, Stück für Stück und zur rechten Zeit“.
Wir ersehen aus diesen Andeutungen, wie leicht, und doch auch wie schwer, dieses „Selbst“ sich uns offenbaren will. Indess´ ist niemand vollauf glücklich, der es nicht kennt. Glücklich aber möchten wir alle sein. Was ist nun das „Selbst“?
Hören wir, was im elften Shloka des Mundaka-Upanishad des Atharva-Veda gesagt ist: „Brahman (das Selbst) ist dies Unsterbliche im Osten, Brahman im Westen, Brahman im Süden und Norden. Brahman (das Selbst) erstreckt nach unten sich und oben, Brahman (das Selbst) ist dieses (Innerlichste im) herrlich große(n) Weltall.“
Das „Selbst“ oder „Brahman“ ist jenes Erhabene Eine, dem Immanuel Kant als „Ding an sich“ nahezukommen suchte und das bei Arthur Schopenhauer zum „Subjekt im Objekt“ wird. Schopenhauer sagt von ihm: „Dasjenige, was Alles erkennt und von keinem erkannt wird, ist das Subjekt. Es ist der Träger der Weh, die durchgängige, stets vorausgesetzte Bedingung alles Erscheinenden (Formenhaften). Das Subjekt (Selbst) liegt nicht in Raum und Zeit: (es) ist ganz und ungeteilt in jedem vorstellenden Wesen; daher ein Einziges . . .“
Mit anderen Worten: das „Selbst“ ist jene Eine Kraft, jene Eine Energie, jene Eine Substanz, die nötig ist, um eine Welt der Gestalten und Formen, der sichtbaren, greifbaren Dinge oder „realen Wirklichkeiten“ hervorzubringen. Es ist „Alles in Allem“, das A und O (das Alpha und Omega), „der Anfang und das Ende“. Und doch ist es nicht das Sichtbare und Fassbare selbst, – denn was sichtbar und greifbar ist, unterliegt dem Werden und Vergehen; das Eine oder „Selbst“ aber vergeht nicht. Es kann verstanden werden als das „Feuer“ der Zoroastrier oder das „Atash-Behram“ (der allbelebende Geist) der Parsen, als das „Elmsfeuer“ der alten Germanen, als die „Fackel“ des Apollo, als der „brennende Busch“ des Moses, als die „brennende Lampe des Abram“, als der „große Atem“ der indischen Adepten, als das „brütende Prinzip“ der Kabbalisten, jene „mystische Flamme“, die alle zeitlichen Daseinsheiten „entzündet“ (werden lässt) und wieder in sich aufzieht. Es ist dieses „Selbst“ jener „Ewige Fluss“ in der Philosophie Heraklits, und es ist jenes Ewig-Seiende im Buddhismus, das dort als „die wesentliche Natur aller lebenden Wesen gedacht ist und auch der „Buddha des Ewigen Lebens“ genannt wird.
Der Japaner Zitsuzen Ashitsu sagt von Ihm, dem Buddha des Ewigen Lebens (dem Selbst), folgendes: „Wenn wir unser Gemüt von allem Unreinen befreien und aus der Nacht der Torheit in das Licht der Gotteserkenntnis treten, so sind wir selbst Eins mit Buddha, dem Erleuchteten. Diese „Persönlichkeit“ Buddha´s (die Eine Selbstheit) ist über die Zustände, welche man „Leben“ und „Tod“ nennt, erhaben.“
Auf S. → des „Buddhist“, 1906, lesen wir: „Der Buddha des Ewigen Lebens“ (das Selbst) ist unermesslich: Er ist weit jenseits der Erkenntnis des gewöhnlichen Menschen.“
In der vollen Erkenntnis dieses vorchristlich erfassbaren Selbst oder „Buddha“ aber liegt die Seligkeit nirvanischen Friedens, jene unermessliche Wonne, die für die neuzeitliche Welt von Christus als das „Einssein mit dem Vater“ gefeiert worden ist.
„Was es ist (dieses Einssein, dieses Seligsein), kann nicht in die Worte, welche unsere schwachen Lippen fassen, gekleidet werden; aber obgleich niemand sagen kann, was . . . (es) (das Seligsein) ist, so können wir doch aufs stärkste sagen, dass es ist.“
Ja, fürwahr, es ist! – Es ist durchaus keine Abstraktheit, dieses Selbst, sondern es ist die Höchste Realität, die ein „kindlich“ Gemüt, ein von Voreingenommenheit und Spekulationen freier Mensch empfinden kann.
Der Unterschied zwischen materialistischem Monismus und esoterischem Monismus ist groß. Der Esoteriker darf von sich behaupten, dass er hinter die Kulissen des großen Lebensdramas zu „blicken“ vermag, wenn er vom „Selbst“ als der „Ewigen Wahrheit in sich selbst“ spricht, von der jeweilig nur einzelne Aspekte (Betätigungen) und Daseinsformen wahrgenommen werden, die aber nichtsdestoweniger die Ewige Wahrheit offenbaren. In der Bhagavad-Gita (einer anderen Lehre vom Selbst) heißt es: „Unter tausend Menschen gibt es kaum einen einzigen, der . . . mich (das Selbst) in Wahrheit erkennt. Meine materielle Natur teilt sich in Erde, Wasser, Luft, Äther, Gemüt und Sonderbewusstsein (Wachbewusstsein, Bewusstsein von der „Andersheit“ als der [das] „Andere“. Erkenne Du aber nun meine höhere (geistige) Wesenheit, welche das Weltall belebt.
Wisse, dass die obengenannten Elemente den Mutterleib aller existierenden Dinge bilden (von Geist zu „Form“ gehend). Ich aber (das Selbst) bin die Quelle, aus der das ganze Weltall (und also auch die Mutter-Elemente) entspringt und in die es zurückkehrt.
Es gibt nichts, das über Mir (dem Selbst) ist. Das All ist an Mich (das Selbst) geknüpft, wie Perlen an eine Schnur. Ich bin das Erfrischende im Wasser, Ich bin das Licht des Mondes, das OM (Om oder Amen, der Tempel der Erkenntnis), der Lobgesang und die Herrlichkeit, die in den Veden scheint, (Ich bin) der Ton, der im Äther klingt, und in Männern die Manneskraft.
Ich (das Selbst) bin der Erde Wohlgeruch und der Glanz des Feuers, das Leben in allem Lebendigen und die Entsagung in dem Entsagenden.
Wisse, dass Ich in allen Dingen der unsterbliche Same bin. Ich bin der Verstand der Verständigen und die Herrlichkeit in den Herrlichen.
Ich bin die Stärke der Starken, frei von (ihrer) Habsucht und Leidenschaft (die in persönlichem Dünkel, in illusorischem Wähnen wurzelt). Ich (das Selbst) bin diejenige Liebe in allen Wesen, welche von keinem Gesetze verboten ist . . .
Toren glauben, dass Ich (das „Selbst“), der Formlose und Unsichtbare, eine sichtbare Form hätte. Sie erkennen nicht meine geistige, höhere Natur, welche unvergänglich und über alles (Formenhafte) erhaben ist.
Durch Meinen mystischen Zauber verhüllt, bin Ich (das Selbst) nicht jedermann (sondern nur den Weisen) offenbar. Die betörte Welt kennt Mich, den Unerschaffenen, Ewigen nicht.
Ich (das Selbst) kenne alle Wesen, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen, aber keines kennt Mich.“
Dieses „Selbst“ ist „jene Wesenheit“, die in allem webt, alles bewegt, alles durchebbt, alles durchflutet, zum Leben entfacht und im „Sterben“ auch noch „Eins mit ihm“ ist. Innerhalb dieses Selbst vollziehen sich Leben und Tod, und doch ist es zugleich „jenseits“ von beiden. Es steht ebenso hinter dem „Guten“ als hinter dem „Bösen“ (denn das sind nur relative Begriffe), die es durchdringt.
Wenn wir uns vom „Selbst“ einen Begriff bilden wollen; so wäre es vielleicht angebracht, an uns selbst „ein Exempel zu statuieren“. Wir haben im Wachsein ein Ich-bin-Bewusstsein, wir fühlen, dass wir sind: „Cogito, ergo sum“ – „Ich denke, und deshalb bin ich“ sagte Cartesius (Rene Descartes), der französische Philosoph (1629–1649).
Wir fühlen dieses unser „Ich“ oder „Ich-bin“ in unseren Gedanken, in unseren Worten und Handlungen, in unserem gesamten physischen und geistigen Organismus. Ja, wir fühlen dieses unser „Ich“ pulsieren in jedem einzelnen Teile unseres materiellen Körpers und in jeder Gedankenform, die wir bilden (die sich in uns bildet). Dessen ungeachtet aber ist ein Glied unserer rechten oder linken Hand, unser Kopf oder Arm, oder irgendein Wort aus unserem Munde, oder ein Federstrich, den unsere Hand zieht, nicht unser „Ich-Selbst“. Dagegen wird jedes Gliedmaß und jede einzelne Tat unseres physischen oder psychischen Apparates „überschattet“ (geleitet) von unserem eigentlichen „Bewusstseinsubstrat“ (dem unserem Wesen zugrundeliegenden „Etwas“). Dieses „Bewusstseinsubstrat“ könnten wir, um eine Erklärung zu ermöglichen, dem Universalen, Einen, „Selbst“ vergleichen. Da gewahren wir, wie unser „Ich“ unser Gedankenleben zum „Guten“ oder zum „Bösen“ anleitet, wie es unsern Körper zum Gehen und Laufen veranlasst, wie wir feilschen und handeln auf dem Markte usw., alles wird getrieben, geleitet und beeinflusst von unserem gewöhnlichen „Selbst“, das der „Herr“ über unsere Hand, wie unseren Mund und unsere Gedanken ist.
Analog ist´s um das Eine Wahre Selbst bestellt, um das sich die Ausführungen dieses Aufsatzes drehen. Ist uns unser Ich-bin-Bewusstsein klar als der Lenker unserer persönlichen Angelegenheiten vor Augen getreten, so haben wir leicht auch das universale Selbst erkannt, jenes „unergründliche Ding an sich“. Im Lichte des Einen Universalen Selbst fällt dann freilich unser kleines persönliches „Ich-bin“ dahin. Denn dann wird ja eben das „Eine Selbst“ unser Selbst, „unser eingebildetes kleines Selbst“ geht im „Universalen Selbst“ auf, – das Universale Selbst wird zum Lenker und Leiter unserer Persönlichkeit, und wir werden somit zu einem Gliede innerhalb der Erscheinungs-(Formen-)Welt. Damit zugleich aber gewinnen wir Anteil am gesamten Universum und seiner Unteilbarkeit im geistigen Sinne, darinnen unsere Unsterblichkeit begründet ist. Doch nicht nur das. Absorbiert („saugt auf“) das Eine Universale Selbst unser Selbst, so nimmt es auch das Selbst der anderen Wesen in sich auf, – oder umgekehrt: Ist einmal unser kleines Selbst im Ewig-Einen Universalselbst erwacht, dann erkennen wir innerlichst auch die übrigen Selbste der anderen Menschen, und ebenso auch die Gruppen-Selbste der Tiere und Pflanzen, der Steine, wie auch die Selbste der ,,Götter“ oder Engel, Erzengel oder Zeitgeister usw., je nachdem wir uns zu den über uns stehenden Lichtgestalten und zum Christus erheben. Inbezug auf das Eine Wahre Selbst sehen wir dann alle Wesen der Welt in der Linie des Menschen stehen. Und wir begreifen wieder nun die Wahrheit des Satzes: „Wenn ein Mensch auf den Pfaden des Erbarmens wandelt, wäre es da möglich, dass er absichtlich (und nutzlos) einem Wesen Qual bereiten könnte?!“
Der „Christus“ (das „Wahre Selbst“) der in der Form des Menschen leiden wollte und litt, weil die Gesamtheit der menschlichen Formen sich selbst als „Göttliche Selbste und Eines Selbst“ noch nicht erkannten, und ER ihnen deshalb „Weg und Ziel“ wurde, ER ist doch zugleich das lobsingende, erlösende, auferstandene Selbst, sobald ER erkannt wird. „Erkenne Dich selbst!“ ist noch immer das Rätsel der Sphinx, das gerade in heutiger Zeit der Not gelöst werden will und muss, womit dann auch der vierte Epheserbrief lebendig wird: „Ein Leib und Ein Geist, Ein Herr, Ein Glaube (ein geistiges Wahrnehmen), eine Taufe (ein Ozean der Erkenntnis)“.
Die wahre Gnosis (Erkenntnis) gewinnt je mehr an Schönheit und Gedankenfülle, je mehr man liest in den Werken, in denen sich das Selbst offenbart.
„Wer jenes Höchst und Tiefste (des Selbsts) schaut, dem spaltet sich des Herzens Knoten, dem lösen alle Zweifel sich.“
Denn siehe: „In gold´ner, herrlichster Fülle Staublos und teillos Brahman (das Selbst) thront. Glanzvoll, der Lichter Licht (der Weisen Lebensglück) ist es, und dies erkennt, wer den Atman (eben dieses Eine Brahman oder Selbst) kennt.“
„Als frei, beruhigt und leidlos,
Als unaussprechlich höchste Lust,
Als ewig, ewigen Objekts
Allbewusst, schildern Kenner es (das Selbst).“
In der Bhagavad-Gita, dem „Hohen Liede der Unsterblichkeit“ leuchtet das „Selbst“ auf im Lichte Krishna´s (des personifizierten „Wahren Selbsts“ das zum „niedrigen, falschen Selbst“ (Ardjuna genannt) also spricht: „Wer sich mit reinem Herzen Mir (dem Selbst) ergibt, und was er tut, in Meiner (Höchst-Selbst-Einen) Kraft vollbringt, dem (falschen) Selbst entsagend, sich in Mir (dem Wahren Selbst) befestigt, und Tag und Nacht sich Meinem Dienste weiht, den werd´ ich sicher aus der Sturmflut (irdischer Drangsal) heben; im Wogenschwall des Lebensmeeres soll er nicht versinken; Ich (das Wahre Selbst) errette ihn, weil er in Mir die rechte Rettung sucht. So wende Mir (o Mensch) Dein Herz vor allem zu, erfasse Mich mit Deinem ganzen Wollen, lass Deinen Geist in mir die Ruhe finden und streb´ empor zu Meiner Seligkeit!“
Den Menschen zieht freilich das niedrige Selbst noch immer hinab, und immer wieder entschwindet ihm „Lohengrin“, der Repräsentant des (Wahren Selbst) „brautlos“ dahin. „Mein lieber Schwan! – Ach, diese traur ´ge Fahrt, Wie gern hätt´ ich sie dir erspart!“
Gegen dieses falsche, ewig leidbringende Ich-Selbst wollte auch Nietzsche die Menschen zum Kampfe rufen. Mit welchem Erfolge er es vermocht, das zeigt uns die Gegenwart, in der Feindschaft das Panier noch immer höher entfaltet. In seinem „Zarathustra“ predigt dieser einsame Dichter: „Werkzeug Deines Leibes ist auch Deine kleine Vernunft, mein Bruder, die Du „Geist“ nennst . . .
„Ich“ sagst Du, und bist stolz auf dieses Wort. Aber das Größere ist – woran Du nicht glauben willst – Deine große Vernunft (das Wahre Selbst): Die sagt nicht „Ich“, aber tut „Ich“.
Was der Sinn fühlt, was der (niedrige) Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Aber (irdischer) Sinn und (verblendeter) Geist möchten Dich überreden, sie seien aller Dinge Ende: So eitel sind sie!
„Werk- und Spielzeuge sind (niederer) Sinn und Geist: Hinter ihnen liegt noch das (Wahre) Selbst. Das (Wahre) Selbst sucht auch mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes.
„Immer horcht das Selbst und sucht: Es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des (wähnenden, falschen) „Ich´s“ Beherrscher.
„Hinter Deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser – der heißt (Wahres) Selbst! In Deinem Leibe wohnt er.“
„Dein (Wahres) Selbst lacht über Dein (falsches) „Ich“ und seine stolzen Sprünge.“
Verstehen auch viele heute noch nicht den Sinn der besten Dichter und Denker, so wird doch die Zeit der Erkenntnis kommen. Verstehen wird dann „jedes Kind“, was Franz Ewers mit seinem „fünften theosophischen Psalm“ sagen wollte: „Und ich danke Dir, der Du in mir bist! Und ich danke Dir, der Du über mir bist! Ich habe Dich (das Selbst) gefühlt. Und Deine Flammen haben mich trunken gemacht! Mein Auge war durstig nach den Melodien Deines Lichtes – und mein Herz klopfte Dir entgegen. Und ich habe Dich gefunden: In mir, in meinem Innersten.
Wer Dich da erkannt hat, der kennt keine Reue mehr und keine schleichenden Schmerzen; Der weiß nichts von Sünde und ahnt sein wahres Ich. O, Du großer Geist (Du mein Selbst), Du All-Liebe, Ich danke Dir!“
Selbstsucht ist die größte Tugend und zugleich das größte Laster der Menschen. Wohl dem, der sein Selbst sucht und sein Selbst findet; doch wehe dem, der sein gefundenes Selbst hausieren trägt.
Das Selbst ist wie eine giftige Natter und wie der Lorbeer, der eines siegenden Kämpfers Stirne umkrönt.
Das Selbst ist der Erde Größtes und des Himmels Eigentum. Es fesselt zur Erde und verankert mit sieben Tauen die Ewigkeit.
Das Selbst ist der Erde Lust und der Gandharven Stärke. Es ist der beiden Lobgesang.
Hüte Dich aber vor dem Selbst. Entfliehe dem Selbst. Doch indem Du fliehest, vergiss nicht, dem Selbst Dein Früh-, Mittag- und Abendopfer darzubringen.
Das Selbst ist der Tyrann der Welt und der König des Lebens. Er ist der Liebling der Frauen und der Schwertknauf der Männer.
Hüte Dich vor dem Selbst. Schaue umher im Lande und auf den Gassen nach den Altären des Selbst. Und wo Du deren einen erblickst, reiße ihn nieder. Aber bedenke, dass das Selbst Dein eigener Herzog ist, der Dich zu Deinem Kampfe führt, und dass das Selbst der Altäre bedarf, wenn Du Deine Opfer zu bringen hast.
Auf! Suche das Selbst, und diene ihm!
Doch diene ihm nicht, ehe Du selbst der Herr des Selbst geworden bist. Im Dienen liegt Gehorsam, lebendiger Friede, höchste Weisheit und niedrigste Sklaverei.
Fürchte das Selbst! Es zermalmt Dich und alle Deine Brüder. Stündlich lauert es Dir auf. Zermalmt aber gibt es Dich frei. Zermalme es! Doch lasse auch Dich zermalmen!
Gib Dich ihm ganz! Doch gib Dich ihm, nachdem Du es zertreten. Aber es zertritt Dich zuvor. Es schonet nicht die, die sich ihm bieten.
Wie ein ungeheuerlicher Drache lauert es allem auf, was sich ihm naht. Und was sich ihm nicht naht, das sucht es auf. Aber es presst sich selbst aus, wie eine Zitrone.
Sein Rachen ist wie der eines hungrigen Haies, der nie satt wird. Aber es wohnet sich wohlig in seinem unersättlichen Bauche. Mache Dich zum Hausherrn in diesem Bauche; bist Du bloß Mieter, so wirst Du zerdrückt.
Es ist immer ein Unterschied zwischen dem Herrn und dem nur Geduldeten.
Hüte Dich vor dem Selbst. Alles verschlingt es! Selbst im Fliehen eilt es Dir nach und packt Dich. Das Selbst ist schneller denn Du. Hüte Dich! Freund und Feind zugleich ist Dir das Selbst.
Liebe sie beide, den Freund und den Feind. Gewinne Dir seinen Hass und seine Liebe. In seiner Liebe bist Du selig, und in seinem Hass der Vater Deiner Liebe. Ich liebe Die, die das Selbst lieben und das Selbst hassen. Dich, mein Bruder, suche ich in dem erlesenen Kreise.
Doch nur dann liebe ich Dich ganz, wenn Du wie Faust den Zauberring um Dich ziehst, wenn Du den Weihrauchkessel schwingst, und Deine Kreuze gegen Morgen und Abend machst. Ich liebe Den, der unterliegt und im Unterliegen lacht. Den, der lachend wieder aufsteht. Im Lachen wohnt Leben, im Lachen beschämt sich das Selbst. O sonniges Selbst; das das Lachen erträgt! Es eint sich dem Selbst zum Ewigen Selbst!
5. Abenteuer von Dr. Faustus
Dr. Faustus zauberte einem Ritter ein Hirschgeweih an den Kopf
Als der Doktor Faustus dem Kaiser sein Begehren erfüllte, hat er sich abends, als man bei Hofe zu Tisch blies, auf eine Zinne gelegt, das Hofgesind aus- und eingehen zu sehen. Da sieht nun Faustus hinüber in der Ritter Wohnung einen schlafend am Fenster liegen, denn es war der Tag gar heiß gewesen; die Person hab´ ich nicht nennen wollen, weil es ein Ritter und geborener Freiherr war. Ob nun wohl dies Abenteuer dem Freiherrn zum Spott gereichte, so half der Geist seinem Herrn fleißig dabei und zauberte ihm ein Hirschgeweih auf dem Kopf. Als er nun erwachte und den Kopf bewegte, empfand er die Schlakheit, denn er konnte mit dem Kopf weder hinter sich noch für sich, was der Kaiser wahrnahm und sich wohl gefallen ließ, bis ihm endlich Doktor Faustus den Zauber wieder aufhob.
Dr. Faustus sieht alle Dämonen in ihrer wahren Gestalt
Des Doktor Faustus oberster Fürst und Meister kam eines Tages ihn zu besuchen. Doktor Faustus erschrak nicht wenig vor seiner Greulichkeit, denn unangesehen, dass es Sommer war, ging eine so kalte Luft vom Teufel, dass Doktor Faustus vermeinte, er müsste erfrieren. Der Teufel, so Belial (Verderben) nannte, sprach: „Dr. Faustus, um Mitternacht, da du erwachtest, hab ich deine Gedanken gesehen, dass du gerne etliche der vornehmsten höllischen Geister sehen möchtest. So bin ich mit meinen vornehmsten Räten und Dienern erschienen, dass du ihrer ansichtig würdest.“
Dr. Fautus antwortet: „Wohlan, wo sind sie denn?“
„Draußen“, sagte Belial.
Die anderen erschienen auch in Gestalt unvernünftiger Tiere, wie Schweine, Rehe, Hirsche, Bären, Wölfe, Affen, Biber, Büffel, Böcke, Geißen, Eber, Esel. Dr. Faustus verwunderte sich darüber sehr und fragte die sechs zunächst stehenden, warum sie nicht in anderer Gestalt erschienen wären. Sie antworteten, sie könnten sich in der Hölle nicht anders verwandeln, außer in Menschengestalt. Hierauf sagte Dr. Faustus, es wäre genug, wenn die sechs da wären, und bat den anderen Urlaub zu geben, was auch geschah. Darauf begehrte Faustus, sie sollten ihn eine Probe sehen lassen von ihrer Kunst. Das ward ihm gewährt, und einer nach dem anderen verwandelte sich in allerlei Tier und Vogelgestalt. Das gefiel dem Dr. Faustus wohl, er fragte, ob er es auch könnte. Sie sagten ja und warfen ihm ein Zauberbüchlein (geladene Formeln) hin und er sollte seine Probe machen: Das tat er.
Ehe sie nun Probe nehmen wollten, konnte Dr. Faustus nicht umhin zu fragen, wer denn das Ungeziefer erschaffen habe. Sie sagten, nach dem Fall des Menschen sei auch das Ungeziefer erwachsen dem Menschen zur Plage und zum Schaden.
„Wir können uns auch selbst in allerlei Ungeziefer verwandeln so gut als in andere Tiere.“
Dr. Faustus lachte und begehrte das zu sehen. Da verschwanden sie vor ihm und alsbald erschien in des Dr. Faustus Gemach allerlei Ungeziefer als Ameisen, Egel, Kuhfliegen, Grillen, Heuschrecken, also dass sein ganzes Haus voll Ungeziefer ward; sonderlich verdross in das Ungeziefer, das ihm am Leibe plagte, z. B. die Ameisen beschmutzten ihn, die Bienen stachen ihn, die Mücken fuhren ihm ins Angesicht, die Flöhe bissen ihn, dass er zu wehren hatte, die Läuse plagten ihm auf dem Kopf und unter dem Hemde, die Spinnen fuhren auf ihm herab, die Raupen krochen auf ihn, die Wespen zerstachen ihn. Kurz, er ward so geplagt, dass er sagte: „Ich glaube, dass ihr alle junge Teufel seid.“
Also konnte Dr. Faustus in der Stube nicht mehr verbleiben; sobald er sie aber verließ, verspürte er keine Plage mehr an sich; auch verschwanden sie stracks alle miteinander.
Wie Dr. Faustus in die Hölle fuhr
Dr. Faustus hatte nun 8 Jahre mit forschen, fragen und lernen zugebracht. Dabei träumte er allezeit von der Hölle. So forderte er also von seinem Geist Mephistopheles, er solle ihn seinen Herrn Belial oder Luzifer kommen lassen. Sie schickten ihn aber einen anderen Teufel: Baalzebuth, welcher den Doktor fragte, was sein Anliegen sei. Da verlangte er, dass ihn ein Geist in die Hölle und wieder heraus führen möchte, dass er der Hölle Eigenschaft, Fundament und Stoff erlernen möchte.
„Ja“, antwortete Baalzebuth, „um Mitternacht ziehe ich deinen Astralkörper heraus und wir fahren in die höllischen Sphären.“
Als es nun Nacht war, erschien ihm Baalzebuth nahm ihn bei der Hand und flugs waren sie in der Astralwelt. Bald darauf kamen sie auf einen hohen Berg, daraus Feuerstrahlen von Pech und Schwefel schlugen mit solchem Ungestüm und prasseln, dass der Dr. Faustus aufschreckte.
Sein Dämonenführer fuhr mit ihm in dieses Feuer hinein, aber Faustus empfand keine Hitze, da ihn der Geist davor schützte. Er sah jede Menge von Dämonen bei ihrer Arbeit, einen Hirsch mit großen Hörnern und Flügeln Namens Furfur kam auf ihn zugesaust und wollte ihn attackieren, doch Baalzebuth vertrieb ihn.
Er sah Schlagen und Ungeziefer schweben, die alle unsäglich groß waren. Auch ein fliegender Bär kam ihm entgegen. Plötzlich sah er einen geflügelten Stier aus einem Höllentor hervor kommen, der direkt auf Faustus zurannte und riss ihn von seinem Geiste los. Er fiel in unsagbare dunkel tiefen, sah seinen Führer nicht mehr und glaubte schon, mit seinem Leben den Astralritt zu bezahlen zu müssen. Doch Baalzebuth fand ihn wieder und rettete ihn. Währenddessen überzog die Hölle ein dichter finsterer Nebel, dass er eine Weile gar nichts sehen konnte. Hierauf tat sich eine Wolke auf, daraus zwei große drachenähnliche Pferde flogen, die einen Wagen nachzogen; auf den setzte sich der Doktor. Sie fuhren immer tiefer in die Finsternis und plötzlich zuckten Blitzstrahlen auf Faustus zu. Doch er konnte erneut entkommen und strandete auf einer einsamen höllisch, spitzen Klippe, aus rotem Gestein, unheimlich anzusehen. Er blickte sich um und ihm kam das Grauen.
„Das ist also die Hölle. Schrecklich anzusehen.“
Er hörte ein Gestöhne, ein Schreien, nahm ein Zittern wahr und der Gestank nach Schwefel und verbrannten Fleisch drehte ihm seinen Magen um. Doch bevor er ohnmächtig wurde, kam Baalzebuth und half im wieder hoch und er war wieder mit seinem Körper verbunden. Doch er war so was von matt, erschöpft, platt und ausgelaugt, dass er nie mehr wieder dort rein wollte. Er sah immer und überall nur die Höllenflammen der dämonischen Sphäre. Er meinte schon verrückt zu werden. Und er wusste, dass er ohne die Führung und den Schutz seines Dämon die Astralreise nicht überlebt hätte.
Dr. Faustus Reise in den Sternenhimmel
Als ich eines Tages nicht schlafen konnte und über das Firmament nachdachte, wie es beschaffen sein konnte, da kam plötzlich ein Brausen und Sausen in meinem Haus auf und eine Stimme sagte: „Wohlan, deines Herzen Ludt und Begehr soll dir erfüllt werden!“
„Wenn ich das zu sehen bekomme, an was ich dachte, so komme ich gerne mit.“
„Guck aus dem Fenster und du wirst das Gefährt sehen, dass dich durch die himmlischen Sterne führt.“
Das tat ich und sah einen Wagen mit 12 feurigen Pferden und die Stimme schrie erneut: „Spring auf!“
„Ja, aber ihr müsst mir gestatten, dass ich fragen zu meiner Astralreise stellen darf.“
„Ja, dieses Mal ist es erlaubt.“
Ich sprang auf und der Wagen mit den teuflischen Pferden fuhr immer höher und höher. Je höher ich kam, desto finsterer wurde die Welt. Das Zeitgefühl verlor sich genauso wie der Raum. Mein Geist Mephistopheles erschien und erklärte mir den Sachverhalt.
„Sieh!“, und er deutete nach unten und ich sah Asien, Afrika und Europa und er zeigte mir sämtliche Länder der Erde.
Dann guckte ich nach oben, sah den Himmel so hell und sich schnell wandeln, sah die Sonne, die so heiß war, dass mein Geist mich davor schützen musste und ich im unendlich dankbar war. Ich meinte schon, die riesengroße Sonne würde mich verbrennen! Ich konnte auch den Anblick der Sonne nicht mehr ertragen. Sie war zu hell! Sie war so groß, wie das gesamte Universum. Und jeder Stern stellte eine eigene Welt dar, dessen Mittelpunkt er ist.
Meine Astralreise dauerte dieses Mal acht Tage und ich konnte meinen Kalender danach wieder neu einrichten.
6. Geschichten aus Indien
,,Am Ufer der Ganga lebte einst ein Einsiedler und beobachtete einem Gelübde zufolge unverbrüchliches Schweigen. Er nährte sich von Bettelbrot, und eine Menge anderer Bettelmönche umgab ihn als seine Jünger. Sein Heim war eine Tempelklause.
Eines Tages, als er, um Nahrung bittend, an die Tür eines Kaufmanns klopfte, kam dessen schöne Tochter heraus, ihm die Speise zu reichen; und dieses Mädchen war so wunderhold, dass ihre Anmut alsbald des Mönches Herz bestrickte.
Da rief der Schurke: „Wehe! Wehe!“, so laut, dass es der Kaufmann hören musste. Dann nahm er die erbettelte Gabe und kehrte nach seiner Klause zurück.
Der Kaufmann ging ihm nach und fragte ihn verwundert, als sie ohne Zeugen waren, warum er heute plötzlich durch jenen Ausruf sein Schweigen gebrochen habe. Da antwortete ihm der Bettelmönch: „Böse Zeichen trägt deine Tochter an ihrem Leibe. Ihre Vermählung würde für dich nebst Sohn und Gattin den sicheren Untergang bedeuten. Und da ich sie gesehen, ward ich sehr betrübt, denn du bist mir ergeben. Darum habe ich mein Schweigen durch jenen Ausruf gebrochen, um deinetwillen. Nun aber höre! Nimm heute, wenn es Nacht wird, deine Tochter und lege sie in eine Kiste. Auf diese stelle ein Licht und setze sie in der Ganga aus.“
In seiner Angst versprach der Kaufmann, zu gehorchen, und als die Nacht gekommen, tat er alles, wie ihm geheißen. Denn die Furcht beraubt die Leute ihres gesunden Verstandes.
Währendem sagte der Mönch zu seinen Schülern: „Gehet hinab an die Ganga, so werdet ihr eine Kiste schwimmen sehen, mit einem Lichte darauf. Diese bringet herbei, doch so, dass euch niemand gewahre. Und hütet euch, sie zu öffnen, auch wenn ihr ein Geräusch in ihr vernehmen solltet.“
Seine Schüler gehorchten und gingen. Doch waren sie noch nicht an den Strom gekommen, als von ungefähr ein Königssohn an dessen Ufer niederstieg. Der ward auf die von dem Kaufmann ausgesetzte Kiste durch den Schein des Lichtes aufmerksam und ließ sie von seinen Dienern schnell ans Land ziehen. Neugierig, befahl er, sie zu öffnen; da bot sich seinen Blicken in ihr jenes holde Mädchen dar, und also bald erkor er es zu seiner Gemahlin. In die Kiste ließ er dafür einen scheußlichen Affen sperren und sie mitsamt dem Lichte wieder in die Ganga bringen.
Als nun der Königsspross mit dem erbeuteten Juwel gegangen war, kamen die Schüler des Mönches auf ihrer Suche an diesen Ort. Sie fanden die Kiste und trugen sie zu ihrem erfreuten Meister. Dieser sagte zu ihnen: ,,Schaffet sie nur hinauf in die obere Zelle und lasset mich dann allein. Ich habe eine Beschwörung vor. Ihr aber leget euch unten zur Ruhe und verharret die Nacht im Schweigen.“
Also trugen sie die Kiste hinauf, und als sie ihn allein gelassen, öffnete er sie. Denn sein Herz sehnte sich nach der Kaufmannstochter.
Da aber sprang ein Affe heraus von entsetzlicher Gestalt und stürmte auf ihn ein. Hässlich war er, wie die fleischgewordene Ungezogenheit, und in seiner Wut zerfetzte er mit seinen Zähnen des Mönches Nase und mit den Nägeln seine Ohren, gerade als hätte er das Strafrecht studiert.
Gehörig zugerichtet, kam der Mönch herunter. Seine Schüler konnten sich bei seinem Anblick kaum des Lachens erwehren. Am nächsten Morgen aber war die Sache schon ruchbar, und alle Leute lachten ihn aus.
Der Kaufmann hingegen und seine Tochter waren froh; denn das Mädchen hatte einen trefflichen Gatten gefunden.“
*
Pischel hat unter dem Titel „Gutmann und Gutweib in Indien“ Parallelstellen zu Goethes gleichnamigem Gedichte gesammelt, in denen die Pointe immer darauf hinausläuft, eine infolge einer Wette schweigend dasitzende Person zum Bruch ihres Schweigens zu bringen. So geraten einmal vier Narren in Streit darüber, wem von ihnen der Segen eines Heiligen gegolten habe, dem sie begegnet sind. Dem Dümmsten, lautet dessen Entscheidung. Jeder will nun der Dümmste sein und erzählt zum Beweise dessen eine Geschichte. Über den dritten heißt es: „Der dritte Narr lag einmal mit seiner Frau im Bette. Da beschlossen sie nach seinem Vorschlag, dass derjenige, der zuerst spräche, zehn süße Kuchen dem andern geben müsse. Als sie so still lagen, kam ein Dieb in das Haus und nahm alles, was zu stehlen war. Als der Dieb schon auf das Untergewand der Frau seine Hand legte, sprach die Frau den Mann an: „Was? Wirst du auch jetzt ruhig zuschauen?“
Da verlangte der Mann die versprochenen zehn Kuchen, weil sie zuerst das Schweigen gebrochen hatte.“
*
Bei Dubois sagt der Brahmane Anantaya zu seiner jungen Frau einst beim Schlafengehen, die Frauen seien Schwätzerinnen. Sie antwortete ihm, sie kenne auch Männer, die ebenso geschwätzig seien wie die Frauen. Der Brahmane fühlte sich dadurch getroffen. Sie wetteten, wer zuerst sprechen werde, und bestimmten als Gewinn der Wette ein Betelblatt. Darauf schliefen sie ein, ohne ein Wort zu sprechen. Als sie am nächsten Tage sich nicht außer dem Hause zeigten, und auf Rufen und Pochen die Tür nicht öffneten und keine Antwort gaben, ließen die Leute die Tür durch einen Zimmermann erbrechen, weil sie glaubten, das Ehepaar sei während der Nacht plötzlich gestorben.
Nach Öffnung der Tür fand man Mann und Frau mit gekreuzten Beinen vollkommen gesund dasitzen, aber der Sprache beraubt. Alle Mittel, sie zum Sprechen zu bringen, blieben vergeblich, so dass man an eine Verhexung glaubte. Die Eltern des Mannes ließen einen berühmten Zauberer kommen, der das Ehepaar für einen hohen Preis zu entzaubern versprach. Als er sich dazu anschickte, erklärte ein befreundeter Brahmane, es handle sich nur um eine natürliche Krankheit, die er ohne Kosten heilen wolle. Er machte ein Goldstäbchen an einem Kohlenfeuer heiß und stieß es dem Manne in die Fußsohlen, unter die Ellbogen, in die Herzgrube und schließlich in den Scheitel des Kopfes. Der Mann ertrug die Schmerzen, ohne einen Laut von sich zu geben. Als aber der Brahmane das glühende Goldstäbchen an die Fußsohlen der Frau brachte, zog sie schnell das Bein zurück und rief: „Genug, genug!“ Sie erklärte sich für besiegt und reichte dem Manne das Betelblatt, der nun seine Behauptung bestätigt fand, dass die Frauen Schwätzerinnen seien.
*
Die Frau eines Bettlers hat fünf Stück einer bestimmten Sorte von Reiskuchen (muffies) gebacken. Da ihnen der Gedanke, dass die Hälfte von fünf zweieinhalb ist, nicht kommt, geraten sie bei der Teilung in Streit. Sie einigen sich schließlich dahin, dass sie sich schlafend stellen wollen, und dass der, der zuerst ein Auge öffnet oder spricht, zwei Kuchen, der andere drei Kuchen bekommen soll. Als sie 3 Tage lang nicht im Dorfe erschienen waren und die Haustür sich als von innen verriegelt erwies, stiegen zwei Dorfpolizisten durch das Dach ins Haus und fanden Mann und Frau scheinbar tot daliegen. Auf Kosten der Gemeinde wurden sie nach dem Verbrennungsplatz geschafft und auf zwei Scheiterhaufen gelegt, die man in Brand steckte. Als das Feuer seine Beine erreichte, hielt der Bettler es doch für ratsam, die Wette aufzugeben. Während die Dorfbewohner fortfuhren, die Totengebräuche zu vollziehen, rief er plötzlich: „Ich bin mit zwei Kuchen zufrieden,“ und vom andern Scheiterhaufen antwortete die Frau: ,,Ich habe die Wette gewonnen; gib mir die drei!“ Entsetzt liefen die Bauern davon, weil sie glaubten, die Toten kämen als böse Geister wieder. Nur ein beherzter Mann hielt stand und erfuhr schließlich von den Bettlern die Geschichte.
*
Das sind nun freilich uralte Legenden, mythologische Erzählungen, die einer überaus weit zurückliegenden Zeit angehören, und man möchte wohl glauben, dass die alte Welt der Wunder, die darin geschildert ist, für die Hindus längst zu existieren aufgehört hat, dass dies aber keineswegs der Fall ist, zeigt u. a. eine Wundergeschichte aus dem Leben des Baba Nanak, des Gründers der modernen Sekte der Sikhs, der von 1469–1539 A. D. lebte. Während einer Rast auf einer jener ausgedehnten Wanderungen, die Baba Nanak auf der Suche nach Weisheit zu unternehmen pflegte, ging sein treuer Diener Mardanah aus, um für ihr rauchiges Feuer Brennholz zu sammeln. Nicht weit von ihrem damaligen Lagerplatz lebten sichtbarlich einige von jenen vollendeten Yogins, die als Siddhas bekannt sind; und sobald Mardanah eine kleine Menge Brennholz zusammen hatte, kam einer dieser Siddhas herbei und nahm ihm alles mutwillig weg. Der Früchte seiner Arbeit beraubt, kehrte Mardanah zu seinem erhabenen Meister zurück und berichtete, was ihm zugestoßen war. Ohne ein Anzeichen von Ärger holte Nanak sofort aus den Falten seines wallenden Gewandes einiges Reisig hervor, und mit diesem so wunderbar beschafften Brennmaterial zündete Mardanah das Abendfeuer an. Beschämt und ärgerlich, erregten die Siddhas einen heftigen Sturm, um Nanaks dhuni auszulöschen; aber die einzige Wirkung davon war, dass er ihr eigenes Reisig wegwehte und ihre eigenen Herde verlöschte. Trotz ihrer übernatürlichen Kräfte waren so die Siddhas genötigt, selber umherzugehen, um für sich selber Holz und Feuer zu holen; aber da Baba Nanak dem Genius des Feuers befohlen hatte, ihnen nicht zu helfen, so waren die Siddhas schließlich gezwungen, zu Baba zu kommen und ihn demütig zu bitten, ihr Reisig für sie anzuzünden. Nanak wollte jedoch ihre Bitte nur unter der Bedingung erfüllen, dass Goraknath, ihr vielverehrtes Haupt, ihm einen seiner Ohrringe und einen seiner Holzschuhe als Zeichen der Anerkennung seiner Minderwertigkeit sende. Um Nanak weiter auf die Probe zu stellen, forderten die Siddhas, die sich über ihre Niederlage ärgerten, ihn auf, ihnen dann und wann Milch zu geben. Er tat es auf der Stelle, indem er bloß das Wasser in einem dicht dabei gelegenen Brunnen sich in Milch verwandeln hieß. Die Verwandlung trat ein, gehorsam dem Winke des Heiligen, wobei die so hervorgebrachte Milch auf die Oberfläche heraufkam.
Nanaks nächstes Wunder in diesem Zusammenhange war, dass er Wasser vom Ganges herbeischaffte, da die Siddhas ihn gebeten hatten, sie mit frischem Flusswasser für ihr Morgenbad zu versorgen. Mardanah wurde mit einem Spaten ausgesandt, um eine fortlaufende Linie von dem fernen Flusse her zu ziehen, mit der Anweisung, auf keinen Fall sich umzusehen. Wie er den Spaten hinter sich entlangzog, folgte diesem ein Wasserstrom; als er sich aber der Stelle näherte, wo sein Meister seinen Sitz hatte, vergaß er in der Neugierde seine sonstige Gehorsamkeit und wandte wie Lots Weib den Kopf, um über seine Schulter zu sehen: Da hörte der Strom, der so weit mitgeflossen war, auf, weiterzuströmen. Die Siddhas sagten prahlerisch: „Jetzt wollen wir ihn mit unserer eigenen Kraft weiterfließen lassen“, aber ihre Anstrengungen waren ganz vergeblich.
Ärgerlich über diese Proben von Nanaks Überlegenheit, beschlossen seine Gegner auf eigne Faust einige Wunder zu vollbringen. Einige von den Siddhas begannen umherzufliegen oder ihre Gazellenfelle durch die Luft schweben zu lassen wie gewöhnliche Bewohner der Lüfte.
Ein dünkelhafter Siddha wollte auf Feuerflammen reiten, ein anderer auf einem Stück von einer Steinmauer, als wenn es ein Pferderücken wäre. Nanaks Gleichgültigkeit bei ihren Vorführungen außerordentlicher Kräfte brachten diese Thaumaturgen gewaltig in Eifer, und sie forderten ihn offen auf, etwas den von ihnen vorgeführten Wundern Ähnliches zu vollbringen, und wäre es auch nur um seines eigenen Kredits willen. Aber Baba Nanak brachte dagegen vor, dass er nur ein geringer Mann sei und ihnen nichts Überraschendes zu zeigen hätte, mit dem Bemerken, er würde sie finden, wo auch immer sie wären, wenn sie sich verstecken wollten. Die Siddhas nahmen die Herausforderung des Meisters zum Versteckespiel an. Der eine von ihnen flog in den Himmel hinauf und verbarg sich dort, ein anderer suchte einen Schlupfwinkel in den Schluchten des fernen Himalaja, ein dritter verbarg sich in den Höhlungen der Erde; aber Nanak fand sie bald einen nach dem andern und zog sie aus ihren Verstecken an den Locken heraus, die die Scheitel ihrer Häupter zierten. Nun war Nanak an der Reihe, sich zu verstecken, und die anderen mussten ihn suchen. Seine Tätigkeit dabei bestand darin, seine körperliche Hülle in ihre ursprünglichen Bestandteile, Feuer, Luft, Erde und Wasser, aufzulösen, während seine Seele mit Gott wiedervereint war. Die Siddhas konnten natürlich den zersetzten Meister nicht finden; aber er hatte ihnen vor seinem Verschwinden gesagt, wie sie ihn zur Rückkehr bringen könnten, falls sie, wie er voraussah, unfähig sein sollten, ihn zu entdecken. Sie sollten eine kleine Spende am Fuße des Baumes darbringen, an dem er gewöhnlich saß, und Gott um die Rückkehr Nanaks bitten, wenn er wieder erscheinen wollte. Völlig unterlegen, taten sie das, und Baba Nanak kehrte gnädiglich zurück.
*
Nanak lehrte, es gäbe keine Hindus und keine Muselmänner. Das brachte ihn in den Ruf der Verrücktheit. Auf das Antreiben des Kazi berief ihn der Navab Daulat Khan zu sich, um ihn über seine Lehre zu vernehmen. Es war gerade die Zeit des Mittagsgebets, und der Khan lud Nanak ein, ihn in die Moschee zu begleiten. Der Kazi betete vor; Nanak aber, statt andächtig zuzuhören, fing zu lachen an. Nach dem Gebet beklagte sich der Kazi über Nanaks unehrerbietige Aufführung. Darüber von dem Khan zur Rede gestellt, erwiderte er: Er habe gelacht, weil das Gebet des Kazi ein nutzloses gewesen sei. Aufgefordert, sich näher auszusprechen, fuhr er fort: Der Kazi habe in seinem Hofe, in dem ein offener Brunnen sei, ein junges Füllen gelassen, während des Betens habe er immer an das Füllen gedacht, es möchte in den Brunnen fallen. Auf dieses hin fiel der Kazi zu Nanaks Füßen und bekannte die volle Wahrheit. Dadurch stieg Nanak auf einmal in der Achtung aller, und der Khan entließ ihn gnädigst, nachdem er ihm noch all sein Vermögen angeboten hatte.
In Dilli soll er einen toten Elefanten wieder lebendig gemacht haben. Als aber der damalige Moghul, der davon hörte, Nanak aufforderte, den Elefanten zu töten und in seiner Gegenwart wieder lebendig zu machen, lehnte er dies klugerweise ab.
Auf seiner dritten Reise soll er die sonst giftigen Früchte und Blüten des Akk-Baumes in getrocknetem Zustande ohne Schaden für seine Gesundheit genossen haben.
Auf der vierten Reise, die ihn nach Mekka führte, legte er sich dort an der Kaabah nieder und streckte seine Füße zufällig gegen diese. Der Kazi Ruknuddln, der dies bemerkte, machte Nanak Vorwürfe wegen dieser Unehrerbietigkeit. Nanak erwiderte ihm: Lege meine Füße nach der Richtung, wo das Haus Gottes nicht ist. Der Kazi drehte die Füße Nanaks um, aber wohin er sie auch drehte, dahin richtete sich auch die Kaabah. Auf dieses Wunder hin küsste der Kazi Nanak die Füße und hatte eine lange Unterredung mit ihm, in der er selbstverständlich den Kürzeren zog.
Als er sein Ende herannahen fühlte, sagten die Mohammedaner, die um sein Lager herumstanden: „Wir wollen ihn begraben“; die Hindus dagegen: „Wir wollen seinen Leichnam verbrennen.“ Nanak aber befahl: „Leget Blumen zu meinen beiden Seiten, auf die rechte die der Hindus und auf die linke die der Muselmänner. Wenn die Blumen der Hindus bis morgen grün bleiben, so sollen sie mich verbrennen, wenn aber die der Muselmänner grün bleiben, so sollen sie mich begraben.“ Dann forderte er seine Schüler auf, Strophen zum Lobe Gottes zu singen. Als die Strophen beendigt waren, zog er seine Füße hinauf und schlief ein. Als sie das Tuch, womit er bedeckt war, aufhoben, war nichts darunter. Die Blumen beider Parteien blieben grün, und so nahmen die Hindus und Muselmänner ihre Blumen und gingen heim.
*
Als Kumarapala, ein Fürst von Gujarat, sich dem Jaina-Glauben zuneigte, riefen die Brahmanen den Rajacarya Devabodhi herbei. Dieser war ein großer Yogin, der sich die Göttin Bharati untertänig gemacht hatte, der Zauberei kundig war und die Vergangenheit und die Zukunft kannte. Nachdem der König gehört hatte, dass Devabodhi in die Nähe von Anhilvad gekommen war, empfing er ihn mit großen Ehren und führte ihn in seinen Palast. Mit den Empfangsfeierlichkeiten ging der größte Teil des Tages vorüber. Am Nachmittag verehrte der König ein Bild des Santinatha in Gegenwart des ganzen Hofes. Da ermahnte ihn Devabodhi, von dem Jaina-Glauben abzulassen. Als Kumarapala den letzteren wegen der Ahimsa-Lehre pries und den Srauta Dharma wegen Himsa tadelte, ließ Devabodhi die Götter Brahman, Vishnu und Siva, sowie die sieben Chaulukya-Fürsten Mularaja und seine Nachkommen erscheinen, die natürlich für die Religion des Veda sprachen. Am folgenden Morgen überbot Hemacandra Devabodhis Leistungen noch um ein Bedeutendes. Zuerst ließ er sich den Sitz wegziehen und führte das bei den Yogins angeblich sehr beliebte Kunststück aus, sich freischwebend in der Luft zu halten. Dann ließ er den ganzen Olymp der Jainas vor dem Könige erscheinen samt allen Vorfahren des Königs, welche die Jainas anbeteten.
*
Von den vielen Legenden, die über Hemacandra in den einschlägigen Sammlungen im Schwange sind, schildern bei Weitem die meisten seine übernatürlichen Kräfte, seine Gabe der Prophezeiung, seine Kenntnis der fernsten Vergangenheit, seine Macht über die bösen Geister und die dem Jaina-Glauben feindlichen brahmanischen Gottheiten. Im Prabhavakacantra wird eine Weissagung Hemacandras erwähnt, welche richtig in Erfüllung ging. Der König von Kalyanakataka, heißt es, der durch seine Späher erfahren hatte, dass Kumarapala ein Jaina geworden und machtlos sei, zog mit einem großen Heere aus, um Gujarat zu erobern. Voll Sorge ging Kumarapala zu Hemacandra und fragte, ob er diesem Feinde unterliegen würde. Hemacandra tröstete ihn, indem er sagte, dass die Schutzgöttinnen der Jaina-Lehre über Gujarat wachten, und dass der Feind am siebenten Tage sterben würde. Wirklich brachten Kumarapalas Spione bald darauf die Nachricht, dass die Prophezeiung eingetroffen sei.
Einen zweiten Beweis seiner Sehergabe lieferte Hemacandra, indem er dem Könige seine Geschichte in einem früheren Leben verkündigte.
Er hatte auch die Fähigkeit des Fernsehens. Einst, heißt es, saß Hemacandra mit dem König und dem Saiva-Asketen Devabodhi zusammen und erklärte die heiligen Schriften. Plötzlich hielt er inne und stieß einen lauten Wehruf aus. Devabodhi rieb sich die Hände und sagte: ,,Es macht nichts.“ Dann wurde die Erbauungsstunde fortgesetzt. Als Hemacandra geendigt hatte, fragte Kumarapala, was er mit Devabodhi gehabt hätte. Da antwortete der Mönch: „König, ich sah, dass eine Ratte im Tempel des Candraprabha zu Devapattana einen Lampendocht wegschleppte und dadurch eine Feuersbrunst entstand. Devabodhi löschte dieselbe, indem er sich die Hände rieb.“ Darauf sandte Kumarapala Boten nach Devapattana und fand, dass Hemacandras Angaben richtig waren.
Durch die Kraft seines Yoga heilte er auch Amrabhalta, der bei der Wiederherstellung des Tempels des Suvrata in Broach mit der Saindhavi Devi in Konflikt geriet und krank wurde. Desgleichen reinigte er den König Kumarapala kraft des Yoga vom Aussatz.
Dieser Fürst hatte gelobt, um das sechste Gelübde der Jainas zu erfüllen, während der Regenzeit nie seine Hauptstadt zu verlassen. Da erfuhr er durch seine Späher, dass der Saka-Fürst von Garjana, d. h. der mohammedanische Sultan von Gazni, sich vorgenommen hatte, gerade um diese Jahreszeit Gujarat mit Krieg zu überziehen. Kumarapalas Verlegenheit war groß. Wenn er sein Gelübde halten wollte, konnte er sein Land nicht verteidigen. Wenn er aber seine Herrscherpflichten erfüllen wollte, musste er dem Jaina-Glauben untreu werden. In diesem Dilemma wendete er sich an Hemacandra, der ihn sofort beruhigte und Hilfe versprach. Hemacandra setzte sich dann in die Lotussitz-Positur und gab sich tiefer Meditation hin. Nach einer Weile kam ein Paiankin durch die Luft geflogen, in dem ein schlafender Mann lag. Dieser Schläfer war der Fürst von Garjana, den Hemacandra durch die Kraft seines Yoga-Zaubers herbeigezogen hatte. Er wurde nur wieder freigelassen, nachdem er versprochen hatte, mit Gujarat Frieden zu halten und in seinen Staaten die Schonung aller lebenden Wesen während sechs Monaten zu gebieten.
Eine zweite Erzählung (bei Jinamandana) schreibt Hemacandra eine noch größere Macht zu. Einst hatte er mit Devabodhi einen Streit, ob es Vollmondstag oder Neumondstag sei. Er selbst hatte die erstere Behauptung aufgestellt, die aber irrig war, und wurde deshalb von Devabodhi verspottet. Trotzdem erklärte er sich nicht für besiegt, sondern versicherte, dass der Abend die Richtigkeit seiner Ansicht beweisen werde. Als die Sonne unterging, bestieg Kumarapala mit Devabodhi und seinen Baronen den Söller des Palastes, um zu sehen, ob der Mond aufgehen würde, und entsendete zur Vorsicht noch Boten auf einem schnellen Dromedare nach Osten. Wirklich ging der Vollmond im Osten auf, schien die ganze Nacht hindurch und ging am folgenden Morgen im Westen unter. Die königlichen Boten, welche weit in das Land hineingeritten waren, berichteten bei ihrer Rückkehr, dass sie dasselbe beobachtet hatten. Es war also nicht ein Blendwerk, das die Augen des Königs getäuscht hatte, sondern ein wirkliches Wunder, das Hemacandra mit Hilfe eines dienstbaren Gottes vollbrachte.
Der König selbst durfte sich übrigens auch eines hübschen Erfolges seiner Frömmigkeit rühmen. Wir lesen bei Bühler, dass bei dem Abschreiben der zahlreichen Werke des Hemacandra die Palmblätter ausgingen und keine Hoffnung vorhanden war, dass bald ein neuer Vorrat aus dem Auslande importiert würde. Kumarapala war tief betrübt, dass die Tätigkeit seines Lehrers unterbrochen wurde. Er ging in seinen Garten, wo viele gewöhnliche Palmbäume standen, verehrte dieselben mit wohlriechenden Substanzen und Blumen, legte mit Perlen und Rubinen verzierte goldene Ketten um ihre Stämme und betete, dass sie sich in Sritala-Bäume verwandeln möchten. Am folgenden Morgen meldeten die Gärtner, dass des Königs Wunsch erfüllt sei. Die Überbringer der frohen Nachricht wurden reich belohnt und die Schreiber arbeiteten munter weiter.
*
In Dandins Roman trifft Mantragupta einen Zauberer, dessen Leib mit flimmernden Menschenknochenstückchen als Schmuck bedeckt war, der sich mit dem Staub von den völlig verzehrten Kohlen feuerverbrannter Scheiter (d. i. mit Asche) bemalt hatte, der Flechten trug, anzusehen wie die Blitzranke, und der in ein Feuer, das ein Rakshasa (Zerstörer, verschlingender Unhold) war für die Finsternis des Waldbezirks, und dessen Flamme durch die Verzehrung des Augenblicks ergriffenen verschiedenen Brennholzes emporhüpfte – mit der linken Hand unaufhörlich knitternden und knatternden Sesam, weißen Senf usw. hineinstreute. Vor ihm stand mit gefalteten Händen und mit den Worten: „Gib deinen Befehl; womit kann ich dir dienen?“, der Diener. Und von dem überaus Niedriggesinnten ward ihm befohlen: „Geh, bring Kardanas, des Kaiingakönigs, Tochter, die Kanakalekha, aus dem Mädchenharem hierher!“ – Der tat also. Darauf packte der Zauberer sie, die in gewaltigem Schreck, mit tränenrauher Stimme und sehnsuchterfasstem Herzen: „Weh, Vater! Weh, Mutter!“ schrie, an ihren dichten Haaren, auf denen der um den Scheitel getragene Kranz zerknüllt und welk und das Band zerrissen war, und machte Anstalten, ihr mit einem an einem Stein geschärften Schwerte den Kopf abzuhauen. Wuppdich, riss ich das Messer aus seiner Hand an mich, hieb ihm damit den Kopf ab, mit dem dichten Flechtennetz daran, und steckte selbigen in eine Spalte im Stamme eines nahebei stehenden morschen Baumes . . .“
Ebenso böse endet die Beschwörung, die der Zauberer in der Märchensammlung „Fünfundzwanzig Geschichten eines Leichendämon“ (Vetalapancavimbatika) ausführt.