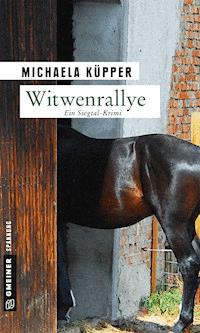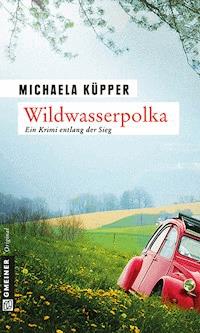9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michaela Küppers aufwühlender Roman über ein Frauen-Schicksal im Dritten Reich vor dem Hintergrund der sogenannten Kinderlandverschickung Das Ruhrgebiet im Sommer 1943. Die junge Lehrerin Barbara soll eine Gruppe Mädchen im Rahmen der sogenannten Kinderlandverschickung begleiten. Angst, aber auch gespannte Unruhe beherrschen die Gedanken der Kinder, denn sie wissen nicht, was sie erwartet. Das Heim, das ihr zeitweiliges Zuhause werden soll, erweist sich zunächst als angenehme Überraschung, doch dann muss dieses geräumt werden. Es beginnt eine Odyssee, die nicht nur die Kinder, sondern auch Barbara an ihre Grenzen führt, denn mehr und mehr wird sie, die sich bisher aus der Politik herauszuhalten versucht hat, mit den grausamen Methoden und Plänen der Nationalsozialisten konfrontiert – und mit Menschen, die für ihre Ideologie vor nichts zurückschrecken. Als schließlich ein Mädchen verschwindet und ein polnischer Zwangsarbeiter verdächtigt wird, kommt für die Lehrerin die Stunde der Entscheidung. Ein Roman über die Frage: Wie konnte man, konnte eine Frau unter dem verbrecherischen System des Nationalsozialismus anständig bleiben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Michaela Küpper
Der Kinderzug
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Ruhrgebiet im Sommer 1943. Die junge Lehrerin Barbara soll eine Gruppe Mädchen im Rahmen der sogenannten Kinderlandverschickung begleiten. Angst, aber auch gespannte Unruhe beherrschen die Gedanken der Kinder, denn sie wissen nicht, was sie erwartet. Das Heim, das ihr zeitweiliges Zuhause werden soll, erweist sich zunächst als angenehme Überraschung, doch dann muss dieses geräumt werden.
Es beginnt eine Odyssee, die nicht nur die Kinder, sondern auch Barbara an ihre Grenzen führt, denn mehr und mehr wird sie, die sich bisher aus der Politik herauszuhalten versucht hat, mit den grausamen Methoden und Plänen der Nationalsozialisten konfrontiert – und mit Menschen, die für ihre Ideologie vor nichts zurückschrecken.
Als schließlich ein Mädchen verschwindet und ein polnischer Zwangsarbeiter verdächtigt wird, kommt für die Lehrerin die Stunde der Entscheidung.
Ein Roman über die Frage: Wie konnte man, konnte eine Frau unter dem verbrecherischen System des Nationalsozialismus anständig bleiben?
Inhaltsübersicht
1. BARBARA SALZMANN
2. EDITH
3. BARBARA
4. EDITH
5. BARBARA
6. KARL
7. BARBARA
8. GISELA
9. KARL
10. EDITH
11. BARBARA
12. KARL
13. GISELA
14. KARL
15. BARBARA
16. GISELA
17. KARL
18. EDITH
19. BARBARA
20. EDITH
21. KARL
22. BARBARA
23. KARL
24. BARBARA
25. KARL
26. BARBARA
27. EDITH
28. GISELA
29. EDITH
30. GISELA
31. BARBARA
32. KARL
33. GISELA
34. KARL
35. EDITH
36. BARBARA
37. EDITH
38. GISELA
39. BARBARA
40. GISELA
41. BARBARA
42. EDITH
43. GISELA
44. KARL
45. GISELA
46. BARBARA
47. GISELA
48. EDITH
49. GISELA
50. KARL
51. BARBARA
52. GISELA
53. BARBARA
54. GISELA
55. BARBARA
56. EDITH
57. GISELA
58. BARBARA
59. KARL
60. BARBARA
61. KARL
62. BARBARA
63. KARL
64. GISELA
65. BARBARA
66. KARL
67. BARBARA
68. GISELA
69. BARBARA
70. NACHWORT
Quellen
1. BARBARA SALZMANN
24. September 1945
Die Stimmung an jenem Morgen, der das Ende ihrer 819-tägigen Odyssee einleiten sollte, war von einer so gleichmütigen, beinahe heiteren Gelassenheit, dass er sie fast glauben machte, es sei nie zuvor anders gewesen.
Die Schulbehörde hatte ihr fest zugesagt, einen Wagen zu schicken, der sie und die Mädchen innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden abholen und nach Hause bringen würde, komme, was wolle. Fahrzeug und Fahrer seien organisiert, für genügend Kraftstoff gesorgt, die Passierscheine bereits ausgestellt. Was also gab es noch zu befürchten? Sie beschloss, alle Zweifel beiseitezuschieben und die Muße zu genießen, die sich unerwartet auftat. Ein kurzer Morgenspaziergang schien ihr der richtige Auftakt zu sein.
Die Luft war kühl und frisch, jedoch nicht so klar und schneidend wie auf den Höhen des Großen Arber, sondern voller herbstlicher Aromen. Das Harz der Tannen, die wie dunkle Rauschebärte an den Bergen hingen, die taufeuchten Wiesen der Talsenke, das schlammige Ufer des nahen Bachlaufs: All das glaubte sie, beinahe schmecken zu können. Sie blieb einen Moment stehen, atmete tief durch, lauschte dem Gezwitscher der Vögel und dem Schnauben der Pferde, die in der Nähe grasten. Es waren schöne Tiere, ein Fuchs und ein Brauner, beide sahen wohlgenährt und gesund aus. In besseren Tagen hatte der Wirt sie vor den Landauer gespannt, um seine Gäste vom nahen Bahnhof abzuholen, was bei der Kundschaft immer sehr gut angekommen war. Der Landauer hatte den Krieg unbeschadet in einem überdachten Winkel hinter den Stallungen verschlafen, vom Bahnhof hingegen war nur ein Trümmerhaufen übrig geblieben: ein Stationsgebäude ohne Dach und Fenster, Überreste einer Trafostation, gesprengte Schienen, die sich halbkreisförmig hochbogen, als wollten sie die Loks geradewegs in den Himmel katapultieren. Einmal war sie mit den Mädchen dorthin gewandert und hatte den Schrecken in ihren Augen lesen können – wie auch die Enttäuschung. Von hier aus würde kein Zug heimwärts rollen.
Nur nicht mehr daran denken – heute gelang ihr das sogar beinahe. Die Sonne hatte inzwischen die Hügelkette erklommen und stand als hellgoldener Ball am Himmel, strahlendes Licht ergoss sich über den Kronenhof und die nahen Koppeln; die Kruppe des Fuchses schien Feuer zu fangen.
Sie hob das Gesicht der Sonne entgegen, schloss die Augen und gab sich ihrer weichen, hoffnungsvollen Stimmung hin, bis das Geschnatter der Mädchen sie aus ihren Gedanken riss. Dem Lärm nach hätte man glauben können, es wäre ein ganzes Klassenzimmer im Anmarsch – oder vielmehr die vollständige Oberschulklasse, deren Lehrerin sie einmal gewesen war –, nicht nur dieses versprengte Häuflein vierzehnjähriger Backfische. Munter durcheinanderplappernd drängten sie aus dem Wirtschaftseingang des Hotels, in dessen Küche sie sich nützlich gemacht hatten. Was die Amerikaner übrig ließen, war weit mehr und besser als der trockene Maiskanten mit dem Löffelchen Kunsthonig, den man ihnen offiziell zugestand: Hier gab es weiches weißes Brot, Butter und Marmelade, Wurst in runden Dosen, dazu ham and eggs. Wenn der Duft des gebratenen Specks in der Luft hing, lief einem unwillkürlich die Spucke im Mund zusammen, man konnte sich gar nicht dagegen wehren.
Auch die Soldaten verließen soeben den Kronenhof, allerdings durch das Hauptportal. Sie versammelten sich um die beiden großen Laster, die gestern Abend eingetroffen waren, besprachen sich kurz: Lieutenant Miller, dünn wie ein Streichholz, neben ihm der schwarze Riese mit den blitzenden Zähnen, von dem sie nur den Vornamen kannte – John –, dann der kleine Blonde mit dem weichen Blick, Stevens. Auch Sergeant Hoover war da, dazu sieben, acht weitere junge Kerle. Wie immer schienen sie keine Eile zu haben, es blieb ihnen Zeit genug, den Mädchen allerlei Unsinn hinterherzurufen. Die drehten prompt bei und steuerten auf die Gruppe zu. Wie versessen die Gören auf einmal darauf waren, ihr Englisch zu verbessern! Auch das Interesse der Amerikaner an der deutschen Sprache schien sich in den letzten Wochen enorm gesteigert zu haben. Sie sind zu jung, dachte Barbara kopfschüttelnd. Die Mädel sind zu jung, um sich als Unterhaltungsdamen für heimwehkranke amerikanische Boys einspannen zu lassen. Sie hätte dem Einhalt gebieten müssen. Eigentlich. Aber was sollte schon noch passieren? Morgen wären sie fort.
Der schwarze Riese sagte etwas, und alle lachten, Gisela am lautesten. Seit ihre Schwester Edith nicht mehr da war, war ihre Stimmung unberechenbar geworden. Der blonde Stevens gab eine Runde chewing gum aus, wozu er seinen Arm recht weit von sich strecken musste, denn die Mädchen hielten einen gewissen Abstand ein und bewegten sich auch jetzt nicht vom Fleck. Na bitte! Mit Befriedigung stellte Barbara fest, dass ihre Ermahnungen nicht vollkommen ungehört verhallt waren. Dann war die kleine Zusammenkunft auch schon wieder beendet. Die Mädchen warfen ihre Zöpfe zurück und schlenkerten wild mit ihren Körben, während sie an den Lastwagen vorbeistolzierten. Auch die Soldaten machten sich zur Abfahrt bereit. Hoover und Stevens stiegen in einen Jeep, John schwang sich auf das Trittbrett des vorderen Lasters, die anderen stiegen hinten ein.
»Hallo, Fräulein Salzmann!«, grüßten die Mädchen, als sie sie fast erreicht hatten. »Der Wirt schickt uns, Nachschub holen. Häm und äggs. Und Milch natürlich. One bottle of milk, pleeease.« Gisela zog die Lippen breit.
»Na, dann mal los mit euch!«, rief Barbara, wobei ihr das einschränkende »Aber« schon auf der Zunge lag, denn üblicherweise kam bei ihr keine Aufforderung ohne Ermahnung aus. Doch heute wollte ihr nichts mehr einfallen. Genug war genug.
Während die Mädel an ihr vorbeimarschierten, wurden drüben vor dem Hotel Motoren gestartet, Fahrzeuge gewendet. Als der Konvoi sich näherte, trat sie beiseite, ganz nah an den Koppelzaun. Voran fuhr der Jeep, darin Stevens und Hoover. Hoover nickte ihr knapp zu, Stevens hob lächelnd die Hand zum Gruß und schaute ihr für Sekunden in die Augen. Sie winkte zurück, und die Fahrzeuge rumpelten an ihr vorbei, in dieselbe Richtung, in der die ersten Mädchen gerade hinter einer Biegung verschwanden. Plötzlich erklang von Ferne ein langes, sehnsuchtsvolles Wiehern. Der Braune hob den Kopf und schaute mit gespitzten Ohren in die Richtung, aus der es gekommen war. Seine Blesse leuchtete wie ein Wegweiser. Mit zusammengekniffenen Augen folgte Barbara seinem Blick, nahm eine scharfe Bewegung wahr. Ein Schuss peitschte durchs Tal und ließ sie zusammenfahren, dicht gefolgt von einem zweiten. Dann ein grelles Aufblitzen inmitten des gleißenden Gegenlichts. Die Detonation hatte eine Wucht, die den Jeep in die Höhe hüpfen ließ; ein vielfaches Echo hallte donnernd durchs Tal. Augenblicklich schoss eine Stichflamme in den Himmel, höher als die Tannen am Wegesrand. Tintenschwarze Rauchwolken stiegen auf, und aus ihrem Zentrum drangen die schrillen Schreie der Mädchen. Die Mädchen! Barbara wollte sich in Bewegung setzen, doch ihre Glieder gehorchten ihr nicht. Wie erstarrt stand sie da, unfähig, sich zu rühren, unfähig zu verstehen, was vorgefallen war. Dann sah sie sie, die Schar schmächtiger Gestalten. Karabiner im Anschlag, rannten sie jetzt über die Pferdekoppel. Und da begriff sie endlich.
2. EDITH
819 Tage zuvor
Als die Lok einrollte, wogte eine Welle über den Bahnsteig. Eine Welle aus Kinderleibern. Alle sprangen auf, winkten und schrien, alle trugen gelbe Verschickungskarten um den Hals und hatten Gepäck dabei: Lederkoffer, Pappköfferchen, zusammengeschnürte Bündel. Nun sollte es also losgehen. Kindersonderzug war auf einer Kreidetafel zu lesen, ein Scherzbold hatte ein R aus dem K gemacht.
Für Edith hatte die Mutter eine kleine Reisetasche gepackt, mehr konnte sie noch nicht tragen. Die Reisetasche stand vor ihr, und hinter ihr hüpfte Gisela vor Aufregung auf der Stelle. Mit schrillem Quietschen kam der Zug zum Stehen, eine Wolke von Wasserdampf hüllte sie ein. Ediths Hand krampfte sich unwillkürlich fester um die der Mutter. Von der kleisterigen Hitze und dem Gestank nach verbrannter Kohle wurde ihr ganz schlecht.
»Passt schön auf euch auf!« Die Mutter drückte sie fest an sich, dann kniff sie Gisela in die Wange. »Dass du mir ja auf deine kleine Schwester achtest!« Was wie ein Kommando klang, war in Wahrheit eine hilflose Bitte, das wusste selbst Edith. Wenn sie erst fort wären, könnte die Mutter nichts mehr ausrichten.
Als die Türen sich öffneten, setzte ein wildes Getümmel ein. Die Kinder erstürmten den Zug wie Ritter eine feindliche Festung, es gab Geschiebe und Gerangel. Gisela fasste ihre Schwester bei der Hand, spürte den Widerstand, begann ungeduldig zu zerren, und für einen Moment ließ auch die Mutter nicht los, sodass Ediths Arme länger und länger wurden. Sie fühlte sich wie ein Regenwurm zwischen zwei Hühnerschnäbeln, bis ihre Mutter nachgab.
»Komm schon, Edith!« Gisela eilte auf die nächstgelegene Waggontür zu.
»Ediths Tasche!«
Gisela machte noch einmal kehrt, schnappte sich die Reisetasche, hatte nun in beiden Händen Gepäckstücke, sodass sie Edith mit ihrem Körper vor sich herschieben musste, hin zur Tür, die steilen Stufen hinauf, rein in den Zug. Im Gang gab es Stau, ein paar hatten sich mit ihrem Gepäck verkeilt; ein Pappkoffer riss auf, sein Inhalt ergoss sich auf den Boden und musste erst aufgesammelt werden.
»Blöde Trine! Jetzt sind die besten Plätze bestimmt schon belegt.« Gisela stellte sich auf die Zehenspitzen, um die Lage besser überblicken zu können. »Da ist Irmi!« Sie fuhr ihre Ellbogen aus und kämpfte sich voran, Edith im Schlepptau, die sich wie ein Äffchen an ihren Ärmel klammerte. Irmi hielt ihnen die Tür auf.
»Da bist du ja endlich, Griselda! Ich hab dir einen Platz frei gehalten.«
Sie stolperten ins Abteil, in dem sich schon sechs Mädchen um die Plätze stritten. Für Edith war eigentlich kein Platz mehr, aber Irmi war anderer Meinung. »Die Kleene kriegen wir noch reingequetscht.«
»Mensch, richtige Polster!«, staunte Gisela. »Nix da von wegen popelige Holzklasse!«
Ein schrilles Pfeifen gemahnte zur Abfahrt. Die Mädchentraube schob sich zum Fenster, alle steckten ihre Köpfe hinaus.
»Die Kleene, was ist mit der? Die sieht ja nix.« Schon wieder Irmi. Sie griff nach Ediths Hand, zog sie zu sich, packte sie unter den Achseln und stemmte sie hoch. »Macht mal Platz da!«
Irmis Griff war nicht sonderlich geschickt, sie quetschte ihr die Haut unter den Achseln, es tat weh, aber Edith wagte nicht, sich zu wehren. Aus dem Fenster schauen wollte sie auch nicht, womöglich sah die Mutter ihre Tränen. Doch Irmi ließ nicht locker, und so blieb ihr nichts übrig, als den Kopf rauszustrecken. Eines der kleinen Hakenkreuzfähnchen, mit denen die Mädchen eifrig winkten, klatschte ihr ins Gesicht. Sie suchte mit den Augen die Mutter, fand sie keine zehn Schritte entfernt. Auch die Mutter hatte sie jetzt entdeckt und winkte wie wild.
»Edith! Gisela! Dass ihr mir ja fleißig schreibt!« Sie verzog den Mund zu einem breiten Lächeln, aber Edith ließ sich nicht täuschen, selbst aus dieser Entfernung sah sie die Tränen. Die Mutter war nicht zur Schauspielerin geboren, ihr konnte man alles vom Gesicht ablesen.
Als die Lok anfuhr, ging ein Rucken durch den Zug. Langsam, langsam rollte er aus dem Bahnhof, doch Ediths Körper schien nicht mitgehen zu wollen. Eine Faust krampfte sich um ihren Magen, wie damals auf der Schiffschaukel. Alle hatten gelacht und gekreischt vor Wonne, nur sie hatte sich panisch festgekrallt und nicht gewusst, wie sie umgehen sollte mit diesem Gefühl des Fallens, das ihr die Sinne zu rauben schien.
»Anhalten, anhalten!«, hätte sie am liebsten geschrien, doch das ging ja nicht, damals wie heute, und der nicht ausgestoßene Schrei blieb ihr im Halse stecken und bildete einen dicken Kloß, der ihr das Schlucken unmöglich machte. Sie zog den Kopf ein, ließ sich tiefer gleiten, schlüpfte zwischen den Mädchenkörpern hindurch und sackte auf die Sitzbank.
Bald gab’s draußen nichts mehr zu sehen, erneut kam Unruhe auf. Noch war die Sitzordnung nicht abschließend geklärt.
»Die Kleinsten nach oben!«, kommandierte Irmi und zerrte schon wieder an ihr. Edith wollte nicht ins Gepäcknetz, und so kletterte ein anderes Mädchen hinauf, der Platz war begehrt.
Gisela drängte sich auf einen der Fensterplätze.
»He! Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!«, maulte ein Mädchen mit runden Backen und einem dicken Hahnenkamm auf dem Kopf. »Ich war vor dir da!«
»Die Letzten werden die Ersten sein!«, konterte Gisela feixend, warf sich in ihrem Sitz zurück und machte sich ungeniert breit. Edith dagegen machte sich ganz klein; nur nicht weggeschickt werden! Doch sie konnte nicht still sitzen. Nervös fuhr sie über ihre Oberschenkel, die in hellen Strumpfhosen steckten, trotz der Hitze. Darunter klebte die Haut. Was man am Leib hat, muss man nicht tragen, hatte die Mutter gemeint. Ediths Hände glitten vor und zurück, vor und zurück, fanden ein winziges Loch am rechten Knie. Sie konnte nicht anders und bohrte den Zeigefinger hinein.
Patsch! Eine Hand schlug auf die ihre.
»Lass das!«, schimpfte Gisela. »Willst doch nicht aussehen wie eine Asoziale mit zerrissenen Strümpfen!«
Edith zog die Hand weg.
»Jetzt sei mal nicht so streng mit der Kleenen«, mahnte Irmi, aber Gisela hörte nicht auf sie und funkelte Edith drohend an.
»Dass du mir ja keinen Ärger machst, verstanden? Von dir lass ich mir nicht den Spaß verderben. Und jetzt hör endlich auf zu flennen, Heulsuse! Was soll der Führer von dir denken? Etwa, dass du feige bist?«
Nein, das sollte er keinesfalls denken, wo ihr doch eine so schöne Reise bevorstand. Wie viele daheimgebliebene Kinder sie glühend darum beneiden würden! Und sie musste sich auch keine Sorgen machen, der Führer passte ja auf sie auf, das hatten sie ihr immer wieder gesagt. Anfangs hatte sie tatsächlich geglaubt, Hitler persönlich würde diesen Zug begleiten, doch als sie eine entsprechende Bemerkung gemacht hatte, war Gisela in schallendes Gelächter ausgebrochen.
»Du meinst, der Führer hätte Zeit, mit uns zu fahren? Das wäre ja noch schöner.«
Edith wusste nicht, ob das noch schöner wäre. Schöner als schön. Der Zug ratterte durch die Landschaft, und allmählich wich die Angst einer dumpfen Beklommenheit, einem wehen Ziehen im Herzen, während sich Kilometer um Kilometer zwischen sie und die Heimat schob. Einmal hielten sie kurz an einer Bahnstation. Räder rollen für den Sieg – unnötige Reisen verlängern den Krieg. Edith schaute schnell weg. Sie wollte keinesfalls schuld sein, dass der Krieg noch länger dauerte.
3. BARBARA
Diese Hitze war kaum auszuhalten. Eine dumpfe, nach Staub und Ruß schmeckende, enervierende Hitze, die trotz fortgeschrittener Stunde nicht weichen wollte. Dazu die Unruhe der Kinder. Ganz zu schweigen von ihrer eigenen.
Jeden Moment musste der Sonderzug einrollen, und sie wollte die Mädel ihrer Klasse gerade dazu anhalten, weiter aufzurücken, als sich plötzlich eine Hand über ihre Augen legte. Erschrocken fuhr sie herum. Vor ihr stand Johann, und ihr Herz machte einen Satz.
»Was tust du denn hier?« Sie merkte sofort, dass ihre Frage weder besonders intelligent noch charmant war.
»Freust du dich nicht?«
»Doch, natürlich!« Ja, das tat sie, sehr sogar, so sehr, dass es ihr peinlich war, allerdings geschah dieses Zusammentreffen im denkbar ungeeignetsten Moment.
»Ich musste mich doch vergewissern, ob man die Meute auf dich loslassen kann!« Johann grinste frech. Er ließ seinen Blick über die Heerschar von Kindern schweifen, die den Bahnsteig bevölkerten, und pfiff leise durch die Zähne. »Das müssen ja mindestens hundert sein. Und die gehören alle zu dir?«
»Nein, nein, es sind auch noch andere Schulen dabei, und ich bin nur für meine Klasse verantwortlich«, widersprach sie schnell.
»Da bin ich beruhigt.« Er nickte ernst und deutete auf ein kleines blondes Mädchen, das sich an die Hand seiner Mutter krallte. »Aber die da, auf die musst du besonders achtgeben! Die ist gefährlich.«
Barbara konnte nicht anders, sie musste lachen. Ausgerechnet Giselas kleine Schwester hatte er sich herausgepickt! So zart, wie sie war, dazu mit ihrem blonden Wuschelköpfchen wirkte sie nun wirklich, als könnte sie kein Wässerchen trüben.
»Denkst du, ich mache Witze?« Johann spielte den Gekränkten. »Du solltest mir glauben, ich habe einen Blick dafür.«
»Was du nicht sagst!« Sie schrie jetzt fast, um die einrollende Lok zu übertönen. Er erwiderte etwas, doch sie verstand ihn nicht mehr. Mit einem ohrenbetäubenden Schleifgeräusch bremste der Zug und hüllte sie in eine schmutzig graue Dampfwolke. Blitzschnell umfasste Johann mit beiden Händen ihr Gesicht und küsste sie. Sie war so perplex, dass sie es einfach geschehen ließ. Der Qualm verzog sich, er ließ von ihr ab. Die Überraschung hatte sie sprachlos gemacht. Mit einer Hand fuhr sie sich über die Lippen, mit der anderen ergriff sie ihren Koffer, zur Flucht bereit.
»Tja, ich muss dann.« Sie hatte sich bereits halb umgedreht, als sie Dr. Ritters Blick auffing und erneut erschrocken innehielt. Dass er sie mit Johann zusammen sah, war ihr mehr als unangenehm. Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps, hätte ihr Großvater das Problem in etwa umrissen beziehungsweise dessen Lösung gleich parat gehabt, wobei er den Schnaps zeitlebens durchaus nicht hintangestellt hatte. Aber das war ein anderes Thema. Herrje! Sie war eine erwachsene Frau und durfte tun und lassen, was sie wollte. Sollte Dr. Ritter doch gucken. Was gab es gegen ein privates Abschiednehmen einzuwenden? Ihm selbst stellte sich dieses Problem erst gar nicht, da seine Familie ja mitfuhr. Tatsächlich wirkte er weder konsterniert noch ungehalten, sondern eher irritiert. Genau wie sie. Schnell wandte sie sich abermals Johann zu und streckte ihm die Hand hin. »Auf Wiedersehen. Und danke, dass du gekommen bist.«
»Du schreibst mir doch?«
»Ja, natürlich.«
»Sofort nach eurer Ankunft, versprochen?«
Sie zögerte einen Moment. »Versprochen.«
Er ließ sie los. Wie nervös sie war! Dabei hatte sie jetzt wirklich anderes im Kopf als romantische Brieffreundschaften. Ein letztes Lächeln, dann ließ sie Johann stehen. Mit übertriebenem Eifer begann sie, die Mädchen zum Zug zu treiben, was sich als gar nicht nötig erwies, da diese bereits anstandslos Frau Ritters energischen Aufforderungen zum Einsteigen folgten.
»Fräulein Salzmann?« Die Mutter einer ihrer Schülerinnen fasste Barbara am Arm. »Sie passen mir gut auf meine Mädel auf, nicht wahr?«
Barbara blieb noch einmal stehen. »Aber natürlich, Frau Spilles! Es besteht kein Grund, sich Sorgen zu machen. Sie werden sehen, für die Kinder wird die Zeit wie im Flug vergehen.« Sie nickte der Frau aufmunternd zu, schob sich an ihr vorbei und bestieg den Zug. Bereits in der Tür stehend, hielt sie noch einmal nach Johann Ausschau, konnte ihn jedoch nirgends entdecken. Er war wohl bereits gegangen. Du hast es vermasselt, dachte sie, und das Eingeständnis versetzte ihr einen Stich. Wie hatte sie nur so stocksteif dastehen können! Genauso gut hätte er einen Holzklotz umarmen können. Bloß nicht mehr daran denken, es gab anderes zu tun. Barbara arbeitete sich zielstrebig vorwärts, zählte nach, ob ihre Mädel alle an Bord waren, betrat schließlich das letzte Abteil, das sie sich mit der Familie Ritter teilte: Dr. Ritter, dem Rektor der Schule und künftigen Lagerleiter, seiner Gattin und den beiden Töchtern Lydia und Marion.
Der Zug war bereits angerollt, und Barbara musste aufpassen, dass sie das Gleichgewicht hielt, während sie ihren Koffer ins Gepäcknetz wuchtete. Dr. Ritter kam ihr zu Hilfe, doch sein ungeschickter Versuch, ihr die Arbeit abzunehmen, brachte sie für einen Moment ins Straucheln. Sie konnte sich gerade noch fangen und nahm nahe der Tür Platz, gegenüber der kleinen Marion. Geschafft. Fürs Erste zumindest.
Drei Monate lagen nun vor ihr. Drei volle Monate! Eine halbe Ewigkeit, die wohl kaum wie im Fluge verstreichen würde, wie sie Frau Spilles weiszumachen versucht hatte – zumindest nicht, was ihr eigenes Zeitgefühl betraf.
Immerhin war ihr die Lagerleitung erspart geblieben, wofür sie noch immer von Herzen dankbar war. Eigentlich hatte sie die Leitung übernehmen und mit einer kleinen Gruppe von Mädchen in die Verschickung aufbrechen sollen. Zwar war sie nicht die Wunschkandidatin für diese Aufgabe gewesen – dafür hatte sie sich zu wenig engagiert –, aber mit fortschreitender Dauer des Krieges war die Auswahl an Fachpersonal erheblich geschrumpft, weshalb man doch auf sie zurückgekommen war: jung, ledig und, abgesehen von ihrer verwitweten Mutter, ohne Anhang. Angesichts der Überschaubarkeit der geplanten Maßnahme war das Risiko, das man mit ihr eingegangen wäre, wohl kalkulierbar erschienen. Doch dann war alles ganz anders gekommen. Die Bombardements hatten ungeahnte Ausmaße angenommen, und ein nächtlicher Treffer hatte das halbe Schulgebäude zerstört. Nachdem der Unterricht an den städtischen Volksschulen bereits eingestellt worden war, entschied der Reichsverteidigungskommissar, dass auch die Oberschulen geschlossen würden. Unterricht würde nicht mehr stattfinden, die Schulen in sichere Gebiete verlegt. Eine Entscheidung, die noch einmal ganz neue Weichenstellungen notwendig gemacht hatte.
Für eine komplette Schulverlegung hatte Barbaras Reputation natürlich nicht ausgereicht, weshalb man sich genötigt sah, den Rektor zum Dienst zu verpflichten. Auch er war wohl kein Wunschkandidat, wie Barbara vermutete, aber er genoss das Vertrauen der Eltern, und das war in dieser Angelegenheit von entscheidender Bedeutung. Die Mütter und Väter hörten auf den Rat des erfahrenen Pädagogen und waren nun bereit, ihre Kinder aus der Stadt zu schicken, ja, manche bettelten jetzt sogar darum. Endlich hatte das Werben der Partei gefruchtet. Die Folge war gewesen, dass man Barbara und Dr. Ritter eilends zu einem Lehrgang nach Bad Podiebrad beordert hatte, und so hatten sie erst vor Kurzem schon einmal gemeinsam in einem Zug in Richtung Osten gesessen. Dort hatten sie Vorträgen über die Ziele nationalsozialistischer Erziehung, über Wirtschaftsführung und die politischen Verhältnisse im Protektorat gelauscht, wobei Dr. Ritter seinen Blick gern gedankenvoll aus dem Fenster hatte schweifen lassen – genau wie er es in diesem Moment tat. Seine Frau hingegen schien ganz auf das Hier und Jetzt konzentriert. Ihre Handtasche wie einen Abwehrschild auf ihrem Schoß umklammernd, saß sie kerzengerade da, während ihr unsteter Blick die Umgebung permanent auf Unstimmigkeiten zu überprüfen schien.
»Nicht so zappelig, Marion!«, tadelte sie. »Hör bitte auf, dein Haar immerzu um die Finger zu wickeln, und starr das Fräulein Salzmann nicht so an. So etwas tut man nicht.« Dann, an Barbara gewandt: »Sie müssen entschuldigen. Marion ist manchmal etwas ungehobelt.«
Seltsamerweise fühlte sich Barbara von dieser Frau weitaus ungehobelter behandelt als von Marion, einem Kind, das lediglich unverhohlen seiner Neugier frönte, wozu es angesichts der außergewöhnlichen Situation allen Anlass hatte. Hinter Frau Ritters vorgeschobener Freundlichkeit lauerte hingegen etwas anderes, das sie kaum verbergen konnte – oder sich gar nicht erst die Mühe machte. Ob Dr. Ritter das bemerkte? War dies der Grund für seine innere Abkehr?
Barbara dachte an die Heimreise von Bad Podiebrad. Die Verlegenheit hatte geradezu quälend zwischen ihnen gestanden, als hätte schon ihrem bloßen Beisammensein eine gewisse Anrüchigkeit angehaftet. Nur Dr. Ritters gelegentliche, mit unvermittelter Heftigkeit vorgetragene Einlassungen hatten dieses lastende Schweigen durchbrochen. Er müsse sich fragen, ob die Nachhaltigkeit des Erkenntnisgewinns in Bad Podiebrad es rechtfertige, den Unterricht der Schülerinnen noch stärker vernachlässigt zu haben und ihr ohnehin schon im Sinkflug begriffenes Leistungsniveau billigend in Kauf zu nehmen, hatte er beispielsweise eingeworfen, um gleich darauf wieder in echsenhafte Erstarrung zu fallen. Vielleicht hatte er sich ja düpiert gefühlt, weil er mit ihr, einer jungen, unerfahrenen Lehrerin, hatte vorliebnehmen müssen. Vielleicht war es auch seiner Frau nicht recht, dass man ihren Mann in Begleitung einer jungen Dame losgeschickt hatte – und nun wieder losschickte. Verstohlen schaute Barbara zu Ida Ritter hinüber. Allein diese verbissene Miene! Wie eine Kneifzange! Alles an ihr signalisierte: Sie würde wachsam sein.
Barbaras Gedanken sprangen zu Johann zurück, und ihre Hand fuhr unwillkürlich über ihren Mund, als würde der Kuss noch immer auf ihren Lippen brennen. Ein Hansdampf sei er, hatte ihre Freundin Gitti sie gewarnt. Einer, der nichts anbrennen lasse.
Auf Gerüchte gab Barbara nicht viel, doch sie würde sich vorsehen. Und sie hatte sich nichts vorzuwerfen. Was war schon passiert? Man hatte sich ein paarmal unterhalten, war zwei-, dreimal gemeinsam ausgegangen. Nichts, was sie nicht mit jedem anderen und ohne Hintergedanken hätte tun können, sogar mit einem Mann wie Dr. Ritter. Ja, auch mit Dr. Ritter, dachte sie trotzig. In Bad Podiebrad hatten sie gemeinsam ein Klavierkonzert und einen Liederabend besucht, und was hatte das zu besagen? Nichts, rein gar nichts! Barbara spürte einen Anflug von Ärger in sich aufwallen. Was glaubte diese Ida Ritter eigentlich? Dass sie versuchte, sich in ihre Ehe zu drängen? Und was traute diese Kneifzange ihrem Gatten zu, einem so feinen, integren Mann wie ihm? Es war einfach lächerlich. Nur gut, dass Johann sie auf dem Bahnsteig so innig verabschiedet hatte, was dieser Person hoffentlich nicht entgangen war. Barbara hatte es nicht nötig, nach verheirateten Männern zu schielen.
Herrje, was waren das für wirre Gedanken, schalt sie sich. Höchste Zeit, in ihrem überspannten Hirn wieder ein wenig Ordnung zu schaffen. Johann. Ob sie ihn überhaupt wiedersehen würde? Sie war keine, die sich die Dinge schönredete, die die Augen vor der Wahrheit verschloss. Vielleicht war es ein Abschied für immer gewesen. Er war Soldat, alles war möglich, das hatte sie das Leben gelehrt. Alles.
»Wie bitte?« Die Kneifzange hatte ihr eine Frage gestellt. Sie musste aufmerksamer sein. Wie sie ihre Wäsche vor Knitterfalten schone? Sie lege sie ordentlich zusammen und hoffe das Beste, antwortete Barbara. Eine rettende Technik kenne sie leider nicht.
»Dampf«, erklärte Frau Ritter entschieden. »Es geht nichts über heißen Dampf.« Außerdem führe sie auf Reisen stets ein kleines Plätteisen mit sich, denn ein nicht ordentlich gebügeltes Männerhemd lasse doch schnell auf eine Krautwirtschaft schließen. Ein Mann in der Position ihres Gatten, der nun auch noch mit lebensrettenden Schutzmaßnahmen für die Jugend und damit für den Fortbestand des geliebten Vaterlandes betraut sei, der dürfe freilich knitterfreie Hemden erwarten. Barbara stimmte dem vorbehaltlos zu, wobei sie sich zwang, nicht zu Dr. Ritter hinüberzuspähen.
»Mein Gott, eine Hitze ist das hier!« Die Kneifzange kramte in ihrer Handtasche und betupfte sich mit Kölnischwasser, während ihr Gatte gänzlich in seine Landschaftsbetrachtungen versank – oder schlief er? Marion spielte mit ihrer Puppe, aß ein Butterbrot, fragte, ob sie zu den anderen Kindern dürfe, was von der Mutter nicht erlaubt wurde, warum auch immer. Lydia schaute beharrlich drein, als eskortierte man sie geradewegs in einen sibirischen Gulag, hielt sich aber mit Kommentaren zurück. Barbara griff zu einer älteren Ausgabe des Filmwelt-Magazins und blätterte ausdauernd darin, obwohl ihre Konzentration kaum für das Betrachten der Bilder reichte, aber es schützte sie vor neuerlichen erzwungenen Konversationsversuchen. Der Zug rollte und rollte, der Abend wollte nicht enden. Ihr kam es vor, als reisten sie geradewegs zum Polarkreis, wo die Sommersonne niemals unterging. Aber dann tat sie es doch, mit einem betörend schönen Farbenspiel sogar, das sie allerdings nicht lange genießen konnten, da die Verdunkelung anstand. Sie machte sich noch einmal auf, um nach ihren Schülerinnen zu schauen, ihrer Quarta, dreißig Mädchen, die sich dem Backfischalter näherten. Genau genommen waren es nur noch dreiundzwanzig, sieben waren nicht mitgekommen. Dazu hatte man ihr die Sextanerinnen aufs Auge gedrückt – wenn es sich auch nur noch um eine Handvoll Mädel handelte.
»Vom Winde verweht«, war Dr. Ritters Kommentar zu dem drastischen Schülerinnenschwund gewesen, dem fast die Hälfte der Mädchen zum Opfer gefallen war. Trotz Anweisung hatten viele Eltern ihre Kinder nicht mitgeschickt oder sie anderswo untergebracht. Dafür nahmen sie nun ein paar Kinder aus anderen Schulen mit in die Verschickung, wie Giselas Schwester Edith, die Volksschülerin, deren Mutter Barbara auf dem Bahnhof angesprochen hatte. Ediths Zartheit bereitete Barbara allerdings Sorge. Mit Zehnjährigen hatte sie wenig Erfahrung, dafür umso mehr Befürchtungen, was den Verlauf der Reise betraf. Energisch schob sie die Abteiltür auf.
»Verdunkeln, Mädel! Wir wollen den Fliegern doch nicht als Zielscheibe dienen. Anschließend Betten bauen und dann Nachtruhe. Versucht zu schlafen, so gut es geht.« Sie ließ ihren Blick über die Mädchen schweifen und verweilte kurz bei Edith, die ganz zufrieden aussah. Keine Tränen. Gott sei Dank. Wenn es nur so einfach bliebe.
4. EDITH
Wenn Gisela geht, müssen Sie Edith auch mitnehmen«, hatte die Mutti zu Dr. Ritter gesagt, dem Rektor der Oberschule für Mädchen, die ihre Schwester besuchte und in die auch Edith im nächsten Schuljahr hätte wechseln sollen. »Die Volksschule hat sowieso dichtgemacht, das Kind verpasst also nichts, im Gegenteil. Edith wäre mit ihrer Schwester zusammen und könnte sogar etwas lernen. Es besteht doch sicher die Möglichkeit, dem Mädel auch ein bisschen Unterricht angedeihen zu lassen. Zur Not soll sie zuhören, was die Großen sagen.« Dr. Ritter hatte nicht gerade begeistert gewirkt. »Wenn Edith nicht mitkann, dann bleibt Gisela auch hier!«, war die Mutter stur geblieben. »Man kann mich nicht zwingen, sie mitzuschicken. So heißt es doch immer von der Reichsdienststelle: dass die KLV auf Freiwilligkeit beruht.«
»Nun ja, aber die Situation hat sich geändert«, hatte Dr. Ritter eingewandt. »Ich muss Ihnen ja nicht erklären, welche verheerenden Folgen die andauernden Bombardements haben. Und unsere Schule wird komplett verlegt.«
»Deshalb sollen Sie Edith ja mitnehmen! Damit ich mir um die Kleine keine Sorgen machen muss. Meine Tochter ist ein liebes Kind. Sie werden kaum merken, dass sie überhaupt da ist.«
Dr. Ritter hatte kurz zu Edith hinüber, dann recht lang auf seine Hände geschaut und schließlich eingelenkt. Nun war auch Edith bemüht, sich zu fügen; das Reden überließ sie anderen. Ihrer Schwester zum Beispiel.
»Ich könnte wochenlang Bahn fahren«, behauptete Gisela gerade, wobei sie in ihrem Polstersitz klebte wie ein schlabbriges Spiegelei. »Endlich mal eine richtige Reise, nicht bloß zu Tante Lene nach Neuss, wohin man’s zur Not mit dem Drahtesel schafft. Oder in die öde Eifel.« Sie rümpfte die Nase. Gisela hatte bereits eine Verschickung mitgemacht, von der sie sich allerdings mehr versprochen hatte, wie Edith wusste. Ihr selbst war die Eifel erspart geblieben: Damals war sie zu jung fürs Lager gewesen. Aber jetzt war alles ganz anders. Jetzt lag die halbe Stadt in Schutt und Asche, und in den Schulen gab es keinen Unterricht mehr. Jetzt hatte die Mutter ihre Meinung radikal geändert. Welch ein Glück für dich, dass du eine so schöne Reise machen darfst, Edith!
Edith beugte sich nach unten. Ihre bestrumpften Knöchel, die noch dazu in Filzstiefeln steckten, juckten wie verrückt. Im Winter waren die Stiefel eigentlich nicht warm genug gewesen, dafür wärmten sie jetzt umso mehr. Sommerliche Schuhe besaß Edith nicht, die Mutter hatte leider keine auftreiben können. Dazu das kneifende Leibchen. Schrecklich.
»Hamm – Bielefeld – Hannover – Celle – Wittenberge – Pasewalk – Swinemünde.« Gisela las die Stationen der Reise vor, die sie auf einem Zettel notiert hatte. »Pasewalk, Swinemünde: Wie das klingt! So schön weit weg.«
»Dein Zugfahrplan stammt garantiert noch aus Vorkriegszeiten«, brummte ein hohlwangiges Mädchen mit kantigem Kinn und einem Topfhaarschnitt. »Jetzt liegt alles in Schutt und Asche. Ich glaub nicht, dass wir da heil durchkommen.«
»Du meinst, uns wird was passieren?« Das Mädchen mit dem Hahnenkamm riss die Augen auf.
»Lass dich doch von unserer Bruno nicht verrückt machen, Schmittchen«, mischte Irmi sich ein. »So ist sie eben: immer optimistisch. Dafür lieben wir sie ja.« Irmi knuffte Bruno lachend in die Seite.
»Und wie«, murmelte die lange Lotte, die Edith schon kannte, weil sie nur zwei Straßen weiter wohnte. Oder gewohnt hatte, bis ihnen eine Bombe aufs Dach gefallen war.
»Also ehrlich, Bruno! Was ist denn das für eine Einstellung?«, meldete sich die kleine Braunhaarige aus dem Gepäcknetz. Sie hatte eine eigentümlich tiefe Stimme, die gar nicht zu ihrer zarten Erscheinung passte. »Das petze ich dem Führer!«
»Ich bezweifle stark, dass der sich für einen laufenden Meter wie dich interessiert«, konterte Bruno, ohne aufzusehen.
»Von wegen ›laufender Meter‹!« Das Mädchen holte aus und versuchte, Bruno von oben einen Klaps auf den Hinterkopf zu geben, was jedoch misslang. »Wart’s ab!«, drohte sie. »Wenn du schläfst, drück ich dir Zahnpasta in die Ohren.«
Bruno zuckte die Achseln. »Dann hör ich dein Schnarchen wenigstens nicht.«
»Bruno! Gerda! Schluss mit dem Unsinn, alle beide!« Irmi spielte die strenge Lehrerin. Für einen Augenblick trat Stille ein, und Schmittchen nutzte den ungefüllten Moment, um sich ihrem Fresspaket zuzuwenden. Den trockenen Keks, den sie Edith anbot, lehnte diese mit einem Kopfschütteln ab. Kein Hunger.
»Das gibt’s doch nicht, dass eine keinen Hunger hat!« Schmittchen hielt ihr noch immer den Keks hin. »Nun nimm endlich!« Edith griff zu, damit sie ihre Ruhe hatte. Schob eine Ecke des Gebäcks zwischen die Lippen, saugte ein wenig daran, bis es weich wurde. Bekam die tröstliche Süße zu schmecken. Mit zwei Happen war der Keks verspeist, ebenso wie der nächste. Schmittchen nickte zufrieden.
»Der Appetit kommt beim Essen.«
»Schön wär’s, wenn man den immer erst hätte, wenn’s was zu beißen gäbe!«, bemerkte Lotte trocken.
»Mist! Jetzt hat mein Fähnchen einen Fettfleck abbekommen«, schimpfte Schmittchen.
»Schmeiß weg!«, knurrte Bruno. »Kannste sowieso nicht mehr brauchen.«
Gerda reckte empört das Kinn. »Also wirklich, Bruno! Du bist unmöglich! Wenn du keins mehr brauchst, dann gib ihr doch deins!« Das Geplapper nahm wieder Fahrt auf, und draußen setzte allmählich die Dämmerung ein. »Wir fahren immer an der Nacht lang«, zitierte Gisela ihre Lehrerin.
Im Schutze der Nacht; durch Nacht und Nebel, schoss es Edith in den Sinn. Stille Nacht, heilige Nacht. Hohe Nacht der klaren Sterne. Aber viel Nacht war nicht draußen, es war ja Hochsommer, und Sterne waren auch keine zu sehen. Trotzdem stand plötzlich das Fräulein Salzmann im Abteil. Edith straffte sich blitzschnell und saß kerzengerade.
»Verdunkeln, Mädel! Wir wollen den Fliegern doch nicht als Zielscheibe dienen. Anschließend Betten bauen und dann Nachtruhe. Versucht zu schlafen, so gut es geht.« Edith spürte ihren Blick auf sich ruhen, dann verschwand sie wieder. Gisela stand auf und zog das schwarze Rollo herunter.
»Verdammt, das ist ja düster wie in Düvels Arsch!«, maulte Schmittchen. Verhaltenes Gekicher der übrigen Mädel. Die bläuliche Notbeleuchtung schien alle anderen Farben zu schlucken. Edith umschlang ihre Knie mit den Armen und starrte vor sich hin. Bei Nacht und Nebel. Nachts sind alle Katzen grau. Hässlich wie die Nacht. Sie verspürte den Drang, ihren Daumen in den Mund zu schieben, wie sie es im Luftschutzkeller immer getan hatte, aber das war ihr zu peinlich. ›Lass das! Du bist doch jetzt ein großes Mädchen.‹ Sie hörte Mamas Stimme so deutlich, als stünde sie neben ihr.
Das Stampfen der Lok, das rhythmische Rattern der Räder über die Schienenfugen – tak-tak, tak-tak, tak-tak –, die Dunkelheit – all das lullte sie ein, und obwohl sie nicht schlafen wollte, fielen ihr bald die Augen zu. Eine Weile drang noch das Tuscheln der Mädchen an ihr Ohr, die sich auf ihren Sitzen zusammengerollt hatten wie die Katzen, dann nicht einmal mehr das. Sie war eingeschlafen.
Nur einmal schreckte sie auf. Sie ruckelten heftig über eine Weiche, und es tat einen Schlag. Ein unterdrückter Aufschrei, Geraune – Gerda war aus dem Gepäcknetz gefallen. Wie die Sache ausging, bekam Edith nicht mehr mit, sie schlief bereits wieder.
Beim Erwachen drang ein greller Lichtschein durch ihre Lider. Die strahlende Morgensonne flutete das Abteil. Ediths Haar klebte im Nacken, sie war ganz verschwitzt. Der Zug rollte nur noch sehr langsam. Sie schaute zu Gisela hinüber, die jetzt neben ihr saß, offenbar immer noch putzmunter.
»Sind wir da?«
»Etappenziel.« Gisela sprang auf. Der Zug hielt. Alles aussteigen!
Am Bahnhof wurden sie von zwei NSV-Frauen und einem halben Dutzend Jungmädel begrüßt und zum Heim der Hitlerjugend begleitet, das an einem Fluss namens Aller lag. Dort bekamen sie ein ordentliches Frühstück, für jede eine Doppelschnitte, sogar Kakao gab es. Alle langten ordentlich zu, auch Edith. »Pack ein!« Gisela griff herüber und legte ihr eine geschmierte Stulle mit zwei Scheiben Käse auf den Teller. »Man weiß nie, wann’s wieder was gibt.« Als die Brotkörbe leer waren, klatschte Fräulein Salzmann in die Hände. »Heute Abend geht es weiter«, verkündete sie. »Bis dahin machen wir uns einen schönen Tag. Natürlich erst, nachdem das Geschirr abgespült ist.«
Nach dem Abwasch vertrieben sie sich die Zeit mit Schwarzer Peter und Siebzehnundvier, sie sangen gemeinsam und spielten am Flussufer Nachlaufen. Später machten sie einen Spaziergang durch die Stadt, die Celle hieß und aussah wie eine große Puppenstube. Eine Stadt voller Puppenstubenhäuschen, alle geputzt und sauber und unversehrt. Als gäbe es den Krieg gar nicht. Unglaublich.
»Ätsch!« Gisela streckte Bruno die Zunge raus. »Von wegen Schutt und Asche!« Alles war in schönster Ordnung, und alle fühlten sich ganz famos. Dann, in der schützenden Dämmerung, ein anderer Zug. Dort gab es keine Abteile mehr und nur noch Holzbänke, die Mädchen mussten sich neu verteilen. Edith klammerte sich an den Arm ihrer Schwester, bis Irmi sie bei der Hand nahm und ihr einen Platz neben sich anbot. Verdunkelung, blaue Funzel, tak-tak, tak-tak, tak-tak.
Irmi schielte durchs Rollo. Nacht, überall Nacht. Nirgends brannte Licht. Nicht in den Dörfern, nicht in den Städten. Die Nacht wich dem Morgen.
»Sind wir bald da?« Edith sah ihre Schwester fragend an.
»Wir haben bereits Wollin passiert. Allzu lang kann es nicht mehr dauern.« Gisela kannte sich aus.
»Außer, sie lassen uns wieder irgendwo die halbe Nacht rumstehen«, brummte Bruno.
»Ach, du!«
Als sie in Swinemünde einrollten, ging ein leichter Schauer nieder. Die Luft roch wie frisch gewaschen. Edith hielt sich nah bei ihrer Schwester, während die Mädchen einen Halbkreis um Dr. Ritter, Fräulein Salzmann und die junge Frau in BDM-Uniform bildeten, die ihnen lachend zuwinkte. Edith atmete tief durch, legte den Kopf in den Nacken und hielt ihr Gesicht in den Regen.
5. BARBARA
In Swinemünde nieselte es. Wenn’s weiter nichts ist als das bisschen Regen, dachte Barbara und spürte vor allem Erleichterung. Entgegen ihrer Befürchtungen war die Reise ohne größere Zwischenfälle und Verzögerungen verlaufen, und die Mädchen hatten sich als brav und gefügig erwiesen. Jetzt freilich wirkten sie recht überdreht und angespannt, aber wer wollte es ihnen verdenken.
Umsteigen in die Bäderbahn nach Ahlbeck. Am Bahnhof wurden sie von einer jungen Frau in Empfang genommen, die sich als Elfie Klatt vorstellte, Lagermädelführerin vom Haus Margarethe. Sie begrüßte die Mädchen sehr herzlich und schien überhaupt eine freundliche, zuvorkommende Person zu sein. Die vormalige Lagerleitung sei mit ihren Schülerinnen vor drei Tagen abgereist, erklärte sie. Da sie selbst ihren Dienst jedoch erst wenige Wochen zuvor angetreten habe, sei entschieden worden, dass sie ihre Arbeit vor Ort fortsetzen solle.
»Schön, dass jetzt wieder Leben ins Haus kommt!«, freute sie sich und streckte die Hände aus, als wollte sie die Mädchen umarmen. »Drei Tage allein – oder fast allein –, das war nichts für mich!« Gegen ihr fröhliches Lachen schien niemand gewappnet zu sein. Sogar die Kneifzange lächelte.
Nach einem nicht allzu langen Marsch erreichten sie ihr Lager, das Haus Margarethe, das sich als nobles Hotel entpuppte. Den Mädchen stand der Mund offen. Hier sollten sie wohnen, wo sonst die ganz Vornehmen Urlaub machten? Sie konnten es kaum glauben.
Barbara freute sich mit ihnen. Sie schienen es wirklich ganz ausgezeichnet getroffen zu haben.
»Siehste!«, triumphierte Gisela und boxte Brunhild so fest in die Rippen, dass diese aufheulte. »Von wegen, hier steht nix mehr!«
»Gisela, bitte! Beherrsche dich!« Barbara zog das Mädchen beiseite. »Was ist das Wichtigste vor Ort, das A und O? Ein vorbildliches Benehmen! Wir wollen doch nicht als die Wilden aus dem Westen verschrien werden, nicht wahr?«
Im Haus wurden sie von der Wirtin Frau Sommers erwartet, die sie mit der professionellen Freundlichkeit einer Hoteliersfrau in Empfang nahm. Sie stellte sich kurz vor und winkte einen jungen Mann zu sich heran. Der Angesprochene trat zögernd näher, und Barbara erkannte jetzt, dass er eher noch ein Junge war, obwohl er Frau Sommers um einen halben Kopf überragte.
»Das ist mein Sohn Rudi«, stellte sie vor. »Er kümmert sich um Haus und Garten.«
Rudi riss den rechten Arm hoch und brüllte: »Heil Hitler!«, so laut, dass alle zusammenschreckten, dann grinste er breit in die Runde.
»Wir wollen unsere Gäste nicht weiter mit langen Reden aufhalten«, beeilte sich Frau Sommers zu sagen. »Bestimmt möchten sich die jungen Damen nach der anstrengenden Reise frisch machen. Und danach gibt es Frühstück, im Speisesaal ist bereits eingedeckt.«
Frühstück! Eine ganz ausgezeichnete Idee, fand Barbara. Frau Sommers zeigte ihnen die Waschräume, dann ging es ab zu Tisch. Als alle saßen, stand Elfie nochmals auf, schlug mit dem Löffel an ihr Glas und rief:
»Hippel di wippel, die Wurst hat zwei Zippel, der Schinken vier Ecken, drum lasst es euch schmecken!« Die Mädchen lachten laut. Es war nicht zu übersehen, dass sie ihre neue Lagermädelführerin sofort ins Herz geschlossen hatten. Barbara war froh, dass diese Elfie das Heft in die Hand nahm. Das vielfach unterbrochene, nervöse Wegdämmern im Zug war kaum als Schlaf zu bezeichnen gewesen, sie war hundemüde. Umso angenehmer empfand sie es, dass es in diesem Haus bereits eingespielte Routinen zu geben schien, und ein Blick zu Dr. Ritter verriet ihr, dass er ganz ähnlich dachte. Was in Frau Dr. Ritters Kopf vorging, ließ sich schwer erahnen, sie schien mit der Situation jedoch nicht unzufrieden zu sein.
Das Frühstück war reichhaltig und sättigend: zwei Sorten Brot, Streichfett, Vierfruchtmarmelade, dazu zwei Scheiben Wurst für jede und zur Feier des Tages für die Erwachsenen sogar eine Tasse Bohnenkaffee.
Nach dem Essen folgte eine kurze Besprechung. Frau Sommers und Elfie würden eine kleine Hausführung machen, das Lehrpersonal dann im Anschluss über die Zimmerbelegung entscheiden. Danach Betten bauen, auspacken, einräumen.
Elfie wandte sich wieder den Mädchen zu, wobei sie sich erst durch einen scharfen Pfiff mit den Fingern Gehör verschaffen musste, da die Unterhaltungen in vollem Gange waren. Sie erläuterte knapp den Ablauf der nächsten beiden Stunden und setzte hinzu: »Anschließend finden wir uns alle wieder in eurem Klassenraum ein.« Fragende Gesichter. Welcher Klassenraum? »Na der, in dem ihr schon sitzt!« Sie lächelte schelmisch. »Denkt nur nicht, ihr habt den lieben langen Tag Ferien! Nun ja, eine Weile schon, aber dann wird genauso fleißig gelernt wie zu Hause. Ach, was sag ich, fünfmal so fleißig!«
Ein vielstimmiger Seufzer ging durch den Raum. Natürlich hatten alle schon die große Tafel am Kopfende des Saales bemerkt, auf der ein blumenumranktes Herzlich willkommen! prangte, so nett anzusehen, dass das Wegwischen eine Schande gewesen wäre.
»Derzeit gibt es nur ein klitzekleines Problem«, verkündete Elfie gut gelaunt und kniepte Barbara zu. »Es ist einfach kein Nachschub an Kreide zu bekommen. Ich habe schon drüben im Lager Zentralhotel gefragt, aber die wollen nichts abgeben, diese Geizhälse.«
Die Mädchen kicherten.
»Wir können uns ja welche holen gehen«, schlug Marianne aus der Quinta vor. »Hier gibt’s doch Kreidefelsen.«
»Kreidefelsen! Was soll das denn sein?« Elvira, eines der Mädchen aus Dr. Ritters Untersekunda, legte wie immer einen schnippischen Ton an den Tag.
»Na, Felsen aus Kreide eben. Meine Mutter sagt, die gibt’s hier.«
»Deine Mutter hat keinen Schimmer.«
»Hat sie wohl!«
»Nee, die meint Rügen«, mischte sich Gisela ein. »Da gibt’s welche.«
Barbara klatschte in die Hände. »Hier wird nicht gestritten! Ich bin sicher, das Problem ist zu lösen. Aber jetzt wollen wir uns erst einmal von Frau Sommers das Haus zeigen lassen.«
Nach einer von vielen Ahs und Ohs untermalten Führung wurden die Mädchen auf die Zimmer verteilt, anschließend begleitete Frau Sommers das Ehepaar Ritter in die ehemalige Angestelltenwohnung im zweiten Stock, während Elfie Barbara ihr zukünftiges Zimmer zeigte. Zu Barbaras Erstaunen stellte sie fest, dass das Bett bereits frisch bezogen war.
»Aber das hätte ich doch wirklich selbst tun können!«
»Ich glaube gern, dass Sie das können«, erklärte die Lagermädelführerin freundlich. »Aber ich hatte nicht viel zu tun, und da ich nun einmal die Jüngere bin, darf ich ruhig tüchtig zupacken.«
Barbara musste lächeln. »Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Neunzehn.«
»Na, da habe ich Ihnen immerhin fünf Jährchen voraus.« Barbara war sich nicht ganz sicher, ob die wohlmeinende Ironie bei Elfie ankam.
»Wenn Sie vielleicht etwas trinken möchten? Unten steht ein Krug Apfelsaft, ich könnte Ihnen ein Glas bringen.«
»Nun verwöhnen Sie mich mal nicht zu sehr, Elfie! Ich habe ja gerade erst gefrühstückt. Und – wollen wir nicht Du sagen?« Normalerweise war Barbara zurückhaltender, jemandem das Du anzubieten, doch bei dieser jungen Frau erschien es ihr wie die natürlichste Sache der Welt.
»Aber gern.« Elfie strahlte.
Der Rest des Vormittags verging mit Organisatorischem, dann stand auch schon das Mittagessen an, das ebenso gut und reichlich war wie das Frühstück. Eine klare Vorsuppe, Gulasch mit Kartoffeln und zum Nachtisch Birnenkompott. Welch ein Luxus, satt zu werden! Daheim war ja kaum noch etwas aufzutreiben gewesen. Wenn das so weiterging, würde sie vielleicht ein paar Pfund zulegen, hoffte Barbara, die sich bereits ihrer kantigen Schlüsselbeine und Hüftknochen wegen schämte. Nach dem Essen wurde Mittagsruhe verordnet, und zwar heute recht ausgiebig aufgrund der anstrengenden Reise. Auch Barbara ging auf ihr Zimmer, um eine Weile zu entspannen. Wider Erwarten schlief sie auf der Stelle ein.
Am Nachmittag ging es dann endlich ans Meer. Das Wetter hatte sich beruhigt, die Wolkendecke war aufgerissen und ließ die Sonne durch. Die Mädel konnten es kaum abwarten und plapperten durcheinander wie ein Schwarm Papageien, während sie in Zweierreihen die Straße hinuntermarschierten, Elfie vorneweg. Kaum waren sie um die Ecke gebogen, kam ihnen ein Trupp Jungen entgegen. Sie johlten und pfiffen beim Anblick der Mädchen und grinsten sich eins.
»Wat sind denn dit für Hungerharken!«, rief einer, und alle lachten laut.
»Kriegt ihr nüscht zu beißen?«, krakeelte ein anderer.
»Wat wollt ihr Kanaillen?«, brüllte Gisela zurück. »Hat euch eure Mutti zum Haareschneiden den Nachttopf übergestülpt, oder weshalb seht ihr alle so dämlich aus?« Einer der Jungen zeigte ihr eine lange Nase, und Gisela streckte ihm die Zunge raus.
»Gisela, bitte!«, mahnte Barbara.
»Das sind die Buben aus dem Lager Zentralhotel«, bemerkte Elfie kopfschüttelnd. »Kein Benehmen!«
Mit hochrotem Gesicht und keuchendem Atem hetzte ein grauhaariger Herr der marodierenden Horde hinterher. Sie erwiderten seinen knappen Gruß, dann war die Gruppe auch schon verschwunden. Nach wenigen Fußminuten endeten die Häuserzeilen, und vor ihnen lag unvermittelt die Ostsee. Einige Mädchen jubelten, andere blieben still stehen und staunten. Sie hatten noch nie zuvor das Meer gesehen.
Strandleben. Bald tollten alle durch den Sand. Barbara ließ sich auf einer mitgebrachten Decke nieder und atmete tief durch. Die Unendlichkeit von Himmel und Meer hatte etwas Befreiendes an sich, etwas Vollendetes; etwas, dem man nichts mehr hinzufügen musste. Wie gut das tat!
Edith stand noch immer still da im dünnen Sommerkleidchen und mit wirr lockigem Blondhaar, ein hell leuchtender Ankerpunkt inmitten des Trubels. In ihrem Gesichtsausdruck lag Staunen, ja, Verzückung, aber zugleich auch eine leise Furcht. Das Meer hatte auch eine andere Seite. Wer ein Leben in Luftschutzbunkern gewohnt war und bei Alarm wie eine Maus in jedem Loch Unterschlupf gesucht hatte, dem konnte die schutzlose Weite, die Nicht-Begrenzung Angst machen, dachte Barbara. Ob sie das Mädel bei der Hand nehmen sollte? Aber nein, sie kannten einander ja kaum. Sicher wäre es Edith unangenehm.
Sie schaute zu Ediths Schwester Gisela hinüber, der das alles entging. Gisela tobte herum wie ein junger Hund, und es war klar, dass sie nicht als Kindermädchen für ihre jüngere Schwester herhalten wollte. Sie hatte sogar zu protestieren versucht, als Barbara das Geschwisterpaar gemeinsam auf einem Zimmer einquartiert hatte. Barbara würde ein Wörtchen mit ihr reden müssen. So ging es nicht. Gisela musste lernen, dass man sich seine Pflichten nicht aussuchen konnte. Sie würde ihr die Aufsicht über die Sextanerinnen übertragen.
Plötzlich kam Irmi angelaufen, fasste Edith unter den Armen und wirbelte sie im Kreis herum, wieder und wieder, bis sie schließlich das Gleichgewicht verlor und hinplumpste. Edith stürzte mit ihr, lachte jetzt aber, und beide rollten sich durch den Sand. Einmal schaute Edith kurz auf, als spürte sie, dass Barbara sie beobachtete, und lächelte schüchtern. Barbara lächelte zurück.
Ihr Blick wanderte zu Dr. Ritter, der sich gerade seiner Schuhe und Strümpfe entledigte und mit umständlicher Sorgfalt die Hosenbeine hochkrempelte. Anschließend watete er ins Wasser und begann, im Storchengang auf und ab zu schreiten. Barbara konnte nicht anders, sie musste lachen.
»›Mit vollen Segeln lief ich in das Meer des Lebens‹, wie schon Schiller zu sagen wusste«, rief er ihr zu. »Und Sie dürfen sich gern über mich lustig machen. Aber erst, nachdem Sie es selbst versucht haben.« Barbara stand auf und gesellte sich zu ihm. Im ersten Moment erschien ihr das Wasser ungemein frisch, doch sie gewöhnte sich schnell daran, und sie wateten einträchtig nebeneinanderher.
»Gefällt es Ihnen hier, Fräulein Salzmann?«
»O ja! Wir haben es gut getroffen, finde ich.«
»In der Tat. Es tut gut, mal etwas anderes zu sehen als die zerbombte Heimat – auch wenn Ihnen der Abschied sicher schwergefallen ist.« Barbara runzelte fragend die Stirn, sagte aber nichts. »Ich konnte meine Familie mitnehmen«, setzte Dr. Ritter zu einer Erklärung an. »Aber Sie … Sie hatten doch sicher andere Pläne.«
»Pläne?«
Er seufzte leise. »Ihre private Zukunft betreffend, Fräulein Salzmann. Ihr Bekannter – Verlobter – ist er Soldat?« Sie wollte antworten, er habe die Offizierslaufbahn eingeschlagen, kam aber nicht dazu. »Nun ja, was soll ein Mann, der jung und gesund ist, in diesen Zeiten schon anderes sein als Soldat«, gab er sich selbst zur Antwort, ehe Barbara etwas erwidern konnte.
»Ich habe keine Pläne«, erklärte sie, eine Spur härter im Ton als beabsichtigt. »Keine in dieser Richtung zumindest.«
»Entschuldigen Sie, die Frage war unpassend. Das ist Ihre Privatangelegenheit und geht mich nichts an.« Dr. Ritter hob beschwichtigend die Hände. Nie hatte Barbara einen Mann mit schöneren Händen gesehen. Schmal und schlank, mit großen blassrosa Nägeln. Die Hände eines Klavierspielers, der er ja nun einmal auch war.
»Ihre Frage braucht Ihnen nicht leidzutun«, entgegnete sie schnell. »Ich fürchte nur, die Szene auf dem Bahnhof hat einen falschen Eindruck erweckt.« Ach ja? Warum eigentlich? Und was wäre denn der richtige Eindruck gewesen? Plötzlich schämte Barbara sich.
»Nun, Abschiede … die sind nie ganz frei von Emotionen, zumal in Zeiten wie diesen«, kam Dr. Ritter ihr zu Hilfe.
»Dürfen wir auch ins Wasser? Ach bitte!« Am Ufer hatte sich ein Pulk von Mädchen gebildet.
»Na, dann stürzt euch mal in die Fluten!« Er winkte ihnen zu, und die Mädchen hüpften kreischend ins Meer.
Barbara watete zurück an Land. Wieder musste sie an Johann denken. Wie echt waren ihre Gefühle füreinander tatsächlich? Wie echt konnten Gefühle für jemanden sein, den man kaum kannte? Zehn Prozent spontane Zuneigung, neunzig Prozent Hirngespinste, sagte ihr ihr Verstand. Vielleicht waren sie einander nur ein willkommener Zeitvertreib gewesen, ein jeder dem anderen als Objekt dienend, auf das sich die Gedanken fokussieren konnten, eine Ablenkung von dem Wahnsinn, der seit vier Jahren tobte. Dem Wahnsinn, der sich ihr Leben nannte. Mein Gott, wie pathetisch, schalt sie sich selbst. Dr. Ritters Bemerkungen hatten sie durcheinandergebracht.
Lieber Johann,
wir sind wohlbehalten auf der Insel angekommen, und man hat uns mit offenen Armen empfangen. Das ist natürlich schön für die Mädchen, die doch einiges erleiden mussten und durchzustehen hatten. Sie halten sich aber ganz prächtig und machen mir keinen Kummer. Auch das Wetter spielt mit – es ist sommerlich warm, und das Meer ist natürlich eine Attraktion für sich. Für unser leibliches Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt, man verwöhnt uns regelrecht. Es gibt also keinen Grund zur Klage.
Ich hoffe, du bist wohlauf und konntest deine restliche freie Zeit genießen.
Es grüßt dich recht herzlich
Deine Barbara
Sie las sich den Brief nochmals durch, dann ein drittes Mal. Nach langem Ringen setzte sie hinzu:
PS: Du fehlst mir, und ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen.
6. KARL
Drüben im Haus Margarethe hatten sich neue Mädel breitgemacht, sie waren ihnen auf dem Rückweg vom Strand begegnet. Sahen genauso zickig aus wie die vorherigen, fand Karl. Eine hatte ihm sogar die Zunge rausgestreckt, das musste die Oberzicke sein.
Zur Kaffeestunde gab’s gleich die nächste Überraschung: Der neue Lamafü sei soeben eingetroffen, hieß es. Nicht nur ein einfacher Lagermannschaftsführer, sondern sogar Standortlagermannschaftsführer, erklärte ihnen Krause mit wichtiger Miene. Der Neue sollte einen Blick auf die Berliner Lager haben, allein hier im Ort gab es ja noch zwei weitere. Aber im Zentralhotel hatten sie’s am besten getroffen, so viel stand fest. Meerblick gab es zwar keinen, denn die Stube lag nach hinten raus, aber sonst war alles tipptopp. Und das beste Essen gab’s auch. Wahrscheinlich war das der Grund, weshalb sich der neue Lamafü bei ihnen einquartiert hatte.
Der alte hatte Pitter geheißen. Hans-Peter Ronstedt. Pitter hatten sie eingezogen, dabei war er nur ein paar Jahre älter als die Jungen. Warum, zum Kuckuck, konnte Karl nicht auch einige Jährchen mehr auf dem Buckel haben? Warum durfte einer wie Pitter in den Krieg ziehen, er aber nicht? Diese Frage stellte sich mindestens die Hälfte der Jungs hier im Lager, jeder, der was auf sich hielt, und die anderen konnte man sowieso vergessen: Muttersöhnchen, Waschlappen, »traumselige Pazifisten«, wie Lehrer Hohnscheid diese Typen einmal genannt hatte. Das hatte ein bisschen geschwollen geklungen, traf die Sache aber ganz gut, fand Karl.
»Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn’s dem bösen Nachbarn nicht gefällt«, hatte Hohnscheid zum Abschied gemeint, bevor auch er in den Krieg gezogen war gegen all die nahen und fernen Nachbarn, die dem deutschen Volk den Frieden nicht gönnten. Recht gehabt hatte er. Aber manche taten, als ginge sie die Sache nichts an. Sie machten die Augen zu, anstatt der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Man brauchte sich einen wie Herbert Glos doch nur anzugucken, oder Uwe Pfannstedt, diese Jammergestalt. Solche wie die konnte man glatt vergessen. Aus dem Rahmen fiel da eigentlich nur der Kriebel. Bernd Kriebel. Der war an sich kein so ungrader Typ, wenn auch etwas quer im Kopf. Mümmelte seelenruhig weiter an seiner Marmeladenstulle und schaute als Einziger nicht auf, als der neue Lamafü den Speiseraum betrat und mit »Heil Hitler!« grüßte, so zackig, dass alle sofort aufsprangen und es ihm nachtaten.
Helmut Schmiedel hieß er, der Neue. Sah noch recht jung aus, war aber wohl schon Mitte zwanzig. Braune Haare, graue Augen, vielleicht auch blau. Hell jedenfalls. Beim Gehen zog er den linken Fuß ein bisschen nach, aber wirklich nur ein bisschen. Wahrscheinlich riss er sich am Riemen. Kriegsverletzung aus dem Polenfeldzug, hatte Willi Wegener zu berichten gewusst, und dass Schmiedel so was wie ein Held sein sollte. Hatte es den Polen damals so richtig gezeigt nach ihrem dreisten Überfall auf Gleiwitz. Karl erinnerte sich gut, er hatte die Sache damals begeistert verfolgt: Mit ihren motorisierten Stoßtrupps war die Wehrmacht über zweihundert Kilometer ins Feindesland reingerauscht, dicht gefolgt von der Infanterie, fünfundsechzig Kilometer am Tag, alles zu Fuß. Dann Zangenangriff um die polnische Hauptstadt bis zur Kapitulation. Und mittenmang der Schmiedel, wenn’s stimmte, was der Wegener erzählte. Respekt!
Schmiedel war vorn ans Pult getreten und sprach jetzt vom deutschen Geist, von Kameradschaft und Ehre. Karl schielte nach links zur Assel rüber: Ihr war die Enttäuschung deutlich anzumerken. Eigentlich hätte sie den Laden übernehmen sollen, hatte ja auch extra den Lamafü-Kurs gemacht, aber jetzt hatte man ihr diese Lichtgestalt vor die Nase gesetzt. Einem wie Schmiedel konnte sie nicht das Wasser reichen, das sah sogar die Assel ein. Ihr richtiger Name war eigentlich Axel Keller, aber alle nannten sie Assel, das passte besser zu dieser kriecherischen Type.
Nach dem Kaffee hieß es: Kluft rauskramen. Mit dem Räuberzivil sei jetzt Schluss, hatte Schmiedel angeordnet. Karl kniff die Hose im Schritt, und richtig schließen lassen wollte sie sich auch nicht mehr. Bequem war was anderes. Auch das Braunhemd spannte unter den Armen, er musste wohl gewachsen sein. Vielleicht lag’s auch am guten Essen. So taugte das jedenfalls nicht, eine neue Uniform musste her, das wollte er der Mutter unbedingt schreiben.
Zum Abendbrot erklärte der Standortlagermannschaftsführer, dass er das Wohl aller im Blick haben müsse und dafür Sorge tragen, dass es überall nationalsozialistisch zugehe, weshalb er sich nicht jeden Tag um sie kümmern könne, so gern er es auch tue. Was das heißen sollte, ließ er offen, wechselte anschließend nur ein paar Worte mit Krause und dem Direx und rief dann die Assel zu sich. Die sah nach der Unterredung höchst zufrieden aus. Nun hatte sie es also doch geschafft: Sie war offiziell zum neuen Lamafü des Zentralhotels befördert worden.
»Schmiedels Stellvertreter auf Erden«, unkte Lupo später auf der Stube.
»Wie findet ihr ihn?«, fragte Karl in die Runde.
»Wen jetzt?«
»Na, bestimmt nicht die Assel.«
»Der Schmiedel wird uns noch richtig schleifen«, prophezeite Udo Kosserow und ließ offen, ob das eine düstere Prognose war oder ob er der Sache etwas abgewinnen konnte.
»Scheint gar nicht mal so’n ungrader Typ zu sein«, meinte Willi Wegener. »Mit Rechnen und Religion und Schnickschnack hat der nichts am Hut. Der weiß, worauf es ankommt.«
»Zucht und Ordnung«, sagte Lupo.
»Kampfgeist«, sagte Anton.
»Gute Nacht«, sagte Bernd. »Schlaft gut.«
Am nächsten Morgen wurden sie von Schmiedel geweckt, und das ziemlich lautstark.
»Auf, auf, aber dalli! Waschen, Betten bauen, Ordnung schaffen! In einer halben Stunde ist Stubenappell!«
Die Jungen rieben sich die Augen. Da zog einer ja ganz neue Saiten auf. Also nichts wie raus aus den Federn. Warum ließen sich die zerwühlten Laken nicht glatt ziehen? Warum wollte die Bettdecke sich nicht legen? Warum schloss die vermaledeite Tür des Wäscheschranks nicht? Im Waschraum dann Gedränge, mehr als Katzenwäsche war nicht drin.
»In Reihe antreten!« Da war er schon wieder, der Standortlagermannschaftsführer. Sie stolperten in den Flur. Die Morgensonne fiel durch die gläserne Flügeltür am östlichen Ende des langen Gangs und badete die Jungen in Licht, als wollte sie Schmiedel die Arbeit erleichtern. Mit hinter dem Rücken verschränkten Händen schritt er die Reihe ab, schaute jedem ins Gesicht und auf die Hände.
»Nennst du das sauber? Nägel wie ein Totengräber, pfui Teufel! Wie heißt du?«
»Karl. Karl Dengler.«
»Ich will so etwas nie wieder sehen, Dengler. Verstanden?«
Karl nickte.
»Wie?«
»Es wird nicht wieder vorkommen«, versprach Karl.