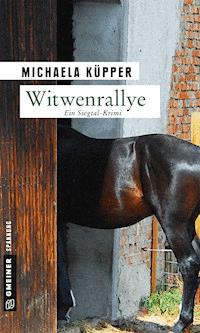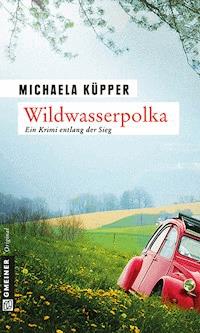9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Exakt recherchiert, mitreißend erzählt:- ein ergreifendes Stück deutsche Geschichte aus der Zeit des Nationalsozialismus in Köln – und die wahre Geschichte einer mutigen Familie Köln im Sommer 1933: Die SA stürmt die Wohnung der Familie Kühlem, die dafür bekannt ist, regelmäßig kommunistische Treffen abzuhalten. Gertrud und ihre Tochter Mucki lässt man zunächst in Ruhe, doch Peter Kühlem wird ins Braune Haus verschleppt. – wo erst einen Tag zuvor eine Freundin und Genossin zu Tode kam. und muss später als "Moorsoldat" in einem Arbeitslager um sein Leben bangen. Trotz ihrer Sorge um Peter hält Gertrud jetzt erst recht an ihrem Kampf für eine bessere, gerechtere Welt fest. Als die Herrschaft der Nazis immer erdrückender wird, schließt Mucki sich den »Edelweißpiraten« an, einer Gruppe Jugendlicher, die im Widerstand aktiv ist und immer größere Risiken eingeht … Michaela Küpper greift in ihrem sorgfältig recherchierten historischen Roman das Schicksal der Familie Kühlem aus Köln auf, die sich von Anfang an der Herrschaft des Nationalsozialismus widersetzt hat. »Die Edelweißpiratin« ist ein bewegender Roman – und eine wahre Geschichte. Aus der Zeit des Nationalsozialismus ist von Michaela Küpper ebenfalls der historische Roman »Der Kinderzug« erschienen, der die Kinderlandverschickung während des 2. Weltkriegs behandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michaela Küpper
Die Edelweißpiratin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Familie im Widerstand
Die Kühlems sind von Anfang an keine gewöhnliche Familie: Als die Apothekerin Gertrud Anfang der 1920er den einfachen Arbeiter Peter kennenlernt, scheinen Welten zwischen der Bürgerlichen und dem Kommunisten zu liegen. Doch ihre Liebe ist stärker, und die unpolitische Gertrud entwickelt sich schnell zu einer glühenden und wortgewandten Verfechterin kommunistischer Ideale. Auch ihre kleine Tochter Mucki ist stets dabei, wenn die Kölner Wohnküche zum konspirativen Treffpunkt der Genossen wird. Als jedoch 1933 die Nazis die Macht ergreifen, stehen nicht nur Peter und Gertrud vor der Frage, was sie für ihre Überzeugungen zu opfern bereit sind: Mucki hat den Kampfgeist ihrer Eltern geerbt, geht aber ihre ganz eigenen Wege …
Inhaltsübersicht
TEIL I
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
TEIL II
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
TEIL III
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
GERTRUD
MUCKI
NACHWORT
QUELLEN (AUSZUG)
TEIL I
GERTRUD
Jetzt haben sie ihn also mitgenommen. Nun doch.
Es war zwar nicht das erste Mal, und wir haben damit rechnen müssen, aber der Schock sitzt tief. Vor allem nach dem, was gestern passiert ist.
Es wird schon gut gehen, sage ich mir. Wir müssen jetzt stark sein und Geduld haben, alle drei. Also sitze ich hier und versuche, meine Gedanken zu Papier zu bringen, damit Hirn und Hände beschäftigt sind. Ich merke allerdings, mir fehlt ein wenig die Übung, denn nur so für mich selbst geschrieben habe ich zuletzt als Kind. Am Vormittag waren wir im Botanischen Garten und haben den Titanwurz bestaunt. Er blüht ein einziges Mal im Jahr, und das auch nur mit Glück. Die Blüte war wirklich imposant, verströmte aber einen so entsetzlichen Duft, dass unsere Bewunderung schnell verflog. An solche Sätze erinnere ich mich, oder: Herta und Friederike haben schon wieder meine Annelie im Wägelchen ausgefahren, obwohl ich es ihnen ausdrücklich verboten hatte. Warum spielen sie nicht mit ihren eigenen Puppen?
So klang mein Leben damals. Heute klingt es dagegen so: Zum Abendbrot kam die SA. Schwere Stiefelschritte auf der Treppe, Tritte gegen die Tür, und dann standen sie auch schon in der Küche: »Hausdurchsuchung!«
Sturmriemen unterm Kinn, gezückte Revolver, martialisches Gebrüll: Die SA will uns das Fürchten lehren, und dafür ist sie bestens ausgestattet. Einer kommt auf mich zu und schubst mich vom Stuhl, ich kann mich gerade noch fangen. Mucki schreit auf, verstummt aber augenblicklich, als er drohend den Finger in die Höhe reckt. Ich greife nach ihr, ziehe sie weg, und wir kauern uns in die hinterste Ecke. Auch Peter ist aufgestanden. Der Anführer fragt ihn, wo die Waffen seien.
»Wir haben keine«, antwortet er wahrheitsgemäß.
»Du kannst mir viel erzählen, Kühlem!« Der Kerl ist kaum dreißig und so dürr, dass ihm das Braunhemd um die Schultern schlackert. Aber wer die Macht hat, braucht weder Muskeln noch Manieren, das sollte uns ein für alle Mal klar sein. Und jetzt haben die Braunen die Macht.
»In diesem Drecksnest muss mal aufgeräumt werden!«, poltert er mit forscher Geste, und die Meute schlägt los. Schränke fliegen auf, Schubladen werden herausgerissen, alles wird zerwühlt und auf den Boden geworfen. Sie trampeln auf der Bügelwäsche herum, reißen meine Schlüpfer aus der Kommode, werfen sich mit anzüglichem Grinsen meine Büstenhalter zu und halten das für sehr männlich. Sie zerren die Bücher aus den Regalen und schlitzen Polster und Matratzen auf, dass uns die Federn und Fetzen nur so um die Ohren stieben. Natürlich finden sie nicht, wonach sie suchen, und aus Wut darüber beginnen sie, die Möbel zu zertrümmern. Nicht einmal vor dem Kinderzimmer machen sie halt.
Am liebsten würde ich schreien, auf sie losgehen, ihnen mit geballten Fäusten ins Gesicht schlagen, doch ich darf nicht. Auch Peter schweigt die ganze Zeit eisern, und das ist gut so – wer weiß, was ihm blühte, würde er den Mund aufmachen. Trotzdem nehmen sie ihn mit. Kein Händedruck, kein Abschiedskuss, nur ein Nicken mit starrem Blick, als hätten wir uns gestritten und könnten uns nicht zu mehr überwinden. Dann ist er auch schon fort.
Aber das Kind. Meine Mutterpflicht lässt mir keine Zeit für Tränen. Es bricht mir das Herz, wie die Kleine leidet.
»Der Papa kommt bald wieder«, versuche ich zu trösten und würge den Kloß im Hals hinunter. »Wenn er weit weg auf der Arbeit ist, müssen wir doch auch auf ihn warten.«
»Papa ist nicht auf der Arbeit«, widerspricht Mucki mit Grabesstimme und fügt hinzu: »Die Männer sind böse!«
»Ja, Liebelein, das sind sie. Doch dein Papa ist stark. Der wird schon mit ihnen fertig.« Ich bin nicht dafür, Kinder zu belügen, aber es ist ja keine Lüge. Es ist das, woran ich mich selbst klammere. Klammern muss. Dass Peter mit alldem fertigwird.
Später kommen Ralf und Marianne rüber, sie haben bereits von der Sache erfahren. Ralf hängt die Haustür wieder ein, stellt die Kommode auf und leimt zwei kaputte Stühle. Marianne fegt die Scherben zusammen, räumt die Bücher zurück ins Regal und macht sich mit Nadel und Faden daran, die Matratzen zusammenzuflicken.
»Es sieht schlimmer aus, als es ist«, beruhigt sie die Kleine. »Wirst sehen, alles halb so wild!«
Alles halb so wild. Wenn ich nur daran glauben könnte! Ich gebe Ralf und Marianne vom frischen Brot und der Butter mit, die noch auf dem Tisch stehen – so ziemlich das Einzige, was wundersamerweise an Ort und Stelle geblieben ist. Der Appetit ist mir ohnehin vergangen, und die Schöller-Kinder müssen oft Hunger leiden, seit Ralf seine Arbeit verloren hat. Zuerst will er nichts annehmen – Männer haben ihren Stolz –, aber ich sage ihm, dass er an seine Pänz denken soll, die würden ihm die Bescheidenheit garantiert übel nehmen. Auch Peters Streichwurst gebe ich mit, die ist sicher ohnehin verdorben, wenn sie ihn laufen lassen. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen.
Zum Abschied eine stumme Umarmung, die Worte sind aufgebraucht. Sie waren es eigentlich gestern schon, als wir hier beieinandersaßen: Peter, Ralf, Marianne und ich, stumm vor Entsetzen und Trauer und nicht ahnend, dass es noch schlimmer kommen würde.
Aber schlimmer geht’s immer, wie’s scheint.
Wie stickig es ist! Ich gehe und reiße alle Fenster auf. Eine nächtliche Brise fährt durch die Zimmer. Sie trägt den Duft des Sommers mit sich, den Duft verwehten Glücks. Sommernachtsträume, die sich an sich selbst berauschen. Mich packt die Sehnsucht, ich weiß nicht, wonach.
Mucki ist immer noch wach. Ausnahmsweise erlaube ich ihr, ins Ehebett zu krabbeln, wie sie es als kleines Kind oft getan hat. Ich lege mich neben sie, damit sie zur Ruhe kommt, und endlich schläft sie ein. Leider bleibt mir der Schlaf verwehrt, also sitze ich hier mit dem Stift in der Hand und hoffe, dass Satzbau und korrekte Grammatik mir helfen, meine wirren Gedanken in eine halbwegs geordnete Form zu bringen. Subjekt, Prädikat, Objekt, wie wir es einmal gelernt haben. Die Braunen / töten / die Kommunisten. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ist doch ganz einfach.
Gestern haben sie die Rosi aus dem Fenster geworfen. Und jetzt ist die Rosi tot.
Aber immer schön der Reihe nach, so sind die Regeln. Erstens, zweitens, drittens, oder: Wer A sagt, muss auch B sagen. Nein, das ist jetzt wieder etwas anderes – und trifft es doch am besten. Wir haben uns die Sache eingebrockt, mein Peter und ich. So ergeht’s den Roten, wir waren ja gewarnt. Seit dem 30. Januar 1933 waren wir es. Seit dem Tag, an dem Paul von Hindenburg, unser altehrwürdiger Reichspräsident, kaiserlicher Generalfeldmarschall und »Held von Tannenberg«, jämmerlich einknickte und einen verhinderten österreichischen Kunstmaler namens Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. Seit dem Tag, an dem wir uns endgültig hätten eingestehen müssen, dass wir verloren haben, dass die Braunen nun nichts mehr aufhalten kann. Weil sie niemand mehr aufhalten wollte. Weil niemand Einspruch erhoben hat außer uns, den Aufwieglern und Ruhestörern, den Unbequemen, Ketzerischen, den vaterlandslosen Gesellen. Nicht etwa die Braunen, sondern wir waren der Dorn im Auge des kleinbürgerlichen Spießertums, und wir sind es jetzt, die für die Ruhestörung büßen sollen. Aber all das brauche ich mir ja nicht selbst zu erzählen. Ich muss es nur ertragen.
Fassen wir also zusammen:
1. Gestern hat die arme Rosi dran glauben müssen.
2. Heute Morgen hat der Prozess gegen Peters Genossen Hermann Hamacher und die anderen Rotfrontkämpfer begonnen.
3. Heute Abend wurde Peter von der SA verhaftet. Sollten sie ihn festgenommen haben, weil sie ihn mit Punkt 2 in Verbindung bringen, dann gnade uns Gott.
MUCKI
In der Küche ist es still. Zu still. An gewöhnlichen Abenden hallt der Bass des Vaters durch die Wohnung, unterbrochen von seinem dröhnenden Lachen oder, wenn es wieder einmal Ärger mit den Braunen gegeben hat, von deftigen Flüchen.
»Nicht so laut, Peter, man hört dich ja bis auf die Straße runter!«, mahnt die Mutter dann immer, wovon er sich gewöhnlich wenig beeindrucken lässt. Heute dagegen bleibt alles stumm.
Mucki drückt die Tür auf, die nur angelehnt ist. Im warmen Lichtkegel der Petroleumlampe sitzt die Mutter und schreibt. Die Hälfte ihres Gesichts leuchtet golden – Stirn, Wange, Kinn –, ebenso die Hand, die den Stift führt. Der Rest liegt in tiefem Schatten. Sie mag es, abends in diesem Licht zu sitzen. Dramatisch und schön sieht das aus, wie auf einem alten Gemälde, das Mucki in einem Buch gesehen hat. Ein lebendiges Bild. Sie möchte ein Teil davon sein.
»Mama, was machst du?« Zögernd tritt sie näher.
»Ich schreibe mir die Sorgen von der Seele«, antwortet die Mutter und fügt, von einem leisen Seufzer begleitet, hinzu: »Zumindest versuche ich es.« So ist sie, die Mama. Sie behauptet nicht: »Ich schreibe einen Brief an Tante Hedi«, oder: »Ich gratuliere dem französischen Onkel zum Geburtstag.« Sie versucht nie, Mucki mit Ausflüchten abzuspeisen. Sie sagt, was ist. Mucki ist stolz darauf, dass ihre Eltern sie nicht wie ein kleines Kind behandeln. Mit ihren neun Jahren ist sie das ja nun wirklich nicht mehr.
»Unsere Tochter muss wissen, was in der Welt vorgeht«, sagt auch der Vater immer und schickt sie nie weg, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. Mucki interessiert sich sehr dafür, was in der Welt vorgeht, doch an diesem Abend, dem zweiten, nachdem die Braunen ihn verhaftet haben, sehnt sie sich mehr nach Trost und guten Worten als nach der bösen, hässlichen Wahrheit dort draußen.
Ihre Mutter bemerkt ihr Zögern, legt den Stift beiseite. »Kannst du nicht schlafen?« Mucki schüttelt stumm den Kopf. Die Mutter streckt ihr die Arme entgegen, und sie klettert auf ihren Schoß. Es tut gut, ihre Nähe zu spüren, die Wärme ihrer Haut, obwohl es ohnehin warm ist im Raum, geradezu heiß. In Sommernächten stehen die Fenster gewöhnlich weit offen, doch als zur Abendbrotzeit das Stiefelstampfen eines SA-Trupps von der Görresstraße heraufhallte, hat die Mutter sie schnell geschlossen. Jetzt legt sie die Arme um ihre Tochter und drückt die Nase in ihre krausen Locken, wie sie es früher immer getan hat. »Mmh«, macht sie, »dein Haar riecht nach Sonnenschein.« Auch das hat sie früher immer gesagt.
Leider hält der schöne Moment nicht lange an, denn Mucki ist kein Fliegengewicht mehr, und die Beine der Mutter sind dünn und knochig. Beim Vater kann sie stundenlang auf dem Schoß sitzen, ohne ihm eine Last zu werden, hier, auf diesem Stuhl, im warmen Schein der Petroleumlampe, während beide die Köpfe über ihren Büchern zusammenstecken oder er ihr vorliest, am liebsten wilde Abenteuergeschichten oder Texte von Rosa Luxemburg. Mucki liebt Rosa, ihre unerschrockene Heldin mit dem glasklaren Verstand.
»Liebelein, es geht nicht mehr.« Mucki steht auf. Die Mutter fasst sie bei den Schultern, dreht sie zu sich und schaut ihr in die Augen. »Wir müssen tapfer sein, meine kleine Gertrud. Stark und tapfer. Das sind wir deinem Papa schuldig. Er soll sich nicht auch noch um uns sorgen müssen, nicht wahr?«
Mucki nickt. Sie will ja tapfer sein. Papa ist stark, das tröstet sie ein wenig. Sie kennt keinen Mann, der so stark ist wie er. Wenn er die Muskeln seiner Arme anspannt, kann sie sie kaum mit beiden Händen umfassen. Ach was, vier Hände bräuchte sie dazu! Doch was hat ihm alle Kraft genützt, als die bösen Männer in die Wohnung stürmten, als sie herumschrien und alles kaputt machten? Lang und dürr wie ein Sargnagel war der Anführer gewesen. Gegen den hätte der Vater leichtes Spiel gehabt, und doch hat er nichts ausrichten können. Ob diese Männer es auch schaffen würden, ihren Papa aus dem Fenster zu schubsen? Mucki darf gar nicht darüber nachdenken.
»Stell dir nur vor: Der Mann weit weg auf Montage, und sie kommen und zerren dich aus dem Bett, und das Kind bleibt allein zurück. Nur Unmenschen bringen so etwas fertig!« Marianne hat das gesagt, die Freundin der Mutter. Hier, in dieser Küche, erst vor drei Tagen. Da war Papa noch da. Alle haben um den großen Küchentisch herumgesessen wie so oft, nur dass es nicht so hoch hergegangen ist wie sonst. Normalerweise wird hier gescherzt, gelacht, diskutiert und geschimpft. Seit Anfang des Jahres wird mehr sorgenvoll die Stirn gerunzelt als gelacht und geschimpft, aber so seltsam still wie an jenem Abend war es sonst nie. Fast so still wie jetzt.
Sie hat beim Vater gesessen, tieftraurig, aber geborgen wie ein Kätzchen im Schoß eines Riesen, und seine Hände haben schützend auf ihren Schultern gelegen.
»Hat sich aus dem Fenster gestürzt, dass ich nicht lache!« Wieder Marianne, doch sie hat kein bisschen gelacht, im Gegenteil. »Nie hätte Rosi so etwas getan! Schon wegen des Kindes nicht. Was soll nur jetzt aus ihm werden?«
Mit dem Kind war Margret gemeint, Muckis Freundin aus der Schule. Am frühen Morgen hatte sie vor der Wohnungstür gestanden, im schicken bunten Sommerrock und mit heller Bluse, wie zu einem Ausflug, doch ihr fliegender Atem und das tränennasse Gesicht hatten eine ganze andere Sprache gesprochen.
»Die Mama, die Mama!«, hat sie immer wieder gestottert und die Wahrheit schließlich herausgewürgt wie einen Brocken, an dem sie zu ersticken drohte. »Die Mama ist tot!«
Die Mama ist tot. Der Satz fuhr Mucki durch Mark und Bein wie ein Stromstoß. Und fast unmittelbar darauf setzte die Scham ein. Scham über das unermessliche Unglück, das die Freundin ereilt hatte. Scham darüber, Zeugin dieses Unglücks zu sein, Zeugin Margrets nackter Hilflosigkeit, dem Zwang zur vollkommenen Entblößung ihres Elends. Und Scham über das Aufblitzen eines Gefühls, gegen das Mucki sich nicht wehren konnte: der jähen Erleichterung darüber, dass es nicht die eigene Mutter getroffen hatte.
Nie wird Mucki dieses Bild vergessen: Margret in ihrem neuen geblümten Stufenrock – von der Mutter genäht und gestern noch heiß beneidet –, dazu die ärmellose Bluse, ein blütenweißer Klecks auf gebräunter Haut. Ihr schönes helles Haar, sonst stets zu einem dicken Flechtzopf gebändigt, offen und wirr. Wie ein verzweifelter Rauschgoldengel hatte sie ausgesehen.
Ständig muss Mucki an Margret denken. Bald enden die Sommerferien, aber sie glaubt nicht, dass sie sie wiedersehen wird. Dass sie sie jemals wiedersieht. Schon jetzt vermisst sie die Freundin, ihr Fehlen schmerzt wie eine offene Wunde. Aber noch schmerzlicher vermisst sie ihren Vater.
GERTRUD
Draußen regnet es in Strömen, und es ist sehr kalt geworden, mitten im Juli.
»Sauwetter!«, schimpft Marianne und strubbelt sich durch ihr nasses Haar. Wenn ich Dienst in der Apotheke habe, nimmt sie mir Mucki ab und bringt sie manchmal auch wieder heim, so wie jetzt.
»Willst du ein Handtuch?«
Marianne winkt ab. »Bin ja nicht aus Zucker.«
Mucki steht noch immer nahe der Tür und sieht mich fragend an. Ich kenne diesen Blick bereits, wie auch sie meine Reaktion zu deuten weiß, ohne dass ein einziges Wort gesprochen werden muss: nichts Neues vom Papa.
»Dürfen wir noch spielen?«, fragt Lene, Mariannes älteste Tochter, die mitgekommen ist.
»Verschwindet schon!« Ich tue so, als würde ich sie wegscheuchen. Die Mädchen streifen ihre Sandalen ab, ohne sich die Zeit zu nehmen, die Fersenriemchen zu öffnen, und huschen ins Kinderzimmer. Lene liebt Muckis Zimmer, daheim muss sie sich einen winzigen Raum mit ihren drei kleinen Geschwistern teilen.
»Neuigkeiten?«, erkundigt sich Marianne. Ich schüttele den Kopf, und sie stößt einen leisen Seufzer aus. Wir gehen in die Küche, doch kaum haben wir uns hingesetzt, klopft es schon wieder.
»Das wird Ralf sein«, vermutet Marianne. »Und er bringt noch jemanden mit.« Sie lächelt jetzt. Ich gehe, um zu öffnen. Tatsächlich ist es Ralf – und neben ihm steht Manfred Siefen.
»Manfred!« Das ist nun wirklich eine Überraschung. »Wie schön, dass du wieder bei uns bist!« Ich bin ehrlich gerührt, strecke die Hand aus, streiche über seinen Arm.
»Nur keine falsche Zurückhaltung, junge Dame!« Manfred packt mich, zieht mich an sich und drückt mir einen Kuss auf die Wange. Sein Gesicht ist nass vom Regen, und es pikst ein bisschen. Peters Bartwuchs kratzt nie, fährt mir durch den Sinn. Er rasiert sich zweimal am Tag, wenn’s sein muss. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Manfred ist wieder da, allein das zählt im Moment.
Er ist einer von Peters ältesten Freunden, Mitglied des offiziell längst verbotenen Roten Frontkämpferbundes wie er, ein liebenswerter, verlässlicher Kerl. Gleich am 30. Januar, dem Tag von Hitlers Machtergreifung, haben sie ihn verhaftet. Er soll Mülltonnen von einem Dach herunter auf einen SA-Trupp geworfen haben, der im Triumphmarsch durch Ehrenfeld zog. Zuzutrauen wär’s ihm. Ich hoffe sogar, dass er’s getan hat, wenn er schon dafür einsitzen musste.
Einen knappen Monat später, unmittelbar nach dem Reichstagsbrand, wurde auch Peter auf offener Straße verhaftet. Doch sie konnten ihm nichts nachweisen und mussten ihn gleich wieder laufen lassen. Damals hat er mehr Glück gehabt.
»Wie geht es dir?«, frage ich Manfred. Müde und blass sieht er aus, mit blauschwarzen Schatten unter den Augen, als hätte er wochenlang nicht geschlafen.
»Hervorragend!«, dröhnt er und reibt sich demonstrativ die Hände. »Bin seit gestern wieder draußen. Ein tolles Gefühl, sag ich dir! Nur ein bisschen viel Platz überall um mich rum. Muss mich erst wieder dran gewöhnen.« Er lächelt schief. Ich lächle zurück, irgendwie.
Dann hocken wir gemeinsam am Küchentisch wie in alten Zeiten. Ich koche Muckefuck und schneide einen Rosinenblaatz auf. Ralf packt ein paar mitgebrachte Bierflaschen aus, reicht Manfred eine. Schnappverschlüsse ploppen. Alles fast wie immer. Nur Peter fehlt.
»Was ist das für ein Heft?« Ralf deutet auf mein frisch begonnenes Tagebuch, das noch auf der Tischplatte liegt. Ich starre darauf, und als hätte ich seinen Zweck momentan selbst vergessen und müsste mich erst besinnen, schütze ich Gleichgültigkeit vor.
»Eine Kladde, nichts weiter. Darin notiere ich meine Gedanken.«
»Hoffentlich nur harmlose.«
»Völlig harmlos!«, bekräftige ich. »Kochrezepte, Gedichte über Blumen, über die Liebe, solche Dinge eben.«
Ralf runzelt die Stirn. »Darf ich sehen?«
»Nein.«
Er seufzt resigniert. »Die SA kann jederzeit wiederkommen, Gertrud. Du solltest nichts aufschreiben.«
»… sagte er und machte sich auf den Weg, um bei Nacht und Nebel die Rote Fahne unters Volk zu bringen.« Ich grinse freudlos. Ralf überhört meine Bemerkung und wiederholt seine Mahnung. Wo ich meine Wut denn sonst loswerden soll, außer auf dem Papier, frage ich ihn, und darauf schweigt er. Ich greife nach der Kladde und lasse sie in einer Schublade des Küchenbüfetts verschwinden. Einen Moment herrscht Stille. Draußen klatscht der Regen gegen die Scheiben. Die Küchenuhr tickt die Zeit weg.
»Gibt es Neuigkeiten von deinem Mann?«, durchbricht Manfred schließlich das Schweigen.
»Nein. Leider.«
»Was genau wirft man ihm vor?«
»Wenn ich das wüsste! Jeden Tag renne ich zum Braunen Haus, aber sie wollen mir nichts sagen.«
Manfred nickt nur, und es ist dieses wissende Verständnis, das mich aus der Fassung bringt.
»Habt ihr gehört, was sie fordern?«, platze ich heraus und greife nach dem Westdeutschen Beobachter, der auf dem Herd liegt, bereit, ihn zu verfeuern. »Gerechte Sühne für die feige und ungemein bestialische Mordtat«, lese ich vor. »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« Ich schaue zu Manfred hinüber. »Von schändlichem Treiben jüdisch-marxistischer Mordhetzer reden sie, von angeblichen Meuchelmorden der ›roten Untermenschen‹. Rote Untermenschen nennen sie uns! So weit ist es gekommen!«
»Klingt wie die Morlocks aus der Zeitmaschine«, brummt Manfred, der seinen trockenen Humor offenbar nicht verloren hat. Aber mir ist das Lachen vergangen.
»Der Selbsterhaltungswille des deutschen Volkes kann keine Nachsicht üben«, zitiere ich weiter. »Wer sich –«
»Es wäre gut, wenn du mich aufklärst«, unterbricht er mich ruhig. »Ich war sozusagen auf entferntem Außenposten in letzter Zeit, da kamen nicht alle Informationen an.« Er lächelt schwach. »Es geht um den Prozess wegen der toten SA-Männer, nehme ich an. Aber Erna hat die Geschichte nicht so richtig zusammengekriegt, und diese Schmierblätter lese ich nicht.« Sein Kinn ruckt verächtlich in Richtung Zeitung. Ich hole tief Luft, versuche, wieder ruhig zu werden. Weiß nicht, wo ich anfangen soll.
»Am 24. Februar gab’s hier einen Haufen Wahlveranstaltungen, wegen der Reichstagswahl am 5. März«, springt Ralf mir bei. »›Sturm auf Köln‹ nannten die Braunen das. An dem Abend haben sich einige Männer vom Rotkämpferbund, Gruppe Nord, getroffen. Im Ohm Paul am Gereonswall, du kennst die Kneipe.« Manfred nickt. »Josef Engels, der Organisationsleiter der RFB-Gruppe, hat die Order vom politischen Leiter rausgegeben: Die Genossen sollten auf den Straßen patrouillieren, alle uniformierten Nazis anhalten und auf Waffen kontrollieren – das Übliche also. Angeblich gab’s dazu aber noch den Befehl, SA-Männer ›umzulegen‹, falls sie Widerstand leisten sollten. Ob’s stimmt …« Ralf zieht die Schultern hoch und dreht die Handflächen nach oben.
»Wer war alles dabei?«, erkundigt sich Manfred.
»Hermann Hamacher, Otto Waeser und Bernhard Willms«, zählt Ralf auf. »Dazu Heinrich Horsch, Mathias Moritz und noch ein paar andere. Sagen dir die Namen was?«
»Den Hermann kenne ich. Und Otto Waeser ist der Bruder vom Andreas, oder?«
»Andreas ist auch angeklagt«, schiebt Marianne ein.
»Jesses!« Heftiger als nötig setzt Manfred seine Flasche ab.
»Die Männer sind also raus auf Streife«, fährt Ralf fort. »Gegen halb elf sollen sie dann auf zwei Mann von der Sturmabteilung gestoßen sein, Walter Spangenberg und Winand Winterberg. Beide SA-Leute kamen jeweils von irgendwelchen Wahlveranstaltungen zurück, wo sie sich als Saalschützer betätigt hatten. Zuerst kam Spangenberg, und Hermann Hamacher hat angeblich sofort das Feuer auf ihn eröffnet. Heimtückisch und mit Vorsatz. Also Mord. Ähnliches geschah dann angeblich kurz darauf beim Zusammentreffen mit Winterberg. Wieder soll Hermann geschossen haben, aber auch andere seiner Gruppe. Das ist zumindest das, was die Anklage behauptet. Nur haben wir starke Zweifel, ob es tatsächlich so war. Diese Geschichte kommt doch wie gerufen, um ein Exempel an uns zu statuieren.«
Manfred schweigt nachdenklich. »Aber es sind Schüsse gefallen«, wendet er ein. »Sie müssen also Waffen gehabt haben.«
»Tja.« Ralf reibt sich das Kinn. »Unsere Männer wurden noch in der Nacht verhaftet beziehungsweise gleich am nächsten Morgen. Wir wissen also nur, was im Westdeutschen Beobachter steht. Und der dreht sich die Wahrheit bekanntlich, wie’s ihm passt.«
Manfred schüttelt den Kopf. »Das mit den Waffen ist nicht gut, gar nicht gut.«
»Aber die Umstände müssen doch berücksichtigt werden«, mische ich mich ein. »Denkt daran, welche Stimmung in diesen Tagen herrschte: Hitler gerade zum Reichskanzler ausgerufen, und unser frischgebackener preußischer Innenminister Göring ernennt die SA zur Hilfspolizei. Ausgerechnet die SA, unseren größten Feind! Was haben wir nicht alles getan, um sie aus den Arbeitervierteln rauszuhalten, und dann fallen sie hier ein und drohen uns mit Mord! Hermann Hamacher stand bei der SA auf der schwarzen Liste. Er musste damit rechnen, dass sie ihn umbringen. Allein das ist ja eigentlich schon Erklärung genug, warum er bewaffnet war. Diese Fakten müssen doch berücksichtigt werden!«
Ralf schaut mich lange an, aber so, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders, dann greift er nach der Zeitung und liest vor: »Zur Prozesseröffnung saßen in Begleitung des Oberstaatsanwaltes Hagemann in der erhöhten Loge des Gerichtssaales der NSDAP-Gauleiter Grohé, Oberbürgermeister Riesen, Bürgermeister Schaller, Polizeipräsident Lingens, der Chef des Presseamtes Frielingsdorf, SA-Standartenführer Odendall und weitere Mitglieder.« Er blickt auf. »Da oben hockt fast das gesamte braune Bonzenpack Kölns beisammen. Und der Rest sitzt unten am Richtertisch. Im Mai ist die Kölner Staatsanwaltschaft nahezu geschlossen der NSDAP und dem NS-Juristenbund beigetreten«, wendet er sich nun direkt an Manfred. »Jetzt dürfen uns die Braunen ans Leder und werden begnadigt. Ja, sie dürfen sogar Landtagsabgeordnete ungestraft erschießen, wie letztens in Oldenburg.«
Manfred macht ein angewidertes Geräusch, greift nach seinem Bier.
»Und hör dir das an!« Ralf ist jetzt nicht mehr zu bremsen. »Hermann Hamachers Pflichtverteidiger würde es begrüßen, dass auch der politische Verbrecher wieder zittere und fühle, dass das Schwert der Justiz geschliffen und frei von Rost gemacht worden sei. Das nenne ich einen engagierten Anwalt, liebe Freunde!« In seiner Stimme schwingt Verbitterung mit.
»Lasst uns das Thema wechseln!«, bitte ich. »Mir wird ganz schlecht davon.«
»Hier, du musst was essen.« Marianne schiebt mir eine dicke Scheibe Rosinenblaatz hin. Im selben Moment reicht Ralf mir seine Flasche Bier über den Tisch. Ich muss lachen, trotz der Anspannung.
»Vielen Dank, aber Bier und Blaatz, das geht nun wirklich nicht zusammen.«
»Dat jeht janz wunderbar!« Manfred greift sich die Scheibe süßen Hefebrots und spült sie mit großen Schlucken Bier hinunter. Wortlos reicht ihm Marianne eine weitere Scheibe. »Noch mal zurück zu dem Prozess«, nuschelt er mit vollem Mund, meine Bitte ignorierend, wie es so oft männliche Art ist. »Warum ausgerechnet die beiden?«
»Du meinst Winterberg und Spangenberg?« Ralf zuckt die Achseln. »Zufall?«
»Das war kein Zufall!«, wende ich ein. »Beide waren KPD-Mitglieder, bevor sie zum Feind übergelaufen sind. Und Otto Waeser hat den Winterberg angeblich gekannt.«
»Weißt du, ob’s stimmt?« Marianne sieht mich fragend an.
»Was? Dass Winterberg und Spangenberg mal KPD-Mitglieder waren? Das stand nicht in der Zeitung, das hat Peter mir erzählt. Und der wusste es von jemandem aus der RFB-Gruppe.« Manfred kneift die Augen zusammen und fixiert mich prüfend. Mir wird bang vor der Frage, die er gleich stellen wird. Und da kommt sie auch schon.
»Hat Peter mit der Sache zu tun?«
Ich schüttele den Kopf, noch ehe er zu Ende gesprochen hat. Halte inne. Denke an Hermann. An dieses schmale Bürschchen. Ein blasser, fahriger Typ mit unstetem Blick. Ich habe ihn nur zwei-, dreimal gesehen. Er gehörte nicht zu Peters engstem Kreis. Aber sie hatten miteinander zu tun. »Er kennt ein paar von ihnen, zumindest Hermann Hamacher und Otto Waeser«, gebe ich zu.
»Die kennen wir auch«, hält Manfred dagegen. »Aber war er in der Kneipe? War er im Ohm Paul an dem Abend?«
»Ich … ich weiß es nicht. Sicher war er früher mal da. Er sagte mir aber, er sei bei dem konspirativen Treffen nicht dabei gewesen. Nur war er … er war nicht zu Hause an dem Abend.« Ich kann Manfreds Blick nicht standhalten.
»Würden sie Peter mit dem Hamacher-Prozess in Verbindung bringen, käme seine Verhaftung reichlich spät«, gibt er zu bedenken.
Mir sitzt ein Kloß im Hals. »Es sei denn, jemand hat gegen ihn ausgesagt«, erkläre ich heiser. Nun ist sie ausgesprochen, meine größte Sorge. Und niemand kann sie mir nehmen.
Jetzt ist es raus. Man hat sie gestern Abend zum Tode verurteilt. Hermann und die anderen. Ich bin am Boden zerstört.
Peter, mein Peter! Noch immer weiß ich nicht, weshalb sie dich festhalten. Aber ich weiß, dass ich ohne dich nicht sein kann. Ich halte das alles nicht aus. Komm zurück, Peter! Du musst einfach!
MUCKI
Als Mucki morgens barfuß und im Nachthemd den Flur entlangtappt, dringen Stimmen aus der Küche. Durch das halb transparente Rankenmuster der Türverglasung erblickt sie eine kompakte Gestalt, direkt daneben den schmalen Schemen der Mutter. In freudigem Schrecken drückt sie die Klinke herunter, wird aber sofort enttäuscht: Der Mann, der da am Tisch sitzt, ist nicht ihr Vater, sondern ein Fremder.
»So jet darf man dene nit durchjehe losse«, sagt er gerade in breitestem Kölsch. »Dat war keen Prozess, dat war en abjekartetes Spiel! Ausrotten wollen die uns, sonst nix. Da muss man sich wehre, un’ wenn et am Ende Konzertlager heißt.«
»Still jetzt!«, kommandiert die Mutter. Ihr Gesicht ist ganz nah vor dem seinen, und als sie die Nadel einsticht, saugt er geräuschvoll die Luft ein. Die Mutter blickt kurz auf, hat jetzt Mucki entdeckt.
»Ah, Liebelein, du kommst gerade richtig! Reich mir bitte einen Verband aus dem Schränkchen.« Weiter braucht sie nichts zu sagen, denn Szenen wie diese hat Mucki schon viele Male erlebt. Sie weiß, was zu tun ist. Wo andere Leute Schüsseln, Saucieren und Suppenterrinen verwahren, hat die Mutter ein ganzes Arsenal an Medikamenten und Verbandszeug untergebracht. Was aufgebraucht ist, wird durch stetigen Nachschub aus der Apotheke ersetzt.
Mucki geht zum Buffet, holt das Gewünschte, denkt auch an die kleinen Metallklämmerchen zum Fixieren des Verbands. Sie legt alles auf das bereitstehende Stahltablett, beugt sich dann vor, um die Verletzung des Mannes genauer in Augenschein zu nehmen: eine ordentliche Platzwunde oberhalb der rechten Augenbraue, bereits gereinigt und desinfiziert. Trotzdem sieht sie fies aus, aber Mucki hat schon schlimmere gesehen. Auch die Unterlippe des Mannes hat etwas abbekommen und ist mächtig geschwollen, am linken Ohrläppchen klebt Blut.
»Na, Kleen, wie is et?« Ohne seinen Kopf zu drehen, äugt er zu Mucki herüber.
»Jut. un’ Ihnen?«, fragt sie höflich zurück.
»Auch jut«, antwortet er und zieht gleich wieder die Luft ein. Acht Stiche insgesamt, schätzt sie; zwei sind bereits gemacht. Die Mutter knüpft einen Knoten, schneidet mit einer Nagelschere die Enden ab, fädelt erneut ein Stück Faden ein.
»War wohl ’ne ordentliche Keilerei«, stellt Mucki sachlich fest.
Der Fremde lacht auf. »Du solltest erst die anderen sehen!«, nuschelt er und zwinkert ihr mit seinem gesunden Auge zu. »Da hab ich mich wohl aus vaterländischem Überschwang zu Straftaten hinreißen lassen«, ergänzt er mit Blick auf die Mutter, wobei sein schiefes Grinsen noch breiter wird.
»Stillhalten«, erwidert sie nur, aber Mucki interessiert die Sache.
»Kommst du jetzt auch ins Gefängnis?«, erkundigt sie sich.
»Nee.« Der Mann schüttelt den Kopf.
»Still jetzt!«, mahnt die Mutter in schärferem Ton.
»Und wenn sie dich erkannt haben?«
»Keine Sorge, ich war jetarnt.« Wieder dieses schiefe Grinsen, während er auf das schwarze Tuch deutet, das er um den Hals geschlungen hat. Unmittelbar darauf jault er erneut auf.
»Jetzt zeigst du’s mir aber mal richtig, Jertrud, was?«
»Kannst froh sein, dass du so einen Betonschädel hast.«
Acht Stiche. Nicht ohne Stolz bemerkt Mucki, dass sie richtig geschätzt hat. Bald darauf liegt der Mann, der Ewald heißt, auf dem Sofa und schläft wie ein Stein im Kiesbett.
»Gehirnerschütterung?«, erkundigt sie sich fachkundig.
Die Mutter wiegt den Kopf hin und her. »Möglich. Wir lassen ihn eine Weile liegen.« Sie geht und wirft eine blutgetränkte Kompresse in den Mülleimer. »Möchtest du Rührei zum Frühstück?«
Ja, Mucki möchte.
»Was waren das für Straftaten, die Ewald aus vaterländischem Überschwang begangen hat?«, fragt sie später zwischen zwei Bissen.
»Das war nur ein Scherz.« Ein müdes Lächeln huscht über das Gesicht der Mutter. »Er hat ziemlich wortwörtlich die Braunen zitiert. Die haben vor ein paar Monaten eine Amnestie für alle beschlossen, die Kommunisten angegriffen haben. Amnestie bedeutet, sie bekommen keine Strafe dafür.«
»Haben sie Rosi deswegen aus dem Fenster geworfen?«, fragt Mucki mit gerunzelter Stirn.
»Das ist leider anzunehmen.« Die Mutter seufzt tief.
»Aber das ist doch nicht richtig!«, empört sich Mucki. »Die Verbrecher lassen sie laufen, und unseren Papa sperren sie ein, dabei hat der gar nix gemacht!«
»Recht hast du, mein Kind.« Die Mutter beugt sich über sie, nimmt den leer gegessenen Teller fort. »Deshalb müssen wir uns wehren und für die gerechte Sache kämpfen, wann immer wir es noch können. So, wie Genosse Ewald es getan hat.«
Genosse Ewald schläft den Schlaf der Gerechten und wacht erst am späten Vormittag wieder auf. Die Schiebermütze tief in die bepflasterte Stirn geschoben, Zigarette im Mundwinkel, verabschiedet er sich von ihnen.
»Halt die Ohren steif, Kleen! Und lass dir nix verzälle.« Er schenkt ihr ein letztes schiefes Grinsen, dann ist er auch schon fort, und nur der zäh im Raum hängende Tabakdunst erinnert noch an ihn.
»War schon lang keiner mehr da.« Mucki muss nicht näher ausführen, was sie meint. Früher, vor der Sache mit diesem Hitler, kamen oft Leute, die böse Verletzungen davongetragen hatten, oder sie wurden von anderen hereingeschleift. Bei Schlägereien mit den Braunen war es schon immer handfest zugegangen.
»Sie haben jetzt Waffen«, erklärt die Mutter, während sie ihr einen Teller zum Abtrocknen reicht. »Und sie sperren jeden weg, der ihnen nicht in den Kram passt.«
»Wie unseren Papa.«
»Wie deinen Papa, richtig. Aber sie kriegen ihn nicht klein. Dazu ist er zu stark.«
Mucki nickt, und sie widmen sich wieder dem Abwasch. Danach macht die Mutter sich zur Arbeit fertig. Sie hat Dienst in der Apotheke. Mucki bleibt allein zurück, wenn auch nicht für lang. Nach einer Runde Steckhalma holt sie ihr Täschchen, das sie überallhin mitnimmt, hockt sich auf die schmale Bank im Flur, schlüpft in ihre Sandalen. Die Riemchen sind so ausgeleiert, dass ein neues Loch gestochen werden muss. Einen Moment lang überlegt sie, ob sie Hammer und Nagel holen soll, wie es die Mama einmal gemacht hat, verwirft den Gedanken aber schnell. Für heute wird’s schon noch gehen. Sie nestelt den Schuh zu, richtet sich auf, greift nach ihrem Täschchen. Während sie noch einmal gewissenhaft dessen Inhalt prüft, geht ein Schlüssel im Schloss. Aufspringen und zur Tür rennen sind eins.
»Papa!«
»Muckelchen!« Der Vater hebt sie hoch und schwenkt sie einmal in Kreis herum, ganz so, wie er es sonst immer tut, wenn er länger auf Montage war. Doch die Bewegung gerät weniger schwungvoll als gewöhnlich, und mit schmerzverzerrtem Lächeln setzt er sie wieder ab. »Meine kleine Gertrud! Wie schön, dich zu sehen!« Er drückt sie nochmals an sich, und sie schlingt ihre Arme um ihn, will ihn gar nicht mehr loslassen. Schließlich blickt sie zu ihm auf und schluckt tapfer die Tränen hinunter, die Worte der Mutter im Ohr. Wir wollen ja nicht, dass er sich um uns sorgen muss.
Müde sieht der Vater aus, und unter dem linken Auge hat er eine blutverkrustete Wunde. Sie haben ihn geschlagen, denkt sie und ballt unwillkürlich die Fäuste. Diese Verbrecher!
»Komm!« Der Vater nimmt sie bei der Hand und führt sie in die Küche, wo er sich auf den erstbesten Stuhl sinken lässt. Sonst sitzt er immer am Tischende, aber die Sitzordnung ist ihm wohl gerade egal. »Ist deine Mutter auf der Arbeit?« Sie bejaht, und er nickt gedankenverloren. »Wir müssen ihr Bescheid geben.«
»Ja«, sagt sie nochmals, ohne seine Hand loszulassen. Wie erschöpft er aussieht! Dazu unrasiert. Und hungrig. Er muss hungrig sein! Bestimmt haben sie ihm nichts zu essen gegeben. Wenn er erst wieder etwas in den Magen bekommt, geht es ihm sicher bald besser.
»Soll ich dir Rührei machen?«, schlägt sie vor. Rührei zubereiten kann sie schon, das hat die Mutter ihr beigebracht. »Das beste von janz Kölle«, behauptet der Vater immer.
»So eine schöne Rühreipfanne ist genau das, worauf ich jetzt Appetit habe.« Er streicht ihr zärtlich über die Wange, und sie schmiegt sich in seine Hand. Eine warme Woge wallt durch ihren Körper, alles in ihr ist Liebe. Es tut fast weh. Niemand, niemand darf dem Vater etwas antun! Nun mogeln sich die Tränen doch durch, und auch seine Augen bekommen einen glasigen Glanz. Er fährt sich mit der Hand durchs Gesicht, räuspert sich.
»Ob du wohl ein Glas Kranenburger für mich hättest?«
Sie löst sich von ihm, füllt ein Glas mit Leitungswasser, stellt es ihm hin. Sofort greift er danach und trinkt es in einem Zug leer. Sie zündet die Herdplatte an, gibt Fett in die Pfanne, schlägt sechs Eier auf – alle, die noch da sind. Dann greift sie nach seinem Wasserglas, schenkt jetzt Milch ein. Milch ist gut für die Knochen, sagt die Mutter immer zu ihr, und was für ihre Knochen gilt, wird wohl auch für die ihres Vaters gelten.
»Ich gehe mir nur rasch die Hände waschen.« Noch einmal steht der Vater auf und verschwindet im Badezimmer. Mit brennender Ungeduld wartet sie auf seine Rückkehr. Es scheint ewig zu dauern. Als er wieder in die Küche tritt, hat er Hemd und Hose gewechselt. Auch das getrocknete Blut unter dem Auge ist weg. Sein Haar ist mit Wasser nach hinten gekämmt, sogar rasiert hat er sich und den mächtigen Schnurrbart gestutzt. Jetzt ist er fast wieder der Alte.
»Essen ist fertig!« Stolz deutet sie auf den übervollen Teller, und mit einem freudigen Lächeln setzt er sich zu Tisch. Eigentlich müsste sie jetzt zur Apotheke laufen und der Mutter Bescheid geben, aber sie bringt es nicht über sich, sich von ihm zu trennen. Sitzt nur da und schaut mit großer Genugtuung zu, wie er seine Mahlzeit verzehrt.
»Das war das beste Rührei von janz Kölle«, sagt er schließlich und wischt sich den Mund an der Serviette ab, die sie ihm hingelegt hat. Servietten gibt es nur an Festtagen, aber heute ist ein Festtag. Der allerhöchste sogar. Sie haben ihren Papa nicht aus dem Fenster geworfen. Er lebt und sitzt hier bei ihr am Tisch.
»Nun lauf schon!« Der Vater nickt ihr aufmunternd zu. Sie trennt sich nur schweren Herzens, doch es geht nicht anders. Auch die Mutter muss von seiner Rückkehr erfahren, sie muss heimkommen. Erst dann sind sie wieder eine Familie.
GERTRUD
Peter ist wieder zu Hause. Welch eine Erleichterung! Mir ist, als hätte man mich zuvor mit Gewalt unter Wasser gedrückt und dann plötzlich losgelassen. Ich kann wieder atmen. Fühle mich leicht und lebendig. Vollständig. Als hätte in den letzten Wochen ein Teil meiner Seele gefehlt.
Mein Peter! Eine lange Umarmung, ein Kuss, dann sitzen wir da, Hand in Hand, wir alle drei, wie zum gemeinsamen Gebet. Und in gewisser Weise ist es das ja auch. Das Glück, einander wiederzuhaben, macht demütig.
Später schicke ich Mucki zu Marianne und Ralf rüber. Sie soll ihnen Bescheid geben, dass Peter freigekommen ist. Doch vor allem muss ich eine Weile mit meinem Mann allein sein. Es gibt so viele offene Fragen. Zuerst aber sehe ich, dass er Schmerzen hat, auch wenn er sie vor mir verbergen will. Entsprechend unwillig zeigt er mir seine Seite. Die Haut über dem rechten Rippenbogen ist violett verfärbt und von rostroten Schrunden überzogen. Blutverkrustete Striemen auch in der Nierengegend. Gürtelhiebe. Ich lasse mir meinen Schrecken nicht anmerken, säubere die Wunden, trage Salbe auf.
»Heilende Hände«, behauptet Peter mit dankbarem Lächeln. »Schon alles wie weggeblasen.« Was geschehen ist, will er mir nicht erzählen. Nur, dass sie von ihm nichts erfahren haben. Dass sie ihm letztlich nichts nachweisen konnten. Und dass es hätte schlimmer kommen können.
Vom Urteil gegen Hamacher und die anderen Genossen hat er bereits während seiner Verhaftung erfahren. Aus der Zeitung. Man hat ihm den Westdeutschen Beobachter vom jeweiligen Vortag überlassen, offenbar zu Zwecken der politischen Bildung, wie er ironisch bemerkt.
»Für diesen feigen Meuchelmord schrie des deutschen Volkes Stimme nach Sühne, für diese hinterhältigen Mordbanditen wäre nur ein Hauch von Mitleid eine Sünde wider unser ganzes Volkstum«, zitiert er voller Bitterkeit einen Satz, der ihm offenbar besonders haften geblieben ist. »Klosettpapier!« Er macht eine abfällige Geste. »Meine größte Genugtuung war, dieses Hetzblatt seiner wahren Bestimmung zuzuführen.« Ich lache, auch wenn mir anderes durch den Kopf geht. Hätten sie Peter direkt mit dem Spangenberg-Winterberg-Mordfall in Verbindung gebracht, dann könnte auch er »keinen Hauch von Mitleid« erwarten. Dann säße er nicht hier, heute nicht und vermutlich niemals wieder.
Bereits morgen früh will er an seine Arbeitsstelle bei der Klöckner-Humboldt-AG zurückkehren. Er könne es nicht riskieren, arbeitslos zu werden, erklärt er mir.
»Mach dir mal keine Sorgen um mich, Täubchen. Ein bisschen Bewegung hat noch keinem geschadet, im Gegenteil. Was mir geschadet hat, war die Untätigkeit der letzten Wochen. Wer rastet, der rostet, du weißt.«
Ich weiß. Und wusste von Anfang an, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Einem wie ihm ist der braune Abschaum nicht gewachsen. Gedemütigt und geschlagen haben sie ihn, aber gebrochen haben sie ihn nicht, meinen lieben Mann. Seine Verletzungen sind schmerzhaft, jedoch nicht gefährlich, also widerspreche ich ihm nicht und lasse ihn ziehen. Es ist gut, wenn wir unseren Alltag wiederhaben.
Leider hat Peter nun doch seine Arbeit verloren. Wer mit den Braunen in Konfikt gerät, ist nicht mehr gut gelitten und nah dran am Verbrecher. Wer sitzt schon unschuldig ein? Die Logik passt sich geschmeidig den Verhältnissen an. Aber wieder erklärt Peter beruhigend:
»Mach dir keine Sorgen, Täubchen! Einen wie mich brauchen sie überall.« Und wirklich, kaum hat er sich auf die Suche nach Arbeit gemacht, kommt er mit einer guten Nachricht wieder: Direkt in der nächsten Woche kann er bei Van der Zypen im Eisenbahnwagenbau anfangen. Welch ein unverschämtes Glück in diesen harten Zeiten, wo so viele arbeitslos sind! »Es liegt nicht am Glück, sondern am Können«, scherzt mein Mann und gibt mir einen Kuss. »Wie ich schon sagte: Kein Grund zur Besorgnis.«
Das Schicksal meint es also doch gut mit uns, und das wollen wir feiern. Am Wochenende geht es mal wieder raus ins Bergische. Wir wollen uns frischen Wind um die Nase wehen lassen, Freiheit atmen, Seite an Seite. So wie früher, mit unseren bündischen Freunden. Wie sehr ich mich schon darauf freue!
Frühmorgens brechen wir auf, mit der Bahn über den Rhein, dann weiter in Richtung Overath. Der Regen der vergangenen Tage zeigt nun doch sein Gutes: Er hat die Hochsommermüdigkeit vertrieben, hat Staub und Schmutz hinweggespült und allerorten junges Grün sprießen lassen. Alles sieht frisch und sauber aus, als hätte die Natur ein Bad genommen. Noch steigt Kälte vom Boden auf, als wir aus dem Zug steigen, doch bald brennt die aufsteigendende Sonne den Frühdunst weg und flutet die Landschaft mit Licht. Der helle Tag liegt vor uns wie ein kostbares Geschenk. Wir haben uns, wir haben einander, wir sind eine glückliche Familie, die glücklichste überhaupt.
Wie immer sind wir mit den Naturfreunden unterwegs. Menschen, die unsere Leidenschaft fürs Wandern teilen und die Überzeugung, dass jeder nach seiner Fasson glücklich sein darf. Wenn wir Seite an Seite schreiten und die alten Wandervogellieder singen, fühle ich mich leicht und frei, dann schöpfe ich Hoffnung, Hoffnung für uns alle.
Der Wahnsinn ist periodisch, er wird bald ein Ende haben, so wie eine Grippe nicht ewig währt. Sie ist gefährlich, sie rafft Menschenleben dahin, aber sie ist doch besiegbar. Und so wird es auch mit den Braunen sein.
Merkwürdigerweise sind es nicht mehr die heimlichen Versammlungen der Kommunistischen Partei, die mir diese Hoffnung geben, sondern gerade diese unpolitischen Naturfreunde. Sie sind wie die Vögel am Himmel: unaufhaltsam, unbeirrbar. Mutter Natur wird ihren Weg gehen. Sie lässt sich von niemandem befehligen.
Unweit des Overather Bahnhofs überqueren wir die Agger, dann geht es weiter den Berg hinauf. In Halzemich genießen wir den weiten Blick über die Hügellandschaft bis hin zum Siebengebirge und in die Eifel. Und über allem spannt sich ein hoher Himmel von durchscheinendem Blau. Wem geht nicht das Herz auf beim Anblick dieser schier nicht enden wollenden Weite!
Wir wandern einen schmalen Weg entlang, auf dem die letzten Pfützen verdunsten. Das Getreide steht hoch, und die Wiesen warten auf eine zweite Mahd. Lerchen hängen über den Feldern wie zitternde kleine Papierdrachen. Klatschmohn, Margeriten und Kornblumen grüßen am Wegesrand; die Mädchen schmücken ihr Haar damit. Wir tauchen ein ins Waldesgrün, marschieren abwärts, in den Talgrund hinab, treten aus tiefstem Schatten ins Licht. Von Erlen gesäumt, mäandert der Bach durch sattgrüne Wiesen; Hahnenfuß und Sumpfdotterblumen strahlen wie gelbe Sterne darin. Still ist es hier, doch die Ruhe vibriert vom Summen der Insekten, dem Gesang der Vögel, dem Flüstern des Windes im Pappellaub. Wie schön das Leben ist! Wir überqueren eine steinerne Brücke und folgen dem Bachlauf, wandern weiter, plaudernd und singend. Ich gehe abwechselnd mit Peter und den Frauen, schwatze mit dieser und jener, bis jemand das nächste Lied anstimmt. Mucki und die anderen Kinder toben als wilde Horde vorweg und genießen ihre Freiheit.
Das Tal weitet sich, Milchvieh und Pferde beäugen uns neugierig. Wir locken zwei Fohlen mit einem Büschel Gras, das sie dann doch nicht begeistern kann. Als sie mit steifbeinigen Bocksprüngen davontollen, kugelt sich Mucki fast vor Lachen.
An einer kleinen Furt machen wir Rast. Die Kinder waten im Bach herum und quietschen vor Vergnügen. Peter drückt meine Hand. Wie schön es ist, unser Kind so fröhlich und befreit spielen zu sehen! Aller Kummer scheint von ihr abgefallen.
Nach der Mahlzeit strecken wir uns im Schatten aus. Peter legt einen Arm um mich, mein Kopf ruht auf seiner Brust. Ich kann seinen Herzschlag spüren, stark und gleichmäßig. Das Geschnatter um uns her verstummt allmählich, in friedlichem Halbschlaf gleitet der Mittag in den Nachmittag über.
Die Sonne wandert weiter, und wir tun es ihr nach. Zwischen Weiden und Waldrand geht es wieder hinauf auf den Bergrücken, dann hinunter ins Aggertal. Kurz hinter einem Weiler, der sich Naafshäuschen nennt, führt uns ein aufsteigender Pfad auf einen breiteren Weg, dem wir folgen. Auf einer Wiese nahe der Burg schlagen wir unser Nachtlager auf. Die Kinder sammeln Holz und holen Butter, Milch und Speck von einem nahen Bauernhof. Wir rösten Brot über dem Feuer, werfen Kartoffeln in die Glut. Als die Speckscheiben in der Pfanne brutzeln, läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Wie jeder weiß, schmeckt es nach einer zünftigen Wanderung am besten.
Später werden die Mandolinen und Gitarren ausgepackt, und für mich beginnt nun der schönste Teil unserer Ausflüge: das gemeinsame Musizieren. Als Gerd leise Wenn der Abend naht anstimmt, überlauft mich ein wohliger Schauer.
Während wir singen, sickert kaum merklich die Nacht ein. Der Osten hüllt sich schon in Dunkelheit, im Westen glimmt noch ein letzter Widerschein des Abendrots. Jemand legt Holz nach, wir rücken näher an die Flammen. Inge und Gerd improvisieren im Duett, als führten sie ein inniges Gespräch. Peter reicht mir noch einen Becher Wein, stochert im Feuer. Ein sprühender Funkenregen stiebt auf in die Schwärze der Nacht. Vielleicht ist unser Leben wie ein Funkenflug, denke ich. Wir werden, glühen, vergehen.
Der neue Chef hat angerufen. Die Gestapo hat Peter auf der Arbeit verhaftet. Ratzfatz. Ohne Begründung. Und die Sonne lacht noch immer vom Himmel und schert sich um gar nichts.
Wieder renne ich zum Braunen Haus, werde abgewiesen. Doch so einfach will ich mich nicht fortschicken lassen, muss dafür einige zotige Bemerkungen einstecken. Was diesen Leuten an Manieren fehlt, machen sie mit schmutzigen Fantasien wett. Letztendlich zahlt sich meine Hartnäckigkeit aus. Ich weiß jetzt zumindest, dass Peter wieder dort ist, allerdings nicht, was man ihm vorwirft. Vielleicht hat er gestern Abend in Willems Eck eine Runde geschmissen und zur Vereinigung der Proletarier aller Länder aufgerufen. Es wäre nicht das erste Mal gewesen. Vielleicht hat ihn jemand angeschwärzt. Vielleicht liegt auch gar nichts gegen ihn vor, und sie sperren ihn nur weg, um ihn zu brechen.
Mucki habe ich gesagt, ihr Vater sei auf Montage. So weit ist es gekommen, dass ich mein Kind anlüge! Aber sie hat während der letzten Verhaftung so gelitten, ich will sie nicht schon wieder ins Unglück stürzen. Manche kommen schnell wieder frei, schon nach einer oder zwei Nächten. Vielleicht hat Peter Glück. Falls nicht, bleibt immer noch Zeit genug für die Wahrheit.
Bei den Genossen ist die Nachricht von seiner erneuten Verhaftung bereits rundgegangen, wie ich von Manfred weiß. Er wolle sich vergewissern, dass sie mich nicht ebenfalls mitgeschleppt hätten, erzählt er mir und setzt sich unaufgefordert. Ich frage mich, ob er mir nicht noch etwas anderes zu sagen hat.
»Ist etwas vorgefallen gestern Abend?« Angeblich weiß er von nichts. »Ihr habt euch nicht irgendwo mit der SA angelegt?«
»Nein.« Wieder schüttelt er den Kopf. »Vielleicht hat ihn jemand angeschwärzt wegen der Roten Fahne.«
»Aber er hat die Parteizeitung nicht ausgetragen«, wende ich ein. »Das habe ich getan.«
»Dann weiß ich’s auch nicht, Gertrud.« Er kramt seine Zigaretten hervor, zündet sich eine an, raucht eine Weile schweigend. Dann beugt er sich vor und fasst meine Hand. »Peter wird wiederkommen, Gertrud.«
»Natürlich kommt er wieder!«, schnappe ich und ziehe die Hand weg. Er reagiert nicht darauf. Ich stehe auf, stelle einen Aschenbecher vor ihn hin, setze mich wieder.
»Den Heini Stoll haben sie auch eingelocht«, sagt er jetzt. »Und Gunni. Gunther Altrogge.«
»Bist du gekommen, um mir das zu erzählen?«
»Nein, Gertrud. Hör mal …« Wieder ist da seine Hand, dieses Mal auf meinem Arm. Ich schlage nach ihr, wie man eine lästige Fliege verscheucht.
»Was willst du, Manfred?«
»Ich habe dir was mitgebracht.« Er klemmt die Zigarette in seinen Mundwinkel, beugt sich hinunter und zieht etwas aus seiner speckigen Ledertasche. Legt einen dicken Schmöker auf die Tischplatte, schiebt ihn mir hin. »Für dich. Du wanderst doch so gern.«
Kein schöner Land. Die lieblichsten Landschaften des Deutschen Reiches, lese ich und bin sprachlos.
»Das ist nicht dein Ernst, oder?«
Manfred grinst mich an. »Nun schau erst mal rein.« Unwillig schlage ich das Buch auf, irgendwo mittendrin. Bin nun doch bass erstaunt. In die Innenseiten ist ein sauberes Rechteck geschnitten, etwa von der Größe einer Kladde. Das Buch ist kein Buch, sondern eine Art Tresor.
»Für deine Liebesgedichte. Damit die Braunen nicht auf die Idee kommen, deine schmutzigen Gedanken zu lesen.« Manfreds Grinsen wird noch breiter. Ich spüre, wie mir vor Scham das Blut in den Kopf schießt, und weiß nicht, was ich sagen soll.
»Tut mir leid, Manfred. Meine Nerven liegen blank.«
Er winkt ab, drückt seine Zigarette in den Aschenbecher.
»Ich lass dich jetzt mal wieder allein. Die Familie wartet.« Geräuschvoll schiebt er seinen Stuhl zurück, steht auf, geht mit schweren Schritten zur Tür, bleibt noch einmal stehen. »Morgen bring ich dir einen Eimer Pflaumen vorbei«, kündigt er an. »Die pflücken wir pfundweise bei der Poller Schwägerin, aber ich krieg nur die Scheißerei davon.«
»Wie lieb von dir!«
»Das will ich meinen!«
Wir lachen beide.
»Danke, Manfred. Für das Buch und dafür, dass du gekommen bist.«
Er tippt sich an seine Schiebermütze und schlüpft zur Tür hinaus.
MUCKI
Diese Ferien waren keine richtigen Ferien, dafür ist zu viel Schlimmes passiert. Nur gut, dass vor ein paar Tagen die Schule wieder begonnen hat. Mucki freut sich darauf, gleich ihre Freundin Judith zu treffen, die wie jeden Morgen an der Ecke Görresstraße/Rathenauplatz auf sie wartet. Gewöhnlich winkt ihr Judith schon von Weitem zu, doch heute steckt sie zur Begrüßung die Finger in den Mund und stößt einen schrillen Pfiff aus.
»Donnerwetter!«, lobt Mucki, als sie bei der Freundin angelangt ist. »Wie kriegst’n das hin?«
»Damit.« Judith sperrt den Mund auf und deutet auf eine Zahnlücke neben ihren Schneidezähnen.
»Wächst da was nach?«, fragt Mucki zweifelnd.
»Klaro! Oder denkst du, dass ich ’ne zahnlose Oma bin?« Sie kichern albern.
»Klappt aber auch ohne Lücke«, erklärt Judith fachmännisch. »Mein Bruder kann’s auch so. Man muss nur üben.«
»Bringst du’s mir bei?«
»Na sicher!« Die beiden Mädchen haken einander unter und maschieren einträchtig die Straße entlang. Sie sind bereits in die Lochnerstraße eingebogen und nur noch wenige Meter vom Schulgelände entfernt, als sich ihnen drei Klassenkameradinnen in den Weg stellen. Die größte von ihnen, Heidrun, deutet mit ausgestrecktem Finger auf Mucki.
»Guckt euch die an! Den Vadder von der ham se einjelocht, dat is ’ne Verbrecher!«
»Verbrecher, Verbrecher!«, skandieren die beiden anderen im Chor. »So wat liecht inne Familie«, verkündet Heidrun selbstgefällig. »Jetzt müsse mer uffpasse, dat die Jertrud uns nid beklaut!«
Mucki erstarrt, doch ihr Herz rast. »Mein Vater ist kein Verbrecher!«, schreit sie.
»Und ob!«, beharrt Heidrun mit hämischem Grinsen. »Jestern morjen ham s’en mitjenommen. Direkt vonne Arbeit. Mein Vadder war dabei.«
Mucki will sich auf sie stürzen, doch Judith hält sie fest. »Die lügen doch«, flüstert sie ihr zu. »Die wollen dich nur auszanken. Komm, wir beachten sie gar nicht!« Sie zerrt die Freundin mit sich, vorbei an den feixenden Mädchen, hinein in den quirligen Strom der Kinder, die in das Schulgebäude drängen.
Rechnen bei Herrn Rübsam. Dann Heimatkunde. Mucki kann sich nicht konzentrieren. Stimmt es etwa, was Heidrun behauptet hat? Der Vater war nicht zu Hause gestern Abend. Auf Montage, hat die Mutter gesagt. Normalerweise verabschiedet er sich vorher von Mucki. Aber dieses Mal hat er es nicht getan. Der Auftrag sei ganz kurzfristig gekommen, so die Mutter, und sie lügt nie. Oder doch?
Gong – große Pause. Mit Gejohle und Gepolter stürmt alles aus dem Klassenzimmer.
»Verbrecher!« Die Stimme ist ganz nah an Muckis Ohr. »Verbrecher!«, wiederholt sie. Es klingt nicht einmal wie eine Beschimpfung, eher schadenfreudig. Mucki erkennt die Stimme sofort. Sie wirbelt herum, drischt mit geballten Fäusten auf Heidrun ein, rechts, links, rechts, wie Karl ihr das einmal gezeigt hat. Karl der Boxer, ein Freund ihres Vaters. Doch Heidrun ist groß und kräftig und kann einige Schläge abwehren. Sie bekommt Muckis mühsam glatt gekämmtes Haar zu fassen, reißt daran. Es tut höllisch weh. Mucki kann sich freikämpfen und versetzt ihrer Widersacherin einen Tritt vors Schienbein, dann gleich noch einen. Heidruns Schmerzensschreie hallen durch den langen Flur.
»Schluss damit! Auf der Stelle!« Auf einmal ist Fräulein Sechtem da, die neue Lehrerin, und zerrt die beiden Streithälse auseinander. »Was fällt euch ein?«
Augenblicklich bricht Heidrun in Tränen aus. »Die Jertrud war’s! Die hat mich verdroschen ohne Jrund.«
»Ich hab nix gemacht!«, brüllt Mucki zurück. »Die hat angefangen!«
»Hab ich nicht!«
»Haste doch!«
»Nee!«
»Wohl!«
Jetzt sind auch Else und Resi zur Stelle, Heidruns Kumpaninnen.
»Die Jertrud hat anjefangen. Wir ha’ms jenau jesehn!«
»Die lügen auch!«, schreit Mucki mit Blick auf die Lehrerin, deren Gesichtsausdruck sich zusehends verfinstert.
»Was fällt dir ein, Gertrud? Erwachsene brüllt man nicht an! Du gehst sofort zurück ins Klassenzimmer!«
Die schadenfreudigen Blicke der Mädchen im Nacken, wird Mucki von Fräulein Sechtem in den Klassenraum eskortiert. In die Ecke. Gesicht zur Wand. Und wehe, sie rührt sich vom Fleck.
Die Lehrerin geht, Mucki bleibt allein zurück. Starrt auf den schmutzig weißen Putz, schließt die Augen, öffnet sie wieder. Riecht die unverwechselbare Mischung von Kalkfarbe und Kreidestaub, Tinte und ungewaschenen Hälsen. Hört das Lachen und Kreischen der Jungs auf dem zweiten Schulhof und, deutlich leiser, das ewige Summen und Rauschen der Stadt. Plötzlich fühlt sie sich eingesperrt, abgetrennt von allem. So muss es dem Vater ergangen sein. Oder gerade ergehen. Und vielleicht noch weit schlimmer. Nur nicht daran denken!
Sie könnte heimlich aus dem Fenster schauen, überlegt sie, sich zumindest hinsetzen, bis die Pause vorbei ist. Könnte den Apfel essen, den sie in der Rocktasche hat. Am Waschbecken einen Schluck Wasser trinken. All das könnte sie tun, und Fräulein Sechtems Drohungen zum Trotz würde es niemand merken. Aber falls ihr Papa wieder im Gefängnis ist, kann er all das nicht – nicht aus dem Fenster schauen, wenn ihm danach ist, keinen Apfel essen, wenn er darauf Appetit hat, kein Wasser trinken, wenn man ihm keines gibt. Im Gefängnis darf man gar nichts tun, hat sie gehört. Deshalb bleibt auch Mucki stehen, stocksteif, und selbst das Zwinkern verkneift sie sich.
Wenn sie es schafft, ganz still auszuharren, nicht mit dem Kopf zu wackeln, nicht auf den Zehen zu wippen, nicht einmal von einem Fuß auf den anderen zu treten … Wenn sie es schafft, sich nicht den juckenden Mückenstich zu kratzen, nicht die Nase krauszuziehen, nicht die Haarsträhne wegzustreifen, die ihr ins Gesicht hängt. Wenn sie all das schafft, wenn sie durchhält bis zum Ende der folgenden Schulstunde, dann, ja dann … dann kommt ihr Papa nach Hause.