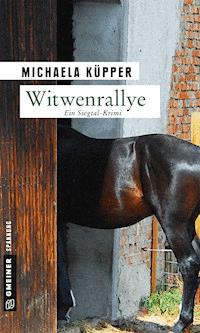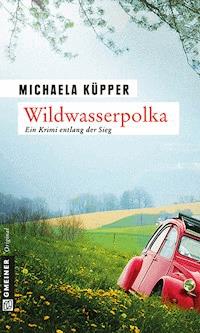9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein spannender und atmosphärischer Roman über die Spuren, die Chaos und Leid bei den vom Krieg Traumatisierten hinterlassen haben, von der Autorin Michaela Küpper. Ein Roman, der auf beklemmende Weise die Nachkriegsjahre heraufbeschwört, Für die Leser von Brigitte Glaser und Mechtild Borrmann. Frühsommer 1954: Eine vorlaute Bemerkung über die braune Vergangenheit seines Chefs bereitet Kommissar Peter Hoffmanns Traum von einer Karriere bei der Düsseldorfer Kripo ein Ende. Er wird in die rheinische Provinz versetzt, die er so schnell wie möglich wieder verlassen will. Da geschieht in dem Provinznest Kaltenbruch ein Mord, der die Gemüter der Menschen bewegt. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Lisbeth Pfau macht sich Hoffmann auf die Suche nach dem Täter – und stellt fest, dass die Wunden, die der Krieg geschlagen hat, noch lange nicht verheilt sind, sondern auch in der jüngeren Generation nachwirken. Hoffmann und Pfau stoßen bei ihren Ermittlungen auf erschütternde Entdeckungen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michaela Küpper
Kaltenbruch
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein spannender und atmosphärischer Roman über die Spuren, die Chaos und Leid bei den vom Krieg Traumatisierten hinterlassen haben, Frühsommer 1954: Eine vorlaute Bemerkung über die braune Vergangenheit seines Chefs bereitet Kommissar Peter Hoffmanns Traum von einer Karriere bei der Düsseldorfer Kripo ein Ende. Er wird in die rheinische Provinz versetzt, die er so schnell wie möglich wieder verlassen will.
Da geschieht in dem Provinznest Kaltenbruch ein Mord, der die Gemüter der Menschen bewegt. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Lisbeth Pfau macht sich Hoffmann auf die Suche nach dem Täter – und stellt fest, dass die Wunden, die der Krieg geschlagen hat, noch lange nicht verheilt sind, sondern auch in der jüngeren Generation nachwirken. Hoffmann und Pfau stoßen bei ihren Ermittlungen auf erschütternde Entdeckungen …
Inhaltsübersicht
Marlene
1. Kapitel
2. Kapitel
Lisbeth
3. Kapitel
Hoffmann
4. Kapitel
Wolfgang
5. Kapitel
Marlene
6. Kapitel
Gruber
7. Kapitel
Berta
8. Kapitel
Hoffmann
9. Kapitel
10. Kapitel
Marlene
11. Kapitel
Hoffmann
12. Kapitel
13. Kapitel
Marlene
14. Kapitel
Hoffmann
15. Kapitel
16. Kapitel
Lisbeth
17. Kapitel
Hoffmann
18. Kapitel
19. Kapitel
Marlene
20. Kapitel
Hoffmann
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Lisbeth
24. Kapitel
25. Kapitel
Gruber
26. Kapitel
Wolfgang
27. Kapitel
Hoffmann
28. Kapitel
29. Kapitel
Marlene
30. Kapitel
31. Kapitel
Hoffmann
32. Kapitel
Wolfgang
33. Kapitel
Gruber
34. Kapitel
Hoffmann
35. Kapitel
Wolfgang
36. Kapitel
Lisbeth
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Marlene
40. Kapitel
Wolfgang
41. Kapitel
Hoffmann
42. Kapitel
43. Kapitel
Lisbeth
44. Kapitel
45. Kapitel
Berta
46. Kapitel
Wolfgang
47. Kapitel
Marlene
48. Kapitel
Lisbeth
49. Kapitel
Dana
50. Kapitel
Gertrude
51. Kapitel
Marlene
52. Kapitel
Dana
53. Kapitel
Marlene
54. Kapitel
Dana
55. Kapitel
Marlene
56. Kapitel
Gertrude
57. Kapitel
Lisbeth
58. Kapitel
Hoffmann
59. Kapitel
Dana
60. Kapitel
Hoffmann
61. Kapitel
Lisbeth
62. Kapitel
Hoffmann
63. Kapitel
Lisbeth
64. Kapitel
Gertrude
65. Kapitel
Marlene
66. Kapitel
Danksagung
Marlene
1.
Erdbeerzeit. Marlene und Dana saßen unter der Kastanie vor dem Haus, an dem alten Küchentisch aus Vorkriegszeiten, den sie aus der Scheune geschleppt hatten. Ein plötzlich aufkommender Wind rauschte durch das dichte Blätterdach über ihnen, und zu ihren Füßen wirbelte Staub auf. Stundenlang hatten sie auf dem Feld hinter dem Silo Erdbeeren gepflückt, Reihe um Reihe, die stechende Sonne im Nacken, jetzt brannte die Haut auf ihren Schultern und Armen – die kühle Brise tat gut.
Sie putzten die überreifen Früchte, die sie nicht würden verkaufen können, entfernten das Grün und die schadhaften Stellen, zerteilten die Beeren grob und warfen sie in den großen Topf in der Mitte des Tisches. Alles war rot und klebte, der Tisch, die Finger, die Gesichter der Zwillinge Konrad und Ilse, die um sie herumsprangen, von einem Ohr zum anderen mit Erdbeersaft beschmiert.
Eben war Renate zum Helfen herübergekommen, und auch die Metzgerstochter Brigitte putzte mit, weil sie sich nie die Gelegenheit für einen kleinen Schwatz entgehen ließ.
Eine neuerliche Böe fegte über den Hof. Marlene wandte den Kopf und schaute zu der Wäsche hinüber, die auf der Kälberweide zwischen den Apfelbäumen im Wind flatterte; das Weiß der Laken und Handtücher bildete einen scharfen Kontrast zu der blauschwarzen Wolkenfront, die unweigerlich heranzog. Von ferne grollte der Donner. Es würde Regen geben. Nun doch.
»Ich gehe mal, ehe alles nass wird.« Dana war bereits aufgestanden und wischte sich mit einem nassen Tuch die Hände sauber. Brigitte plapperte unverdrossen weiter, während sie das Grün häufchenweise zusammenkehrte und in den Zinkeimer unter dem Tisch warf.
»Dat Kleid kannsse doch nicht auffe Hochzeit von deine einzige Schwester anziehen, hab ich gesacht. Da musse dir schon wat Besseres zulegen.«
Marlene begutachtete die Erdbeerflecken auf ihrem Rock, die sie wohl nicht mehr herausbekommen würde, stufte den Schaden aber als nicht weiter tragisch ein: Der alte Fetzen taugte ohnehin nur noch für die Arbeit. Heini, der eben von der Feldarbeit heimgekommen war, gesellte sich zu ihnen und zog sich Danas Stuhl heran.
»Heute wieder Krauskopfwetter?« Wie üblich zog er seine Schwester Renate wegen ihrer Locken auf, worauf diese über den Tisch langte und ihm mit gespieltem Zorn durchs Haar raufte.
»Pah, glatt wie Schnittlauch, pfui Deibel!«
Konrad und Ilse kamen angerannt, um ihrem älteren Bruder einen mumifizierten Frosch zu zeigen, den sie gefunden hatten, stoben jedoch sofort wieder davon und stellten den jungen Katzen nach, die mit hohem Buckel und in gestelzten Hüpfern den umherwirbelnden Blättern hinterherjagten, die der Wind den Bäumen entrissen hatte. Konrad bekam die Graugescheckte zu fassen, hob sie hoch und presste sie an seine Brust. Es folgte ein gellender Schmerzensschrei: Sie hatte ihre Krallen in seinen Hals geschlagen. Marlene war bereits dabei, aufzustehen, um ihm zu helfen, aber das Tier hatte schon wieder von ihm abgelassen. Ihre Augen noch halb auf das Kind gerichtet, setzte sie sich wieder, und als sie vor sich auf die Tischplatte blickte, lag dort eine einzelne tiefrote Beere, die in Form eines perfekten Herzens geschnitten war. Irritiert sah sie auf. Renate schaute gerade nach ihrer Tochter Gudrun, die neben dem Tisch auf dem Boden herumkrabbelte. Mit einem hohen Kreischlaut warf sie ihr Knippchen hin, als sie erkannte, dass Gudrun auf dem getrockneten Frosch herumkaute. Brigitte schüttelte sich schaudernd und brach in Gelächter aus. Nur Heini erwiderte Marlenes Blick. Er kniff die Augen zusammen und sog die Wangen ein, während er gelassen sein Taschenmesser wegsteckte. Einen Atemzug lang musterte sie ihn ausdruckslos, dann lächelte sie: ein kleines, komplizenhaftes Lächeln, das anhielt, bis sie nach dem Erdbeerherz griff und es mit einem Happs verspeiste.
»Schluss für heute«, befand Renate und nahm ihre lauthals protestierende Tochter auf den Arm. »Besser, ich bin mit Gudrun daheim, bevor es losgeht.«
»Ich komme mit euch.« Brigitte wischte sich die Finger an einem Küchentuch ab, stand auf und strich ihren Rock glatt. Auch Marlene war aufgestanden. Heini schob seinen Stuhl zurück und nahm den schweren Einkochtopf, um ihn für sie in die Küche zu tragen. Als er an ihr vorbeiging, strich sie sanft über seinen Unterarm und schüttelte kaum merklich den Kopf. Fragend hob er die Augenbrauen, doch sie reagierte nicht mehr.
Das Licht unter der Kastanie veränderte sich, ein seltsames Leuchten umspielte die Szenerie. Auch die Geräusche veränderten sich. Als hätte ihnen jemand eine große grüne Glasglocke übergestülpt, dachte Marlene, und ihr Blick schweifte wehmütig über die Kälberweide, hin zu den kniehoch wogenden Weizenfeldern, die sich gen Kaltenbruch zogen.
»So fasziniert von der Aussicht?« Plötzlich stand Dana neben ihr, den Wäschekorb auf der Hüfte abgestützt, und starrte sie an.
»Jesus! Ich hab dich gar nicht kommen hören.«
»Soll ich demnächst hupen?« Dana verzog den Mund. »Hättest mir ruhig helfen können mit der Wäsche. Erdbeeren in einen Topf werfen kann sogar Ilse.«
»Nun sei nicht beleidigt und gib her.« Marlene nahm ihr den Wäschekorb ab, worauf Dana achselzuckend die Messer einsammelte. Schweigend gingen sie nebeneinander ins Haus zurück.
Zwei Stunden später waren die Zwillinge abgefüttert und zu Bett gebracht, die Hühner weggesperrt. Marlene stand am Küchenfenster, die Rhabarberstangen in Händen, die sie noch verarbeiten musste, und beäugte kritisch das Stückchen Himmel, das sie von ihrem Blickwinkel aus sehen konnte: Zwischen braunrotem Kuhstalldach und braunrotem Scheunendach trieben eilig schiefergraue Wolkenfetzen dahin. Noch immer war kein Tropfen gefallen, aber lange konnte es nicht mehr dauern. Die Felder brauchten den Regen, dachte sie und seufzte tief, um fast im selben Moment erschrocken herumzuwirbeln: Heini hatte sich lautlos herangeschlichen und sie in die Seite gekniffen.
»Was fällt dir ein!« Sie schlug mit einer Rhabarberstange nach ihm, doch statt sich wegzuducken, schnappte er danach wie ein Hund nach einem Wurstzipfel und biss blitzschnell zu.
»Köstlich!«, log er kauend und zog eine Grimasse. Marlene hob drohend den Rest ihrer Rhabarberstange. Seine Hand schnellte vor, um sie ihr zu entreißen, aber sie hielt eisern daran fest, und es begann ein Tauziehen, das bald zur wilden Rangelei geriet. Als Dana die Küche betrat, hatte Heini Marlene in den Schwitzkasten genommen.
»Sie will den schönen Rhabarber für sich allein haben«, schnaufte er. »Komm, wir sperren sie in den Keller.«
»Ilse hat Durst«, war alles, was Dana erwiderte.
»Ich geh schon«, keuchte Marlene.
»Amüsiert euch nur weiter.« Den Blick stur nach vorn gerichtet, schob Dana sich an ihnen vorbei, holte ein Wasserglas und füllte es über der Spüle.
»Spaßbremse«, murmelte Heini, als sie gegangen war. Er griff erneut nach Marlene, die sich losgekämpft hatte.
»Es reicht, Heini!« Sie schlug nach seinen Fingern, aber ihr Widerstand befeuerte ihn umso mehr. Dann war auf einmal Martin da.
Mit eingezogenem Kopf trat er durch die Tür, die von der Küche auf den Hinterhof hinausführte, wie immer der Letzte, der Feierabend machte.
»Hier geht’s ja lustig zu«, brummte er, während er sich die Schuhe an der Matte abstreifte. Eilig wand Marlene sich los und drehte den Brüdern den Rücken zu. Ihr Herz pochte, ihre Wangen glühten.
»Wir kämpfen um die letzten Rhabarberstangen. Die sind ja so köstlich, was Besseres gibt’s gar nicht auf der Welt«, spottete Heini und warf seine Beute lässig in den Spülstein. Martin sagte nichts.
»Möchtest du Bratkartoffeln?« Marlene schaute ihn nun doch an. »Wir haben Stullen gegessen, aber ich hab noch Kartoffeln übrig.«
»Bratkartoffeln«, wiederholte er und kratzte sich am Kopf. »Ja, das wäre nett.« Er schenkte sich ein Glas Milch aus dem Krug ein, der auf dem Tisch stand, und setzte sich. Heini hockte sich neben ihn auf die Eckbank, langte nach einer Scheibe Brot und tunkte sie in die Schale mit dem Rest heißer Erdbeermarmelade.
»Auch eins?« Er deutete auf seine Stulle, doch Martin meinte, er würde auf die Kartoffeln warten.
Wieder einmal bemerkte Marlene, wie ähnlich die beiden Brüder einander sahen: dieselbe Statur, dasselbe hellbraune Haar, die graublauen Augen.
»Ihm machst du Bratkartoffeln, und ich krieg nur Marmeladenstullen«, beschwerte sich Heini, als sein älterer Bruder gegangen war, um sich die Hände zu waschen.
»Martin hat ja auch gearbeitet«, entgegnete Marlene provokant, die Betonung lag auf dem Satzende. »Außerdem hast du vorhin den Rest vom Braten gegessen, ohne ihm etwas übrig zu lassen.«
»Du magst ihn lieber als mich, oder?«
Auf diese Frage war sie nicht gefasst. »Wie kommst du darauf?«
»Komm ich halt.«
»Blödsinn, Heini. Es war nur Spaß.«
»Aber –«
Sie legte den Finger an die Lippen. »Still, er hört dich!«
Martin kehrte zurück und setzte sich auf seinen Stuhl, während sie sich wieder an die Arbeit machte. Sie pellte die Kartoffeln und schnitt sie in Scheiben, häutete eine Zwiebel, würfelte ein großes Stück Speck, gab Schmalz in die Pfanne, ließ den Speck aus und briet die Kartoffeln und Zwiebeln darin an. Die jungen Männer redeten währenddessen über eine Kuh, die weniger Milch gab als sonst, und eine, die bald kalben würde.
»Heiner, Martin!« Der alte Leitner rief nicht nach seinen Söhnen, er brüllte. Wie üblich. »Könnte sich wohl einer von euch herbequemen, oder soll ich das Trumm allein die Treppe raufschleppen?«
»Was will der denn?«, fragte Heini in abschätzigem Ton. »Ich dachte, der hätt sich’s schon oben gemütlich gemacht.« Er deutete mit dem Kinn in Richtung Zimmerdecke.
»Die Truhe soll nach oben«, erklärte Marlene. »Er schafft das nicht allein.« Martin war im Begriff aufzustehen, aber sein jüngerer Bruder hielt ihn zurück.
»Lass mal, ich mach das schon.«
Heini verließ die Küche, und Marlene dreht sich um. »Das Essen ist gleich fertig«, verkündete sie, die Hände haltsuchend auf die Spüle gestützt. Martin schwieg, doch sein Blick ruhte auf ihr. »Es regnet noch immer nicht«, fügte sie leise hinzu.
»Nein, es regnet nicht«, wiederholte er langsam. Im selben Moment gellte das Geschrei der kleinen Ilse durchs Haus, die nicht an Schlaf zu denken schien.
»Marli, Marli! Meine Marli soll tommen!«
2.
Ein Abend im Juni. Gab es Schöneres auf Erden? Die Luft war lau, das Gras wogte hüfthoch im goldenen Licht der untergehenden Sonne, die Vögel sangen ihr Abendlied – und das Unwahrscheinliche war eingetreten: Die Wetterfront hatte sich verzogen, ohne dass das geringste bisschen Regen gefallen war.
Sie lief am Erdbeerfeld vorbei, bog in einen klatschmohngesäumten Weg ein, dann am Waldrand entlang, durch die kühle, feuchte Senke, in der es schon fast Nacht war und sie der herbe Duft des allseits wuchernden Storchenschnabels umfing, wieder aufwärts, durch den jungen Birkenhain, zurück ins Licht. Ihre Schritte wurden schneller, fast war ihr nach Hüpfen zumute, so leicht fühlte sie sich, so voll brennender Erwartung. Nie hätte sie gedacht, dass das Leben solche Überraschungen bereithielte, dass sie vor Gefühl überschäumen könnte wie ein Waschbottich.
Als sie den Weiher erreichte, stand die Sonne als glühender Ball über der Fichtenschonung am jenseitigen Ufer. Einen bangen Moment lang fürchtete sie, er wäre nicht gekommen, und die Enttäuschung fuhr ihr in alle Glieder. Sie legte die Hände schützend über die Augen, schaute in das blendende Licht, erkannte vage den Steg, die kompakte Baumgruppe daneben – und die einsame Gestalt, die sich daraus löste. Ihr Herz tat einen Sprung. Er war da! Oh, sie liebte, liebte, liebte ihn, und endlich durfte sie es zeigen! Blindlings rannte sie los, den ausgebreiteten Armen entgegen.
Lisbeth
3.
Dieser Tag war nicht ihr Tag, das machte er Lisbeth gleich nach dem Aufstehen deutlich. Erst kam sie mit der Wimperntusche nicht zurecht, die sie sich extra angeschafft hatte: das rechte Auge schwarz wie das eines Kohlenbengels, das linke nackt wie ein frisch geworfenes, spinnenbeiniges Karnickel – so konnte sie nicht vor die Tür. Dann kochte ihr die Milch über, weil die Schminkerei ungebührlich viel Zeit in Anspruch genommen hatte. Ihr Kaffee – vermutlich der letzte, den sie sich würde leisten können – musste ohne auskommen, was ihr wiederum der Magen krummnahm. Dazu dieser Regen. Jedes vorbeifahrende Auto ließ das Wasser in Fontänen auf den Gehsteig spritzen. Die neuen Stöckelschuhe wären ruiniert, ehe sie auch nur einen Fuß ins Polizeipräsidium gesetzt hätte.
Sie gab ihren Fensterplatz auf, stellte ihre Tasse in die Spüle und warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel: In der feinen Bluse und dem biederen Jäckchen erkannte sie sich kaum wieder. Mit einem Seufzer griff sie nach Schirm und Handtasche, zog die Tür hinter sich zu und schlich auf Zehenspitzen die Treppe hinunter, an der Wohnungstür der Breuninger vorbei. Ein zweckloses Unterfangen – einer wie der entging man nicht.
»Ah, das Frolleinchen! Schon so früh unterwegs?«
»Guten Morgen, Frau Breuninger. Ich hab’s ein bisschen eilig.«
»So? Mit der Miete haben wir’s dann hoffentlich auch bald ein bisschen eilig.« Die Breuninger zeigte ihr Wolfsgrinsen.
»Ja, Frau Breuninger. Ich denke dran, ganz bestimmt. Aber jetzt muss ich gehen, ich habe einen Termin wegen einer Anstellung.«
»Donnerwetter, so früh am Morgen schon einen Anstellungstermin!«
»Frau Breuninger, es ist gleich acht Uhr.«
»Ich mein ja nur, wo das Frollein doch immer so spät heimkommt.« Für die Breuninger herrschte gleich nach der Abendandacht tiefste Nacht.
Nein, heute würde Lisbeth sich nicht provozieren lassen. »Einen schönen Tag, Frau Breuninger.« Sie drückte sich an ihrer Vermieterin vorbei und spürte deren missliebige Blicke noch im Rücken, als sie zwei Straßen weiter in die Tram stieg.
Der Regen hörte in dem Moment auf, in dem sie das Polizeipräsidium betrat. Das Erste, was sie registrierte, war ein penetranter Geruch nach Bohnerwachs. Angebrannte Milch zu Hause, nasser Hund in der Tram und jetzt das – sie versuchte, den olfaktorischen Großangriff zu ignorieren. Nur nicht ablenken lassen, Lisbeth. Es geht um so viel. Es geht um alles.
Sie zeigte einem dicken Beamten am Empfang ihr Einladungsschreiben vor, woraufhin ein deutlich magerer Kollege sie zu Kommissar Peter Hoffmanns Büro im ersten Stock begleitete. Auf ihr zaghaftes Klopfen hin forderte eine Stimme von drinnen sie auf, einzutreten.
Hoffmann saß hinter einem wuchtigen Schreibtisch, der auf Lisbeth wie ein Bollwerk wirkte, und musterte sie ausdruckslos.
»Herr Hoffmann? Mein Name ist Lisbeth Pfau, Sie haben mich eingeladen.« Sie hielt ihm schüchtern das Schreiben entgegen, das sie noch immer in der Hand hatte.
»Ja, richtig.« Er stand auf und trat auf sie zu. »Schön, dass Sie hergefunden haben.« Lisbeth ergriff seine ausgestreckte Hand und deutete einen Knicks an. Herrje, tat man so etwas heutzutage noch?
Sein Äußeres passte zu den bohnerwachspolierten Fluren: das gestärkte Hemd, die von Brillantine glänzende Tolle, die blitzenden Zähne, so exakt in Reih und Glied, dass jeder vor Neid erblassen musste. Bei einem Mann in seiner Position hätte sie allerdings vorausgesetzt, er würde auch eine gewisse Reife ausstrahlen, die ihm in ihren Augen jedoch völlig abging: Hoffmann sah aus wie ein Pennäler.
Er rückte ihr einen Stuhl zurecht, wartete, bis sie Platz genommen hatte, setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch und taxierte sie prüfend.
»Fräulein Pfau«, begann er, »wie Sie wissen, suchen wir eine Sekretärin, eine Mitarbeiterin, auf die ich mich – auf die wir uns – hundertprozentig verlassen können. Eine fleißige Biene, die uns entlastet.«
Sie nickte eifrig und ärgerte sich darüber, dass er ihre neuen Schuhe gar nicht sehen konnte. Aufgepasst wie ein Luchs hatte sie, und gesprungen war sie wie ein Hase, um dem Spritzwasser zu entgehen.
»›Fräulein‹ ist doch richtig?«
»Wie bitte? Oh, ja.« Sie nickte wieder. Nicken, nur immer schön nicken.
Hoffmann lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Einen ulkigen Namen haben Sie«, befand er mit der Andeutung eines Lächelns. »Aber den sind Sie ja sicher bald los.«
»Wie bitte?«
»Tja, es wird doch wohl einen netten jungen Mann geben, der Sie in den Hafen der Ehe –«
In ihren Ohren klang es, als traue er ihr etwas Anrüchiges zu. »Nein, nein«, widersprach sie schnell. »Ich stehe Ihnen voll und ganz zur Verfügung. Ich meine, ich könnte Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen, wenn Sie mich haben würden, also nehmen wollten …« Ihr wurde klar, welchen Unsinn sie redete, und sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss.
»Fräulein Pfau, ganz so sehr möchte ich Sie nicht strapazieren.« Er machte sich lustig über sie, eindeutig. Mein Gott, sie benahm sich wie ein dummer Backfisch.
»Tut mir leid, ich habe mich ungeschickt ausgedrückt«, nahm sie erneut Anlauf. »Ich meinte nur, dass ich keine Absichten in diese Richtung hege.«
»Schön, schön.«
Nein, überhaupt nicht schön. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, die Scharte auswetzen und sich rechtfertigen zu müssen. »Ich hatte eigentlich nie ein Problem mit meinem Namen«, redete sie drauflos. »Für Männer mag er schwieriger sein.«
»Ach ja?« Hoffmanns Augenbrauen wanderten nach oben. »Wieso das?« Da er mit dem Rücken zum Fenster saß, bemerkte er den Fensterputzer nicht, der plötzlich angeschwebt kam wie der Weihnachtsengel im Kurtheater.
»Weil man bei einem Mann vom Namen auf den Charakter schließen könnte«, erklärte Lisbeth und bemühte sich, ihren Blick nur auf Hoffmann zu richten. »Bei einer Frau besteht die Gefahr nicht so sehr, die weiblichen Tiere sind ja recht unscheinbar.«
»Soso.« Hoffmann schien ihr nicht recht zuzuhören und griff nach ihren Unterlagen. »Sie haben ein Zertifikat in Aquarellmalerei erworben, und ein Abzeichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Silber haben Sie auch. Sehr schön, sehr lobenswert, nur legen wir hier Wert auf andere Fähigkeiten.« Er blätterte weiter, während der Fensterputzer von ihm gänzlich unbemerkt die Scheibe einseifte. »Ich sehe, Sie haben des Weiteren als Küchenhilfe gearbeitet und eine Hauswirtschaftsschule besucht, diese aber nach einem halben Jahr Unterricht abgebrochen. Weshalb?«
Der Blick des Fensterputzers drang plötzlich durch das Glas zu Lisbeth vor. Er grinste breit und zwinkerte ihr zu.
»Es … es war nicht das Rechte für mich.« Sie fuhr mit den Händen über ihren Rock, der ihr plötzlich zu kurz vorkam.
»Warum nicht?«
»Ich habe mir beim Nähen in die Finger gestochen.«
»Sind Sie immer so ungeschickt?«
»Nein«, log sie und schaute Hoffmann in die Augen. »Ich kann nur nicht nähen.«
»Tja, wissen Sie, ich brauche eine Person mit Geschick, eine, die absolut zuverlässig ist, die Akten anlegt und Anrufe entgegennimmt, die gut organisieren kann. Und fehlerfreies Tippen sollte selbstverständlich sein.«
»Selbstverständlich«, pflichtete sie ihm bei. »Alles kein Problem, solange ich keine Knöpfe annähen muss!« Sie lachte ein bisschen über ihren kleinen Scherz und fing den Blick des Fensterputzers auf. »Ich belege Abendkurse in Maschinenschreiben und in Stenografie«, setzte sie eilig hinzu. »Sie müssten die Bescheinigungen vor sich haben …«
»Ja, ja, habe ich gesehen, danke. Aber wie sieht es mit einem Abschluss aus?«
»Den mache ich demnächst. Ganz sicher. Ist quasi nur eine Formsache.« Er quittierte ihre Bemerkung mit einem leichten Stirnrunzeln.
»Nun, wichtig ist vor allem auch eine gewisse Robustheit.«
»Robustheit? Ich bin gesund, wenn Sie das meinen.«
»Ich wollte sagen, dass wir hier nicht beim Straßenverkehrsamt sind. Wir jagen Verbrecher, Gewalttäter, Mörder. Bei uns kommen manchmal Bilder auf den Tisch, die eine zarte weibliche Seele aus dem Gleichgewicht bringen können.«
»Oh, damit habe ich kein Problem«, verkündete Lisbeth im Brustton der Überzeugung. »Mein Onkel Rudolf war Schlachter, bei dem war ich oft zu Besuch. Ich kann Blut sehen.«
Hoffmann lächelte kühl. »Das spricht für Sie, Fräulein Pfau, aber der Ernst unseres Geschäfts erfordert doch auch eine gewisse Reife.«
Sie holte tief Luft. Reife? Ausgerechnet dieser Kerl sprach von Reife? Einer, der aussah, als würde Mutti ihm morgens mit ihrem spuckegetränkten Taschentuch die Wangen polieren? Reiß dich zusammen, Lisbeth! Mach ein freundliches Gesicht, damit sind die meisten Männer schon zufrieden.
»Sie kommen vom Dorf?«
Auch das noch. »Nun ja, das tun viele.« Sie legte ihren ganzen Charme in ihr Lächeln, oder hatte das zumindest vor, aber so recht wollte es ihr nicht mehr gelingen. Der Fensterputzer leckte sich schon die Lippen und machte zweideutige Gesten. Er dachte wohl, sie sei zum Verhör einbestellt und mit so einer könne er sich diese Frechheiten erlauben.
»Warum sind Sie in die Stadt gezogen?«, erkundigte der Kommissar sich jetzt, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf, gab diese Pose jedoch sofort wieder auf, da sie ihm unverhofft Schmerzen zu bereiten schien.
Lisbeth gab sich locker. »Wie heißt es so schön: Stadtluft macht frei, nicht wahr?«
»Stadtluft?« Hoffmann hielt irritiert inne, dann fiel offenbar der Groschen. »Ach ja, die auch.«
Herrje, sie war schon wieder ins Fettnäpfchen getreten! Dass dieser vermaledeite Hitler aber auch alles und jedes hatte verwursten müssen!
»Sie haben vier Monate in einem Kaufhaus gearbeitet, wie ich sehe. War das auch nichts für Sie, oder weshalb haben Sie dort so schnell wieder aufgehört?«
»Ähm. Tja.« Was sollte sie dazu sagen? Mit der Wahrheit herauszurücken schien ihr keine gute Idee. »Die Abteilung, in der ich gearbeitet habe, wurde aufgelöst – zu wenig profitabel.« Sie hoffte, er würde das nicht nachprüfen können. »Hat aber nicht an mir gelegen«, schob sie schnell hinterher.
»Das klingt beruhigend«, kommentierte Hoffmann trocken. »Sonstige Berufserfahrung haben Sie nicht?«
»Wie bitte? Ach so, leider nein.«
Er begann, leise mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte zu klopfen. Schließlich drehte er sich um und erblickte den Fensterputzer, der gewissenhaft seiner Arbeit nachging.
»Wie schön, dass wir uns wieder um Dinge wie saubere Fenster kümmern können, nicht wahr? Tja, Fräulein Strauß, ich bin mir sicher, dass Sie in einigen Jahren eine tüchtige Kraft abgeben werden. Momentan benötigen wir leider eine Person mit etwas mehr Erfahrung. Genießen Sie weiterhin die Stadtluft. Und arbeiten Sie an Ihren Qualifikationen, das ist meine Empfehlung.«
Als Lisbeth das Polizeipräsidium verließ, hatte der Regen wieder eingesetzt und sorgte dafür, dass ihr Äußeres ihrer Befindlichkeit entsprach: Sie fühlte sich wie ein begossener Pudel.
Hoffmann
4.
Hoffmann musterte zum wiederholten Mal die junge Frau, die so hastig redete, als peitschte sie jemand durch dieses Gespräch: ihre blasse, sommersprossige Haut, das kupfrige Haar. Fussig, sagte man im Rheinland dazu. Diese Rüschenbluse, und erst die altbackene Strickjacke: unmöglich! Wo kam nur diese Landpomeranze her? Allein ihr Name: Lisbeth Pfau. Sie habe eigentlich nie ein Problem damit gehabt, schwatzte sie gerade drauflos. Für Männer sei er schwieriger.
»Ach ja? Wieso das?«
»Weil man bei einem Mann vom Namen auf den Charakter schließen könnte«, erklärte sie mit eigentümlich stierem Blick. »Bei einer Frau besteht die Gefahr nicht so sehr, die weiblichen Tiere sind ja recht unscheinbar.«
»Soso.« Hoffmann fühlte sich unbehaglich. Es kam ihm vor, als hätte sie ihm gerade persönlich überzogene Eitelkeit unterstellt, dabei war doch nicht er derjenige, der diesen albernen Vogelnamen trug. Und warum starrte sie ihn so an? Er griff nach ihren Unterlagen.
Ein Zertifikat in Aquarellmalerei, ein Abzeichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Silber, na prima! Küchenhilfe, danach Besuch einer Hauswirtschaftsschule, nach einem halben Jahr abgebrochen. Das klang wenig überzeugend, und auch der weitere Gesprächsverlauf brachte wenig Erfreuliches.
»Sie haben vier Monate in einem Kaufhaus gearbeitet, wie ich sehe. War das auch nichts für Sie, oder weshalb haben Sie dort so schnell wieder aufgehört?«
»Ähm. Tja.« Wieder wirkte ihr Zögern, als müsse sie sich erst eine plausible Ausrede aus den Fingern saugen. »Die Abteilung, in der ich gearbeitet habe, wurde aufgelöst – zu wenig profitabel.« Und schnell schob sie hinterher: »Hat aber nicht an mir gelegen.«
Das klang ja beruhigend!
»Sonstige Berufserfahrung?«
Sie schien erst in ihrem Gedächtnis kramen zu müssen. Hoffmann begann, ungeduldig mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte zu klopfen. Dieses Fräulein Pfau wirkte reichlich unkonzentriert. Sie schien durch ihn hindurchzusehen, als sei da etwas in seinem Rücken, weshalb er sich umdrehte und einen Fensterputzer erblickte, der gewissenhaft seiner Arbeit nachging. »Wie schön, dass wir uns wieder um Dinge wie saubere Fenster kümmern können, nicht wahr?«
Plötzlich hatte er genug. Der Hansel dort draußen war offenbar interessanter für die Dame als das, was sich hier drinnen abspielte. »Tja, Fräulein Strauß. Ich bin mir sicher, dass Sie in einigen Jahren eine tüchtige Kraft abgeben werden«, machte er der Quälerei ein Ende. »Momentan benötigen wir leider eine Person mit etwas mehr Erfahrung. Genießen Sie weiterhin die Stadtluft. Und arbeiten Sie an Ihren Qualifikationen, das ist meine Empfehlung.«
Du meine Güte, dachte er, als er die Tür hinter ihr geschlossen hatte. Was war denn nur los? Es fiel ihm gewöhnlich leicht, sich eine kleine Freundin zu angeln, wenn ihm nach weiblicher Gesellschaft zumute war, aber niemals hätte er sich träumen lassen, dass es so anstrengend sein könnte, eine geeignete Mitarbeiterin zu finden. Und dabei hatte er schon Abstriche gemacht! Er hätte sogar die ältliche Witwe genommen, wenn sie ihm nicht angedroht hätte, jedem Täter mit Nachsicht und Milde gegenüberzutreten, da auch er von Gott geschaffen sei. Das Gegenübertreten würde er schon noch selbst übernehmen. Er brauchte doch nur eine, die das gottverdammte Telefon bediente, während er unterwegs war, die in der Lage wäre, bis zu seiner Rückkehr ein paar einfache Dinge festzuhalten.
Er warf einen schnellen Blick in die zweite Mappe, die er vorliegen hatte. Eine gewisse Pauline Kern, vierundzwanzig Jahre alt, Stenografie und Maschinenschreiben, drei Jahre Berufserfahrung bei einer Versicherungsgesellschaft: Vielleicht würde der Tag sich doch noch zufriedenstellend entwickeln.
Als Peter Hoffmann auf dem Weg zu einer frischen Tasse Kaffee die junge Dame erblickte, die bereits im Flur auf ihren Termin wartete, war er plötzlich sicher, dass sich dieser Tag ganz hervorragend entwickeln würde.
Wolfgang
5.
Nicht nur dumm, sondern auch noch faul. Frustriert hockte Wolfgang vor der Baracke und bohrte seine Schuhspitze in den Staub. Fast zwei Wochen war es jetzt her, dass Schürmann die Katze aus dem Sack gelassen hatte. Einen Tag vor den Pfingstferien, die nun bereits auf ihr Ende zugingen. Ständig musste Wolfgang daran denken, doch er hatte noch immer mit niemandem darüber gesprochen.
»Tasche auf, Kaminski!«
»Ich habe nichts getan«, wagte Wolfgang einzuwenden.
»Tasche auf, aber dalli!« Lehrer Schürmann duldete keine Widerrede.
Wolfgang blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Er öffnete seinen Tornister und hielt ihn Schürmann hin, der sich nur ein wenig hätte vorbeugen müssen, um einen Blick hineinwerfen zu können, doch das reichte ihm offenbar nicht.
»Ausleeren!«, kommandierte er.
Wolfgang griff in seine Tasche und legte ihren mageren Inhalt auf das Lehrerpult: zwei Hefte, ein Bleistift, ein Radiergummi, ein paar lose Zettel, ein Apfel mit brauner Stelle. Keine Schinkenstulle.
»Bestimmt hat er sie sich schon reingestopft!«, ließ Franz Thierse sich von seinem Platz aus vernehmen. »Ich hab doch gesehen, wie er an meinem Ranzen war.«
Schürmann kniff die Augen zusammen. »Stimmt das, Kaminski?«
Wolfgang schüttelte den Kopf und hielt den Apfel fest, der vom Pult zu rollen drohte.
»Wie?« Schürmann hielt sich die Hand ans Ohr.
»Nein, Herr Lehrer. Ich habe nichts genommen. Die Tasche ist umgefallen und lag im Weg. Da hab ich sie aufgehoben und an ihren Platz zurückgestellt.«
»Sprich lauter!«
Wolfgang stockte einen Moment und raufte sich durch sein mausbraunes Haar. Es kostete ihn alle Kraft, das Gesagte zu wiederholen, doch es würde nicht viel besser zu verstehen sein. Mit seiner gespaltenen Oberlippe klang er nun einmal, als hielte er sich beim Sprechen die Nase zu. Dagegen war nichts zu machen, selbst wenn er sich noch so sehr bemühte. Schürmann fixierte ihn mit strengem Blick, entschied aber offenbar, die Sache nicht auf die Spitze zu treiben.
»Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Du kennst das Sprichwort, Kaminski.«
»Aber ich hab nicht gelogen!«, wagte Wolfgang einen letzten Verteidigungsversuch, wohl wissend, dass er nicht fruchten würde.
»Du wirst Franz deinen Apfel geben, verstanden?«
Wolfgang antwortete nicht.
»Ob du verstanden hast?«
»Ja, Herr Lehrer.«
»Wegtreten.«
Wolfgang stopfte seine Siebensachen zurück in die Tasche, machte kehrt und eilte zurück zu seinem Platz. Im Vorbeigehen legte er den Apfel auf die Schulbank, die Franz sich mit seinem Kumpan Georg teilte, und registrierte aus den Augenwinkeln deren hämisches Grinsen.
»Raus mit euch!«, polterte Schürmann noch einmal, die Pause hatte längst begonnen. Augenblicklich brach der Lärm los. Vierzig Stühle wurden zurückgeschoben, gefolgt von vieltönigem Stampfen und Rennen, Geschrei und Gelächter. Wolfgang wartete, bis der Pulk draußen war, achtete aber darauf, nicht der Letzte zu sein, damit Schürmann ihn nicht noch einmal zurückpfeifen konnte.
Auf dem Schulhof stellte er sich ein wenig abseits und hielt sich von seinen Mitschülern fern. Ein solcher Tag roch nach Prügelei, und darauf wollte er es keinesfalls ankommen lassen. Er fühlte sich niedergeschlagen und war zugleich wütend. Niemals würde er diese Geschichte loswerden. Sie klebte an ihm wie Federn am Teer.
»Was glotzt du so dämlich, Polacke?« Franz Thierse hatte Wolfgang aufgespürt. Etwas kam auf ihn zugeflogen, verfehlte ihn aber und zerplatzte drei Schritte hinter ihm auf dem Pflaster. Es war der Apfel, den er Franz hatte abtreten müssen.
»Da hast du deinen Appel!«, grölte Franz und stopfte sich etwas in den Mund, das verdächtig nach Schinkenstulle aussah. Mit einem fetten Grinsen zog er von dannen.
Sicher hatte Franz sich die Geschichte mit dem gestohlenen Pausenbrot nur ausgedacht, um von irgendeiner eigenen Schandtat abzulenken. Und ihm schoben sie mal wieder den Schwarzen Peter zu, dachte Wolfgang. Doch der Tag sollte noch weitere unangenehme Überraschungen für ihn bereithalten.
»Hefte raus, Diktat!« In der Schulstunde, die auf die große Pause folgte, diktierte Schürmann ein ellenlanges, kompliziertes Gedicht über die Pflanzenwelt, in dem es nur so rankte und blühte, keimte und sprießte. Für Wolfgang klang es wie ein einziges Kauderwelsch. Lag es an seinen Ohren, wie er manchmal vermutete, oder war er einfach zu dumm?
Mit einer Hand den Text haltend, die andere hinter seinem Rücken verborgen, schritt Schürmann die Bankreihen ab und inspizierte flüchtig über die Schultern seiner Schüler hinweg, was diese bislang fabriziert hatten. Bei ihm blieb er stehen. Wolfgang hasste Schürmanns abgestandenen Tabakatem, der seinen Nacken streifte, er hasste den Mottenkugelgeruch seines Anzugs.
»Nun, Kaminski. Da möchten wir uns an der Anmut und Schönheit edler Rosen erfreuen, aber du bringst nur Kraut und Rüben zu Papier! Wir möchten von betörenden Düften träumen, doch was du lieferst ist bloß Gestank.«
Verhaltenes Lachen, das sofort wieder erstarb. Niemand wollte durch überzogene Schadenfreude auf sich aufmerksam machen und womöglich selbst zum Opfer werden. Lehrer Schürmann trat kopfschüttelnd in den Gang zurück, und Wolfgang hoffte schon, er hätte von ihm abgelassen, doch dem war nicht so.
»Kraut und Rüben, Kaminski. Dazu eine Handschrift wie ein besoffener Hilfsarbeiter. Das wird wohl nichts werden mit der Versetzung.«
Wolfgang erstarrte. Er wagte es nicht, den Blick zu heben.
»Das kommt davon, wenn man nicht nur dumm ist, sondern auch noch faul«, ergänzte Schürmann in selbstzufriedenem Tonfall.
Keine Versetzung. Wolfgangs Hände krampften sich zu Fäusten, sein Herz hämmerte gegen seine Brust. Am liebsten würde er ihn umbringen. Die Finger um Schürmanns dürren Hals mit dem hüpfenden Adamsapfel schließen und zudrücken, ganz fest, so fest, dass ihm die Zunge aus dem Hals hängen würde und die Augen aus dem Kopf springen würden.
Es blieb still im Raum. Mucksmäuschenstill. »Der bleibt sitzen, der bleibt sitzen!«, hatten sie damals geschrien. Heute, drei Jahre älter und gewitzter geworden, brüllten seine Klassenkameraden nicht mehr, sie feixten nur. Die ungebremste Häme hoben sie sich für die Zeit nach dem Unterricht auf.
Schürmann wollte ihn nicht versetzen. Schon wieder. Nach den Pfingstferien würden es nicht einmal mehr sechs Wochen bis zu den Sommerferien sein, da war nicht mehr viel zu holen.
Warum? Warum traf es immer und immer wieder ihn?
Er schämte sich und war verzweifelt. Wie sollte er die Sache nur seiner Mutter erklären? Ein weiteres Jahr Schule, das war einfach nicht drin. Er würde arbeiten müssen, und das wollte er ja auch. Endlich zupacken. Endlich Geld verdienen. Er war ohnehin älter als die meisten anderen, er hatte ja schon eine Ehrenrunde gedreht.
Flüchtlingspack. Von Anfang an hatte Schürmann keinen Hehl aus seiner tiefen Abneigung gegen die Vertriebenen gemacht. Aber die anderen wurden versetzt. Selbst Otto Marek, obwohl er ständig fehlte. Otto war allerdings auch noch nie beim Klauen erwischt worden. Oder hatte sich nicht erwischen lassen, was wohl wahrscheinlicher war. Wolfgang fragte sich, ob Schürmann ihn weniger hassen würde, wenn er ihn nicht für einen lausigen Dieb hielte.
Wie sie gehungert hatten damals! Nicht nur während ihrer Flucht aus der Heimat, sondern auch später. In diesem ersten Kaltenbrucher Winter. Bei ihrer Ankunft sollten die Baracken eigentlich fertiggestellt sein, aber das waren sie nicht, weshalb man ihnen eine eisige Kammer über den Stallungen des Bauern Thierse zuwies, in der einmal ein Knecht gehaust hatte. Ein Wunder, dass der nicht erfroren war. Aber vielleicht war er es ja, wer konnte es wissen.
Ein winziges Zimmer für sechs Menschen, fünf davon Kinder, seine jüngste Schwester Monika noch im Wägelchen. Sie konnte damals zwar schon laufen, aber eben noch nicht marschieren. Darüber mokierte Bauer Thierse sich besonders. Über das Wägelchen. Eine Frau mit Kinderwagen war als Arbeitskraft nicht zu gebrauchen.
»Kommen daher und setzen immer weiter Bälger in die Welt, die wir dann durchfüttern müssen. Das tut doch keine Not!« Während er sprach, saß er in seiner warmen Küche mit dem Rücken zu ihnen am Tisch und löffelte seine Suppe, er drehte sich nicht einmal zu ihnen um.
Das tut keine Not. Wolfgang, damals sieben oder acht Jahre alt, begriff nicht, was Thierse damit sagen wollte, und so recht verstand er es bis heute nicht, denn die Not war groß gewesen.
Dieser Winter. Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Ohne Strom und Wasser ließ sich leben, aber die Kälte! Der Wind pfiff durch jede Ritze, das einzige Fensterchen war mit Eisblumen übersät. Hinausschauen konnte man nicht, da der eigene Atem sofort zu einer milchigen Eisschicht gefror und die Scheibe blind machte.
Auf ihren Strohsäcken schmiegten sie sich aneinander und hofften auf ein Ende der Kälte – oft im Dunkeln, wenn das Petroleum mal wieder ausgegangen war. Wer hungert, soll auch frieren. Wie sehr der Spruch auf sie zutraf! Offenbar konnten die Kaltenbrucher sich nicht vorstellen, was eine sechsköpfige Familie zum Überleben brauchte. Oder es war ihnen gleichgültig.
Dabei hatten die Bauern immer genug zu essen, einem wie Franz mangelte es nie an Nahrung. Wer satt war, brauchte sich nicht an fremdem Eigentum zu vergreifen. Der musste nicht auf krumme Ideen kommen.
Seine Mutter sagte immer, man müsse die alten Geschichten ruhen lassen, aber das konnte Wolfgang nicht. Was Hunger war, das vergaß man nicht. Die Magenschmerzen, die Schwäche, die Wehrlosigkeit. Tief in seinem Innern bohrte dieser Schmerz noch immer, als wäre da etwas in ihm, das nie mehr satt werden würde. Nein, vergessen konnte er die Geschichte nicht. Wie sollte er auch, wenn man sie ihm heute noch nachtrug? Wenn die Kaltenbrucher ihm Dinge vorwarfen, für die sie sich eigentlich selbst bitter hätten schämen müssen.
Damals. Es musste im Februar gewesen sein, als die Mutter das Elend nicht mehr mit ansehen konnte, sich einen Kartoffelsack schnappte und loszog, den kleinen Wolfgang im Schlepptau. Warum sie nicht Rudi oder Elke mitgenommen hatte, wusste er bis heute nicht. Vielleicht, weil sie für ihre beiden ältesten Kinder härtere Strafen fürchtete, falls sie erwischt würden. Vielleicht wollte sie auch nicht, dass der draufgängerische Rudi sie bei etwas unterstützte, das ihn zu weiteren Sünden verleiten könnte. So war es Wolfgang, der Schmiere stand, während seine Mutter sich auf das erstbeste Huhn stürzte, das sie erwischen konnte, ihm den Sack über den Kopf stülpte und mit einer einzigen, schnellen Bewegung den Hals umdrehte. Drei Tage lang konnten sie sich von dem herrlich fetten Vieh satt essen.
Wolfgang würde nie vergessen, wie heiter und zufrieden er gewesen war. Als dann wieder Schmalhans Einzug hielt, wollte er es seiner Mutter gleichtun. Er wollte essen. Er wollte satt sein. Er wollte, dass die anderen stolz auf ihn waren.
Leider ging sein Plan nicht auf. Zwar gelang es ihm ganz allein, ein Huhn in die Enge zu treiben und ihm den Sack über den Kopf zu werfen, aber er schaffte es nicht, dem Vieh den Hals umzudrehen. Es gab ein wildes Gezerre und Gegacker, und auf einmal stand die Bäuerin vor ihm, mit der Mistgabel drohend.
»Wollt’st uns wohl ein Huhn stehlen, du Kanaille!«
»Wollt ich gar nicht!«
Dann kam Bauer Thierse und prügelte ihn windelweich, und keine zehn Schritte entfernt stand der kleine Franz und lachte sich kaputt.
Hühnerdieb. Kaminski ist ein Hühnerdieb! Der Ruf hing ihm bis heute nach. Nicht nur ihm, sondern der ganzen Familie, auch wenn der Flüchtlingshelfer kurz nach dem Vorfall einen Sack Kartoffeln und zwei Pfund fetten Speck gebracht hatte; irgendjemanden musste offensichtlich das Gewissen geplagt haben.
Im März hatten sie dann in die Baracke einziehen können, und seine Mutter hatte Arbeit gefunden. Es war wohl als Ironie des Schicksals zu bezeichnen, dass sie ausgerechnet auf einem Hühnerhof unterkam. Auch Rudi fand Arbeit in Schlüters Besenfabrik, und alles wurde besser. Die Hungerzeit war vorbei. Doch Lehrer Schürmann hatte ein gutes Gedächtnis, und andere Lehrer offenbar auch.
Wolfgangs Schwester Angelika war es zumindest anfangs kaum besser ergangen als ihm. Das Fräulein Rumpf, das sie unterrichtete, hatte ihr strikt verboten, während des Unterrichts aufs Klo zu gehen, bis sie sich eingepullert hatte. Auf dem Heimweg von der Schule war die Pisse an ihrer Strumpfhose festgefroren, man hätte sie hinstellen können wie Rudis Arbeitshosen, wenn die bei Frost auf der Leine hingen. Doch im Gegensatz zu ihm war es Angelika später gelungen, die Lehrer durch Fleiß und Höflichkeit zu überzeugen und sogar ein paar Freundschaften zu schließen.
Die Kaminskis konnten ja noch froh sein, dass sie katholisch waren, obwohl die Kirche in der Familie nie eine große Rolle gespielt hatte. Frieder Platzek, der aus der Oberlausitz stammte, war evangelisch, und mit ihm hatten die Kaltenbrucher Kinder in den ersten Jahren nicht einmal reden dürfen. Dazu wohnte er in Gödern, was für ihn jeden Morgen einen Fußmarsch von gut vier Kilometern bedeutete. Er hatte Wolfgang einmal die Frostbeule an seinem linken großen Zeh gezeigt. Wo steckte Frieder überhaupt? Wolfgang hatte ihn schon seit Längerem nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich half er irgendwo bei der Ernte, das war auskömmlicher als die Schule.
Und wenn er abhauen würde, überlegte Wolfgang. Einfach auf und davon ginge? Sich irgendwo eine Arbeit suchte und sich hier nie wieder blicken ließe? Das konnte er der Mutter nicht antun.
»Was guckst du so trüb, Brüderchen?« Rudi riss ihn aus seinen Gedanken. Er war eben von der Schicht heimgekommen und blieb neben Wolfgang stehen. »Guckst seit Tagen drein wie die Kuh wenn’s donnert. Was ist los mit dir? Hast du Liebeskummer?« Wolfgang schluckte hart, antwortete jedoch nicht. »Nun spuck’s schon aus, mir kannst du’s doch sagen.«
»Ich werde nicht versetzt«, bekannte er kleinlaut.
»Was denn, schon wieder nicht?«
»Schürmann meint, ich sei zu dumm und zu faul.« Wolfgang hob den Blick und sah Rudi verschämt an.
»Und, bist du’s?«
»Muss wohl stimmen, wenn er’s sagt.«
»Unsinn, Wolfi! Lass dir nichts einreden von dem Kerl.«
»Aber er hat recht. Ich sag ja auch nicht viel. Wenn ich’s doch tu, lachen die anderen, und er muss dreimal nachfragen, was ich gemeint hab. Also sag ich lieber nichts. Und das mit der Rechtschreibung will auch nicht besser werden.«
»Rechtschreibung! Wen interessiert die schon?« Rudi zog eine verächtliche Miene. »Wolfi, du kannst lesen und schreiben, und im Kopfrechnen bist du fixer als ich. Mehr brauchst du nicht im Leben, alles andere kommt dann schon von selbst. Warum solltest du noch ein Jahr in der Schule absitzen?«
»Aber was soll ich denn tun?«, fragte Wolfgang verzagt.
»Gar nichts tust du. Lass das nur meine Sorge sein. Ich werd mit Schürmann reden.«
»Der lässt nicht mit sich reden.«
»Wart’s ab! Man muss nur die richtigen Argumente haben.« Rudi zwinkerte ihm zu. »Verlass dich auf mich, Brüderchen. Ich hab da so meine Methoden.« Er grinste breit, begann zu tänzeln und boxte Wolfgang gegen den Oberarm. Der reagierte nicht darauf, doch Rudi ließ nicht locker. Er zog ihn auf die Füße und drohte ihm scherzhaft mit den Fäusten. »Nun los, zeig’s mir!« Nur halbherzig wehrte Wolfgang einen neuerlichen Schlag ab und wollte sich abwenden, doch Rudi ließ ihn nicht gehen. So war er, sein Bruder. Immer auf Zack, immer in Aktion. Rudi, der Boxer. Rudi mit seinen hellen Augen unter den dunklen Brauen, mit seinem strubbeligen Blondhaar und dem ansteckenden Lachen. Kein Wunder, dass ihm die Mädchen nachliefen.
Der nächste Treffer tat weh. Wolfgang brachte sich in Stellung und schlug zu, einmal und noch einmal, wieder und wieder, bis er völlig außer Puste war.
»So ist’s gut, Wolfi! Lass dir nichts gefallen!« Rudi nahm die Hände herunter und sprang leichtfüßig die Stufen zur Haustür hoch. »Verlass dich auf mich. Und denk dran, die Kaminskis kriegt keiner klein.«
Marlene
6.
Marlene saß schon seit Stunden an dem behelfsmäßigen Obststand an der Straße nach Kaltenbruch, den die Männer eilig zusammengezimmert hatten. Der alte war im letzten Winter unter der Schneelast zusammengebrochen, und niemand hatte es für notwendig gehalten, einen neuen zu bauen, solange er nicht benötigt wurde. Als es dann so weit war, hatte es schnell gehen müssen.
Das Ergebnis war nicht sonderlich ansehnlich, aber zweckdienlich. Vier Stützen links und rechts, eine Bretterwand gegen den Westwind, ein Teerpappendach, ein Tisch für die Auslagen, eine Holzbank, auf der Marlene auf Kundschaft wartete.
Es war Samstagvormittag und schwülwarm wie die Tage zuvor, die Nacht hatte kaum Abkühlung gebracht. Hier, unmittelbar an der Straße, die sich saumlos durch die Felder wand, war die Luft besonders stickig. Jedes Fahrzeug, das vorbeifuhr, wirbelte körnigen Staub auf, der Marlene in die Augen geriet und sich als grauer Film auf ihre Haut legte.
Sie war müde, das konnte sie nicht leugnen, doch die Müdigkeit störte sie nicht, im Gegenteil, durch ihre dämmrige Schläfrigkeit fühlte sie sich noch immer von jenem nächtlichen Traum umfangen, den sie nicht loslassen wollte: der brennende Sonnenuntergang am Weiher, die aufflammenden Sterne, die sich im Wasser spiegelten, ihr Erlöschen im silbrigen Morgengrauen; seine Arme, die sie umschlangen, seine Brust an ihrem Rücken, die warmen Hände, die ihre Füße rieben. Sie wollte den Zauber bewahren, ihn tief in ihr Herz betten, ihn schützen gegen alle Ödnis, gegen dieses triste »zwei Pfund Erdbeeren und sechs Stangen Rhabarber – und ein Glas von der Marmelade, wenn’s recht ist«.
Sie hatte gut verkauft an diesem Morgen. Jetzt, wo es auf Mittag zuging, ließ der Verkehr jedoch nach, bereits seit einer Viertelstunde war kein Wagen mehr vorbeigefahren. Die Sonne stand hoch am weißglühenden Himmel, die Luft vibrierte vor Hitze, sogar die Vögel verstummten. Marlene fielen die Augen zu. Sie registrierte den schwarzen Mercedes erst, als er bereits hinter der Erdbeerhütte angehalten hatte. Unverkennbar der Wagen der Familie Schlüter – niemand sonst in der Gegend besaß einen solchen.
Gegen das Licht blinzelnd, erkannte Marlene die Töchter Anneliese und Margarethe auf der Rückbank. Die Beifahrertür schwang auf, Frau Schlüter stieg aus und kam mit strahlendem Lächeln auf sie zu.
»Marlene! Wie schön, dich zu sehen. Das Wetter ist ja mörderisch, nicht wahr? So schwül und drückend, und dabei fällt nicht ein Tropfen! Aber es kann nicht mehr lang dauern. In Köln regnet es schon Katzen und Hunde, wie ich hörte, und die Meteorologen sagen auch für uns hier starke Regenfälle voraus. Behauptet zumindest mein Mann. Nun ja – den Erdbeeren hat die Trockenheit offenbar nicht geschadet, sie sehen ganz wunderbar aus.«
»Und so schmecken sie auch«, bekräftigte Marlene lächelnd.
»Das glaube ich dir aufs Wort, meine Kleine.« Frau Schlüter fixierte sie mit eigentümlich intensivem Blick, ehe sie weiter drauflosplauderte. »Wir waren bei der Schneiderin in Kaltenbruch. Mein Gott, war das eine Hitze! Dann dieses Hin und Her: Nein, ich möchte diesen Stoff, oder doch lieber den anderen? Das Kleid kürzer oder länger? Oder ganz mutig: eine Hose? Puh! Aber wir haben es wacker durchgestanden, und jetzt hoffen wir, dass die gute Frau alles so hinbekommt, wie wir uns das vorstellen, nicht wahr?« Sie sprach, als wüssten sie beide nur zu gut, dass die Tücken der Maßschneiderei im Detail lagen. Marlene lächelte, lächelte und lächelte.
»Nun mal her mit den süßen Früchtchen!«, beendete Frau Schlüter ihren Redefluss und orderte vier Pfund Erdbeeren. Marlene empfahl die Stiege zu fünf Pfund, die praktisch dasselbe kostete, und beschloss, auch einmal so jung und frisch wie Frau Schlüter auszusehen, wenn sie alt wäre.
»Wenn du es sagst, Kind!«, meinte diese gerade. Marlene hatte den Faden verloren. »Einer Person wie dir glaubt man ja alles aufs Wort. Weißt du das? Nein, nein, schau nicht so bescheiden, Marlene! Ich weiß, wovon ich rede. Da drüben sitzen meine Töchter im Wagen, du kennst sie doch, sie sind ja mit dir zur Schule gegangen. Aber ich sage dir, keine von beiden hat dein Potenzial. Ja, lach nur! Es ist das Vorrecht der Jugend, sich über die Erwachsenen lustig zu machen. Manchmal haben wir allerdings den größeren Weitblick, und eines Tages wirst du merken, dass ich recht habe. Ah, ich sehe es dir an, du weißt es schon jetzt, nicht wahr?« Da war es wieder, dieses feine Lächeln, das einen so für diese Frau einnahm. »Eine Person wie du, hübsch und praktisch veranlagt, sollte nicht im Straßenstaub sitzen«, befand sie jetzt. »Hier verdorrst du ja, ohne jemals geblüht zu haben!«
Marlene war verwirrt, sie fühlte sich geschmeichelt und gedemütigt zugleich. Sie öffnete den Mund, doch ihr fiel nichts Passendes ein, das sie hätte erwidern können.
»Entschuldige, das war vielleicht ein bisschen hart«, ruderte Frau Schlüter zurück. »Aber du könntest gut leben mit dem Geld, das mein Gatte dem Herrn Leitner bietet, ihr alle könntet das. Es hätte ein Ende mit den Erdbeeren – auch wenn das natürlich bitterschade wäre, unsere Köchin würde Tränen vergießen. Trotzdem –«
»Ich habe mit Herrn Leitners Geschäften nichts zu tun«, brachte Marlene endlich hervor.
»Natürlich nicht.« Frau Schlüter klang milde, doch ihre braunen Augen blitzten wie die eines vom Jagdfieber gepackten Terriers, der nicht aufzugeben bereit war. »Wenn du ihn allerdings gelegentlich darauf hinweisen würdest …«
Marlene lachte trocken. »Wenn Sie glauben, dass er auf mich hört, täuschen Sie sich gewaltig!«
Die Ältere winkte ab. »Sag so etwas nicht! Wenn meine Töchter meinem Mann gegenüber einen Wunsch äußern, dann tut er alles, um ihn zu erfüllen, egal, wie idiotisch er ist.«
»Ich bin nicht Leitners Tochter!«, entgegnete Marlene scharf, worauf eine eigentümliche Stille eintrat.
»Ach ja, das vergesse ich immer wieder«, sagte Frau Schlüter schließlich. »Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen.« Sie bezahlte, nahm die Erdbeeren in Empfang und verabschiedete sich. »Komm uns bald einmal besuchen! Meine Töchter würden sich freuen.« Der als Chauffeur abgestellte Arbeiter der Firma Schlüter war inzwischen ausgestiegen, nahm ihr die Erdbeeren ab und verstaute sie im Kofferraum. Als der Mercedes davonfuhr, sah Marlene die Gesichter von Anneliese und Margarethe, die sich zu ihr umdrehten und sie anstarrten; zwei bleiche Flecken vor dunklem Grund, die immer kleiner wurden, bis der Wagen hinter der nächsten Kurve verschwunden war.
Marlene schluckte, sie fühlte sich völlig ausgetrocknet. Der Staub, die Hitze, diese Frau. Diese Frau, die mindestens vierzig sein musste, aber immer noch wunderschön war, die lächeln konnte wie eine Heilige. Hier verdorrst du ja, ohne geblüht zu haben.
Sie bückte sich nach ihrer Wasserflasche, musste aber feststellen, dass sie umgefallen und ausgelaufen war. Als sie wieder aufsah, erblickte sie Kaminskis Berta, die auf ihrem rostigen Drahtesel angeradelt kam, schweißgebadet, wie immer im Kittel, mit geblümtem Kopftuch. Berta hielt an, lehnte ihr Rad gegen den Unterstand und wischte sich mit einem knittrigen Taschentuch die Stirn, während sie die Spankörbchen mit den Erdbeeren ins Visier nahm, jedes sorgfältig prüfend, ehe sie sich für eines entschied. Marlene reichte ihr das Gewünschte und gab noch eines dazu, weil sie wusste, wie sehr Berta sich strecken musste mit ihren fünf Kindern.
»Die bekomme ich heute sowieso nicht mehr quitt«, behauptete sie, um die Frau nicht in Verlegenheit zu bringen. Vermutlich entsprach das sogar der Wahrheit, und vom Marmeladekochen hatte Marlene vorläufig genug. Berta bedankte sich ohne Überschwang, der ihr ohnehin nicht zu eigen schien, deponierte die Erdbeeren in der offenen Holzkiste, die sie auf den Gepäckträger geklemmt hatte, und griff in ihre Kittelschürze. Für einen Augenblick erstarrte sie, dann begann sie hektisch, ihre Schürzentaschen abzuklopfen.
»Mei Portjuchhe!«, stammelte sie erschrocken. »Ich muss es im Hofladen vergessen haben.« Sie sprach in ihrem eigentümlichen breiten Dialekt, der kurze Wörter in die Länge zu ziehen und lange zu stauchen schien.
»Du kannst später bezahlen, Berta.«
»Aber das Portjuchhe!«
Marlene winkte ab. »Es ist wirklich kein Problem.«
»Das sagst du! Ich muss sofort zurück. Die Köchin von Schlüters war doch da und hat die Pute abgeholt, die sie bestellt hatte, und die Höhner konnte nicht wechseln, weil sie mir gerade den Wochenlohn ausbezahlt hatte, und da hab ich … da muss ich … Ich muss es liegengelassen haben.« Berta schnappte ihren Drahtesel, wendete und schwang sich in den Sattel.
Arme Frau, dachte Marlene. Jetzt muss sie noch einmal den ganzen Berg rauf, und das bei der Hitze. Sie sah Berta lange nach: eine gebeugte, krumme Gestalt unter bleiernem Himmel, die immer kleiner wurde und irgendwann von den Kornfeldern verschluckt wurde. Wieder übermannte Marlene die Müdigkeit, und sie nickte ein, bis das Motorengeräusch eines Schleppers an ihr Ohr drang, das rasch lauter wurde. Ihr Herz schlug unweigerlich schneller.
Dann erkannte sie, dass es Heini war. Er parkte den Traktor am Straßenrand und stellte den dröhnenden Motor ab. Die plötzlich eintretende Stille war so intensiv, dass sie glaubte, das Blut in ihren Ohren rauschen zu hören.
»Hallo, Liebchen!« Grinsend sprang er vom Trittbrett, quetschte sich zu ihr auf die Bank und legte seinen Arm um ihre Schulter. »Wie schaut’s aus?«
»Als würd’s bald Regen geben, so schaut’s aus.«
»Ach, das tut’s seit Tagen, und nix passiert.« Er seufzte wohlig. »Wunderbar – wir beiden Hübschen so ganz unter uns, nicht wahr?«
»Das nennst du ›unter uns‹? Wir sitzen quasi auf der Straße, dazu im Dreck, und jeden Moment kann jemand vorbeikommen.«
»Hoppla, hat hier jemand schlechte Laune?« Er schob sie etwas von sich, um sie besser betrachten zu können, und wurde plötzlich ernst. »Marli, lass uns nicht die Zeit vergeuden. Wir haben so selten Gelegenheit, allein miteinander zu reden. Das Gerede um den heißen Brei führt doch zu nichts.« Auf ihren fragenden Blick hin wurde er deutlich: »Lass uns Nägel mit Köpfen machen und unsere Verlobung bekannt geben. Dann ist es vorbei mit der Heimlichtuerei.«
Marlene schnappte hörbar nach Luft. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«
»Ich wollte dich gestern schon fragen. Den Anfang gemacht habe ich ja, wie du dich vielleicht erinnerst …« Er lachte, ohne den Satz zu Ende zu sprechen, und hielt einen Moment inne. Dann klopfte er sich entschlossen auf die Schenkel. »Aber jetzt sind wir allein. Jetzt können wir’s ausmachen.«
»Heini, du bist erst siebzehn.«
»Na und?«
»Ich bin älter als du.«
»Glaubst du, die zwei Jährchen würden mich stören?«
»Jetzt vielleicht nicht, aber wenn ich mal dreißig bin, fragst du dich, wie du dir so eine alte Schachtel zulegen konntest.« Sie lächelte gezwungen, und er zog seinen Arm zurück.
»Ich mag es nicht, wenn du so redest, Marlene.«
»Ich mag auch nicht, wie du redest.«
Die Heftigkeit, mit der sie das sagte, ließ ihn zusammenfahren. »Du magst mich also nicht?« Er schaute plötzlich drein wie der kleine Konrad, nachdem er eine Ohrfeige kassiert hatte – zutiefst gekränkt.
»Doch, Heini.«
»Ehrlich?«
»Selbstverständlich mag ich dich.«
Er schlang seine Arme um sie und presste sie an sich. Sie ließ es geschehen, ohne seine Umarmung zu erwidern.
»Heinrich, es geht nicht«, murmelte sie gegen seine Schulter.
»Oho! Wenn du mich Heinrich nennst, kann das nichts Gutes bedeuten!« Er gab sie ein Stück frei, ließ sie aber nicht los. »Du musst Mut haben, Marlene. Wir schaffen das, ganz bestimmt! Der Alte hält nicht mehr lange durch, schau ihn dir doch an! Nächsten Monat werd ich achtzehn, und dann sind es nur noch drei Jährchen. Oder wir türmen schon vorher und schlagen uns durch, bis es so weit ist. Hey, lach nicht! Ich kann zupacken, ich bring uns schon durch. Und wenn ich einundzwanzig bin, verkauf ich meinen Anteil am Hof.«
»Du willst deinen Anteil verkaufen?« Marlene starrte ihn entgeistert an.
»Warum denn nicht?« Jetzt lächelte er wieder. »Ich muss nicht auf dem Land meiner Ahnen begraben werden, den Blut-und-Boden-Zirkus haben wir ja wohl hinter uns! Ich will meine Freiheit. Ich will, dass wir beide frei sind.«
»Aber was wird dann aus Martin?«, fragte sie und spürte ihr Herz wild gegen ihre Brust hämmern. »Er will den Hof übernehmen, er muss dich auszahlen!«
»Auszahlen?« Heinis Lachen klang bitter. »Du weißt doch selbst, dass er nie und nimmer das aufbringen kann, was der Hof eigentlich wert ist – was mein Anteil wert ist. Schlüter zahlt mir das Doppelte, mindestens. Martin wird sich die Sache auch noch überlegen, glaub mir. So eine Chance bekommen wir nie wieder.«
»Und Renate?«
»Renate hat kein Interesse an dem Land, seit sie in den Melzerhof eingeheiratet hat. Sie und ihr Mann haben Großes vor mit ihren Schweinen, da können sie jeden Pfennig brauchen. Ich wette, sie liebäugeln auch schon mit Schlüters Angebot.«
Marlenes Miene erstarrte vollends.
»Mädel, nun sieh mich nicht so entsetzt an!« Heini umfasste ihre Schultern und drückte sie fest. »Du kannst mir vertrauen, Marli!« Er schaute ihr tief in die Augen. »Und ich? Kann ich dir vertrauen?«
Sie antwortete nicht.
Gruber
7.
Der Hilfsarbeiter Hans Gruber war kein humoriger Mensch, an einem Tag wie diesem schon gar nicht. Er hätte die Finger von Schulzes Selbstgebranntem lassen sollen. Was von Schulze kam, konnte ja nicht gesund sein.
Schulzes Fusel mache blind, hatte Grubers Vorarbeiter Reuss behauptet, einem Schwager seines Bruders sei das mal so ergangen mit Selbstgebranntem, und bei der Fahne, die Gruber habe, sei es ratsam, sich schon mal die Binde mit den drei schwarzen Punkten zuzulegen – solange er sie noch sehe, haha. Sollte Reuss sich um seinen eigenen Dreck scheren! Trotzdem – bildete Gruber es sich nur ein, oder war da wirklich etwas mit seinen Augen? Verdammt! Wenn Schulze ihn vergiftet hatte, würde er ihm die Fresse polieren! Vielleicht lag es auch nur daran, dass er eigentlich eine Brille bräuchte, aber die war ja hin. Er würde irgendwann in die Stadt müssen, um sich eine neue machen zu lassen, wofür mindestens ein halber Tag Urlaub draufginge, wenn nicht ein ganzer. Das wäre zwar weniger tragisch, als blind zu werden, aber noch schlimm genug. Verflixt und zugenäht!