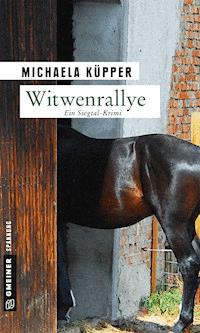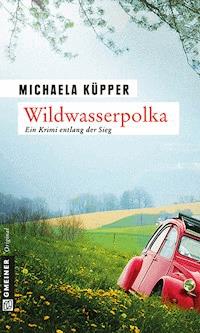14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein berührender Roman über das Schicksal von Kriegswitwen und ihr mutiges Leben nach dem 2. Weltkrieg im Paperback von der Autorin Michaela Küpper, die bekannt für ihre einfühlsamen Romane über das Leben inn der Kriegs-und Nachkriegszeit ist Deutschland 1945. Endlich ist der Krieg zu Ende, und nun stehen vor allem die Frauen vor der Aufgabe, das Überleben ihrer Familien zu sichern. In einer kleinen Stadt am MIttelrhein lebt Gerrit in einem Haus, in dem viele Flüchtlinge Schutz gesucht haben. Eines Tage steht die ausgebombte Kölnerin Eva vor der Tür und bittet um Unterkunft. Eher widerwillig stimmt Gerrit zu, ist doch gerade ein Zimmer frei geworden, nachdem die vorige Bewohnerin, die junge Hilda, spurlos verschwunden ist. Eva kann aufatmen, doch das Zusammenleben der Frauen ist zunächst geprägt von Neid und Misstrauen - und dem Kampf ums Überleben. All jenen Frauen gewidmet, die sich und ihre Kinder nach dem Krieg alleine durchbringen und ein neues Leben beginnen mussten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michaela Küpper
Undtrotzdemlebenwir
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Deutschland 1945. Endlich ist der Krieg zu Ende, und nun stehen vor allem die Frauen vor der Aufgabe, das Überleben ihrer Familien zu sichern. In einer kleinen Stadt am Mittelrhein lebt Gerrit in einem Haus, in dem viele Flüchtlinge Schutz gesucht haben. Eines Tages steht die ausgebombte Kölnerin Eva vor der Tür und bittet um Unterkunft. Eher widerwillig stimmt Gerrit zu, ist doch gerade ein Zimmer frei geworden, nachdem die vorige Bewohnerin, die junge Hilda, spurlos verschwunden ist. Eva kann aufatmen, doch das Zusammenleben der Frauen ist zunächst geprägt von Neid und Misstrauen – und dem Kampf ums Überleben.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Dank
Für meine Mutter
1.
Jetzt. Emil liebt den Moment, in dem Himmel und Erde entflammen, in dem der Fluss Feuer fängt. Er liebt diese magische Lichtflut, ihr rotgoldenes Gleißen.
Der Strom schwelgt in Purpur, Flusskiesel werden zu Diamanten und Stille legt sich über das Land. Sogar die Vögel verstummen. Ein ehrfürchtiges Innehalten der Natur.
Emils Blick schweift über die abgeholzten Pappeln hinweg, über die Betontrümmer und die Überreste des zerschossenen Panzers. Den aufgelaufenen Frachtkahn denkt er sich als ehernes, die Strömung teilendes Felsungetüm. So ist es fast wie früher. So kann er das Abendrot uneingeschränkt genießen als das, was es ist: ein unverrückbares Wunder der Schöpfung. Wunder sind so ähnlich wie Ewigkeit, fährt ihm durch den Sinn. Nicht kaputt zu kriegen.
Aus dem strahlenden Lichtfeuer löst sich eine Silhouette, unscharf, mehr Bewegung als Körper. Noch ehe er sie richtig erkennen kann, ahnt er instinktiv, dass es Hilda ist.
»Na, Kleener.« Sie stellt sich vor ihn hin, so nah, dass er den Kopf in den Nacken legen muss, um ihr ins Gesicht zu sehen. Er hebt den Arm, beschirmt seine Augen.
»Ach, du bist’s!«, tut er überrascht.
»Yes, it’s me. In vollster Pracht.« Sie lacht und tritt einen Schritt zur Seite, damit ihn das Licht nicht mehr so stark blendet. Langsam nimmt er seinen Arm herunter, mimt nun den Gleichgültigen.
»Noch Spaß gehabt gestern Abend?«
»Spaß? Von wegen!« Sie stößt ein verächtliches Schnauben aus. »Ist doch alles öde hier.«
»Für mich sah’s aus, als hätt’st du dich köstlich amüsiert.«
»Amüsiert? Wobei?«
»Na, beim Tanzen.«
»Das Herumgehopse nennst du tanzen?« Sie furcht die Stirn, verzieht den Mund, schiebt dann scheinbar harmlos nach: »Oder meinst du wegen dem Kranzler?« Als ob sie das nicht gleich gewusst hätte! Er sagt nichts darauf. Eine so dämliche Frage hat keine Antwort verdient, doch Hilda scheint auch keine zu erwarten. »Kranzler ist ein aufgeblasener Gockel«, behauptet sie, legt ihre Hände ins Kreuz, streckt den Rücken durch. »Mit dem hab ich nur geredet, damit er mir was zu trinken spendiert. Diese ewige Selbstzahlerei hab ich satt. Wozu ist man jung, wenn man sich nicht mal einladen lassen darf?« Sie schaut zu ihm hin, wütend beinahe, als hätte er den Schlamassel zu verantworten. »Wie satt ich das hier alles habe. So satt!« Ihre Hände schleudern durch die Luft, eine allumfassende Geste, die folglich auch seine Person mit einbezieht.
»Dann geh doch weg«, brummelt er mit gesenktem Blick.
»Du, das mach ich!« Die Antwort kommt so prompt und entschlossen, dass er nun doch wieder aufschaut. »Ich geh in die Schweiz«, verkündet Hilda und legt gleich nach: »In der Schweiz sind alle stinkreich, weil sie sich aus dem beschissenen Krieg rausgehalten haben.«
»In die Schweiz«, wiederholt er gedehnt. »Wer’s glaubt.«
»Was denn, du glaubst mir nicht?« Sie legt jetzt neckisch den Kopf zur Seite, grinst. »Wart’s ab! Wirst schon sehen.«
»Warum sollten sie dich aufnehmen?«, kontert er mit vorgerecktem Kinn. »Da könnt ja jeder kommen.« Fast gegen seinen Willen gleitet ihm dieser Satz über die Lippen, denn er hat ihn immer gehasst. Da könnte ja jeder kommen. Er zum Beispiel. Und was hat einer wie er schon zu wollen? »Nimmst du mich mit?« Die Frage ergibt sich wie von selbst. Fast glaubt er, jemand anders hätte sie gestellt.
»Dich?« Hilda lacht auf. »Nee du. Mit einem Kerlchen wie dir im Schlepptau komm ich bestimmt nicht weit.«
»Kommste sowieso nicht.« Er kreuzt die Unterarme auf den angewinkelten Knien, legt sein Kinn darauf ab, will ihr nicht zeigen, dass ihre Antwort ihn getroffen hat.
»Ich komm überall hin, wenn ich will.« Sie klingt plötzlich milde, fast nachsichtig. Mit einem Fuß streift sie ihre Sandale ab, entledigt sich auch der anderen, steht nun barfuß da in ihrem gelben Kleid, das in diesem besonderen Licht aufblüht wie eine Osterglocke. Vergessen alle Fadenscheinigkeit, vergessen die vorstehenden Rippen darunter, die kantigen Hüften. In diesem Moment wirkt Hildas Körper perfekt, wie der einer Tänzerin. Prompt hebt sie sich auf ihre Zehenspitzen und reckt die Arme empor, als wollte sie nach etwas greifen, doch ihre Hände greifen nicht, sie wedeln nur sanft hin und her, spielerisch, wie eine Blüte, die sich im Abendwind wiegt. Er schaut ihr zu, wie sie sich da biegt und streckt, glotzt regelrecht, bemerkt es selbst und kann doch nicht anders. Wie gestern Abend vor Jupps Büdchen. Es macht einen verrückt, dieses Sprunghafte an ihr.
Die spontane Darbietung endet mit einem klirrenden Lachen. Sie senkt die Fersen, steht mit beiden Füßen wieder fest auf dem Boden. »Sag mal, wie alt bist du eigentlich?«
»Sechzehn«, lügt er, weil man mit sechzehn schon ein halbwegs vollwertiger Mensch ist.
»Sechzehn«, wiederholt sie nachdenklich. »Tja, das ist traurig.«
»Traurig? Wieso?«
»Weil du aussiehst wie vierzehn. Das kann einem jungen Kerl doch nicht recht sein.« Sie hätte ihm auch einen Kübel Eiswasser über den Kopf schütten können.
»Blödsinn! Alle schätzen mich älter«, versucht er sich zu retten, setzt sich aufrecht, strafft die Schultern.
»Dann schauen sie nicht richtig hin«, beharrt Hilda stur.
Er beißt sich auf die Lippen, weiß nicht, was er sagen soll. Was will sie eigentlich von ihm? Wieder steigt ihm das Blut zu Kopf. Wie gestern vor Jupps Büdchen. Der Schwoof auf dem Freiluft-Tanzboden war früher weithin bekannt. Dicht an dicht haben sich die Paare, von einem Flussdampfer oder aus den Nachbarorten kommend, aneinander vorbeigeschoben. Als kleiner Bengel ist er einmal in das Gewirr von Röcken und Hosenbeinen hineingeraten und war in Panik ausgebrochen bei dem Gedanken, es nie wieder hinauszuschaffen aus diesem lebendigen Irrgarten. Die Zeiten sind vorbei, in jeder Hinsicht. Jetzt spielt dort nur noch eine alte Frau namens Margarethe auf dem Bandoneon, und aus Mangel an Männern tanzen die Frauen paarweise, umgeben von einer Horde herumhüpfender Kinder, die eigentlich ins Bett gehören.
Aber Emil war dort. Hilda auch, und einer plötzlichen Laune folgend, hat sie ihn auf den Tanzboden gezerrt. Vom Tanzen hatte Emil keine Ahnung, aber davor war ihm nicht bang. Mit grätschbeinigen Polkaschritten im Kreis hüpfen kann jeder, so hat er gedacht und mutig seine Hände in Hildas verschränkt. Im parallelen Gleichschritt sind sie zu Oma Margarethes Aufspiel herumgehoppelt, hopp und hopp und hopp. Hildas Finger fühlten sich kühl an trotz der warmen Witterung, dazu dünn und leicht wie Vogelknöchlein. Sie grinste ihn an mit offenem Mund, ihr Atem ging immer schneller, doch ehe die Hüpferei wirklich anstrengend werden konnte, war sie auch schon wieder zu Ende. Noch immer grinsend, ließ sie ihn einfach stehen. Er ist ihr nachgegangen, fand sie an den Mauervorsprung gelehnt, der neuerdings als provisorische Theke diente, und noch ehe er bei ihr war, hörte er sie sagen: »Mannomann, hab ich ’nen Durst!« Aber sie hat nicht zu ihm gesprochen und auch nicht zu Fräulein Schulze, die den Ausschank führte, sondern zu Kranzler, dem miesen Sack. Kranzler, der sich im beheizten Beschaffungsamt immer schön den Hintern warm gehalten hat, während die Brüder Hagemann – fast derselbe Jahrgang wie er – an der Ostfront die Arschbacken zusammenkneifen mussten. Emil hat für beide geschwärmt. Sie hatten die Junior-Fußballmannschaft trainiert, waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gewesen und hatten sich auch sonst allerorten nützlich gemacht. Würden diese feinen Jungs noch leben, es wäre ein Gewinn für alle. Bei Kranzler ist das Gegenteil der Fall. Immer schön auf sich bedacht, immer schön den Großkotz raushängen lassen. Und zum Dank rissen sich jetzt auch noch die Weiber um ihn. Widerlich.
»Zwei Gläser Champagner«, hörte er ihn auch schon sagen, worauf Hilda ein perlendes Lachen ausstieß, als hätte sie bereits welchen getrunken. Dabei gab’s nur wässrige Molke, wie überall. Dieses Lachen hat Emil endgültig die Laune verhagelt, und er ist gegangen.
Beim Gedanken an Kranzler rümpft er unwillkürlich die Nase, zieht den Nacken ein. Seine Schulterblätter zucken ein wenig, als wollte er die Erinnerung abschütteln. Ob Hilda es bemerkt hat? Sie hockt sich neben ihn, umschlingt ihre Knie mit den Armen, ihre Haut leuchtet golden in dem magischen Licht.
»Kranzler ist ein Depp«, behauptet sie, als wollte sie ihn trösten. »Ich habe ihn stehen lassen.«
Mich hast du stehen lassen, denkt er, sagt aber nichts. Ebenso schweigt er sich darüber aus, dass Egon Wegmeier den Deppen und Hilda später in der Laube hinterm Rebenfeld verschwinden sah.
Was will sie?, fragt Emil sich einmal mehr. Hat sie ihn nicht schon genug gedemütigt? Er bohrt seine Füße in den warmen Sand, bohrt tiefer, bis es kalt und nass wird, blickt dabei in die Ferne. Die Lichterglut erlischt allmählich. Aus dem flammenden Rot wird ein blaustichiges Violett, das in ein tiefdunkles Lila ausläuft. Eine Brise fährt übers Wasser und trägt Flussschlammgeruch mit sich. Vom Boden steigt Feuchtigkeit auf. Zwei Möwen kreischen, als wollten sie einander Gute Nacht sagen; von weit her kämpft sich ein Schlepper stromaufwärts. Das Stampfen seines Motors dringt durch das Tal wie ferne dunkle Trommelschläge.
Seit die Pontonbrücken erhöht wurden, ist der Fluss wieder für die Schifffahrt freigegeben, wenn auch nur für den Transport der allernötigsten Dinge. Emil ist froh darüber. Ohne Schiffe ist ein Fluss kein Fluss.
»In der Schweiz gibt’s Schokolade, die man trinken kann«, tönt Hilda plötzlich in das Schweigen hinein.
»Und die Berge sind aus Käse«, ergänzt Emil abfällig und springt auf seine Füße. Er geht ein paar Schritte, sucht sich einen flachen Stein, lässt ihn übers Wasser plitschern. Eins-zwei-drei-vier.
»Du glaubst wirklich nicht, dass ich’s schaffe, oder?« Auf einmal steht sie neben ihm. Sie hat wieder dieses Grinsen im Gesicht und spielt mit dem Anhänger ihres Kettchens, einem silbernen Kleeblatt.
»Das mit der Schweiz? Nein.«
»Na warte! Der Schlepper da drüben, das ist meiner!« Schon knöpft sie ihr Kleid auf, das gelbe, leuchtende, butterblumenhafte, lässt es zu Boden gleiten. Sie hat kräftige Schultern trotz aller Magerkeit. Vielleicht stimmt es sogar, dass sie einmal eine Goldmedaille im Kraulschwimmen gewonnen hat. Angeblich im Bombenhagel verschüttgegangen. Angeblich hätte sie sogar bei der Sommerolympiade in Helsinki dabei sein sollen, woraus dann leider nichts geworden ist, weil diese Olympiade nie stattgefunden hat. Er weiß nicht, ob er ihr die Geschichte glauben soll, aber er weiß, dass sie eine gute Schwimmerin ist. Jetzt rennt sie auch schon ins Wasser. Es spritzt nach allen Seiten.
»Wir sehen uns in der Schweiz!«
»Lass den Quatsch!«, ruft er ihr nach, und ausgerechnet in diesem Augenblick kippt ihm die Stimme weg. Nur gut, dass sie es nicht bemerkt haben kann, denn das stakkatohafte Wummern des nahenden Schiffsmotors übertönt alles. Was soll’s. Sie wird sich ohnehin nicht aufhalten lassen, und auch er ist ein guter Schwimmer. Warum es also nicht einmal wagen? Schnell streift er sich das Hemd über den Kopf, kämpft sich mit einbeinigen Hüpfern aus der kurzen Hose, galoppiert durch das Flachwasser, watet mit rudernden Armen weiter, stürzt sich schließlich mit einem Hechtsprung in die Fluten. Sie hat bereits die Buhne passiert, er sieht ihren hellen Kopf die Flussmitte ansteuern, dem Schlepper entgegen, den sie im richtigen Moment abpassen muss. Nun hat er selbst mit der Strömung zu kämpfen, spürt einmal mehr, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Wer sich auf Höhe des Sandstrands anschickt, den Rhein zu durchschwimmen, gelangt zwei Kilometer flussabwärts ans andere Ufer. Mindestens. Falls überhaupt. Der Fluss ist gefährlich. Alle Kinder kennen die Predigt. Aber er ist kein Kind mehr. Mit kraftvollen Zügen krault er voran, genießt seine Stärke, die Geschmeidigkeit seiner Bewegungen. Die Sonne ist bereits vor Minuten untergegangen, schnell fällt nun die Dunkelheit ein. Keine Lichter an den Ufern, nirgends. Wieder ein Abend ohne Strom.
Viel Zeit bleibt nicht. Noch immer ist Hilda weit vor ihm, sieht er sie zügig vorangleiten, doch beim letzten Widerschein des Lichts verliert er sie plötzlich aus dem Blick. Da ist nur noch der kompakte Schemen des sich nähernden Lastkahns, das Zigarettenglimmen seiner roten Warnleuchte.
Die Strömung erfasst ihn nun vollends. Schon ist er auf Höhe des Schiffes, jedoch viel zu weit entfernt, als dass er es erreichen könnte. Ebenso schnell treibt er daran vorbei, machtlos gegen die Urgewalt des Wassers. Er dreht sich auf den Rücken, schaut zurück. Da! Steht dort nicht eine Gestalt Ausschau haltend am Achterdeck? Hebt sie nicht jetzt den Arm, um ihm zuzuwinken? Beim Versuch, sie schärfer in den Blick zu nehmen, klatscht ihm eine kabbelnde Welle ins Gesicht. Er schluckt Wasser, muss husten, dreht sich zurück in Bauchlage. Der Moment ist vertan, die ganze Aktion sinnlos, dazu lebensgefährlich. Nach kurzem Ringen mit sich selbst steuert er zurück in Richtung Ufer. Auf einmal kann es ihm nicht schnell genug gehen, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Das Motorstampfen wird leiser und schließlich vom unheilvollen Grollen der Heckwellen übertönt, die ihn jetzt mit Wucht erfassen. Alles ist ein Aufbäumen und Niedergehen, ein Fluten und Zurückfluten. Urplötzlich scheint ihn etwas festhalten zu wollen, eine geballte Energie, tausendfach stärker als er. Je mehr er kämpft, desto gnadenloser zieht ihn diese Kraft nach unten. Angst peitscht sein Herz auf. Jetzt nur die Nerven behalten, nicht in Panik verfallen! Scheinbar gegen alle Vernunft stellt er seinen Widerstand ein, lässt sich treiben. Und tatsächlich: Die unsichtbaren Hände geben ihn frei. Jörg, der ältere der Brüder Hagemann und ein ausgezeichneter Schwimmer, hat ihm einmal erklärt, wie mit diesem Phänomen umzugehen ist. Jörg Hagemann, der Lebensretter, der sein eigenes Leben so früh hergeben musste, sollte recht behalten, wie in allen anderen Dingen auch.
Emil ist wieder Herr seiner selbst, ein Gefühl unsäglicher Erleichterung durchströmt seinen Körper. Die auslaufenden Wellen tragen ihn nun wie von selbst in Richtung Ufer. Bald hat er schlammigen Grund unter den Füßen, schwimmt noch ein paar Züge, erspürt ein Kiesbett, watet an Land. Der Strand ist hier steinig und schmal wie ein Handtuch, begrenzt von einem steil aufragenden Wall aus Basaltbrocken. Sofort macht er sich an den Aufstieg, hat Glitschiges, Moosüberzogenes unter Händen und Füßen. Dann die Scharfkantigkeit trockenen, nackten Gesteins. Er stößt sich den linken Zeh, zieht scharf die Luft ein, langt oben an, lässt sich erschöpft in einer glatten Mulde nieder. Noch immer trommelt sein Herz gegen seine Brust, doch allmählich beruhigt sich sein Atem. Er streckt die Glieder, erspürt dankbar die letzte, ins Dunkel herübergerettete Sonnenwärme des Gesteins. Wieder umfängt ihn Stille, unterbrochen nur vom leisen Spiel der kaum noch anschlagenden Wellen. Die Nacht hat Fluss und Schiff verschlungen. Und Hilda.
Es ist nicht das erste Mal. Sie hat ihn schon einmal zum Narren gehalten, in der ersten Hitzewelle Anfang Juni. Auch damals ist sie weit hinausgeschwommen, hat sich treiben lassen, um dann plötzlich wie in Todesangst mit den Armen zu rudern. Schon damals hat sie ihm einen Mordsschrecken eingejagt und auch noch die Frechheit besessen, ihn später damit aufzuziehen.
Ob es wirklich Hilda war, die winkend an der Reling stand? Er ist sich nicht sicher. Falls nicht, wird sie, die geübte Schwimmerin, sich allerdings geschickter angestellt haben als er, wird sich nicht von irgendwelchen Flussdämonen ergreifen lassen haben, sondern längst irgendwo an Land gegangen sein. Vermutlich lacht sie schon wieder über ihn.
Emil zieht Halt suchend die Beine an, ballt die Fäuste. Mit den zurückkehrenden Kräften kommt die Wut. Wie will sie jetzt nach Hause kommen? Es ist gefährlich, nachts am Flussufer herumzuschleichen. Einem Mädchen muss das wohl nicht erst gesagt werden. Wenn’s nach der Mutter ginge, dürfte auch er längst nicht mehr hier sein. Aber mit dem nächtlichen Schleichen und Sichtummeln hat Hilda ja Erfahrung, denkt Emil grimmig. Und wenn’s darum geht, jemandem – ihm! – eins auszuwischen, scheut sie offenbar kein Risiko. Soll sie’s nur versuchen! Noch einmal lässt er sich nicht von ihr zum Narren halten. Soll sie zusehen, wie sie nach Hause kommt.
Plötzlich weht ihn eine schlammig feuchte Kälte an. Er erschauert, reibt sich die eiskalten Arme, spürt die Gänsehaut. Hier hat er nichts mehr verloren.
Ein paar Schritte durchs harte Gras, dann hat er den Weg oberhalb des Flusses erreicht. Ein schmaler grauer Streifen in der Schwärze der Nacht. Er fällt in seinen gewohnten Zockeltrab, kommt zügig voran, spürt unter der dicken Lederhaut seiner Fußsohlen kaum Split und Steinchen. Auf halber Strecke trifft er auf ein paar Gestalten, die sich um ein Feuer gruppiert haben, mehr Glut als Flamme. Gesindel, dem man lieber nicht begegnen möchte: ehemalige Fremdarbeiter, in die Freiheit entlassen und nun auf Rache sinnend, lichtscheues Volk, Halbverrückte und Kriminelle aller Art. Da, dieser gelbe Schein. Ist sie das nicht? Er drosselt sein Tempo, schaut genauer hin. Nein, unter den Lagernden ist keine Frau. Und überhaupt – wie soll sie so schnell an ihr Kleid gelangt sein? Schnell läuft er weiter, überhört die an ihn gerichtete Stimme, spöttisch, aber nicht unfreundlich, wird erst langsamer, als er wieder allein ist.
Soll Hilda doch in die Schweiz gehen. Oder zum Teufel. Dumme Kuh.
2.
Immer wenn man beim Essen sitzt!« Gerrit Mann schiebt rumpelnd ihren Stuhl zurück, stapft durch den dunklen Flur, reißt die Tür auf. »Wir kaufen nichts!«
Die junge Frau, die vor ihr steht, weicht erschrocken einen Schritt zurück, fängt sich aber gleich wieder.
»Ich will Ihnen nichts verkaufen«, erklärt sie schnell, tritt einen Moment auf der Stelle, wagt sich dann wieder vor. »Mein Name ist Eva Koch. Ich möchte fragen, ob Sie ein Zimmer für mich haben.«
»Ein Zimmer?« Gerrits Hand schließt sich unwillkürlich fester um die Türklinke. »Wenn Sie eine Unterkunft suchen, müssen Sie sich bei der Notquartierstelle melden.«
»Das habe ich ja!«, entgegnet die Fremde unerwartet heftig, spart jedoch das Ergebnis ihrer Bemühungen aus. Wäre sie erfolgreich gewesen, stünde sie nicht hier.
»Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen.« Schon schickt Gerrit sich an, die Tür zu schließen.
»Es ist furchtbar dort oben!«, legt diese Eva Koch nach.
»Wo oben?« In Gerrits Frage liegt argwöhnische Neugier.
»In der Burg.«
»Sie sind in der Burg untergebracht?« Diese Information erstaunt sie nun doch. »Wenn’s Ihnen da nicht fein genug ist, wird es Ihnen hier kaum besser gefallen«, erklärt sie beinahe amüsiert.
»Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch!« Der Ton der Fremden kippt ins Flehende. »Ich will nicht undankbar erscheinen oder anspruchsvoll. Aber es geht nicht.«
Gerrit sagt nichts darauf, mustert die junge Frau nur von oben bis unten: das braun gewürfelte, puffärmelige Kleid, dessen lange Knopfleiste auf den ersten Blick Vollständigkeit suggeriert; die braune, vor den Bauch geklemmte Handtasche. Echtes Leder, wie’s aussieht. Ebenso wie die zweifarbigen Halbschuhe, zwar abgetragen, aber durchaus noch tauglich. Unwillkürlich wandert Gerrits Blick zu ihren eigenen nackten Füßen hinunter. Bei dieser Hitze kann man getrost sein Schuhwerk schonen. Nur die Nägel sollte sie sich mal wieder schneiden. Es gab eine Zeit, da hat sie auf so etwas geachtet. Lang ist’s her.
Dem Spiel muss ein Ende gesetzt werden. »Hören Sie, Sie sind hier an der falschen Adresse.« Sie tritt einen Schritt zurück, der Spalt zwischen Tür und Rahmen schließt sich fast.
»Aber das Zimmer im Hinterhaus – es ist doch frei!« Ein letzter verzweifelter Vorstoß der Blonden, ein Alles-oder-nichts.
»Woher wollen Sie das wissen?«, argwöhnt Gerrit, bereits zur Hälfte im dunklen, schützenden Hausflur verborgen.
»Ich … ich weiß nicht«, windet sich die Angesprochene. »Irgendjemand hat’s mir erzählt. Es ist möglich, dass ich –«
»Das Zimmer ist belegt!«, fährt Gerrit dazwischen und knallt ihr die Tür vor der Nase zu.
Trotz der Helligkeit draußen herrscht im ehemaligen Schankraum schummriges Zwielicht. Es dauert einen Moment, ehe sich ihre Augen wieder darauf eingestellt haben. Sie geht zum Esstisch zurück, lässt sich auf ihren Stuhl fallen.
»Jetzt sind sie kalt!« Mit zorniger Geste schiebt sie ihren Teller zur Seite. Die drei schrumpeligen Pellkartoffeln darauf geraten ins Rollen. Sie wendet den Kopf und ruft in die andere Ecke hinüber: »Mutter?«
»Ich hab mich schon hingelegt«, erwidert eine brüchige Stimme.
»Hast du’s wieder im Kreuz?« Die Antwort ist ein Seufzen, das bis zu Gerrit vordringt.
»Warum warst du so barsch zu der Kleinen?« Guido Mewes führt seine Gabel zum Mund, ohne seine Schwester anzusehen. Dennoch bemerkt sie den Ausdruck belustigter Kritik in seinen Augen.
»Dass du Mitleid hast, wundert mich nicht.«
»Sie hat nett gefragt.«
»Sie hat schon ein Dach überm Kopf. Und ich will nicht noch mehr Leute im Haus haben.«
»Es ist ein großes Haus.«
»Herrje!« Gerrit wirft sich in ihrem Stuhl zurück. »Es ist randvoll mit Leuten, vom Keller bis zum Dach! Und ein kleines bisschen wollen wir ja auch noch mitzureden haben, wer hier haust und wer nicht.«
»Wir haben noch das Zimmer von Hilda Rieger«, wirft ihr Bruder ein.
»Eben. Es ist Hildas Zimmer.«
»Aber sie ist seit drei Wochen weg.«
»Na und? Besteht hier etwa Anwesenheitspflicht?«
»Du kennst ihren Lebenswandel. Sie wird den Amerikanern nachgelaufen sein oder bei sonst wem untergekrochen.«
»Genau das vermute ich auch! Wir haben ja gesehen, wie sie sich an die Boys rangeschmissen hat.« Gerrit lächelt grimmig. »Aber vielleicht hat sie übermorgen genug vom Poussieren, und dann steht sie wieder auf der Matte. Ist mir auch alles vollkommen schnurz. Offiziell ist sie hier einquartiert, also werde ich mir nicht freiwillig noch jemanden ins Nest setzen! Ich will meine Ruhe, verstehst du? Ich will, dass Gretchen und Mutti jede ein Zimmer für sich bekommen. Von mir ganz zu schweigen. Es ist doch eine Schande: Das Haus gehört uns, aber wir dürfen’s nicht nutzen!«
»Nun fang nicht wieder damit an!« Guido Mewes seufzt resigniert. »Wir können froh sein, dass die Bude nicht dauerhaft konfisziert wurde. Dann säßen wir auch auf der Straße.«
»Blödsinn!« Mit forscher Geste wischt Gerrit seinen Einwand beiseite. »Schau dir die Baders drüben an! Wursteln gemütlich weiter zu zweit vor sich hin, während wir uns den Lokus mit zehn Leuten teilen müssen!« Nicht zum ersten Mal gerät sie bei diesem Thema in Rage. »Erst die Schickse aus dem Ruhrgebiet, diese Erika Schott. Trampelt von früh bis spät die Treppe rauf und runter, als würd sie Geld dafür kriegen. Dann diese wunderliche Ida Schlagmichtot, die angebliche Nichte der Nichte unserer Großcousine, wer auch immer das sein mag. Nicht zu vergessen ihr missratener Sohn, der sich vor jeder Arbeit drückt. Und über die Lemminge aus dem Osten wollen wir gar nicht reden.«
»Nein, wollen wir nicht.« Guido Mewes hat seine Mahlzeit beendet und legt die Gabel auf den Teller zurück. »Die Leute müssen irgendwo unterkommen.«
»Aber doch nicht alle bei uns!«
»Lass gut sein, Gerrit. Dieses Gerede führt zu nichts. Mir tat sie halt nur leid.« Er greift mit einer Hand nach seiner Krücke, stützt sich mit der anderen auf der Tischplatte ab, stemmt sich hoch.
»Doch nur, weil sie hübsch war!«, legt Gerrit nach.
»Das kann ich nicht beurteilen«, erwidert ihr Bruder gefasst. »Ich habe sie nicht gesehen. Nur ihre Stimme gehört.« Nein, er wird sich nicht provozieren lassen, da kann sie sich auf den Kopf stellen, besagt sein Ton.
Diese demonstrative Gelassenheit bringt sie noch mehr auf die Palme.
»Ich weiß, du hast gern junge Frauen um dich«, giftet sie. »Am liebsten in jedem Arm eine!« Kaum ausgesprochen, weiß Gerrit, dass sie zu weit gegangen ist. Doch zurücknehmen kann sie’s nun nicht mehr. Sie greift nach ihrem Wasserglas, trinkt in großen, gierigen Schlucken, wischt sich mit dem Handrücken über den Mund. »Ganz schön heiß heute.«
Guido Mewes sagt nichts darauf. Mit Krücke und Teller hantierend, humpelt er in Richtung Theke, sorgsam darauf bedacht, nicht den Rest Heringslake zu verkleckern.
»Nun lass mal, ich mach das schon!« Gerrit springt auf, nimmt ihm den Teller aus der Hand und trägt ihn zu dem bereitgestellten Eimer, in dem schon das Frühstücksgeschirr dümpelt. In drei Schritten ist sie beim nächstgelegenen Fenster, schiebt die Gardine eine Handbreit zurück.
»Sieh mal einer an! Da ist sie immer noch!« Ihr Zeigefinger bohrt sich gegen die Scheibe. Tatsächlich steht Eva Koch nur wenige Meter entfernt auf dem Gehsteig und ist gerade dabei, einem Kind die Nase zu wischen. Ein Mädchen, etwas älter als Gretchen, ungefähr fünf oder sechs Jahre alt. In einem Handkarren hockt ein zweites Kind. Noch jünger.
»Siehste! Kinder hat sie auch!«, triumphiert Gerrit. »Und kein Wort davon gesagt, das Luder!« Schon reißt sie das Fenster auf. »He, Sie! Sie haben nichts von den Kindern gesagt!«
Eva Koch richtet sich auf, schaut sich nach der Ruferin um, entdeckt sie am Fenster, das in Brusthöhe auf die Gasse weist.
»Nein«, antwortet sie zögerlich. »Ich wollte nicht, dass –« Sie unterbricht sich, schüttelt resigniert den Kopf.
»Falls die Rieger zurückkommt, müssen Sie raus«, kräht Gerrit zu ihr herüber.
»Ja, aber –« Fassungsloses Staunen.
»Wenn Sie erst rumdiskutieren wollen, überleg ich’s mir anders.«
»Aber nein!« Die Koch greift entschlossen nach ihrem Handkarren und setzt zum Wendemanöver an. Auf Gerrits Wink hin zieht sie den Karren am Haupteingang vorbei und durch ein Bogentor, muss hier erst ein provisorisches Zaungatter öffnen, es wieder hinter sich schließen. Sie durchquert den Innenhof, nimmt ihren Sohn auf den Arm, die Tochter bei der Hand, folgt Gerrit eine Hinterhofstiege hinauf. Da ihr keine Hand frei bleibt, muss sie auf den stützenden Handlauf verzichten und ihr Gleichgewicht durch präzise austarierenden Körpereinsatz wahren.
Oben angelangt, sperrt Gerrit die Tür auf, eine schlichte Holztür mit Z-förmiger Verstrebung, tritt ein und fordert die Frau mit einer knappen Kinnbewegung auf, ihr zu folgen. Eva Koch schiebt sich an ihr vorbei – mit dem Kind auf dem Arm ein etwas umständliches Unterfangen –, tritt zögernd über die Schwelle. Geflissentlich ignoriert sie die dumpfe Backofenhitze, die ihr entgegenschlägt. In Sekundenschnelle hat ihr zweckgerichteter Blick das Wesentliche erfasst: Licht, Luft, Schutz vor Regen, Wind und unliebsamen Mitbewohnern. Nun bleibt Zeit für die Details: gekälkte Backsteinwände, eine tiefgezogene Dachschräge zur Hofseite hin, ein winziges Fensterchen, durch das das Licht als gleißend heller, scharf umrissener Quader auf den Dielenboden fällt. Vor die Stirnwand ist ein Bett geschoben. Keine Klappliege, kein Lager aus Strohsäcken. Ein richtiges Bett mit einer richtigen Matratze. Gerrit kennt die Vorteile dieser Räumlichkeit.
»Recht so?«, erkundigt sie sich mit beabsichtigter Ironie.
Eva Koch wendet sich zu ihr um.
»Ich bezahle für das Zimmer«, sagt sie. Offenbar will sie erst gar keine Zweifel aufkommen lassen, was Gerrit zu schätzen weiß. »Vorausgesetzt natürlich, dass wir bleiben können.« Entschlossen stellt die Koch ihren Sohn auf die Füße, lehnt ihn gegen ihre Knie, um ihn am Umfallen zu hindern. Mit ihren frei gewordenen Händen greift sie in den Ausschnitt ihres Kleides, zerrt einen ledernen Brustbeutel hervor, tastet darin herum, zieht schließlich einen kleinen Gegenstand hervor, den sie der Hauswirtin auf offener Handfläche präsentiert.
»Ein Ehering«, konstatiert diese ohne Regung. »Etwa Ihrer?« Die Angesprochene schüttelt verneinend den Kopf. »Na, wenn das so ist.« Gerrit Mann greift zu. Der Ring wiegt schwer, man könnte glatt zwei daraus machen. Für eine neuerliche Eheschließung beispielsweise, zwischen wem auch immer. Mit Gold kann man nichts falsch machen. Sie lässt den Ring in ihre Tasche gleiten, nickt der jungen Mutter bestätigend zu.
Soll Hilda Rieger bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und falls sie doch zurückzukehren gedenkt, wird sie sich eben woanders umschauen müssen. Wohnraum auf Verdacht vorzuhalten, grenzt an Unmoral, wo doch die Not so groß ist! Da soll ihr mal einer kommen.
»Wasser gibt’s an der Pumpe im Hof. Strom immer dann, wenn alle welchen kriegen. Den Schlüssel lass ich in der Tür stecken.« Mit diesen Informationen lässt sie es vorerst bewenden und stapft schon wieder die Stiege hinunter. Eine gute Tat am Tag ist genug.
3.
Eva wartet noch einen Moment ab, dann schließt sie die Tür hinter sich. Sie ist schweißgebadet, und ihr Atem geht schnell, wie nach einer großen Anstrengung. Und doch ist da eine plötzliche Freude, ein regelrechtes Triumphgefühl.
»Was sagst du dazu, Norbertchen?« Sie nimmt ihren Sohn wieder hoch und lässt ihn mit Schwung auf das Bett plumpsen, auf das weiche, federnde. Das Kind quietscht vor Wonne, und sie lacht über sein Behagen.
»Mama?« Ihre Tochter Martha zupft an ihrem Rock und schaut mit großen Augen zu ihr auf. »Wohnen wir jetzt hier?«
»Hier wohnen wir jetzt«, bestätigt Eva, und ihre Augen glänzen vor Stolz. »Eine Zeit lang zumindest«, schränkt sie dann doch ein. Man kann ja nie wissen.
Auch Martha hüpft nun auf das Bett wie ein Hündchen. Der kleine Norbert federt hoch, kippt zur Seite, giggelt und gluckst. Eva setzt sich zu ihm, lässt sich rückwärtsfallen, streckt die Arme von sich. Dieses anschmiegsame Einsinken, ein herrliches Gefühl. Im Luftschutzkeller gab es nur harte Holzbänke, im Bunker dann die typischen Stockbetten, jede Etage mit jeweils zwei Strohsäcken ausgestattet; drei, wenn man Glück hatte. Die Betten mitsamt den Säcken waren von den Bunkern geradewegs in die Notunterkünfte gewandert, stinkend, durchwanzt, verlaust. Wie oben in der Burg.
Am liebsten würde sie sich sofort in dieses Bett legen, richtig hineinlegen, darin einsinken und in einen Schlaf des Vergessens fallen. Bis der Albtraum vorbei wäre. Bis das Wort Frieden seine Bedeutung verdiente. Sie schließt kurz die Augen, streicht über die Bettdecke, kühles Leinen, von fleißigen Händen gewebt. Fürs Weben hat sie sich nie interessiert. Handarbeiten waren ihr schon immer verhasst, aber hier, in diesem Moment, wünscht sie sich die Fähigkeit, mit eigenen Händen etwas so Wunderbares wie diese Sommerdecke erschaffen zu können. Der Gedanke entzückt sie regelrecht. Es muss die Erleichterung sein nach all den Strapazen der letzten Tage und Wochen. Wochen und Monate. Monate und Jahre, wenn man’s genau nehmen wollte.
Eva öffnet die Augen wieder, setzt sich auf, lässt ihren Blick nochmals durch den Raum schweifen. Bett, Nachttisch, Stuhl. Auf dem Nachttisch eine Waschschüssel. Eine Kiste für Kleidung. Sie nickt zufrieden.
»Stell dir vor, sogar einen eigenen Eingang haben wir«, murmelt sie. »Ein Anbau nach hintenraus; im Parterre hausen Ziegen. Ich hab sie noch nicht gesehen, aber ich kann sie riechen.« Sie kichert leise. »Du siehst, mein Schatz: Wir schlagen uns wacker.«
»Was hast du gesagt, Mama?« Martha, die gerade Schneeengel auf der kühlen weißen Leinendecke gespielt hat, wälzt sich nun herum, das Kinn auf ihre kleinen Fäuste gestützt, und mustert sie fragend.
»Ach, nichts«, wehrt Eva ab. Sie muss sich abgewöhnen, laut mit ihrem Mann zu reden. Er ist Tausende Kilometer weit weg, irgendwo im Ural oder in Sibirien, so genau weiß sie es nicht. Weit genug entfernt jedenfalls, dass er sie nicht hören kann, das steht allemal fest. Und doch: Es tut gut, auf diese Weise Verbindung zu ihm zu halten. Es schützt sie vor der Einsamkeit und hilft ihr gegen die lähmende Angst, dass er tatsächlich nicht heimkehren, womöglich gar nicht mehr am Leben sein könnte.
Allerdings müssen die Kinder diese Gespräche nicht unbedingt mitbekommen. Nur einen Satz erlaubt sie sich noch, spricht ihn sogar laut aus: »Du darfst stolz auf uns sein, Ferdi.« Und an Martha gerichtet, wiederholt sie es noch einmal: »Der Papa kann stolz auf uns sein.« Stolz ist sie vor allem auf sich selbst: Sie hat den Bombenterror überlebt und die Flucht, hat nun sogar eine Bleibe für ihre kleine Familie gefunden. Hier kann sie die Tür hinter sich schließen, hier lauert ihr niemand auf. Beim Gedanken an jenes Vorkommnis vor drei Tagen durchfährt sie erneut ein inneres Erschauern, trotz der Hitze. Dieser elende Kerl in der Burg. Besser gekleidet als die meisten, gar nicht bedürftig hat er ausgesehen. Höflich zunächst, gute Manieren vortäuschend. Hat sich als Kurt Schöntau vorgestellt. Sie weiß bis heute nicht, ob der Name stimmte. Er habe sie und die Kinder schon eine Weile beobachtet, behauptete er. Dort draußen, auf dem Vorplatz, unter den schattigen Linden, unter denen sie mit den Kindern die Nachmittage verbracht hatte. Ein Jammer, dass sie sich mit all dem Pack herumschlagen müsse. Das sei sicher eine große Belastung für eine Frau wie sie. Eine, die Besseres gewohnt war, implizierte das wohl, was wiederum auf ihn, der dies erkannt und zur Sprache gebracht hatte, ebenso zutreffen musste. Ein Gleich und Gleich, das sich gefunden hat. Aus diesem Grund wolle er ihr einen Vorschlag machen, kam er schnell zur Sache. Keine Angst, nichts Anrüchiges. Aber nicht hier, zwischen all den offenen Ohren. Zu viel Neid und Missgunst. Besser, die Sache unter vier Augen zu besprechen. Ob sie ein Stück mit ihm spazieren gehen wolle? Nicht weit, nur raus aus dem Trubel. Eine Sache von ein paar Minuten. Aber die Kinder … Ihre Kinder würden kaum bemerken, dass sie weg gewesen sei, beruhigte er sie und bot ihr seinen Arm an. Sie ging mit ihm durch den Park – der immer noch ein Park war trotz der ins Kraut geschossenen Buchsbaumhecken, der verwilderten Rasenflächen und der Gemüsebeete, die die Blumenrabatten ersetzten. Sie gingen weiter, auf eine Gruppe uralter Bäume zu. Er habe eine kleine Wohnung unterm Dach, fing er an. Nichts Besonderes, aber trocken und sauber. Dort könne sie mit den Kindern einziehen. Was sie davon halte? Er blieb stehen, ohne ihren Arm loszulassen, sah sie an. Doch in seinem Blick lag etwas, das nicht das Geringste mit seinen Worten zu tun hatte. Er würde sie auch gern mal zu einer Fahrt in seinem Cabriolet einladen, fuhr er fort. Die Welt aus den Fugen, aber er brüstete sich mit einem Cabriolet! Für wie blöd hielt er sie? Sie wich instinktiv zurück, er folgte ihr. Noch ein Schritt rückwärts, und sie prallte gegen einen Baumstamm. Hoppla. Unvermittelt beugte er sich vor und presste seine ausgestreckten Arme gegen den Stamm, rechts und links von ihrem Kopf.
Dann bohrte sich seine Zunge zwischen ihre Zähne, wie eine fette, feuchte, sich windende Schnecke. Er rammte sein Knie zwischen ihre Beine, zerrte an ihrem Rock. Sie rief um Hilfe – es waren Menschen in der Nähe –, es wimmelte von Menschen auf dem Gelände der Burg, aber da war niemand, der eingegriffen hätte.
Bei ihrer Rückkehr weinten die Kinder schon. Sie musste warten, bis sie eingeschlafen waren, und dann noch einmal eine Stunde vor dem Waschraum anstehen.
Diese Geschichte hat sie ihrem Ferdi nicht erzählt, und sie wird es auch niemals tun. Was soll er sich grämen.
Auch sie selbst will sich nicht länger grämen. Die Erinnerung beiseiteschieben, die Sache vergessen, das wird das Beste sein. Und wenn sie erst vergessen ist, dann hat sie nie stattgefunden.
Später am Nachmittag bringt Gerrit Mann, ihre neue Zimmerwirtin, einen Karton für die Sachen der vormaligen Mieterin. Viel ist es nicht, was diese Hilda zurückgelassen hat: eine Bürste. Einen hölzernen Kamm. Eine Garnitur Unterwäsche. Einen Büstenhalter mit ausgeleierten, sich zigfach windenden Trägern. Ein Paar Socken, beide löchrig. Strumpfhalter.
Neben der Waschschüssel liegt noch ihre Zahnbürste. Auch Zahnpasta. Echte Zahnpasta. Eva kann es geradezu spüren, das perlende Gefühl sauber geschrubbter Zähne, den frischen Mentholgeschmack. Die Versuchung ist groß, die Tube an sich zu nehmen, doch sie widersteht tapfer und legt sie zu den anderen Dingen in den Karton. Niemand soll ihr Diebstahl vorwerfen können. Nicht in diesem Haus.
Am Haken neben der Tür hängt eine Strickjacke. Echte Schafwolle und schön dick. Auch eine Versuchung. Aber wer braucht bei diesen Temperaturen eine Wolljacke? Eilig faltet Eva sie zusammen, legt sie obenauf und verschließt den Karton. Fertig.
»Mama, ein Hase!« Martha hat den Stuhl unters offene Fenster geschoben, um hinausschauen zu können. »Sieh doch mal!« Ihr Ton wird drängend. Eva tritt zu ihr und blickt über ihre Schulter hinweg in den Innenhof hinunter. Ein paar Hühner scharren dort im Staub, die bereits erschnupperten Ziegen – zwei an der Zahl – turnen auf einem Stapel ausgedienter Autoreifen herum. Nah der Mauer hockt ein braunes Kaninchen und knabbert am Löwenzahn, der sich durchs Pflaster gezwängt hat. »Ob wir ihn mal streicheln dürfen?«
»Demnächst vielleicht«, gibt Eva zur Antwort. »Und das ist kein Hase, sondern ein Kaninchen.« Sie hat ihren Blick bereits auf den Pritschenwagen gerichtet, der in diesem Moment röhrend und knatternd in den Innenhof einfährt. Gelbliche Qualmwolken steigen auf. Ein übel stinkender Holzvergaser. Das Karnickel schießt von der einen in die andere Ecke. Die Hühner stieben gackernd davon. Die Ziegen glotzen. Der Motor erstirbt, und Gerrit Mann steigt aus, jetzt in langen, derben Arbeitshosen. Sie knallt die Fahrertür zu und stapft zu dem großen Rolltor des gegenüberliegenden Gebäudes hinüber. Bevor sie es aufzieht, schweift ihr Blick noch einmal kurz über den Hof, und ihre Blicke treffen sich für Sekunden. Eva hebt die Hand zu einem verhaltenen Gruß, tritt dann schnell zurück, um ihre Zimmerwirtin nicht zu einer Reaktion zu nötigen. Falls eine Frau wie Gerrit Mann sich überhaupt nötigen lässt.
Das Norbertchen liegt noch immer auf dem Bett, gefällt wie ein Baumstamm und in tiefsten Schlaf gesunken. Sie tritt zu ihm und streicht über seine feuchten Schläfen, über das schweißverklebte Flaumhaar und die kleine Kuhle zwischen Hinterkopf und Nacken, in der die Haut so unfassbar weich und glatt ist.
Wenn es den Kindern gut geht, ist alles gut. Dann ist alles zu schaffen.
4.
Emil tritt in die Pedale, er hat es eilig. Noch eine Viertelstunde bis Mittag, bis dahin sollte die Sache geklärt sein. Möglich, dass auch andere davon Wind bekommen haben und bereits Pläne schmieden.
Im Rathaus sei noch eine Kiste Hakenkreuzfahnen aufgetaucht, hat Freddy Schüller ihm heute Morgen gesteckt. Das will er von seiner Mutter erfahren haben, die Sekretärin im Versorgungsamt ist. Die wiederum weiß es von Schildebach, dem Rathaus-Faktotum. Schildebach hat sich bei ihr beklagt, dass er sich nun mit der leidigen Sache herumschlagen müsse. Offenbar ist die Kiste beim Einmarsch der Amerikaner übersehen, folglich nicht vernichtet worden. Auch die Amis haben sie nicht entdeckt, nur eben jetzt Schildebach, als man ihn nach irgendwelchen verstaubten Grundbüchern in den Keller schickte. Regelrecht darüber gestolpert sei er. Zunächst war der Plan, sie am Rheinufer zu verbrennen – im Auftrag des Bürgermeisters, versteht sich. Aber bei der Hitze? Das würde doch sehr verdächtig riechen. Und der Bürgermeister und er, die würden dann auch sehr verdächtig riechen. Dabei könnten sie beide ja nun nichts für die vermaledeite Kiste, so Freddys Mutter. Bei Nacht und Nebel vergraben war ihr Vorschlag gewesen, aber dazu hat Schildebach sich noch nicht durchringen können. Ein Glück für Emil.
Was die Mutter daraus würde zaubern können! Daran hat er sofort denken müssen, als Freddy mit der Geschichte kam. Freddy hingegen hat das Potenzial nicht erkannt, sonst hätte er die Sache ja für sich behalten oder zumindest Ansprüche angemeldet. Emil weiß nur leider nicht, wem er sie noch auf die Nase gebunden hat, also Tempo. Mit klappernden Schutzblechen rattert er übers Pflaster der Krummgasse, umrundet die lange Schlange vor dem Milchladen, hebt kurz die Hand zum Gruß, als er Frau Schott unter den Wartenden entdeckt. Ein Stück weiter vorn erblickt er nun auch das hoch aufgeschossene Mädchen, das mit seiner Familie unterm Dach wohnt – Luise heißt sie –, schaut schnell wieder weg, als erfordere die Fahrt seine volle Konzentration. Nur noch ein paar Meter, dann hat er sein Ziel erreicht. Vor dem Rathaus kettet er sein Rad an, nimmt in zwei Sprüngen die Stufen, klopft beherzt an der ersten Tür, fragt nach Schildebach. Vermutlich in seiner Amtsstube im zweiten Stock, erfährt er von einer grämlich dreinblickenden Dame, und ihre Vermutung erweist sich als richtig. Emil wird hereingebeten.
»Schönen guten Tag, Herr Schildebach!« Ein angedeuteter Bückling erscheint ihm angemessen. Der alte Amtmann tut beschäftigt, schiebt einen Stapel Papier von links nach rechts, klopft die Seiten zusammen, schaut dann erst auf.
»Was führt dich zu mir, Junge?«
»Ein Mäuschen hat mir erzählt, es gäbe da eine Kiste Müll im Keller«, umreißt Emil ohne Umschweife das Problem, tut einen Atemzug, um das Gesagte wirken zu lassen, präsentiert dann auch gleich die Lösung. »Ich würde die Entsorgung übernehmen.«
»Du?« Schildebach beugt sich ein wenig vor und mustert ihn mit verschwommenem Blick.
»Ganz recht, Herr Schildebach. Ich kümmere mich um die Angelegenheit. Schnell und diskret.« Das Wort »diskret« hat er von seiner Mutter, die damit zum Ausdruck bringen wollte, ihre Kundschaft habe ein Anrecht darauf, dass außer ihr, der Schneiderin, niemand die Schmerbäuche, Kissenbrüste, Hängehintern oder sonstigen körperlichen Unvorteilhaftigkeiten zu sehen bekomme. Nötig geworden war diese Ansprache ein paar Mal, nachdem Emil, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, mit seinen Freunden Freddy und Willi ohne Vorwarnung durch die Nähstube geschossen kam, während seine Mutter gerade Maß nahm. Er hat schnell begriffen damals und begreift auch jetzt: Auf der aktuellen Beliebtheitsskala dürften Schmerbäuche und Hakenkreuzfahnen etwa gleichauf liegen.
»Jungchen, du scheinst mir ja ein ganz Fixer zu sein«, sagt Schildebach wohlwollend. Immerhin leugnet er nicht, dass es ein Problem gibt. »Aber die Angelegenheit kann ich dir nicht überlassen«, schränkt er dann doch ein und lehnt sich wieder in seinen Stuhl zurück. »Wie soll ich das erklären, wenn sie dich erwischen? Dass ich ein Kind mit der Sache beauftragt habe?«
»Es wird nichts zu erklären geben«, behauptet Emil vollmundig. »Sie gehen gleich zu Tisch, und wenn sie wiederkommen, ist die Kiste weg. Als wäre sie nie da gewesen.« Zur Unterstreichung seiner Worte schnippt er mit den Fingern wie ein Zauberkünstler. Der Amtmann sagt eine Weile nichts, zwirbelt nur nachdenklich an seinem Schnäuzer.
»Und wenn sie dich schnappen?«
»Dann hat ein dummes Kind einen noch dümmeren Diebstahl begangen.« Emil grinst.
»Der dich den Kopf kosten könnte«, ergänzt Schildebach.
»Ja, aber es ist mein Kopf.« Emils Grinsen wird noch breiter.
Schildebach scheint mit sich zu ringen. »Sag mir, Junge: Was willst du mit dem Zeug?«
»Vorkriegsware, beste Qualität«, antwortet Emil augenzwinkernd. »Die Weiber können sich die schönsten Kleider draus machen.«
»Kleider …« Der alte Amtmann lässt von seinem Schnurrbart ab, räuspert sich. »Also gut. Vorausgesetzt natürlich, dieses Gespräch hat nie stattgefunden.«
»Sie haben mein Wort«, verspricht Emil feierlich.
»Pah!«, macht Schildebach nur, als wäre das Wort eines Jungen nichts wert.
Zehn Minuten später befindet er sich auf dem Weg nach Hause, wo das Mittagessen auf ihn wartet, und Emils Entsorgungsaktion ist in vollstem Gange. Eilig stopft er die Flaggen in den Sack mit der Aufschrift REINIGUNG, den seine Mutter mal in der Wäscherei Mischke hat mitgehen lassen, als sie noch dort gearbeitet hat.
Mit dem prall gefüllten Sack spaziert er zum Haupteingang hinaus, spannt ihn mittels Gurt am Gepäckträger seines Fahrrads fest und radelt los. Wieder geht es durch die Krummgasse, vorbei an Grundemanns Kolonialwarenladen, in dem es statt Bohnenkaffee, edlen Gewürzen und feinen Pralinen nur noch Schmierseife, Vierfruchtmarmelade und Muckefuck zu kaufen gibt. Während Emil über Kopfsteinpflaster rollt, muss er dem Sack mit einer Hand zusätzlich Halt geben. Erneut passiert er die Warteschlange vor dem Milchladen, grüßt abermals die Schott, schaut an Luise vorbei, überlegt kurz, ob er nicht doch den Umweg über den weniger frequentierten Burgpfad hätte nehmen sollen. Aber nein, was soll schon passieren?
Bereits wenige Minuten später schleppt er seine Beute die Treppe im Krug hinauf und in das Zimmer, das er sich mit seiner Mutter teilt. Vor ihren staunenden Augen stülpt er den Sack um und leert dessen wertvollen Inhalt auf dem Fußboden aus.
»Schöne lange Bannerfahnen«, lobt er in lockerem Ton, um dem erschrockenen Blick der Mutter entgegenzuwirken. »Solche, wie sie früher im Bürgersaal die Wände runtergehangen haben.« Er bückt sich und breitet die Fahnen aus. »Viel Rot dran, wie du siehst. Wenn du den Mittelteil rausschneidest …«
Die Mutter braucht einen Moment, um sich zu fangen, kniet sich dann hin, befühlt den Stoff. »Das war noch Qualität«, haucht sie seufzend.
»Vorkriegsware eben«, bemerkt Emil altklug und freut sich an ihrem Mienenspiel, das mehr und mehr ins Verzückte gleitet. Wenn sie ein feines Stück Stoff in der Hand hält, ist sie wie ausgewechselt. Dann ist sie wieder die Person, die sie früher einmal war. Das Gegenteil von verträumt und weggetreten. Wach, zupackend, fleißig. Es ist wie ein Aufwecken, als brächte die Schneiderei sie ins Leben zurück. Als wären Tuche, Garne und Borten, Knöpfe und Pailletten ihre Medizin.
»Den Mittelteil könntest du in Streifen schneiden und uns daraus einen Trennvorhang nähen«, schlägt er vor, denn nach einem solchen Sichtschutz zwischen ihrer und seiner Zimmerhälfte sehnt er sich schon lange. Die Mutter will sehen, was sich machen lässt, und damit gibt er sich vorerst zufrieden. Wenn sie nicht Nein sagt, lässt sich fast immer was machen.
Fehlt nur noch das Garn, sie braucht es nicht extra zu erwähnen. Er weiß, was sie zum Nähen benötigt. Also auf zur Witwe Gutenkorn in die Bachstraße. Emil schaut auf die Küchenuhr. Gleich eins. Möglicherweise noch ein bisschen früh, falls die Alte sich hingelegt hat. Vielleicht ist sie aber auch schon auf, er wird sehen. Leise tappt er die Treppe hinunter, um die Mittagsruhe der alten Frau Mewes nicht zu stören. Aber noch wichtiger ist ihm, dieser Gerrit Mann nicht über den Weg zu laufen. Der fällt immer etwas ein, was er erledigen soll. Und das meist sofort.
Vorsichtig öffnet er die Haustür und späht nach draußen. Mist. Sie steht neben einem Kübelwagen im Hof, einen schweren Schraubendreher in der Hand. Ohne sie aus den Augen zu lassen und gleichzeitig darum bemüht, ihren Blicken zu entgehen, schleicht er sich aus dem Haus.
»Hoppla!«, ruft plötzlich jemand, und er fährt herum. Vor ihm steht das Mädchen von oben. Luise. Um ein Haar wäre er mit ihr zusammengeprallt.
»Hoppla!«, äfft er sie nach, seinen Schrecken überspielend, fügt dann aber versöhnlich hinzu: »Du bist Luise, oder?« Luise nickt und presst dabei den kleinen Laib Brot so fest gegen ihre Brust, als bestünde Gefahr, er könnte ihn ihr entreißen. »Luiiiiiiise«, wiederholt er grinsend, als läge irgendeine Anzüglichkeit in ihrem Namen.
»Blödmann!« Sie schiebt sich schnell an ihm vorbei und verschwindet im Haus.
Immerhin ist die Witwe Gutenkorn schon auf den Beinen. »Mittag ist bei mir um halb zwölfe«, klärt sie Emil auf. »Danach wird geruht. Aber nur eine Stunde, sonst komm ich nicht mehr hoch.« Ihm kommt ihr kurzer Schlaf sehr entgegen.