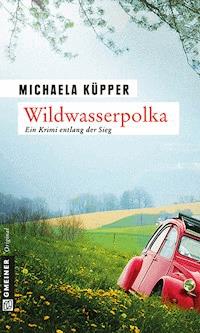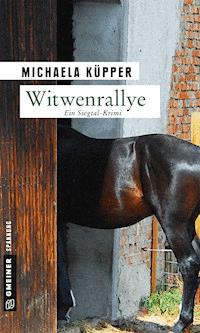
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektivin Johanna Schiller
- Sprache: Deutsch
Privatdetektivin Johanna Schiller hat den Auftrag, die abtrünnige Frau von Exbankräuber Krämer aufzuspüren. Schnell hat sie Erfolg. Doch am Morgen nach dem Wiedersehen ist Krämer tot. War die Aufregung zu viel für sein krankes Herz? Bald hat Johanna eine andere Spur. Krämer erhielt von seinem Bruder kurz vor dessen Tod einen Brief mit dem Hinweis, wo sich die Beute aus dem gemeinsamen Überfall befindet. Ein Motiv für die jungen Witwen der Brüder? Eine wilde Schatzsuche durch das Rheinland beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michaela Küpper
Witwenrallye
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2015
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Francesca Schellhaas / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4792-1
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
0. Kapitel
»Im nächsten Monat hätten wir unseren 13. Hochzeitstag gefeiert, ist das nicht furchtbar?« Für einen Moment wendet sie mir ihr spitzes, blasses Fuchsgesicht zu, um gleich wieder den Blick zu senken.
»Ich dachte, Sie wollten sich scheiden lassen«, wage ich einzuwenden und fahre mit dem Zeigefinger das winzige Rosenmuster der Tischdecke nach. Draußen hupt jemand, ein LKW rollt an, ein Moped knattert, der morgendliche Berufsverkehr hat längst eingesetzt. Durch das halb geöffnete Fenster weht ein Luftzug herein und bauscht die lindgrünen Vorhänge. Er trägt mir einen Geruch nach Babycreme zu, der von ihr ausgeht. Und den von etwas Likörartigem.
»Er war ein wunderbarer Mensch, ein ganz wunderbarer Mann«, sagt sie plötzlich in einem brüsken, beinahe trotzigen Ton, als müsse sie ihn verteidigen, und ich bin mir nicht sicher, ob sie meine letzte Bemerkung gehört hat.
»Aber mit ihm zusammenleben wollten Sie nicht mehr. Immerhin sind Sie zu Hause ausgezogen.« Eine Feststellung, ruhig und sachlich vorgetragen.
Sie schaut auf, und jetzt bleibt ihr Blick an mir haften. »Warum sagen Sie das?«, fragt sie scharf. »Was wollen Sie überhaupt? Ich muss nicht mit Ihnen reden.«
Nein, das muss Sie nicht. Aber sie braucht auch nicht zu lügen. Über niemanden wird mehr gelogen als über frisch Verstorbene. In den Todesanzeigen wimmelt es von wunderbaren Menschen, da fragt man sich doch, was aus den ganzen Arschlöchern wird, die das Zeitliche segnen. Und wenn wir ehrlich sind, spricht vieles dafür, dass ihr Gatte zu letzterer Kategorie gehörte.
Okay, ich geb’s zu: Ich habe schlechte Laune; die letzte Nacht ist mir gehörig auf die Stimmung geschlagen. Ich stehe auf und hole mir den Rest Kaffee aus der Kanne, obwohl er übel nach Lakritz schmeckt, aber ich brauche das Koffein.
»Wir haben uns geliebt, trotz allem«, beharrt sie in fast kindlichem Tonfall. »Wir wollten es noch einmal miteinander versuchen. Weil wir zusammengehören. Weil wir doch gesagt haben: bis dass der Tod uns scheidet.«
Und der kam überraschend plötzlich, denke ich. Für eine Nacht sehen sie sich wieder, und prompt ist er hinüber.
Sie beginnt zu weinen. Ich wundere mich einmal mehr. Wenn das Schicksal einen von beiden ereilen soll, dann sie, hätte ich gestern noch gewettet. Aber jetzt sitzt sie quicklebendig vor mir, und mein Auftraggeber ist tot. Ein unvorhergesehener Umstand, der Fragen aufwirft – beispielsweise die, wer nun eigentlich meine Rechnung begleicht. Muss eine Ehefrau, deren Gatte eine Detektei beauftragte, sie zu beschatten, nach dessen Ableben für die erbrachte Dienstleistung aufkommen? Mich überkommt die finstere Ahnung, dass ich diesen Fall unter der Rubrik »shit happens« ablegen kann. Und dabei hatte alles so gut angefangen …
1. Kapitel
»Frau Schiller, nicht wahr? Schön, dass Sie gekommen sind.« Wenz empfängt mich im gepflasterten Innenhof des Reitstalls Röcklingen, sein Händedruck lässt den Landwirt erkennen. Ich nicke und lächle, weil Nicken und Lächeln gut ist, wenn man mit einem neuen Klienten warm werden will. Oder muss. »Es geht um Ihr verschwundenes Pferd?«
»Genau. Wie ich schon am Telefon sagte: Dieser Kerl hat Stjörnugnýr einfach mitgenommen, letzten Dienstag, also vor drei Tagen.«
»Und Sie wissen, wer es war?«
»Im Prinzip schon. Er hatte ja vorher Linda gekauft, das andere Pferd, aber das wollte er dann offenbar …«
Stopp. So geht das nicht. »Entschuldigen Sie bitte, aber ich komme nicht ganz mit«, unterbreche ich ihn. »Wir sollten besser noch einmal von vorn anfangen, bei den grundsätzlichen Dingen.«
»Wie Sie meinen.«
Die grundsätzlichen Dinge sehen so aus: Reinhard Wenz besitzt einen Reitstall in Windeck-Röcklingen, den er zusammen mit seiner Frau Inka führt. Inka ist ausgebildete Reitlehrerin und leitet den Unterricht, er kümmert sich vor allem um den Hof. Die Wenz’ besitzen zwölf Schulpferde, hinzukommen etwa 15 Einstellpferde und vier weitere Tiere, die sie ausschließlich privat reiten. Gestohlen wurde ein vierjähriger Islandwallach mit dem nahezu unaussprechlichen Namen Stjörnugnýr, ein wertvolles Tier, aber nicht das wertvollste im Stall. Für die Zucht ist er logischerweise ungeeignet und als Reitpferd bislang nur bedingt tauglich, da er noch nicht ganz eingeritten ist. Auch das mindert den Marktpreis, wie mir Wenz erklärt. Allerdings besäße das Pferd gute Anlagen zu Tölt und Pass, den speziellen zusätzlichen Gangarten der Isländer, weshalb es zukünftig vielleicht einmal zu einem guten Rennpferd heranreifen würde.
»Kann das der Grund für den Diebstahl gewesen sein?«
Wenz zuckt die Achseln. »Wenn ich das wüsste.«
»Waren Sie bei der Polizei?«
»Ja, klar.«
»Und?«
»Die kümmern sich drum.«
»Wieso wenden Sie sich dann an mich, wenn ich fragen darf?«
»Die Polizei hat viel zu tun«, meint Wenz unbestimmt und kickt ein Steinchen beiseite. »Stjörnugnýr ist das Lieblingstier meiner Frau, verstehen Sie?«
»Ich verstehe. Allerdings glaube ich nicht, dass ich viel für Sie tun kann. Sie kennen den Täter, und in diesem Fall scheint mir die Polizei der beste Ansprechpartner zu sein.«
»Wer sagt, dass ich ihn kenne?«, widerspricht Wenz. »Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Die Kaufpapiere hat er unterschrieben mit Carsten Vogel, aber das ist offenbar nicht sein richtiger Name, sagte mir die Polizei.«
»Also hat er das Pferd gekauft, aber nicht bezahlt?«
»Nein. Er hat Linda gekauft, eines unserer Schulpferde, aber Stjörnugnýr hat er mitgenommen.«
»Eine Verwechslung vielleicht?«
»Eine Verwechslung?« Wenz schnaubt verächtlich. »Linda ist ein Englisches Reitpony, eine Fuchsstute, und Stjörnugnýr ein schwarzes Islandpferd. Da ist eine Verwechslung wohl ausgeschlossen. Außerdem hat der Kerl ja zuerst Linda in den Hänger geladen.«
»Und wie ist er dann an Stjörn… äh …« Der Name will mir einfach nicht über die Lippen. »Wie ist er an das Islandpferd gekommen?«
»Er hat den Wallach unbemerkt von der Weide geholt.«
»Es fehlen also beide Tiere?«
»Nein. Linda hat er dagelassen. Die stand abends auf der Koppel, dafür war Stjörnugnýr weg.«
Was für eine verworrene Geschichte. »Hat er gesagt, für wen er das Pferd kaufen wollte?«, frage ich.
»Ja, es sollte für seine Tochter sein. Er meinte, er suche ein braves, zuverlässiges Tier für sie, weil sie Reitanfängerin sei.«
»War sie Schülerin hier, die Tochter?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Sie glauben nicht? Hat er denn einen Namen genannt?«
Wenz runzelt unwillig die Stirn. »Ja, irgendeinen Vornamen, aber den weiß ich nicht mehr.« Er bemerkt meinen skeptischen Blick. »Hören Sie, hier springen an die hundert Mädchen herum, die kann man sich nicht alle merken.«
»Sie wissen also nicht, wie Ihre Schülerinnen heißen?«
»Nee. Doch. Meine Frau, die schon.«
»Kann die sich vielleicht erinnern?«
»Nein. Sie war ja nicht dabei.«
»Also gut. Er wird vermutlich nicht die Wahrheit gesagt haben, sonst wäre es zu einfach, ihm auf die Spur zu kommen. Und gezahlt hat er sicher auch nicht?«
»Doch, in bar.«
Die Antwort überrascht mich. »Dann haben Sie ja immerhin Ihr Geld erhalten. Oder einen Teil des Geldes.«
Wenz zieht ein Gesicht, als hätte ich das Gegenteil behauptet. »Es geht mir nicht ums Geld«, sagt er säuerlich, »es ist das Lieblingstier …«
»… Ihrer Frau, ich weiß. Sind Sie ihm nur dieses eine Mal begegnet? Dem Dieb, meine ich?«
»Nein, er war schon einmal da. Vor zwei, drei Wochen tauchte er auf und erzählte, dass er ein Pferd für seine Tochter suche, und dabei hat er auf Stjörnugnýr gezeigt. Ich dachte, das sei ein Zufall, weil Inka ihn gerade in diesem Moment über den Hof führte. Ich habe ihm gesagt, der Rappe sei zu jung für ein Kind und noch nicht ganz eingeritten. Außerdem sei er nicht verkäuflich. Der Typ hat dann noch ein bisschen herumgeredet und gefragt, ob es am Preis läge, aber ich habe ihm erklärt, da sei nichts zu machen, das Pferd wäre ohnehin denkbar ungeeignet für seine Zwecke. Stattdessen habe ich ihm Linda vorgeschlagen.«
»Warum dieses Tier?«
»Sie ist lammfromm und gut zu reiten. Weich in den Gängen, willig, fleißig.«
»Und was ist nicht so toll an ihr?«
»Wie meinen Sie das?«
»Wie ich’s gesagt habe. Sie werden ja wohl nicht ohne Not Ihr bestes Pferd im Stall weggeben.«
Wenz druckst ein wenig herum. »Linda ist nicht krank, falls Sie darauf hinauswollen, aber sie ist nicht mehr die Jüngste – was für einen Reitanfänger nur von Vorteil ist. Später kann man dann immer noch auf ein temperamentvolleres Pferd umsteigen.«
Ich nicke. »Hatte der Mann Ahnung von Pferden?«
»Nicht die Spur.«
»Wenn man keine Ahnung von etwas hat, das man kaufen möchte, nimmt man dann nicht jemanden mit, der sich auskennt?«
»Das fragen Sie mich?«
»Wen sonst?«
»Tja, vernünftig wäre das. Aber er hat’s nicht gemacht. Er war allein. Außerdem haue ich niemanden übers Ohr.«
»Vielleicht hat er das gewusst«, sage ich lächelnd. »Und er hat keine Adresse angegeben?«
»Doch. Die existiert sogar, das habe ich schon nachgeprüft. Nur wohnt er dort leider nicht. Und dieser Carsten Vogel auch nicht.«
»Wo wohnt er denn angeblich?«
»In Sankt Augustin.«
»Ist ja nicht weit weg.«
»Wenn’s stimmen würde.«
»Sein Wagen?«
»Ich habe nicht darauf geachtet. Ein dunkler Van. Er parkte so, dass er mit dem Hänger zum Hof stand.«
»Und dieser Anhänger?«
»NR-Kennzeichen, mehr weiß ich nicht. Geliehen, sagte er. Dabei habe ich mir nichts gedacht, es hat schließlich nicht jeder einen eigenen Hänger.«
Ob er mir die Weide zeigen könne, auf der der Isländer gestanden hat, frage ich. Wenz führt mich über den gepflasterten Hof, vorbei am Wohnhaus und den Stallgebäuden. Wir passieren eine Gasse zwischen den Stallungen, die zum rückwärtigen Teil des Anwesens führt. Vor uns liegt jetzt ein offener Reitplatz mit Sandboden, in dessen Mitte eine stämmige Blondine steht und einen noch stämmigeren Haflinger longiert. Als sie uns sieht, hebt sie die Hand zum Gruß.
»Meine Frau«, erklärt Wenz und winkt kurz zurück. Wir gelangen zu einem Holztor, das auf die Koppeln hinausführt. Er öffnet das Gatter, und wir schlüpfen hindurch. Das Gras trieft vor Nässe, obwohl es nicht geregnet hat, doch die Nacht war kalt und feucht. Im Nu sind meine Leinenturnschuhe vollkommen durchgeweicht. Wir wandern weiter durch frühlingsfrisches, saftiges Grün, weg vom Hof. Auf einem Stück Wiese, das offenbar länger brachliegt, blühen Wolken zartvioletten Wiesenschaumkrauts, unterbrochen von leuchtend gelben Sumpfdotterblumen. In der Ferne glitzert die Sonne auf dem Wasser der Sieg. Die Koppeln liegen genau im Bogen einer engen Schleife, die der Fluss oberhalb von Röcklingen zieht, und werden von dieser begrenzt.
Wenz hakt einen der Elektrozäune aus, die das Gelände umfassen, lässt mich hindurch und schließt ihn wieder. Er deutet in nordwestliche Richtung, zum Ende der Weide, neben der ein kleines Sträßchen oder ein Feldweg verläuft. »Stjörnugnýr stand dort hinten mit den Schulpferden, die an dem Tag nicht mehr ranmussten. Meine Frau hatte ihn vormittags noch geritten.«
Ich will seinem Blick folgen, werde aber abgelenkt. Hinter einem Weißdorngebüsch zu unserer Linken taucht ein großes graues Pferd auf und trabt zielstrebig auf uns zu.
»Das ist John-Boy«, erklärt Wenz freundlich und streckt die Hand nach dem Tier aus. »Der will bloß sehen, ob wir ein Leckerchen für ihn haben.«
»Er sieht aus, als wollte er uns fressen.« Ich trete vorsichtshalber einen Schritt zurück. Nach meinem unfreiwilligen Ritt vor einiger Zeit sind mir Pferde nicht mehr geheuer, nicht einmal die mit einem Stockmaß unter einem Meter zehn. Und dieser John-Boy liegt eindeutig darüber. Wenz lacht und klopft dem Tier freundschaftlich den Hals. Ich deute auf das ungefähr 50 Meter entfernt liegende Tor im Zaun, hinter dem sich das Sträßchen befindet.
»Dürfte kein großes Problem gewesen sein, Stjörni … das Pferd hier herauszuholen.«
»Wenn man das Vorhängeschloss knackt, mit dem das Tor gesichert ist, dann nicht«, meint Wenz. John-Boy im Schlepptau, wandern wir auf die Stelle zu. Ich besehe mir die Sache aus der Nähe und schieße ein paar Fotos. Ob es in der Vergangenheit ähnliche Vorkommnisse gegeben habe, will ich wissen. Wenz verneint dies. Weder bei ihm noch bei anderen, soweit ihm bekannt sei. Wir machen uns auf den Rückweg.
»Könnte Rache das Motiv gewesen sein?«, frage ich und weiche einem Maulwurfshügel aus. Wenz hält das für wenig wahrscheinlich.
Als wir wieder auf den Hof gelangen, kommt ein kleines, zartes Mädchen mit einem großen, speckigen Schimmel am Führstrick auf uns zu. Ich trete drei Meter zurück, was Wenz grinsend zur Kenntnis nimmt. »Sie haben was gegen Pferde, oder?«
»Ooch …«
»Sie sollen Stjörnugnýr ja nur finden, keine Turniere mit ihm reiten.«
»Da bin ich froh, Herr Wenz, Sie haben mich überzeugt. Also machen Sie mal die Liste fertig.« Er sieht mich verständnislos an. »Eine Liste aller Mädchen beziehungsweise Personen, die bei ihnen reiten oder sich sonst wie hier vergnügen.«
Wenz macht ein Gesicht, als sei das eine nahezu unlösbare Aufgabe. »Die kommen und gehen«, versucht er sich herauszureden.
»Aber Sie werden doch irgendwo festhalten, wer in welchem Kurs ist?«
Er gibt sich geschlagen und nickt. »Brauchen Sie auch die, die nicht mehr kommen?«
»Gerade die«, antworte ich, und jetzt ist das Grinsen an mir.
2. Kapitel
Ein neuer Fall. Zwar geht es um ein Pferd, und Pferde sind nicht meine Lieblingstiere, aber das Pferd ist nur Ermittlungsgegenstand, denn es ist verschwunden – ergo nicht in meiner Nähe. Wichtiger ist derjenige, der es hat mitgehen lassen. Kein Wühlen in fremden Betten, kein Kaufhausmief, keine zugigen Schwarzarbeiterbaustellen – dafür nehme ich zur Abwechslung sogar Huftiere in Kauf. Also frisch ans Werk, und das bedeutet wie immer: Herbert anrufen, meinen überaus geschätzten freien Mitarbeiter, den Expolizisten mit Rückenproblemen, aber topfittem Hirn, nicht zu vergessen seine exzellenten Beziehungen, ohne die ich oft einpacken könnte. Ich schildere Herbert den Stand der Dinge und bitte ihn, nach einem gewissen Carsten Vogel zu forschen, also jenem Namen, mit dem der Pferdedieb den Kaufvertrag für Stute Linda unterschrieben hat. Ich schätze, dabei kommt nicht viel heraus, aber irgendwo muss man ja anfangen. Wir plaudern noch ein Weilchen über Magenprobleme, die Herberts Frau Helga seit Wochen quälen, und ich empfehle Ingwertee, weil ich das immer tue, egal, um welches Leiden es sich handelt. Nachdem ich aufgelegt habe, lehne ich mich zurück und betrachte das Foto von Stjörni-Dings, das Wenz mir gegeben hat. Ich habe es auf dem Kopierer vergrößert und direkt neben meinen Schreibtisch an die Bürowand gepinnt. Mir kommt Black Beauty in den Sinn, dieser unsterbliche, Fleisch gewordene Pferdetraum aller jungen Mädchen. Auch Stjörni-Dings ist ein Rappe mit einem kleinen weißen Stern auf der Stirn, allerdings war Black Beauty kein Islandpony. Aber vielleicht wäre er eines, würde die Geschichte heute geschrieben, überlege ich, auch Pferderassen unterliegen nun einmal Moden. Wenn der Dieb es auf Stjörni-Dings abgesehen hat, warum hat er ihn dann nicht gleich gestohlen, warum der Umweg über das andere Pferd? Und warum hat er Geld gezahlt? Er hätte es leichter gehabt, wenn er das Tier einfach bei Nacht und Nebel von der Koppel geholt hätte, und hätte sich dabei zudem einem weit weniger großen Risiko ausgesetzt, selbst identifiziert zu werden. Apropos identifizieren: Wenz hat mir gesagt, Stjörni habe ein Brandzeichen auf der Hinterhand und sei gechipt. Der Täter hat natürlich keine Papiere für ihn: keinen Equidenpass – eine Art Ausweis für Pferde –, nicht einmal die Eigentümerurkunde. Dies alles macht es schwer, das Tier weiterzuverkaufen. Es sei denn, es steckt große kriminelle Energie dahinter, und der Dieb schreckt nicht davor zurück, Papiere zu fälschen, womöglich das Brandzeichen zu überbrennen und so weiter. Das alles passt wiederum nicht zu der Art und Weise, in der der Diebstahl erfolgt ist. Einerseits wirkt er raffiniert und dreist, andererseits alles andere als professionell. Vielleicht doch eine eher persönliche Geschichte zwischen Wenz und Wer-weiß-wem?
Stjörni ist letzten Dienstag verschwunden, am helllichten Tag, gegen 16 Uhr. Es war sonnig und trocken gewesen, wie ich mich erinnere. Das ideale Wetter, um ein paar Schritte vor die Tür zu wagen. Genau wie heute. Ich beschließe, noch einmal nach Windeck zu fahren und Ausschau nach möglichen Zeugen zu halten.
Diesmal parke ich nicht auf dem Wenz’schen Anwesen, sondern ein Stück davor, am Ende einer Häuserzeile, die an das Wiesengelände grenzt. Gemächlich schlendere ich die Straße entlang in der Hoffnung, möglichst vielen Leuten zu begegnen, aber es herrscht tote Hose. Gut, Röcklingen ist nicht New York City, nicht mal Siegburg nach Geschäftsschluss, aber das hier … Dann treffe ich doch noch auf Menschen. Sie wisse von dem Diebstahl, erklärt mir eine junge Frau mit Buggy, als ich ihr das kopierte Foto von Stjörni zeige, aber leider könne sie überhaupt nicht helfen. Das kann auch eine ältere Dame nicht, die ich beim Fensterputzen antreffe, ebenso wenig wie ihr Gatte, der gerade von einem Spaziergang mit dem Hund heimkommt. Die Mittvierzigerin, die ich anspreche, als sie gerade in ihr Auto steigen will, hat ebenfalls nichts mitbekommen. Dito der Junge, der ein Blättchen austrägt. Meine Hoffnung, hier könne irgendjemand irgendetwas gesehen haben, ist nach 30 Minuten beträchtlich gesunken. Ich kehre um und registriere in einiger Entfernung einen alten Mann, der zu mir herüberblickt. Als ich näherkomme, wendet er sich ab und schlendert vor mir her die Straße hinunter. Ich folge ihm, weil ich ohnehin in dieselbe Richtung muss, hole ihn aber erst unmittelbar vor meinem geparkten Wagen ein. Höflich grüßend halte ich ihm Stjörnis Bild unter die Nase. »Haben Sie vielleicht von der Sache gehört, von dem Pferd hier, das gestohlen wurde?« Der Alte mustert mich sehr viel intensiver als das Foto. Ich versuche es anders. »Erinnern Sie sich, in der letzten Woche einen Wagen mit einem Pferdeanhänger gesehen zu haben?«
Noch immer ruht der Blick des Alten auf mir. Als ich schon glauben will, er könne gar nicht sprechen, antwortet er überraschend: »Schon möglich.«
»Möglich, aber nicht sicher?«, präzisiere ich.
»Kommt drauf an.«
Jetzt merke ich, dass er ein Spiel mit mir spielt. »Auf was kommt es denn an, wenn ich fragen darf?«
»Darauf, ob du eine Zigarette für mich dabei hast oder nicht, Liebchen.« Er grinst schelmisch.
»Tut mir leid, ich rauche nicht.«
»Ein Päckchen wäre noch besser.«
»Ich sagte doch, dass ich nicht rauche.«
»Aber es gibt Läden«, antwortet der Alte zuversichtlich. »Ich komme hier so schlecht weg, weißt du. Meine Schwiegertochter, die nimmt mich ja nirgendwo mit hin, das Luder.«
Wirklich ein pfiffiges Männchen, und ein sehr schlecht erzogenes. Kein Wunder, dass die ludrige Schwiegertochter keinen Bock auf seine Begleitung hat. Vermutlich hat der alte Zausel auch gar nichts von dem Pferdediebstahl gesehen oder es bereits wieder vergessen – ist ja schon länger als drei Tage her. Ich überlege, ob ich ihn einfach stehen lassen soll.
»Du meinst letzten Dienstag, Liebchen, nicht wahr?« In seinen wässrigen Augen blitzt es unvermittelt auf.
Bingo.
Er nickt wissend. Also gut. »In welcher Richtung ist der nächste Laden?«
Der Alte deutet nach Osten. »In Dattenfeld.« Ich öffne meine Wagentür und steige ein. »Da gibt’s auch ein Schnäpschen, für die Verdauung«, schiebt er grinsend hinterher, überaus zufrieden mit sich und der Welt. Genervt knalle ich die Tür zu.
In Dattenfeld kaufe ich das Gewünschte und frage mich, ob ich Kippen und Fusel von der Steuer absetzen kann. Im Recklinghäuser Lehrinstitut für private Ermittlungen, in dem ich ausgebildet wurde, gab es ein Seminar mit dem Titel »Der Detektiv als Unternehmer«, und eine Klausurfrage lautete: »Sind materielle Gefälligkeiten im Gegenzug für Auskünfte, die Sie von einem Informanten erhalten, steuerlich absetzbar?«
»Kommt drauf an«, war die richtige Antwort, umgangssprachlich übersetzt. Kommt drauf an, wie immer im Leben. Alles reine Verhandlungssache.
Als ich zurückkehre, ist der Alte nicht mehr da. Ich fürchte schon, dass der vor einer halben Stunde ausgehandelte Deal in die Hose gegangen ist, entdecke ihn aber ein paar hundert Meter weiter hinter den Wenz’schen Pferdekoppeln, auf jenem Sträßchen parallel zur Sieg, das auch der Pferdedieb genutzt haben muss. Der Alte möchte offenbar bei unserem konspirativen Treffen nicht beobachtet werden – genauso wenig wie ich. Ich steige ins Auto, fahre ihm nach und halte an. »Ich habe Ihnen die Zigaretten besorgt.«
»Nett von dir, Liebchen.« Er streckt die Hand aus.
»Erst eine Auskunft.«
Er streckt mir noch immer die Hand entgegen. Mit einem Seufzer reiße ich die Zellophanhülle auf und halte ihm die Packung hin. Feuer hat er selbst.
»Hier dreh ich immer meine Runden«, beginnt er, nachdem er den Rauch kräftig inhaliert und ihn noch kräftiger wieder ausgehustet hat. Er deutet das Sträßchen hinauf und malt mit der Hand einen großen Bogen am Siegufer entlang zurück in Richtung Dorf. »Letzten Dienstag war ich auch unterwegs, und da überkommt mich auf einmal ein Drang, wie soll ich sagen? Ich musste pissen«, behilft er sich selbst. »Ich also rechts ran, austreten. Da, hinter dem Gesträuch.« Er zeigt auf einen weiß blühenden Vogelbeerbusch wenige Meter vor uns. »In dem Moment kommt ein großer dunkler Wagen mit Hänger, der an dem Tor dort drüben an der Weide hält, und ein Mann steigt aus.«
»Kannten Sie ihn?«
»Also der Wenz war’s nicht. Ein bulliger Typ, breit wie ein Schrank und groß. Der macht sich an dem Tor zu schaffen mit einer Gerätschaft, zack, zack, und dann stößt er es auf. Ich hab mir nicht viel dabei gedacht, er hat ja auch gar nicht heimlich getan, eher so, als wär’s das Normalste der Welt. Dann hat er ein Pferd aus dem Hänger geführt und auf die Weide gebracht, ein Klaps auf den Arsch, und ab die Post! Danach geht der Kerl auf die Koppel und holt sich den kleinen schwarzen Zossen. Ich steh noch immer hinterm Busch, weil’s mir peinlich ist, ausm Unterholz zu brechen wie die Wildsau.« Der Alte grinst. Kaum zu glauben, dass ihm irgendetwas peinlich sein könnte. »Er zerrt das Pferd in den Hänger und hat es jetzt mächtig eilig«, fährt er fort. »Der Schwatte will erst nicht, und da wird der Kerl sickig, und das Pferdchen denkt sich wohl, mit dem leg ich mich besser nicht an, und schwups!, ist es drin. Klappe zu und weg. Hat alles keine fünf Minuten gedauert.« Mein Informant hält inne und sieht mich an, als warte er auf Applaus.
»Und die Geschichte haben Sie nicht zufällig irgendwo aufgeschnappt?«
Er hebt abwehrend die Hände. »Alles selbst erlebt, so wie ich hier stehe!«
»Und warum haben Sie niemandem davon erzählt?«
»Dir erzähle ich’s doch gerade, Liebchen. Sonst hat keiner gefragt. Wie sieht’s übrigens aus mit dem Schnaps? Der tät mir jetzt richtig gut.«
»Schau’n mer mal.« Ich entschließe mich zu einer kleinen Fangfrage. »Der Schimmel, den dieser Mensch aus dem Hänger geholt hat, den hat er einfach laufen lassen, sagten Sie?«
Der Alte runzelt die Stirn. »Von einem Schimmel weiß ich nichts. Ich habe nur diesen Fuchs gesehen, ein zierliches kleines Pferdchen, viel schöner als der schwarze Zossen, den er mitgenommen hat.«
»Die Geschmäcker sind halt verschieden«, antworte ich, reiche dem Alten die Schachtel Zigaretten und hole den Schnaps aus dem Wagen. Er dreht den Schraubverschluss auf, nimmt einen kräftigen Schluck und hält mir die Flasche hin. Ich sage nicht Nein.
»Du steckst was weg, wie ich sehe, Kindchen. Biste von der Polizei?«
»Nein. Ich bin Privatdetektivin.«
»Privatdetektivin, is’ ja ’n Ding! Ein Engel für Charlie, wie?« Er klopft mir auf die Schulter und verrät mir vor Begeisterung das Kennzeichen des Pferdetransporters. Das echte. Jenes unter dem falschen Kennzeichen, das der bullige Kerl flugs entfernt hat, bevor er sich mit Stjörni vom Acker machte. Mein Informant steckt Schnaps und Zigaretten unter seine Jacke, und ich wünsche ihm noch einen fröhlichen Nachmittag. Die Investition hat sich gelohnt, würde ich sagen, auch wenn das Finanzamt vielleicht anderer Meinung ist.
Ich fahre ein paar Kilometer weiter, parke irgendwo am Rande eines Waldwegs und rufe Herbert an. Seine Frau Helga ist am Apparat. Herbert drehe gerade seine Nordic-Walking-Runde, berichtet sie, wobei sie »Walking« sehr deutsch ausspricht. Sport auf Krücken wäre nichts für mich, erkläre ich und gebe Helga das Kennzeichen durch, das Herbert für mich prüfen soll. Der Höflichkeit halber erkundige ich mich nach ihrem Gesundheitszustand, empfehle Ingwertee und füge hinzu: »Der hilft auch beim Abnehmen.«
Nach dem Telefonat bringe ich den Fahrersitz in Liegeposition und lege die Füße aufs Lenkrad. Der Schnaps hat mich müde gemacht, ein Nickerchen wird mir guttun.
3. Kapitel
»Du hast Helga gesagt, sie soll abnehmen?« Denise klingt wenig begeistert. »Warum tust du das?«
»Weil sie sich dann bestimmt besser fühlt.«
»Sie soll sich besser fühlen, wenn du ihr sagst, sie sei zu fett?«
»Ich habe Helga nicht gesagt, sie sei zu fett, obwohl das der Wahrheit entspräche! Ich habe ihr Ingwer empfohlen, mehr nicht. Und jetzt beenden wir unser Damenkränzchen und kommen zur Sache. Es gibt einen neuen Auftrag.«
Denise sagt einen Moment lang nichts, doch schließlich siegt die Neugier. »Lass hören.«
Ich berichte ihr von dem Pferdediebstahl, schildere ausführlich die näheren Umstände der Tat, das Gespräch mit Wenz und später mit dem Alten. »Und, was hältst du davon?«
»Klingt nach einem Fall für ›Die drei Fragezeichen‹.«
»Sehr komisch! Du könntest ruhig erwähnen, wie geschickt ich die Sache angegangen bin. Ich hoffe, dass Herbert morgen oder übermorgen …«
»Mama, was heißt das?«, unterbricht mich Yannick, mein sechsjähriger Sohn.
»Ich telefoniere, Yannick. Denise, ich rechne damit, dass wir …«
»Was ist das für ein Buchstabe!?«, beharrt Yannick.
»Ich telefoniere.«
»Aber ich weiß nicht, was das heißt!« Bei meinem Kind bahnt sich mal wieder ein hysterischer Anfall an.
»Nun sag’s ihm doch«, schaltet Denise sich ein.
»Aber er soll nicht dazwischenreden, wenn ich geschäftlich telefoniere. Es reicht, dass er hier in meinem Büro hockt und meine Arbeitsmaterialien zerschneidet«, sage ich und wende mich Yannick zu: »Das ist ein Q.«
»Quuaaa-drooooooo…«
»Ich lasse morgen oder übermorgen von mir hören, Denise. Bis dann.«
»Alles klar. Ciao, Bella.«
»Qwa-droooooo-kooo…«
»Quadrocopter«, komme ich Yannick zuvor. In manchen Dingen habe ich einfach keine Geduld. »›Der Quadrocopter Cyklop X64100-i zeigt vollendete Flugeigenschaften, selbst bei ungünstigsten Witterungsverhältnissen‹«, lese ich vor. »›Die feingetunte Funkfernsteuerung erlaubt selbst schärfste Manöver. Der integrierte HD-Camcorder liefert hochauflösende Bilder von hervorragender Qualität mit einer sensationellen Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten. Das Ultra-Leichtgewicht mit den erstaunlich geringen Maßen von …‹«
»Was ist ein Quadrocopter?«, unterbricht mich Yannick.
»Dieses Ding hier, eine Art Hubschrauber, aber mit vier Rotoren, auf den Bildern kannst du’s sehen.« Ich deute auf die aufgeschlagene Seite in Mr. Q’s Secrets, meinem heißgeliebten Bestellkatalog für die Spionagebranche, den es seit Kurzem auch auf Deutsch gibt. Bereits seit einiger Zeit liebäugele ich mit der Kameradrohne, konnte mich allerdings noch nicht zum Kauf durchringen, da ich mich um die Geräuschentwicklung sorge. Das Ding ist zwar nicht größer als ein Spatz, aber sollte es wie ein echter Hubschrauber über zu observierendes Terrain donnern, ist mir damit wenig gedient. Der betagte Mr. Q, der mir von fast jeder Seite aus einer Art Luftblase heraus entgegenlächelt, verspricht zwar, dass der Cyklop X64100-i praktisch nicht zu hören ist, aber im Alter wird das Gehör bekanntlich nicht besser. Yannick betrachtet den Quadrocopter eingehend und greift zur Schere. Mein Katalog ist bereits reichlich zerfleddert.
»Warum malst du nicht ein schönes Pferdebild?«, schlage ich vor.
Yannick zuckt die Achseln und mahnt: »Du sollst dir noch mein Froschheft anschauen.«
Gut, dass er mich daran erinnert. Er reicht mir sein Heft, und ich blättere darin herum. »Sehr schön, sieht super aus«, lobe ich und will es ihm zurückgeben.
»Aber du sollst dir jede Seite ansehen«, krittelt Yannick, »ob alles richtig ist.«
»Es ist nicht gut für die kindliche Entwicklung, wenn Eltern dauernd nach Fehlern suchen«, wende ich ein. »Das nimmt Kindern ihr Selbstvertrauen.«
»Ich will aber nicht, dass Fehler drin sind«, bleibt Yannick stur. Also gut. Ich blättere weiter. Wann Herbert wohl mit Ergebnissen rausrücken wird? Und wird es überhaupt Ergebnisse geben? Der Alte kann sich auch ein falsches Kennzeichen gemerkt haben.
Als Herbert zwei Stunden später immer noch nichts von sich hören lassen hat, bestelle ich die Drohne.
Es ist bereits halb elf am nächsten Morgen, als er endlich anruft. Und er hat Neuigkeiten. Der Hänger ist auf einen gewissen Manfred Krämer zugelassen, ebenso wie ein Toyota Land Cruiser. Ein Privatmann, kein Fahrzeugverleiher also. Das passt zu meiner Hypothese, nach der der Dieb mit seinem eigenen Fahrzeug vorgefahren ist, es zur Tarnung jedoch mit falschen Kennzeichen ausstattete – er konnte ja nicht wissen, dass sie sich ohnehin niemand merken würde. Auf dem Heimweg, mit Stjörni im Gepäck beziehungsweise im Hänger, hat er die falschen Kennzeichen entfernt und ist mit den »echten« weitergefahren – ebenfalls nicht ahnend, dass sich ausgerechnet die jemand merkt.
Weit gereist ist Krämer nicht gerade, um sich seinen Traum vom eigenen Pferd zu erfüllen: Er ist in Hennef gemeldet, keine 20 Kilometer von Windeck entfernt, also quasi um die Ecke. Ich bin gespannt, ob ich Stjörni dort antreffen werde. Wie immer, wenn ich eine Fährte wittere, packt mich eine leichte Nervosität. Ich wähle Denise’ Nummer.
»Es kann losgehen«, komme ich sofort zur Sache.
»Jetzt? Aber ich habe gleich einen Vorsorgetermin mit Merle beim Kinderarzt, den kann ich nicht absagen.«
»Schick deinen Freund hin.«
»Der ist auf Fortbildung.«
»Komisch. Immer, wenn er sich mal ums Kind kümmern soll, ist er auf Fortbildung«, mokiere ich mich.
»Sag mal, spinnst du? Das stimmt doch überhaupt nicht!«
Ich vergaß: Auf ihren Eric lässt sie nichts kommen. »Ich zahle dir die ganze Woche Geld, obwohl du noch keinen Handschlag getan hast«, schieße ich zurück. »Da kann ich wohl erwarten, dass du mal mitkommst, wenn ich dich brauche.«
»Ja, aber du kannst vorher Bescheid geben. Und damit meine ich einen Tag vorher, keine fünf Minuten.« Was soll ich dazu sagen? Am besten gar nichts. »Von mir aus um zwei«, lenkt Denise ein, »dann bringe ich Merle vorher zur Oma.«
»Okay, ich hole dich ab.« Ende des Gesprächs.
Bei meinem letzten großen Fall, genau genommen meinem einzig wirklich »großen« Fall, bin ich um ein Haar für den Rest meines Lebens hinter Gitter gewandert, weil ich die Sache im Alleingang durchgezogen hatte. Seitdem habe ich mir geschworen, gewisse Dinge nur noch im Team zu erledigen, was sich manchmal als überaus lästig erweist.
Was nun? Zunächst gilt es, die Lage vor Ort zu sondieren. Dass dieser Krämer in Hennef gemeldet ist, heißt nicht, dass er sich dort aufhält. Oder dass er tatsächlich der Pferdedieb ist. Es muss auch nicht bedeuten, dass ich Stjörni dort finde. Es muss überhaupt nichts bedeuten. Warum Denise mitschleppen, wenn vermutlich nichts dabei herauskommt? Ich werde niemanden observieren, mit niemandem reden, nichts unternehmen. Nur mal gucken.
Eine halbe Stunde später habe ich den Allner und den Dondorfer See hinter mir gelassen und fahre weiter in Richtung Bülgenauel. Obwohl es nur ein kleiner Ort ist, ist Krämers Haus nicht leicht zu finden. Er wohnt an der Straße »In den Erlen«, doch die Bebauung endet hier zunächst vor einem großen Wiesengelände. Ich fahre weiter, vorbei an einer Viehweide, hinter der die Straße scharf rechts abknickt und zu einer weiteren Handvoll Häuser führt. Das letzte Haus, ein gutes Stück abgerückt von den anderen, ist das Gesuchte. Ein Wäldchen im Rücken, die grüne Wiese vor sich, genießt es einen direkten Blick auf die Stachelhardt und die Drachenfliegerschanze. Keine Überraschung für mich, ich habe das Terrain zuvor per Satellitenbild am Computer gecheckt. Im Vorbeifahren mustere ich mein Zielobjekt: ein Walmdachbungalow älteren Datums mit brauner Klinkerfassade. Einige PKW parken auf dem großen Hof, allesamt Oldtimer jüngeren Datums. Auf der Weide, die dem braunen Bungalow unmittelbar gegenüberliegt, erblicke ich ein Mädchen – beziehungsweise ein Pferd. Das Mädchen ist ungefähr 13 Jahre alt und trägt ein Halfter über der Schulter. Das Pferd, auf das es zugeht, ist relativ klein und pechschwarz, wie Stjörni. Mein Herz schlägt ein paar Takte schneller. Nur keine Aufmerksamkeit erregen, langsam weiterfahren. Ich passiere ein Nadelwäldchen und gelange schließlich in großem Bogen wieder zu der Abzweigung.
Kein Personenkontakt ohne Begleitung, mahnt meine innere Gouvernante. Aber das hier ist doch keine erwachsene Person, sondern ein Mädchen, ein Kind. Wie soll es mir gefährlich werden?
Ein Kind hat Eltern.
Das Pferd ist vielleicht morgen schon nicht mehr da.
Aber sicher noch um 14 Uhr, wenn Denise Zeit hat.
Dann ist die Kleine womöglich weggeritten. Und wer weiß, ob es überhaupt Stjörni ist. Ich müsste ihn mir mal aus der Nähe ansehen. Also parke ich auf dem Randstreifen, greife nach meiner Jacke und im Schweinsgalopp geht es Richtung Bungalow beziehungsweise Weide. Wenn die Kleine nur nicht schon weg ist! Diese Gefahr besteht keineswegs, wie ich vor Ort feststelle. Das Mädchen stapft noch immer mit dem Halfter in der Hand über die Wiese, und immer, wenn es sich dem Pferd nähert, dreht das Tier ab und schlendert scheinbar gemütlich, aber zielstrebig in die entgegengesetzte Richtung. Ich warte einen Moment, bis sie das Spiel in meine Nähe treibt. »Na, geht ihr beide ein bisschen spazieren?«, scherze ich über den Zaun hinweg und bleibe stehen.
»Er trickst mich immer aus.« Verlegen lächelnd tritt das Mädchen näher.
»Ja, die Isis haben so ihren eigenen Kopf«, mime ich die gestandene Pferdefrau und sehe sofort, dass ich ihr Interesse geweckt habe.
»Eigentlich wollte ich ein bisschen reiten, aber bis ich ihn habe, ist es wahrscheinlich dunkel.« Wir lachen beide. Der Isländer ist neugierig geworden und nähert sich uns.
»Beachte ihn gar nicht«, empfehle ich. »Dann kommt er von selbst.«
»Sie haben Ahnung von Pferden, nicht wahr?«
Eher von Meerschweinchen, bei denen funktioniert der Trick ebenfalls. »Ich hatte auch mal einen Isländer«, behaupte ich. »Eine ganz liebe Stute, Blessi hieß sie. Ach, ich liebe Pferde, leider habe ich zu wenig Zeit zum Reiten.«
»Sie haben sie verkauft?!« Der Gesichtsausdruck des Mädchens ist nicht schwer zu deuten: Wer es übers Herz bringt, sein Pferd zu verkaufen, der ersäuft auch kleine Katzen.
»Um Gottes willen!«, wehre ich ab. »Ich könnte nie ein Pferd hergeben, das mir ans Herz gewachsen ist. Nein, die gute Blessi ist an Altersschwäche gestorben. Ganz friedlich. Im Schlaf. In meinen Armen, sozusagen.«
»Wie alt ist sie denn geworden?«
»Äh … zwölf«, behaupte ich ins Blaue hinein.
»Zwölf? Das ist aber jung für ein Pferd.«
»Zwölf Pferdejahre«, präzisiere ich. »Die zählen neunmal so viel wie Menschenjahre.«
Sie schaut skeptisch drein und meint, sie kenne nur Hundejahre, von Pferdejahren habe sie noch nie gehört.
»Doch, doch.« Ich lächle wissend. »Einen schönen kleinen Kerl hast du da. Wie heißt er denn?«
»Ragnar.«
»Ragnar. Ach ja, diese komplizierten isländischen Namen.« Ragnar sieht tatsächlich aus wie das Pferd auf meinem Foto. Bis auf den kleinen weißen Stern, den Stjörni auf der Stirn trägt. Dieses Tier hier ist lackschwarz.
»Haben Sie ein Reitabzeichen?«, will das Mädchen wissen.
Als ehemalige Pferdebesitzerin werde ich wohl irgendein Abzeichen gemacht haben, überlege ich und nicke.
»Welches denn?«
Keine Ahnung. »Das Goldene«, antworte ich – wenn schon, denn schon. Das Mädchen pfeift durch die Zähne. Ob ich zu dick aufgetragen habe?
»Sind Sie auch Turniere geritten?«
Wollen wir’s mal nicht übertreiben mit der Reiterkarriere. Ich schüttele den Kopf. »Turniere sind nicht mein Ding, ich reite lieber in der freien Natur.« Durch Feld und Flur, wo mich niemand sieht. Allein durch Wald und Wiesen. Ohne Zeugen, sozusagen. »Habt ihr noch mehr Pferde?«, lenke ich ab.
»Ja, drüben im Stall. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen!«
»Tja, ich weiß nicht …«
»Bitte, kommen Sie!«
»Na gut. Wenn deine Eltern nichts dagegen haben …«
»Papa bestimmt nicht«, meint das Mädchen, »aber er ist sowieso nicht da.«
Na, dann. Keine Eltern. Diese Chance kriege ich kein zweites Mal. Die Kleine kriecht durch den Zaun und steht jetzt neben mir.
»Wie heißt du eigentlich?«
»Rachel.«
»Rachel? Ein seltener Name hierzulande.«
»Ein bescheuerter Name.«
»Wieso? Er klingt doch gut. Hast du eine englische Mutter oder einen Vater?«
Rachel lacht auf und schüttelt den Kopf. »Nein, habe ich nicht. Der Name ist aus diesem bescheuerten Film mit dem Pfaffen und der Alten, die ihr Leben lang auf ihn wartet, bis er tot ist. Kennen Sie den? Kam gleich nach der Stummfilmzeit.«
Sie meint »Die Dornenvögel«, bin ich mir sicher, doch ich möchte dieses Thema nicht vertiefen und schüttele den Kopf. »Ich heiße übrigens Cornelia.«
Mein Handy macht sich bemerkbar. Eine SMS von Herbert. »M. Krämer hat eingesessen wg. Überfall auf Geldtransporter«, lese ich »entlassen 2011«. Das klingt ja vielversprechend. Ich hoffe, er ist wirklich nicht zu Hause.
»Mein Mann«, sage ich zu Rachel und deute auf mein Smartphone. »Er fragt, ob ich noch einkaufen gehe. Offenbar hat er Hunger.« Wir schlendern in Richtung Haus, Rachel immer einen halben Schritt voraus, mit wippendem aschblondem Pferdeschwanz. Auf der Rückseite des Hofes und von der Straße aus nicht einsehbar liegt das Stallgebäude, frisch geweißt und top in Schuss. Rachel stößt eine Seite des doppelflügeligen Holztors auf. »Da sind wir. Kommen Sie rein!«
»Und deine Eltern haben wirklich nichts dagegen?«
»Quatsch. Und wie gesagt: Mama und Papa sind nicht da.«
Ganz das, was ich hören wollte. An das blendende Sonnenlicht gewöhnt, haben meine Augen im ersten Moment Schwierigkeiten, sich an die tiefe Dämmerung hier drinnen anzupassen. Schemenhaft erkenne ich einen Gang, links eine Pferdebox, dahinter, nur wenige Schritte weiter, bereits die rückwärtige Stallwand. Aus einem Fenster über der Box fällt ein schräg einbrechender, scharf gebündelter Lichtstrahl, der ein helles Rechteck auf den Betonboden wirft. Ich frage Rachel, wo die Pferde sind.
»Drüben, auf der anderen Seite. Aber ich wollte Ihnen zuerst Ragnars Box zeigen.«
»Kannst du mal Licht machen? Ich sehe fast nichts.«
»Ja, gleich. Ach verflixt, jetzt habe ich mein Haargummi verloren! Es muss am Tor runtergefallen sein, warten Sie einen Augenblick.« Schwups, ist sie draußen, und in der nächsten Sekunde kracht die Stalltür zu.
»Rachel?« Ein Riegel wird vorgeschoben. »Rachel?« Das darf doch nicht wahr sein! Ich renne zur Tür und stemme mich dagegen. Sie hat mich eingesperrt, das Biest hat mich eingesperrt! Ich sprinte zurück, in Ragnars Box, auf das Licht zu, das einzige Fenster des Stalls, so hoch angebracht, dass ich mich strecken muss. Kaum will ich es aufstoßen, drückt eine unsichtbare Hand von außen dagegen. Wieder das metallische Scharren eines Riegels, und plötzlich herrscht finstere Nacht.
»Rachel!« Ich stolpere zurück zur Tür. »Rachel, was soll das? Lass mich sofort hier raus!« Ich poche wie wild gegen das Tor. »Das ist kein Spaß, hörst du? Ich rufe die Polizei! Ich habe mein Handy dabei.«
»Hier hat niemand Empfang«, schallt eine helle Kinderstimme von draußen. Und das ist das Letzte, was ich von Rachel höre.
Sie hat recht: kein Netz hier drinnen. Ich kann es kaum glauben. Wie konnte das passieren? Und warum? Unweigerlich kommt die Erinnerung an die Erzgrube hoch, in die Waskovic mich in meinem letzten Fall eingesperrt hatte, und nur mit Mühe gelingt es mir, die aufwallende Panik niederzuringen. Hey, das hier ist weder ein stillgelegtes Bergwerk noch ein Hochsicherheitstrakt, versuche ich mich zu beruhigen. Hier kommt man irgendwie raus. Ich finde den Lichtschalter; ein Deckenstrahler flammt auf. Hektisch schaue ich mich um. An der Wand zu meiner Rechten diverse Haken, daran aufgehängt Zaumzeug, ein Führstrick, ein weiteres Halfter. Ein Sattel auf einem hölzernen Bock, daneben ein Regal mit Putzutensilien. In der Ecke eine Schaufel, eine Mistgabel, eine aufgestellte Schubkarre. Kein Werkzeug. An der rückwärtigen Wand stapeln sich Heu- und Strohballen bis auf halbe Raumhöhe. Ich nehme das Regal mit den Putzutensilien genauer unter die Lupe, insbesondere eine Pappschachtel, die aussieht wie frisch aus dem Drogeriemarkt. »Perfect brilliance hair mascara ultrablack permanent« steht darauf, darunter das Gesicht einer Frau, deren Haar so schwarz glänzt wie Rabenflügel. Ein Haarfärbemittel. Sie haben Stjörni den Stern auf der Stirn gefärbt, wird mir klar. Und ihn in Ragnar umgetauft. Keine Frage, ich bin am richtigen Ort. Nur leider zum falschen Zeitpunkt, wie’s aussieht.
4. Kapitel
Schreien nützt nichts, hier hört mich ja doch niemand. Also Ruhe bewahren, nachdenken. Denise geht davon aus, dass ich sie um zwei abhole. Tauche ich nicht auf, wird sie anrufen. Wenn sie mich nicht erreichen kann, wird sie Herbert anrufen und der hat die Adresse Manfred Krämers und seiner Bagage. Meine Mitarbeiter werden zwei und zwei zusammenzählen und wissen, dass ich mal wieder gegen alle Regeln verstoßen und mich allein auf die Socken gemacht habe – und offenbar in Schwierigkeiten stecke. Sie werden mich suchen. Oder die Polizei rufen. Oder beides. Ich brauche nur ein bisschen Geduld. Jemand wird kommen. Mit diesem Mantra lulle ich mich ein, bis ein Gedanke mich siedend heiß durchfährt. Helga hat heute einen Termin in einer Kölner Spezialklinik – und Herbert wird sie begleiten, er hat es mir selbst erzählt. Er wird nicht erreichbar sein, sein Handy ausschalten, keine SMS lesen. Also wird Denise auch nichts über meinen Aufenthaltsort erfahren. Es wird niemand kommen.