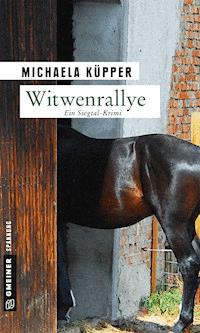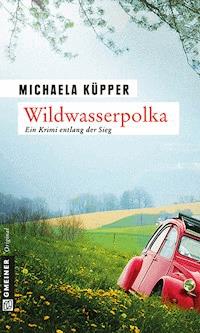Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Karen zieht aus der Großstadt in ein ehemaliges Bauernhaus. Doch statt der erhofften Ruhe und Idylle empfängt sie die unverhohlene Ablehnung der älteren Dorfbewohner. Bald kommt es zu offenen Anfeindungen und tätlichen Angriffen, die Karen veranlassen, den Ursachen der Feindschaft auf die Spur zu kommen. Bei ihrer Suche nach der Wahrheit bringt sie Ereignisse ans Tageslicht, die für immer im Dunkeln verborgen bleiben sollten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michaela Küpper
Wintermorgenrot
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © sanne84/photocase.de
Umschlaggestaltung: Simone Hölsch
ISBN 978-3-7349-9290-2
1. Kapitel
Ich hocke auf einem Schweineschemel vor dem Stall und betrachte das Blut an meinen Händen. In feinen, sich zart verästelnden Bahnen rinnt es die Handgelenke hinab bis zu den Ellbogen, wo es sich sammelt und nach einem kurzen Moment des Zögerns den Gesetzen der Schwerkraft gehorcht. Gedankenlos folgen meine Blicke den hellroten Spuren, die ein feuchtwarmes Gefühl auf der Innenseite meiner Arme hinterlassen. Zwischen meinen Füßen steht eine metallene Schüssel bereit, um jeden Tropfen des Lebenssaftes aufzufangen, damit nichts verloren geht. Stärker und stärker wird der Fluss. Das Rinnsal, von ergiebiger Quelle gespeist, schwillt bald an zum munteren Strom. Bald sieht man den weiß emaillierten Grund des Gefäßes nicht mehr. Merkwürdig viel Blut für ein kleines Karnickel. Viel zu viel Blut. Mir fallen die Augen zu, ich bin müde, unendlich müde. Schau hin. Du musst hinschauen. Langsam senkt sich mein Blick. Was da auf meiner Schürze liegt, ist ein Stofftier mit stumpfem, struppigem Plüschfell und einem staubtrockenen Innenleben aus gepresster Holzwolle. Ich starre auf meine blutverschmierten Hände und beginne zu schreien. Doch die Schreie dringen nicht einmal bis an mein eigenes Ohr, sondern werden geschluckt von der Luft, die wie Watte ist.
»Nimm du das Ding hier!« Roland drückte mir meine heiß geliebte Pinguinleuchte in die Hand und wuchtete selbst die letzten beiden Bücherkisten aus dem klapprigen Ford Transit, der vor einer halben Stunde noch bis unters Dach mit meinem Hausstand beladen gewesen war. Während ich ein paar Dehnungsübungen für meinen schmerzenden Rücken machte, schleppte mein treuer Lakai die Kartons hinein, holte das ein oder andere Kleinmöbel aus dem Wagen und brachte schließlich die letzte Topfpflanze unversehrt an ihren neuen Bestimmungsort. Vor Erleichterung wurde mir warm ums Herz: Ich hatte es geschafft, der entscheidende Schritt war getan.
An diesem beschaulichen Ort hoffte ich die Muße zu finden, die ich für meinen seelischen Wiederaufbau dringend benötigte. Und was konnte der Rekonvaleszenz zuträglicher sein als eine schützende Zuflucht in der hintersten Ecke Deutschlands, fernab von allem Trubel und bar jedes Zeichens urbaner Zivilisation?
Ich hatte mir so viel frische Landluft verordnet, wie ich atmen konnte, dazu lange Ertüchtigungsspaziergänge und beschauliche Abende am Kamin. Auf diese Weise sollten die Wunden heilen, die mir das Schicksal in Gestalt einer kaum dem Kindergartenalter entwachsenen Rechtsanwaltsgehilfin mit Porzellanteint und auberginefarben präpariertem Haar zugefügt hatte.
Welche Frau sieht nicht rot, wenn sie, gerade noch in hausfraulicher Trance versunken, beim Staubsaugen unterm vorehelichen Bett plötzlich einen Lippenstift findet, der farblich nie und nimmer der eigenen Kollektion zugeordnet werden kann?
Nachdem die Dame sich auf diese Weise geoutet hatte, war meine Welt wie ein Kartenhaus zusammengefallen, doch nun war ich fest entschlossen, die Trümmer zu beseitigen und von vorn anzufangen.
»Jetzt haben wir uns eine schöne Tasse Kaffee verdient«, meinte Roland und schlurfte zum Bus, um seinen Picknickrucksack zu holen, den er vor Antritt der Fahrt gepackt hatte. Thermoskanne, Pappbecher, belegte Brötchen und ein Apfel wurden hervorgekramt und auf dem Küchentisch verteilt. Leider gab die Kanne nur noch einen halben Becher voll her, da mein Freund und Helfer bereits auf dem Hinweg nach 50 Kilometern ein sonniges Plätzchen angesteuert und die erste Brotzeit gehalten hatte. Mir war nichts anderes übrig geblieben, als ebenfalls anzuhalten und auf ihn zu warten.
Ich sah mich um und entdeckte einen Rest Kaffeepulver im Regal über der Spüle, sogar eine angebrochene Büchse Dosenmilch fand sich im Kühlschrank.
»Das wär doch gelacht, wenn ich mich in meinem Haus nicht zurechtfände!«, triumphierte ich und setzte die Kaffeemaschine in Gang. »Mein Haus«, das klang einfach wunderbar. Nun ja, rechtlich gesehen war es natürlich nicht meines, aber für die nächste Zeit würde ich ungehindert so tun können als ob. Thomas und Claudia hatten mir ihr Domizil großzügig überlassen, einzig mit der Auflage, es halbwegs in Schuss zu halten und die Blumen zu gießen. Die beiden arbeiteten als Entwicklungshelfer und hatten sich vor einigen Jahren diesen alten Bauernhof gekauft, um sich einen ruhenden Pol in ihrem bewegten Leben zu schaffen. Doch es zog sie immer wieder hinaus in die Welt, sie waren und blieben Vagabunden. Ihr neuestes Ziel hieß Mali; vor drei Tagen waren sie abgereist.
»Meinst du, Kaffee aus Tutanchamuns Grabkammer ist noch genießbar?«, fragte Roland und deutete grinsend auf die altägyptischen Motive, die die Kaffeedose zierten. »Wie alt mag der wohl sein?«
»Keine Ahnung, mir schmeckt er jedenfalls!«
»Zumindest ist er heiß.« Mein Umzugsgehilfe leerte sein Becherchen mit wenig vornehmen Schlurfgeräuschen und erhob sich. »Lass uns mal deine Sachen rauftragen. Hier unten ist ohnehin kein Platz dafür.«
In Küche und Wohnzimmer war es tatsächlich ziemlich eng. Außer altägyptischen Kaffeedosen gab es einiges, was dem Inventar jedes Völkerkundemuseums Konkurrenz gemacht hätte. Töpfe und Tiegel, Vasen und Wandbehänge, Speere und Schilde, Masken und Maskottchen drängten sich in den Räumen und grüßten stumm aus fernen Ländern. Dieses exotische Sammelsurium hatte durchaus Charme und wirkte recht behaglich, der Gegensatz zu der urdeutschen Dorfidylle draußen vor der Tür hätte allerdings nicht krasser sein können.
Wir schleppten meine Habseligkeiten in das Zimmer im ersten Stock, das die Hausbesitzer für mich leer geräumt hatten. Der Raum war recht groß und gut geschnitten. Zwei Fenster, die zur Südwestseite hinausgingen, sorgten für genügend Licht und gewährten einen freien Blick über den Hof. An der Wand hing ein großes Schild mit der Aufschrift »Herzlich willkommen«. Ich war gerührt.
»Tja, ich werd mich bald auf die Socken machen müssen«, erklärte Roland, nachdem wir unsere Arbeit beendet hatten.
Wir tranken noch einen Kaffee, und ich füllte ihm den Rest in seine Thermoskanne für den Fall, dass er auch auf dem Rückweg eine Pause machen wollte. Zum Abschied versprach er, in drei Wochen wiederzukommen, denn ich hatte ihn und seine Freundin Gabi eingeladen, das Wochenende in meinem neuen Heim zu verbringen. Bis dahin hoffte ich, mich bereits recht gut eingelebt zu haben.
Bevor Roland ging, konnte er es sich nicht verkneifen, mit beiden Händen meine Rechte zu ergreifen und mich mit einem langen, mitleidsvollen Blick zu bedenken. Diese unerwünschte Geste verringerte den Trennungsschmerz erheblich, und ich war froh, als sein Bus vom Hof rollte. Natürlich war Roland ein lieber, hilfsbereiter Kerl, und ich tat ihm Unrecht. Trotzdem konnte ich nicht verstehen, wie Gabi es tagtäglich mit diesem Menschen aushielt. Allerdings gab es momentan ohnehin keinen Mann, der vor meinem kritischen Auge Gnade gefunden hätte.
Es war erst gegen halb sechs, ich hatte also noch einen langen Abend vor mir. Zunächst bezog ich mein Bett, verteilte Handtücher, Waschutensilien und Zahnbürste im Bad und machte mich anschließend daran, mein Bücherregal aufzubauen. Erschöpft und hungrig ging ich nach getaner Arbeit hinunter in die Küche, um mir eine Dose Ravioli aufzuwärmen. Ich war nervös, das konnte ich nicht leugnen. Also beschloss ich, nicht allzu rigoros mit liebgewordenen Gewohnheiten zu brechen, den Kamin heute kalt zu lassen und mich stattdessen mit meinem Raviolitopf vor den Fernseher zu setzen. Es gibt nichts Beruhigenderes als einen alten »Tatort«.
Die einschläfernde Wirkung hielt jedoch nicht lange vor, und mich befiel wieder eine innere Unruhe. Ich tigerte im Wohnzimmer umher und besah mir ausführlich die Schätze aus aller Welt. Eine afrikanische Maske hatte es mir besonders angetan: Die Fratze des Dämons war kalkweiß geschminkt, der weit aufgerissene Schlund ein gähnendes schwarzes Loch. Die Augen traten aus den Höhlen und waren rot geädert, die Nüstern riesig und kreisrund. Mithilfe eines Bandes ließ sich das Ding sogar aufsetzen. Die Maske vor dem Gesicht lief ich in den Flur, um mich im Garderobenspiegel zu betrachten. Ich sah verdammt gruselig aus. Der Effekt ließ sich steigern, indem ich die erhobenen Hände zu Klauen krümmte und einen unsichtbaren Feind traktierte, von angsteinflößendem Fauchen und Grollen akustisch untermalt. Ich hängte den Dämon an seinen Platz zurück, ging unter die Dusche und ins Bett, wo ich prompt einschlief.
Entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten stand ich ziemlich früh auf. Ein Blick aus dem Fenster belohnte mich für meine Tapferkeit: Erst 9 Uhr, die Sonne strahlte, und wie hübsch die Landschaft aussah im goldenen Oktoberglanz! Ich beschloss, mich erst einmal im Dorf auf die Suche nach Kaffee und Brötchen zu machen. Tatsächlich fand ich schnell einen kleinen Laden, in dem man das Nötigste kaufen konnte. Neben dem Nötigsten gab es Nostalgisches, wie zum Beispiel einzeln käufliche Schokoküsse. Ich konnte nicht widerstehen und kaufte gleich vier Stück, die mir die etwas kuhäugig dreinblickende Verkäuferin in eine Papiertüte packte. Kaum dass sich die Ladentür mit schrillem Klingeln hinter mir geschlossen hatte, nahm ich einen heraus und biss hinein. Schlagartig wurde mir klar, dass dieses Exemplar wohl annähernd so alt war wie ich selbst. Fäden ziehend, zäh und klebrig haftete es besser an Zähnen und Lippen als eine geplatzte Kaugummiblase, der Geschmack hatte sich im Laufe der Jahre verflüchtigt.
Zurückgekehrt, nahm ich ein reichhaltiges Frühstück zu mir und machte mich anschließend daran, ein- und umzuräumen. Gegen halb vier hielt es mich nicht länger drinnen, und ich brach zu einem Spaziergang auf. Das Wetter war nach wie vor herrlich, der schönste Altweibersommer. Ein hoher Himmel von reinstem Blau spannte sich über die Landschaft, dezent geschmückt von schneeweißen Bilderbuchwolken, die gemächlich dahinsegelten. Die Wiesen waren noch sattgrün und saftig, während das Laub sich bereits verfärbte. Scharf umrissen hob sich der Wald vom Himmel ab, die Luft war fast unnatürlich klar. Ein solches Licht gab es nur im Herbst, und ich liebte diese Jahreszeit. Irgendwo draußen auf den Feldern entdeckte ich einen Apfelbaum, der noch Früchte trug. Ich wandte mich der Sonne entgegen, lehnte mich gegen den rauen Stamm und aß zwei Äpfel. So wohl hatte ich mich seit Ewigkeiten nicht mehr gefühlt. Mir war, als könne ich plötzlich wieder durchatmen. Jeder Atemzug entkrampfte meinen Körper ein wenig und machte mich ruhiger. Mit prall gefüllten Taschen trat ich den Heimweg an. Es war wirklich eine gute Idee gewesen, hierher zu ziehen.
2. Kapitel
Sie war bereits wach, als das erste Grau am Horizont den Nachthimmel zu erhellen begann. Der Hahn eröffnete ein Duett mit seinem Nachbarn vom Jöd’schen Hof, und in der Ferne stimmten weitere ein.
Mechanisch zündete sie die Petroleumlampe an, schürte den Ofen, goss Wasser aus einem bereitgestellten Eimer in den Topf auf der Ofenplatte und schüttelte die Bettdecke auf. Während sie darauf wartete, dass das Wasser warm wurde, sah sie hinaus in das quadratische Stück Himmel, das die Dachluke freigab. Noch zierte der kalte, matte Glanz einzelner Sterne die Dunkelheit.
Sie füllte die Waschschüssel, zog das knöchellange Nachthemd über den Kopf und begann sich zu waschen. Als sie sich abtrocknete, hörte sie, wie der Knecht Willem bereits an ihrer Kammer vorbei- und die Stiege hinabschritt. Obwohl er schon über 60 war, hatte er noch immer den forschen, festen Gang eines 30-Jährigen.
Eilig zog sie ihre Leibwäsche an und Wollsocken, einen Unterrock, ihr abgetragenes taubenblaues Kleid, eine Kittelschürze ohne Ärmel und darüber den wollenen Umhang. Sie griff nach ihrer Bürste, fuhr mit flinken, energischen Bewegungen durch ihr langes blondes Haar und flocht es zu einem Zopf, den sie, geschickt zu einem Knoten aufgerollt, im Nacken feststeckte. Dann schlüpfte sie in ihre klobigen Arbeitsschuhe, die vorn mit Zeitungspapier ausgestopft waren, warf einen letzten Blick in den halbblinden Spiegel über der Kommode, goss das Seifenwasser in den leeren Eimer zurück und verließ die Stube. Heute sollte die Kartoffelernte beginnen.
Am späten Vormittag zogen die Frauen hinaus aufs Feld. Die Kartoffeln waren bereits einige Stunden zuvor gerodet worden, sodass sie ein wenig in der Sonne hatten trocknen können. Nachdem die Sammelwagen aufgestellt und die Weidenkörbe verteilt waren, begann die mühsame Arbeit. Die Frauen rutschten auf Knien über den Acker, jede mit knappen, raschen Würfen ihren mitgeführten Korb füllend. Neben Maria arbeiteten die Bäuerin und deren Tochter Annegret sowie einige Flüchtlingsfrauen aus Schlesien samt ihren Kindern. Zwischen ihnen sprang der dreijährige Joachim umher, jüngster Spross des Bauern und mit zwölf Jahren Altersunterschied zu seiner Schwester ein rechter Nachzügler. Er versuchte es den Großen gleichzutun, warf statt der Kartoffeln allerdings immer wieder Steine und Erdklumpen in die Körbe. Verstohlen beobachtete er die Flüchtlingskinder, die mit stillen, eifrigen Mienen ganz in ihre Arbeit versunken waren und keine Notiz von dem kleineren Kind nahmen.
Waren die Körbe gefüllt, wurden sie zu einem der Sammelkarren getragen und ausgeleert. Auf diese Weise verging Stunde um Stunde. Die Glieder begannen zu schmerzen, doch die Arbeit war noch lange nicht beendet.
Am Nachmittag kam Willem mit dem Pferd. Alle scharten sich um Tier und Karren und packten die mitgebrachten Brote sowie Kannen mit Malzkaffee aus. Die Erwachsenen wandten ihre Gesichter der Sonne zu, die noch Kraft hatte, ohne zu brennen. Die Kinder spielten Fangen. So am Wegrand lagernd, genossen alle für kurze Zeit einen der letzten schönen Tage des Jahres.
Nachdem Joachim sein Brot aufgegessen hatte, reckte er fordernd seine Ärmchen in die Höhe, und Willem hob ihn aufs Pferd. Auch die übrigen Kinder streckten zaghaft die Hände aus, um das Tier zu streicheln. »Wie heißt es denn?«, wollte eines von ihnen wissen, ein mageres, ungefähr sechsjähriges Mädchen mit kurzem braunem Haar.
»Heiner heißt unser guter alter Freund hier, nicht wahr, mein Dicker«, antwortete Willem und klopfte freundschaftlich den schweren Hals des Tieres.
»Dürfen wir mal drauf reiten?«
»Na sicher doch. Los, kommt her!« Willem hob eines der Kinder nach dem anderen aufs Pferd, das kleinste vorn, das größte hinten. Alle saßen fast im Spagat und hinter dem letzten war immer noch Platz auf der mächtigen, sesselbreiten Kruppe. Heiner ließ sich von alldem nicht irritieren, sondern suchte in aller Ruhe weiter zwischen Kartoffelkraut und braunen Knollen nach etwas, das ihm vielleicht besser munden würde. Da es hier jedoch offensichtlich nichts zu holen gab, hob er den Kopf und stieß sanft zuerst Maria und dann Annegret vor Brust und Bauch. In deren Kittelschürzen hatte sich schon des Öfteren ein Leckerbissen für ihn versteckt; tatsächlich wurde er auch diesmal fündig.
Mit dem greisen Ackergaul hatte es etwas Seltsames auf sich: Keine Kreatur auf dem Hof – ob Mensch oder Tier – wurde derart respektvoll und freundschaftlich behandelt wie er. Willem und Heiner waren ein eingespieltes, über die Jahre zusammengewachsenes Gespann. Mit Heiner redete Willem mehr als mit allen Menschen. Jedes der Bauernkinder hatte bereits auf Heiners Rücken gesessen, bevor es laufen konnte. Der gutmütige Riese war ihr liebster Spielgefährte. Sogar die Bäuerin stand manchmal, wenn sie sich unbeobachtet glaubte, vor ihm und kraulte gedankenverloren seine samtigen Lippen.
Um Heiner spann sich sogar eine bewegende Geschichte, die im Dorf nach wie vor hinter vorgehaltener Hand kursierte. In den letzten Kriegswochen hatten die Frauen des Dorfes erfahren, dass ein Wehrmachtsoffizier mit Gefolge unterwegs sei, um die verbliebenen Pferde im Dorf einzutreiben. Kaum hatte die Bäuerin diese Nachricht ereilt, führte sie lauthals fluchend das Pferd aus dem Stall.
»Was soll uns dieser Krieg denn noch kosten?«, schrie sie. »Der Bauer liegt da mit zerschossenem Bein und wird nie mehr ordentlich laufen können, der Knecht ist weit weg, dass wir Weiber die ganze Arbeit allein tun müssen, und unsere Kinder zerren sie an die Front, um sie dort abzuschlachten wie Vieh! Aber ich sag euch, der Heiner kommt mir nicht auch noch weg, der bleibt hier!«
Betroffen starrten die anderen ihr nach, als sie das Pferd vom Hof führte, um es in einer Senke im Wald zu verstecken. Seit Monaten hatte niemand die Bäuerin dermaßen aufgebracht gesehen. Der Tod ihres ältesten Sohnes Karl schien alle Empfindungen in ihr abgetötet zu haben. Nun jedoch bröckelte die steinerne Fassade aus Lethargie und Schweigen, mit der sie sich seither von jeglichem Geschehen distanzierte. Unter der kalten Asche glimmte ein Funke. Sie war noch lebendig.
Wenig später erzählte sie den Soldaten, der alte Gaul sei vor Kurzem an einer Darmkolik eingegangen. Er habe einen halben Sack Hafer gefressen, den jemand versehentlich auf einem Schubkarren vor der Boxentür stehen gelassen hätte. Der Offizier schaute sie ein wenig ungläubig an und spähte skeptisch in die Ställe, gab sich dann aber zufrieden und fuhr davon. Anschließend beteten alle, dass er beim Abdecker im Nachbarort keine Erkundigungen einziehen möge. Doch die Sache ging gut und Heiner überlebte den Krieg, womöglich unbeschadeter als alle anderen.
3. Kapitel
Als ich nach meinem ausgedehnten Spaziergang auf den Hof zurückkehrte, stand dort eine weißhaarige, gebeugte Gestalt und starrte angestrengt durch mein Küchenfenster. Freundlich grüßend trat ich näher. Langsam und scheinbar äußerst widerwillig wandte die Alte den Kopf.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich zögernd. Die Alte blickte feindselig drein, als wäre es eine Anmaßung meinerseits, sie gestört zu haben, gab jedoch keine Antwort. Sie kniff angestrengt die Augen zusammen, und ihr runzeliges, spitzes Gesicht zeigte einen Ausdruck ungläubiger Verwunderung, der von einer Sekunde zur anderen in blankes Entsetzen umschlug. Ein Zittern durchlief ihren Körper, und sie schwankte gefährlich, dann setzte sie sich mit einem Ruck in Bewegung, schob sich an mir vorbei und eilte wieselflink davon. Als sie die Straße erreicht hatte, blickte sie sich noch einmal um und schrie mir aus sicherer Entfernung zu: »Hau ab, du Hure! Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist, wir wollen dich hier nicht, Teufelsweib!«
Drohend schüttelte sie die erhobene Faust und lief eilig weiter in Richtung des Nachbarhauses. Dort ging wie auf Kommando die Haustür auf, und die Alte verschwand hinter schützendem Gemäuer. Kopfschüttelnd sah ich ihr nach. Was für eine nette Begrüßung!
Ich ging nicht sofort zurück ins Haus, sondern beschloss, erst einen Blick in die Scheune gegenüber des Wohnhauses zu werfen. Ich versuchte, die kleine Holztür zu öffnen, die in das Scheunentor eingelassen war, aber sie war verschlossen und es steckte kein Schlüssel darin. Also machte ich mich daran, mit erheblichem Kraftaufwand und einigen derben Flüchen das große, eisenbeschlagene Tor in Bewegung zu setzen. Ächzend und quietschend rollte es in seinen Schienen zurück und ließ einer Flutwelle von Licht freie Bahn. In einer Ecke standen rostige alte Ackergeräte, in einer anderen lag ein Stapel Holz. Eine Leiter führte zu einem zweiten Boden ziemlich hoch oben. Ich kletterte hinauf und stand inmitten einer Hügellandschaft längst zerfallener Heu- und Strohballen. Durch unzählige Ritzen und Spalten schien die Abendsonne zwischen den Schindeln hindurch, und Abermillionen winziger Staubkörnchen schwebten in leuchtend goldenem Licht. Es war absolut still.
Die Stimmung dort oben im Heuschober berührte mich auf merkwürdige Weise, ich fühlte mich plötzlich unendlich müde. Benommen ließ ich mich zwischen den staubigen Heuballen nieder, starrte auf die tanzenden Sonnenflecken und begann zu weinen, ohne zu wissen, warum. Ich weinte, bis mich ein lautes Rufen unten im Hof aufschreckte.
»Hallo? Hallo!«
Einem wilden Kaninchen gleich duckte ich mich und gab keinen Mucks mehr von mir. Bloß nicht entdeckt werden in dieser erbärmlichen Verfassung, in der ich mich augenblicklich befand. Doch die Ruferin hatte bereits die Scheune betreten.
»Hallo, sind Sie da oben?«
Ich gab mich geschlagen. »Ja, ich bin hier!« Hastig fuhr ich mir mit dem Ärmel durchs Gesicht und trat an den Rand des Dachbodens. »Einen Moment bitte, ich komme herunter!« Der Abstieg war verflucht steil. Unten erwartete mich eine ausgestreckte Hand, die zu einer älteren Dame gehörte, deren Ähnlichkeit mit der verrückten Alten mir sofort ins Auge fiel.
»Guten Tag, junges Fräulein. Gut, dass ich Sie gefunden habe! Jödt ist mein Name, Bärbel Jödt. Jödt mit dt.«
Ich ergriff ihre kleine, schwielige Hand und stellte mich ebenfalls artig vor. Bärbel Jödts engstehende kleine Knopfaugen fixierten mich gnadenlos.
»Tut mir leid, ich habe Sie nicht sofort gehört. Bin bloß mal da oben rauf, um mich umzusehen, und hab prompt einen Anfall von Heuschnupfen bekommen. Ist ganz schön staubig hier drin.« Ich lächelte schief und wischte mir in Ermangelung eines Taschentuchs verlegen mit dem Handrücken die triefende Nase. Der Alten entging das nicht.
»Heuschnupfen haben Sie?«, fragte sie missbilligend. »Da dürften Sie aber gar nicht hierher kommen! Wenn Heuzeit ist, fliegt das Zeug durchs ganze Dorf. Was wollen Sie dann machen, sich wochenlang im Haus einschließen? Das nützt Ihnen auch nichts, es kommt durch alle Ritzen, lassen Sie sich’s gesagt sein!«
»Nun ja, jetzt wird’s erst einmal Winter«, wagte ich ihr kleinlaut entgegenzusetzen, doch sie überging meinen Einwand.
»Der Sohn einer Großnichte, der ist auch so empfindlich. Als die mal zu Besuch waren, Gott, war das ein Drama! Da haben wir alle Fenster und Türen dichtgemacht, und trotzdem, kaum aus den Augen gucken konnte das Kind, und Luft hat’s auch fast nicht gekriegt. Schrecklich, so was. Nun ja, Stadtkinder, was soll man da erwarten, die vertragen die Natur gar nicht mehr. Eine Schande ist das!« Sie schüttelte den Kopf. »Aber was red ich, ich bin doch hier, weil ich mich entschuldigen wollte wegen Änne.«
»Entschuldigen, wofür denn?«, tat ich naiv.
»Ach, für das Betragen meiner Schwester vorhin. Meine Schwester Änne Jödt, Sie haben sie ja bereits kennengelernt. Die Gute ist manchmal nicht mehr ganz richtig im Kopf, und wenn ich mal einen Moment nicht aufpasse, schwupp, ist sie weg und bringt mich in Schwierigkeiten. Hoffentlich war sie nicht allzu unhöflich zu Ihnen!«
»Nein, nein, darüber machen Sie sich mal keine Gedanken!« Ich lächelte nachsichtig.
»Sie verkalkt langsam, wissen Sie. Sie weiß oft nicht mehr, was sie tut. Furchtbar ist das, aber man kann nichts machen dagegen. Ja, ja, das Alter, da kommt eins zum anderen, da kann man dankbar sein, wenn der Herrgott einen irgendwann zu sich holt!« Sie tat einen tiefen Seufzer. »Ich hab’s mit den Gelenken. Hier, seh’n Sie, ich kann sie manchmal gar nicht mehr bewegen.« Sie fuchtelte mit ihren knorrigen Händen vor meiner Nase herum. »Von der Schulter an, alles ganz steif. Es war schon mal so schlimm, dass Änne mir die Kaffeetasse halten musste. Furchtbar, sag ich Ihnen. Aber was will man machen, nicht wahr? Und besser die Hände wollen nicht mehr, als dass der Kopf streikt, sag ich immer. Das Schlimmste ist, dass Änne es gar nicht merkt, wenn in ihrem Oberstübchen mal wieder alles durcheinandergerät. Sie meint, sie wär normal und alle anderen täten spinnen. Das ist ein Kreuz, ich hab’s weiß Gott nicht leicht mit ihr. Aber es kümmert sich sonst keiner, da bleibt eben alles an mir hängen.« Sie hielt inne und warf mir einen Blick zu, als trüge ich die Schuld an ihrem Leiden.
»Manchmal hat sie auch Phasen, da funktioniert alles tipptopp«, fuhr sie fort. »Da erinnert sie sich haarklein an Sachen, die liegen über 50 Jahre zurück. Das weiß sie alles, als wär’s gestern gewesen, da kommt unsereins gar nicht mit. Und Sie?«
»Wie bitte?«
»Wohnen Sie jetzt hier?« Wieder beäugte sie mich argwöhnisch. Irgendwie hatte sie Ähnlichkeit mit einem Frettchen oder einem anderen kleinen Raubtier.
»Ja, ich werde hier für ein paar Monate wohnen.«
»Ist Ihr Mann nicht da?«
Gerade hatte ich überlegt, ob ich die alte Dame nicht der Höflichkeit halber ins Haus bitten sollte, aber nach dieser Frage hatte sich das Thema Höflichkeit für mich erledigt.
»Ich bin unverheiratet«, erklärte ich. »Das Haus gehört nach wie vor den Beckmanns, ich passe nur ein wenig darauf auf, während sie weg sind.«
»Da wird Ihnen die Zeit unerträglich lang werden«, prophezeite mir Bärbel Jödt. »Sie kennen doch gar niemanden hier.«
»Ich habe zu arbeiten und komme ganz gut allein zurecht – das bin ich gewohnt«, antwortete ich kurz angebunden. Langsam reichte es mir.
Eine senkrechte Falte bildete sich auf Bärbel Jödts Stirn. »Meine Schwester sagt, sie kennt Sie. Behauptet steif und fest, sie hätte Sie schon mal gesehen.«
Ich versuchte, ihrem bohrenden Blick standzuhalten. »So? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Obwohl – ich habe die Beckmanns einige Male besucht, vielleicht hat sie mich da …«
»Haben Sie Verwandte hier in der Gegend?«
»Äh, nein, nicht dass ich wüsste. Ich kenne nur die Beckmanns.«
»Die sind ja nicht von hier, sind auch bloß zugezogen und außerdem nie daheim. Was das für ein Leben sein soll, immer unterwegs wie die Vagabunden, na, ich weiß nicht.«
»Ich denke, die beiden machen eine wichtige Arbeit, Frau Jödt.«
»Fräulein Jödt.«
Ich sah sie verständnislos an.
»Fräulein Jödt. Ich war nie verheiratet«, erklärte sie pikiert und fixierte mich wieder, als wolle sie bis in die letzten dunklen Abgründe meiner Seele vordringen. »Dann hat sich meine Schwester wohl getäuscht. Ich sag’s ja, der Kalk.«
»Ihre Schwester hat sich bestimmt geirrt«, pflichtete ich ihr bei. »Es tut mir leid, dass ich sie erschreckt habe.«
»Erschreckt?« Sie zog eine Augenbraue hoch.
»Ja, sie wirkte sehr erschrocken.«
»Ach was, ich sagte doch, das ist das Alter. Ich will Sie jetzt nicht weiter stören, wir sehen uns ja wohl öfter, falls Sie wirklich hier bleiben wollen. Aber überlegen Sie sich das gut! Also, auf Wiedersehen, Fräulein Jansen.«
»Auf Wiedersehen, Fräulein Jödt.«
Erschöpft ging ich ins Haus und ließ mich auf die Couch im Wohnzimmer fallen. Jetzt brauchte ich unbedingt eine Zigarette. Ich stand noch einmal auf, holte mein Päckchen aus der Küche und goss mir bei dieser Gelegenheit auch gleich ein Glas Sherry ein. Ein bisschen Genuss hatte ich mir verdient.
Draußen wurde es allmählich dunkel. Was für ein merkwürdiger Tag! Erst der wunderschöne Spaziergang in geradezu euphorischer Stimmung, dann die hysterische Alte, gleich darauf mein sentimentaler Anfall oben auf dem Heuboden und zuletzt dieses Fräulein Jödt mit dt, aber ganz und gar ohne Manieren. Warum mochte ich ihre Schwester dermaßen erschreckt haben? Nun ja, die beiden würden sich an mich gewöhnen. Auf dem Dorf sah man schließlich nicht jeden Tag neue Gesichter, da entstand womöglich zwangsläufig erst einmal Aufregung.
Ich beschloss, meine besinnliche Stimmung durch ein loderndes Kaminfeuer zu untermalen, musste jedoch feststellen, dass kein Brennholz mehr im Haus war. Da stellte sich mir doch demnächst eine Aufgabe! Holzhacken hatte etwas Zünftiges, Urwüchsiges und war bestimmt sehr gesund. In Ermangelung eines wärmenden Feuers führte ich mir die ganze Flasche wärmenden Sherrys zu Gemüte, der seine Wirkung nicht verfehlte. Die nervöse, unbehagliche Stimmung vom Vorabend blieb aus, und ich verbrachte die nächtlichen Stunden in gemütlich dumpfer Zufriedenheit.
4. Kapitel
»Verflixt und zugenäht! Da hol’s der Deibel!« Die Alte konnte fluchen wie ein Droschkenkutscher, wenn sie verärgert war, und das war sie eigentlich immer. Irgendetwas stimmte mit ihrem Braten nicht.
Aus Marias Sicht wirkte es, als tauche die halbe Großmutter in die Backröhre, nur das magere, vorgereckte Hinterteil war noch zu sehen. Den Blick auf die Alte geheftet, warf sie eine geschälte Kartoffel in die bereitgestellte Schüssel und griff sich die nächste.
»Autsch!« Statt der braunen Knolle zu Leibe zu rücken, hatte sie präzise ein Stück ihrer Daumenkuppe gekappt. Wütend lutschte sie an ihrem Finger herum, den metallenen Geschmack frischen Blutes im Mund. Als sie die Wunde betrachten wollte, fielen sofort dicke, rote Tropfen auf die Tischplatte.
»Haste wieder nicht aufgepasst, ungeschicktes Ding! Herrje, Maria, bind dir was drum, das ist ja eine schöne Sauerei!« Die Alte wühlte in den Schubfächern des Küchenbuffets, kramte einen sauberen Fetzen Stoff hervor und riss ihn in schmale Streifen. »Nun zeig schon her!«
Die Magd streckte ihr den Daumen entgegen.
»Na, das ist ein ordentlicher Ratsch, da wirst du wohl einige Zeit deine Freude dran haben!« Geschickt verband die Bäuerin die Wunde. Maria bedankte sich und wischte den Tisch ab, während die Alte weiter vor sich hin schimpfte. »Sapperlot, der Teig ist auch noch nicht gemacht! Das wird ein schönes Essen werden, da wird der Bauer sich wieder freuen. Aber ich hab auch nur zwei Händ’, ich kann schließlich nicht hexen! Könnt mir ja wenigstens einmal rechtzeitig Bescheid geben, wenn er den Herrn Pfarrer zum Essen einlädt. Aber nein, das ist wohl zu viel verlangt. Wozu unnötig den Mund aufmachen, die Alte wird’s schon richten.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!