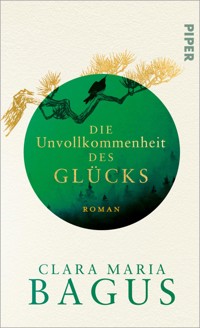9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wenn das Leben zerspringt, macht Clara Maria Bagus aus dem Klang der Scherben Musik.« Wolfgang Herles Kennen Sie dieses Gefühl? Manchmal möchte man einfach aus dem Leben verschwinden. Zwei Frauen, eine Entscheidung, fatale Konsequenzen. Ein vom Leben verwöhnter Mann, über den in einer Vollmondnacht das Schicksal hereinbricht, das alles verändert. Ein anderer, der noch immer die Scherben seiner Kindheit zusammensetzt. Immer wieder streifen sich die Leben dieser Menschen, berühren sich, hauchzart, ohne dass der eine vom anderen weiß. Bis das Schicksal aus ihren persönlichen Geschichten eine einzige macht. Ein Roman, der heilt und uns mit dem Leben versöhnt. Feinsinnig und mit empathischer Sprachkunst erzählt Clara Maria Bagus tief berührend, dass sich das Gute im Leben nicht aufhalten lässt. Bewegend, weise und von poetischer Schönheit »In einer Zeit der schwindenden Gewissheiten, nimmt Clara Maria Bagus uns mit auf die packende innere Reise ihrer Figuren, zu ihren Wunden – und ihrer Heilung.« Eckart von Hirschhausen »Eine Sonate des Lebens. Ein Buch, das tief bewegt, heilt und unvergesslich bleiben wird.« Christoph Keese »Clara Maria Bagus beherrscht die Kunst des heilenden Erzählens.« Nele Neuhaus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meinen Mann Rolf, mein Gegenstück. Und für unsere Zwillingssöhne Numa und Avi, die mir alles bedeuten.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Prolog
Teil I
Das Labyrinth dreier Geschichten
Erste Familie
Zweite Familie
Dritte Familie
TEIL II
Jean-Pierre
Juliette
Jean-Pierre
Virginie
TEIL III
Juliette
Jean-Pierre
Juliette
Jean-Pierre
Juliette
Jean-Pierre
Juliette
Jean-Pierre
Hermes
Jean-Pierre
Juliette
Jean-Pierre
Juliette
Jean-Pierre
Elodie
Hermes und Virginie
Hermes
Juliette
Jean-Pierre
Elodie
Juliette
Jean-Pierre
Juliette und Jean-Pierre
Juliette
Jean-Pierre
Hermes
Léo
Juliette
Binette und Claude
Juliette und Jean-Pierre
Elodie und Juliette
Elodie
Juliette
Margaux und Hermes
Epilog
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Zuerst suchte ich das Leben. Dann suchte das Leben mich.
Prolog
Der Ausgang einer Geschichte hängt davon ab, wo wir sie enden lassen.
***
An die meisten Geschehnisse erinnere ich mich sehr genau, wenngleich einige durch die Zeit ein wenig verfärbt sind wie vergilbte Polaroids. Auch mag mein Gedächtnis einige Details mit der Zeit etwas verwandelt haben. Wie es unser Gehirn mit Erinnerungen macht. Es vermischt die Bilder, fügt sie neu zusammen, lässt aus, ergänzt, schafft eine neue Ordnung, in der wir irgendwann selbst nicht mehr ausmachen können, was umgeformt wurde. Doch ändert das in dieser Geschichte nichts am Wesentlichen der Ereignisse, die wahr und bedeutsam sind.
Es ist Zeit, sie zu erzählen, bevor mein Erinnerungsvermögen versagt und mir die Geschichte zwischen den Händen zerfällt wie brüchiges Papier.
Die meisten Menschen suchen an irgendeinem Punkt in ihrem Leben nach dem Sinn. Sie wollen dem Unsinn ein Ende setzen und versuchen, eine tiefer gehende Bedeutung in den Ablauf der Ereignisse zu bringen – nicht selten, damit sie erträglicher werden. Andere glauben an keinen größeren Zusammenhang, sondern ausschließlich an wissenschaftliche Erklärungen. Für sie kommen und gehen die Tage in rein zufälliger Weise. Reihen sich aneinander und werden zu einer Geschichte, die in ihnen verschwindet.
Doch in jeder Vergangenheit findet man – siebt man sie nur gründlich durch – Fragmente, überdauernd und kostbar, die selbst die Zeit nicht zersetzen kann.
Wer den Mut hat, diese Teile zu sammeln und zu verbinden, erkennt den Sinn des Daseins und den Zusammenhang von allem.
Teil I
Das Labyrinth dreier Geschichten
Erste Familie
Sie hatte es sofort gewusst. Ohne den Anflug eines Zweifels. Und dann hatte sie gespürt, wie es sich in ihr bewegte.
Sie wollte dieses Kind nicht. Sie wollte ihn. Nicht sein Kind. Aber mit diesem Kind würde sie ihn verlieren.
Was immer sie versucht hatte, um das Baby in ihrem Bauch loszuwerden, es war nicht gewichen. Sie hatte wenig gegessen, sich in enge Kleider geschnürt, auf ihren Bauch geschlagen. Vielleicht, so hatte sie am Anfang noch gehofft, würde das Kind durch ihre Ablehnung aufhören zu wachsen und aus ihrem Leben verschwinden. Aber es verschwand nicht.
Dann kam es zur Welt. Und sie fasste es an, ohne es zu berühren. Schaute es an, ohne es zu sehen.
Nun stand sie im Ruderboot, das auf dem See schaukelte, und hielt dieses Baby in den Armen. Ein Säugling, eingewickelt in ein weißes Leintuch. Ein Kind, nicht ohne Ähnlichkeit mit ihm. Ein Sohn.
Ringsum blitzende Spiegelungen der Bläue. Hier und da Fischreiher, die geräuschlos vorbeiglitten. Weiter entfernt schwammen blühende Inseln wie Gärten voller Frühling. Fragmente, die sich über die Jahrzehnte vom Ufer gelöst hatten. Kormorane stoben als dunkle Wolke in den Himmel empor, ein lautloses Geflatter von Schatten.
Sachte legte sie das Kind zwischen ihre Füße ins Heck, setzte sich auf das Brett und umfasste die Ruder. Die untergespülten Luftblasen zerplatzten.
Lange trieben sie so dahin. Die Bläue des Himmels wurde blasser und blasser, dann durchsichtig und füllte sich schließlich mit dem Schwarz der Nacht.
Über ihr dieser riesige Mond, den die Wolken immer wieder verschleierten und der, wenn sie vorübergezogen waren, wie aus einem leeren Himmel silbernes Licht auf das Kind fallen ließ.
Der Grund des Sees wurde sumpfiger. Sie steuerte das Ruderboot durch Buchten von Schilfgras, bis der Bug schließlich ans sandige Ufer stieß. Mit bloßen Füßen, den langen Rock über den Knien zu einem Knoten gebunden, stieg sie aus dem Boot ins Wasser, schob es am Heck die letzten Meter bis auf den Sand. Einen Arm unter seinen Kopf geschoben, den anderen in den Kniekehlen, hob sie das Baby heraus und stapfte durch die schlammige Erde, bis sie hier und da erste Häuser zwischen dem hohen Schilf ausmachen konnte. Mehrmals sackte sie so tief in den feuchten Boden ein, dass sie beinahe mit dem Kind gestürzt wäre, fing sich aber immer wieder und ging keuchend weiter. Bis das Haus der beiden alten Schwestern aufblitzte, von denen bekannt war, dass sie sich Problemen wie diesem annahmen, und es, gelang es einem, rechtzeitig wieder zu verschwinden, für einen aus der Welt schafften.
Sie legte das Kind vor der Eingangstür auf der Veranda ab und lief davon. Ohne sich ein einziges Mal umzublicken. Paddelte zurück in das ihr zugewiesene Leben – bis die Sonne am Horizont hervorkroch und sich über ihr der weite helle Himmel des anbrechenden Tages ausbreitete wie blanker Hohn.
Sie fanden den Säugling mit den ersten Sonnenstrahlen. An das Leintuch ein bloßer Zettel geheftet, auf dem in zittrigen Buchstaben stand: Eine Handvoll Licht. Sonst nichts. Kein Name. Kein Geburtsdatum. Sodass der kleine Junge auf die Frage, wie alt er sei, später immer antworten würde: »fast sechs«, »etwa acht«, »beinahe zwölf«.
In der kommenden Nacht erwachte erstmals die tiefe Sehnsucht in ihr, ihr Kind in den Armen zu halten. Nicht wie ein Bündel von Problemen. Sondern wie eine Mutter ihr Kind hielt. Sie tastete im Bett neben sich in eine Leere, die sie hochschrecken ließ. Erst jetzt begriff sie, was sie getan hatte. Furcht durchflutete sie. Die Furcht, das eigene Kind nie wiederzusehen. Eine Furcht, die sie fast umbrachte. Und zum ersten Mal im Leben wusste sie wirklich, was Angst ist.
Nur noch zwei Wochen verblieben, bis ihr Mann mit der gemeinsamen zwölfjährigen Tochter von einem sechsmonatigen Streifzug durch die Welt zurückkehrte. Sie hätte ihre Familie begleiten sollen, hatte aber am Abreisetag vorgegeben, sich unwohl zu fühlen. Gesagt, sie käme nach, sobald es ihr besser ginge. Und war nicht nachgekommen. Stattdessen hatte sie ein Kind geboren, von dem niemand wusste.
Hinter ihren Lidern immer wieder das Gesicht des Mannes, den sie liebte und der der Vater war. Der, nachdem sie die Liaison – aufgrund der sie in Panik versetzenden Schwangerschaft – beendet hatte, etwas tat, das entscheidender war als alles andere: Er war für immer aus ihrem Leben verschwunden.
Sie irrte durch die Tage. Als eine Woche vergangen war und sich der Schock über ihren Verzweiflungsakt so tief in Glieder und Seele gefressen hatte, dass sie sich kaum noch zusammenhalten konnte, zog sie sich hastig an und rannte hinunter zum Ufer.
Draußen hing ein bleicher Morgen über dem See. Sie löste das Ruderboot und stieg hinein. Paddelte so schnell sie konnte, ohne einmal innezuhalten. Bis sie sich Stunden später der Siedlung näherte und Stimmen zu ihr hinübertrieben.
Zwischen Büscheln von Schilfgras versteckte sie sich und wartete. Das Haus der Schwestern im Blick. Weißes Holz, vier Pfosten, die die Veranda stützten. Blühende Sträucher davor. Über allem ein leerer Himmel.
Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sich die Tür schließlich öffnete und jemand heraustrat. Ein Mann. Eine Frau. Und schon erblickte sie ihn. Ihren Sohn. Das schwarze Haar, das wie nasser Stein glänzte. Die winzigen zu Fäusten geballten Händchen. In den Armen dieser Fremden.
Sie musste es gespürt haben. Tief drinnen gefühlt haben, dass ihn jemand genau an diesem Tag holen und für immer von ihr fortbringen würde.
Aus der Entfernung konnte sie das Gesichtchen kaum erkennen, erst recht nicht das Sternenmuster aus Talgdrüsen an seiner linken Stirn, das sie sich so fest eingeprägt hatte. Doch sein leises, helles Wimmern drang bis in ihr Herz.
Ohne dass sie etwas dagegen machen konnte, verschwand ihr Kind hinter dem Schleier ihrer Tränen.
Unsicher trat sie aus ihrem Versteck hervor, doch es war bereits zu spät. Die Fremde drückte den kleinen Jungen fest an sich, strich ihm über den Kopf, küsste ihn auf die Stirn.
Jeder konnte sehen, was diese Frau hinter sich hatte. Jener Moment musste die Befreiung aus einer langen Zeit voller Sehnsucht und Anspannung sein. Zum Greifen nahe war das aufkommende Gefühl überfließenden Glücks dieser Fremden, das gleichzeitig ihr Unglück bedeutete.
Die alten Schwestern hatten schneller als gedacht Eltern für ihr Kind gefunden.
Sie konnte nichts mehr tun. Ihn nur noch mit den Augen festhalten, ihren kleinen Sohn. Und dieser Blick barg mehr Worte, mehr Wahrheit und mehr Liebe, als sie je hätte aussprechen können.
Dann stieg das Paar mit dem Kind in einen Lloyd Alexander TS, dessen apricotfarbener Lack verblichen und kreidig vom Sandstaub war. Im rechten hinteren Kotflügel hatte er eine tiefe Delle, und der Kofferraum schloss nicht richtig. Die Frau hatte mit dem Baby auf der Rückbank Platz genommen. Der Mann ließ den Motor an. Die Räder wirbelten einen Schleier aus Staub auf, in dem die winzigen Sandkörnchen in der Sonne wie Gold funkelten. Dann fuhren sie davon. Der Wagen wurde kleiner und kleiner, schmolz zu einem schwarzen Strich, dann zu einem winzigen Punkt, der sich schließlich auflöste.
Scharf wie eine Messerklinge durchtrennte dieser Augenblick den Faden, der sie mit ihrem Sohn verband.
Mit den Lippen formte sie die Worte: »Ich werde dich finden. Eines Tages werde ich dich wiederfinden«, während er weiter und weiter von ihr fortgetragen wurde. Sie schloss die Lider. Tränen rannen ihr über die Wangen. Als sie die Augen wieder öffnete, waren sie fort, diese Menschen. Mit ihrem Kind.
Dieses letzte Bild – ihr Sohn in den Armen einer fremden Frau – sollte ein Leben lang in ihren Träumen flimmern. Seine kleinen Hände, zu Fäusten geballt, und der Kuss der fremden Frau auf seiner Stirn.
Das Nachmittagslicht strömte herab auf die Blätter der Bäume, auf die Dächer der Häuser, auf den See. Stille. Etwas spülte über sie hinweg wie eine Welle. Und verschluckte sie.
Zweite Familie
Dieses Geräusch. Es kam von weit oben. Vom Dachboden. Das Mädchen stieg die Stufen hinauf. Und dann entdeckte es sie. Die Hand um den Abzug gelegt, die Mündung fest ans Kinn gepresst und gleich darauf dieser ohrenbetäubende Schuss. Der Kopf der Mutter, der auseinanderflog.
Wie in Trance setzte es zitternd ein Bein vors andere. Nur zwei Schritte. Hielt abrupt inne. Erstarrte.
Das Blut war überall. Ein fein schimmernder Film, wie der Guss auf einer Torte.
Die Frau, die da vor den bloßen Füßen des Mädchens auf dem Boden lag, war kein lebender Mensch mehr. Sie war gar kein Mensch mehr. Nur noch eine Hülle. Eine gesprengte Hülle, und der Mensch war verschwunden. Eine Wirklichkeit wie eine eiskalte Berührung.
Das Schicksal war über das achtjährige Kind hergefallen und hatte ihm die Federn aus den Flügeln gerissen.
Dritte Familie
Atemlos rannte die junge Frau die Straße entlang. Die Luft schlug ihr ins Gesicht wie eine eisige Hand, und die Schwärze der Nacht bohrte sich wie Tausende von Nadeln in ihre Haut. Plötzlich blieb sie stehen. Im Licht einer Laterne gefangen. Sah sich um. Versuchte, sich zu orientieren. Dann lief sie weiter. Bis ans Ende des Weges. Dort, wo nur ein schmaler Pfad durch hohes Gras zum Fluss hinunterführte. Der mit unter Bäumen festgemachten Ruderbooten gesäumt war.
Schmatzender Lehmboden unter ihren Füßen. Und trotzdem eine eigenartige Stille. Im Licht des Vollmonds leuchtete ihr Gesicht weiß. Sie hatte blassblaue, dunkel umrandete Augen, die direkt durch einen hindurchblicken konnten. Einen schmalen Mund. Wachsbleiche Lippen. Schulterlanges, glattes, kupferfarbenes Haar.
Sie stand schon bis zu den Knien im Wasser, als ich sie erspähte. Ich hockte gerade in einem der Boote, rauchte eine meiner Lieblingszigarren und betrachtete den Himmel. Noch bevor ich die Lippen öffnen und zu einem tonlosen »Tu es nicht« formen konnte, war sie im reißenden Fluss untergetaucht. »Mein Gott«, stieß ich hervor, warf meine Zigarre in den Fluss und stand auf. Der Sog des Wassers war ungeheuerlich. In der Ferne konnte ich nur noch hier und da Haut oder ein Stück Stoff aufblitzen sehen, flüchtig den zerbrechlichen Körper ausmachen, der vom Strom mitgerissen wurde. Bis er sich in Ästen und anderem Strauchwerk verfing, das sich vom letzten Sturm angesammelt hatte. Ich stieg aus dem Boot ans Ufer und rannte.
Während ich das zarte Bündel Mensch aus dem Wasser fischte, fielen mir Splitter ihrer Vergangenheit ein.
TEIL II
Jean-Pierre
Seine Blicke griffen nach den Frauen. Doch wenn er sie erst einmal hatte, hielt die Spannung nur in den ersten Augenblicken, und schon flaute die Erregung ab. Es kam vor, dass er aus einem gewissen Gefühl der Verpflichtung heraus eine Frau für kurze Zeit in sein säuberlich geordnetes Leben einpasste, ihr einen bestimmten Wochentag zuwies, ohne sich jedoch auf eine tiefe Beziehung einzulassen oder auch nur einen Hauch von seiner alten Ordnung aufzugeben. Vom Schicksal und der eigenen Familie verwöhnt, durch günstige Vermögensverhältnisse und allerlei daraus resultierenden Privilegien nahezu wunschlos gemacht, galoppierte er auf hohem Ross durch die Welt und verbrachte unvernünftig viel Zeit damit, alles in seinem Leben unter Kontrolle zu halten. Seine Eitelkeit, prickelnd wie am ersten Tag, an dem er festgestellt hatte, dass er ein von der Natur begünstigter, mit Schönheit und Intelligenz beschenkter Mann war.
Jean-Pierre, vierunddreißig, groß und schlank, mit zaghaften ersten grauen Strähnen im schwarzen Haar, markantem Kinn, hohen Wangenknochen, eleganter Nase, gepflegtem Sechstagebart und leicht gebräunt, strahlte auf den ersten Blick die Lässigkeit eines Mannes aus, der mit allem im Leben fertigwerden würde. Erst auf den zweiten Blick konnte ein empfindsamer Mensch erahnen, dass er sich nur besser unter Kontrolle hatte als viele andere Menschen.
Das Auffälligste an ihm waren wohl seine seewassergrünen Augen, mit denen er fast jede Frau betörte. Auf Frauen wie auf Männer hatte er eine anziehende Präsenz. Und doch umgab ihn ein Mantel aus Unnahbarkeit, aus etwas Unergründlichem.
***
Der Winter war in diesem Jahr heftiger als sonst hereingebrochen. In der Ferne zeichneten sich gegen einen schiefergrauen Himmel die Umrisse des Universitätsspitals ab. Die ganze Stadt schneeüberzuckert. Der Wind blies durch die Straßen und brachte eine Kälte mit sich, so durchdringend, dass sie alles berührte. Eine Kälte, die zu früh kam.
Der Abend war eisig. Die Straßen schon dunkel. Jean-Pierre nahm seinen Wollmantel vom Haken, schlüpfte hinein, klappte den Kragen hoch und verließ das Haus. Die Enden seines Schals flatterten im Wind. Als er in die Dunkelheit spähte, die ihn wie eine kondensierte, zähe schwarze Masse zu umschließen schien, schlich sich eine unheilvolle Vorahnung in sein Empfinden, die er sogleich mit einer zuckenden Kopfbewegung abzuschütteln suchte.
Hier und da schloss jemand die Fensterläden, und leise Stimmen schwebten zerbrechlich in der Winterluft.
Er blickte hinauf in den tintenschwarzen Himmel und sah einen riesigen weißen Vollmond, so hell leuchtend, als hätte jemand ein Loch in die Dunkelheit gestanzt. Wie ein Leck im Firmament. Ein einsames Leck, in das all die Helligkeit gesackt zu sein schien.
Ein Gedanke kroch in seinen Kopf, den er nicht zu fassen bekam, eine Angst in seine Brust, wie die Kälte unter seine Kleidung. Unvermittelt spürte er eine tiefe Traurigkeit in sich aufsteigen, die er nie zuvor gekannt hatte. Ihm, den nie etwas sonderlich berührte, schossen mit einem Mal Tränen in die Augen. Ein wenig erschrak er über die Heftigkeit dieses unbekannten Gefühls. Und dann, ganz plötzlich, schnürte es ihm den Hals zu. Er musste innehalten und sich auf eine Bank stützen. Er löste den Schal, öffnete den Mantel. Doch das Gefühl der Enge in seiner Kehle blieb. Auf seiner Stirn glänzte ein feiner Film von kaltem Schweiß. Die Welt schwamm vor seinen Augen. Er setzte sich. Atmete tief ein und aus, bis sich der Druck auf seiner Brust allmählich löste und die Umgebung wieder Konturen annahm.
Ein Moment solcher Deutlichkeit, der über all seine bisherige Erfahrung hinausging. Was war das nur für ein eigenartig stechender Schmerz, der sich in sein poliertes Leben verirrt zu haben schien?
Wahrscheinlich hatte er einfach zu viel Sport getrieben, zu wenig gegessen und geschlafen. Das Übliche. Die vergangenen Nächte im Spital waren lang gewesen. Zu viele Notfälle. Operationen bis in die frühen Morgenstunden hinein.
Vermutlich brauchte er einfach ein wenig Ruhe.
Er stützte sich von der Bank ab, stand auf. Ein letzter Blick hinauf zum Mond, der nun blass am Himmel hing. Und ihm war, als sähe er eine Träne in dem bleichen Gesicht. In einem Gesicht, das in dieser Nacht nur auf ihn herabzublicken schien.
Mit einem Mal wurde es still. Auch der Wind legte sich. Und dann flirrten trompetende Rufe durch die glasklare Winternacht. Ein Schwarm Kraniche schob sich vor die Mondscheibe. Schwarze Silhouetten, mit klaren Rändern in den Mond geschnitten. Von silbernem Licht bestäubt.
Noch Monate später würde er das Gefühl nicht beschreiben können, doch er spürte in diesem Augenblick, dass in dieser Nacht etwas Entscheidendes geschah. Und dass die kommenden Wochen nicht wie die üblichen verlaufen würden, in denen sich die Tage spurlos in die Nächte verflüchtigten, wie in all der Zeit zuvor. Doch dass sie zu solchen werden würden, die seine gesamte Geschichte umschreiben sollten, ahnte er nicht.
In den nachfolgenden Jahren dachte Jean-Pierre oft, dass jene Nacht den Wendepunkt seines Lebens bedeutet hatte.
Juliette
Es war ihr achter Geburtstag gewesen, als ihre Mutter starb. In nur einem Augenblick hatte das Unglück das Herz des kleinen Mädchens gesprengt. Selbst Jahre später waren die Stücke nicht wieder nahtlos zusammengefügt. Risse waren geblieben, durch die schließlich all ihre Kräfte gesickert waren. Bis sich die unerträgliche Leere in ihrem Innern wie Blei angefühlt hatte, das sie jeden Tag tiefer hinabzog. Noch lange sollte sie sich fragen, ob der Tod ihrer Mutter etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun hatte. Warum sonst hatte sie Juliettes Geburtstag für ihren Abschied gewählt?
Ihre Mutter war ihre Landkarte gewesen. Nach dem Verlust hatte Juliette keinen Orientierungssinn mehr. Ganz so, als sei ihr inneres Navigationssystem zerbrochen. Sie war wurzellos geworden, von ihren Ursprüngen abgeschnitten. Und hatte sich schließlich verirrt.
Da ihr niemand die bedingungslose Liebe entgegenbrachte, die eine Mutter einem Kind schenkte, begriff sich Juliette irgendwann als eine Sammlung von Eigenschaften, aus denen sich niemand etwas machte.
Ihr ganzes nachfolgendes Leben lang fühlte sie sich außerhalb. Außerhalb der ihr gebliebenen Familie, außerhalb von Gruppen, von Gesprächen und Situationen. Und um doch ein wenig dazuzugehören, definierte sie sich schließlich durch die Augen anderer. Durch die ihres Vaters, damit sie ihm entsprach. Durch die der beiden Brüder, damit sie ihnen eine akzeptable Schwester war. Durch die Augen der Lehrer, um als unauffällige Schülerin wahrgenommen zu werden, und durch die der Nachbarn, um als anständiges Mädchen gesehen zu werden. Sie wollte gefallen.
Und so jagte sie ein Leben lang einem Ich hinterher, das andere erschaffen hatten. Aber wer war sie wirklich?
Zur jungen Frau herangereift, strebte sie unter der Oberfläche danach, endlich die zu werden, die ihr die Menschen aus ihrer Umgebung in Kindheit und Jugend nicht zugestanden hatten.
Sie wollte nicht mehr diese Person sein, die andere sich für sie ausgedacht hatten. Sie wollte sie selbst sein. Doch sie fand sich nicht.
Wie auch? Niemand hatte es je für nötig gehalten, ihr zu sagen, dass sie ganz bezaubernd, klug und in vielen Dingen, die das Leben brauchte, unheimlich begabt war.
Der Tod ihrer Mutter hatte Juliettes Leben in ein Vorher und ein Nachher geteilt. Und im Nachher war sie nie wieder jemandem begegnet, der ihr das Gefühl gab, aus tiefstem Herzen geliebt zu werden. Was immer Besonderes an ihr war, schien seinen Weg nicht in die Augen anderer zu finden.
Mit dem Verlust der Mutter hatte sie das ganz normale, das kleine, das alltägliche Glück verloren. Dieser brutale erste Zusammenstoß mit der Wirklichkeit hatte ihr alles geraubt, was für das gesunde Heranwachsen eines achtjährigen Mädchens notwendig gewesen wäre.
Nie wirklich wahrgenommen worden, war es nicht verwunderlich, dass sie sich im Erwachsenenalter an der Seite eines Mannes stets fühlte, als verschmelze sie mit dessen Schatten. Inmitten anderer Frauen kam sie sich wie deren Negativ vor. Die Menschen in ihrem Leben waren all das, was Juliette nicht war: anziehend, interessant, selbstsicher, mutig und nahezu angstfrei.
Am Tag, an dem ihre letzte Liaison die Sachen packte, weil er sich in eine andere Frau verliebt hatte, und die Tür hinter sich zuschlug, war ihr, als schrumpfe sie zu einem winzigen, schwarzen Punkt, zu einem Loch im Boden ihres Lebens, durch das sie hindurchfiel.
Auch diese Liebe hatte sie einer Idee geopfert. Nun blieb sie hinter sich selbst zurück.
Seine abschließenden Worte waren wie aufgeworfene Blätter haltlos in der Luft geflattert und widerstandslos zu Boden gesunken. Was hätte sie ihm schon entgegensetzen können? Sein Urteil über ihre gemeinsame Zeit war gefallen wie eine wertlose Münze. Er war Schriftsteller. Oder besser gesagt: Er wollte einer werden. Sie war Lektorin in einem renommierten Verlag. Er hatte sie nur benutzt, um Kontakt zum Verleger zu bekommen. Den er jetzt hatte.
Juliette wollte die Frage nicht stellen, ob ihm je ernsthaft an ihr gelegen gewesen war. Seine Gleichgültigkeit in den vergangenen Wochen war Antwort genug.
Abfällig hatte er sie auf der Türschwelle von oben bis unten gemustert und gesagt: »Was hast du denn geglaubt? Schau dich doch mal an.«
»Aber«, hatte sie gestottert, »hätte es nicht gereicht …«
Er hatte sie unterbrochen und erniedrigend gezischt: »Dich einfach nur als Kontakt zu nutzen? Juliette, Juliette. Du begreifst auch gar nichts. Weil es so mehr Spaß gemacht hat. Und: Im Schlafzimmer war es ja dunkel.« Er riss seinen Mantel von der Garderobe, stieß ihr mit dem Finger gegen das Brustbein und sagte: »Du bist für mich wie irgendeine Frau, die zufälligerweise neben mir auf dem Bahnsteig steht. Ich habe dich kurz bemerkt, möglich, aber es ist mir so was von egal, ob du in den Zug einsteigst oder dich einfach auf das Gleis wirfst.«
Dann sprang er auf den Zug seines Lebens auf, während für sie der verlassene Perron den sicheren Tod bedeutete.
Ihre Seele im freien Fall.
Nichts als Kälte war in seinen Augen gewesen. Mit Mühe hatte sie versucht, ihre Ohren gegen das Gewicht seiner Worte zu verschließen. Hatte versucht, sich gegen die Wellen der Verzweiflung zu stemmen, die ihren Körper, ihre Seele durchfluteten und sie schließlich verschluckten.
Sie war allein zurückgeblieben. In ihrer kleinen Wohnung. Die ohne einen anderen Menschen nicht nur unbewohnt wirkte, sondern leer. Auf eine endgültige Weise.
Das Gesicht in den Händen vergraben, zitterte sie am ganzen Körper. Hockte auf dem Boden. Zwischen den Trümmern ihrer Träume.
Am Morgen noch schien alles in Ordnung gewesen zu sein, und dann plötzlich war der Tag auseinandergesprengt und hatte alles, was Juliettes Leben ausgemacht hatte, in Fetzen zerrissen. Und ihre ganze Vergangenheit war auf sie niedergestürzt, wie ein Haus, dessen zerklüftetes Fundament schließlich eingekracht ist.
War es je in Ordnung gewesen? Ihr Leben? Seit sie sich erinnern konnte, war es immer nur ein Kampf. Der mit dem plötzlichen Tod ihrer Mutter an Juliettes achtem Geburtstag begonnen hatte und nicht enden wollte.
»Es ist tatsächlich so«, dachte Juliette, »dass eine große Katastrophe einen nicht vor den kleinen schützt. Obwohl sich das gerechter anfühlen würde.«
***
Die winterliche Nachmittagssonne sickerte durch die halb heruntergelassene Jalousie und tauchte den Raum in schwefelgelbes Licht. Ein Licht, das mit all seinem Gewicht auf ihre Schultern drückte.
Juliette kniff die Augen zusammen und kroch auf allen vieren zum Fenster. Sie zog sich am Fensterbrett hoch und wagte einen Blick hinaus, bevor sie das Rollo ganz hinunterließ. Es schneite unaufhörlich. Dicke, schwere Flocken fielen vom Himmel herab.
Noch sachte erkannte sie seine Fußspuren im Schnee. Wie schwarze Wunden im Weiß.
Sie öffnete das Fenster. Streckte ihre Hand hinaus, versuchte, ein, zwei Schneeflocken zu fangen. Und betrachtete ihre Handfläche. Nach dem Glück zu greifen war genauso, wie nach Schneeflocken zu greifen. Sobald man es hatte, löste es sich auf.
Endlich war es Nacht im Zimmer. Wie Samt fühlte sich die Dunkelheit an. Und die Stille schmiegte sich um Juliette wie ein Tuch aus feinster Seide.
***
Als sie am nächsten Tag erwachte, die Jalousien öffnete und im Fenster ihr sich spiegelndes Gesicht erblickte, sah sie eine alt aussehende junge Frau mit eingefallenen Wangen und erloschenem Blick, aus der das Leben entwichen war. Sie war verwelkt, noch ehe sie in voller Blüte stand.
Juliette erschrak über die Müdigkeit, über die Erschöpfung, die ihr in jede Gesichtsfalte eingeschrieben stand. Sie war wie eines dieser Pakete, auf denen rundherum schreiende Etiketten mit der Aufschrift Vorsicht Glas! Zerbrechlich! klebten und in denen die Scherben dennoch klirrten. Juliette wandte sich ab, zwang sich in ihre Kleider. Sie musste zum Verlag. Ihr Beruf war alles, was ihr geblieben war.
Weil ihr die eigene nicht gelang, flüchtete sie sich gern in die Geschichten der anderen. Wenn sie selbst schon kein eigenes erzählenswertes hatte, konnte sie wenigstens in den Leben anderer verschwinden.
Die Wochenenden verbrachte sie am liebsten in Bibliotheken. Sie waren für Juliette wie eine andere Welt. Eine Welt, mit deren Geschichten sie sich zu vervollständigen suchte.
Wie gern kröche sie beim Lesen der unzähligen Romane zwischen den schwarzen Zeilen hindurch und schlüpfte einfach hinein, in ein anderes Leben. In das gewöhnliche Leben von gewöhnlichen Menschen.
Und wenngleich sie am Ende eines Buchs oft allein inmitten einer stillen Leere zurückblieb, so kam es vor, dass eine Hoffnung zwischen den Zeilen herausraschelte, hauchfein. Eine Hoffnung auf die Möglichkeiten der Welt.
***
Die nachfolgenden Tage trieben fort in einer schmerzhaften Einsamkeit.
Mit jedem Blick in den Spiegel schien Juliettes Gesicht durchscheinender zu werden. Es wurde blasser und blasser. Undeutlicher. Bis eines Abends ein bloßes, mit wässriger Farbe ins Nichts gemaltes Oval übrig war.
Das, was sie jahrelang befürchtet hatte, mit Wänden und Tapeten, ja, sogar mit Fußböden zu verschmelzen, da sie kaum jemand je wahrnahm, war passiert. Sie war unscharf geworden. Ein Schmierfleck. Eine Frau, die aus dem Leben ausradiert und nur noch hauchzart sichtbar war.
Genauso unsichtbar hatte sie gelebt. Wenn sie ginge, würde sie die Leben anderer ebenso geräuschlos verlassen, wie sie sie betreten hatte, dachte Juliette.
Sie starrte aus dem Fenster. Es hatte zu schneien aufgehört. Nebel hatte die Straßen in ein Grau gekleidet, das alles verschluckte. Es war so still, dass Juliette das Verstreichen der Zeit kaum bemerkte.
Sie dachte an ihre Mutter, die, soweit sich Juliette erinnern konnte, immer von einer tiefen Traurigkeit durchwoben war. Von einer Sehnsucht, die stets aus ihren Augen gesprochen hatte. Eine, die Juliette von sich selbst kannte. Es war eine unnennbare, unstillbare, tiefe Sehnsucht, die brannte.
Plötzlich dachte Juliette an ihn. An ihre erste große Liebe. Damals. Im jungen Erwachsenenalter. Es war ihre einzige Liebe gewesen, wenn sie ehrlich zu sich war. Eine hingebungsvolle, tiefe Liebe. Doch er hatte nicht dasselbe empfunden. Liebe konnte man sich nicht befehlen.
Wie sollte ein anderer sie lieben können, wenn es nicht einmal ihr selbst gelang?
Was hatte sie in all den Jahren seit damals getan? Im Grunde war sie immer nur damit beschäftigt gewesen, das, was in ihrer Kindheit in Stücke zerbrochen war, wieder zusammenzusammeln.
Nicht alles konnte man reparieren. Aber manchmal konnte man die Scherben wieder zusammenfügen. Nicht so wie vorher. Aber anders. Und manchmal war das, was daraus entstand, sogar schöner. Das hatte ihr zumindest ihre Großmutter Geneviève weismachen wollen. Juliette sah das nicht so.
Es war der einunddreißigste Dezember. Juliette war inzwischen neunundzwanzig Jahre alt, und nichts hatte sich geändert. Die Zeit war ihr wie Sand aus den Taschen gerieselt.
Sie hatte nichts mehr zu verlieren. Und fasste einen Entschluss.
Auf dem Schreibtisch stapelten sich ungelesene Manuskripte auf der einen, Briefe und Rechnungen auf der anderen Seite. Bis sie in der Unordnung leere Papierbögen gefunden hatte, dauerte es eine Weile. Schließlich zog sie unter dem Poststapel welche hervor, setzte sich, griff nach dem Füllfederhalter, schnippte den Deckel weg und begann zu schreiben.
Und veränderte damit nicht nur ihre eigene, sondern auch die Geschichte eines anderen Menschen.
***
Nach Stunden fiel ihr der Füllfederhalter aus der Hand, und ein Tag, der nie richtig hell geworden war, wurde schließlich von der Dunkelheit verschluckt.
Juliette faltete die Briefbögen zusammen, steckte sie in ein Kuvert, klebte es zu und kritzelte Namen und Adresse darauf. Auf dem Weg ins Badezimmer ließ sie den Umschlag auf die Kommode am Eingang fallen.
Sie drehte den Hahn des Lavabos auf, formte mit den Händen eine Schale, ließ Wasser hineinlaufen und klatschte es sich ins Gesicht. Nur nachlässig trocknete sie sich ab, bevor sie den Kopf hob und in den Spiegel schaute. Es war seltsam. Je länger sie ihrem eigenen Blick standhielt, desto bleicher wurde ihr Gesicht. Verlor zunächst die Konturen und löste sich dann von den Rändern her immer weiter auf. Bis sie ganz verschwunden war. Und kein Spiegelbild mehr warf. Eine Frau ohne Widerschein, ohne Echo. Eine Frau ohne Gesicht. Eine Frau, die nicht existierte.
Für einige Sekunden krallte sie sich mit den Händen am Waschbecken fest, klappte dann die Türen des Spiegelschränkchens auf und nahm die Tablettendöschen heraus. Fast ein Jahrzehnt hatte sie sie gesammelt.
Wenn Juliette recht überlegte, beendete sie heute lediglich, was vor Jahren mit der ersten Kapsel begonnen hatte. Damals, als bereits ein winziges Stückchen ausgereicht hatte, um ihre Gedanken und Gefühle herrlich zu betäuben. Um sie benommen zu machen und in den Schlaf zu spülen.
Wie sehr hatte sie sich auf die braven Tabletten verlassen, die ihren Kopf behaglich einnebelten, sie am Denken hinderten, wenn das Leben zu schmerzhaft wurde, und sie in warmes, weiches Vergessen hüllten. Doch mit der Zeit hatte sie immer größere Mengen gebraucht, um die gleiche Beruhigung zu empfinden. Bis die guten Kapseln ihre magische Kraft scheinbar ganz verloren hatten und nur noch in exorbitanten Mengen in der Weise wirkten, wie Juliette es brauchte.
Da hatte sie mit dem Sammeln begonnen. Es war nicht schwer. Ihr Arzt hatte Monat für Monat das Rezept erneuert, ohne Fragen zu stellen. Anscheinend war das ganz gewöhnlich in der heutigen Zeit.
Sie drehte einen Deckel nach dem anderen auf und schüttete die Pillen in ihre Handfläche. Dann schloss sie den Schrank und blickte ein letztes Mal in den Spiegel. Nichts. Sie war bereits jetzt nicht mehr da.
Juliette hockte sich auf den Rand der Badewanne und betrachtete die Kapseln leicht verschiedener Farbe und Größe. Über die Jahre hinweg hatten sich die Hersteller geändert, der Wirkstoff war gleich geblieben.
Vermutlich würde sie nicht viele brauchen. Aber wer wusste das schon. Schließlich brachte sie sich zum ersten Mal um.
Während sie mit den Fingern über die Pillen strich, überlegte sie, ob sie danach einfach im Schlafzimmer zwischen die Laken kriechen sollte. Aber nein. Sicherer war es hier. Im Bad.
Kurz schloss sie die Augen. Hinter ihren Lidern tanzten die wenigen schönen Erlebnisse ihres jungen Lebens wie zaghafte Lichtpunkte, eilten aber immer rascher vorbei. Wurden schließlich von den viel größeren Schatten ihrer Tage verschluckt, die sie wieder zu sich selbst führten. Zu ihrer luftleeren Gegenwart.
Es half nichts, sich eine in weiter Ferne liegende, vielversprechendere Zukunft zu erträumen. Es hatte noch nie geholfen. Umhergeirrt war sie lange genug. Zu viele Jahre. Zu viel Vergangenheit, in der der Schmerz wie eine Schlingpflanze in ihr gewuchert war und ihre Seele langsam erwürgt hatte. Die Zeit hatte ihre Illusionen davongefegt. Juliette glaubte nicht mehr an das Glück, sich ein anderes Leben einrichten zu können als jenes, welches das Schicksal ihr ihrer Meinung nach zugedacht hatte.
Sie schlug die Augen auf und besann sich. Die eine Hand zu einer Faust geformt und die Pillen haltend, stand sie auf und ließ mit der anderen Hand Wasser in die Wanne einlaufen. So heiß, dass sie die Finger kaum hineinstecken konnte. Der Dampf stieg zur Decke hinauf und beschlug das Glas im Oberlicht. Juliette öffnete die Handfläche, betrachtete die vielen bunten Kapseln ein letztes Mal.
Sie hielt mich in der Hand. Oder hielt ich sie?
Noch ein letzter prüfender Blick in den Spiegel. Nichts als Leere. Sie war nicht mehr da.
Juliette schloss die Augen. Schluckte eine Tablette nach der anderen. Spülte sie mit wenig Wasser hinunter. Tauchte mit dem Fuß in die Wanne ein. Ließ sich dann, ganz langsam, Zentimeter um Zentimeter, hineingleiten. Bis ihr das Wasser bis zum Hals stand.
Sie legte ihren Kopf in den Nacken und blickte hinauf zum Fenster. Dort oben in der blauschwarzen, schweigenden Nacht hing einsam ein riesiger, ungewöhnlich leuchtender Vollmond. Und dann löste sich aus dem Silber des Mondes etwas heraus, eine Verschiebung von lichtgrau auf lichtgrau. Und dann sah sie sie, als sie ins Schwarz hineinsegelten. Kraniche. Und den feinen Glimmer ihrer Flügel im Silber des Mondlichts, der auf sie herabzuregnen schien. Bis der Mond verblasste. Es musste an der Gedämpftheit liegen, mit der die Kapseln ihr Hirn einhüllten, und die allem eine seltsame Unwirklichkeit verlieh.
Eine schwarze Schläfrigkeit kroch ihr durch die Adern, tröpfelte nach und nach in ihren Geist.
Sie starrte auf die Risse in der Decke. Es kam nicht mehr darauf an. Es war nie darauf angekommen. Bald würde es vorbei sein. Sie schloss die Augen.
Jean-Pierre
»Jean-Pierre?«, fragte der Assistenzarzt, der sich wie alle anderen im grünblauen Kittel, die Ärmel weit hinaufgeschoben, gerade Hände und Unterarme desinfizierte.
»Schon im OP«, sagte die Schwester der Notaufnahme. »Vermutlich schüchtert er gerade das Skalpell mit seinem Blick ein.«
»Das wird er heute nicht brauchen«, drang eine entfernte Stimme zu ihnen durch. »Unterkühlung. Junge Frau nach Suizidversuch. Nach Angaben der Rettung lange im Wasser getrieben, ehe sie herausgefischt wurde.«
Jean-Pierre stand wie immer vor allen anderen bereit, nicht selten, um seine Umgebung in den Dunst seiner Arroganz zu tauchen. Stets umwehte ihn ein gewisser Übermut. Für ihn, bereits als junger Mann leitender Oberarzt der Notfallstation, war es keine Frage, dass er schon bald in die Fußstapfen seines Freundes und Chefarztes Hermes schlüpfen würde.
Doch in dieser Nacht zeichneten Furchen seine Stirn. Dieses seltsame Geschehnis draußen auf der Straße – seine Atemnot, der Mond, die Kraniche – saß ihm noch in den Gliedern.
Jäh wurde er aus seinen Gedanken gerissen, als die Aluminiumtüren unter Hast aufgestoßen und die leichenblasse junge Frau mit lilafarbenen Lippen in den grün gekachelten, grell ausgeleuchteten Raum geschoben wurde.
Hektik verbreitete sich, Ärzte und Schwestern eilten herbei, Monitore wurden eingeschaltet, jeder nahm seinen Platz ein.
»Ausgangskörpertemperatur: vierundzwanzig Grad«, sagte einer der Sanitäter, »langsame, unmerkliche Atmung, weit geöffnete Pupillen, aber nicht starr. Puls schwach tastbar. Blutdruck kaum messbar. Jetzt fünfundzwanzig Grad.«
Jean-Pierres Blick glitt kühl über die Kollegen hinweg, als sähe er sie nicht. Er beugte sich über die Trage. Der Rumpf der bewusstlosen Frau war in Decken gewickelt.
Mathieu, ebenfalls Oberarzt und genauso wenig Freund weichgespülter Worte wie Jean-Pierre, hob die Frau sachte an.
»Nicht bewegen!«, schrie Jean-Pierre.
»Wenn ihr mich fragt, ist da ohnehin nichts mehr zu machen«, sagte Mathieu.
»Dich fragt aber keiner«, sagte Jean-Pierre. »Mir ist zumindest noch keiner gestorben!«
»Das kommt schon noch.«
»Ich bin ja nicht du.«
»Aber du bist auch nicht der, für den du dich hältst. Was, liebe Kollegen, ist wohl der Unterschied zwischen Jean-Pierre und Gott? Gott hält sich nicht für Jean-Pierre!«
Ein Raunen.
»Klappe!«, zischte Jean-Pierre, »weiter beatmen, und wärmt sie langsam zu den Extremitäten hin auf. Und noch mal: Nicht bewegen! Komm schon, komm schon«, sagte Jean-Pierre mehr zu sich selbst, »hier wird nicht gestorben. Bei mir nicht.«
»Du siehst grauenhaft aus heute, Jean-Pierre. Ärger im Paradies?«, sagte Mathieu.
»Spar dir dein Mitgefühl und konzentrier dich auf das, wozu wir hier sind«, sagte Jean-Pierre.
»Noch segelst du im Strom von Hermes’ Ruhm dahin, aber pass nur auf, dass du mit deinen Anstrengungen, so zu werden wie er, nicht in Zweitklassigkeit stecken bleibst.« Mathieu stieß ein schmutziges Lachen aus.
Überall flackerten Monitore.
Die Wachsamkeit dieses Raumes, mir das Licht auszulöschen, sobald ich mich auch nur millimeterweise näherte, war in jedem Winkel zu spüren, in jedem Gesicht zu sehen.
Allseits Blinken und Warnzeichen. Der Puls der jungen Frau verlangsamte sich, ihr Herzschlag zeichnete auf dem Bildschirm unregelmäßige Zacken aus Strom, die immer flacher wurden.
Ihre Zeit wurde dünner. Jean-Pierre sah in die Runde. Sah die Gedanken seiner Kollegen. Und dann blickte er sie an. Diese zarte, junge Frau. Die wie eine kaputte Puppe unter seinen Händen lag.
Er betrachtete ihren Körper, ihre durchscheinende Haut, durchzogen von Venen direkt unter der Oberfläche, wie die feinen Bänder in weißem Marmor.
Mit den Fingern hob er ihre Lider, sah in ihre Augen und damit in ein blassblaues Gewässer.
Ende der Leseprobe