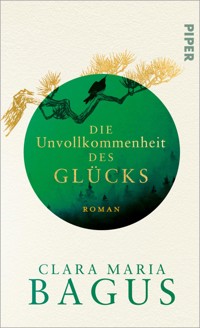9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die großen Themen unseres Lebens: das Streben nach Glück, das Suchen und Finden der Liebe, die Rolle des Zufalls, der Sinn unseres Daseins – alle sind in diesem weisen, großartigen Roman verdichtet zu einem sprachlich überwältigenden Werk.« Markus Lanz
Eine falsche Entscheidung, die das Leben dreier Familien für immer verändert: Ein Richter zwingt die Krankenschwester Charlotte, sein sterbenskrankes Neugeborenes gegen ein gesundes zu tauschen. Folgt sie seiner Drohung nicht, entzieht er ihr den Pflegesohn. Die Welt aller Beteiligten gerät aus den Fugen, doch hinter allem wirkt der geheimnisvolle Plan des Lebens …
Können wir im falschen Leben das richtige finden? Wie öffnet man sich einem neuen? Wie lässt man los? Mit großer sprachlicher Kraft und Anmut zeigt die Autorin, dass jeder seine Lebenskarte bereits in sich trägt und alles auf wundersame Weise miteinander verknüpft ist.
In diesem Roman findet jeder seine Farbe von Glück.
»In manchen Büchern liest man eine Wahrheit, die passt gerade so sehr ins eigene Leben, dass sie unmittelbar ins Herz trifft und einem den Atem nimmt – dieses Buch ist voll von diesen Dingen.« Alexandra Reinwarth
»Ein weiser, anmutiger Roman. Clara Maria Bagus beherrscht die Kunst des heilenden Erzählens.« Nele Neuhaus
»So zärtlich hat noch niemand vom Glück erzählt, das aus Unglück wächst. Eine federleicht und doch psychologisch raffinierte Reise ins magische Reich der Seele. Traurig und tröstlich zugleich. Ein großes Geschenk.« Wolfgang Herles
»Ein wunderbarer Roman über die Liebe und ihre vielen überraschenden Erscheinungsformen. Großartig komponiert, voller Weisheit, Emotionalität und Zuversicht. Selten war ich am Ende eines Buches so dankbar, Zeit mit ihm verbracht zu haben.« Jean-Remy von Matt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Farbe von Glück« an empfehlungen@piper.de, und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Personen und Handlung dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit einer lebenden oder verstorbenen Person ist zufällig.
© Piper Verlag GmbH, München 2020
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Liebeserklärung
Oft sind wir auf der Suche. Ohne zu wissen, wonach. Für jene, die suchen.
1
Menschen unterscheiden sich in ihren Träumen. In ihren Hoffnungen sind sie alle gleich.
Antoines Geschichte beginnt zweimal. Einmal mit dem Tag seiner Geburt. Und ein zweites Mal, sechs Jahre später, am Tag, an dem seine Mutter Marlene verschwand.
Es war viel zu früh, um zu sterben. Und schlimmer noch als der Tod war das Schicksal, an das Antoine seine Mutter verlor.
»Warte hier«, hatte Marlene zu ihrem Sohn gesagt. »Warte hier, bis ich zurück bin.«
Er war ihr bis zum Gartentor gefolgt, weinte, krallte sich an ihrem Oberschenkel fest, flehte sie an, ihn mitzunehmen. Aber Marlene ging einfach weiter. Versuchte ihn von ihrem Bein abzuschütteln wie eine lästige Fliege. Setzte einen Fuß vor den anderen. Ohne zu ihm hinabzublicken.
»Lass das.«
»Wann kommst du wieder?«
»Rechtzeitig.«
»Wann ist rechtzeitig?«
Marlene wandte sich ihm ein letztes Mal zu, hockte sich vor ihn auf den sandigen Kiesweg, zerzauste ihm das Haar, nahm sein Gesicht für einen Moment in ihre Hände und sagte: »Warte einfach.«
Zweifel blitzten in Antoines Augen auf. Marlene fuhr mit der Handfläche über den feuchten Lehmboden und schrieb ihm mit der an ihren Fingern haftenden Erde etwas auf die Stirn. Dies alles geschah mit einer gewissen Endgültigkeit, die er damals nicht verstand.
Schließlich stand sie auf, drehte sich um, schob den Holzriegel nach hinten, öffnete die Tür und trat, ohne sich nochmals umzudrehen, durch das gemauerte Tor hinaus auf die Straße. Sie ließ ihren Sohn allein zurück – ohne die Zukunft, die sie ihm versprochen hatte. Zog in eine ferne Welt, die Antoine viele Jahre verschlossen bleiben sollte.
Er folgte mit seinem Blick jedem ihrer Schritte über den Pfad, der sich an Weizenfeldern entlang und zwischen Trauerweiden hindurchschlängelte, bis sie sich in dem sie immer stärker umgebenden Geäst auflöste, Teil von ihm wurde. »Mama«, schrie er ihr nach, als der blaue Zipfel ihres Kleides endgültig verschwunden war. Ein Schrei, der alles durchschnitt, als ob sie ihm das Herz entrissen hätte. Ein Schrei, der jedem, der ihn hörte, in der Seele wehtat.
Die Zeit verlangsamte sich, bis sie ganz stillstand. Allein stand er da in einem bloßen löchrigen weißen Pyjamahemd. Auf dem Kiesweg. Auf Steinchen, die sich in seine Fußsohlen bohrten. Und wartete. Stunden. Den ganzen Tag. Im Regen, der in feinen dünnen Fäden vom Himmel fiel.
Er sehnte sich nach irgendetwas Vertrautem, an das er sich klammern könnte. Selbst der Garten, das Haus, alles um ihn herum erschien ihm plötzlich fremd. Ohne sie.
Und noch bevor der Vorhang der Dunkelheit auf ihn herabsank, buchstabierte ihm sein Verstand in aller Klarheit, was er bereits geahnt hatte: Sie würde nicht zurückkommen. Sie würden sich auf diese Weise nicht wiedersehen.
Umgeben von Pfützen mit kaffeebraunem Wasser, schrumpfte er auf der matschigen Erde zu einem triefenden Schmutzbündel zusammen.
Schon am Morgen hatte sich Antoine gewundert, dass Marlene, im Haus hin und her schreitend, ihre Sachen zusammensuchte und in eine Tasche stopfte. Schon am Morgen hatte er ein unbehagliches Gefühl, als er sah, wie sie vor dem Spiegel stand, eine Schere in der Hand, und sich die Haare abschnitt. Wie sie ihr prächtiges schwarzes Haar in Zeitungspapier einschlug und es ins Kaminfeuer warf. Wie sie sich ein blaues Kleid aus Wolle überzog, das ihrem gewöhnlichen Stil überhaupt nicht entsprach. Schon am Morgen war ihm unwohl, ohne zu wissen, dass er nach diesem Tag viele Jahre brauchen würde, um die Teile seines blauen Himmels wieder zusammenzusetzen.
Antoine stellte sich eine Frage nach der anderen. Versuchte, eine Tür ins Ungenannte aufzustoßen. Doch auf manche Fragen gibt es keine Antworten. Bloß Erinnerungssplitter, die unbeschriftet bleiben. Bilder, die fortdauern. So auch das Bild seiner Mutter. Wie sie in ihrer schmalen Statur zum Gartentor schritt, ohne sich noch einmal umzudrehen. Wie sie in die letzte Woge des frühmorgendlichen Laternenlichts trat und für immer daraus verschwand.
Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Sie trocknet sie nur aus. Warum verlässt eine Mutter ihr Kind? Ohne Nachricht, ohne Erklärung. Warum geschehen Dinge, die uns dazu veranlassen, uns ein ganzes Leben lang die Frage nach dem »Warum« zu stellen? Ein Warum, dass uns aushöhlt wie ein Wurm eine Frucht.
Was sich über Antoine zu diesem Zeitpunkt sagen ließ, war, dass ihm alles Schreckliche, was einem Kind passieren konnte, bereits passiert war. Viel zu früh hatte er lernen müssen, dass Menschen selten die sind, für die wir sie halten. Und auch selten da sind, wo wir sie brauchen.
Und doch durfte er gleichsam erfahren, dass es immer irgendjemanden gibt, der aus einem Winkel der Welt zusieht. Und der plötzlich da ist. Bei uns. Für uns. In seinem Fall war es Charlotte.
Charlotte stand plötzlich da. Vor Antoine. Im Garten. Er sah sie nicht. Aber er spürte sie. Der kleine Junge hockte in der durchfeuchteten Erde. Sein gelocktes Haar war vom Regen glatt geworden und klebte an seiner Kopfhaut. Das eisige, nasse Pyjamahemd pappte an seinem Körper und ließ die Haut hindurchschimmern. Er zitterte. Dünne, lilafarbene Äderchen durchzogen die Lider seiner geschlossenen Augen. Es war eine feuchte, kalte Nacht mit eisigem Wind. Noch viele Jahre später sollte sich Charlotte daran erinnern. Wolken wie schwarze Blutflecken, ganz so, als ob der Himmel spiegelte, was auf der Erde passierte.
Der Junge schlug die Lider auf. Augen schimmernd wie Grünspan starrten in die weichen Züge einer jungen Frau. Sie mochte Anfang zwanzig gewesen sein. Charlotte kniete sich vor Antoine hin, streckte ihre Arme nach ihm aus. Und als sie seine Schultern berührte und ihn mit ihren sanften, gütigen Augen ansah, schnitt der Mond am Himmel eine Sichel aus der Schwärze der Nacht. Das war das erste Wunder dieser Geschichte.
Charlotte strich ihm übers Haar, über den Rücken. Als ihr Blick auf seine Stirn fiel, stiegen ihr augenblicklich Tränen in die Augen, die sie wegzublinzeln versuchte. Der kleine Junge hatte schon viel zu viel Schmerz in seinem kleinen Herzen. Wie sollte er noch verkraften, was da in großen schwarzen Lettern auf seiner Stirn stand?
Ihm entging nichts. In Charlottes Ausdruck suchte er nach Hinweisen auf das, was ihm seine Mutter ins Gesicht geschrieben hatte. Suchte in ihren Augen nach der Antwort darauf, warum seine Mutter fortgegangen war.
Die Tränen einer fremden Frau waren Antwort genug. Nicht für das Warum. Aber für die Endgültigkeit. Charlotte rieb sich die Augen mit den Handrücken und lächelte ihn an. Und in der schwärzesten Nacht seines bisherigen Lebens sah er plötzlich einen hellen Stern.
»Komm mit mir«, sagte sie schließlich.
Antoine zitterte.
»Wer bist du?«, fragte er. Seine Stimme nur ein kraftloses Flüstern.
»Eine Freundin«, sagte sie. »Oder wenigstens möchte ich das gern sein.« Ihre Stimme klang weich und freundlich. »Was meinst du, Antoine, einen heißen Kakao?«
»Woher kennst du meinen Namen?«
»Ich weiß vieles über dich, mein Kleiner.«
»Was? Was weißt du? Wo meine Mama ist? Wann sie wiederkommt?«
»Nein«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid. Das weiß ich nicht.« Sie strich ihm über die Arme, stand auf, nahm seine kalten in ihre warmen, weichen Hände und sagte: »Komm, lass uns gehen.«
»Ich kann nicht mit dir kommen. Ich muss auf meine Mama warten. Sonst ist sie traurig, wenn sie zurückkommt und ich nicht hier bin.«
Charlotte nickte. »Ich verspreche dir, wenn deine Mama zurückkommt, werden wir da sein.«
Von diesem Moment an wurde Charlotte zu seiner einzigen Insel an Wärme im Meer aus Kälte, das ihn umgab. Sie wusste, wie man auf einen kleinen Jungen zugehen musste, der von seiner Mutter verlassen worden war.
Sie kannte viele Lebensgeschichten. Geschichten, die sich niemand hätte vorstellen können. Geschichten, auf die niemand gefasst war. Und die es dennoch gab. Immer wieder. Und überall.
Ihre Augen hatten die Schicksale anderer gesehen. Ihre Seele die eigenen. Etliche Landschaften des Lebens trug sie in sich. Ohne zu verzweifeln, ohne zu verbittern.
Während er auf seine Mutter gewartet hatte, hatte Antoine nicht bemerkt, wie sich die Kälte mit der eindunkelnden Nacht auf die Erde gelegt hatte, wie sie in seine Lungen gedrungen war. Starr war sein Blick in die weite Ferne gerichtet gewesen, in der das blaue Kleid von Marlene verschwunden war. Bevor er niedergeschlagen die Augen schloss. Dort, an diesem Punkt, so glaubte er noch Wochen später, würde der flatternde Stoff aus blauer Wolle als Erstes wieder zu sehen sein. Antoine würde sie zuerst erblicken. Und noch jemanden: seinen Vater. Hand in Hand würden sie auf ihn zukommen: seine Eltern. Er würde aufspringen, aus dem Haus eilen, ihnen winken und zurufen. Sie würden auf ihn zulaufen, zunächst langsam, dann immer schneller. Den Hang hinunter, die Straße entlang, durch das Gartentor. Marlene würde sich vor ihm auf die Kieselsteine werfen, ihn fest in ihre Arme schließen und nie wieder loslassen. Sie würde das tun, was eine Mutter tut. Ihn halten, lieben und beschützen.
Lange sollte sich Antoine an dieses Fragment eines Winters erinnern, in dem jegliche Ordnung zerstört worden war, die es für einen Sechsjährigen eigentlich noch hätte geben müssen. An jene ersten Tage und Nächte in Charlottes Haus. An Mauern, von denen der Putz abblätterte. An Wände, an denen abgehängte Fotos einer anderen Zeit Schatten hinterlassen hatten. An Decken, deren Farbanstriche Blasen warfen. An das leise, monotone Tropfen, das von einem undichten Dach herrührte. Daran, wie das Licht der Kerze Charlottes Zimmer füllte, wie es das Dunkle von ihren Gesichtern wusch und der Welt wieder ein bisschen Farbe gab.
Charlotte bewohnte ein kleines, heruntergekommenes Haus. Auch von der Außenfassade schälte sich die weiße Farbe. Hier und da waren Ziegel gebrochen oder fehlten ganz. Es stand nur wenige Straßen entfernt von Antoines Elternhaus. Auch roch es darin genauso. Es war der Geruch von Armut. Zu Hause hatte er das nie so empfunden. Das Elend war ihm dort nie aufgefallen. Zu Hause hatte er eine Mutter. Sie war sein Reichtum gewesen. Auch wenn er sie nicht wirklich gekannt hatte. Auch wenn er in den sechs Jahren, die sie miteinander verbracht hatten, nicht einen Zipfel ihres Lebens zu fassen bekommen hatte. Aber immerhin hatte er eine Mutter gehabt. Jetzt hatte er nichts mehr. Glaubte er zumindest.
Beschämt über sein schmutziges Aussehen, betrachtete er sich im Spiegel. Regenwasser tropfte ihm aus den Haaren, rann über seine gezeichnete Stirn, ohne die verkrustete Erde wegzuwaschen. Er starrte auf das Wort, das sein Gesicht befleckte, und zeichnete es mit den Fingern nach.
»Was steht da?«, fragte er.
»Warum kommst du nicht erst mal herein und nimmst ein heißes Bad«, sagte Charlotte. Ihr Blick hatte genügt.
Schweigend führte sie ihn in den Waschraum. Erst dort fielen ihr noch nicht verheilte, jüngste Verbrennungen an seinen Handflächen auf. Über seine Handrücken spann sich ein Netz aus Narben. Charlotte hockte sich neben die Badewanne, tauchte den Schwamm ins warme Wasser und strich ihm damit sanft über die Stirn. Spülte das letzte Wort seiner Mutter davon, in der Hoffnung, neben dem Sichtbaren auch das Unsichtbare für immer wegzuwischen.
Als Charlotte Antoine nach dem Bad in eine Decke packte, zum Sofa führte und ihm einen heißen Kakao reichte, taute sein Gesicht auf. Schweigend saßen sie nebeneinander. Nach einer Weile sah er sie an, öffnete die Lippen, als wolle er etwas sagen, brach jedoch in Tränen aus. Charlotte schloss ihn in die Arme, strich ihm über den Rücken.
Bebend, sich mit beiden Händen an der Tasse festhaltend, blickte er die Fremde über den Tassenrand hinweg durch den aufsteigenden Dampf an.
Bevor er fragen konnte, wer sie war, legte sie sich den Zeigefinger an die Lippen. Dann stand sie auf, nahm einige Holzscheite aus einem Korb und entzündete im Kamin ein Feuer. Ein leises Knistern füllte bald den Raum. Die züngelnden Flammen warfen Licht und Schatten zugleich. Antoine beobachtete, wie Splitter weißer Glut vom Holz in die schwarze Asche fielen. Draußen vor den Fenstern hockten Dunkelheit und Kälte. Die Nacht hatte sich über alles gelegt. Bis auf den Himmel selbst. Dort schimmerte der zarte Glanz der Sterne.
In dieser Nacht gewann Charlotte einen neuen Sinn für Größenverhältnisse. Gleichsam wurde Antoine zu Charlottes liebstem und Charlotte zu Antoines einzigem Menschen.
2
Das Leinen des Bettes roch nach frischer Luft. Zartgelbes Morgenlicht fiel durch die Ritze des Bastrollos, das es in hauchdünne Scheiben schnitt. Antoine blinzelte. Hülle um Hülle streifte sein Verstand den Schlaf ab. Schließlich öffnete er die schlafverschnürten Augen. Er sah sich um, und das eisige Bewusstsein überfiel ihn: Es war kein Traum. Seine Mutter war fort. Und er allein zurückgeblieben im Haus einer Fremden.
Hell war es im Raum. Zu hell für sein Befinden. Er schloss die Augen wieder und suchte nach der Dunkelheit, in der er sich verstecken, mit der er verschmelzen konnte.
Zum Glück begann es zu regnen. Tagelang regnete es. Die Feuchtigkeit kroch ins Haus. Antoine hockte am Ofen und stierte in die Flammen. Charlotte sah ihn aus dem Augenwinkel heraus an. Immer wieder kam ihr das Bild seiner Verbrennungen und Narben in den Sinn. Sie fühlte sich versucht, ihn danach zu fragen. Vielleicht weil sie hoffte, sie hätten nichts mit seiner Mutter zu tun. Doch sie schwieg.
Sosehr sie sich auch bemühte, es gelang ihr nicht, den Jungen aus seiner Abwesenheit zu locken. Er aß kaum. Magerte ab. Seine Wangenknochen traten immer schärfer hervor. Wochenlang hockte er stumm auf seinem Bett oder am Ofen, die Beine an den Brustkorb gezogen, die Stirn auf den Knien, und starrte in die Leere. Wie eine mit Stille gefüllte Seifenblase, die jederzeit zerplatzen konnte.
Wenn Charlotte anfangs etwas sagte, was sich auf jenen Tag bezog, an dem sie ihn gefunden hatte, fiel ein Schatten auf Antoines Gesicht, und eine tiefe Traurigkeit legte sich über alles. Er zog sich aus dem Gespräch zurück und kam ihr abhanden. Und weil der Schmerz, der sich in diesen Momenten zwischen und in ihnen ausbreitete, unerträglich war, blendete auch Charlotte die Erinnerung an diesen schrecklich kalten Wintertag irgendwann aus und stellte keine Fragen mehr.
Nur sehr langsam fand er sich in der neuen, fremden Atmosphäre zurecht. Eine Freundin riet Charlotte, einen Nervenarzt aufzusuchen. Charlotte runzelte daraufhin nur die Stirn und sagte: »Antoine ist doch nicht defekt. Seine Schale ist zerbrochen. Seine Seele verwundet. Da ist es doch ganz natürlich, dass er Zeit braucht.«
»Warum tust du dir das an, Charlotte?«
»Ich kenne ihn seit seiner Geburt.«
»Das ist nicht die Antwort auf meine Frage.«
»Ich habe ihn gewissermaßen mit zur Welt gebracht. Du erinnerst dich doch an jene Nacht. Die so schwarz war, dass nicht einmal der Mond gegen die Dunkelheit ankam.«
»Wer erinnert sich nicht daran? Du hast ihn damals gerettet. Ihn und seine Mutter. Du musst das nicht ein zweites Mal tun.«
»Jetzt rette nicht ich ihn. Er rettet mich«, sagte Charlotte und schwieg. Dann fuhr sie fort: »Mit Kindern rückt die Welt näher. Man kann sich ihr nicht mehr so einfach entziehen. Durch Antoine kehre auch ich wieder ein wenig in die Welt zurück, die mir selbst so fremd geworden ist.«
»Du bist erst zweiundzwanzig. Hast dich in deinem Leben schon durch genügend schwere Zeiten geschleppt. Warum jetzt wieder eine Last? Wenige verstehen, warum du das machst. Der Junge ist …«
»Wer in seinem Herzen keinen Platz für Antoine hat, für den habe ich in meinem Herzen keinen Platz«, unterbrach Charlotte die Freundin.
»Das ist es nicht. Die Leute haben Mitleid mit dir.«
»Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Ich brauche niemanden, dem ich leidtue. Ich weiß, was ich mache. Es ist richtig. Für ihn. Und auch für mich.«
Die Tage und Wochen trugen die Einzelheiten davon. Und ein klein wenig von der Schwere. Charlotte ließ Antoine sein, wie auch immer er sich fühlte. Schlicht und anspruchslos redete sie mit ihm, ohne dass er sich in ein Gespräch gezwungen fühlte. Sie fragte, ohne Fragen zu stellen. Und spürte, dass ihm das guttat. Mit der Zeit gaben beide vor, die Aufschrift auf seiner Stirn vergessen zu haben, obwohl sie täglich daran dachten.
»Es gibt viele Menschen, die nicht die Familie haben, die sie verdienen«, sagte Charlotte. »Unsere eigene Geschichte ist nur eine von vielen.«
3
Für Charlotte war das Leben nicht bloßer Zufall. Das wäre zu einfach, sagte sie. Hinter allem läge ein größerer Plan. Außerdem war sie überzeugt, dass wir – wenn wir wirklich wollten – dem Leben, in dem wir steckten, mit ein wenig Anstrengung und Ausdauer immer die gewünschte Gestalt geben könnten. Viele von uns wünschten sich einen anderen Anfang für ihre Geschichte. Doch wie auch immer dieser Anfang gewesen sein mochte, bevor er uns an ein schlechtes Ende führte, konnten wir die eigene Geschichte noch immer umschreiben.
Charlottes wiedererwachter Glaube daran, dass wir die Wahl haben, uns ein Schicksal auszulesen, egal, was uns bereits widerfahren ist, ließ nach und nach die Ohnmacht von Antoine abfallen und machte neuer Hoffnung Platz. Ließ ihn – der Wochen in der Vergangenheit eingefroren gewesen schien – auf wundersame Weise in die Realität zurückreisen und neuen Mut fassen.
Hin und wieder gab es zwar noch Tage, an denen er in seinen Erinnerungen gefangen war und sich durch das Eis seiner Vergangenheit kämpfte. Doch schließlich gelang es Charlotte mit ihrer Wärme, einen Ausgang daraus zu schmelzen. Und er fand zurück in eine Gegenwart, die eine Zukunft versprach.
Charlotte war eine schöne Frau. Ausdrucksvolle Gesichtszüge, lilienweiße Haut. Ihr Haar, je nach Licht in allen Laubfarben, fiel wie ein Wasserfall über ihre Schultern und zerstob auf Brust und Rücken. Hochgesteckt sah es aus wie ein Wollknäuel, den man einer Katze zum Spiel hingeworfen hatte. Leuchtende Augen, in grünem Oliv mit einem gelben Kranz um die Pupille. Jedes Lächeln kündigte sich als Fältchen um die Mundwinkel an – die aber nie ganz verschwanden. Sodass immer etwas Heiteres auf ihrem Gesicht lag, selbst wenn sie nachdachte oder nach Worten suchte. Ihre Arme lang und schlank. Ihre Hände schmal und grazil. Die Finger feingliedrig und flink. Unter ihren Kleidern zeichnete sich eine zierliche Figur ab, mit wohlgeformten Schultern, die an manchen Tagen vom Leben niedergedrückt schienen. Sie war eine herzliche Frau, doch in ihrer Moral ab und an etwas zu anstrengend, zwanghaft. Ein Mensch, der gern in der Burg seiner Ideale hauste.
Charlotte liebte die Sonne. Nicht jedoch knallhelle Sommertage. Das Gleißen nähme allem die Farbe, sagte sie. Ließ die Welt ausbleichen, das wahre Leben verblassen. Sei man zudem an hellen Tagen in dunkler Stimmung, fühlte es sich an, als läge die Sonne mit ihrem ganzen Gewicht auf einem. Auch mochte sie das Schweigen und die Stille der Dämmerung. Wenn sich das Leben schlafen legte und am frühen Morgen erwachte. Wenn in und über allem Frieden lag.
Bis zum Tag, an dem sie Antoine zu sich holte, hatte sie ihr Leben hingenommen als etwas, das noch irgendwie bis zum Ende durchzustehen war. Zwischen dem, was sie sich einst erträumt hatte, und dem, zu dem es bereits in jungen Jahren durch unglückliche Wendungen geworden war, hatte sie eine solche Kluft empfunden, dass sich die Mühe nicht mehr zu lohnen schien, diese schließen zu wollen. Antoine jedoch füllte Charlotte so aus, als wäre die innere Leere, wie auch die Kluft zwischen Träumen und Wirklichkeit, allein durch die Anwesenheit des kleinen Kerls auf einen winzigen, nicht mehr spürbaren Spalt geschrumpft.
Für Antoine war Charlotte anders als alles, was ihm bisher von der Welt zugeteilt worden war. Als Erstes fiel ihm an ihr auf, dass sie Menschen anders deutete, als seine Mutter es getan hatte. Seine Mutter war streng mit den Menschen. Charlotte war streng mit sich. Nie urteilte sie vorschnell über jemanden. »Das Urteil über einen Menschen wird ihm nie gerecht«, sagte sie.
Gleichsam lehrte sie Antoine, Gemeinheiten anderer Leute nicht auf sich zu beziehen. »Wenn dich jemand schlecht behandelt, ist das nicht dein Problem, sondern seines.« Sie pflanzte einen fast unerschütterlichen Glauben an sich selbst in den Jungen. Machte ihm Mut, genau das Leben zu leben, das er leben wollte. Zu den Bedingungen, die er wünschte.
Sie kannte nicht alle Farben des Lebens, aber seine Schattierungen. Und schenkte Antoine eine Gegenwart, die in der Wüstenlandschaft seiner Seele erstmals Blumen blühen ließ. Eine Gegenwart, in der zum ersten Mal in seinem Leben eine Zukunft möglich wurde.
4
Antoine fiel auf mit seinem schwarzen Haar, das sich dicht gelockt und eigensinnig um seinen Kopf kräuselte. Mit seinen großen Augen, die die Umgebung unentwegt durch den Vorhang seiner langen, dunklen Wimpern beobachteten. Diese Augen waren es auch, durch die er sich besonders zu offenbaren vermochte. Augen, die tief blicken ließen. Augen, die auf der Suche waren.
Er war ein feinsinniger kleiner Kerl, der sich alles sehr zu Herzen nahm. Daher schwieg Charlotte über die Zeit vor seiner Geburt ebenso wie über die frühkindlichen Jahre seines Lebens, als hätte es sie nie gegeben. Zumindest nicht so, wie Charlotte sie aus der nahen Ferne miterlebt hatte. Sie wusste, dass Antoine diese leere Zeit mit seinen eigenen Vorstellungen füllte. Doch weil diese Vorstellungen nie so schlimm sein konnten wie das, was sich wirklich zugetragen hatte, sagte sie nichts.
Erst viel später – und auch nur, weil Antoine sie unentwegt danach fragte – erzählte Charlotte dem Jungen, was seine Mutter ihm auf die Stirn geschrieben hatte: »Adieu.«
Mit diesem Wort war die Dunkelheit erneut wie ein Tuch über die Erde gefallen, und für einige Tage war es wieder Nacht um Antoine geworden. Tage, in denen sich Charlotte fragte, ob es das Ende von Marlenes Geschichte war oder das Ende seiner. Oder ob wir in unserem einen Leben mehrere Leben nacheinander führen können.
Bis Antoine schließlich eines Abends stumm aus seinem Zimmer kam, an den Tisch herantrat, an dem Charlotte gerade in einem Buch blätterte, und seinen Kopf auf ihre Hand legte.
Beide blickten nach draußen, wo ein Platzregen vom Himmel fiel. Wie geschmolzenes Silber lief das Wasser an der Fensterscheibe hinab.
»Es fühlt sich alles so falsch an«, sagte der Junge.
»Ich weiß«, sagte Charlotte und strich ihm durchs Haar. »Wenn etwas mit dem Weggang der eigenen Mutter beginnt, kann sich nichts richtig anfühlen.« Sie legte die Hand auf seine und schlang ihre Finger darum. »Auch wenn es grausam ist, was du erleben musstest, Antoine, so bedenke immer: Der Regen fällt niemals nur auf dich. Jeder von uns, ob klein, ob groß, ob reich oder arm, muss über Pfützen springen. Das Leben kann brutal sein. Das Schicksal verteilt, wie es ihm gefällt. Aber es gibt auch Entschädigungen: unerwartete kleine und größere Wunder in den undenkbarsten Momenten. Du wirst schon sehen. Wir verstehen nicht alles, was passiert. Das Schreckliche genauso wenig wie das Ungewöhnliche. Die Wirklichkeit reicht nicht aus, um das eine oder das andere zu erklären. Doch – zumindest was Außergewöhnliches betrifft – schließt ein besonderer Zauber die Lücken, die die Realität nicht schließen kann. Und manchmal sind die Dinge, die wir nicht sehen können, sogar wirklicher als die, die wir sehen können.«
5
Zwei Jahre später
Jules war einer der angesehensten Richter der Stadt. Ihm eilte der Ruf voraus, besonders ehrenhaft und gerecht zu sein. Er war ein Mann mittlerer Größe, von guter Statur, mit sonnengebräunter Haut. Er hatte ein kantiges Gesicht mit ausgeprägten Wangen- und Kieferknochen und die Angewohnheit, sein linkes Auge immer ein wenig zusammenzukneifen, wenn er sprach, was ihm einen besonderen Charme verlieh. Sein silberfarbenes, gelocktes Haar hatte er kurz geschnitten. Seine tiefen, dunklen Augen leuchteten von innen heraus wie bläulich glühende Kohlen, bis die Schläge des Schicksals sie erloschen.
Nach Jahren unerfüllten Kinderwunsches war seine Frau schließlich schwanger geworden. Ein erstes, ein zweites und ein drittes Mal. Doch jedes Mal hatten sie das Kind verloren. Nacheinander hatte sie zwei Totgeburten erlitten. Das dritte Baby war innerhalb weniger Tage nach der Entbindung gestorben. Zeiten der Trauer und Verzweiflung folgten, in denen beide am Schmerz fast zerbrochen waren. Nun jedoch war die Angst, die lange Zeit unter der Asche geglommen hatte, zu einer neuen, zaghaften Hoffnung aufgeflackert, denn Louise war zum vierten Mal schwanger und stand kurz vor der Niederkunft. Bisher war alles gut verlaufen und die Vorfreude auf das lang ersehnte Kind groß. Selbst wenn noch ungewiss blieb, ob auch dieses vierte Kind die Erbkrankheit in sich trug, die ihnen schon drei Kinder entrissen hatte: die Krankheit der kurzen Leben.
Diesmal musste es einfach gut gehen. Es war Jules’ und Louises letzte Möglichkeit auf ein eigenes Kind. Vier ausgetragene Schwangerschaften hatten Louises zierlichem Körper viel Kraft geraubt. Die Ärzte hatten es ihnen unmissverständlich dargelegt: Eine fünfte würde sie nicht überleben.
Wie den Rat eines Arztes befolgen, wenn das eigene Leben von einem Kind abhängt? Und Louises Leben hing von einem Kind ab. Das hatte sie ihrem Mann hundertfach erklärt. Und Jules hatte verstanden: Eine Frau, die ein Kind will, muss ein Kind bekommen.
Und sie gebar ein Kind: ein winziges, zaghaftes Mädchen, leichenblass in einer tiefschwarzen Nacht. Es schrie nicht, sondern schnappte wie ein Vögelchen nach Luft. Der Arzt trug es aufgeregt davon. Die Schwestern gaben Louise ein Schlafmittel, damit sie sich von den Strapazen der Geburt erholen konnte. Und Jules zog seine Schlüsse.
Sein Blick nach draußen in die Finsternis verfloss mit dem grausamen Anblick des nach Luft ringenden Babys zu einem einzigen entsetzlichen Erleben und erfüllte ihn mit Angst und Schrecken.
Wieder zu Hause, lag er die ganze restliche Nacht wach. Drehte sich von der einen auf die andere Seite. Bis ihm ein Gedanke zuflog, der seine Furcht davontrug.
Er stand auf, kleidete sich an und machte sich auf den Weg ins Geburtshaus. An der frischen Luft ging er erneut die Ereignisse der vergangenen Nacht durch. Die Möglichkeiten, die ihm zur Lösung seines Problems am frühen Morgen in den Sinn gekommen waren. Und sah seine Lage nun in hellerem Licht als in der auf nahezu wundersame Weise entschwundenen Dunkelheit.
Es war Winter. Feuchter Nebel hing tief in den Bäumen. Reif glitzerte an den Zweigen. Funkelnde Kristalle überzogen die Blätter der Mahonien, deren gelbe Blüten wie Wintersonnen leuchteten. Nur hier und da flirrten Stimmen durch die kalte Morgenluft.
Aschgraues Licht sickerte durch die Fenster auf beiden Seiten des Ganges, der vom Eingangsportal zu einem sternförmigen Flur führte, von dem zu allen Seiten Zimmer abgingen.
Das Stimmengemurmel von Ärzten, Schwestern und Besuchern wurde von der immensen Weite des Korridors gedämpft. In der Luft lag der Geruch von Desinfektionsmitteln und Zitrusreinigern. Es roch nach Sauberkeit.
Die Entscheidung zur Lüge, die Jules an diesem Morgen getroffen hatte, hing an den Fäden einer tiefen Sehnsucht, an den Fäden von Louises Lebenstraum. Auch wenn Jules sich anfangs der Macht dieser Entscheidung mit all ihrer Kraft zu widersetzen suchte, gab er sich ihr schließlich kopflos hin. Zu verführerisch fühlte sich das Leben an, das sie beide haben würden.
Besser, sich nicht weiter mit der Wirklichkeit seines in Gedanken beschlossenen, grauenvollen Plans auseinanderzusetzen. Besser, keine Zeit zu verlieren. Bald würden die Wöchnerinnen erwachen, und man würde ihnen ihre Neugeborenen zum ersten Stillen bringen.
Sachte öffnete Jules die Tür zum Saal, in dem die Babys in ihren Bettchen schliefen oder vor sich hin grummelten. Diese vielen lieblichen Gesichter, von denen ein solches Licht auszugehen schien. Eine Helligkeit, die ihn quälte. Für einen kurzen Moment kniff er die Augen zusammen, versuchte das Bild, das sich ihm bot, auszublenden, aber es gelang ihm nicht. Das Licht drang durch die dünne Haut seiner Lider. Er holte tief Luft, öffnete die Augen und schritt auf das Bettchen zu, in dem sein Töchterchen schlief. Und da lag es unverschleiert vor ihm: das durchsichtige Schicksal seines Kindes.
Eine junge Frau mit Namen Charlotte – wie auf ihrem Kittel stand – wiegte gerade ein Baby auf dem Arm, während sie mit dem Zeigefinger der anderen Hand sanft über die Wange von Jules’ Töchterchen strich.
Er schaute sein Kind an. Der Blick auf das kränklich wirkende Gesichtchen, auf das kleine Mündchen, das unentwegt nach Luft rang, flößte ihm weder Liebe noch Mitgefühl ein, sondern eine Art von Abneigung, die er nicht zuordnen konnte. Was Jules für dieses kleine Wesen empfand, war ganz und gar nicht das, was er erwartet hatte. Nichts Schönes war an diesem Gefühl. Im Gegenteil: die grausame Erinnerung an den Tod des letzten Kindes, nur wenige Tage alt. An den winzigen weißen Sarg. Den einsamen Schmerz, den er mit Louise nicht teilen konnte, weil er für sie stark sein musste. Seine Angst und Verwundbarkeit, nochmals ein Kind zu verlieren.
Wie sehr er auch danach suchte, er fand in seinem Herzen kein einziges Anzeichen liebevoller, väterlicher Gefühle für das kleine Mädchen in diesem Bettchen. Kein Drang, beschützen zu wollen. Nur der tiefe Wunsch, sich aus seiner Lage zu befreien.
Er erkannte das Kind auf Charlottes Arm sofort. Es war nur eine Stunde vor seiner Tochter im gleichen Geburtssaal entbunden worden. Jules erinnerte sich an das volle, schwarze Haar. Ganz so, als komme es aus einer anderen Welt und nicht aus dem Bauch einer Frau. Er hatte zumindest noch nie ein Neugeborenes mit so viel Haar gesehen. In der Nacht zuvor noch feucht und klebrig, nun dicht und weich. Es blühte vor Gesundheit.
Als er das quirlige Baby anschaute, drängte sich sein Vorhaben mit aller Kraft in seinen Geist. Er schloss die Lider. Vor seinem inneren Auge erinnerte er, wie leblos und schlaff sein eigenes Kind bereits aus dem Körper seiner Frau geglitten war. Er öffnete die Augen wieder in der Hoffnung, der Anblick seiner Tochter habe sich während dieses Lidschlags gewandelt. Doch das blieb nur ein Wunsch. Es lag in seinem Bettchen, sein kleines Mädchen, genau wie von der ersten Sekunde an. Kraftlos. Mit winzigen, schrumpeligen lila Händchen und Füßchen. Einem so schwachen Körper, der mehr dem zuckenden Flämmchen eines sich zu Ende neigenden Streichholzes glich als der Flamme des Lebens. Ein hauchdünner Luftzug, und es würde erlöschen. Und was würde das für Louise bedeuten? Was für sie beide? Für ihre Ehe? Für ihr Leben? Der ganze Saal um ihn schien sich zu drehen. Rasch schloss er wieder die Augen.
Charlottes Stimme durchdrang seine Dunkelheit. »Alles in Ordnung mit Ihnen? Möchten Sie sich setzen?«
Jules schlug die Lider auf, stützte sich mit einer Hand am Bettchen seiner Tochter. Hob seinen Blick und sah Charlotte an. Er sah sie an und vergaß für einen kurzen Augenblick, warum er hier war und in welches Leben er gehörte. Stille. Nur das Grummeln der Babys.
Jules empfand eine Nähe zu Charlotte, die ihm fremd war. Ein Gefühl, mit dem er nicht gerechnet hatte. Dieser Blick, diese Augen. Und der Duft von Jasmin. Er wollte nicht sehen und sah auch nicht, was dieser Blick bedeutete. Er wollte nicht verstehen und verstand auch nicht, was dieser Blick in ihm rührte. In diesem kurzen Augenblick pendelten seine Gedanken zwischen seinem gegenwärtigen und einem anderen Leben hin und her.
Auch sie spürte es. Beide packte einen Moment lang ein Gefühl tiefer Zuneigung. Mit den richtigen Worten hätte Charlotte ihr beider Leben in diesem einzigen Moment zu einem anderen machen können. Doch als ob sie dieser Begegnung nicht länger standhalten, die Bedeutung dessen, was auch sie spürte, nicht länger aushalten konnte, entwich ihr nur: »Keine Sorge, das geht vielen so, die zum ersten Mal Vater geworden sind.«
Die Magie des Augenblicks war verloren. Jules fand sich zurück in seinem bisherigen Leben, zurück in der Haut des Verzweifelten.
»Ich wollte nach ihr sehen. Wie geht es unserer Tochter?«, fragte er.
»Schwer zu sagen, warten wir doch, bis der Arzt kommt.«
»Was sollte der Arzt heute anderes sagen als das, was er gestern Nacht gesagt hat? Dass sie vermutlich sterben wird. Wie unser letztes Kind und die Kinder davor.«
»Das wissen wir doch gar nicht. Es kann auch gut gehen. Jedes Kind bringt seine eigene Geschichte mit auf die Welt.«
Jules schien ihr nicht zuzuhören. Er blickte auf das bläulich angelaufene Gesichtchen seiner Tochter, und schon war sie wieder da, stand unausweichlich vor ihm. Diese Hürde. Diese Hürde, sein eigenes Kind zu berühren. Diese Hürde der Gefühle und die Hürde der Worte.
Ganz anders das, was sich beim Anblick des anderen Mädchens in ihm rührte, das auf Charlottes Arm so ruhig schlief. Was er für dieses fremde, aber gesunde Kind empfand, ging tiefer, war bedeutungsvoller als alles, was er je empfunden hatte. War das ein Vergehen?
Jules öffnete den Mund. Dann schloss er ihn wieder und sagte nichts. Wieder sah er sich seine Tochter an, und ihn überlief unvermittelt ein Schauer der Angst. Vor seinen Augen wurde es dunkel. Hatte der Tod sich schon auf den Weg gemacht, um sein nächstes Kind zu holen?
»Sie stirbt«, sagte er.
»Zwischen Sterben und Nahezu-Sterben liegt ein großer Unterschied – Ein ganzes Leben!«, sagte Charlotte.
»Das Gesicht violett. Die Atmung schwach. Verkrampfte Finger und Zehen.«
»Sie hat einfach etwas mehr Schwierigkeiten als andere Babys, in der neuen Welt Fuß zu fassen.«
»Meine Frau und ich haben bereits drei Kinder verloren. Zwei Totgeburten. Das dritte lebte nur dreiundzwanzig Stunden. Kaum spürbare Herzschläge. Schwache Atemzüge. Blaue Händchen und Füßchen. Auch damals machte man uns Hoffnung. Und plötzlich war es tot. Drei verlorene Leben in fünf Jahren. Meine Frau ist jetzt dreißig. Sie wird kein weiteres Kind mehr austragen können, sagen die Ärzte. Sie verstehen, wie sehr die Leiden auf uns lasten. Uns quälen. Ein totes Kind folgt dem anderen. Nach jedem Verlust monatelange Trauer. Louises Gefühl, vom Leben um das beraubt zu werden, was sie zu einer Frau macht. Ich habe ihr versprochen, dass diesmal alles gut gehen wird. Ich habe es ihr versprochen.« Jules hielt einen Moment inne. »Dies ist unsere letzte Chance. Und Sie müssen mir dabei helfen. Sie müssen.«
Charlotte merkte, dass schon in diesem Satz eine Frage steckte, mit der sie ganz und gar nicht einverstanden war. Eine Forderung, die sie entsetzte. Sie versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie begriffen hatte, was er von ihr wollte, und sagte: »Es tut mir sehr leid, was Ihnen widerfahren ist und was Sie durchmachen mussten. Doch ich wüsste wirklich nicht, was ich für Sie tun könnte, außer mich, so gut es mir möglich ist, um Ihr neugeborenes Töchterchen zu kümmern.«
Eine lange, erdrückend schwere Stille folgte. Dann rückte Jules heraus: »Sie müssen die Babys tauschen.«
Charlotte riss die Augen auf: »Was sagen Sie?«
»Tauschen. Sie müssen die Babys tauschen. Gestern Nacht, nur eine Stunde bevor meine Tochter geboren wurde, hat eine andere Frau auch eine Tochter zur Welt gebracht. Das Kind, das Sie in Ihren Armen halten, richtig? Es ist das dritte gesunde Kind dieser Frau!«
»Wovon reden Sie?«
»Diese Frau hat bereits zwei gesunde Kinder. Ich habe sie gesehen. Gestern. Auf dem Korridor. Mit ihrem Vater. Dem Ehemann. Zwei Söhne. Außerdem ist sie noch jung. Jünger als meine Frau. Sie kann noch viele Kinder gebären. Sie lebt nicht einmal in dieser Stadt. Sind auf der Durchreise. Er ist Perlenhändler. Kommen von weit her im Osten. Er hat sein Neugeborenes noch nicht einmal gesehen. War nicht im Geburtssaal. Musste bei den kleinen Söhnen bleiben. Ich habe ein Gespräch zwischen dem Ehemann und dem Arzt mitbekommen. Gestern Nacht.«
»Was reden Sie da? Ich verstehe Sie nicht.«
»Oh doch. Sie verstehen mich. Eins für das andere.«
»Sie wollen die Babys tauschen?«
»Nicht ich. Sie!«
»Niemals! Sie können den Müttern doch nicht ihre Kinder wegnehmen!«
»Wir nehmen niemandem ein Kind weg. Wir tauschen sie nur. Ein weiteres Kind zu verlieren würde meine Frau nicht überleben.«
»Keine Frau überlebt das. Hören Sie, die Dinge sind, wie sie sind. Das Leben ist nicht immer gerecht. Und Sie haben nicht das Recht, sich ins Leben einzumischen und es nach Ihren Vorstellungen von Gerechtigkeit zu ordnen. Als Richter im Gerichtssaal meinetwegen. Aber nicht hier im Geburtssaal. Das können Sie nicht tun.«
»Und ob ich das kann.« Jules heftete seine Augen auf sie. Er hörte, wie Angst in seiner Stimme mitschwang. »Sehen Sie doch ein, wenn meine Frau dieses Spital ohne ein gesundes Kind verlässt, verliere ich den Verstand!«
»Den Verstand kann nur der verlieren, der einen besitzt«, erwiderte Charlotte.
Jules fuhr sich durchs Haar, einmal, zweimal, dann über sein Gesicht und sagte: »Sie haben einen kleinen Jungen, richtig? Sie haben sich des Kindes angenommen, als seine Mutter ihn verlassen hat. Ist es nicht so? Ich erinnere genau, was vor zwei Jahren geschehen ist. Und jeder in dieser Stadt weiß, was vor acht Jahren passiert ist. Ich nehme an, Sie haben keinen richterlichen Beschluss, der Sie als Mutter dieses Jungen anerkennt. Richtig? Nichts, was belegt, dass Sie das Kind behalten dürfen. Ich habe zumindest nie einen Antrag gesehen und entsprechend nie eine Vormundschaft erteilt.«
Charlotte schwieg. Was sollte sie darauf antworten? Sie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Hörte den Pulsschlag in ihren Ohren. Plötzlich strahlten beide etwas aus, das die Luft erfüllte wie Gas, entflammbar durch die kleinste Wortzündung.
»Ist es nicht so?« Jules versuchte die Glut in Charlotte anzufachen und sich gleichzeitig für sein eigenes Vorhaben zu rechtfertigen. Weniger vor Charlotte als vielmehr vor sich selbst.
»Es ist so«, flüsterte Charlotte schließlich. Ihre trockene Stimme klang verwundet und ungeschützt.
»Dann verstehen wir uns. Sie wollen den Jungen behalten, der in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Ihnen steht, und ich will dieses Mädchen.« Jules kreiste seinen Finger und zeigte dann auf das Kind in Charlottes Armen.
»Das können wir nicht tun!«
»Können wir nicht tun?«
»Denken Sie Ihren Plan doch mal bis zu Ende durch. Sie als Richter haben doch einen Sinn für Anstand. Warum gebrauchen Sie ihn nicht?«
»Wie heißt Ihr Junge?«
Charlotte zögerte.
»Wie Ihr Junge heißt!«, wiederholte Jules.
Charlotte schüttelte den Kopf. Das konnte dieser Mann nicht ernst meinen. Nicht dieser Mann.
Schweigen.
Ein langes Schweigen.
Charlotte hatte sofort begriffen, dass sich Jules die Maske des Mächtigen nur übers Gesicht gelegt hatte, weil er nicht anders konnte. Weil er genauso verzweifelt war wie sie, und genauso verzweifelt wie Louise.
Jules, der inzwischen nicht mehr die betörende junge Frau vor sich sah, sondern einen Gegner, der seinem Vorhaben in die Quere kam, wiederholte mit scharfer Zunge: »Wie heißt der Junge?«
Charlotte sagte nichts.
»Wie er heißt!«
»Antoine«, flüsterte sie.
»Antoine. Schöner Name. Sie möchten Ihren Antoine dem Waisenhaus übergeben?«
»Nein«, stieß Charlotte mit zittriger Stimme hervor und wandte ihr Gesicht ab. Die Hoffnung, dass dieser Mann nicht ernst meinen konnte, was er gesagt hatte, starb so unvermittelt, wie sie gekommen war. Er würde seine Androhung wahr machen. Das begriff sie jetzt.
Es wäre einfach nur grausam, zeigte sich in seiner Drohung nicht so etwas Nacktes. Sie drehte sich zum Fenster. Ihr Blick glitt nach draußen. Schnee rieselte vom Himmel. Schneeflocken wie Asche. Wie ruhig in diesem Moment alles schien, ganz so, als bewegte sich auf der ganzen Welt nichts als der Schnee.
Jules’ Drohung hing im Raum wie eine Messerklinge, die auf sie herabzustürzen drohte. Charlottes Augen füllten sich mit flüssigem Schmerz. Im Zimmer war es so still, als hielte die Welt für einen kurzen Moment den Atem an.
Niemand hatte bisher von ihr gefordert, den Jungen ins Waisenhaus zu geben. In der Stadt kannte jeder das Schicksal des kleinen Kerls. Jeder, der Antoine ansah, begriff ihn sofort – seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Und jeder wusste, dass Charlotte seine Hoffnung war. Die Hoffnung, dass die Wunden seiner Vergangenheit heilen könnten, die Gegenwart ihn nicht sterben ließ und der Frühling des Lebens in der Zukunft auf ihn wartete.
Bislang hatten alle geschwiegen. Und würden es auch weiterhin tun. Um ihn zu schützen. Um ihn davor zu bewahren, alles zu verlieren. Auch Charlotte. Doch bekanntlich genügt eine Stimme des Verrats. Und wenn sie zudem noch die eines Richters war, war alles verloren.
Wortlos löste Charlotte das Namensbändchen vom Arm des gesunden Kindes.
»Wie heißt das Mädchen?«, fragte Jules.
»Es hat jetzt keinen Namen mehr«, sagte Charlotte und senkte den Blick. Dann reichte sie Jules das Kind.
»Das Namensbändchen meiner Tochter«, sagte Jules mit einer Stimme, die zwischen Entschluss und Zweifeln schwankte, den Blick auf den Säugling im Bettchen gerichtet.
Behutsam nahm Charlotte das kleine Mädchen aus dem Bettchen, schmiegte seine Wange an ihre tränenfeuchte und löste mit nur einer Hand das Namensbändchen vom Handgelenk des Babys. Mit ausgestrecktem Arm hielt sie Jules das Bändchen hin. Er ergriff es und schob es in seine Hosentasche.
Dann zog er sich auf leisen Sohlen, unendlich langsam, wie es beiden erschien, Zentimeter für Zentimeter, mit dem falschen Baby auf dem Arm, rückwärts aus dem Säuglingszimmer zurück.
Sein letzter Blick fiel auf Charlotte. Wie sie sein Kind auf ihrem Arm schaukelte, das Ärmchen seines Töchterchens mit ihrer Hand sanft umschlang und ihm mit dem kleinen Händchen einen Abschiedsgruß zuwinkte. Dann trat sie aus dem Lichtstrahl des Türspalts und verschwand. Nie jedoch sollte sie aus seinem Gedächtnis weichen. Für all die künftigen Jahre hinterließ sie in ihm ihren duftenden Faden von Jasmin, der sich nicht wieder aus seiner Nase verlieren sollte.
6
Es war eines davon. Eines der vielen stummen Schicksale, die auf die Leben von Menschen einschlagen, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt. Eines der zahllosen schweigenden Dramen, die sich auch den Betroffenen erst sehr viel später offenbaren.
Nie hätte Charlotte von sich geglaubt, dass sie zu so etwas fähig sei. Müttern Kinder und Kindern Mütter zu rauben. Um Antoine als ihren Sohn legitimieren zu lassen. Um selbst Mutter bleiben zu dürfen. War das eine moralische Tat, die in einem jeden menschlichen Herzen zu finden ist? Würden wir selbst töten für die, die wir lieben? Kann das, was wir menschlich nennen, überhaupt Eigenschaften haben? Gibt es gut oder schlecht wirklich? Oder ist das eine bloße Bewertung, die je nach Situation unterschiedlich ausfällt? Dürfen wir dann eigentlich über andere urteilen?
Charlotte stand da mit dem kleinen Mädchen im Arm. Fassungslos über sich selbst. In einer Unruhe, die an Verzweiflung grenzte, ging sie im Saal auf und ab. Das Baby rang erneut nach Luft. Charlotte legte das Mädchen ins Bett zurück und band ihm das Namensschildchen des anderen Kindes um den Arm: »Du heißt jetzt Ni Lou«, flüsterte sie der Kleinen zu. Dann legte sie dem Baby eine Sauerstoffmaske an, die so groß war, dass das gesamte Gesicht darin verschwand. Sie strich über Ni Lous Köpfchen und betrachtete das Kind. Selbst der sorgloseste Mensch wird bei einem solchen Anblick traurig, dachte sie. Ärmchen und Beinchen steckten in viel zu großen Kleidern. Ein Gesichtchen, dessen von Anstrengung erfüllte Züge schon jetzt erschreckend erwachsen wirkten.
Ein wässriger Film lag über Charlottes Augen. Sie löste ihre Hand vom Köpfchen der Kleinen und legte sie auf Ni Lous Brust. Lungen klein wie Libellenflügel, dachte sie. »Versprich mir, dass du sie entfalten wirst. Dass du dich in diese Welt traust. Trotz des Regens, der auf dich fällt. Dass du fliegen lernst. Wenn auch nicht an dem Platz, der ursprünglich für dich vorgesehen war. Dass du dich aufschwingen wirst – ins Leben.« Das Baby fing an zu schreien.
»Verzeih mir, Kleines. Bitte verzeih mir«, sagte Charlotte. Sie griff sich mit beiden Händen in den Nacken, öffnete den Karabiner und löste ihre Kette, an der eine bronzegefertigte Feder mit einem eingefassten, tiefblauen Lapislazuli hing. Mit seinen Einschlüssen glich der Stein einer Erdkugel. Das Amulett, mitsamt dem ihm innewohnenden Geheimnis, hatte Charlottes Mutter der Tochter in die Hände gelegt, bevor ihr letzter Atemzug in die Ewigkeit geströmt war. Von da an hatte Charlotte die Kette getragen und bis zum heutigen Tag nicht wieder abgelegt. Tränen lösten sich aus ihren Augen, als sie sie in ein Taschentuch einschlug und zusammen mit einem Stück Papier, auf das sie ein paar Zeilen kritzelte, in einen Briefumschlag gleiten ließ. »Für Sarasvati«, schrieb sie auf das Kuvert. Sie legte es auf die Brust des kleinen Mädchens, und mit einem Mal hörte das Kind auf zu weinen. Still wurde es im Raum. Für einen winzigen Augenblick schlug das Kind die Lider auf, blickte Charlotte an und schloss sie wieder. Der Brustkorb der Kleinen bewegte sich von Minute zu Minute ruhiger und gleichmäßiger auf und ab.
»Es gibt sie. Überall. Diese kleinen magischen Momente. Gleich einem einzigen Sonnenstrahl, der sich durch einen bedeckten Himmel schiebt. In jedem Menschenleben. Wir brauchen nur darauf zu vertrauen.« Das waren die Worte, die Charlottes Mutter an sie gerichtet und gleichzeitig Charlottes Finger um das Amulett geschlossen hatte. Vierzehn Jahre zuvor. Charlotte war damals zehn. Heute sagte die junge Frau dieselben Worte zu Ni Lou. Dann löste sie den Blick vom kleinen Mädchen, strich sich den Schwesternkittel vom Leib, faltete ihn einmal, ein zweites Mal, hängte ihn über die Stäbe des Gitterbettchens und verließ den Saal.
Ende der Leseprobe
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: