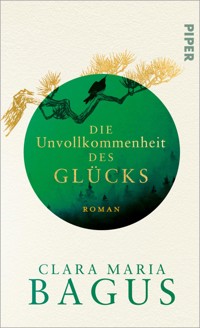
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich – der neue Roman von Clara Maria Bagus!
Dies ist die Geschichte einer Frau und eines Mannes. Die in denselben Himmel blicken. Ihrer voller Zugvögel. Seiner voller Trümmer. Sie will ihrem alten Leben entfliehen – und findet Liebe und Bestimmung dort, wo sie es nie vermutet hätte. Er will dem Tod entkommen – und rettet damit nicht nur sein Leben. Zweimal begegnen sie sich. Einmal bleibt es bei einer Ahnung von Glück. Dann ordnet sich die Welt neu, und die beiden treffen sich unerwartet wieder.
In ihrem neuen, meisterhaft erzählten Roman verwebt SPIEGEL-Bestsellerautorin Clara Maria Bagus die Fragen nach Glück, Sinn und dem, was wirklich zählt im Leben. Ein zutiefst zärtlich geschriebenes Buch, das einen erfüllt und staunend zurücklässt.
Ein einzigartiger Roman über die zerbrechliche, und doch wundersame Schönheit des Lebens – für Fans von Delia Owens, Robert Seethaler und Matt Haig.
»Clara Maria Bagus beherrscht die Kunst des heilenden Erzählens.« Nele Neuhaus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Unvollkommenheit des Glücks« an empfehlungen@piper.de, und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Dies ist die Geschichte …
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meinen Mann und meine Söhne
Du bist nur ein einziges, unwiederholbares Mal auf dieser Welt.
Worauf wartest du? Fang an zu leben.
Es ist viel später, als du denkst.
Dies ist die Geschichte einer Frau und eines Mannes.
Die in denselben Himmel blicken.
Ihrer voller Zugvögel. Seiner voller Trümmer.
Sie will dem Leben entkommen. Er dem Tod.
Und was sie finden, ist Licht, das Licht berührt.
Prolog
Manchmal sieht man tagelang keinen Himmel. Die Welt ist in einen dichten Nebel gehüllt, den nachts nicht einmal das Licht des Vollmonds zu durchdringen vermag.
Manchmal scheint die Sonne so grell, dass sie alle Farben ausbleicht und alles wie ein stark überbelichtetes Foto erscheinen lässt.
Doch manchmal ist alles im Gleichgewicht: Hell und Dunkel, Klarheit und Undurchsichtigkeit, Leuchten und Verglühen.
An manchen Tagen ist die Nacht so dunkel, als ob hinter zahllosen Schichten von Schwärze das Blau des nächsten Tages unüberbrückbar weit entfernt läge.
An anderen Tagen strömt das Licht vom Himmel wie Kristall. Die Luft ist blau. Ein Blau voller Leichtigkeit. Ein Blau, das man in die Hand nehmen kann.
1
Erinnerungen
Man sagt, jene, die aus dem Krieg zurückkehren, werden ein Leben lang von ihm heimgesucht. Zum Beispiel, wenn sie abends im Bett liegen und die Augen schließen. Dann stürmen die Erinnerungen auf sie ein, besonders jene Gräueltaten, zu denen sie in ihrer Rolle als Soldaten gezwungen wurden. Schlagen sie die Augen auf, verschwinden die quälenden Bilder, doch mit geschlossenen Lidern sind sie immer da.
Ganz gleich, wie unbeteiligt die Szenen, Filmen gleich, in ihren Köpfen während des Kampfes auch aufgenommen wurden, wie frei von emotionaler Kraft – weil Soldaten im Krieg von ihrem wahren Wesen abgeschnitten sind, weil sie nicht mehr denken und fühlen dürfen, nur reagieren –, spiegeln die im Kopf abgespulten Filme nach dem Krieg jedes Detail wider. Die dauernden Wiederholungen statten die Bilder mit einer solchen Bedrohlichkeit aus, die der Soldat bei seinen Taten vielleicht nicht empfunden hat, nicht empfinden durfte, die jedoch jetzt mit Wucht auf ihn einstürzen. Unauslöschlich in die Sehnerven eingebrannt, quälen die Szenen den Rückkehrer nun. Bleiben bis in jeden Winkel hinein spürbar, bis ans Lebensende.
2
Die Katastrophe
Zensur in allen Medien. Nur noch die Täuschung wird abgedruckt. Und die, die für die Wahrheit kämpfen, werden beiseitegeschafft. Dann plötzlich kippt das Land ins Dunkle. Ohne dass es jemand merkt. Es merkt niemand, weil es keiner glaubt. Und dann ist es zu spät. Der Krieg verliert sein Fragezeichen. Er wird zu einem Punkt, dann zu einem Ausrufezeichen. Er ist keine ausgedachte Geschichte mehr in einer ausgedachten Welt. Kein Film und kein Roman. Er ist real.
Sie schrecken auf. Fallen aus ihren Träumen vom Frieden – wie durch dünnes Eis. Das, von dem sie geglaubt hatten, es würde nie geschehen, geschieht.
Der Frieden der vergangenen Jahrzehnte war nicht dauerhaft, wie gewähnt. Er war nur eine Atempause zwischen den Kriegen, nur eine Zeitfalte in der Geschichte, in die wir uns gebettet hatten, solange das Glück auf unserer Seite war.
In ihren Köpfen hagelt es Gedanken.
So schön die Vergangenheit auch war, legen sich jetzt Schatten auf den Rückblick und nehmen allen Annahmen über eine gütliche Welt die Farbigkeit.
Jetzt erkennen sie: Schon Jahre zuvor hatten sich erste Risse im Frieden gezeigt, hatte der Wind den Duft der Freiheit davongeblasen und in entfernte Gebiete geweht.
Viel zu lange hatten sich die Länder an das geklammert, was alle zu vereinen schien: den Schrecken an die Grausamkeit der bisherigen Kriege, aus denen wir glaubten, herausgewachsen zu sein, die niemand mehr in solch tierischer Form erwartet hätte.
Und dann begreifen sie: Er war immer schon da. Dieser Krieg. Still war er mitgezogen und hatte von Jahr zu Jahr ihrer Untätigkeit an Kraft gewonnen. Um nun zuzuschlagen.
Zuversicht ist zur Bedrohung geworden. Und Ignoranz zum Wagnis. Die Lieferung von Blutkonserven an die Grenze, das kann kein bloßes Manöver sein. Und dann zerbersten die ersten Granaten. Zerstören Häuser. Zerfetzen Menschen. Raketen schießen in den Himmel, explodieren in tausend Splitter aus geschmolzenem Licht. Gebäude brechen in Flammen aus. Felder angesät mit menschlichen Gliedmaßen. Und in den Schützengräben harren die Soldaten. Alles Sterbende. Ohne zu sterben.
Wie hatte es nur so weit kommen können? Zu diesem barbarischen Echo der Vergangenheit.
3
Lew
Lew, fünfundvierzig, ist ein gut aussehender Mann auf die ungeschliffene Weise. Er ist groß, schlank, hat dunkles, leicht gewelltes Haar, markante Züge und einen gepflegten Sechstagebart. Ein leicht vorspringendes Kinn betont das scharf geschnittene Gesicht. Ein dichter schwarzer Wimpernkranz umgibt seine grauen Augen. Sein sehniger Körper bewegt sich mit einer natürlichen Zwanglosigkeit.
Lews ganzes bisheriges Leben ist windstill verlaufen. Ohne größere Aufstiege oder Abstürze, ohne nennenswerte Erschütterungen oder Gefahren. Nie hat ein Sturm, selten ein scharfer Luftzug hineingeweht in seine behagliche Existenz. Und wenn das Schiff, auf dem er gerade durchs Leben segelte, doch einmal leckte und voller Wasser lief, schnappte er sich ein Rettungsboot und ging von Bord.
Lews Leben ist eines mit wenigen Spannungen und nur unmerklichen Veränderungen. Aufgrund unzähliger Abschirmungen geschieht in seiner Welt nie etwas Plötzliches. Die Katastrophen, die sich auf der Erde ereignen, finden in seiner Wahrnehmung in der Peripherie statt, durchdringen jedoch nie sein gut gepolstertes, abgesichertes Dasein. Er ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass er fremdes Leid in den mannigfaltigen Erscheinungsformen an sich herankommen lässt. Was draußen in der Welt geschieht, ereignet sich praktisch nur in der Zeitung, klopft nie an seine Wohnungstür. Stets im gleichen Rhythmus lässt er sich von der Welle der Zeit weitertragen.
Lew ist ein Mann, der jedem Gedanken an Familie ausweicht. Sein Leben lang schon ist er ein unabhängiger, freiheitsliebender Mensch, der sich jeglicher Art von Vertrautheit und Verpflichtung entzieht. Er liebt das unbeschwerte Kosten und Genießen.
Obwohl seine Freunde längst verheiratet sind und teils schon beinahe erwachsene Kinder haben, betrachtet Lew sich noch immer als jemand, der unermesslich viel Zeit vor sich hat.
Er fühlt sich wohl in der Rolle des Liebhabers. Gekonnt versteht er es, den emotionalen Schlaglöchern des Lebens auszuweichen. Wenn es Lew zu eng wird, stiehlt er sich einfach davon und hinterlässt nichts als Chaos – ganz so wie ein Dieb ein geplündertes Haus. Für ihn lässt sich Partnerschaft am besten als Destillat leben, in kurzen, konzentrierten Dosen. Alles, was danach kommt, geht ihn nichts an. Er besitzt das Talent, Erwartungen zu enttäuschen.
Tief berührt ihn keine. Außer diese eine Frau – eine Begegnung vor zehn Jahren –, die ihn verzaubert hat wie keine davor und keine danach. In einer einzigen Nacht. Es war nicht einmal Sex gewesen. Ein bloßer Kuss. Die Magie eines Augenblicks. Der Funke, den man nie vergisst. Sie war ihm »zugestoßen«, diese Frau.
Jedes Mal, wenn er daran denkt, wie seine Fingerspitzen über ihre Arme, ihren Hals, ihr Gesicht geglitten waren und sie ertastet hatten, spürt er mit Erstaunen, aus welcher Ferne diese Frau in sein Leben getreten war, es umgeworfen, mit einem Sturm von Glück erfüllt und es wieder verlassen hatte.
In den Beziehungen, die er seitdem mit Frauen führt, vermisst er stets etwas, das ihn zum Bleiben bekehrt. Der Atmosphäre fehlt entweder die letzte Beschwingtheit, oder aber sie enthält nicht genug Spannendes, Prickelndes, Elektrisierendes. Das besonders Glückhafte, das fast jeder Mensch zu Beginn einer neuen Beziehung empfindet, das Verliebtsein, jenes knisternde Verhältnis eben, das sich unaufhaltsam bei der ersten Nähe ergibt, hat er nach der einen mit keiner mehr erlebt. Ohne dieses Beflügelnde versickert der anfänglich flirrende Reiz rasch, und was er an Zuneigung zu empfinden imstande ist, reicht nicht aus, um ihn länger als einige Wochen bei einer Frau zu halten. Die Unzufriedenheit der Frauen bleibt ihm ein Rätsel, allerdings eins, dessen Auflösung ihn nicht sonderlich interessiert. Als seine Mutter ihm rät, er solle bei den Frauen weniger auf das Äußere achten, gibt er salopp zurück, bei den meisten gäbe das Innere auch nicht viel her.
Überzuckert von zu vielen Komplimenten und Privilegien genießt er das leichte, verantwortungslose, klingende Leben und bleibt sich selbst genug. Ein Schlendrian, der dahinlebt wie in einer behaglichen Dämmerung. Achtlos zieht Lew an Dingen vorüber, die einen Mann in seinem Alter eigentlich beschäftigen sollten. Nur ab und an schleicht sich ein Hinterfragen in sein Bewusstsein, und es scheint ihm mit seinem Leben etwas nicht ganz richtig zu sein, etwas darin zu fehlen. Aber er findet nicht heraus, was es ist.
An einen möglichen Krieg hat er nie geglaubt. Für ihn stehen die Beziehungen der Länder untereinander fest und unverrückbar. Im heutigen Zeitalter scheint ihm alles Radikale und Undurchdachte ohnehin ausgeschlossen. Lew, im Militär einst zum Kampfjetflieger ausgebildet, ist heute Luft- und Raumfahrtingenieur und meint, der stetige technische Fortschritt müsse auch einen stetigen moralischen Aufstieg zur Folge haben.
Noch ist ihm nicht bewusst, dass dieser Krieg ein weiterer ist, der zeigt, dass weder die Spannungen zwischen Ländern zerfließen noch die Grenzen zwischen Konfessionen. Dass die Menschen weiter vom Frieden entfernt sind, als sie glaubten. Dass dieser Krieg die Welt um Jahrzehnte menschlicher Anstrengungen zurückwerfen wird.
Noch denkt er, dass dieser Krieg eine kurze Angelegenheit sein wird. Noch lebt er in der Überzeugung, dass er sein Leben selbst im Krieg bis auf die winzigste Lücke gegen das Schicksal verbarrikadieren kann.
4
Ana
Etwa eintausendsechshundert Kilometer weiter südwestlich, in einem Land ohne Krieg, lebt Ana, zweiundvierzig. Eine Frau mit blasser, fast papierweißer Haut, auf deren Wangen sich ein Hauch von Röte abzeichnet, sobald es draußen etwas kühler ist. Ihr langes, immer leicht zerzaustes Haar schimmert in der Farbe von Hagebutten und fällt in weichen Wellen über ihre Schultern. Ihre Augen sind von einem blassen, zerfließenden Blau.
Ana hat ein Gesicht ohne besondere Kennzeichen. Ein Gesicht, das in der Menge unsichtbar bleibt. Eigentlich. Denn in gewisser Hinsicht wirkt sie doch anziehend. Keine Schönheit, aber eine Ahnung von Schönheit. Eine stille Schönheit. Eine geräuschlose. Sie ist eine Frau, die auf schlichte Weise hübsch ist. Ganz so, als verkörperten ihre zarten Züge, ihre hohen Wangenknochen, ihre schmalen Lippen und die ganze Unauffälligkeit ihrer Erscheinung das weibliche Vorbild einer neuen Epoche. Einer Epoche, die es noch zu entdecken gilt. Einer leisen Epoche.
Ana weiß, sie macht sich zu viele Sorgen und lebt zu sehr in ihrem Kopf. Doch wie auch nicht? Ihr Wesen saugt Stimmungen geradezu auf. Nicht nur die eigenen, auch die der anderen. Kaum betritt sie einen Raum, erfasst sie dessen emotionalen Tenor. Sie absorbiert die Emotionen der Menschen, die sie umgeben, buchstäblich. Dafür muss sie die Leute gar nicht lange in Augenschein nehmen. Hinzu kommen ihre eigenen Gefühle, die viel zu rasch und intensiv auf die Umgebung reagieren. Folglich muss Ana nicht nur die kompliziert gewordene äußere Welt stets neu für sich ordnen, sondern zusätzlich ihre eigenen Emotionen und jene, die von anderen auf sie einströmen. Vermutlich liegt es an diesem ausgeprägten Innenleben, dass sie immer recht müde wirkt.
Ana mag den frühen Morgen. Dann, wenn es draußen noch leise ist. Und die Abenddämmerung. Dann, wenn alles ruhig wird. Sie liebt sie, die Ränder des Tages, wenn die Welt gedämpft ist und still.
Der Grund, warum sie einst in die Stadt gezogen ist, ist zum Grund geworden, aus der Stadt fortzuziehen: die vielen Menschen, das flirrende, gellende Leben.
Anfangs hat Ana die bodentiefen Fenster ihrer Wohnung genossen. Sie offenbarten, was die Stadt zu bieten hatte: an Wetter, an Licht, an Möglichkeiten. Doch inzwischen lassen sie zu viel hinein. Selbst wenn sie geschlossen sind, wird das Appartement vom Lärm überflutet. Von der Hast und Grelle der Schnelligkeit. Es bleibt nicht mehr draußen, dieses heutige Leben, es dringt bis in die Häuser ein, in jede Wohnung, in jedes Zimmer. Es entspricht ihr nicht, und sie entspricht nicht ihm.
Ausziehen sollte sie. Fort. Doch wohin? Beinahe zehn Jahre lebt sie nun hier. Ihr Ex-Freund Mika hatte das Appartement zuerst bewohnt und sie damals – nur wenige Wochen nachdem sie sich kennengelernt hatten – überredet, ihre kleine Wohnung aufzugeben und zu ihm zu ziehen. Zu jener Zeit wusste Ana noch nicht, dass ihr Zuhause das erste einer langen Reihe von Dingen war, die sie für ihn aufgeben sollte. Letzten Endes sich selbst. Doch das merkte sie erst, als er sie vor zwei Jahren verließ.
Mika hatte Ana Ziele, Pläne und sogar Gedanken übergestülpt. Sie hat nahezu jede seiner Belehrungen ernst genommen und befolgt, ohne zu merken, dass diese Anweisungen sie so weit von sich selbst wegführten, dass sie letzten Endes keine wirkliche Person mehr war. Nur noch ein Abziehbild von Mika oder der Frau, die er in ihr sehen wollte. Mit der Zeit war Ana so gut darin geworden, ihre eigenen Neigungen zu unterdrücken, dass sie sich derer jetzt kaum noch bewusst ist. Wie ein reißender Fluss ein Flussbett auswäscht, sein zerrender Strom Gestein und Boden erodiert, hat Mikas Dominanz mehr und mehr von Anas Persönlichkeit davongeschwemmt.
Warum sie noch immer in diesem Appartement wohnt, das ursprünglich seines war, weiß sie nicht. Der abgestandene Geruch nach Vergangenheit klebt in jeder Ecke und klemmt ihr die Luft ab. Längst hätte sie sich etwas Neues suchen sollen, ohnehin ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ihre Rücklagen aufgebraucht sind und sie die Miete nicht mehr zahlen kann. Ihre Ersparnisse: das Geld, das ihr Vater nach der Trennung der Eltern vor nun fast dreißig Jahren monatlich bis weit nach Abschluss ihres Studiums an sie überwiesen hatte. Irgendwann hat er die Zahlungen eingestellt – kein Wunder, weder sie noch ihre Schwester Daria haben sich je bei ihm gemeldet, nicht einmal, um sich für die regelmäßige finanzielle Spritze zu bedanken. Ana rührte das Geld nie an, hielt sich während des Studiums – Journalismus und Kreatives Schreiben – mit Nebenjobs bei Zeitungen über Wasser und lebte nach Abschluss ihres Bachelors von ihrem spärlichen Gehalt als freie Journalistin. Später dann, als sie mit Mika zusammenwohnte, zahlte Mika die vollständige Miete für das Appartement weiterhin allein. Seit er jedoch ausgezogen ist und Anas monatliches Einkommen, das sie sich durch unregelmäßige Auftragsarbeiten verdiente, immer dünner wurde, rettete ihr das Geld des Vaters das Leben oder zumindest den Alltag. In wenigen Monaten wäre allerdings auch dieses Konto leer.
Wenn sie es sich richtig überlegt: Der Inhalt der Wohnung, ihr bescheidener Besitz, wäre schnell in Kisten gepackt. Das Appartement war sowieso für eine andere Zukunft gedacht gewesen, für eine, die nun nicht mehr stattfinden wird.
Doch wohin?
Sie versteht es nicht: das Zeitgemäße, das Laute, das Hektische, die Oberflächlichkeit. Sie findet keinen Zugang zu dieser Welt, in der unsere Aufmerksamkeit von kurzlebigen Geschehnissen absorbiert wird, die dann irgendwo in uns verschwinden, als seien sie nie da gewesen. Manchmal fühlt sie sich in dieser Zeit so verloren, als irre sie in einem fremden Jahrhundert umher.
Es ist schwer für Ana, das moderne Leben auszuhalten. Den Rhythmus dieser Epoche. In der an einem einzigen Tag so viel geschieht wie früher in einem Jahrhundert. In der eine Erfindung die andere jagt. In der eine erschreckende Nachricht auf die nächste folgt. Diesen Takt, der sich unweigerlich auf den Menschen überträgt, unser Hirn überfordert, das noch immer ein anderes Maß hat und sich einer solchen Schnelligkeit gar nicht so rasch anpassen kann.
In Anas Augen hat der Fortschritt früherer Jahrhunderte das Leben der Menschen einfacher gemacht. Heute, davon ist sie überzeugt, macht er es schwerer. Damals, als der Reißverschluss die Knöpfe ersetzte, das Auto die Pferde und der Computer die Schreibmaschine, passte die äußere Geschwindigkeit noch zur inneren. Doch heute? Heute überholt uns das Außen, und wir hinken hinterher mit unserem biologischen Gehirn. Immer zügiger ersetzt künstliche Intelligenz den menschlichen Verstand. Und wieder fehlt uns ein Grund, um nachzudenken.
Es erschöpft Ana, dieses heutige Dasein, in dem der Einzelne in einem ständigen Wettstreit ist, die anderen und sich selbst übertreffen zu müssen. Dieses gierige Vorwärtsjagen. Dieses Getriebensein. Dieses Verlangen, durch ständige Posts und Statusberichte in den Sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dieser Hunger nach Selbstdarstellung und Bestätigung, der in den Blutkreislauf der Zeit eingedrungen zu sein scheint. Eine Art zu leben, die uns verbraucht, die uns leert.
Sollten wir nicht versuchen, uns selbst Anerkennung zu geben, statt ihr im Außen nachzujagen? Machen wir uns nicht zu Gefangenen, wenn unser Wohlbefinden derart von anderen Menschen abhängig ist? Vergleichen wir uns in den sozialen Netzwerken nicht ohnehin nur mit der beschönigten Version des Lebens anderer? Denn wer postet sich selbst schon in einem schwarzen Moment? Warum also sind die im Sekundentakt eintrudelnden Veröffentlichungen anderer und das stetige Surren des Mobiltelefons ein solcher Magnet? Wenn sie sowieso nur dazu führen, dass wir uns schlechter fühlen als vorher.
Die maßlose, ungeheuerliche Leere der Zeit erschreckt Ana. Die meisten Menschen kommen ihr vor wie Pflichtmaschinen. Die arbeiten und arbeiten. Und keine Ruhe finden. Die durch die Tage hasten und nie stehen bleiben. Wie aufgezogene Uhren. Bis die letzte Sekunde vorüberzieht und das Uhrwerk für immer stehen bleibt. Und was war das dann für ein Leben?
An jeder Straßenecke springt Ana das Gefühl der Absurdität an. Nirgendwo ist man sicher vor dieser Invasion. Überflüssige Lichtreklamen, Screens an jeder noch so unsinnigen Stelle. Sie sind ihr zu viel, diese unzähligen flirrenden Reize und Sinnesempfindungen. Diese durch ständiges Vergleichen überempfindlichen Augen und Ohren. Diese Gesellschaft, die nach Ausrufezeichen verlangt, nach Lautstärke, in der man schreien muss, um sich verständlich zu machen. Die fordert, stets überall präsent zu sein, und dabei vergisst, dass es für manche schon schwierig genug ist, überhaupt zu existieren. Ana kann nichts Natürliches in dieser Lebensführung finden, und doch hat sie ihr keine Alternative entgegenzusetzen. Sie irrt in dieser Welt umher wie in einem Labyrinth.
Unzählige Male hat sie versucht, das Weltgeschehen für sich zu ordnen. Aber wie soll es einem hochsensiblen Menschen gelingen, die äußere Welt zu ordnen, wenn die innere stets durcheinander ist?
Am liebsten bleibt sie für sich. Selbst mit Freunden geht Ana nur gelegentlich aus. Wozu auch? In der heutigen Zeit macht man Bekanntschaften, wie man sich eine Zigarette anzündet. Man nimmt ein paar Züge, gerade so viele, wie einem schmecken, und wenn man genug hat, drückt man das spärliche Glimmen aus.
Früher versuchte Ana noch, sich mit einem bestimmten Kreis von Leuten innerlich zu verbinden. Aber es gelang ihr nur selten. Schwerlich fand sie Menschen, mit denen sie über Dinge sprechen konnte, die ihr wichtig sind. Sich darüber auszutauschen zum Beispiel, was der Sinn des Lebens ist oder wie man ein gutes Leben führt, wie man seinen eigenen Weg findet und nach einem Scheitern wieder aufsteht. Doch sie kennt nur wenige, die so tief über das Leben nachdenken wollen. Die Konfrontation mit sich selbst ist nicht jedermanns Sache.
Hinzu kam Anas achtjährige destruktive Beziehung mit Mika, die ihren Kontakt mit anderen nicht leichter gemacht hat, sondern schwerer. Als Ana Mika kennenlernte, ging sie noch regelmäßig mit Freundinnen aus. Doch Mika kontrollierte Ana mehr und mehr, redete ihr Treffen genauso aus wie die Freundinnen selbst. Als Ana begriff, warum er das tat, war es bereits zu spät. Das Problem des Betrügers ist nicht, dass ihm keiner glaubt, sondern dass er keinem glaubt.
Überhaupt stand Mika jeglicher Freundschaft, die Ana damals noch mit anderen unterhalten hat, sowie all ihren Lieblingsbeschäftigungen im Weg. Er drängte all ihre Interessen in den Hintergrund und verkleinerte ihren Lebenskreis immer weiter. Anfangs schleichend, nahezu unmerklich, bis Anas Leben auf einen einzigen Menschen, auf einen einzigen Punkt, geschrumpft war. Auf Mika.
Von Monat zu Monat beschränkte sie ihre Existenz mehr und mehr auf die Beziehung mit diesem Mann, verlor unter dieser Einengung allmählich ihre eigene Identität. Überließ sich einem Leben, das Mika diktierte. Entfernte sich von Tag zu Tag mehr davon, wie sie eigentlich leben wollte.
Bis Mika ging. Und ihr Ich mitnahm.
Jetzt sucht Ana nach einem Versteck vor der Welt. Nach einem Ort, der ihr die Menschen und das Leben vom Leibe hält. Doch wo einen solchen Platz finden? Wo war man vor Menschen sicher?
Sie ist um jeden Tag froh, an dem sie mit niemandem reden muss. Lebt im Schattenland der Zerbrechlichen. Nimmt bloß als Beobachterin am Leben teil. Schränkt ihren Lebensraum auf den kleinstmöglichen ein. Denn nur in der Miniaturwelt, die sie sich erschaffen hat, fühlt sie sich sicher.
Und doch vergeht kein Tag ohne das Gefühl, die Zeit auf dem Erdball unbeholfen und ungenutzt davonrinnen zu lassen. In dieser Abgeschiedenheit, in der sie lebt. In dieser Entrücktheit.
Ja, vielleicht ist sie das, was viele über sie sagen: sonderbar.
All die Jahre ist Ana das gewesen, was Mika ihr einflößte: ein Nichts. Wie hätte sie ihm auch nicht glauben sollen? Die Leute schauten schon immer an ihr vorbei oder vielmehr durch sie hindurch, ganz so, als sei sie unsichtbar. Beinahe kann sie es verstehen. Schließlich ist ihr Hauptmerkmal Blässe.
Wenn sie jetzt verschwinden würde, wäre es, als hätte es sie nie gegeben. Will man so leben? Spurenlos?
Ana weiß, sie muss etwas tun. Sie muss etwas ändern. Doch sie scheitert an sich selbst. Immer und immer wieder. Nichts scheint möglich zu werden. Und sie nie die, die sie eigentlich sein will. Sie entkommt sich nicht. Wie wir uns nie entkommen, bevor wir in uns ankommen. Wie gern würde sie ihre Wahrheit finden. Doch wo danach suchen?
Angefüllt und umgeben von dichtem Nebel steht sie da. Hat keine Ahnung, wer sie ist, und wartet darauf, dass die Welt es ihr sagt. Sie wünscht sich, sie könnte das Rätsel ihres Wesens lösen, könnte jenen Teil in sich erkennen, der sie in Wahrheit bestimmt. Aber dafür müsste sie leben. Und das wagt sie nicht. Der Schritt ins Leben macht ihr eine solche Angst, dass sie sich täglich weiter zurückzubewegen scheint statt vorwärts.
Ana fragt sich, wie viele Menschen es wohl da draußen gibt, die ähnlich empfinden wie sie. Wie viele nach ihrem Platz suchen. Und: Wie macht man sich auf die Suche, wenn man nicht mal weiß, wonach?
5
Der Brief
Der Brief erreicht ihn an einem Mittwochmorgen. Ein Einschreiben in einem amtsgrünen Umschlag. Als Lew ihn in den Händen wiegt, legt sich ihm eisiger Schweiß auf die Haut. Er dreht das Kuvert. Auf der Rückseite ist ein Wappen eingestanzt. Lew reißt den Umschlag auf und zieht das dünne Papier heraus. Seine Finger zittern, als er das Blatt auseinanderfaltet. Plötzlich kribbelt Furcht in seinen Nerven. Er überfliegt das Schreiben. Es ist dreimal unterschrieben und gestempelt. Eine wichtige Angelegenheit. Er liest es noch einmal. Diesmal konzentrierter. Dennoch erscheint es ihm, als wackelten die Buchstaben hin und her. Als zerflössen sie für den Bruchteil einer Sekunde und schwömmen dann in ihre Form zurück.
Lew hat ihn erwartet, diesen Brief. Er hat sich sogar freiwillig gemeldet, trotz seines Alters. Es war seine Chance, endlich wieder die Kraft der Luft zu spüren. Endlich wieder der einzigen Leidenschaft nachzugehen, die er wirklich hat: Fliegen.
Und doch. Und doch denkt er jetzt an seine Mutter, die beinahe siebenundachtzig ist und sich langsam aufzulösen beginnt. In den letzten Jahren hat sie sich sukzessive verändert. Und auch wenn die einzelnen Schritte dieser Veränderung nur unmerklich zu spüren waren, so ist sie doch ganz offensichtlich alt und brüchig geworden.
Was soll er ihr bloß sagen? Wie soll er es ihr sagen? Er muss zu ihr fahren. So etwas sagt man nicht am Telefon.
Lew ist bereit, seinem Land zu dienen. Dem Land, das diesen Krieg vor nun fast einem Jahr begonnen hat. Jetzt, da es für ihn so weit ist.
Seit fast zwanzig Jahren ist er als Ingenieur im Flugzeugbau tätig. Er ist derjenige, der die Steuerungssoftware von Militärflugzeugen wie kein anderer kennt. Ein Experte. Eine Koryphäe.
Aufgrund seines Alters trafen ihn nicht die ersten Wellen der Einberufung. Jetzt ist er eingezogen.
Einen wie ihn kann man brauchen. Das weiß er. Keine Frage, die jungen Piloten haben die besseren Augen, die schnelleren Reaktionen, die größere Ausdauer. Dafür hat er mehr Erfahrung. Außerdem können ihm andere Augen beim Sehen helfen, zum Beispiel die eines scharfsinnigen Co-Piloten. In diesem Krieg, da ist er sich sicher, wird er sich beweisen.
Als Lew am Wochenende seine Mutter besucht, hört er schon im Korridor das Rascheln des hauchdünnen Papiers jedes Mal, wenn sie die Zeitungsseiten umblättert. Er späht um die Ecke. Sie sitzt am Küchentisch. Ihre Fingerkuppen sind dunkel von der noch frischen Druckerschwärze. Die hungrigen Gläser ihrer Brille schlucken gierig jeden neuen Bericht über den Krieg.
Lew betritt die Küche und sieht, wie angespannt sie ist. Sie schaut zu ihm auf. Eine Mutter im Schwebezustand zwischen Angst und Sorge. Eine weise Frau, die schon monatelang unter diesem Krieg leidet, die die ganze Tragik schon vorausgelitten hat, als der Krieg noch gar nicht begonnen hatte. Sie hatte diese Ahnungen.
Jetzt, da er sie so dasitzen sieht, fragt sich Lew, ob er den Mut haben wird, in diesen Krieg zu ziehen. Noch präziser fragt er sich, ob er den Mut haben wird, nicht in diesen Krieg zu ziehen.
Die Greisin hatte nach Kriegsbeginn hinter seinem Rücken den Hausarzt angefleht, eine Eingabe zu machen, dass Lew, ihr einziger Sohn, nicht in die Reserve kommt. Er sei mit fünfundvierzig ohnehin zu alt. Doch der sechzigjährige patriotische Hausarzt hat nur streng über den Rand seiner Brille geschielt und den Kopf geschüttelt. Wenn das Land Lew braucht, braucht das Land Lew.
Lew denkt an seinen Vater, der im Alter von dreiundfünfzig Jahren an Krebs gestorben ist und mit letztem Atemhauch zu seinem damals zehnjährigen Sohn sagte: »Ich glaube an dich, Lew. Ich glaube, dass du einmal etwas Großes bewirkst.«
Das will Lew jetzt. Etwas Großes bewirken. Kämpfen. Den Feind töten. Oder etwa nicht? Er redet es sich ein, bis er es sich selbst glaubt. Er würde in diesem Krieg der Sohn seines Vaters werden.
Lew zieht sich einen Stuhl heran und setzt sich zu seiner Mutter. Ohne ein Wort reicht er ihr den abgegriffenen Briefumschlag über den Tisch. Er hat das Schreiben so viele Male aus dem Kuvert gezogen, gelesen und wieder hineingesteckt, dass es schon ganz seifig ist.
In ihren Augenwinkeln sammeln sich Tränen. Lew blickt in ihr sorgenvolles Gesicht. In das Gesicht einer Mutter, die seit Kriegsbeginn jeden Tag aufs Neue ihren Sohn in der Hölle verschwinden sieht. Und heute ist der Tag, an dem ihr Albtraum Wirklichkeit wird.
»Du kannst den Brief wieder einstecken«, sagt sie, ohne den Umschlag zu öffnen, und schiebt ihn zurück über den Tisch. Sie weiß ohnehin, was darin steht. »Willst du dein Leben wirklich wegwerfen?« Stille. »Du machst also tatsächlich freiwillig bei diesem Desaster mit? Unbegreiflich! Selbst nach einem Jahr fasse ich noch immer nicht, dass es so weit gekommen ist. Mitten im Frieden ein Krieg!«
»Das wussten wir doch, Mutter.«
»Nichts wusstest du. Du hast mir nicht geglaubt, als ich vermutete, dass unser Präsident Derartiges plant. Wie die meisten hast du die Möglichkeit eines Krieges weggeschnippt wie die Asche einer Zigarette. Irgendein Knistern war schon lange im Gebälk, immer wieder flogen Funken von Reibungen, die man nicht ernst genug genommen hat, bis das Feuer ausgebrochen ist.« Sie schluckt schwer. »Dazu kann ich nur sagen: Gott, vergib ihnen nicht, denn sie wissen genau, was sie tun!« Ihre unruhigen Finger versuchen die sich einrollenden Ecken der Zeitung glatt zu streichen. »Dass du freiwillig bei diesem Grauen mitmachen willst, ist nicht nur unverständlich, es ist schlicht inakzeptabel! Du bist doch kein Mörder.«
»Ich ziehe nicht in den Krieg, um zu morden, Mutter. Ich will kämpfen – für unser Land.«
»Glaub nicht immer, was du wahrhaben willst. Wir sind doch nicht nur Staatsbürger, wir sind auch Weltbürger«, sagt die Greisin. Ihr silbernes Haar hat sie hinter dem Kopf zu einem Knoten gebunden. Ihre Haut ist bleich und wirkt mit den eingefallenen Wangen beinahe durchsichtig. Die schmalen Lippen sind trocken und rissig, die Lider gerötet und von lila Äderchen durchzogen. Ihre Augen, die tief in den Höhlen liegen und hinter der Lesebrille riesig erscheinen, wirken viel zu groß für den geschrumpften kleinen Körper – ganz so, als hätten sie genug gesehen von dieser Welt.
Erst jetzt nimmt Lew den vertrauten Geruch des Hauses wahr. Eine Mischung aus Vergangenheit, Kölnisch Wasser und Kaffeebohnen.
»Du selbst sagst mir doch immer, man könne sich nicht aus allem raushalten, in der Hoffnung, das Leben ließe einen dann in Ruhe«, sagt Lew kleinlaut.
»Rede doch keinen Unsinn. Du weißt sehr genau, dass ich das in Bezug auf andere Dinge meine.«
»Ich habe mich als Kampfjetpilot ausbilden lassen, Mutter. Um für unser Land zu kämpfen, wenn es notwendig wird.«
»Das war vor fünfundzwanzig Jahren!«
»Aber ich habe mich damals bewusst dafür entschieden.«
»Du glaubst dir doch selbst nicht, was du da sagst. Meinst du etwa, bei jedem, der sich in jungen Jahren für eine militärische Ausbildung entschieden hat, spult sich der Lebensfaden bis ins hohe Alter unabänderlich fort? So ein Blödsinn!« Sie nimmt ihre knochige Hand vom Tisch und hebt ermahnend den von der Arthritis knotigen Zeigefinger. »Über den Krieg kann man nichts wissen, solange man ihn nicht gesehen hat! Mir steckt das Grauen des Zweiten Weltkrieges noch in den Knochen, in dem mein Vater – dein Großvater – gefallen ist. Diese Grausamkeiten, diese Vergehen, diese Qualen. Dieses Gemetzel. All die Zerstörung und das Blutvergießen. Ich werde in meinen Träumen noch immer vom Knall detonierender Bomben heimgesucht. Dann schrecke ich aus tiefschwarzen Nächten auf, schweißnass und bete, dass die Welt endlich und endgültig aufwacht.« Lews Mutter schließt die Augen und schüttelt den Kopf.
»Dieser Krieg ist etwas anderes«, sagt Lew.
»Krieg ist Krieg.« Sie schaut ihn eindringlich an. Dann sagt sie: »Diese teflonbeschichtete Version von dir ist ja hoffentlich noch nicht das Endprodukt. Mir kommt es beinahe so vor, als würdest du dich in den Krieg hineinflüchten, weil er eine gute Möglichkeit ist, um vor dir selbst wegzulaufen. Ich will gar nicht wissen, wie viele in den Krieg ziehen, weil der Widerstand eines Einzelnen gegen eine Macht weit mehr Mut erfordert als das bloße Sich-Mitreißen-Lassen. Ich weiß, mein Sohn, das sind Gedanken, die du nicht gern zu Ende denkst.«
»Mutter.«
»Dass junge Menschen Angst davor haben, sich diesem Irrsinn entgegenzusetzen, verstehe ich ja. Aber in deinem Alter! Männer mit deiner Intelligenz haben das Land verlassen, als es noch möglich war. Sie haben sich von Land und Politik abgewendet, weil sie erkannt haben, dass beides zwangsläufig in einer Katastrophe enden wird.«
Ihr Blick gleitet ab, irrt für einen Moment im Zimmer umher, dann zum Fenster und bleibt schließlich irgendwo draußen hängen. Im Tageslicht, das durch die Scheibe fällt, wirkt ihr Gesicht plötzlich zart und klein. Ganz so, als würde sie zu einem Kind.
Dann wendet sie sich Lew wieder hastig zu. Etwas flackert in ihren Augen auf. »Es ist noch nicht zu spät! Es fänden sich vielerlei Ausreden.«
»Ich bin doch kein Deserteur.«
»Deserteur vor der eigenen Verantwortung schon.« Sie hält einen Moment inne. Dann sagt sie: »Wirst du es nicht müde, vorzugeben, jemand zu sein, der du nicht bist?«
Schweigen.
Schließlich spricht sie in die Stille hinein: »Was deine Möglichkeiten betrifft: Es gibt nicht immer nur das Eine oder das Andere. Wenn ›Soldat werden‹ oder ›Feigling sein‹ die beiden verfügbaren Türen sind, musst du eine dritte Tür finden und öffnen.«
Eine dritte Tür. Wenn das so einfach wäre.
Lew blättert in seinem Kopf einige Möglichkeiten durch, wie er seine Mutter besänftigen könnte, aber es fällt ihm nichts ein.
»Im Krieg geht alles verloren, was gut und edel ist im Menschen«, flüstert sie vor sich hin. Ihre Miene spannt sich an und wird ernst. Jeder Muskel zittert jetzt in ihrem Gesicht. »Du wirst töten und getötet werden. Wenn nicht körperlich, dann seelisch.«
»Ich werde zurückkehren. Lebend.«
»Niemand kehrt lebend aus einem Krieg zurück. Entweder man ist außen tot oder innen«, sagt sie in einem Ton, bei dem hinter Verzagtheit auch Enttäuschung durchschimmert. Sie stützt ihren Kopf in die Hände, atmet tief ein. »Du musst das nicht tun, Lew. Du musst diesen Militärdienst nicht antreten. Du könntest dir ein Bein brechen. Man kann sich leicht ein Bein brechen, weißt du? Es gibt viele steile Treppen, die mit nassen Schuhsohlen erschreckend rutschig sind. Besonders jetzt in dieser Jahreszeit. Mit einem gebrochenen Bein wird man für eine Weile als untauglich erklärt. Und eine Weile kann gerade lange genug sein.«
»Ich werde kämpfen, Mutter. Für unser Land. Wir werden diesen Krieg gewinnen.«
»Gewinnen muss man nicht den Krieg, sondern den Frieden! Sonst folgt bloß ein Krieg auf den nächsten. Angezettelt von Menschen, die mehr Macht haben, als gut für sie ist. Wir sind bloß Marionetten, die erst dann stückweise die Wahrheit erfahren, wenn alles lange vorüber ist. Wenn du die wirklichen Tatsachen erfahren willst, lies die ausländischen Blätter.« Sie klopft mit der Handfläche auf die vor ihr ausgebreitete Zeitung. »Hier steht alles drin! Ich ergattere alle drei, vier Tage eine. Weißt du, wo?«
»Ich will es gar nicht wissen, Mutter«, seufzt Lew. »Ist dir klar, was passiert, wenn sie dich erwischen?«
»Was sollen sie schon machen mit einer Greisin wie mir? Mir den Tod auf den Hals hetzen?« Sie lacht spöttisch. »Sag du mir lieber, wie du mit gutem Gewissen in diesen Irrsinn ziehen willst, wenn du die Fakten nicht kennst.«
»Ich kenne sie, Mutter.«
»Du kennst die offiziellen! Die hiesigen Zeitungen sind gut darin, es so darzustellen, als müsse alles genau so geschehen. Die wirklichen Gründe, die persönlichen Dramen und die seelische Atmosphäre eines Krieges finden ihren Niederschlag nicht in diesen Texten. Es ist erschreckend, wie wenig ihr jungen Leute heute von den Ereignissen wahrhaben wollt.«
Mit den Fingerspitzen streicht Lew ihr sanft über den Handrücken. Sie zieht die Hand zurück und sieht ihn an.
»Es gibt immer solche und solche. Solche, die vom Krieg wegeilen, und solche, die zum Krieg hineilen. Und solche, die darin verloren gehen. Was ist in deiner Erziehung nur schiefgelaufen? Ich habe alles richtig gemacht, aber es hat trotzdem nichts gebracht.«
Lew blickt in ihre Augen. Und sieht darin eine letzte helle Glut, die aus einer erlöschenden Hoffnung zu ihm hinüberleuchtet. Dann schließt seine Mutter die Lider, und Tränen laufen ihr übers Gesicht. Lew fasst ihre kalten, knochigen, erneut zurückschnellenden Hände und drückt sie. Er schiebt seinen Stuhl mit einem scharrenden Geräusch zurück, faltet seine hohe Gestalt auf, beugt sich zu ihr hinunter und umschließt ein letztes Mal ihren, wie ihm erscheint, von Minute zu Minute schrumpfenden kleinen Körper.
Kein Geräusch ist zu hören. Bis auf ein Singen in der Leitung der Heizung und das Vorrücken des Zeigers an der Küchenuhr.
6
Schwarze Löcher
Ein Schwarzes Loch ist ein Gebilde im Weltraum, dessen Masse auf ein extrem kleines Volumen konzentriert ist. Aufgrund dieser Kompaktheit erzeugt es in seiner unmittelbaren Umgebung eine so starke Gravitation, dass nichts mehr entkommen kann, wenn es einmal hineingeraten ist. Die äußere Grenze dieses Bereiches wird als Ereignishorizont bezeichnet. Nichts kann einen Ereignishorizont von innen nach außen überschreiten. Nicht einmal Licht. Lichtstrahlen außerhalb des Ereignishorizonts werden durch die enorme Schwerkraft des Schwarzen Lochs von ihrer ursprünglichen Bahn abgelenkt, umgelenkt oder, wenn sie ganz nah am Schwarzen Loch sind – am Ereignishorizont –, von ihm verschluckt. Da selbst Photonen nicht mehr entweichen können, ist ein Schwarzes Loch schwarz und so gut wie unsichtbar. Schwarze Löcher saugen neben Licht auch Materie aus ihrer Umgebung auf und verschlingen sie. Dadurch wachsen sie, werden immer größer und stärker. Aufgrund seiner Anziehungskraft kann ein Schwarzes Loch selbst Sterne in seiner Nähe dazu bringen, es zu umkreisen. Sie fallen dann dadurch auf, dass sie sich ungewöhnlich schnell bewegen. Und manchmal verschlucken Schwarze Löcher die Sterne sogar.
Es gibt sie. Schwarze Löcher. Nicht nur im Weltall. Auch unter den Menschen. Und genau wie ein Schwarzes Loch Materie und Licht anzieht, in sich verschwinden lässt und dabei stets wächst und kräftiger wird, gibt es Leute, die alle Kraft und alles Licht aus den Menschen ihrer Umgebung saugen und verschlucken. Von solchen Leuten muss man sich fernhalten. Oder wenn man ihnen bereits zu nahe gekommen ist, sollte man sich so schnell wie möglich aus ihrem Gravitationsfeld befreien.
Ana bemerkte viel zu spät, dass Mika ein solcher Mensch war.
7
Das Ende eines Traums
Der Tag, an dem Anas Welt aus den Fugen geriet, begann unter einem wolkenlosen Himmel. Ein Himmel in einem Blau, nach dem man greifen und das man herauszupfen konnte. Ein Himmel in einem Kornblumenblau.
Zwei Jahre sind inzwischen vergangen, doch die Erinnerung an jenen Tag prangt noch immer hinter ihren Lidern in einer Deutlichkeit, die wehtut. Noch immer fragt sie sich, ob sie es hätte kommen sehen müssen. Ganz bestimmt hat es erste Zeichen gegeben. Es gibt sie immer. Aber die meisten von uns sind so in ihrem Alltag gefangen, dass wir den Blick für sie verloren haben.
Mika verließ sie. Seine Worte zum Abschied waren knapp, schneidend, endgültig und zogen einen langen markanten Schlussstrich unter ihre gemeinsamen Jahre.
Selbst jetzt noch steigen Ana Tränen in die Augen, wenn sie daran denkt. Aber sie blinzelt sie weg.
»Wir müssen reden«, sagte der Mann zu ihr, mit dem sie acht Jahre zusammen gewesen war. Für den sie so vieles aufgegeben hatte. »Das geht so nicht weiter. Wir beide. Das funktioniert nicht.«
Es dauerte eine Weile, bis die Worte bei ihr ankamen. Sie verstand nicht. Versuchte, in seinem Gesicht zu lesen. Doch seine Miene war starr, verschlossen. Mit einem Mal war er ihr völlig fremd.
»Was meinst du?«, fragte sie stockend.
»Es hat keinen Sinn. Das mit uns.«
Seine Sätze schienen meilenweit entfernt. Sie fing nur einzelne Worte auf, Fragmente. Bis sie deren Bedeutung begriff und ihre Stimme wiederfand, dehnte sich die Zeit.
»Hast du eine andere?«, sagte sie leise. Und er nickte nur unmerklich.
Ein Gefühl der Unwirklichkeit überkam sie. Sie tastete nach der Stuhllehne und klammerte sich daran fest. Und während sie zitternd so dastand, gestand er ihr noch, dass seine neue Freundin schwanger von ihm war. Als er das sagte, huschte eine mikroskopische Regung über sein Gesicht. Er freute sich auf das Kind.
»Aber du wolltest doch nie ein Kind!«
»Vielleicht. Aber jetzt weiß ich, dass ich eins will.«
Wie gern hätte Ana Kinder gehabt. Jedes Mal, wenn sie davon angefangen hatte, hatte Mika ihr das Wort abgeschnitten. Sie hatte geschwiegen. Aber das Thema war geblieben. Es hatte mit ihnen am Tisch gesessen. Acht ganze Jahre lang. Bis Mika ihren Traum mit einer anderen verwirklichte.
»Warum?«, fragte sie.
»Das willst du wirklich wissen? Du hältst Ehrlichkeit doch gar nicht aus.«
»Bitte«, flehte sie ihn an, und ein Kribbeln selbstvernichtender Erniedrigung kroch ihr über die Haut, breitete sich als schwarze Pünktchen bis in ihr Gesichtsfeld aus und verdunkelte ihren Blick für den Bruchteil einer Sekunde.
Doch Anas Verzweiflung glitt an Mika ab. Scharf sog er Luft durch die Nase ein. »Du warst ein Fehler. Und er endet heute.«
»Das weißt du jetzt? Nach acht Jahren?«, stotterte sie nach einem Moment des schockierten Schweigens. Und flüsterte dann in die schreiende Stille hinein: »Hast du mich je geliebt?«
Die Antwort blieb unausgesprochen im Raum hängen, doch beide kannten sie. Ein Klirren in Anas Herzen war zu hören, als bräche ein Traum aus Glas.
Diese berstende Verzweiflung in ihr. Die Ohnmacht.
Sie kämpfte mit den Tränen. »Bitte nicht«, sagte sie zu ihm und vernahm dabei den bettelnden Ton ihrer Stimme.
Seine Worte darauf wie ein Schlag: »Das mit uns, das ist vorbei. Komm drüber hinweg!«
Während ihres ganzen Wortwechsels zog er immer wieder gierig an seiner Zigarette, und am Ende drückte er den Stummel in den Hals einer vom Vorabend umherstehenden, halb vollen Bierflasche. Ein kurzes Zischen – ganz so wie ihre Beziehung gewesen war –, und dann stieg ein dunkler Rauchfaden aus der Flasche auf.
Sie flehte Mika an, zu bleiben, nach acht gemeinsamen Jahren. Versuchte, seine menschliche Seite anzusprechen. Doch es half nichts. Er ging.
Anas Leben fiel in sich zusammen wie eine Sandburg – während seins wie eine feingestimmte Uhr weiterlief. Seit Ana ihn kannte, plante und führte er sein Leben mit militärischer Präzision. Gekonnt navigierte er es selbst über unbefestigtes Gelände. Er ließ darin keinen Platz für Überraschungen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, andere mit seinen Plänen vor den Kopf zu stoßen. Mika wollte Ana nicht mehr in seiner Welt haben, warf sie vom Beifahrersitz und schloss die Tür. Sie jedoch hatte das Fahren verlernt.
Heute ist Ana klar, dass sie sich lange etwas vorgemacht hat. Dass sie damals blind sein wollte für das Scheitern der Beziehung. Dass ihr eigenes Erleben eine Täuschung war.
Mikas Blick hatte sich schon lange von einer gemeinsamen Zukunft abgewandt. Hätte sie ihr Gespür nicht geleugnet, hätte sie die Distanz fühlen können, die mit jedem gemeinsamen Monat zwischen ihnen gewachsen war.
In den Jahren vor der Trennung hat Mika ihr die Liebe nur vorgespielt, das weiß sie jetzt. Er hat sie gebraucht. Nicht geliebt. Sein Theater war aus Glas, sie hätte hindurchsehen können. Doch hat sie sich nicht eingestanden, dass er bereits im Gehen war und dass sie tatsächlich nicht zueinanderpassten.
Obwohl ihre Körper einander vertraut gewesen waren, waren ihre Gedanken in den Nächten fremdgegangen, aneinander vorbei. Hatten nach anderen Seelen getastet.
Wie oft hat sich Ana dabei ertappt, sich eigentlich nach einem ganz anderen Mann zu sehnen. Nach dem Mann nämlich, der ihr vor langer Zeit begegnet war. Damals, als sie ihn das erste und einzige Mal gesehen hatte und sofort wusste, dass dies einer jener Momente war, die bis ganz zum Ende blieben: Sie war mit Mika erst kurz zusammen gewesen, als sie in ihrem ersten gemeinsamen Urlaub diesen Unbekannten traf. Sie hatten einander angelächelt, und Ana sog sein Gesicht in sich ein. Der Fremde hatte sich ihr zugewandt und ihr direkt in die Augen geschaut. Es hatte sich unwirklich angefühlt, ganz so, als ob er in ihr Innerstes blickte, auf die Wahrheit in ihr. Als ob er sie in ihrer Ganzheit sah – und erkannte. Bis zu jenem Geschehnis hatte Ana nicht gewusst, dass das möglich war. Wann auch immer Mika sie ansah, versuchte er, die Frau zu sehen, die er in ihr sehen wollte. Er konnte oder wollte nicht sehen, wer sie tatsächlich war.
Vielleicht hatte Ana deshalb in jener Begegnung mit dem Fremden diesen merkwürdigen Frieden empfunden – als könne sie in seiner Gegenwart alles, was sie zu sein vorgab, beiseiteschieben, und einfach nur sein, wer sie wirklich war. Es hatte sich so angefühlt, als offenbare ihr sein Blick sich selbst. Als erkenne sie sich in seinen Augen.
Der Fremde hatte Fragen in ihr geweckt, die sich nun in aller Deutlichkeit in ihr Bewusstsein schieben, in es einsickern und Antworten verlangen: Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das? Warum hältst du so wenig von dir? Warum hast du vergessen, wohin du willst?
Als sie mit jenem Mann einen viel zu kurzen Moment allein auf der Veranda des Hotels gestanden war, hatten seine Hände in der Dunkelheit nach ihren getastet. Seine Fingerkuppen berührten ihr Handgelenk, glitten über ihre Arme, über ihren Nacken, über ihr Gesicht. Anas Herz pochte. Ihre Lippen zitterten, als er sie küsste. Plötzlich war Mika aufgetaucht, und sie hatten sich schockiert voneinander gelöst.
Am nächsten Morgen war Mika mit Ana in aller Frühe abgereist, und sie sah den Unbekannten nie wieder. Kannte nicht mehr von ihm als seinen Vornamen.
Wochenlang noch spürte Ana die Hand dieses Fremden auf jedem Zentimeter ihrer Haut, obwohl er sie nur im Gesicht, am Nacken, an den Schultern, den Armen und Händen berührt hatte. Wie oft schloss sie die Augen und belebte die Erinnerung an ihn wieder. Stellte sich die Fragen, die mit den Erinnerungen kamen: Willst du wirklich dieses Leben mit Mika? Willst du wirklich hier sein?
Heute fragt sich Ana, in wie vielen Betten der Welt Paare so eng beieinanderliegen und doch so weit voneinander entfernt. Heimlich und still nach etwas anderem suchend.
Die Atmosphäre um Mika und sie war nur anfangs warm gewesen, lauwarm, präziser gesagt. Kühlte dann jedoch recht schnell ab, und es wurde frostig um sie. Ana spürte recht bald, dass er nicht der Richtige war. Und doch blieb sie. Das hatte nichts mit Dummheit zu tun. Auch nicht damit, nicht wahrhaben zu wollen, dass er der Falsche war. Vielmehr hatte es etwas mit dem Grad der Einsamkeit zu tun. Mit der Tiefe der Sehnsucht. Man verliebt sich nicht immer in den Menschen, der es wert ist. Man bleibt nicht selten, weil man einsam ist. Und wie einsam musste man sein, um sein Innerstes abzustellen – wie ein Radio.
Heute weiß sie: Man kann sich nicht aussuchen, wen man liebt. Und wen man liebt, verändert alles.
Dieses elektrisierende Gefühl, dieses Wissen darum, dass man zueinandergehörte, obwohl man noch nicht viel voneinander kannte, hatte Ana nur dieses einzige Mal vor vielen, vielen Jahren mit dem Fremden erlebt. Nie zuvor und nie danach hatte sie dieses Gespür gehabt, füreinander bestimmt zu sein. Doch sie und dieser Mann hatten sich nach der ersten Begegnung wieder verloren.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























