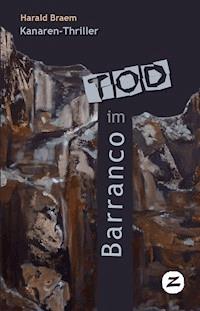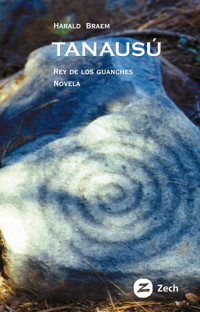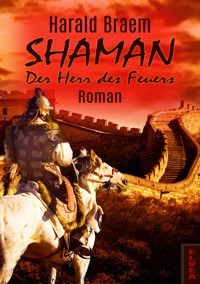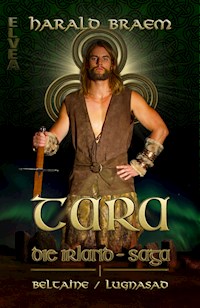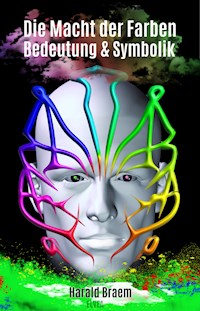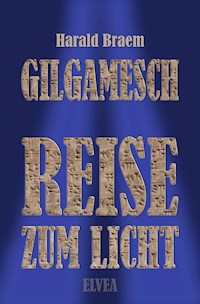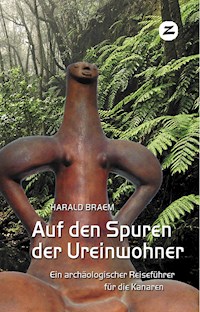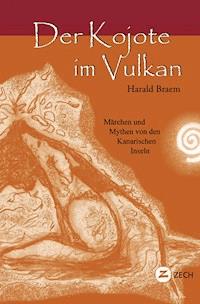
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Historische Romane und Erzählungen
- Sprache: Deutsch
Uralte mystische Verzauberung liegt über den Kanarischen Inseln. Ihre paradiesische Schönheit hat schon die Menschen in der Antike bewegt, seither ranken sich viele Märchen, Mythen und Sagen um den Archipel. Zwanzig der schönsten Erzählungen hat Harald Braem in diesem Band zusammengetragen: mit viel Sach- und Landeskunde und einem Augenzwinkern. Illustriert von Karin Tauer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald Braem
Der Kojote im Vulkan
Märchen und Mythen von den Kanarischen Inseln
Über das Buch
Uralte mystische Verzauberung liegt über den Kanarischen Inseln. Ihre paradiesische Schönheit hat schon die Menschen in der Antike bewegt, seither ranken sich viele Märchen, Mythen und Sagen um den Archipel. Zwanzig der schönsten Erzählungen hat Harald Braem in diesem Band zusammengetragen: mit viel Sach- und Landeskunde und einem Augenzwinkern.
Illustriert von Karin Tauer.
Der Autor
Harald Braem (Berlin, 1944), emerit. Professor für Design und Kommunikation in Wiesbaden, war bis 2013 Direktor des Kult-Ur-Instituts für interdisziplinäre Kulturforschung. Er ist Autor zahlreicher Bücher und langjähriger Kanarenkenner und verfasste Romane, Erzählungen, Sach- und Kinderbücher sowie Filmbeiträge. Im Zech Verlag sind außerdem von Harald Braem erschienen: Tanausú, König der Guanchen, Auf den Spuren der Ureinwohner, Der Vulkanteufel und Tod im Barranco.
www.editorial-zech.es/de/harald-braem
Die Kanarischen Inseln
An Stelle eines Vorworts: Wie die Kanarischen Inseln ihren Namen erhielten
Es gibt unterschiedliche Aussagen darüber, wie die Inselgruppe früher wirklich hieß und was ihr Name bedeutet. Zwei Erklärungen davon möchte ich nennen und ihr eine dritte gegenüberstellen – ein modernes Märchen, das vom typischen Humor der heutigen Einwohner geprägt ist. Hier nun die erste Erklärung, die am weitesten verbreitet ist und sich in nahezu allen Fachbüchern wiederfindet: Für die frühen Kulturen der Antike, die der Ägypter, Griechen und Römer, lag das Totenland, das Land, in das die Seelen der Verstorbenen zur ewigen Ruhe einzogen, stets im Westen, also dort, wo die Sonne untergeht. Die Sonne ‘starb’ im Westen, also musste dort auch das Eingangstor zur Unterwelt sein. Die keltischen Druiden sprachen von Tir-na-nog, den Inseln der ewigen Jugend, und machten sich in lederbespannten Kanus und schlanken Drachenbooten auf, sie zu suchen. Die Griechen legten ihre Friedhöfe, die sie ‘Ne-kropolis’ (Totenstadt) nannten, stets westlich ihrer Wohnplätze an, oft sogar auf vorgelagerten Inseln. Diese letzten Ruhestätten galten aber nur den sterblichen Hüllen; die Seelen indes, so glaubten sie, wurden von einem schweigsamen Fährmann (Charon) über ein graues Meer (Styx) hinweg ins Jenseits (Hades) gerudert, das auch die ‘Elysischen Gefilde’ oder die ‘Inseln der Seligen’ hieß.
Der Eingang dazu wurde von einem großen Hund, dem Cerberus, bewacht. Von einigen wenigen verwegenen Seefahrten abgesehen (Homer berichtet in den Heldentaten des Herakles davon), war der Atlantische Ozean eine riesige, unbekannte Wasserfläche. Also mussten sich dort, ‘jenseits der Säulen des Herakles’, im Westmeer die ‘seligen Inseln’ befinden. Die Kanaren waren also die Inseln des Jenseits.
Nun deutet die Vorsilbe ‘can’ bekanntlich im Lateinischen auf einen ‘Hund’ (canis) hin, und Hunde als Jenseitswächter oder -boten finden wir in der Mythologie der alten Völker allerorten.
Bei den Ägyptern besaß der Totengott Anubis einen hunde- bzw. schakalähnlichen Kopf. In Homers ‘Ilias’ wird von Hunden als Grabbeigaben berichtet. Viele afrikanische Stämme betrachten Hunde als Seelenbegleiter, als Führer der Verstorbenen und Boten des Jenseits. In der Heraklessage haust im ‘Land der Abenddämmerung’ Erytheia der Höllenhund Orthros, und selbst die kanarischen Ureinwohner, die Guanchen, besaßen in ihrer Vorstellung eine stattliche Anzahl von Unterweltgeistern in Hundegestalt, die sie Cancha, Gayote, Coyote, Hagwayan, Hirguan, Tibisenas oder Iruene nannten. Demnach würden die Kanaren also ‘Hundeinseln’ heißen mit der tiefergehenden Bedeutung von ‘Eingang in die Jenseitswelt’.
In der Tat hielten die Guanchen sich Hunde als Haustiere, zwei verschiedene Rassen, von denen der hochbeinige, windhundartige Typus noch heute der bekanntere ist. Von diesen Hunden kündet auch der zweite Bericht:
König Juba II., ein numidischer König, der im Jahr 25 v. Chr. vom römischen Kaiser Augustus das Königreich Mauretanien erhielt, war ein neugieriger, wissensdurstiger Mann. In Rom war er aufgewachsen und erzogen worden, besaß eine riesige Bibliothek, schrieb selbst drei Bücher und hatte den Ehrgeiz, alles Wissen seiner Zeit aufzeichnen zu lassen. Er unternahm mehrere Seereisen, um seinen Horizont zu erweitern, und hat nachweislich auch einmal eine Expedition zu den Kanarischen Inseln geschickt. Neben einem ausführlichen Bericht über die ‘Insulae Canariae’ brachten ihm seine Kundschafter zwei Hunde von außergewöhnlich großem Wuchs mit, die sie auf der ‘Insel der großen Hunde’ (Gran Canaria) eingefangen hatten.
Die ganze Angelegenheit wird uns von Plinius dem Älteren (23-79 nach Chr.), einem äußerst seriösen römischen Geschichtsschreiber, bestätigt. Demzufolge hat also der Archipel seinen Namen nach der Hauptinsel Gran Canaria erhalten. Und wieder sind es die Hunde, auf die wir dabei stoßen.
Die jüngste Legende aber lieferte mir Pepe, als wir beim Rotwein zusammensaßen und Lieder sangen. Seine dunklen, lustigen Augen zwinkerten listig, während er die Geschichte erzählte, und er kraulte unaufhörlich seinen Hund dabei – ein kleines, freundliches Schoßtier, nicht größer als eine Katze.
„Weißt du“, sagte er, „das stimmt alles nicht, was in den Büchern steht über die Islas Canarias. Das ist nicht von innen gesehen, sondern von außen, so wie ihr aus Europa euch die Sache vorstellt.“
„Weißt du denn, wie es wirklich war und wie die Inseln zu ihrem Namen kamen?“
„Ja“, meinte Pepe, „und das war so: Die Islas Canarias waren schon immer schön, wunderschön, glückliche Inseln. Das Klima ist mild, im Sommer nie zu heiß, im Winter nie kalt. Du kannst dreimal im Jahr Kartoffeln ernten oder, wenn du willst, viermal Bananen. Wir Canarios lieben die Inseln. Unsere Vorfahren, die Guanchen, taten das auch, und einer Menge anderer Leute gefiel es hier gut. Wer hier herkam, der wollte meist nicht mehr weg. Und es kamen Schiffe von überall her: Phönizier und Griechen, Leute von Iberia und von der afrikanischen Küste, die hatten sich meistens verirrt. Ja, es haben schon immer Fremde hier bei uns gelebt, so wie du, Hombre. Aber langsam wurde es unseren Vorfahren zuviel. Da griffen sie zu einer List. Du weißt, sie hatten Hunde, schöne Hunde, große und kleine wie diesen hier, wie mein Chico. Einige waren aber auch ganz groß, so richtige Monster. Die mochten sie eigentlich nicht, aber für die List, die sie sich ausgedacht hatten, waren sie brauchbar.
Weißt du, was die Guanchen nun taten, wenn wieder einmal ein fremdes Segel herankam? Sie versteckten sich einfach und schickten die riesigen Tiere an den Strand. Wenn dann die Fremden an Land gingen, liefen ihnen die Hunde bellend entgegen, denn sie waren vorher nicht gefuttert worden und hungrig und hofften, endlich etwas zu fressen zu bekommen. Meistens erschraken die Fremden darüber, flüchteten in ihre Schiffe zurück und fuhren wieder nach Hause, um dort zu erzählen, sie seien noch eben mit dem Leben davongekommen.
Einmal kam ein Schiff, das dieser König Juba aus Mauretanien geschickt hatte. Der Capitano des Schiffes ging an Land, und wie immer rannten die großen, hungrigen Hunde zur Begrüßung zum Strand. Die Guanchen saßen versteckt im Gebüsch und beobachteten, was der Fremde wohl tun würde. ‘Ha’, sagten sie und rieben sich die Hände, ‘gleich sieht er die Hunde und macht sich vor Schreck in die Hosen.’ Aber der Capitano war anders als die meisten sonst, kein Conquistador und auch kein Feigling, obwohl das ja oft das gleiche bedeutet... Er war irgendwie nett, fast wie du, Hombre, wenn du mich zum Vino einlädst... Also, der Capitano zeigte keine Angst vor den Tieren, im Gegenteil, er sprach mit ihnen, streichelte die hässlichen Köter und gab ihnen zu fressen. Danach kam er mit ein paar wenigen Leuten hoch und suchte nach den Besitzern der Hunde. Na, du kannst dir vorstellen, dass die Guanchen da nicht im Gebüsch blieben, sondern zu ihm gingen, um ihn zu fragen, ob er vielleicht handeln wolle oder Geschenke an Bord des Schiffes habe. Beides stimmte, er brachte Geschenke, blieb eine Weile und gab sich Mühe, die Sprache der Einwohner zu erlernen. Daran kannst du sehen, Hombre, dass er anders war als die meisten Touristen heute ...
Er blieb also zwei, drei Monate oder länger und schrieb alles fleißig auf, was unsere Vorfahren ihm erzählten. Dann musste das Schiff zurück, um seinem König ein Ergebnis zu bringen. Und weißt du, was da passierte? Dem Capitano gefiel es so gut hier, dass er nicht mehr zurück nach Afrika wollte. Er jammerte, trank viel Vino und fragte die Guanchen, was er wohl anstellen müsste, um hierbleiben zu können. Da wussten unsere Leute Rat, und weil er ja ein netter Kerl war, sagten sie ihm:
‘Mach es doch einfach so, schick das Schiff zurück zu deinem König und schreib in deinem Bericht, dass es hier schrecklich öde und langweilig ist. Nichts als Vulkane und Lava, trockene Felder und überall furchtbare, zähnefletschende Hunde – kurzum Inseln, um die man lieber einen weiten Bogen machen sollte. Es lohne sich nicht, sie zu erobern. Und als Beweis schick ihm ein paar von den hässlichen großen Hunden mit und gib der Besatzung Anweisung, sie unterwegs nicht zu füttern, damit sie bei der Ankunft auch richtig ausgehungert und unfreundlich sind.’
Das tat der Capitano dann auch, und es hat gewirkt: lange Zeit traute sich kein Schiff mehr heran. Der Capitano aber blieb hier, heiratete ein Mädchen von den Inseln und wurde ein echter Canario.
Siehst du, so ist es wirklich gewesen, so haben die Islas Canarias ihren Namen erhalten.“
Harald Braem
Der Kojote im Vulkan
Es war zur Zeit des Beñesmen, des sommerlichen Erntefestes, das mit der Guatatiboa beginnt, einem ausgedehnten, fröhlichen Schmaus, an dem das ganze Dorf teilnimmt. Die Ernte war eingesammelt, Getreide und Früchte gab es genug für alle und auch den frischen Wein, den glutvollen, guten, der sonnenverwöhnt auf den Lavahängen heranwächst.
Als keiner mehr essen konnte, die Guatatiboa zu Ende war und nur noch reichlich vom gegorenen Traubensaft floss, setzte Tanz und Gesang ein und wurden lautstark die Wettkämpfer angefeuert, die sich im Steineheben, Stabspringen und Ringen zu übertreffen suchten. Der Guanche Taxa, der ansonsten ein recht guter Stabspringer war und mit seiner Sprunglanze leichtfüßig über die Terrassen zu fliegen verstand, sah sich diesmal nicht in der Lage, an der Konkurrenz teilzunehmen, denn er hatte schon über die Maßen vom Wein genossen und fühlte sich nicht mehr ganz sicher auf den Beinen. So saß er also lieber zwischen den Mädchen und sang ihnen Lieder vor, die ihm allerdings in Anbetracht seines Zustands nicht mehr ganz so klar und deutlich über die Lippen kamen. Die Mädchen kicherten und prusteten hinter der vorgehaltenen Hand.
Da gesellte sich Orotaga, sein Nachbar, hinzu, um ihn aufzuziehen:
„Du scheinst mir ein außergewöhnlicher Held zu sein“, lästerte er. „Die Sprungstangen sind dir zu lang, die Hebesteine zu schwer, und zum Ringkampf bist du zu schlapp – was bleibt einem abgestürzten Raben da anderes, als auf dem Boden zu hocken, mit den Flügeln zu schlagen und zu krächzen!“
So durfte man nicht mit dem Taxa reden, denn wenn er auch betrunken war, so hatte er doch seine Ehre. Er rappelte sich also hoch, stand schwankend vor Orotaga und schrie:
„Was glaubst denn du, Ziegenbock von einem Nachbarn, warum ich das tue?“
„Und warum?“ wollte Orotaga wissen.
„Um meine Kräfte für eine wirkliche Mutprobe zu schonen, eine, die du dir niemals zutrauen würdest.“
„Sag, was du meinst“, erwiderte Orotaga, „und ich antworte dir schon jetzt, dass ich dich in allem, was du tun willst, noch um ein beträchtliches Stück überbieten werde!“
„Das sollst du wiederholen, du geschwätziges Großmaul, wenn du erst weißt, was ich vorhabe!“ schrie Taxa.
Mittlerweile hatten sich viele Dorfbewohner um sie geschart und hörten neugierig zu.
„Ich will dem Guayote, dem Kojoten im Vulkan, einen Besuch abstatten.“
Orotaga und alle, die es mitbekommen hatten, erstarrten vor Schreck. Taxa musste völlig von Sinnen sein, dass er solches vorhatte! Kein Mensch, nicht einmal einer, dem der Verstand abhanden gekommen war, würde freiwillig zum Teide gehen.
„Im Teide ist die Hölle los, und man soll das Böse nicht leichtfertig herausfordern“, sagte Orotagas Weib, und eine andere rief: „Noch nie ist einer mit dem Leben davon gekommen, der den Guayote zu Gesicht bekam!“
Orotaga aber war ein störrischer Mann und hatte sich mit seiner Prahlerei bereits viel zu weit vorgewagt. Er würde als Feigling dastehen, wenn er nun einen Rückzieher machte.
„Das wollen wir sehen!“ riefen einige vom Wein selige Männer, und ihre Frauen machten warnende Zeichen, indem sie mit Daumen und Zeigefinger die Lippen zusammenpressten.
Also gingen Orotaga und Taxa los. Das halbe Dorf begleitete sie, denn die Leute wollten mitbekommen, ob die lautstarken Kerle ihren Plan wirklich ausführten. Und die beiden zogen tatsächlich zum Teide, während die Sonne lustig vom Himmel brannte. Unterwegs wurde es jedoch kühler, denn je höher man zum Kraterrand aufsteigt, desto kälter weht der Wind. So blieben die Leute zurück, setzten sich unter einen Teabaum, ließen die mitgeführten Weinkrüge kreisen und beobachteten in aller Gemütsruhe den weiteren Aufstieg der beiden Männer, die immer noch ein wenig unsicher schwankten. Klein und kleiner wurden sie, zwei winzige Ameisen am Rande des gewaltigen Vulkans.
Taxa und Orotaga stapften einträchtig nebeneinander her und sprachen kein Wort. Nach einer Weile hörte der Baumbewuchs vollständig auf, und es wurde noch kälter.
„Lass uns umkehren“, sagte Taxa plötzlich, doch Orotaga wurde nun seinerseits stur.
„Du wolltest unbedingt hierher“, entgegnete er, „und ich habe vor allen behauptet, ich ginge noch weiter als du.“
„Dann bleibe ich jetzt stehen, du gehst zwei Schritte weiter, und wir kehren anschließend um“, schlug Taxa vor.
„Halt den Mund!“ sagte Orotaga barsch. „Wir gehen weiter; auch ich wollte immer schon mal den Guayote sehen. Wenn du mich fragst, ich glaube nämlich nicht, dass es ihn gibt. Vielleicht ist er eine Erfindung der alten Otuteka, die sich nur mit solchen Dingen beschäftigt und alle verrückt macht mit ihrem Gerede, seit sie als Mädchen Harimaguada war.“
In diesem Moment stürzte Taxa in eine Schlucht. Zum Glück war sie nicht tief, und außerdem konnte er sich mit den Händen an einem hervorragenden Felsstück festhalten.
„Bist du tot?“ fragte Orotaga von oben.
„Nein“, brüllte Taxa zurück, „aber wenn du nicht kommst und mir hilfst, bin ich es gleich!“
Vom Sturz war er schlagartig nüchtern geworden. Ganz klar vermochte er die Umgebung rings herum zu erkennen. Als Orotaga umständlich herabgeklettert kam und auch er wieder Boden unter den Füßen hatte, sagte Taxa:
„Hier in der Schlucht ist ein besserer Weg zum Teide, den können wir gehen. Er windet sich gemächlich empor.“
Orotaga war es recht.
So stiegen sie hinab, erreichten den Pfad und folgten seinem Lauf bis zum Kraterrand. Kurz vor dem Krater machte der Weg eine Biegung, und dahinter stand, wie aus dem Boden geschossen, ein Dämon von schrecklicher Gestalt: ein riesiger, langmähniger Hund mit struppigem Fell, feurig glühenden Augen und warmem, hechelndem Atem.
„Der Guayote“, flüsterte Orotaga mit kaum vernehmlicher Stimme. „Es ist tatsächlich ein Kojote, aber so hässlich, wie ich noch keinen sah.“
Der Kojote legte den Kopf schief und betrachtete die Männer, als schätze er ab, welchen er zuerst anfallen sollte.
„Tu uns nichts!“ sagte Taxa. „Wir sind zwei harmlose Wanderer, kommen von der Beñesmen und wollen nur mal kurz zum Teide empor.“
Der Kojote sperrte das Maul auf und sprach zu ihrer Überraschung mit menschlicher Stimme:
„Was habt ihr hier oben zu suchen? Was wollt ihr hier?“
„Oh, vielleicht... wenn wir ihn treffen... dem Guayote ein kleines Geschenk überreichen...“, stotterte Orotaga.
„Was habt ihr dabei?“ fragte der Kojote und sah furchterregend aus: sein Maul war furchtbar groß, und er bleckte die langen, scharfen Zähne.
„Einen... Lederbeutel mit Wein. Ganz frisch ist er, ein guter Tropfen der neuen Ernte“, sagte Taxa und streifte das gegerbte Ziegenfell von seiner Schulter, in das er sich etwas Wein als Reiseproviant eingefüllt hatte.
„Nett gemeint“, erwiderte der Kojote. „Aber leider trinke ich keinen Wein, mich dürstet eher nach Menschenblut.“
„Dann nimm den da“, meinte Orotaga schnell und trat hastig einen Schritt zurück. „Der hat weder Frau noch Familie, man wird ihn im Dorf weniger vermissen als mich.“
„Nichts da!“ rief Taxa zornig. „Warst du es nicht, der so großspurig behauptet hat, er würde in allem, was ich tue, mich um ein beträchtliches Stück überbieten? Wenn also einer dran glauben muss, dann bist du es, Orotaga. Los, geh hin und beweise, dass du ein richtiger Held bist.“
„Streitet euch nicht!“ bellte der Kojote und streckte sich genießerisch, indem er zuerst die beiden Hinterpfoten lang machte und dann den Rücken zum Buckel zusammenzog. „Es gehört sich nicht für einen Guanchen, feige zu sein. Ohnehin habe ich es nicht eilig, das zu bekommen, wonach mich gelüstet, denn in drei Mondwechseln, wenn niemand es ahnt, werde ich reichlich Beute machen.“
„Was?“ riefen da Taxa und Orotaga wie aus einem Munde. „Wirst du vom Teide herabkommen und unser Dorf überfallen?“
„Genau das“, antwortete der Kojote. „Und es wird nicht nur Blut, sondern vor allem auch Feuer und kochende Lava fließen.“
Als die beiden mutigen Guanchen dieses hörten, bekamen sie es erst recht mit der Angst. Sie verabschiedeten sich höflich vom Untier und brachen eilig zum Abstieg auf.
Bei den Freunden am Teabaum angekommen, berichteten sie atemlos und aufgeregt, so dass sich ihre Stimmen überschlugen, von ihrem Treffen mit dem schrecklichen Kojoten. Dabei sahen die Dorfbewohner, dass Taxa und Orotaga überaus nüchtern waren, auch wenn sie auf den Schreck hin erst einmal zum tönernen Weinkrug griffen.
Als dann auch noch die alte Otuteka wenig am Wahrheitsgehalt ihrer Worte zu zweifeln schien, entschied der Dorfälteste, noch vor Ablauf der vom Kojoten genannten Frist, das Dorf zu verlassen.
In der Nacht, als der Mond zum drittenmal wechselte und wie eine scharfe Sichel am Himmel hing, hatten sich die Leute auf einer sicheren Anhöhe versammelt und sahen, dass sich über der Spitze des Teide eine düstere Wolke zusammenzog. Plötzlich zuckte daraus ein gewaltiges Feuer und erhellte die Nacht. Die Erde rumorte und bebte, Donner grollte, und aus dem Innern der Hölle erhob sich eine Säule aus Feuer, Asche und Dampf. Dann aber spuckte der Teide glühende Brocken aus und schleuderte Feuerpfeile zu Tal; wie brennender Honig lief die Lava vom Krater herab, füllte das Tal und machte auch vor dem Dorf nicht halt, bis es unter dem rot wabernden Brei verschwunden war.
Es kann sein, dass der Kojote in dieser entsetzlichen Nacht doch noch genug Blut zu trinken bekam, denn sein Wüten schien keine Grenzen zu kennen. Auch andere Dörfer ergriff er mit gierigen Pranken und überraschte so manchen im Schlaf dabei.