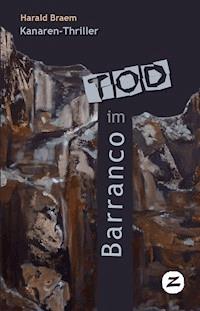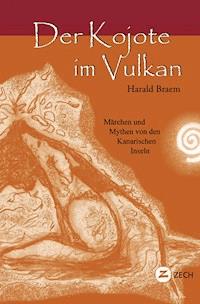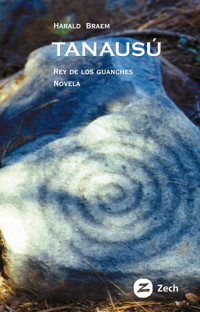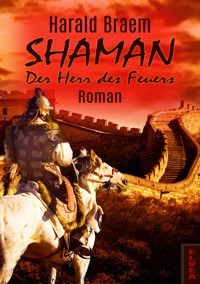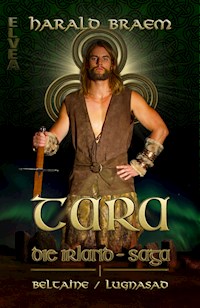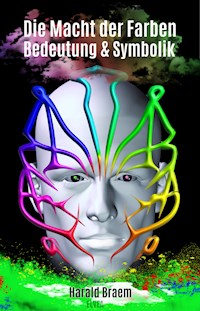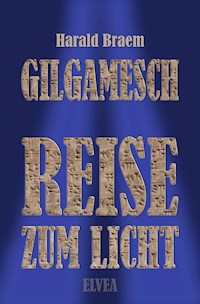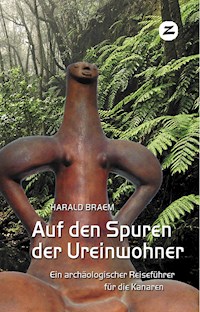Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Krimis u. Thriller
- Sprache: Deutsch
Urlaub machen, Arbeit und Alltag vergessen - das wollte der junge Bibliothekar Frank Richter auf der Kanareninsel La Palma. Doch dann ereignen sich rätselhafte Unfälle und Selbstmorde, Touristen verschwinden spurlos... Handelt es sich um mysteriöse Ritualmorde? Menschenopfer im Schatten des großen Vulkans? Frank Richter und seine Freunde gehen der Sache auf den Grund: Einst gab es hier ein Volk, schon lange vergessen, dessen Kulte plötzlich wieder aufleben... Das Szenario eines möglichen Vulkanausbruchs auf La Palma. Harald Braems fantastischer Roman lässt Gegenwart und Vergangenheit zu einer eigenen Wirklichkeit verschmelzen und wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf die Probleme unserer Zeit. Verfilmt als "Der Feuerläuer".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald Braem
Der Vulkanteufel
Kanaren-Thriller
DAS BUCH: Urlaub machen, Arbeit und Alltag vergessen, das wollte der junge Bibliothekar Frank Richter auf der Kanareninsel La Palma. Doch dann ereignen sich rätselhafte Unfälle und Selbstmorde, Touristen verschwinden spurlos... Handelt es sich um mysteriöse Ritualmorde? Menschenopfer im Schatten des großen Vulkans? Frank Richter und seine Freunde gehen der Sache auf den Grund: Einst gab es hier ein Volk, schon lange vergessen, dessen Kulte plötzlich wieder aufleben... – Das Szenario eines möglichen Vulkanausbruchs auf La Palma. Harald Braems fantastischer Roman lässt Gegenwart und Vergangenheit zu einer eigenen Wirklichkeit verschmelzen und wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf die Probleme unserer Zeit. Verfilmt als »Der Feuerläuer«.
DER AUTOR: Harald Braem (Berlin, 1944), emerit. Professor für Design und Kommunikation in Wiesbaden, war bis 2013 Direktor des Kult-Ur-Instituts für interdisziplinäre Kulturforschung. Er ist Autor zahlreicher Bücher und langjähriger Kanarenkenner und verfasste Romane, Erzählungen, Sach- und Kinderbücher sowie Filmbeiträge. Im Zech Verlag sind außerdem von Braem erschienen: Tanausú, König der Guanchen, Auf den Spuren der Ureinwohner, Tod im Barranco und Der Kojote im Vulkan. Weitere Informationen: www.haraldbraem.de
Impressum
Textgrundlage dieses E-Books Der Vulkanteufel ist die mit dem gleichnamigen Titel im Zech Verlag (Teneriffa 2010) erschienene Taschenbuchauflage, erstmals veröffentlicht im E-Pub-Format im November 2014.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, öffentlichen Vortrag, Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen, z.B. über das Internet.
Alle Rechte vorbehalten. © 2014 ZECH VERLAG
Verena Zech, 38390 Santa Úrsula (Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien)
Tel./Fax: (34) 922-302596 · E-Mail: [email protected]
Text: Harald Braem
Covergestaltung: Claudia Neeb
Konvertierung: Zech Verlag
E-Book ISBN 978-84-941501-5-9 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-84-934857-2-6
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Webseite:
www.editorial-zech.es/de/
Prolog
In jenen Tagen vor langer Zeit, als die Erde jung war und der Geist der Berge noch zu den Menschen sprach, wanderte Tamogante, die wie alle Heilfrauen das zweite Gesicht besaß, mit ihrem Stamm zum heiligen Ort. Nicht zurückschreckend vor schwierigen Wegen, zogen sie unter Gesängen zum Fuß der Weltensäule. Wo sich die Läufe der beiden Wasser schieden, trennte sich auch der Stamm. Die Männer gingen mit den Opfertieren hinauf zum Steinkreis, um jene auszuwählen, die das Blut, die Milch und das Gekröse dem großen Geist überbringen durften. Ihr Denken war Feuer. Die Frauen zogen unter Tamogantes Führung weiter zur Quelle, um die Höhle der Erdmutter mit magischen Bildern und Zeichen zu schmücken. Ihr Denken war Wasser. Als die Männer das Opferfeuer entzündeten, fuhr Wind in den Rauch und blies ihn zu den grollenden Bergen hinüber, stimmte sie freundlich und schenkte der Erde Ruhe. Als die Frauen die Quelle erreichten, ihre Gesichter wuschen und Tamogante eine Handvoll von jenen getrockneten schwarzen Beeren aß, die Tagträume bescheren, fiel Regen aus dem Wind und reinigte den Himmel. In die Höhle kroch Tamogante, legte sich auf den Rücken und betrachtete die Bilder an der Decke. Dabei sang sie leise, denn alle Bilder und Zeichen waren Musik – hier lag das ganze Wissen der Menschen, der Ahnen und Ahnesahnen, und die Frauen des Stammes folgten ihr und vernahmen es durch Tamogantes Mund.
Nachdem Tamogante verstummt war, lauschte sie lange noch nach in den Wind, in den Regen, in das Innere der Erde hinein, ob von dort Antwort käme, weitere Erinnerung, eine Ergänzung zu ihrem Gesang. Aber ringsum blieb es still, der Wind säuselte nur noch, legte sich schlafen, das Trommeln des Regens ließ nach, das Wasser des Himmels versiegte, die Bewegungen der Erde verebbten zur Ruhe.
Nun spürte Tamogante die Wirkung der schwarzen Beeren. Ihr Körper besaß kein Gewicht mehr, sie fühlte sich aufgehoben und leicht wie eine Feder durch die Unendlichkeit von Zeit und Raum getragen. Nicht nur die bereits gemalten Bilder und Zeichen an der Höhlendecke sah sie, sondern auch eine Vielfalt an Rissen und Spalten, Buckeln und Vertiefungen im Fels, die noch darauf warteten, mit scharfem Obsidian nachgezogen, mit roter Farbe ausgeschmückt zu werden. Vor allem eine Stelle im Zentrum der Decke, von der kraftvolle Energie auszuströmen schien: eine sich aufwickelnde, große Spirale.
Tamogante nahm die schwarze Obsidianklinge und führte sie mit beiden Händen auf jenen Punkt an der Decke zu. Je näher sie ihm kam, desto starker begann ihr Körper zu zittern. Mit ungeheurer Anstrengung zwang sie sich aus dem Liegen heraus nach oben, bis die Spitze der Klinge endlich den Fels berührte. Es war, als habe sie den Mittelpunkt der Erde erreicht, als fließe brennend heißes Feuer in ihren armen Körper hinein. Aber die kreisförmige Bewegung der Klinge geriet nun von selbst. Der Traumspur im Felsen folgend, schnitt Tamogante Stück für Stück die große Spirale. Dabei konnte jede der Frauen, die schweigend, mit vor Neugier geweiteten Augen, der Entstehung des Werkes beiwohnten, das gleiche wie Tamogante erkennen. Auch sie hatten vom Sud der schwarzen Beeren getrunken, auch sie sahen die Zeichen neben der Bahn der Spirale und verstanden mit einem Schlag ihren Sinn. Sie unterdrückten ihren Atem und keuchten vor Erregung. Äußerlich steif wie ein Stück totes Holz, in ihrem Innern jedoch angefüllt mit flüssigem Feuer, mit flatterndem, hechelndem Glutatem, zog Tamogante die Bahn der großen Spirale durch Zeit und Raum. Möge sie niemals enden, beteten die Frauen lautlos wispernd, möge sie niemals enden, von ihr hängt nun alles ab, mach langsam, Tamogante, lass dir Zeit, schenk uns und unseren Nachkommen die Zeit, solange du die große Spirale schneidest, schenkst du unserer Welt das Leben...
Kalter Schweiß brach ihr nun aus, sie konnte das Zittern ihres Körpers kaum noch unter Kontrolle halten, noch weniger aber die furchtbare Last ihres Wissens ertragen. Weit streckte sie die Hände mit der Obsidianklinge aus, um noch in den entferntesten Winkel der Decke hineinzufahren, vielleicht einen Fortgang dort, die unendliche Linie zu finden, das ewige Leben, eine Form, eine Zeit, die niemals endet...
Aber dann, am letzten Zeichen, einem deutlich im Fels erkennbaren, strahlenden Stern, brach die Linie abrupt ab. Gellend schrie Tamogante auf, sie ließ die Klinge fallen und stürzte, jeglicher Kraft nun beraubt, rücklings zu Boden. Ihr Kopf schlug auf den harten Grund, Blut sickerte aus einem Ohr, und ihr Bewusstsein raste in tiefe Dunkelheit. Noch lauter, von Grausen gepackt, heulten die Frauen auf. Mit beiden Händen rissen sie sich die Haare aus, schlugen mit Knien und Stirnen zu Boden, verbargen ihre Gesichter, schützten mit den Armen die Augen, um das Entsetzliche nicht sehen zu müssen... Aber das schreckliche Wissen blieb in ihren Köpfen und Seelen. Von nun an nahm das Schicksal unaufhaltsam seinen Lauf...
1 Grüne Insel
Schemenhaft schleichen Gestalten an bröckligen Terrasenmauern entlang, die ausgetretenen Stufen des alten Weges hinauf in die Berge. Das trockene Rascheln von Bananenblättern überdeckt ihre Schritte. Ein Nachtvogel schreit, es klingt, als weine ein Kind im Schlaf. Warm ist der Atem der Nacht. Riesige Kakteen recken die Arme. Wolken vor der fahlen Scheibe des Mondes, der nur für kurze Augenblicke aus dem Dunkel des Himmels grinst. Oben am Steilhang der Schlucht, aus der launisch der Wind springt, ragt der Stein, der Seelenstein mit dem gravierten Muster. Ein tätowiertes Gesicht, verwittert, aus uralten Zeiten. Menschen davor sitzen im Kreis, doch ohne ein Feuer. Diese Nacht verträgt keinen Lichtschein. Schweigen bei jeder Bewegung. Sie wissen auch so, was zu tun ist. Tastende Hände, ein Messer. Den Stein darf niemand berühren. Kiefernzweige werden zu Stangen geschnitzt. Nacheinander treten die Gestalten an den Rand der Schlucht, schleudern ihre Speere in schwarze Unendlichkeit. Vielleicht treffen sie, wenn es gutgeht, das Unbenennbare... Jetzt zerrt jemand die Ziege am Strick herbei. In Vorahnung des Kommenden meckert sie schrill auf. Warum heute, warum ausgerechnet in dieser Nacht?
Grobe Hände. Das Messer. Es fährt seitlich in den Hals des Tieres, vollzieht eine Kurve quer durch die Kehle. Noch bevor das Opfertier in die Knie bricht, wird der Körper herumgeworfen. Eine Schale fängt das warme Blut auf. Nacheinander tauchen alle ihre Hände hinein. Die Gravur im Stein wird bestrichen, das Muster nach langer Zeit wieder aufgefrischt. Gierig trinkt der Stein. Er braucht Blut. Einer der Männer schleift den leblosen Körper der Ziege zum Abhang und stößt ihn in die Schlucht. Mit angehaltenem Atem lauschen seine Begleiter. Nichts, nur nachpolterndes Geröll. Es ist, als hielte der Wind einen Moment lang inne. Dann fährt er aufs Neue heulend auf, rüttelt im Haar. Er ist warm, warm wie das Blut. Und ein paar Fetzen Musik trägt er heran, die er unten im Hafen von Tazacorte eingefangen hat, wo eine Schar ausländischer Touristen im Restaurant Playamont zecht. Dann wieder Stille.
»Vamos«, sagt einer der Männer endlich. Seine Stimme klingt rauh, er muss sich freiräuspern. Die anderen nicken. Stumm gehen sie auseinander, und der Wind trocknet den roten Stein...
Der Bibliothekar Frank Richter träumte im Himmel. Etwa 10.000 Meter über dem Atlantik lagerte er – mit geöffnetem Hemdkragen und vom zweiten Becher Cola mit Rum angenehm entkrampft – im Polster des Flugzeugs und ließ mit seltsam leichtfallender Selbstironie sein bisher reichlich verpfuschtes Leben Revue passieren.
Mit knapp 36 Jahren bereits eine gescheiterte Ehe, ein Kind, das er nur selten zu sehen bekam und das ihm daher zunehmend entfremdet wurde, und eine Geliebte, mit der es auch nicht so recht klappte. Jedenfalls stritten sie sich dauernd, selbst über Kleinigkeiten. Was hatte sie ihm nach dem letzten Krach (und der anschließenden halbherzigen Versöhnung) an den Kopf geworfen? »Irgendwie tickt es bei dir nicht richtig. Kein Wunder bei deinem Job. Wenn ich mich jeden Tag hinter Bücherbergen verkriechen würde wie du, wär’ ich auch verhaltensgestört. Du bist reif für die Insel, mein Lieber, und das mein’ ich mit vollem Ernst. Besser, wir gehen erst mal ein bisschen auf Abstand, bis du wieder klar im Kopf bist.« Peng. So war Ute.
Dabei lag sie mit dem, was sie von seinem Job hielt, eigentlich gar nicht so falsch. War schon frustrierend, von morgens bis abends in der Hochschulbibliothek zu hocken, für die Kontrolle der Ausleihzeiten zuständig zu sein und für den Ersatz von geklauten Büchern. Verdunstungsquote. Wo doch der Etat sowieso gekürzt worden war und das Damoklesschwert weiterer Kürzungen über einem schwebte. Ständig Anträge, Papierkram. Da blieb wenig Zeit für die interessanten Dinge, frustrierend wenig, zumal insgeheim das Wunschbild eines Universalgenies in ihm schlummerte. Doch wie war’s wirklich? Ein paar angefangene Manuskripte, zerfranste, konzeptionslose Computer-Dateien...
Der einzige Lichtblick: Erich, dessen selbstsicherer Blick ständig den Eindruck vermittelte, als amüsiere er sich. Mit ihm konnte Frank niveauvolle Diskussionen führen. »Das mit der Insel erscheint mir gar nicht so dumm«, hatte Erich gesagt. »Du solltest die Kanaren wählen. Am besten La Palma, die kleine grüne Insel im äußersten Westen. Da ist die Welt noch in Ordnung. Kein Massentourismus, sauberes Meer, schmackhafter Fisch, Wahnsinnslandschaft. Und kulturell gesehen Neuland für Forscherseelen. Hast du mal was über die Guanchen gehört? Weiße Steinzeitmenschen im Atlantik. Haben Pyramiden gebaut und ihre Toten mumifiziert wie die alten Ägypter. Jedenfalls bis die Spanier kamen im Kolumbusjahr 1492. Sehr geheimnisvoll. Auch ihre Felsbilder und die Schrift, die übrigens bis heute nicht entschlüsselt wurde. Und Bananen, Palmen, Vulkane, schöne Mädchen. Ich war zweimal da und kann dir nur zuraten. Ja, La Palma ist gut, la isla bonita. An deiner Stelle würde ich dort mal ausgiebig Urlaub machen.«
Also das billigste Flugticket. »Um die Unterkunft brauchst du dir keine Sorgen zu machen«, hatte Erich gesagt. Kenne einen Kollegen dort: Jürgen Brinkmann aus Frankfurt. War früher mal Buchhändler und lebt jetzt in El Paso.«
»Als Buchhändler?«
»Nein, mehr freischwebend als Gelegenheitsjournalist, Fremdenführer und Übersetzer. Mit seiner Frau Susanne, die ein bisschen Geld mitgebracht hat und eine kleine Boutique in Los Llanos besitzt. Nette Leute, hilfsbereit und mit der deutschen Kolonie dort bestens bekannt. Wenn du willst, kann ich denen ja mal schreiben und ankündigen, dass ein völlig fertiger Freund von mir kommt.«
»Besten Dank. Wenn ich alles zusammenkratze, hätte ich tatsächlich vier Wochen.«
»Solltest du, solltest du unbedingt«, hatte Erich gebrummt und Frank einen Schlag auf die Schulter versetzt. »Nimm’s als Herausforderung, als Abenteuer, als Chance. Eine Insel mit so viel natürlicher vulkanischer Radioaktivität und Jodgehalt in der Luft hat schon so manches verkorkste Leben verändert! Vor allem, wo du ganz gut Spanisch sprichst.«
Und so saß er nun mit leichtem Gepäck im Flieger, kribbelig wie ein kleiner Junge auf Schulausflug, und fühlte plötzlich eine Mischung aus großer Müdigkeit und schöner Aufregung auf sich zukommen. Ein Gefühl im Magen verriet, dass die Maschine zum Anflug ansetzte, noch bevor die entsprechende Durchsage kam. Er beugte sich vor, um am Nachbarn vorbei seitlich aus dem Fenster zu blicken. Da sah er das grenzenlos blaugrau glitzernde Meer (ein Anblick, den er sonst aus unterdrückter Flugangst tunlichst vermied) und darin ganz klein die Insel, die nun beständig größer wurde. Wirklich eine grüne Insel, über und über bewaldet mit ziemlich eindrucksvoll hohen Bergen und ein paar vereinzelten weißen Wolken um die Spitzen herum.
Ute hat recht, dachte er. Jetzt tausche ich die Bücherberge gegen tatsächliche ein. Die Wirklichkeit ist grün, und wer ahnt schon, was da unter der Oberfläche des Urwaldteppichs alles steckt...
Er klinkte die Sicherheitsgurte ein, ließ sich ins Polster zurückfallen und schloss die Augen. Die Landepiste direkt am Rand der Felsküste wollte er nicht sehen. Die waren meist beängstigend kurz und unnötig strapazierend für schwache Nerven.
»Was soll das nun wieder bedeuten?« fragte sich Henning Schneider verunsichert. Heute morgen war er die schmale, kurvenreiche Straße vom Hafen nach Tazacorte hochgefahren wie immer, um Brot, Fruchtsäfte und ein paar andere Kleinigkeiten zu holen. Da hatte er an der Steinmauer der Bananenplantage die frisch mit weißer Farbe gemalten Worte gelesen: Extranjeros fuera, und das hatte ihn sonderbar getroffen. »Fremde raus!«
Henning führte seit fünf Jahren die kleine Ferienpension unten am Hafen, er sprach fließend Spanisch und sah auch fast wie ein Einheimischer aus: braungebrannt, schwarze, nach hinten gekämmte Haare, schmaler, gepflegter Oberlippenhart. Ursprünglich hatte er mal Ethnologie studiert, mit Schwerpunkt Südamerika, war aber nach dem Abbruch seiner Studien auf La Palma hängengeblieben. »Schließlich dienten die Kanaren Kolumbus und den nachfolgenden Konquistadoren als Sprungbrett zur Eroberung der Neuen Welt, und es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen hier, Venezuela und anderen Ländern dort drüben«, pflegte er gelegentlich zu äußern, wobei er mit einer vagen Geste über das Meer nach Westen hin deutete. »Die Kultur der Guanchen, die Sprache, die Samba, die Feste...«
Im Laufe der Zeit hatte Henning Schneider die Fähigkeit entwickelt, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Pension lief recht gut, zumal immer mehr Individualtouristen die Insel für sich entdeckten. Die Zimmer waren billig, leicht desolat, wenn auch sauber – zumindest, seitdem Maria Guadalupe regelmäßig putzte, und genau das reizte Lehrerehepaare und andere abenteuerlich gestimmte Intellektuelle, gerade bei ihm in den Ferien zu wohnen. Werbung brauchte er nicht, sein Name hatte sich herumgesprochen. An manchen Abenden entwickelten sich sogar recht aufregende Gespräche über Gott und die Welt in seinem zum Aufenthaltsraum umgerüsteten Wohnzimmer.
»Extranjeros fuera... Verstehst du, was das bedeuten soll?« fragte er am Markt den alten, blinden Juan, der zwar nie etwas sah, aber dennoch alles wusste. »Fremde raus. Sind damit die Touristen gemeint? Stammt das von einer neuen kanarischen Separatistenbewegung? Irgendwie unlogisch, das dann auf spanisch zu schreiben. Deutsch wäre viel angebrachter gewesen, dann würden’s die Urlauber wenigstens lesen können. Oder soll sich die Botschaft an Spanier richten? Sind ja auf gewisse Weise, wenn man’s richtig bedenkt, auch fremde Besatzer hier auf der Insel. Oder sind wir Zugezogenen gemeint, weil wir angeblich den Einheimischen das Geschäft aus der Hand nehmen, oder was? Sag mir, Juan, wie du die Sache verstehst.«
Der alte Juan sog weiter an seinem zerfransten Zigarettenstummel und zuckte die Achseln. »Chicos«, brummte er gleichmütig, »irgendwelche Jungs, die sich wichtig machen wollen.«
»Aber verdammt provozierend, findest du nicht?« bohrte Henning weiter. »Und wenn es doch ernst gemeint ist und mehr dahinterstecken sollte?«
»Loco, totaler Blödsinn«, grunzte der alte Juan mit heiserer Stimme. Er hustete sich erst mal ausgiebig frei und spuckte auf die abgetretenen Fliesen der Plaza. »Alles Blödsinn, hombre. Willst du nicht doch ein Los von mir kaufen?«
»Na gut, gib schon her, vielleicht komm’ ich so doch noch mal zu einem neuen Auto. Die alte Karre macht es nicht mehr lange«, sagte Henning und beschloss, die irritierende Wandparole einfach zu vergessen.
Nachher, als er am Hafen vorbeifuhr und dort einen frischen Schwung erstaunlich weißer, vor Sonnenöl glänzender Neuankömmlinge auf den Metallstühlen vorm Kon-Tiki herumlümmeln sah, musste er aber erneut an den separatistischen Slogan denken. Bueno, ein ziemlicher Haufen diesmal. Die Haut wie schmelzender Camembert, aber die Taschen voll Geld. Ist es nicht genau das, was wir hier brauchen, was soll daran schlecht sein? Extranjeros fuera... So ein Quatsch! Sind doch eine Goldader, diese Touristen, und jeder von uns, vom Kind bis zum Opa, versucht nach besten Kräften davon zu schürfen.
Er winkte aus dem offenen Seitenfenster heraus einer Frau mit zwei Fischeimern zu, und die grinste anzüglich zurück.
Der Leutnant von Santa Cruz stieß eine Kaskade von Flüchen und Verwünschungen aus, als er die Meldung hörte. »Was soll das heißen: Schon wieder ein Ausländer verunglückt?« schrie er. »Können die denn nicht zu Hause sterben? Kommen hierher, trauen sich bei uns die tollsten Bergtouren zu und fallen dann einfach in eine Schlucht. Und was euch und die Bergwacht, diese verdammte Icona, betrifft, könnt ihr nicht besser aufpassen, dass so was in Zukunft nicht mehr passiert?« Sein Gesicht war blutrot angelaufen, und seine Stimme wurde immer lauter. »Wir sind eine perfekte Urlaubsinsel, ein Paradies, verdammt noch mal! Wisst ihr, was das für uns alle bedeutet, wenn im Diario de Avisos bald schon wieder eine solche Meldung auf der ersten Seite steht, womöglich reißerisch mit irgendwelchen fantastischen Mutmaßungen ausgeschmückt wie das letzte Mal? Caramba, die warten doch nur darauf, uns in die Suppe zu spucken!«
Die beiden Gendarmen standen schwitzend in der Tür, senkten verlegen die Blicke und hofften, dass der Zorn ihres Vorgesetzten endlich verrauchen würde. »Es war ein Österreicher, der schon lange auf der Insel wohnte. Besitzt ein Haus in Celtas. Kein millonario, aber wohlhabend. Netter Kerl, wie die Nachbarn von ihm sagen.«
»Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Also weiter!« Der Leutnant sprang hinter seinem Schreibtisch auf, ging ein paar energische Schritte durchs Zimmer und blieb schließlich vorm Fenster stehen, um mit einem Finger die Lamellen des Sonnenvorhangs auseinanderzubiegen und hinab auf die Straße zu spähen. Es war Siesta, unten bewegte sich nichts. Gähnende Mittagshitze, und die Häuser warfen nur kurze Schatten.
»Nun ja«, setzte der zweite Gendarm den Bericht seines Kameraden fort, »also, er hat wohl einen Ausflug zur Caldera gemacht. Oben am Parkplatz stand sein Wagen. Die Icona hat uns per Sprechfunk verständigt, weil er die Nacht über dort parkte. Der Mann muss auf eigene Faust über den verbotenen Weg abgestiegen sein. Dort ist er dann abgestürzt, vermutlich in der Abenddämmerung. Mehr wissen wir im Augenblick noch nicht. Der Mann ist erst heute morgen gefunden worden.«
»Dann sucht gefälligst weiter und klärt die Sache.«
Stille. Die beiden Gendarmen warteten.
Ohne seinen Blick von der Straße zu lösen, sprach der Leutnant nach einer Weile, die ihnen wie eine Ewigkeit vorkam: »Bueno, nehmen wir’s so, wie es nun mal ist. Sauber und gründlich ermitteln, wenn ich bitten darf, meine Herren. Und kein Wort gegenüber der Presse. Es war schließlich bloß ein Unfall.«
»Sí, Señor«, antworteten die Gendarmen wie aus einem Mund und verließen mit der Andeutung eines Salutierens das Büro.
»Sie sind Herr Brinkmann?«
»Der bin ich. Herzlich willkommen auf der Insel des ewigen Frühlings!« rief Jürgen zur Begrüßung vorm Flughafen, wo er wie verabredet gewartet hatte. Lässig lehnte er an seinem Allrad-Suzuki, ein großer Mann, fast schon ein Hüne, mit jugendlich verschmitztem Gesicht, in dem nur einige Falten etwas von seinem wahren Alter verrieten. Konnte aber auch das Resultat überhöhten Alkohol- und Tabakkonsums sein. Jedenfalls strahlte er offen und sympathisch unter seinem weißen Panamahut hervor.
»Frühling ist wohl leicht untertrieben«, sagte Frank Richter, »mir kommt es eher wie Hochsommer vor. Jedenfalls brennt die Sonne recht kräftig.«
»Alles Gewöhnungssache. Allerdings weht heute kein Wind, da kommt es einem wärmer vor, als es wohl ist. Wie geht es in Deutschland?«
So kann nur einer reden, der schon lange hier wohnt, dachte Frank Richter. Was soll man auf so eine Floskel erwidern? »Ach ja, schöne Grüße von Erich soll ich bestellen. Am liebsten wäre er mitgekommen, so hat er geschwärmt«, sagte er, während Jürgen sein Gepäck auf den Rücksitz hievte.
»Der gute Erich.« Jürgen lachte. Er schwang sich mit einem eleganten Sprung hinters Steuer und fügte mit gewinnendem Lächeln hinzu: »Wir Bücherwürmer müssen eben zusammenhalten.«
Geschickt steuerte er den Wagen durchs Gewühl des Flughafenparkplatzes und hieb krachend die Gänge rein, als sie eine breite, kürzlich erst ausgebaute Straße parallel zur Küste erreichten. Der Fahrtwind tat gut, überhaupt das Fahren im offenen Jeep. Rechts und links Palmen und Sträucher mit betörend roten, gelben und brennend violetten Blüten. Der Himmel war so wolkenlos klar, das Licht so grell, dass Frank Richter die Augen zusammenkneifen und blinzeln musste. Das Meer, die Häuser, die Vulkanberge... so hatte er sich die Insel in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt.
Unterwegs plauderte sein Begleiter pausenlos: »Ja, Susanne und ich haben Erich einen Brief geschrieben. Ist wohl nicht mehr rechtzeitig angekommen. Die Post ist oft zwei, drei Wochen oder länger unterwegs, reine Glückssache, wenn was ankommt. Aber macht nichts, jetzt sind Sie ja da. Also, wie gesagt, wir hatten Ihrem Kollegen Erich eigentlich abgesagt.
Unser kleines, bescheidenes Haus ist nämlich voll bis oben hin, sogar der ausgebaute Schuppen im Garten. Susanne findet das auch traurig, zumal Sie Bibliothekar sind wie Erich, aber was soll man machen? Ist alles kein Beinbruch, wir finden schon eine passende Unterkunft für Sie. Vier Wochen, schöne Zeit, aber viel zu kurz für die Insel, jedenfalls besser als gar nichts. Also, da gibt es drüben auf der anderen Seite der Insel, im Westen, wo auch wir leben, eine kleine Pension. Direkt am Hafen von Tazacorte. Ein Freund von uns, Henning Schneider, ebenfalls Deutscher, führt sie. Mal sehen, ob sich da was arrangieren lässt. Jedenfalls meinten Susanne und ich: Wir können den Mann doch nicht am Flughafen stehenlassen, so oder so holen wir ihn erst mal ab. Sie wären ja sonst völlig verloren in dieser Wildnis. Sprechen Sie Spanisch?«
»Etwas«, sagte Frank Richter. Er hielt sich krampfhaft am Türrahmen fest, denn sie rasten nun holpernd eine mit Schlaglöchern übersäte Straße entlang, die sich in unzähligen Kurven höher und höher in die Berge schraubte. »Es ist wahnsinnig nett von Ihnen, sich so um mich zu bemühen. Eine Hafenpension... Eigentlich ist mir jede Unterkunft recht. Am liebsten allerdings – wenn ich mal frei spinnen darf – wäre mir ein winzig kleines Haus in den Bergen, weitab von allem, wo ich Gelegenheit bekomme, endlich mal richtig Ruhe zu finden. Sie verstehen, was ich meine?«
»Aber claro«, lachte Jürgen verständnisvoll, »kleines Haus in den Bergen? Auch gut. Kontemplation, Selbstfindung... Ja, da habe ich, glaube ich, eine Lösung. Achtung, jetzt wird es feucht.«
Sie hatten inzwischen den höchsten Punkt der grünen Bergkette erreicht und fuhren nun in einen Tunnel. Von einer Sekunde zur anderen wurde es dunkel und kalt. Im Licht der Scheinwerferkegel sah man Wasser von der gewölbten Tunneldecke tropfen und spürte die sprühende Nässe unangenehm auf der Haut.
»Das ist die Wetterscheide«, schrie Jürgen gegen das Dröhnen des Motors an, »drüben liegt die ärmere, die ländliche Seite der Insel, wir sagen: der freie Westen.« Er kommentierte auch weiterhin die Umgebung, als sie nach einer erstaunlich langen Tunnelstrecke erneut in die Sonne fuhren.
Los Llanos de Aridane. Die kleine Provinzstadt wirkte geschäftig und typisch spanisch: staubig und scheinbar ständig im Umbau, weiße, herausgeputzte Häuser neben schäbigen Baracken, eine Bar neben der anderen und davor die obligatorischen Gruppen kaffeetrinkender Männer.
Dieser Eindruck änderte sich aber schlagartig, als sie kurz hinter dem Vorort Argual abbogen und einer Straße folgten, die sich vorbei an Bananenplantagen in halsbrecherischen Serpentinen zur Schlucht hinabwand. Es verschlug einem wirklich den Atem. Nach jeder Kurve öffnete sich ein neuer, ungeahnter Einblick in die gewaltige Schlucht, und das bizarre Relief der Berge ringsum wuchs mit seinen kantigen Rucken in den Himmel hinein.
»Das ist der Barranco de las Angustias, die Schlucht der Todesängste«, sagte Jürgen. »Der Name passt, finden Sie nicht? Es ist der größte Barranco auf La Palma und quasi der einzige Zugang in die Caldera de Taburiente. Wissen Sie, was das ist? Ein riesiger Kraterkessel im Innern der Insel, zehn Kilometer Durchmesser, Urwald und Nationalpark. Da haben sich damals, als die Spanier kamen, die letzten Guanchen hineingeflüchtet und waren faktisch unangreifbar. Die Schlucht muss, als es noch keine Straße gab, wesentlich schlimmer gewesen sein. Kein Wunder, dass die Spanier hier Todesängste verspürt haben.«
Er riss das Steuer herum, um einem plötzlich auftauchenden streunenden Hund auszuweichen. Die Kurven waren eng und unübersichtlich. »Da«, sagte er und deutete mit dem Daumen auf eine ausgebrochene Stelle im Straßengeländer, »an dieser Stelle ist neulich ein Österreicher geradeaus gefahren.«
Frank Richter riskierte einen flüchtigen Blick die steile Böschung hinab und schauderte. Auf halber Höhe des Hangs lag noch immer das Autowrack.
Jürgen plauderte munter weiter, als seien solche Vorkommnisse die selbstverständlichste Sache der Welt. »Die Einheimischen fahren manchmal absichtlich durchs Geländer. Ist neben Gift die verbreitetste Art, Selbstmord zu machen. Und hinterher sieht’s immer wie ein Unfall aus. Haben ‘ne komische Art, die Eingeborenen hier, ‘ne seltsame Einstellung zum Tod und zum Leben wohl auch. He, beunruhigt Sie mein Gerede? Schwache Nerven?«
Frank Richter schüttelte den Kopf. »Was für Gift denn?« fragte er matt.
»Nemacur. Pflanzenschutzmittel, ziemlich hochkarätig. Das spritzen sie wie bekloppt in die Bananenplantagen. Alles Monokultur. Das Zeugs gibt’s frei im Handel. Überhaupt stehen hier Sachen in den Läden rum, da fasst man sich bloß noch an den Kopf. Was woanders längst verboten ist, kann auf La Palma jedes Schulkind einkaufen.«
Sie hatten nun die tiefste Stelle der Schlucht erreicht. Zur Linken lag abseits und völlig unerwartet eine schmucke, weißbraun gesprenkelte Kirche. Sie überquerten den eigentlichen Wasserlauf der Schlucht, ein geröllhaltiges, ausgetrocknetes Flussbett, und stießen nach der Brücke auf eine Weggabelung. Links ging es zum Meer, zum Hafen von Tazacorte, rechts begann die Straße erneut atemberaubend anzusteigen. In der Mitte aber, dicht neben der Kirche ragte ein Schild auf mit der lakonischen Aufschrift »Angustias« – die Todesängste.
»Die Fahrerei durch die Schlucht hält die meisten Ausländer davon ab, jenseits des Time zu siedeln«, setzte Jürgen seinen Bericht fort, »die werden alle lieber im Aridane-Tal sesshaft, so um El Paso, Las Manchas und Celtas herum, wenn nicht gleich an der Ostseite. Ist bequemer. Dabei gibt es oben« – er deutete vage die Steilwand hinauf – »genügend Land und preiswerte Häuser. Aber so richtig wird da oben wohl nie etwas laufen. Der Barranco stellt so etwas wie eine magische Grenze dar. Er schreckt die meisten Leute ab.«
Frank Richter, bereits die ersten Anzeichen eines leichten Sonnenbrandes auf seiner Stirn spürend, empfand den Fahrtwind nun durchaus als angenehm.
»Hey, Victor!« brüllte Jürgen und winkte einem Radfahrer zu, der unter kolossalen Anstrengungen bergauf strampelte. Der hob flüchtig den Kopf und winkte zurück.
»Auch ein Europaflüchtling«, sagte Jürgen. »Belgier, glaube ich. Zuckerkrank ist der. Muss sich jeden Tag eine Spritze verpassen. Aber trainiert eisern: täglich bis zum Time hoch, oben bis zur Bananenpackerei in La Punta und dann zurück.«
Frank Richter vernahm Hundegekläff und drehte den Kopf zurück. Da sah er den Belgier kräftig in die Pedalen steigen und zwischendurch nach hinten gezielte Fußtritte austeilen, denn zwei hässlich dünne, braune Hunde waren aus dem Nichts aufgetaucht und verfolgten ihn.
»Das sind seine speziellen Freunde, die kommen immer an dieser Stelle, scheinen auf ihn zu warten. Canarios, scheußliche Köter. Von denen sollen die Inseln übrigens ihren Namen haben. Verdammter Mist, was ist denn das?« Jürgen stieg so heftig auf die Bremse, dass die Reifen kreischten und sie beide nach vorn flogen.
Vor ihnen auf der Straße lag ein regloser Körper, offenbar eine tote Ziege. Der Kadaver sah furchtbar entstellt aus. Der Hals war durchschnitten, der Kopf mit den Hörnern unnatürlich zur Seite verrenkt. Das Tier lag, die Beine nach oben, auf dem Rücken. Sein Bauch war aufgequollen, und ein Schwarm ekelig summender, blauschwarzer Fliegen umschwirrte den zerschundenen Körper. Weit aufgerissene gelbe Augen starrten Frank Richter an, der vor Ekel würgen musste.
Sie stiegen aus. Eine Gruppe von Einheimischen stand um die Ziege herum, einige sonnengebräunte Männer in dreckiger Kleidung, ein paar ältere Frauen und Kinder. Ein kleiner Junge in Jeans und viel zu großem, zerrissenem Hemd traktierte den Kadaver mit Fußtritten, bis jemand das Kind wegzog. Ein Mann fluchte und brüllte und versuchte, so das Stimmengewirr ringsum zu übertönen.
»Caramba«, verstand Frank Richter, »und ich sage euch: Don Vicente hat die Fiesta ausgerufen und den genauen Zeitpunkt bestimmt. Es ist alles klar, die Fiesta findet statt!«
Eine Frau kreischte schrill auf und schlug ihre Hände über dem Kopf zusammen, danach bekreuzigte sie sich mehrfach. »Madre mía«, jammerte sie, immer wieder: »Madre mía, madre mía!«
Ein anderer Mann lachte dröhnend: »Sí, sí, die Fiesta, die Fiesta des Teufels, und der Teufel hat eine Ziege geschickt... Es wird eine große, eine gute Fiesta, das sage ich euch. Wenn nicht, dann soll mich ruhig der Teufel holen!«
Wieder kreischte die Frau, und einige der Umstehenden stimmten in ihren Jammergesang ein. Der Ausdruck ihrer Gesichter wirkte fanatisch, wenn nicht gar irr.
»Was ist hier los, was soll das alles bedeuten?« fragte Frank Richter.
Jürgen Brinkmann zuckte die Achseln. »Ach, es geht wieder mal um irgendeine Fiesta, wahrscheinlich um das Teufelsfest von Tijarafe.«
»Und warum veranstalten die Leute so ein Theater darum?«
»Die Leute sind ein bisschen aufgeregt«, sagte Jürgen Brinkmann. »Das Teufelsfest ist eine große Fiesta, ein ganz besonderes Fest. Das bringt sie aus dem Häuschen.«
»Und was soll die Sache mit der Ziege bedeuten?«
Jürgen zuckte erneut mit den Schultern. »Was weiß ich, irgendein Mummenschanz, keine Ahnung... Die Eingeborenen spinnen halt ein bisschen, daran muss man sich hier gewöhnen.«
»Hat jemand die Ziege angefahren?«
»Sieht nicht so aus. Eher, als ob sie jemand von dem Berg da oben runtergeworfen hätte.«
»Aber der Hals ist doch durchgeschnitten.«
»Eben. Ich sagte ja: Die spinnen, die Palmeros. Haben manchmal komische Sitten. Aber eigentlich sind sie ganz harmlos.«
»Na, ich weiß nicht«, murmelte Frank Richter und scheuchte mit hektischer Handbewegung ein paar besonders aufdringliche Fliegen aus seinem Gesicht.
Inzwischen hatte einer der Männer die tote Ziege an den Hinterläufen geschnappt und zur Böschung geschleift.
»Kommen Sie, lassen Sie uns weiterfahren«, sagte Jürgen Brinkmann, »die Straße ist wieder frei.«
Mit einem nachdenklichen Seitenblick auf die noch immer durcheinander brüllenden Leute kletterte Frank Richter zurück in den Jeep.
Nach der letzten Kurve, am höchsten Punkt der Strecke, gab es ein Lokal mit einem Parkplatz davor.
»Das ist der El Time, ein berühmter Aussichtspunkt, ein Mirador«, erklärte Jürgen mit strahlendem Lächeln, als habe er den Vorfall von eben bereits wieder vergessen. »Sollen wir anhalten und einen Blick riskieren? Haut einen einfach um, dieser Anblick. Ein Kaffee wäre jetzt auch nicht schlecht. Und Javier, der Wirt, kann uns bestimmt wegen Ihres Hauses weiterhelfen.«
Frank und Jürgen waren die einzigen Gäste, als sie die halbdunkle Bar betraten. Frank bestellte sich einen Cortado, eine winzige Tasse starken Kaffees, mit Kondensmilch gesüßt. Jürgen trank seinen Kaffee schwarz und nippte einen Cognac dazu.
»Also, ich weiß nicht«, nahm Frank Richter seinen unterbrochenen Gedankengang wieder auf. »Das mit der Ziege eben war wirklich kein schöner Anblick. Ich begreife auch nicht, was das Tier mit der Fiesta zu tun haben soll.«
Jürgen Brinkmann nickte. »Ich hab’s bereits angedeutet: An so was müssen Sie sich hier gewöhnen. Die Kanarischen Inseln gehören zwar offiziell zu Spanien, also zu Europa, aber im Grunde befinden wir uns hier in einer ganz anderen Welt, einer Welt mit eigenen, für uns Europäer manchmal unverständlichen Gesetzen. Ehrlich gesagt, in letzter Zeit sind hier auf der Insel ein paar merkwürdige Dinge passiert. In einer Woche sind gleich zwei Männer, ein Deutscher und ein Österreicher unter mysteriösen Umständen beim Wandern umgekommen, lagen einfach tot im Gebirge. Angeblich Herzversagen, der Diario de Avisos erwähnte allerdings einen möglichen Ritualmord, weil der Deutsche inmitten eines Steinkreises lag. Aber das sollte Sie nicht beunruhigen.«
Frank Richter hörte verwirrt zu. Immer noch verfolgten ihn die Augen der Ziege. »Die Leute machten gar nicht den Eindruck, sich auf das Fest zu freuen, im Gegenteil: Mir kam es vor, als hätten einige von ihnen, besonders die Frauen, regelrecht Angst davor. Kann das sein?«
»Durchaus richtig«, sagte Jürgen Brinkmann. »Das Teufelsfest ist was ganz und gar Merkwürdiges. Wenn es stattfindet und Sie noch da sind, sollten Sie unbedingt hingehen, so was bekommt man nicht alle Tage geboten. Ich habe es selbst noch nicht erlebt, aber eine Menge darüber gehört. Bei Gelegenheit erzähl’ ich Ihnen mal was davon. Noch einen Cortado?«
Frank Richter lehnte dankend ab. Der starre Blick aus den gelben Augen der Ziege ging ihm nicht aus dem Sinn, sowenig wie das seltsame Getue der Leute, besonders der Frau, die so heftig gejammert und sich bekreuzigt hatte. Ein hässlicher, dunkler Fleck war auf sein schönes Inselbild gefallen.
»Javier«, sagte Jürgen zu dem Wirt, der in schläfriger Gemütlichkeit Gläser spülte. »Du weißt doch, das Haus weiter oben, das den Leuten aus Venezuela gehört, kann man das mieten?«
»Frag‘ Jorge«, gab Javier wortkarg zurück.
Jürgen nickte. »Jorge«, sagte er zu Frank, »ist der Wirt von der anderen Bar, unten an der Straße neben der Kirche.«
»Machen Sie sich bitte nicht solche Mühe mit mir«, sagte Frank Richter, »ich habe Ihre kostbare Zeit bereits lange genug in Anspruch genommen. Vielleicht tut es ja auch etwas am Hafen.«
»Wir Bücherwürmer müssen zusammenhalten«, Jürgen zwinkerte zum zweiten Mal an diesem Tag vertraulich. »Außerdem sagt man mir nach, ich sei ein sturer Hund. Was ich einmal begonnen habe, möchte ich auch zu Ende bringen. Großes Guanchen-Ehrenwort: Sie schlafen heute Nacht noch im eigenen Haus!«
Auch gut, also wieder in die Rappelkiste und ein gutes Stück des Weges zurück. Von der Straße aus war die Bar kaum zu erkennen: ein einzelnstehendes Gehöft mit Kaninchenställen unter den Palmwedeln des Patio. Hühner liefen frei herum und scharrten im roten Staub. Die schmale Holztür stand einen Spaltbreit offen. Jürgen zwängte seinen massigen Körper hindurch und verschwand im Halbdunkel. Als Frank folgte, sah er zunächst einmal nichts. Aber angenehm kühl war es hier. Dann begannen sich Einzelheiten aus dem Zwielicht herauszuschälen, ein Tresen mit leeren Flaschen darauf, ein paar Regale im Hintergrund, die meisten davon gähnend leer. Nur weiter unten lagen griffbereit Konserven, Büchsenmilch und Sardinen, Kisten mit etwas Dunklem darin, Avocados, Gurken und Honigmelonen.
Jürgen klopfte mit einem Pesetenstück auf den Tresen und rief in das Dunkel der Hinterzimmer hinein, wo mit voller Lautstarke ein Fernsehgerät lief. Spanische Werbung, viel Blechmusik, sehr schrill, extrem hart und dazu Stimmen, die rasend schnell sprachen. Jürgen steckte sich eine von diesen furchtbar im Hals kratzenden Zigaretten an, hielt Frank Richter die zerbeulte Schachtel hin und lehnte sich wartend über den Tresen. Frank Richter rauchte aus Gesellschaft mit.
Als sie schon nicht mehr damit rechneten, kam aus dem Hintergrund doch noch jemand herangeschlurft: ein Wesen, das man im ersten Moment durchaus für einen überlebensgroßen Schellfisch halten konnte. Dem Mädchen quollen die Augen so sehr aus dem Vollmondgesicht, dass Frank Richter Angst bekam, sie würden jeden Moment auf den Tresen kollern.
»Buenos días, Carmen«, brüllte Jürgen, »qué tal?«
»Bien, y tú? Buenos días, hombre!« brüllte der Schellfisch zurück.
Es handelte sich um die Tochter von Jorge, eine liebenswerte Person, wie sich herausstellen sollte. Jürgen bestellte erstmal einen Cortado und einen Café solo mit Cognac. Gerade als er zu einer längeren Rede ansetzen wollte, kam von außen eine weitere Gestalt durch die Tür geschlüpft. Wieder brüllte Carmen eine lautstarke Begrüßung, und der Neuankömmling ratterte im Tempo einer mit zehn Fingern bearbeiteten Schreibmaschine zurück. Jürgen kannte ihn auch. Er schien wahrhaftig jeden auf der Insel zu kennen. »Chano, Mensch, altes Schlitzohr, fein, dich mal wieder zu treffen, hombre!«
Sie hieben sich gegenseitig intensiv auf die Schultern, als wollten sie durch diese Geste das Kraftfeld ihrer alten Freundschaft wieder aufladen.
Chano war ein Einheimischer, ein dunkler, drahtiger Junge mit schwarzem Wuschelkopf und Oberlippenbart, der ihm etwas Mongolisches ins Gesicht schrieb. Oder eher wirkte er wie ein Amazonasindianer, ein Kopfjäger oder Karaibe. Hatten so etwa die Ureinwohner, die Guanchen, ausgesehen? Nicht unsympathisch, wenn auch ein Quäntchen gefährlich. Seine Bewegungen waren katzenhaft flink, ebenso seine Augen, Der flackernde Blick eines ungezähmten Tieres. Und jetzt merkte Frank, woran ihn der Junge erinnerte. Nein, nicht an eine Katze – eher waren es die Hunde, jene schlanken, hochbeinigen Viecher, die einen mit einem Blick ansahen, der nicht verriet, was sie in der nächsten Sekunde tun würden – angreifen oder weglaufen. Chano besaß den Kopf und den Körperbau eines Hundes. Aber das war nur ein flüchtiger Eindruck. Als Frank Richter kurz weg- und danach erneut hinblickte, sah er einen lachenden, lebhaften Jungen am Tresen, der ebenfalls Café mit Cognac trank und das gleiche Teufelskraut rauchte wie dieser wortgewaltige Brinkmann. Spanisch sprach er und überraschenderweise einigermaßen Deutsch. Ein Typ, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Vorerst ging es aber um das Haus in den Bergen. »Chano, du weißt schon, dieses casa antigua arriba, das alte Haus oben, wo der Señor in Venezuela lebt. Oder war das Kuba?«
»Sí, sí, Venezuela.« Chano wusste sofort Bescheid.
»Meinst du, das ist zu mieten?«
»Sí, sí, claro«, sagte Chano wieder. Er erweckte den Anschein, als habe er nur darauf gewartet, eingreifen und den Fall abwickeln zu dürfen. Nach längerem Palaver mit der glubschäugigen Carmen stellte sich heraus, dass sich ihre Familie im Besitz des Schlüssels befand. Hin und wieder gab man ihn hier.
»Mil Pesetas, tausend Peseten die Woche, ist das bueno?«
Es war gut, erstaunlich billig war das, mindestens soviel kostete ein Hotelzimmer pro Nacht. Aber vorher wollte Frank Richter die ominöse Bruchbude erstmal sehen. Jürgen nickte, und Chano, der auch gerade nichts Besseres zu tun hatte, schloss sich ihnen an.
Zu dritt fuhren sie einen staubigen Feldweg hoch. Frank Richter saß hinten beim Gepäck und der Eingeborene als Fährtensucher vorn auf dem Beifahrersitz. Die Gegend wirkte unbewohnt. Ein paar zerfallene Häuser, Mandelbäume und verwilderte Terrassen und zerbröckelnde Trockenmauern, über denen lautlos Falken kreisten, sonst nichts. Frank Richter atmete auf. Das war die passende Umgebung für ihn.
Als sie das kleine Haus erreichten, er den Schlüssel im Schloss drehen durfte und die knarrende Tür aufstieß, wusste er, dass er angekommen war. »Gut«, sagte er, »absolut das Richtige für einen vom Wohlstand geschädigten Geist.«
Im Innern des Hauses roch es nach harzigem Kiefernholz. Die dicken Natursteinmauern und die Holzdecke machten es kühl. Ein paar Geckos flüchteten träge ins Gebälk. Ein gutes Haus, ein sehr gutes sogar. Und der Blick vom Fenster aus reichte über Feigengesträuch und wiegende Palmen hinunter zum Meer, das sich sanft gewellt und unbeschreibbar blau unter einen noch blaueren Himmel schmiegte.
Drüben liegt Amerika, dachte Frank Richter. Die Neue Welt mit ihren Problemen, und hinter mir irgendwo die Alte Welt. Und ich sitze in einem Haus, dessen Geschichte unter den Dachschindeln schläft.
»Das mit der Bezahlung hat Zeit, das machen wir später«, meinte Jürgen beim Abschied. »Wenn es Ihnen hier oben zu einsam werden sollte, können Sie auch runter nach Tazacorte kommen, in Henning Schneiders Pension.«
»Das mach’ ich bestimmt irgendwann einmal, schon allein deswegen, weil ich Sie unbedingt zum Essen einladen will, als Dankeschön für Ihre Mühe«, sagte Frank Richter.
»Topp, die Einladung gilt. Ich bringe meine Frau mit. Sagen wir Freitagabend um acht, Treffpunkt Playamont? Das hübsche Lokal mit den Palmen, direkt gegenüber von Hennings Pension. Sie wissen ja inzwischen ungefähr, wo das ist.«
»Kein Problem«, bestätigte Frank Richter, »ich werde das schon finden. Ich freue mich.«
Jürgen schlug sich mit theatralischer Geste an die Stirn. »Ach, ich hatte ja völlig vergessen, dass Sie zu Fuß unterwegs sind und jetzt in dieser Einsiedelei hausen. Völlig unmöglich auf La Palma, ohne Leihwagen sind Sie hier aufgeschmissen und lernen die Insel nie kennen. Wenn Sie einen wollen, Chano besorgt Ihnen einen, zum günstigsten Preis, versteht sich. Sie finden ihn meistens unten bei Carmen in Jorges Bar.«
»Besten Dank für den Hinweis«, rief Frank Richter, »ich glaube schon, dass ich auf das Angebot zurückkommen werde.«
Und Chano winkte beim Abfahren vom Suzuki aus, als wären sie die besten Bekannten.
So langsam läuft’s, dachte Frank, der sich mit einem Mal seltsam überanstrengt und müde fühlte. Fängt an, mir zu gefallen. Ich brauche unbedingt Ruhe in meinem Kopf, klar Schiff für neue Gedanken, Sendepause mit Zeitzeichen grüne Insel, Wind und Rascheln der Palmwedel. Und dann mal sehen, was kommt. Seit seiner Ankunft auf der Insel hatte er nicht einmal an Ute denken müssen. Ein verdammt gutes Zeichen für den Anfang.
Schon wieder so eine unerwartet unanständig unregelmäßige Zacke! Wie vorige Woche schon einmal. Eigentlich nichts Besonderes, nur ein winziger Ausschlag des Stiftes, eine geringfügige seismografische Anomalie auf der Schreibwalze des Erdbebenschreibers, viel zu wenig, um als signifikant zu gelten. Aber gerade weil Victor Depauw ein solcher Pedant war, störten ihn die kleinen, kaum wahrnehmbaren Veränderungen besonders. Die großen sozialen, politischen, gesellschaftsbedingten Ereignisse konnte er mühelos ignorieren und so tun, als gäbe es keine zwischenmenschlichen Streitereien, Wahlen, Verkehrsunfälle. Aber die ganz kleinen, die jeden normalen Menschen völlig kaltließen – die machten ihn regelrecht fertig. Wenn zum Beispiel die Putzhilfe dagewesen war und trotz strengster Ermahnung barbarisch nachlässig gehaust hatte.
Die Bleistifte hatten stets rechts oben auf seinem Schreibtisch zu liegen, jedenfalls die schwarzen. Der rote hingegen musste griffbereit links davon der besonderen Gelegenheiten harren, für die er schließlich angeschafft worden war. Und warum, zum Kuckuck, war die weißgelbe Art-Déco-Vase jedesmal nach dem Staubwischen ein paar Millimeter vom Mittelpunkt des Bücherregals verrückt? Das musste doch wirklich nicht sein, solche Eingriffe in die innere Ordnung seiner Wohnung störten erheblich die Harmonie und besaßen die schädliche Kraft der Irritation, wenn nicht gar Destruktion, die ihm den halben Nachmittag vergällen konnte.
Andererseits besaß gerade diese eine winzige Zacke auf der Schreibwalze des Seismographen unbestreitbar eine gewisse Qualität. Das Innere der Erde ist eben völlig chaotisch und unberechenbar, sagte sich Monsieur Depauw. Und genau deshalb gab es ihn und seine äußerst feinfühligen Apparaturen. Tag und Nacht überprüften sie mit akribischer Genauigkeit die Bewegungen der Erdkruste. Schlimm wäre es, wenn der Schreiber immerfort das gleiche Muster auf die Walzen zeichnen würde. So aber zeigte er an, wie genau und zuverlässig sein Instrumentarium arbeitete, ohne die geringsten Anzeichen von Verschleiß. Man konnte sich auf den Apparat verlassen. Ganz im Gegensatz zu Menschen. Victor Depauw sprach zwar selten darüber, aber dann hielt er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg: Für ihn waren Maschinen weitaus perfekter als Lebewesen.
Aus dem Grund pflegte er auch täglich sein Rennrad. Manche, die ihn kannten, lächelten darüber und hielten sein Privatrennen Time hoch und zurück für eine Marotte. Schließlich hatte der Ingenieur sich in seiner Jugend des Öfteren an Straßenrennen in Belgien beteiligt und sogar vom gelben Trikot bei der Tour de France geträumt. Aber für Victor Depauw besaß die tägliche strapaziöse Bergtour noch eine andere Dimension. Wegen seiner Diabetes fühlte er sich körperlich unvollkommen, und mit dem Training versuchte er, seinem Körper eine gewisse Präzision aufzuzwingen, etwa so, wie er stets auch zu exakt den gleichen Zeiten aß, immer im gleichen Lokal und am gleichen Tisch.
O ja, er kannte dieses Gefühl der automatischen Körperreaktionen am Berg, diese ab einem gewissen Punkt sich ausdehnende Zeitlosigkeit, und er liebte es, an den Rand der Leistungsfähigkeit zu gelangen. Er kannte jede Kurve, jeden Steigungswinkel, sogar einzelne Feigenbäume, Kakteen, selbst einzelne Steine am Straßenrand, die ihm allesamt als Markierungs- und Messpunkte dienten. So gesehen, war die Welt wirklich ein einziges großes Uhrwerk, und er fungierte als Sekundenzeiger darin.
Nur diese Hunde, diese elenden Köter, die so asymmetrisch und unkontrolliert aus dem Buschwerk sprangen, um nach seinen Beinen zu schnappen! Mierda, sie bildeten einen scheußlichen Störfaktor bei seiner Arbeit. Er hätte sie erschießen, erschlagen, vergiften mögen. Warum, zum Kuckuck, konnten Hunde nicht so leise, sanftmütig und sensibel wie Katzen sein?
»Mies, mies, Minouche!« rief er lockend, um seinen Gedanken in der realen Außenwelt bestätigt zu sehen. Tatsächlich öffnete der rote, samthaarige Perserkater sofort die Augen, streckte sich und erhob sich buckelnd von seinem Lieblingsplatz auf dem Sofa.
»Komm her, mein philosophischer, allwissender Tiger, es ist Frühstückszeit, exakt acht Uhr dreißig, Herrchen hat dir was Feines zurechtgemacht«, sagte Monsieur Depauw und klapperte mit dem Napf am Boden. Es war undenkbar für ihn, ohne den gemütlichen Veteranenkater einen Tag zu beginnen. Und weil eine gewisse Zeremonie niemals von Schaden sein konnte, prostete er dem verschlafen blinzelnden, behaglich schnurrenden Tier mit der Teetasse zu.
»Aber das gehört doch gerade zu unseren journalistischen Aufgaben, dass wir die Öffentlichkeit mit Informationen über das, was passiert, versorgen. Innerhalb kurzer Zeit kommen zwei Ausländer unter mysteriösen Umständen hier ums Leben. Darüber müssen wir berichten, ob wir wollen oder nicht!«
Während der Leutnant langsam sein Bierglas leerte, überlegte er, wie er den jungen Reporter, der seinen Beruf offensichtlich sehr ernst nahm, von seinem Vorhaben abbringen konnte. »Aber denken Sie doch bitte auch einmal an die Konsequenzen eines solchen Artikels«, sagte er. »Wir sind eine ausgesprochene Urlaubsinsel, nach Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote und vielleicht noch La Gomera die Urlaubsinsel überhaupt, ein Geheimtipp, ein Paradies unter blauem Himmel. Und da wollen Sie mit solchem Geschreibsel dunkle Wolken aufkommen lassen? Die Dimension, hombre, Sie müssen mal an die Tragweite denken! Im Paradies gibt es saubere Strände, wenige Taschendiebe und schmackhaftes Essen. Der Fisch kommt aus einem unverseuchten Meer fangfrisch auf den Tisch, es gibt Duschen in allen Hotelzimmern und für die Touristen genügend Trinkwasser, das wir extra mit einer neuen, kostspieligen Filteranlage in jedes Zahnputzglas leiten. Habe ich recht? Also. Im Paradies stirbt man einfach nicht, das wäre völliger Stilbruch. Und da wollen Sie mit Ihren Horrorberichten reinplatzen und den Leuten die Stimmung verderben? Also ehrlich gesagt, ich verstehe Sie nicht, amigo!«
»Aber der ungeklärte Tod der beiden Männer, der Kreis aus Steinen um das eine Opfer. Klingt ein wenig nach Voodoo und Macumba, finden Sie nicht? Außerdem soll der Hals des anderen seltsame Würgemale aufgewiesen haben...«
»Woher wissen Sie das?« fuhr der Leutnant dazwischen. Rote Flecken im Gesicht zeigten die ersten Anzeichen eines beginnenden Zornesausbruchs an. Er besann sich aber rasch und stellte geschickt die Weichen für eine andere Strategie. »Also, ich will Ihnen reinen Wein einschenken, amigo. Und wenn ich von der Provinzregierung dafür gesteinigt werde: nichts als die volle Wahrheit. Von mir aus können Sie die ruhig schreiben.«
Aufgeregt nestelte der junge Reporter an seinem Notizblock herum und verlor dabei seinen Kugelschreiber. Er musste vom Barhocker absteigen, sich bücken und unten zwischen den benutzten Papierservietten, Zigarettenkippen und anderem Abfall danach suchen. Diese Zeitspanne gab seinem Gesprächspartner Gelegenheit, eine vertraulich-listige Miene aufzusetzen.
»Also, wenn Sie es genau wissen wollen: In beiden Fällen handelt es sich ohne jeden Zweifel um Herzversagen, wie der Polizeiarzt versichert. Der eine hat sich beim Wandern übernommen, der andere auch und ist daher in äußerst schwierigem, übrigens behördlich gesperrtem Gelände abgestürzt. Es waren keine Würgemale am Hals, sondern Kratzspuren vom Fall übers Geröll. Der Steinkreis war schon vorher da, er stammt von Hirten, die da immer Rast machen. Der Junge, der den Alemán gefunden hat, wollte sich wichtig tun, außerdem ist er blöd, nicht ganz richtig im Kopf. Also, wo Sie auch hinschauen, nirgends ist auch nur die Andeutung eines Geheimnisses zu finden. Alles normal, völlig tranquilo. Unfälle kommen bekanntlich ständig und überall vor. Denken Sie nur an den Einsturz des Supermarktes neulich an der französischen Mittelmeerküste: sechs Tote, das sind wahre Tragödien, ein Elend von großer Tragweite. Aber bei uns? Tut mir leid, keine besonderen Vorkommnisse. Und glauben Sie mir, ich würde Ihnen nie etwas verschweigen, weil Sie mein Freund sind und auch mein Kontakt zu Ihrem Vorgänger stets der allerbeste war. An ihrer Stelle würde ich ein paar nette Schlussbemerkungen zu der Angelegenheit verfassen und mich auf die Sache mit der Pyramide an der Ostküste stürzen, von der die Ausländer meinen, sie sei aus der Guanchenzeit und von besonderer Bedeutung für die Weltgeschichte.«
»Da bin ich schon seit Wochen dran und recherchiere wie ein Bekloppter«, gab der junge Reporter zermürbt auf. »Wissen Sie eigentlich, wie wenig Zeilenhonorar ich für meine Arbeit bekomme?«
»Ach ja, die Welt ist schlecht«, stöhnte der Leutnant teilnahmsvoll. »Wenn es uns beide, Sie und mich, nicht gäbe, wären wir alle verloren...« Insgeheim aber nahm er sich vor, die beiden Gendarmen gehörig zurechtzustauchen. Immer diese elende Schwätzerei bei Rotwein und Bier. Das mit dem Steinkreis und den Würgemalen hätte auf keinen Fall rauskommen dürfen! Er würde sie eine Weile in die Hauptstadt versetzen, damit sie dort am Hafen auf die Autos der Touristen ein Auge warfen und keine Fotoapparate mehr wegkamen. Oder noch besser: Sie könnten diese albernen Wandparolen der Separatisten, die jetzt überall aufgetaucht waren, mit weißer Farbe übertünchen. Caramba, was für ein elender Job, und das bei dieser Hitze!
Ein klarer, frischer Morgen nach warmer Nacht. Frank Richter öffnete die Tür, die Holzläden, schob das Fenster hoch und ließ Licht herein. Als er sich umsah und das Mobiliar betrachtete, musste er lachen. In einem Winkel lag sein Schlafsack, daneben die beiden Reisetaschen, in einer anderen Ecke stand auf wackligem Holztisch der Kocher mit Topf und Gasflasche. Wirklich komfortabel, was wollte er mehr?
Er streckte sich ausgiebig und ging nach draußen, um Wasser zu schöpfen. Chano hatte ihm den Wassertank gezeigt und auch einen Eimer nebst Seil aufgetrieben. Das Wasser war gut, es schmeckte bergfrisch. Gut gelaunt brühte Frank Pulverkaffee in einem Zahnputzbecher auf und aß eine Rolle Kekse dazu. Er saß auf der Terrasse und ließ die Beine über die Mauer baumeln. In den Zweigen des Feigenbaums zwitscherten kleine, unscheinbar graue Vögel. Und dann die Eidechsen... Überall raschelte es. Wenn man still saß, sich wenig bewegte, konnte man sie beobachten, wie sie sich neugierig heranpirschten und die winzigen Reptilköpfe hoben. Es gab grau gesprenkelte und solche, die etwas größer waren und blaue Kehlsäcke besaßen. Richtige Miniaturdrachen.
Sein träge zum Meer hinuntergleitender Blick fiel auf eine Gruppe merkwürdiger Bäume. Er stand auf und ging näher hin. Ihre Stämme waren von unzähligen knorrigen Luftwurzeln umrankt, und die Kronen wirkten wie trutzige Stachelhauben. Dragos waren das, Drachenbäume, wie sie nur hier auf den Kanaren vorkamen, das hatte er im Reiseführer gelesen, der auch Abbildungen dieser Bäume zeigte. Eigentlich sollten es ja riesige Agavenewächse der Urzeit sein, etwas Übergroßes, Ausgestorbenes wie einst die gigantischen Schachtelhalmwälder. In Wirklichkeit wirkten sie noch eigenwilliger. Frank Richter bedauerte wieder einmal, dass er so wenig vom Fotografieren verstand. Mit seinem billigen Apparat würden die Bilder nichts werden. Also die bessere Kamera einsetzen, die eigenen Augen.
Er bewegte sich noch ein paar Schritte vor und bemerkte jetzt, dass die fünf Bäume wohlgeordnet im Kreis standen. Wie ein Hexenring, dachte er. Und wie es bei Assoziationen ist – einmal aufgetaucht, lassen sie einen nicht mehr los. Als er in die Mitte des Kreises trat, glaubte er einen deutlichen Temperaturunterschied zu spüren. Kühl war es, wie erfroren wirkten die spitzen Äste und schuppigen Blätter, die bewegungslos waren, als wären sie versteinert.
Er setzte sich hin und steckte sich eine Zigarette an, betrachtete die Umgebung. Ein Reiter kam den Pfad herunter, hell blinkten die Hufeisen am Stein. Vor ihm auf dem Sattel, der aus einem einfachen Fellfetzen bestand, hockte ein etwa dreijähriges Kind. Beide, der Mann und das Kind, starrten in Gedanken versunken auf den Weg, nahmen keine Notiz von ihm, vielleicht sahen sie ihn auch gar nicht unter den Bäumen. Dann waren sie vorbei. Kurz danach verlor sich auch das Klappern der Hufe.
Wenig später Glöckchenklingen, Gemecker und Trappeln von Ziegen. Eine ganze Herde, 15, 20 Tiere unterschiedlicher Hautfärbung von samtbraun bis schwarzweiß gefleckt, kam den Weg hoch mit kecken Seitwärtssprüngen und spielerischem Hörnergestoße, so nebenbei wurden auch ein paar Blätter gezupft. Ein alter Mann mit breitem Sonnenhut, einer Decke als Umhang und langem Holzstecken bog um die Ecke. »Kirr«, schrie er. Schrille, spitze Schreie, die wie »hiiia, heii, ho, tssi, tsiii« klangen. Ihm folgte eine Frau in zerlumpten Kleidern. Sie trug ein Polster auf dem Kopf und darauf einen mächtigen Flechtkorb mit gelbgrünen Kaktusfrüchten. Mit der rechten Hand stützte sie den Korb, ihr Körper bewegte sich so, dass die Last im Gleichgewicht blieb. Ihr Gesicht lag im Schatten. Frank konnte nur ahnen, wie alt sie war. Vielleicht 60 Jahre oder mehr.
Frank wollte aufstehen und merkte, dass seine Beine eingeschlafen waren. Ameisenkribbeln bis zu den Knien. Er fluchte. Wie spät war es wohl? Er hatte vergessen, seine Armbanduhr aufzuziehen, sie war stehengeblieben. Mit taubem Gefühl in den Füßen humpelte er aus dem Schatten der Drachenbäume. Der Klimawechsel machte ihm zu schaffen. Er beschloss, nach unten ins Dorf zu laufen. Nach einem anständigen zweiten Frühstück würde er sich bestimmt besser fühlen.
Vom Haus aus führte im rechten Winkel zum Weg eine schmale Trittspur hinunter. Bestimmt eine Abkürzung. Zwischen Kakteen ging es über Felsstufen den Hang hinab. Hin und wieder ein aus groben Bruchsteinen gemauertes Haus mit zerfallenem Dach, daneben Palmen, allerlei wucherndes Gestrüpp und wilde Geranien. Eine Idylle. Ebenso das Dorf mit der kleinen Kirche, die Poststation, ein paar Bars zwischen den Terrassen einer ausgedehnten Bananenplantage.
Im Halbdunkel ihrer obskuren Bar begrüßte ihn Carmen mit überschwänglichem Wortschwall und echter Herzlichkeit. Es stellte sich heraus, dass Frank das meiste von dem, was sie sagte, verstand. Ohne nachzudenken, redete er einfach drauflos. Er freute sich, seine Sprachkenntnisse endlich mal praktisch einsetzen zu können. Ja, der Chano würde ein Auto besorgen, plapperte Carmen, das sei überhaupt kein Problem. Einen Seat Panda, am besten mit Allrad, den könne man hier schon gebrauchen. Sie würde ihm gleich Bescheid sagen. Frank Richter solle ruhig erstmal unten an der Plaza bei Luis was essen, daneben sei ja der große Laden, wo er alles, was er brauche, bekomme, sogar neue Gasflaschen, Sombreros, Kerzen, Dosenöffner und andere nützliche Dinge. Dahin würde Chano mit dem Auto dann kommen, no problema, alles tranquilo, hombre.
Mit dem Gefühl eines Mannes, dem jegliche Zeit dieser Welt gehört, erkundete Frank Richter das Dorf, die Plaza, Luis’ Bar, das kunterbunte Angebot im beschriebenen Laden. Schließlich, als er seiner Meinung nach die Ausrüstung für mindestens eine Woche zusammenhatte und mit einer gefüllten Pappkiste auf der Steinbank neben dem Dorfbrunnen saß, erschien Chano mit dem Leihwagen.
Nicht nur, dass er vollgetankt und den Papierkram bei der Autovermietung bereits erledigt hatte – er bot sich nach dem dritten Café mit Cognac zudem noch als wegkundiger Führer an: »Ich kann dir alles zeigen, was dich interessiert, hombre«, sagte er fröhlich grinsend. »Jürgen hat mir erzählt, du wärst ein Gelehrter mit vielen Büchern.«
Frank Richter winkte ab.
»Doch, doch, ich meine es ernst«, beharrte Chano auf seinem Angebot, »wenn du sehen willst, wie La Palma wirklich ist, dann darfst du es nicht machen wie die anderen Touristen. Die kommen für zwei, drei Wochen, liegen dauernd am Strand, essen und trinken und machen viele Fotos. Wenn sie wegfahren, winken sie, geben Trinkgeld und sagen: Eine schöne Insel war das, ein guter Urlaub. Aber gesehen haben sie eigentlich nichts.«
Frank Richter musterte seinen Begleiter aufmerksam. Der Bursche schien wirklich ein guter Geist zu sein, er kam wie gerufen. Ja, genau das war es, was er sich vom Aufenthalt auf der Insel versprach: kein normales Sightseeing, sondern wenn möglich einen ausgiebigen Blick hinter die Kulissen. Ob der Kerl hellsehen konnte?
»Danke«, sagte er, »ich komme bestimmt darauf zurück. Wo finde ich dich am besten, bei Carmen?«
»Meistens ja, wenn nicht, dann unten in Argual in der Bar Tanausú bei meinen Freunden, jenseits der Schlucht der Todesängste.«
Wow, wie das klingt, dachte Frank Richter später, als er zu seinem Haus in den Bergen hinauffuhr: »jenseits der Schlucht der Todesängste...«, wie eine Reise zur Unterwelt. Und der Name Chano klang ja auch ein bisschen wie Charon, der Unterweltbote, der in der griechischen Mythologie bekanntlich die Seelen der Verstorbenen über den Styx zum Hades, dem Reich des Todes, übersetzte. Oder wie »Cano«, was auf spanisch »Hund« bedeutet und mit der Herkunft des Namens »Kanaren« in Zusammenhang stehen soll... Frank spann weiter: Entfernt sah Chano ja auch einem Hund ähnlich, und galten nicht Hunde in der antiken Welt stets als Boten, Hüter und Wächter der Jenseitswelt – Pluto, Cerberus, der schakalköpfige Anubis im alten Ägypten?
Er lachte auf. Quatsch, diese Spielerei mit Assoziationsketten. Er war doch kein esoterischer Kabbalist, der an die geheime Wirkung von Buchstaben, Zahlen und magischen Lauten glaubte. Und die Aussage eines neuzeitlichen Philosophen und Erkenntnistheoretikers etwas umwandelnd, sprach er den Satz vor sich hin: »Eine Insel ist eine Insel, zumal sie grün ist.« Aber Ute, die saß irgendwo weitab im Gestern der Alten Welt.
Der Schweizer Architekt und Immobilienmakler J. S., der sowohl von Fremden als auch Geschäftspartnern nur mit diesem Kürzel benannt wurde, besichtigte die herrlich mit einem dichten Wald aus Drachenbäumen überwucherte Schlucht von Buraca. Seit jemand seinen Sennhund vergiftet und in den Swimmingpool geworfen hatte, war J. S. vorsichtig geworden. Er trug jetzt immer in der Umhängetasche verborgen seinen Revolver bei sich.
Am Eingang zur Schlucht ließ er den Landrover stehen und machte sich weiter zu Fuß an den Abstieg. Man hätte auch keinen Meter weiter fahren können, denn was nun folgte, war ein äußerst steiler, recht schmaler und durch etliche Felsvorsprünge schwer passierbarer Pfad. J. S. ging den mühevollen Weg keineswegs aus Spaß, er war geschäftlich hier. An einer der vielen Biegungen, die einen weiten Blick auf das grandiose Panorama der Schlucht zwischen den Felshängen bis hinab zum Meer ermöglichte, setzte er sich, um zu verschnaufen.
Das war sie also, die Schlucht von Buraca. Eigentlich Brachland, aber ein höchst interessantes Projekt. Wenn man den Pfad breiter ausbauen und ein paar Felskanten wegsprengen würde, ergäbe das eine durchaus passable Fahrpiste, die auch für Pkws geeignet wäre. Unten in der Schlucht wäre dann mehr Platz, vielleicht für Garagen oder auch für zwei oder drei kleinere Häuser. Die Hauptattraktion würde natürlich eine Stelle sein, die zu einer geräumigen Plattform hin auslief. Da sollte die Bungalowsiedlung stehen, etwa zwanzig Gebäude, die sich in Terrassenbauweise an die Felswände schmiegten. Modernster Komfort, Solaranlagen auf den Dächern und uneingeschränkter Seeblick.
J. S. stellte sich ein Zentrum für Managerseminare vor. Einige Leute würden hier ständig Urlaub machen, andere nur gelegentlich zu Schulungszwecken kommen, verbunden mit Survivaltraining unter medizinischer Anleitung. Dazu konnten Schwimmen, Tauchen, Segeln gehören (wenn sich eine steile Steintreppe zur Küste hinab in den Felsen schlagen ließe), ebenso Meditieren in Höhlen und Tagesausflüge im Steinzeitlook. Natur pur und unverfälscht in wohlproportionierter Dosierung für Zivilisationsmüde, die sich nebenbei einen gewissen Luxus leisten konnten. Ein geniales Projekt, aber mit einigen Haken, wie meistens bei solchen gewinnbringenden Ideen.
Der Geschäftsmann J. S. liebte es, gerade an solchen Sachen herumzubasteln, die anfangs als aussichtslos galten. Da bestanden zunächst die üblichen Einwände von Seiten der Gemeinde, der Bezirksregierung und einiger Verbände wegen des Naturschutzes. Blödsinnige Argumente, die sich vor allem um die Dragos drehten, die einige Leute für schützenswerte Naturdenkmäler der Vorzeit hielten. Sentimentalitäten vor allem der Grünen, die sich neuerdings auch auf den Kanaren störend bemerkbar machten. Klammerten sich an jeden blühenden Stängel, als hinge von ihm das Seelenheil der gesamten Menschheit ab. Vor allem galt der Protest den sogenannten »harten« Landschaftseingriffen. Dabei bestand der Felsen, wie er durch einen befreundeten Gutachter hatte feststellen lassen, vorwiegend aus leicht bröckliger Masse, in der Fachsprache »Picón«, der sich leicht wegsprengen ließ. Man brauchte ja nicht alles mit Dynamit wegzublasen, nur gerade soviel, wie für die Straße notwendig war. Die Abraumhalden konnte man ruhig liegenlassen, sie würden in ein paar Jahren von selbst mit Unkraut überwuchert.
Nächster Haken: die Höhlen, die dabei gesprengt würden, zumindest ein paar von ihnen. Angeblich Guanchenhöhlen einer uralten, vorspanischen Siedlung. So ein Gesülze! Tatsächlich hatte sich bis zum Tag der Projektvorstellung niemand darum gekümmert, nicht einmal die Archäologen von der Universität La Laguna aus Teneriffa. Wie J. S. aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle wusste, besaßen die weder Personal noch Geld, um die Höhlen zu untersuchen. Außerdem existierten auf der Insel mehrere tausend Höhlen, und Keramikscherben der Ureinwohner lagen bekanntlich an vielen Plätzen herum. Es gab so viele von ihnen, dass die Chicos sie bereits sammelten und an die Touristen verkauften. Er war sicher, dass sich für diesen speziellen Punkt ein Dreh finden ließ, um alle Seiten zufriedenzustellen. Zum Beispiel ein lukratives Sponsoring für die Universität, damit man andernorts richtig forschen konnte.