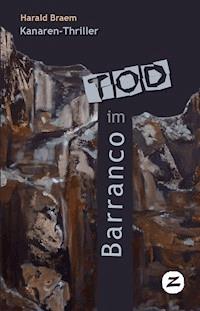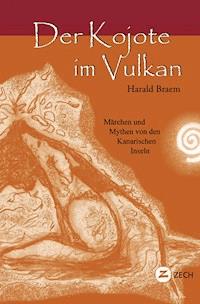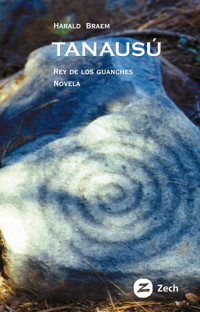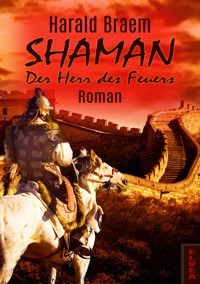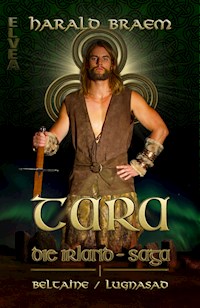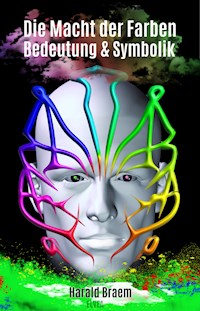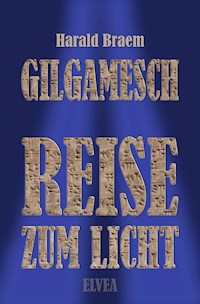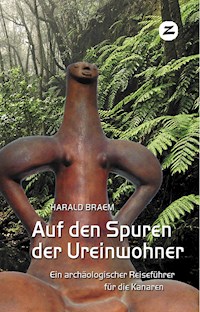6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Elvea
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Waldbaden“ vor 75 Jahren: Ein Flüchtlingsjunge wächst, zusammen mit einem Wolfshund und den Großeltern, unter ärmlichsten Bedingungen im Westerwald auf. Truda hat das „zweite Gesicht“, gilt als Hexe und Heilfrau. Der alte Mudri ist Freigeist, Ingenieur und Erfinder und träumt von einer besseren Welt. Unter diesen Bedingungen lernt der Junge die „Waldschule“ kennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Wälder meiner Kindheit
Eine Erzählung von
Harald Braem
ELVEA
Die Handlung und alle Personen des Textes sind frei erfunden.
Alle möglichen Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Vorgängen oder Ereignissen bzw. mit lebenden oder gestorbenen Personen sind rein zufällig.
»Rasch, greif das Glück und wünsch
dir was. Aber nicht zu viel, denn
Sterne sind schnell und vergesslich.«
(einer von Mudris Ratschlägen, die sich tief
in mein Gedächtnis eingeprägt haben)
»Ich der Wolf und du das Schaf.«
(einer von Trudas Zaubersprüchen)
Der Autor
Harald Braem, geboren 1944 in Berlin, war Professor für Kommunikation und Design an der Fachhochschule Wiesbaden und lebt heute in Nierstein am Rhein und auf der Kanareninsel La Palma. Jüngste Veröffentlichung: ›Die abenteuerlichen Reisen des Juan G.‹ im Elvea Verlag 2020.
Weitere Informationen:
www.haraldbraem.de
Die Wälder meiner Kindheit …
Manchmal duften die Pilze im Moos bis in meine Träume hinein. Dann höre ich wieder die Stimmen der Ahnen, meine Großeltern, ganz leise das Flüstern der Geister.
Sie schlafen in der Speisekammer, die sie geschickt mit Kissen, Decken und einem Teppich zur Kemenate umgestaltet haben. Sie können die dünnen Holzlattentüren von innen schließen wie Läden an einem Haus. Das gibt Schutz und Wärme, besonders im Winter. Aber nach dem Zubettgehen bleiben sie stets noch einen Spalt weit offen. Dann beginnt für mich die magische Nacht.
Ich höre den alten Mudri mit seinem sonoren Bass, der brummen kann wie ein Bär, der schmachtende Lieder der Donkosaken singt, der gern aus dem Stegreif dramatisch klingende Ansprachen hält, die meist dazu führen, dass die Anwesenden, zumal wenn Wodka im Spiel ist, gerührt in Tränen ausbrechen und ihre Gläser über die Schulter an die Wand werfen und ein klirrendes Chaos anrichten. Derselbe Mudri, der aber auch tagelang schweigen kann, besonders bei der Arbeit in den Wäldern.
Und ich höre Truda, die Ahnfrau, die mit ihrem Mund alle Geräusche der Welt nachahmen kann: den Wind, die Stimmen der Tiere, alle Lieder, die sie irgendwann und irgendwo einmal aufgeschnappt hat (»Bei mir biste scheen für eine Mark und zehn, für eine Mark und acht die janze Nacht«). Truda, die die Gabe (oder den Fluch) des Zweiten Gesichts besitzt und manchmal in einer Sprache spricht, die außer ihr niemand versteht.
Ich höre, wie sie in der Speisekammer rumoren und halblaut miteinander reden, mitunter flüstern sie oder kichern. Ich versuche einzelne Worte aufzuschnappen, dem Sinn ihrer Unterhaltung zu folgen. Es gelingt mir nicht, so sehr ich auch angestrengt lausche. Zu undeutlich und verworren bleiben die Stimmen. Und wenn ich etwas zu verstehen glaube, das in mir Bilder erzeugt, wenn die Unterredung intensiver wird und an Lautstärke zunimmt, wenn Truda ein »Pscht« macht, das wie ein ferner Peitschenknall klingt und ich schlagartig begreife, dass dieses »Pscht« mir gilt, weil sie wohl ahnt, dass ich noch wach bin auf dem Strohlager neben dem Ofen, dann reden sie plötzlich nur noch in der ›Blumensprache‹ miteinander, das heißt mit bestimmten Worten und Andeutungen, die wahrscheinlich für ganz andere Dinge stehen, oder auf Russisch weiter, bis ich einschlafe.
Diese magischen Nächte, durch die mich die Stimmen der Ahnen aus der Speisekammer tragen, sind ungemein aufregend, aber nicht immer schön. Mitunter schnappe ich Einzelheiten auf, gruselige Details, die mit Sicherheit nicht für meine Ohren bestimmt sind. Ich höre hemmungsloses Schluchzen und Jammern von Truda, erlebe eine Trübsal, die selbst Mudris beruhigend klingender Bass nicht eindämmen kann. Aus Bruchteilen von Worten, Sätzen, Reden und Gegenreden, verschwommen aus dem Nebel auftauchenden Bildern versuche ich das eben Erlauschte sinnvoll zusammenzufügen. Manches davon erschreckt mich und ich schiebe die schlimmen Bilder rasch beiseite, doch das klamme Bauchgefühl bleibt haften. Wieder murmeln die Ahnen, es ähnelt einem monotonen Gesang oder dem Sprudeln von Wasser über runde Steine im Bachlauf. Dieses Geräusch lässt mich ruhiger werden, ich dämmere ein und schwebe schwerelos durch Träume, in denen sich Personen bewegen, die mir fremd, aber seltsam vertraut sind. Wer sind diese Geister, was haben sie mit mir zu schaffen, was wollen sie mir sagen?
Ich höre sie unentwegt flüstern, auf Deutsch und auf Russisch und in anderen, unbekannten Sprachen. Ihr Wispern gilt der Steppe, der Taiga, dem großen Strom. Sie sind mit dem Wind unterwegs, Nomaden der Nacht, auf der Suche nach Heimat, und tragen ihre Erinnerungen mit sich wie kostbarste Schätze, Geheimnisse, die sie hüten müssen und nur an wenige weitergeben dürfen. Warum ausgerechnet an mich?
Sie flüstern sehr leise, sie fordern meine Ohren heraus. Es ist ein Spiel, das weiß ich. Und ich lasse mich darauf ein. Sie sind die Rufer, ich bin der Fänger. Ich werde Nacht für Nacht besser.
Wenn ich die Augen fest schließe und zum hingebungsvollen Zuhörer werde, zum Gesamtkörper Ohr und nur noch wartende Hörmuschel bin, wenn ich ruhig und gleichmäßig atme, wie Truda es mir beigebracht hat, und mich bemühe, an nichts zu denken, mich von nichts ablenken zu lassen, entsteht in meinem Kopf die innere Welt mit ihren fantastischen Bildern. Ein Garten, in dem man sich verirren kann …
Ich habe seltsame Träume. Ich reite auf einem kleinen, stämmigen Pferd und wundere mich, wie leicht es mir fällt. In Wirklichkeit habe ich das noch nie gemacht, die Tiere sind mir einfach zu groß. Aber im Traum spielt das alles keine Rolle. Ich sitze fest im Sattel und reite mit Männern, mit vielen Männern, in einem Heer aus ledergepanzerten, behelmten Reitern nach Westen. Das war schon immer so, das haben wir seit Jahrhunderten so gemacht. Wie ein Sturmwind galoppieren wir mit donnernden Hufen über die Steppe. Dieser Traum wiederholt sich lange Nacht für Nacht …
Aber es gibt auch Nächte, in denen ich jedes Wort ihrer Unterhaltung deutlich mithören kann. Am besten ist, wenn Großvater von seiner masurischen Heimat erzählt, jenem fernen Land, das wohl, glaubt man dem alten Mudri, und ich zweifele nie an seinen Worten, nur aus endlosen Wäldern besteht, in denen es von Elchen, Bären und Wölfen nur so wimmelt. Truda stammt von der baltischen Ostseeküste, was ihr aber nicht anzumerken ist, denn sie benutzt selten die breite ostische Mundart, höchstens wenn sie etwas betonen will oder wenn sie sich ärgert oder aufgeregt ist. Von der alten »Haimat« zu berichten, das sei nicht ihre Sache, wehrt sie ab. Da solle ich doch lieber Mudri fragen, der könne sowieso viel besser erzählen als sie und sich Dinge merken, die sie längst vergessen habe.
An der Kurischen Nehrung hatten sie sich kennengelernt, und sie war ihm gefolgt, wohin auch immer die Wirren der Zeit sie führten. Truda und Mudri lieben sich. Diese Liebe überstand alles, Hunger, Not und Vertreibung, den Tod des einzigen Kindes, Ihres Sohnes, meines leiblichen Vaters, der im letzten Jahr des Krieges an der Ostfront fiel. Sie überstanden auch den Schmerz über den Verlust ihrer einst so herzlich in die Familie aufgenommenen Schwiegertochter Charlotte, meiner Mutter, die bei der Flucht auf einem Bahnhof spurlos verschwand und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Andere Verwandte leben nicht mehr oder sind wie Charlotte verschollen.
Truda und Mudri haben sich meiner angenommen. Wir wohnen in einem winzigen Haus, eigentlich mehr eine notdürftig eingerichtete Hütte, dicht am Waldrand und ein gutes Stück weit vom Dorf entfernt. Ein Mann von dort, dem mein Großvater gelegentlich aushilft, hat uns die Unterkunft überlassen. Vorübergehend nur, wie er betont. Viel Kontakt zu den anderen Menschen im Dorf gibt es nicht. Wir sind die Fremden, die Flüchtlinge, und wer will hier im Westerwald mit solchen Leuten unklarer Herkunft schon näher zu tun haben?
»Ich bin kein Deutscher, ich bin Masur«, pflegt Großvater mitunter unvermittelt in solchen Nächten zu äußern, und seine Stimme klingt traurig und trotzig dabei.
»Pscht«, zischt Truda dann, weil sie weiß, dass, wenn er in dieser Stimmung weitermacht, nichts Erfreuliches dabei herauskommt. »Nu, bist du wohl stille jetzt. Wenn dich die Laite hören!«
Ich schrecke jedesmal zusammen, wenn sie so spricht. Was meint sie? Wir hausen doch ganz allein, das Dorf liegt weit weg. Oder sollte sich jemand angeschlichen haben, um uns heimlich zu belauschen? Mit ans Holz gepresstem Ohr vor unserer Haustür hocken?
»Doch, ich bin Masur«, wiederholt Großvater halsstarrig. »Wer dort geboren ist und einmal die Luft eingeatmet hat, der bleibt es für immer.«
»Nein, du bist Daitscher, Reichsdaitscher, begreif es endlich, so is es nu ma«, sagt meine Großmutter, »und nu sei endlich stille und lass uns schlafen.«
Und da der alte Mudri am Abend ein paar Gläser vom selbstgebrannten Kartoffelschnaps getrunken hat, schläft er auch tatsächlich bald ein. Sein Schnarchen dröhnt aus der Speisekammer und tönt lauter als der Motor, der im Sägewerk ratternd läuft, wo ich ihn einmal besucht habe, um ihm das Mittagessen im Blecheimer zu bringen.
Ein anderes Mal fragt er: »Weißt du noch, wie wir am Strand Bernstein gesammelt haben?«
»O ja, natürlich«, antwortet Truda. »Das war ein wunderbarer Sommer damals, mein Lieber! Ich habe ständig gebetet, er möge nie zu Ende gehen, so schön war es damals. Besonders in den Dünen.«
Was sie mit der letzten Bemerkung meint, begreife ich nicht recht. Ich hoffe nur, sie wird nicht weinen, denn meine Großmutter neigt mitunter zu Wehmut und Weltschmerz und hat dann dicht am Wasser gebaut. Es ist furchtbar, sie in einem solchen Zustand zu erleben, denn eigentlich ist sie ja ein durchaus lebensfroher Mensch. Sie kann gurrend wie ein Täubchen lachen, und mitunter trällert sie am helllichten Tag frivole Lieder mit zweideutigem Inhalt. Ich verstehe das meiste davon nicht richtig, finde es aber schön, dass sie gute Laune hat.
»Alles hat ein Ende«, pflegt der alte Mudri dann zu sagen, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, »nur die Leberwurst hat zwei.« Oder: »Alles, alles ist vergänglich, nur der Kuhschwanz, der bleibt länglich.«
Dann lacht sie wieder, und er setzt, um die Wirkung zu verstärken, noch eins drauf, indem er anfängt, eine Reihe von witzigen Begebenheiten zu erzählen, die sie allesamt zum Prusten bringen.
»Da gab es doch die Beerdigung vom Schnipkoweit, dem ollen Lorbas.« Es war Winter und der Weg zum Friedhof hart gefroren und völlig vereist. Sehr schwierig zu begehen bei dem Wetter, besonders für die alten Leute. Weil es bitterkalt war, wurde unterwegs reichlich Wodka getrunken, um sich an diesem traurigen Tag wenigstens von innen etwas aufzuwärmen. Das letzte Stück an den Gräbern vorbei zur Friedhofskapelle war fürchterlich glatt, sie kamen äußerst langsam und schwankend voran. »Da kam jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf die glorreiche Idee, die Urne zu öffnen und Schnipkoweits Asche als Streugut zu nutzen.« Als das Grüppchen schließlich beim Pfarrer ankam, war die Urne leer. Schnipkoweit hatte, obgleich ihn im Leben keiner so recht mochte, weil er ein unausstehlicher Knickeböcker und Streithammel war, zuletzt der Gemeinschaft doch noch einen nützlichen Dienst erwiesen.
»Ja, so war das. Alle haben dichtgehalten und dem Herrn Pfarrer nichts verraten. Wir haben dann das Gefäß ohne Schnipkoweit beigesetzt. War harte Arbeit bei dem gefrorenen Boden.«
»Und niemand hat etwas verraten?«
»Nein, niemand. Aber später, im nächsten Sommer, und auch noch Jahre danach nannten die Leute diesen Weg nur noch Schnipkoweits Pfad. Alle wussten davon, aber keiner sprach darüber mit dem Pfarrer. Der Mann war streng in seinen Ansichten und in der Bevölkerung nicht so beliebt, wie er es gern gehabt hätte. Waren ja allesamt noch halbe Heiden, man nahm es mit der Religion nicht so genau.«
Und er fügt, spielerisch in den alten Dialekt fallend, die Stimmen aus dem Gedächtnis hinzu: »Laite, Laite, seid doch stille, dass euch nicht der Pastor heert, ja was is mit meiner Brille? Is ja janz mit Schmand beschmeert …«
»Wenn ich einmal tot bin, möchte ich, dass meine Asche in der Ostsee verstreut wird«, sagt Großmutter.
Und der alte Mudri weicht rasch, um sie abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen, auf eine weitere schalkhafte Episode aus, die Geschichte vom Dorftrottel Igor, der sich einmal eine lange Holzleiter auslieh, sie aber nicht mehr zurück in die Scheune bringen konnte, weil er stundenlang vergeblich versuchte, das sperrige Ding quer anstatt längs durch das Tor zu bringen. Großvater erzählt die Sache stets anders, so dass es jedes Mal spannend für mich wird, ihm zuzuhören. Vielleicht ist das auch nie passiert, vielleicht hat er die Begebenheit nur erfunden. Aber es macht ihm großen Spaß, sie immer wieder mit neuen Ausschmückungen zu erzählen. Ich liebe seine skurrilen, bildhaften Sätze.
Truda und Mudri sitzen in Gedanken in Elbing an der Promenade und essen Sprotten. »Kuck, ich kann die Jräten mitessen, so zart sind die.« Und nachher gibt es geräucherten Aal, den Truda aber nicht vertragen kann, weil er ihr viel zu fett ist. Sie mag lieber Seezunge oder Makrele, am meisten aber Scholle nach Finkenwerder Art mit angebratenen Speckkrümeln und viel Petersilie. Sie stöhnt genüsslich, weil sie just daran denkt. »Und der Weißwein«, sagt sie, »das reinste Vergnügen, so süß wie der war. Hätte man im Keller bunkern sollen.«
»Hätte hätte Fahrradkette«, brummt Mudri. »Und was hätt uns der Keller noch genützt, wo das ganze Haus kaputt war? Nee, nee, da hätt uns der Wein auch nicht mehr viel geholfen.«
»Warum denn nicht? Immer nobel geht die Welt zugrunde«, widerspricht Truda, »hätten wir’s wenigstens im Suff ertragen, den ganzen Schlamassel.«
»Quatsch«, sagt Mudri, der immer noch an Aal und Sprotten denkt und ohnehin lieber Bier trinkt und gelegentlich Wodka. »Wir haben’s doch ertragen. Und so isses nu ma im Leben: Man kann nich alles kriegen, was man sich wünscht. Das ist wie bei der Sache mit dem Gänsebraten …« Und er fügt, sehr zum Vergnügen von Truda, mit verstellter Stimme hinzu: »Gänsebraten ist ein feiner Braten. Ich hab noch keinen gegessen, aber meines Vaters Bruders Sohn, der kannte einen, der hat mal neben einem gesessen, und der sah einen Gänsebraten essen …«
Truda prustet vor Lachen und wiehert wie ein Pferd. »Den Abromeit«, ruft sie, »mach mir den Abromeit!«
»Da kallerten ihm die Arpsen vons Mässär runter und die Jabel half auch nicht ville … da war der Lorbas janz von oben bis unten beklackert …«, sagt Großvater mit fremder Stimme und muss selbst lachen.
Unsere Hütte mit Tür und zwei Fenstern ist winzig klein nur, aber immerhin mit einem wärmenden Ofen ausgestattet, der auch zum Kochen dient. Er wird mit gesammeltem Bruchholz gefüttert und darf nie ausgehen, vor allem im eisigen Winter. Ich sehe Großvater vor der Ofenluke knien, trockenes Reisig in die fast schon erloschene Restglut nachlegen und die Flamme anblasen. Die Asche tragen wir in einem Blecheimer in den Schuppen und sammeln sie in einer alten, zerbeulten Tonne, sie dient als Kompost für Trudas Gemüsebeete und als Streugut im Winter. Jedes Mal wenn die Reihe an mir ist, (Mudri und ich wechseln uns in einem genau festgelegten Rhythmus bei den verschiedensten Arbeiten ab), wenn ich also mit dem Blecheimer Asche aus der Sammeltonne hole und den weißgrauen Flugstaub über das Eis verteile, muss ich dabei an Schnipkoweit denken. Wenn der wüsste, dass man selbst im fernen Westerwald nach so langer Zeit noch an ihn denkt, würden ihm die Ohren klingeln…
Wir schöpfen das Trinkwasser aus dem nahegelegenen Bach und kochen es auf dem Ofen ab, obgleich es sauber und genießbar scheint.
»Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste«, meint Mudri, der weiß, wovon er spricht. Er hat auf dem langen Treck unterwegs schlimme Dinge erlebt und besteht darauf, ohne die geheimen Wirkkräfte der Blutwurz, die Truda für den Fall eines Falles beschwörend ins Spiel bringt, anzweifeln zu wollen.
Größere Mengen an Bachwasser, die es dann in Eimern zu schleppen gilt, werden zu Trudas Waschtagen benötigt. Der große Kochbottich steht bereits im Hof auf dem Feuer. Später wird sie während der ausgedehnten Prozedur mit Inbrunst die nassen, dampfenden Stoffe über das Waschbrett schleifen, drücken, würgen und wringen, bevor sie, noch triefend, mit Holzklammern an der Leine aufgehängt werden. Außer bei Regen und Sturm spielt das Wetter meistens mit, denn hier weht ständig ein frisches Lüftchen und lässt die Wäsche rasch trockenflattern.
»Du kannst dich ruhig mal wieder waschen und saubere Kleider anziehen, du stinkst schon wie ein Schmeerfink!«, ruft Truda und spritzt eine Handvoll Seifenlauge in meine Richtung. Ich springe mit einem empörten Aufschrei beiseite. Stimmt, ich trage Tag für Tag dieselben Klamotten: eine kurze Lederhose mit Gürtel, Sandalen und ein schmutziges Hemd, das ich über dem Bauch zusammenknote im Sommer. Im Winter besteht die Kluft aus langen Wollstrumpfhosen unter der gefütterten Hose, richtigen Stiefeln, die man innen mit Moos auspolstern kann, dazu Pullover, Windjacke, Schal und Fellmütze.
»Und du wie ein Geißbock!«, wendet sie sich zu Mudri um und spritzt ihn neckisch nass. »Dich braucht man nicht zu heeren, dich riecht man schon von weitem. Los nu, runter zum Bach, heute is Waschtag, das gilt für alle.«
Wie nackte Fauns waten und hüpfen Mudri und ich durch den kalten Bach, stoßen Mutschreie aus, bespritzen uns gegenseitig mit Wasser, plantschen nach Robbenart in runden, ausgewaschenen Kuhlen. Nachher bibbern wir, aber die Sonne wärmt uns rasch trocken.
Es gibt keinen elektrischen Strom, wir stehen mit dem beginnenden Tageslicht auf und gehen bei Einbruch der Dunkelheit schlafen. Ein kostbarerer Kerzenstummel wird selten einmal entzündet und nur in Ausnahmefällen die Petroleumlampe, weil wir sparen müssen. Mit dem selbstgepressten Bucheckernöl brennt sie nicht richtig, das eignet sich besser zum Backen und Braten.
Neben dem Haus hat Mudri verschiedene kleinere Schuppen angebracht, für die Hühner, das Stroh, das Winterholz. Und dann gibt es neben dem Hühnerstall, hinter einem Holzstapel verborgen, den geheimen Verschlag, den niemand außer Großvater öffnen darf. Dort brennt er von Zeit zu Zeit Wodka, sein »Wässerchen«, wie er es zärtlich nennt. Was genau sich in dem Verschlag befindet und wie die Sache vonstattengeht, weiß ich nicht. Ich durfte bisher nicht zusehen.
An der linken Außenwand der Hütte befindet sich die überdachte Latrine, ein Ort, den man im Sommer nicht so gern aufsucht, weil einen dann Scharen von grünen Fliegen anfallen, und im Winter zieht es durch den undichten Lattenverschlag. Ich verrichte mein Geschäft lieber am Waldrand, markiere so wie die Tiere mein Revier. Mudri verhält sich ebenso, nur Truda ziert sich und nimmt lieber das eklige Plumpsklo in kauf, als sich im Freien irgendwo hinzuhocken (na – vielleicht tut sie das schon, ich bekomme es nur nicht mit).
Im Holzlager wohnen die Spinnen, fürchterlich große braunschwarze Spinnen, die reglos lauernd auf mich warten und im allerletzten Moment erst auf ihren acht Beinen davonhuschen, wenn ich nach einem Scheit greifen will. Ich muss mich also anschleichen und langsam im Halbdunkel vortasten, um nicht mehr als nötig in Kontakt mit ihnen zu kommen. Einmal huschte mir eine kribbelnd über die Finger, flüchtete tiefer in schützende Spalten des Holzstapels. Ich möchte nicht noch einmal auf solche Weise überrascht werden. Ich habe mir vorgenommen, den Überblick zu behalten. Besonders im Halbdunkel, wo alles schemenhaft wird und doch völlig anders sein kann als vermutet.
Ich höre Mäuse in ihren Nestern rascheln (es ist keine Katze da, die sie jagen würde), im Herbst das Husten und Scharren eines Igels, der am Komposthaufen nach Nahrung sucht und möglicherweise ein Winterlager bei den Holzstapeln anlegt, ich höre das Nagen vom Holzwurm und das Pochen des Holzbocks, das manchmal wie laute Schläge die nächtliche Stille durchbricht. »Die Totenuhr klopft«, sagt Truda dann und bringt mich zum Gruseln.
Außerdem existiert eine Art Innenhof neben Hütte und Schuppen, von Kartoffel- und Gemüsebeeten umgeben, von Bohnenstangen, Tomaten, Gurken, Kürbissen und Beerensträuchern umrahmt, sandig, steinig und von scharrenden Hühnern bevölkert. Hier, in ihrem Revier, empfängt Truda die wenigen Gäste, die sich ab und zu bis zu uns in die abgelegene Einsamkeit herauftrauen. Ich sehe sie deutlich vor mir in ihrem verschlissenen Kleid und mit nackten Füßen im Sand zwischen den Hühnern sitzen, die sie stets nach dem Einsammeln der Eier aus dem Stall entlässt. Neben ihr steht der uralte Samowar, in dem stundenlang eine dunkelbraune, fast schwarze Brühe brodelt, Muckefuck aus gerösteten Eicheln, den niemand außer ihr trinken kann und der, selbst wenn man ihn mit reichlich heißem Wasser verdünnt, immer noch ungenießbar bleibt. Sie trinkt den ganzen Tag über davon in kleinen, nippenden Schlucken, ohne auch nur ein einziges Mal das Gesicht zu verziehen.
Gegen Nachmittag kommen die Gäste, meistens Frauen aus dem Dorf, mitunter auch ein Mann. Sie nähern sich einzeln und darauf bedacht, nicht von anderen gesehen zu werden, denn der Umgang mit Fremden wie uns gilt als nicht schicklich. Manche wagen es aber trotzdem, denn sie schleppen allesamt Probleme mit sich, die sie niemand anderem auf der Welt anvertrauen wollen. »Meine Patienten« nennt Truda sie und hilft ihnen, so gut sie vermag. Sie begrüßt sie freundlich, weist ihnen einen Holzschemel zu und hört sich geduldig die Anliegen an. Meist geht es um Krankheiten und körperliche Gebrechen, für die sie sich Linderung erhoffen durch Medikamente, die Truda herstellt. Es geht um Verletzungen, die nicht so recht heilen wollen, um geschwollene Beine, Kopfschmerzen, Schuppenflechte, steife Gelenke und Liebeskummer.
Bevor Großmutter mit der eigentlichen Behandlung beginnt, legt sie vor sich im Sand die speckigen Wahrsagekarten aus. Dabei befragt sie geschickt die Patienten nach den möglichen Ursachen ihrer Misere, während sie sie nach und nach einzelne Karten aus dem Stapel ziehen lässt und an die passenden Stellen legt.
»Was mich deckt …« grummelt sie und legt eine Karo Zehn in den Sand. »Na, wer sagt’s denn, gar nicht so schlecht für den Anfang … Was mich schreckt …« Sie zuckt leicht zusammen, denn es ist das Kreuz As, das links daneben platziert wird. »… was mir zu Füßen liegt, was mir zu Kopfe steigt …« Truda wirft einen raschen, besorgten Blick auf die Besucherin, denn es handelt sich schon wieder um dunkle Karten: »Da gibt es ja wohl wirklich ein ernstes Problem …«
Die Ratsuchende atmet schneller, beugt sich vor und starrt gebannt auf den Kreuz Buben. Gleich wird sie mit einem Redeschwall über ihren Nachbarn herziehen, den sie für bösartig und durch und durch verkommen hält.
Truda hört interessiert zu, fragt noch ein bisschen nach, um nähere Einzelheiten zu erfahren, aber dann beruhigt sie: »Das geht vorbei (die nächste Karte kommt ganz links zum Einsatz, eine nichtssagende Karo Sieben), … und das eilt herbei (glücklicherweise das Herz As).«
Jetzt geht es Schlag auf Schlag, Truda lässt die Frau weitere Karten aus dem Stapel ziehen und weist ihnen unter beschwörendem Gemurmel bestimmte Plätze zu: »Was bedeutet das alles? Wie stehe ich da, wie sieht man mich? Was macht die Umgebung? Und da ist ein besonderer Hinweis … Aha, hab ich’s mir doch gedacht … Naja … Und was kommt dabei heraus?«
»Ja, ja, wie wird’s denn nun?«, fragt die Besucherin, unruhig auf dem Schemel hin und her rutschend.
Truda hüstelt vieldeutig und scheucht mit einer Handbewegung unsichtbare Spinnweben vor ihrem Gesicht fort.
»Das ist nur zur ersten Übersicht, jetzt können wir weitere Karten befragen, um der Sache auf den Grund zu gehen … So, nochmal schön mischen, mit der linken Hand ziehen und dabei immer an die Frage denken …«
So geht Truda vor, sehr geschickt und mit überzeugend ernster Strenge. Auf diese Weise erfährt sie viel von den Leuten, auch über Zustände und Ereignisse im Dorf. Und sie kann ihr gewonnenes Wissen entsprechend bei der nächsten Sitzung verwenden.
Für die Ratsuchenden ist Truda ein Hoffnungsschimmer, sie vertrauen sich ihr rückhaltlos an, starren auf das Kartenbild, das sich im Sand nach und nach abzeichnet, und lauschen gespannt den mysteriösen Aussagen und Andeutungen meiner Großmutter. Die stört es nicht, wenn mitunter ein Huhn quer über die Karten läuft oder ein Spatz dazwischen kackt. Im Gegenteil: Sie bezieht das herumpickende Volk einfach in ihre Weissagungen mit ein.
»Oh«, ruft sie dann, »die Pik sieben. Das bedeutet Schreck in der Abendstunde. Aber nichts Schlimmes, es geht vorbei. Sieh nur, Allmei läuft munter weiter. Also braucht man sich keine großen Sorgen zu machen … Und da – eine Karo vier, naja, wollen mal sehen, was die will. Und da kommt auch schon der Herzbube, ein junger Mann. Na, wenn das man nicht eine nette Angelegenheit wird, zumal das As ganz in der Nähe liegt …«
Die Besucherin ist über eine solche Aussage sichtlich erfreut. Sie schöpft neues Selbstvertrauen, auch wenn ihr Leben bisher hart und eher unerfreulich gewesen war.
Zum Abschied gibt es stets ein kleines Geschenk, denn Geld nimmt Truda nicht an. Sie traut keiner Währung mehr.
»Jeld? Mit Jeld haben alle Probleme angefangen«, sagt sie, »nee, nee, da hängt ein Fluch dran, damit will ich nix zu tun haben. Jeld hat schon manchen verdorben.«
Aber andere Dinge nimmt sie gerne entgegen, ein halbes Stück Butter etwa, ein Säckchen Mehl oder ein frisch gebackenes Brot.
Ab und zu darf ich bei den Seancen dabei sein, allerdings spielend und in gebührendem Abstand, um die Behandlungen nicht zu stören.
Einmal kommt eine Bäuerin mit ihrem erbärmlich plärrenden Kind auf dem Arm. Gesicht und Oberarme des kleinen Mädchens sind von zahlreichen Wespenstichen angeschwollen.
»Die Kinder haben gespielt und Zuckerwasser getrunken … Jesses, da ist es auch schon passiert. Ein ganzer Schwarm Wespen ist über Irma hergefallen. Und jetzt? Wie furchtbar. Was soll ich nur tun?«
»Ist halb so schlimm, wie es aussieht«, beruhigt Truda und nimmt das weinende Bündel Unglück zu sich auf den Schoß. Sie beginnt leise zu singen und wiegt das Kind, als seien ihre Arme eine Schaukel. Zwischendurch spuckt sie auf die Finger ihrer rechten Hand und tupft das Gesabber auf die Wespenstiche. Sie lässt den Zeigefinger kreisen und drückt dann die rot geschwollenen Hügel einfach weg, einen nach dem anderen, bis außer einer Rötung der Haut nichts weiter zu sehen ist. Auf rätselhafte Weise sind alle Stiche verschwunden. Irma schluckt noch ein paarmal heftig auf, dann will sie zu Mama und bleibt still. Die Tränen sind versiegt.
»Jesses, wie haben Sie das nur gemacht?«, wundert sich die Bauersfrau, erfreut und erleichtert. »Das ist ja alles weg, und dann so schnell? Wie soll ich euch das bloß danken?«
»Ist schon gut«, sagt Truda und erklärt, dass in diesem Anfangsstadium Wespenstiche noch nicht so schlimm sind. Man kann die Schwellung umkehren und nach innen lenken, wo sie sich auflöst. »Noch ein bisschen Ringelblumensalbe drauf und für den Rest sorgt die Natur.«
Als die Beiden abziehen, ruft Truda ihnen nach: »Und auch viel trinken. Bloß kein Zuckerwasser mehr, sonst passiert’s wieder!«
Ein anderes Mal erlebe ich eine ältere Frau, deren Knöchel und Beine unförmig angeschwollen sind und partout nicht ihre ursprüngliche Form zurückgewinnen wollen. Da gibt es nach dem Kartenlegen (diesmal ein schnelles Hexenkreuz mit kurzer Antwort) einen lindernden Verband aus breitblättrigem Spitzwegerich.
»Geh und hol uns davon«, wendet sich Truda an mich, der ich die ganze Zeit über abwartend dabeisitze und für den Einsatz bereit bin. »Du weißt schon, wo er wächst. Geh und bring uns fünf Pflanzen, aber nur sattgrüne mit saftigen Blättern.«
Ich sause los und finde alsbald die bekannte Stelle. Ich ernte die Pflanzen und renne zurück, damit sie frisch bleiben. Bei den dicken Beinen angekommen, muss ich Truda helfen, fachgerecht den Heilverband mit weißem Mulltuch zu wickeln und anzulegen. Das ist harte Arbeit, denn der Verband muss fest anliegen, darf aber nicht abschnüren und die Durchblutung verhindern.
»Eine Woche dranlassen«, sagt Truda mit gepresster Stimme, weil ihr das Atmen in der Hocke schwerfällt, »dann kommen Sie wieder, und wenn’s dann noch nich besser is, machen wir einen neuen.«
Die Frau nickt wortlos, ergeben, lässt ein Fläschchen Wacholderschnaps da (von ihrem Mann selbst gebrannt) und macht sich humpelnd auf den Rückweg.
Wieder ein anderes Mal kommt ein todtraurig aussehender Mann zu uns, der hat ein Bein im Krieg verloren und kämpft sich mühsam mit seiner Holzkrücke den Berg hoch zu unserem Haus. Er schwitzt und zittert vor Anstrengung, als er den Hof erreicht. Sein Blick ist unstet, wirkt gehetzt, und die tief in sein Gesicht gefurchten Falten verraten, dass ihm schon viel Hässliches im Leben passiert ist.
Truda begrüßt den Gast höflich und weist mich an, den einzigen Stuhl aus der Hütte, Mudris Stuhl, für ihn zu holen, damit er sich hinsetzen kann. Vom niedrigen Schemel würde er wohl nie wieder hochkommen. Ich bringe den Stuhl, und der Mann lässt sich stöhnend nieder, streckt sein verbliebenes Bein aus, während der Platz für das andere, nicht mehr vorhandene, leer bleibt. Es sieht seltsam aus, wie er so dasitzt, dieses gerüttelte Maß an Unglück, es erschreckt mich so sehr, dass ich kaum wage, beim Spielen den Kopf zu heben und in seine Richtung zu blicken.
Die obligatorischen Karten kommen zum Einsatz. Truda reicht sie ihm und weist ihn an, sie sorgfältig mit der linken Hand zu mischen und sich dabei genau auf die Frage zu konzentrieren, mit der er hergekommen sei. Großmutter nimmt ihm danach die Karten ab, legt sie aus und beginnt murmelnd mit der Befragung. Diesmal läuft kein keckes Huhn über das ausgelegte Muster.
Die Beiden unterhalten sich leise, fast flüsternd, so dass ich kein Wort von der Unterredung verstehe. Ich habe erwartet, dass meine Großmutter angesichts des fehlenden Beins ernst oder traurig mitfühlend reagiert. Aber das glatte Gegenteil ist der Fall: Während sie Karte um Karte deutet und den Zusammenhang zu den übrigen klärt, fängt sie plötzlich an zu singen. Zu meiner Überraschung ein freches Lied, ein Gassenhauer mit frivolem Refrain.
Der Mann reagiert zunächst irritiert und erstaunt. Mit halb offen stehendem Mund hört er zu. Auch er hat ein solches Lied, zumal in dieser Situation, nicht erwartet. Aber dann breitet sich zaghaft ein Lächeln über sein Gesicht aus. Er wirkt plötzlich jünger, und sein Blick verliert langsam den verstörten Ausdruck.
Trudas Gesang endet. Sie sitzen sich schweigend gegenüber. Ich blicke gebannt auf die Szene und erwarte ein Wunder. Wächst sein fehlendes Bein nach? Besitzt Großmutter die Macht, ein solches Wunder zu bewirken? Ich traue es ihr zu, starre ununterbrochen auf das abgeschnittene und lose baumelnde Hosenteil, in dem sich wohl der Stumpf verbirgt. Aber es passiert nichts. Stattdessen steht Truda auf, geht zum Stuhl und beugt sich über den Mann. Ich sehe, wie sie mit beiden Händen seinen Kopf packt und sanft zu schaukeln beginnt. Dabei murmelt sie leise Sätze in ihrer Geheimsprache. Das geht eine Weile so, bis sie innehält und sich völlig überraschend zu ihm niederbeugt und seine Stirn küsst.
Mir kommt das alles seltsam vor, diese intime Geste, und dabei kennt sie den Mann doch gar nicht. Er ist ein Fremder, ein Rat suchender Gast, mehr nicht. Aber ich springe sofort auf, als Truda mich ruft, und helfe ihr, den Mann von seinem Stuhl hochzuhieven. Als er aufrecht steht, noch immer auf Truda gestützt, reiche ich ihm die Krücke.
»Danke, Kleiner«, sagt der Mann mit belegter, heiserer Stimme. Seine Augen lächeln noch immer.
Bevor er uns verlässt, zieht er noch umständlich eine braune Tüte aus seiner Jackentasche, reicht sie meiner Großmutter und bittet sie, das Papier zu öffnen. Was sie auch tut, denn sie will sichergehen, dass sich darin kein Geld befindet. Es ist auch kein Geld, sondern ein kleines Bild, ein Aquarell, das eine verschneite Winterlandschaft mit Tannen und einer Holzhütte ähnlich der unseren zeigt.
»Habe ich selbst gemacht«, sagt der Mann, »mehr habe ich nicht.«
»Ach, ist das wunderschön!«, ruft Truda aus und klatscht beide Hände vor dem Kopf zusammen. Sie ist sichtlich bemüht darum, ihre Rührung zu verbergen. Ich kenne sie gut, ich ahne, was sie fühlt. Ich weiß, dass sie große Freude über das unerwartete Geschenk empfindet und das Bild in unserem Haus an einem besonderen Platz aufhängen wird. Ich weiß, dass ich später oft dieses Bild betrachten und mich fragen werde, wer in der Hütte wohl wohnen könnte. Die Umgebung sieht aus wie hier, es könnte irgendwo im Westerwald sein oder auch in Masuren oder in Russland. Ich weiß, dass sich Mudri ähnlich äußern wird. Er wird es so an der Wand aufhängen, dass er es von seinem Sitzplatz am Esstisch aus sehen kann. »Ich werde es auf feste Pappe aufziehen und einen schönen Rahmen hobeln«, wird er sagen und es auch tun.
Der einbeinige Mann verabschiedet sich und hinkt langsam den Wiesenhang zum Dorf hinunter. Mir aber scheint, dass er die hölzerne Gehhilfe nun etwas müheloser benutzt. Wir blicken ihm lange nach. Als er schon fast außer Sichtweite ist, dreht er sich noch einmal zu uns um und hebt die Hand zum Gruß. Dann verschwindet er hinter dem Hügel.
Ich habe Großmutter nie danach gefragt, was bei dem Treffen wirklich passiert ist.