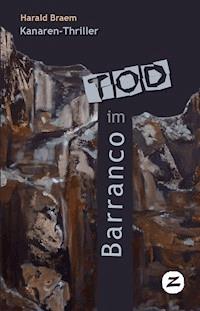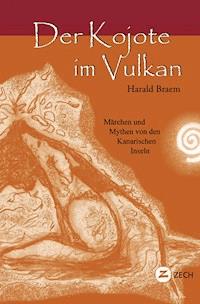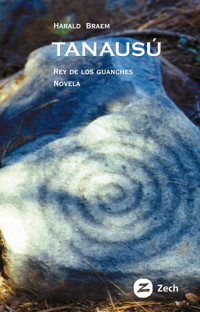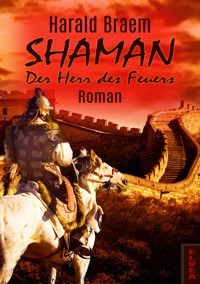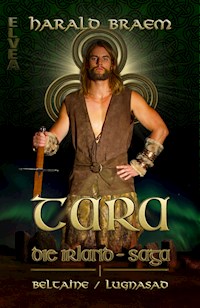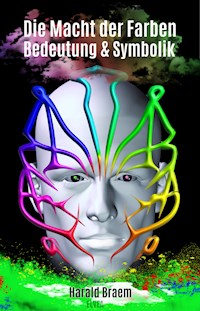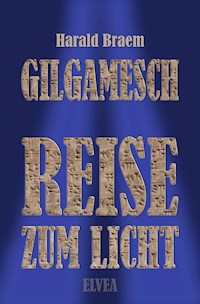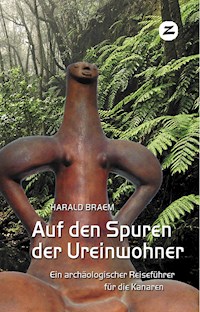6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Elvea
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auf Malta findet die Archäologin Eleonore Zammit in einem unterirdischen Labyrinth uralte Papyrusrollen. Sie sind mit ägyptischen Hieroglyphen bemalt und stammen offenbar von Atlantis. Eleonore Zammit und ein Team von Wissenschaftlern versuchen auf unterschiedliche Weise, den Inhalt der Papyri zu entschlüsseln. Welche Rolle spielt dabei der Ägypter Dr. Salek? Und warum ist der Journalist Danielo Mostar hinter einem geheimnisvollen Suchtrupp her, der das Gelände durchforscht? Schauplätze des Romans sind die magisch-mystischen Orte der Megalithkultur, u. a. Stonehenge, die Bretagne, Irland, und die Inseln und Küsten des Mittelmeers. Er schildert den Untergang des Atlantischen Reiches. Ein fantastisches Roadmovie zur See durch die Welt vor dreieinhalbtausend Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Harald Braem
Die Atlantis-Botschaft
Historischer Fantasy-Roman
Impressum
www.elveaverlag.de
Kontakt: [email protected]
© ELVEA 2020
Chemnitz/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf, auch teilweise,
nur mit Genehmigung des Verlages
weitergegeben werden.
Autor: Harald Braem
Titelbilder:Mikhail Dudarev
Dmytro Tolokonov
Małgorzata Duvendack
Covergestaltung/Grafik: ELVEA
Layout: Uwe Köhl
Projektleitung
www.bookunit.de
Was sind wir Menschen denn anderes als Tiere,
gefangen in den Echokammern der Zeit …
(frei aus der Gedankencloud nach einem unbekannten Denker zitiert)
Der Autor
Harald Braem, geboren 1944 in Berlin, war Professor für Kommunikation und Design an der Fachhochschule Wiesbaden und lebt heute in Nierstein am Rhein und auf der Kanareninsel La Palma.
Jüngste Veröffentlichung: ›Die abenteuerlichen Reisen des Juan G.‹ im Elvea Verlag 2020.
Weitere Informationen: www.haraldbraem.de
1
Malta, in einem Höhlensystem unterhalb von La Valletta
Es ist warm, staubig und bedrückend eng hier unten. Die Luft scheint zu stehen. Im Schein der Stirnlampe tanzen winzige Partikel vor den Augen. Zweimal hat sie sich bereits beim Hineinkriechen an der niedrigen Decke gestoßen. Sie hasst Schutzhelme, weil sie darunter immer so schwitzt und sich wie eine Astronautin vorkommt. Sie nimmt lieber mal kleinere Kratzer und Schrammen in Kauf. Das gehört nun einmal zu ihrem Beruf. Aber diesmal sind es nicht die blöden Stöße an die Decke. Ihre Migräne scheint wieder im Anmarsch zu sein. Und das ausgerechnet jetzt, in dieser klaustrophobischen Situation … Sie kennt die Vorzeichen genau: zunehmender Druck im Schädel, der mitunter schwindelig macht. Dann das erste, unerwartete Stechen, nur in der linken Kopfhälfte, ein Schmerz, der, wie der Stich des Tentakels einer giftigen Feuerqualle, in ihr Bewusstsein greift. Dumpf, von hinten kommend, wie ein greller Blitz nach vorn durch bis zur Nasenwurzel. Zum Glück hat sie ihre Tabletten dabei. Sie trägt sie immer bei sich, in der rechten Außentasche ihrer Cargohose, und manchmal helfen sie wirklich. Aber sie muss sich vorsehen. Sie ist schließlich nicht mehr die Jüngste.
Eleonore, oder besser, Dr. Eleonore Zammit, ist siebzig und emeritierte Professorin der Università ta' Malta in Valletta. Sie ist klein, dünn, um nicht zu sagen spindeldürr, von zäher Konstitution. Kurz geschnittene, drahtige graue Haare umrahmen ein kantiges Gesicht. Sie ist solo, hat in ihrem Leben keine länger anhaltenden Liebesbeziehungen erlebt und dieses Thema irgendwann entschlossen ad acta gelegt. Sie hat auch keine Kinder; ihre Kinder sind die Bücher, die sie zur rätselhaften Tempelkultur ihrer Vorfahren schrieb. Viele Bände, die im hintersten Winkel des archäologischen Fachbereichs, wo man ihr ein winziges Studierzimmer samt Schreibtisch und Computer überlassen hat, die halbe Schrankwand füllen. Forschen und Schreiben, das ist ihr Leben, Feldforschung draußen und das Verfassen, Korrigieren, Überarbeiten tausender Manuskriptseiten in der muffigen Abstellkammer, die, wegen der düsteren Atmosphäre, die in jedem Winkel des Raumes hockt, außer ihr niemand zu betreten wagt.
Eleonore ist ein Arbeitstier, sie hat sich in all den Jahren kaum eine Pause geschweige denn einen sinnlosen Urlaub gegönnt. Wenn sie erst einmal einem Gedanken oder Hinweis auf der Spur ist, ist sie nicht mehr zu bremsen. Das bekommt ihr gut. Bis auf die unregelmäßig auftretenden Migräneattacken ist sie einigermaßen gesund und in der Regel hellwach (abgesehen von einzelnen Phasen, in denen sie etwas zu viel dem Rotwein zuneigt). Sie denkt nur in Projekten, Epochen und Zeitfenstern. Living on the magic line nennt sie diesen Zustand, der sie ohne Drogen und Stimmungsaufheller glücklich macht. Und diese Entdeckung hier, tief unter den belebten Häusern und Straßen der Stadt, wo nur die Stille der Ewigkeit herrscht, hat sie von Anfang an euphorisch gemacht.
Vor einem Jahr fing alles ganz harmlos an: Zuerst stürzte ein verlassenes, baufälliges Haus ein, das abgerissen werden sollte, um Platz für neuen Wohnraum zu schaffen (die Bevölkerung Maltas wächst, Wohnungen in der Stadt werden knapp, und die Mieten steigen in astronomische Höhen). Dann legte der Baggerführer einen verborgenen Eingang im Kellergewölbe frei. Da gerade Semesterferien waren und niemand Zeit und Lust hatte, sich darin stören zu lassen, wurde Eleonore beauftragt, dort nach dem Rechten zu sehen.
»Die alte Professorin hat immer Zeit«, hatte der Direktor geäußert, »die kann das mal machen.«
Und so war sie mit dem Taxi zur Baustelle gefahren, hatte sich tagelang mit mürrischen Bauarbeitern durch Schutt und Trümmer gewühlt und schließlich den Eingang zu einem Höhlensystem gefunden, dessen Ausmaße viel größer waren als Anfangs gedacht. In einem hinteren, halb verschütteten Winkel fand sie die Tongefäße, schräg aneinander geschichtet wie in einem Warenlager. Sie waren mit Lehmklumpen versiegelt und zum größten Teil noch gut erhalten. Als sie mit ihrem Schweizer Offiziersmesser (ein Utensil, das sich stets in der linken Außentasche ihrer Cargohose befand) das Lehmsiegel eines bereits rissig zersprungenen Gefäßes aufschnitt und vorsichtig ein paar größere Scherben entfernte, fiel ihr sofort der Inhalt auf: Es waren Papyrusblätter, eng aneinander gerollt, vielleicht an vielen Stellen zusammengebacken, aber auf den ersten Blick hin in einem erstaunlich heilen Zustand.
Eleonore erinnert sich immer wieder an diesen Moment, obgleich er bereits ein Jahr zurückliegt, selbst in ihren Träumen erlebt sie die Szene real, als würde es gerade passieren. Ihr Herz klopft wild, ihre Hände zittern leicht, und die Gedanken in ihrem Kopf beginnen zu wirbeln. Instinktiv fühlt sie, dass sie soeben dabei ist, die größte Entdeckung ihres Lebens zu machen. Spektakulärer noch als der Sensationsfund damals von Hal-Saflieni, wo man vor vielen Jahrzehnten die schlafende Dame im Hypogäum fand. Eine kleine Tonfigur mit unglaublich dicken Körperteilen, die als sleeping lady in kurzer Zeit zu Weltruhm gelangte.
Eleonore Zammit kommt mittlerweile alles wie ein Traum vor. Was macht sie hier unten noch weiter im Labyrinth, wo manche Decken gefährlich bröckelig wirken und in keiner Weise vorschriftsmäßig abgesichert sind? Was sucht sie? Müsste sie nicht eigentlich längst wieder im Yachthafen von Gzira sein, auf dem Hausboot, das dem Computerteam derzeit als Labor und Unterkunft dient?
Aber sie hat ja den Stick dabei, ihren Laptop in der Nähe, eine Etage höher, wo sie zwischen Schuttbergen an einem Campingtisch ihr provisorisches Büro eingerichtet hat, um permanent online zu sein. Sie weiß, dass inzwischen mehrere Versionen der bisher übersetzten Papyrusschriften existieren. Wie bei den Rollen von Qumran. Eine, die sich streng wissenschaftlich an identifizierbaren Bildzeichen und daraus ableitbaren Bedeutungszusammenhängen orientiert, und eine andere, die frei assoziierend auf vergleichbare Algorithmen setzt. Und eine, die mehr auf Eleonores Fantasie und Erzählfreude beruht. So jedenfalls versteht sie den Text, würde ihn nach ihrem Gefühl so interpretieren. Diese Version hat sie auf ihrem Stick gespeichert. Vorerst hält sie sie noch geheim. Außerdem arbeitet sie noch ständig daran. Immer und immer wieder liest sie den Text, in den Pausen und den Nächten, in denen sie wenig Schlaf findet, ergänzt, verbessert, formuliert um und schmückt ihn an bestimmten Stellen nach bestem Wissen und Gewissen aus.
Eleonore Zammit wischt sich den Schweiß von der Stirn, kriecht rückwärts wie ein Wurm aus dem Erdloch, richtet sich mit einem Stöhnen auf. Einen Moment lang steht sie mit geschlossenen Augen leicht schwankend da. Sie wartet auf den Schmerztentakel. Nichts. Nur ein Druck im Schädel, eine leichte Benommenheit. Sie öffnet die Augen und beginnt den Aufstieg über die Leiter aus Metall. Unendlich langsam, mit der Geschwindigkeit eines Chamäleons, klettert sie Stufe um Stufe nach oben. Als sie den Arbeitstisch und den Schemel davor erreicht hat, schiebt sie den Stick ein …
Was für ein Glück, denkt sie, was für ein Glück, dass ausgerechnet dieses alte Haus eingestürzt ist und dass ich als erste informiert worden bin … Mittlerweile liebt sie die Ruine. Sie ist ihr Zuhause geworden. Der Bildschirm leuchtet auf. Sie beugt sich vor, um ohne Brille lesen zu können …
Es ist ein Papyrustext, den sie in mühsamer Kleinarbeit entziffert hat. (Es gibt da noch eine andere, fürchterlich schlecht erhaltene Rolle, die momentan nur aus winzigen Schnipseln besteht, welche sie schon seit vielen Tagen und Nächten auf dem Bildschirm hin- und herschiebt, um einen logischen Zusammenhang zu finden. Doch um den geht es momentan nicht.) Alle anderen Rollen sind inzwischen übersetzt und in die richtige Reihenfolge gebracht und nummeriert, behaupten jedenfalls die Kollegen aus dem Team. Sie ist anderer Meinung. Bei dieser hier muss es sich um die vorletzte Papyrusrolle handeln, davon ist sie fest überzeugt, obwohl die anderen Experten im Team sie für die Nummer eins halten:
2
Ich, Mazdanuzi, Sohn des Merlin von Karnak und der weisen Meri vom Klan der Eulen im geliebten Armorika, Gesandter der Meere, Eingeweihter dritten Grades und Botschafter von Atlantis, ich stehe mit leeren Händen hier, weil ich das Siegel des Hochkönigs beim großen Beben auf der Insel Minos verlor.
Ich richte meine Rede auch nicht wie sonst an Adlige, Generäle und Hohepriester, sondern nur an meinen Diener Haremtab, damit er ein letztes Protokoll anfertigt.
Ich, Mazdanuzi, bin Augenzeuge geworden vom Untergang unseres Reiches, ich sah das Imperium wanken, bersten und sinken, die einst so stolze und gefürchtete Großmacht der Meere, Inseln und Küsten im Erdkreis. Ich spüre das Land unter mir beben und bin schutzlos ausgeliefert, weil wir kein Schiff besitzen, nicht einmal ein winziges Schilfboot mit Segel, um zu entkommen. Wohin auch sollten wir uns wenden?
Nun, in der Stunde der größten Not, vertraue ich das gesamte Wissen meinem Schreibsekretär an, der mir treu ergeben und ein gebildeter Mensch ist. Haremtab stammt aus der Nilprovinz des Falken-Klans, beherrscht beide Sprachen fließend, unsere und die der dunkelhäutigen Ureinwohner, und versteht es, sie in den Zeichen der geheimen Schrift mit raschen Pinselstrichen auf Papyrus zu malen. Ich hoffe, dass er alles umsetzt, was ich ihm sage, dass er die Bilder gut darstellen wird, auch komplexe Gedankengänge und Schilderungen in Hieroglyphen bannt. Vor allem aber hoffe ich, dass er so schnell schreiben kann, wie ich spreche. Ich habe keine andere Wahl, ich muss es auf diese Weise versuchen, denn es bleibt nur noch wenig Zeit, um über alles, was von Belang sein könnte, genau zu berichten. Diese Niederschrift wird wahrscheinlich meine letzte Botschaft sein …
Unaufhaltsam versinkt Atlantis in den Fluten des Meeres, unter Asche und Lava, in Feuer und Sturm, als hätten sich alle Elemente gleichzeitig gegen uns verschworen. Die Gewalten der Natur, die wir so kühn herausforderten, um sie in unsere Dienste zu zwingen, sie erheben sich nun auf furchtbare Weise.
Die letzten Jahre wurden von Katastrophen erschüttert. Die Vulkane Etna und Thera auf den Inseln im Meer der Mitte barsten auseinander, ebenso der mächtige Hermon an der waldreichen Küste nördlich der Nilprovinz, die vom Klan des Phoenix besiedelt wird. Die Berge spien giftige Nebel aus und sandten Feuer, die alles Leben im weiten Umkreis verbrannten. Mancherorts erblickte ich Stätten des Grauens, vernichtete Tempel und Städte, die vormals als berühmte Zentren des Handels galten. Dort strichen Schakale auf der Suche nach Beute herum, die sie reichlich im Leichenfeld fanden, Seuchen bringende Wesen der Unterwelt, sie dienen dem Tod.
Nichts mehr gewahrte ich von den Palästen, den befestigten Häfen, den Schiffen, der großen Flotte, die bisher Garant unseres Wohlstands waren. Das Meer indes sah ich wütend kochen und Wellen sich hoch zu Bergen wölben. Mehrfach entkam ich nur knapp dem Tod, bis endlich unser Schiff an den Klippen dieser Insel zerschellte, die den Namen Malta trägt, was in der alten Sprache Nabel der Welt bedeutet. Einzig Haremtab und ich blieben von der Besatzung am Leben.
Wir fanden Malta verlassen vor, die Insel der hundert Tempel, und nirgends Anzeichen von Kampf. Das wundert uns sehr, denn es muss ein großes Volk gewesen sein, das am Nabel der Welt lebte, nach meiner Schätzung mehrere tausend Menschen umfassend. Allesamt sind sie weg, wie vom Erdboden verschluckt. Doch ihre Tempel, die sie mit riesigen Steinquadern erbauten, stehen unversehrt, und in den heiligen Stätten unter der Erde ruhen nur die Gebeine der Vorfahren sorgsam bestattet. Also müssen sie wohl Schiffe gebaut haben, Schilf in Massen geschnitten, viele große Boote mit Seitenrudern und Segeln. Sie verschwanden alle auf einen Schlag und ließen keinerlei Nachricht zurück. Wie sollten sie auch ahnen, dass unser Schiff an den Klippen zerschellte? Vielleicht sind sie in dem Toben des aufgewühlten Meeres entkommen. Falls nicht, dann werden Haremtab und ich wohl die letzten Menschen in weitem Umkreis sein. Eine Vorstellung, die mir Unbehagen bereitet und die ich deshalb von mir dränge. Nein, es wird, es muss Überlebende geben! An sie ist die letzte Botschaft gerichtet.
Ich kann nur über das berichten, was ich mit eigenen Augen sah und mit meinen Ohren hörte, was ich an Schrecknissen fühlte und nie mehr vergessen kann, denn es hat sich tief in mein Herz eingebrannt. Auch in meinen Träumen erlebe ich noch einmal das Unheil, so dass ich vermeide zu schlafen, obgleich ich unendlich müde bin. Das viele Wissen belastet mich schwer. Ich weiß: Mächtiger als die Götter sind die Feuer der Vulkane und die Macht des Meeres. Das haben wir schon immer geahnt und aus diesem Grunde Pyramiden gebaut. Auf den meisten Inseln im Meer der Mitte, auf Minos, Thera, am Fuße des Hermon, selbst auf den glücklichen Inseln der ewigen Jugend. In Armorika beobachteten wir von den Pyramiden aus den Himmel und die Meere und kontrollierten die Seefahrt, ebenso auf der Grünen Insel, in Dana, Wasa und Avalon. Auch am Ufer des Nils wurde, wie ich bei meinen Reisen feststellen konnte, in der südlichen Provinz von General Osiris eine Pyramide gebaut, obwohl dort weder Vulkane noch Meer sind, sondern nur endlose Wüste. Wir spähten zum nächtlichen Himmel, um Karten für die Seefahrt zu zeichnen, wir schufen einen Kalender, teilten die Zeit ein und lebten danach, wir kannten den ewigen Rhythmus der Meere, den Atem des Windes und die Unberechenbarkeit der feuerspeienden Berge. Wir wissen, wie gefährlich launisch die Natur sein kann. Aber es ist nicht die Wut der Naturelemente allein, die Atlantis zerstört und seine Trümmer in Vergessenheit sinken lässt, nicht die berstende Erde, die Feuer der Vulkane, das tobend tanzende Meer. All diese Katastrophen, so schlimm sie auch sind, betrachte ich nur als Begleitmusik einer Macht, die weitaus größer und gefährlicher ist. Die endgültige Vernichtung traf uns plötzlich und völlig unerwartet als wütender Sturm aus dem Osten. Einer gewaltigen, alles verschlingenden Flutwelle gleich schlug er in unsere Welt, riss ganze Völker mit sich und warf sie in rasende Schlachten, tausend mal tausend Reiter aus den Steppen und hinter ihnen tausendfach mehr, so dass die Erde unter den Hufen ihrer Pferde erbebte. Dieses ständig anwachsende Beben kann die Ursache sein für die Risse im Boden, das Bersten der Feuerberge, die wilden Flutwellen im Meer …
Wir wissen ja, wie Rhythmus die gesamte Natur bestimmt, speziell die Musik, wenn zum Beispiel unsere Zauberer manchmal die Trommeln schlagen, um Ewigkeit zu erzeugen. Man stelle sich dieses um ein Vielfaches stärker vor und von längerer Dauer. Unglaublich groß muss die Zahl der Menschen im Osten sein, unglaublich groß die Anzahl ihrer Pferde. Sie kamen schneller, als die Schiffe die Gefahr melden konnten, und sie kamen – womit niemand gerechnet hatte – über Land! Reitend überfielen sie das Reich, brandschatzend und plündernd fast gleichzeitig alle Länder und Städte der Atlantischen Union, und vernichteten in wildem Rasen, was das Meer in seinem Wüten bisher noch verschont hatte. Viele Pyramiden und Tempel wurden unter Erd- und Steinhaufen begraben, heilige Plätze unserer Ahnen zugeschüttet, denn alles, was später einmal an uns erinnern könnte, soll ausgelöscht werden. Was unsichtbar ist, verliert nach und nach an Bedeutung.
Bald gibt es Atlantis nicht mehr, nicht weil unsere Heere vernichtet wurden, sondern weil unsere Symbole verschwinden, unsere Tempelberge und Pyramiden, die Plätze der Kraft, die das Imperium im Bewusstsein seiner Bewohner geistig zusammenhielt. Menschen fremder Rassen werden dann in den Mauerresten unserer Städte hausen, die neue Götterfiguren über den Ruinen und Geisterorten aufstellen und anbeten. Was aber das Schlimmste ist – sie werden Menschenopfer an unseren alten, heiligen Plätzen fordern. Wie man hört, sind sie nahezu vernarrt in diese Sitte. Im Namen ihrer zornigen Götter töten sie ihre Gefangenen, manchmal, im religiösen Wahnsinn, sogar sich selbst oder symbolisch die eigenen Götter, indem sie deren Söhne und Töchter auf Erden hinmetzeln. In dieser Hinsicht ähneln sie sehr den Schakalen, denn gleich ihnen dienen auch sie dem Tod.
Wir fragen uns Beide, Haremtab und ich, Mazdanuzi, die bisher wie durch ein Wunder am Leben blieben: Welche Aufgabe haben wir in einer Welt, die dem Tode geweiht ist? Wie viel Zeit verbleibt uns noch, um im großen Buch der Geschichte ein Kapitel zu schreiben? Was kommt danach, wenn unsere Gebeine verblichen sind, die Spuren im Sande verweht, das Meer wieder ein glatter Spiegel? Wird man sich jemals an uns erinnern, wissen, dass wir einmal lebten, liebten und litten?
Nun, da über unser Schicksal entschieden ist, bleibt mir nur noch, möglichst wahrheitsgetreu zu berichten und diese Botschaft in Maltas heiligem Schoß zu versenken, an einem halbwegs sicheren Ort, wo sie aufbewahrt bleiben kann, bis eine neue, bessere Menschheit sie findet und auch versteht. Deshalb muss alles notiert werden, was von Wichtigkeit ist, damit die Welt nach uns daraus lernen kann. Für sie will ich als Gedächtnis dienen. Wer ohne Gedächtnis ist, gleicht einem Schiff ohne Kurs, treibt sinnlos durchs Leben, das ihm stets wie Nebel und Gedankenspiel erscheint. Ein solcher wird sich nie den Geheimnissen nähern, die unser Schicksal lenken.
Die Erde bebt erneut unter meinen Füßen, schon stürzen Teile der Tempelfassade ein, und Wind peitscht das brodelnde Meer. Wohin man auch blickt, ist nichts mehr sicher, kein Schiff, kein Hafen. Der Sturm heult so laut, dass ich gegen ihn anschreien muss. Haremtab hockt im schützenden Rund großer Steine, bemalt sein mit Kieseln beschwertes Papyrus. Später will er den Text im Innern eines Tonkruges bergen, den wir am Eingang des Gigantentempels fanden. Wir flohen hierher vor dem Sturm, suchten Schutz in den Mauern. Wir werden hier sitzen bleiben bis ans Ende der Zeit, so lange harren, wie unsere Kräfte ausreichen, um die Pflicht zu erfüllen.
Jetzt, da ich diese letzte Nachricht diktiere, fällt ein schmaler Strahl Sonne durchs zerborstene Tempeldach direkt auf meine nackten Füße. Es gibt sie also noch, die Sonne, ein leichter Schimmer von ihr reicht aus, um mich mit Hoffnung zu erfüllen. Solange dieses Licht noch da ist und uns wärmt, werde ich sprechen, wird mein Diener Haremtab schreiben …
3
In den Katakomben unterhalb von La Valletta
Eleonore Zammit reibt sich mit beiden Zeigefingern die Schläfen. Sie hat ihre Tablette genommen und mit einem Rest Tee aus der Thermoskanne hinuntergespült. Vorsichtshalber. Einen Migräneanfall kann sie jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ihn stoppen, bevor er beginnt …
Sie ruft eine andere Datei auf. Die Übersetzung der zweiten Papyrusrolle. Jedenfalls haben sie alle im Team nach längerer Debatte entschieden, dass dieser Text unter der Nummer Zwei geführt werden soll. Der Papyrustext, den sie soeben gelesen hat, könnte auch nach den anderen, fortlaufend nummerierten, entstanden sein und trägt noch ein Fragezeichen. Bei dieser Rolle hat sich Eleonore noch nicht endgültig festgelegt. Wenn sie die letzte Rolle gelesen und eingeordnet hat, wird sie mehr darüber sagen können. Aber da sie eine stur und mit äußerster Selbstdisziplin arbeitende Wissenschaftlerin ist, wendet sie sich noch einmal mit höchster Konzentration dem Papyrus Nr. 2 zu:
4
Meine Laufbahn begann im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Lauf auf einer Bahn. Es geschah im zehnten Jahr meines bisher spielend und träumend in Armorika verbrachten Lebens, dass ich am großen Ritual von Menec teilnehmen durfte, denn es war die Zeit der Sonnenwende. Die langen Steinreihen dort hatte ich stets für die Grabstätten unserer Ahnen gehalten, und das sind sie ja auch, nur weitaus mehr noch: Es sind nämlich Bahnen, die für den Lauf der Sonne bestimmt sind, so konstruiert, dass wir ihnen folgen müssen, wenn wir selbst Sonne werden beim Lauf auf Karnak und Basilea zu, der Hauptstadt und ihrer großen Tempelpyramide, wo das Geheimnis unserer Herkunft aufbewahrt wird.
Als Sohn des Merlin bekam ich die rechte Bahn zugewiesen, direkt neben Osiris, dem Spross des Falken-Klans, der später als General aufbrach, um in der Nilprovinz ein neues Karnak zu errichten. Neben ihm liefen die Kinder anderer Klans, unter ihnen auch ein Sohn des Königs, der in den Jahren der Wirrnis verschwand. An den Rändern der Anlage hatte sich viel Volk versammelt, um uns anzufeuern und zuzujubeln, wenn wir unsere letzten Kräfte mobilisierten, um dahinzustürmen wie die Strahlen der Sonne. Die Familien der Edlen von Atlantis lagerten dort zwischen den einfachen Fischern, Bauern und Viehzüchtern Armorikas, die von allen Stämmen herbeigeströmt waren, um dem seltenen Schauspiel beizuwohnen. Es wurden Wetten abgeschlossen, wer als erster von uns Läufern zum Ziel gelangen würde, wer als Sieger den goldenen Sonnenball hinab zu den Ahnen bringen dürfte, ins tiefe, dunkle Herz der großen Pyramide, damit dort auch die Vorfahren an der warmen Kraft der Sonne teilhaben konnten.
Es war ein früher Morgen, und vom Meer her blies ein kühler, frischer Wind, der uns frösteln ließ. Wir trugen, um besser laufen zu können, nur den Hüftschurz, unsere nackten Oberkörper waren zuvor von den Priestern mit Ockerstaub angemalt worden, damit wir dem rötlichen Glanz des Sonnenlichtes ähnelten. Bei den ersten Steinen von Menec standen wir und warteten auf das Zeichen zum Start. Die Zeremonie zog sich hin, da sich die Sonne an diesem Tag besonders viel Zeit ließ, um sich aus dem Dunst der Frühwolken zu schälen und den Tag zu beginnen. Ein Schwarm Möwen und anderer Meeresvögel kreiste landeinwärts und ließ sich schließlich mit lautem Gekreische auf den Spitzen der Steine nieder, so als wollten auch sie Augenzeugen des Wettkampfs werden. Als endlich das Startzeichen ertönte, das vom Hohepriester auf einem Muschelhorn geblasene Signal, stürmten wir nahezu gleichzeitig los. Ich achtete, mir der besonderen Bedeutung der Stunde bewusst, nicht auf den Lauf der anderen Kinder, sondern nur auf mich und meinen Körper, meinen gleichmäßigen Atem und darauf, dass ich meine Kräfte einteilte, mit gutem Rhythmus lief. Auch wenn ich in diesem Moment nicht wusste, an welcher Stelle der Bahn sich meine Familie unter den Zuschauern befand, wollte ich sie nicht mit einer schlechten Leistung enttäuschen. Wie die Anderen hatte ich Wochen zuvor für den Lauf geübt. Nun galt es, alles, was ich dabei an Technik gelernt hatte, unter Beweis zu stellen. Ich begann nicht zu schnell, lief aber ausdauernd und konnte, als ich den richtigen Bewegungsablauf gefunden und meinen Atem darauf eingestellt hatte, kontinuierlich das Tempo steigern. Die Steinreihen von Menec huschten an mir vorbei wie winkende Schatten, ich fühlte die Sonne im Rücken, und das anfeuernde Geschrei der Menge verriet mir, dass ich mit einem anderen Jungen gleichauf in vorderer Position lag. Ein rascher Seitenblick brachte die Gewissheit, dass es Osiris war. Sein blondes Haar glänzte wie ein Helm aus Gold in der Sonne. Dieser Osiris war ein ernsthafter Gegner für mich, schon damals, als wir kleine Kinder waren und das Leben in Armorika eine nie enden wollende glückselige Zeit für uns alle.
Ich lief mit leicht gesenktem Kopf, um mich zu konzentrieren. Aber als ich einmal den Blick hob, sah ich vor mir die Konturen der großen Pyramide. Mächtig wie ein Bergrücken erhob sie sich aus der Hauptstadt Karnak, ein zum Himmel strebender Gedanke, der weit über die Dächer der Siedlung ragte. Niemals zuvor hatte ich Basilea wie an diesem Morgen erblickt, die wuchtigen Steinmassen der Stufen, die Erdrampen, das gleißende Licht auf der obersten Plattform, das nicht von Gold stammte, sondern aus jenem neuen, kostbaren Material bestand, das die Menschen von Atlantis Oreichalkos nannten. Dieses geschmolzene Bergerz besteht aus einer Mischung von Kupfer und Zinn und wird neuerdings auch Bronze genannt. Das Kupfer wird aus den Gruben des Stier-Klans an der Küste von Mil geschürft, Zinn dagegen stammt von der Insel Avalon. Beides vermischt und in großer Hitze zum Schmelzen gebracht, ergibt ein hartes, honigfarbenes Metall, das in seinem Glanze der Sonne sehr ähnlich ist.
An diesem Morgen schien das Oreichalkos von Basileia besonders stark zu glänzen, so als sei mir die Sonne schon vorausgeeilt und vor uns auf dem Dach der Pyramide angekommen. Dieser Gedankenblitz spornte mich an, noch schneller zu laufen. Aber gleich mir muss es auch Osiris passiert sein, denn er blieb beständig auf gleichem Abstand zu mir. Das Geschrei der Menge nahm zu, als wollten sie einen von uns beiden anstacheln, noch mehr als das Äußerste in den Lauf zu geben. Mein Körper dampfte bereits, und mein Herz schlug wie eine dumpfe Trommel. An den letzten Steinen von Karnak, dort, wo die Anlage endet, hatten Priester ein Band aus geflochtenem Frauenhaar über die Bahn gespannt. Osiris und ich durchtrennten es gleichzeitig mit unseren Oberkörpern. Jetzt brach erst recht lauter Jubel aus, denn einen Doppelsieg hatte es lange nicht mehr in Menec gegeben. Ein gutes Omen war dies, ein viel versprechender Hinweis auf unseren späteren Lebensweg und auch darauf, dass unsere Geschicke von diesem Moment an für immer verbunden waren.
Drei solcher unsichtbarer Nabelschnüre gibt es, die unser Schicksal ein Leben lang bestimmen: Die eine bindet uns an die Mutter, auch wenn wir sie viele Jahre nicht sehen oder sie längst ins Reich der Ahnen eingekehrt ist wie die gute, weise Meri vom Klan der Eulen. Die zweite ist das Meer, von dem wir alle abstammen und das wir nie, auch nach langem Aufenthalt auf festem Land, vergessen können. Die dritte Nabelschnur aber knüpft Schicksale zusammen, ob wir das wollen oder nicht, verbindet Leben auf nachhaltige Weise, sei es in der Liebe oder bei solch einem Sonnenlauf wie damals in Menec.
Mehr noch als sonst üblich wurde daher unser Doppelsieg in Karnak gefeiert. Und von einer Sekunde zur anderen veränderte sich damit unser beider Leben. Der Sonnenlauf hatte uns in das Blickfeld gerückt, mit einem Mal wurden wir in die Welt der Erwachsenen aufgenommen und plötzlich wie solche behandelt. Mein Oheim, der Priester des Tempels der Inschriften auf der von drei Flüssen umspülten Insel war, eilte auf mich zu, um mich in seine Arme zu schließen. Nachdem er das gleiche mit Osiris getan und uns Segenswünsche mitgegeben hatte an die Ahnen im Herz der großen Pyramide, die wir noch am selben Tag besuchen würden, raunte er uns noch mit geheimnisvoller Miene zu, dass wir uns bald schon, nämlich am kommenden Vollmond, im Tempel der Inschriften wiedersähen, wo uns ein großes Geheimnis erwarten würde.
Erschöpft von dem anstrengenden Lauf, von jubelnden Menschen hin- und hergeschoben, auf Schultern gehoben und lautstark gepriesen, folgten wir nun den geistlichen Würdenträgern, die sich mit uns einen Weg durch die Menge bahnten. Durch die Straßen von Karnak führte der Zug, vorbei an festlich geschmückten Häusern, hinauf zur Anhöhe von Basilea und den Stufen der großen Pyramide. Aber nicht wie gewöhnlich über Erdrampen ging unser Weg, um auf der obersten Plattform den Göttern Freudenfeuer und Weihrauch zu opfern, sondern an der unteren Böschung entlang bis zu einem Tor, das durch einen gewaltigen Steinquader verschlossen war. Hier hielten wir mit unseren Begleitern an und warteten, bis mehrere Männer in gemeinsamer Anstrengung den Stein beiseite schoben. Ein raffinierter Mechanismus erleichterte ihnen die Arbeit, dennoch mussten sie sich kräftig gegen die Felsplatte stemmen, bis endlich ein passierbarer Spalt im Berg offen entstand.
Die Priester traten als erste ein und machten Osiris und mir, die wir zögernd und abwartend am Eingang zurückblieben, Zeichen, ihnen zu folgen. Wir stiegen in einen schmalen Schacht, der schräg nach unten ins Innere der Erde führte. Schwach leuchtete der Schein der Fackeln den Gang nur aus, so dass wir, vorsichtig die Schritte wählend, hinter den Priestern her tappten. Mehrmals sprang die Richtung des Ganges um, allmählich verloren wir völlig die Orientierung. Nach der kühlen, muffigen Luft zu urteilen, mussten wir uns bereits tief unter dem Zentrum der Pyramide befinden. Wir schritten stumm und in Ehrfurcht voran, wohl wissend, dass es den Wenigsten nur vergönnt war, und dann auch nur einmal im Leben, dem geheimnisvollen Herz von Basilea nahezukommen. Der Weg hinab in die Tiefe der Erde schien niemals zu enden.
Schließlich aber stockte unsere Prozession so überraschend, dass ich in den Rücken des vor mir schreitenden Priesters prallte. Er drehte sich mit ernstem Gesicht um und wies uns mit Zeichen an zu schweigen. Von nun an wurde weder gesprochen, noch etwas von dem erklärt, was geschah. Ich kann mich nur noch an das erinnern, was ich sah, und hoffe, dass ich die Zusammenhänge richtig interpretiere. Auch heute, nach so vielen Jahren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damals alles verstand.
Zunächst zeigte man uns die Grabkammern der Ahnen, die allerdings durch Steintüren verschlossen waren. In ihnen ruhten die durch medizinische Kunst wohl präparierten Körper der königlichen Familien früherer Zeiten in ewigem Schlaf. Die Überlieferung sagt aber, dass sie eines Tages aus diesem Schlaf erwachen und zu neuem Leben aufsteigen werden. Dies betrifft ihre Körper. Ihre Seelen wandern indes schon jetzt, im Zyklus der Sonne nämlich, besonders zu deren Wenden. Da diese Wanderungen ohne Körper beschwerlich sind, brauchen sie regelmäßig Nahrung, die von den Priestern vor den Grabkammern abgestellt wird. Ich hörte, dass viele Ahnen von den dargebrachten Gaben nichts annehmen würden, weshalb die Priester die Speisen und Getränke an ihrer statt verzehren müssen. Wichtiger noch als diese direkten, greifbaren Dinge sollen aber die unsichtbaren Geschenke sein, die den Ahnen im Kult angeboten werden, vor allem das lebensspendende Licht und die heilende Wärme der Sonne, weshalb einer der Priester auch eine im Fackelschein glänzende Kugel aus Oreichalkos mit sich trug. Dieses kostbare Bergerz, durch unseren von einem Doppelsieg gekrönten Sonnenlauf zusätzlich mit Bedeutung aufgeladen, wurde nun vorsichtig im Zentrum der Halle vor den Grabkammern abgelegt.
Wir starrten gebannt die Kugel an und glaubten nach einer Weile wahrzunehmen, dass sie sich im Rhythmus unseres Atems bewegte, als würde sie selber atmen. Auch schien sie, je länger wir sie im Blick behielten, in ihrer Größe zu wachsen, was eigentlich völlig unmöglich ist. Doch war ich mir damals und bin mir heute erst recht nicht mehr sicher, ob dem nicht doch so war. Hier im Herzen von Basilea schienen andere Gesetze als sonst in der Natur draußen zu herrschen. Nach längerer Andacht wies uns schließlich der Hohepriester an, ihm in einen weiteren Gang zu folgen, der von der Halle abzweigte. Nur Osiris und ich sowie zwei weitere Priester durften ihm nachgehen, als er uns zu einer zweiten Halle führte, die hinter den Grabkammern lag. Hier erhellte das tanzende Licht der Fackel eine sonderbare Szenerie. Neben Beilen und Äxten aus edlem Gestein, einer Schale mit geschliffenen, glänzenden Perlen und vielerlei Gerätschaften, deren Verwendungszweck mir weder damals einleuchteten noch heute, lagen im hintersten Winkel vermoderte Hölzer, Teile von Bastmatten und Tuch. Heute weiß ich, dass es die Reste eines uralten Schiffes waren. Wenn mein Oheim im Tempel der Inschriften die Wahrheit sagte – und ich habe keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln –, so müssen das die letzten Überreste jenes Schiffes gewesen sein, mit dem der erste König unseres Volkes, der legendäre Atlas mit seinem Klan, an der Küste von Armorika landete, um Karnak zu erbauen und die viele Inseln und Länder umfassende Union zu gründen. Woher dieser König und seine Gefolgschaft kamen, weiß niemand mehr, denn es liegt mehr als tausend Jahre zurück, und das Erinnerungsvermögen der Menschen gleicht einer Steinlampe, deren Talgfüllung und Docht langsam verbrennen. Danach herrscht nur noch Dunkelheit.
5
Von jenem denkwürdigen Tag an waren Osiris und ich unzertrennbar, jedenfalls eine Zeit lang. Wir unternahmen alles gemeinsam und fieberten dem nahenden Vollmond entgegen. Als der Zeitpunkt endlich erreicht war, übereignete uns mein Vater ein kleines, wendiges Boot. Es bestand aus fellüberspannten Holzplanken und besaß einen Mast mit Segel. Mit ihm fuhren wir in der Nacht die Küste entlang in südliche Richtung. Osiris saß am Seitenruder, ich bediente das Segel, Tätigkeiten, die uns wohlbekannt waren, denn allen Menschen von Armorika ist die Seefahrt von Kind an vertraut. Die Nacht war hell und sternenklar, und es ging eine leichte Brise, die uns rasch vorantrieb. Es fiel uns nicht schwer, uns zu orientieren, wir brauchten nur die Landmarken an der Küste zu zählen – große, im Boden verankerte Steine gleich denen von Menec. Im Unterschied zu diesen stellten sie aber keine Grabmale dar, sondern dienten ausschließlich der Seefahrt. Als wir nach etwa einer Stunde den größten von ihnen erspähten, wussten wir, dass wir nun bald unser Ziel erreichen würden. Zunächst bogen wir an einer markanten Landspitze scharf nach links ab und erreichten eine tiefe Fahrrinne zwischen hohen Ufern. Sie war künstlich ins Erdreich geschnitten, um auch für große Schiffe die Insel Kerne vom Meer aus erreichbar zu machen. Auf Kerne lag der Tempel der Inschriften. Die Insel befand sich dicht am Auray-Fluss, war aber von einer Vielzahl kleinerer Inseln umgeben, die einen Ring um Kerne bildeten. Hielt man sich rechts, so ließ sich bequem der geschützte Hafen erreichen, in dem zu jeder Zeit des Jahres größere Schiffe lagen, Transportschilfboote zumeist, aber auch hölzerne Drachenboote, die schnell wie der Wind über die Wellen glitten.
Wir kannten das Gebiet rings um die Hafenanlage gut, waren unzählige Male bereits an den Docks entlanggestrichen, um den Zimmerleuten bei der Arbeit zuzusehen. Auch das Gelände, an dem geschnittenes Schilf gelagert wurde, zu Bündeln verschnürt und seetüchtig verknotet. Solche Schilfboote mit hochgespanntem Bug und Heck waren praktisch unsinkbar, denn sie lagen trotz schwerster Beladung stets auf dem Wasser, ohne tief einzutauchen. Auf See spülten die Wogen über das Deck, unter den Aufbauten für die Mannschaft und die sorgsam verzurrten Waren einfach hindurch. Mit dieser Art Schiffe wurde von Avalon Zinn geholt und zur Weiterverarbeitung nach Süden gebracht, nach Gades und Mil, wo es Kupfer gab und die Werkstätten für die Schmelze lagen.
Oft hatte ich in Begleitung meines Vaters und anderer Familienmitglieder dem Be- und Entladen der Schiffe zugesehen, die aus fernen Ländern eintrafen. Die gesamte Macht von Atlantis beruhte auf Handel, die Leute der verschiedenen Kulturen kamen weit herum und konnten, wenn sie bei Kerne oder Karnak an Land gingen, oft erstaunliche Dinge berichten. Und alles, was sie erzählten, spornte die Fantasie an, verstärkte die Sehnsucht, gleich ihnen über die Meere zu reisen. Den Menschen von Armorika, der gesamten Atlantischen Union, liegt es im Blut, wir können und wollen nicht anders, wir alle sind Kinder der See.
Den Hafen kannten Osiris und ich also gut. Unbekannt war uns dagegen die Insel Lannic, die gewöhnliche Menschen nicht betreten dürfen, weil sie dem Gott der Meere geweiht ist und ausschließlich von Priestern aufgesucht wird. Im doppelten Steinkreis dort werden zu bestimmten Zeiten des Jahres Stiere geopfert, und selbst Adligen ist es untersagt, den geheimen Zeremonien beizuwohnen. Die einzige Ausnahme bildete mein Vater, dem als Merlin von Karnak die Pflicht oblag, den Ritus zu leiten. Aber soweit ich mich erinnere, sprach er zuhause bei uns kein einziges Wort darüber, was auf Lannic geschah.
Hinter diesem kleinen Eiland lag nun, durch eine weitere Fahrrinne erreichbar, die Insel Kerne mit dem Tempel der Inschriften. Wir trieben ohne Segel dahin, da der Wind sich zum Schlaf gelegt hatte, benutzten stattdessen die Ruder und erreichten ohne Probleme die Insel, die unter Verwaltung meines Oheims stand. Er erwartete uns bereits am Ufer und warf uns ein Seil zu, damit wir das Boot am Landesteg festmachen konnten.
Ich habe die imposante Gestalt meines Oheims noch immer vor Augen: Er war ein sehr großer Mann, der das lang über die Schultern fallende silbergraue Haar mit einem Stirnband gebändigt trug. Seine Kutte aus weichem, gegerbtem Leder war auf der Brust und am Rücken mit seltsamen Zeichen bemalt. Im Hüftgürtel hingen allerlei Beutel aus Ziegenhaut sowie ein Messer, an dessen hölzernem Schaft mit Birkenpech eine scharfe Klinge aus Obsidian befestigt war. Stets strahlten seine graublauen Augen, und sein Blick schien, wenn er einen traf, von sehr weit her zu kommen und weiter zu reichen, als das bei anderen Menschen der Fall ist.
Mein Oheim begrüßte uns ebenso freundlich, wie er es nach dem Sonnenlauf bereits getan hatte, und führte uns vom Strand aus zum Tempel. Bei diesem handelt es sich ebenfalls um eine Stufenpyramide, nur dass sie nicht so gewaltig groß ist wie Basilea und keinerlei Erdrampen aufweist, um auf die obere Plattform zu kommen. Stattdessen öffnet sich im Osten, der aufgehenden Sonne zu, ein steinernes Tor. Bevor man es erreicht, muss man allerlei hölzerne Vorbauten passieren, in denen Standbilder aus hellem Gestein aufgestellt sind. Sie verkörpern die göttliche Familie. Jedes Mitglied symbolisiert eine spezielle Kraft der Natur, und Besucher, die Kerne erreichen, legen je nach Gelegenheit oder Bedürfnis Geschenke vor den Statuen ab. Auch Osiris und ich hatten aus diesem Grund Weihegaben mitgebracht, ich eine sorgsam polierte und am oberen Ende durchbohrte Muschel, Osiris ein Bündel Baumzunder, den er bei einem seiner Streifzüge durch die Wälder aufgespürt und mitgenommen hatte.
Mein Oheim betrachtete mit Wohlwollen, dass wir die heiligen Gesetze achteten und uns gebührend vor den Götterstandbildern verneigten. Dann hieß er uns, nachdem er einen Kienspan entzündet hatte, ihm in den Tempel zu folgen. Wir betraten einen langen Gang und schritten langsam und staunend voran, denn die Fackel des Oheims beleuchtete sehr eigenartige Bilder und Muster an den Wänden, die allesamt zu leben schienen, denn sie bewegten sich im flackernden Lichtschein so rasch, dass wir den Veränderungen kaum mit den Augen folgen konnten. Die Muster ähnelten ineinander verschlungenen Wellenbahnen oder Daumenabdrücken von Riesen. Sorgsam waren sie in die glatten Steinplatten graviert und so dicht, als hätten die Künstler, die sie schufen, vermeiden wollen, dass auch nur eine einzige Stelle an der Wand unbearbeitet blieb. An manchen Steinen glaubte ich fratzenhafte Gesichter zu erkennen, dann wieder kam es mir vor, als würden die Wellenringe, ja der gesamte Gang um uns herum atmen wie ein lebendiger Organismus.
Als wir eine Passage erreichten, an der sich der Gang zur Halle hin öffnete, waren wir im Zentrum des Heiligtums angekommen. Hier gab es in einer der gravierten Platten Halterungen, in die mein Oheim die Fackel steckte. Nach kurzer Zeit leuchtete sie die ganze Halle aus, und wir blickten auf die Stirnwand, deren Platten noch reichhaltiger als alle übrigen bisher mit Zeichen und Mustern geschmückt waren. Wir befanden uns nun im allerheiligsten Zentrum des Tempels. Mein Oheim hieß uns Platz zu nehmen und genauestens die Bildgravuren zu betrachten. Er selbst setzte sich auch und zwar so, dass seine Beine sich unter dem Körper kreuzten. Mit den Händen umschlang er die Knie. In dieser Position begann er leicht mit dem Oberkörper nach vorn zu schwingen, als befände er sich auf hoher See, auf den schaukelnden Planken eines Schiffes. Er schloss die Augen und fing an, mit leiser Stimme zu singen. Zunächst verstanden wir nichts von dem, was er sang, es musste sich wohl um eine geheime Liturgie der Priesterschaft handeln, und vieles davon klang in der alten Sprache. Dann aber schlug er die Augen auf, blickte uns durchdringend an und sprach: »Ihr seid nun im Tempel der Inschriften angelangt, wo die Geschichte unseres Volkes und alle Geheimnisse des Meeres und des Himmels aufgezeichnet sind. Ihr habt das Herz von Basilea gesehen, wo alles ruht vom stolzen Geschlecht der Atlantiden. Nun, da ihr euch als würdig erwiesen habt, der Union der vereinigten Königreiche zu dienen, sollt ihr hier an diesem Ort, an dem Buch geführt wird über die Geschicke der Welt, erfahren, was euch persönlich als Schicksal bestimmt ist.