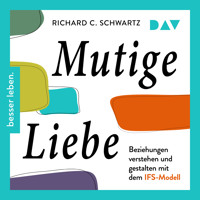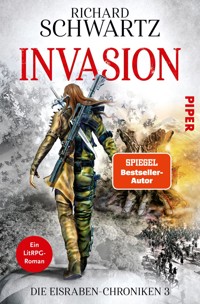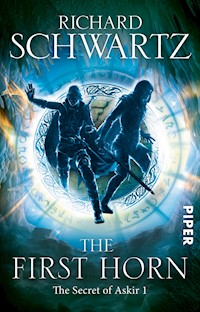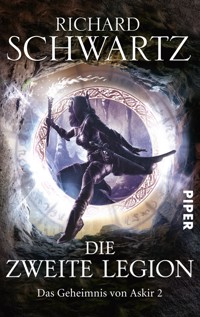8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Begeistert folgen Leserinnen und Leser Richard Schwartz' »Askir«-Zyklus seit dem ersten Band; sie nominierten ihn als beste Fantasy-Serie des Jahres. »Der Kronrat« ist der lang erwartete Höhepunkt der Reihe. Die Gefährten um den Krieger Havald sind endlich am Ziel, in der Hafenstadt Askir. Doch die Allianz wird erschüttert. Durch eine Weissagung erfährt Havald, dass er den Krieg der Götter auslösen wird und es ihm bestimmt ist, gegen seinen letzten Gegner zu verlieren. Wenn sich die Prophezeiung erfüllt, bedeutet dies Havalds Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
ISBN 978-3-492-95109-8
Mai 2017 © Piper Verlag GmbH, München 2010 Umschlagkonzept: semper smile, München Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Uwe Jarling Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Was bisher geschah
Der Nekromantenkaiser Kolaron bedroht sowohl Askir, das zerfallene Reich Askannons, als auch die Neuen Reiche, die Heimat von Havald und seinen Gefährten. Ein Bündnis gegen diesen Feind ist dringend vonnöten. Auf der Reise zum Kronrat in Askir verschlägt es Havald auf die Feuerinseln, und er und seine Freunde stellen mit Entsetzen fest, wie weit die Vorbereitungen des Feindes bereits gediehen sind.
Schwarze Legionen stehen kurz vor dem Angriff. Auch in der Stadt Askir hat der Feind auf magischem Weg eine Attacke gestartet, die im letzten Moment zurückgeschlagen werden konnte. Und jetzt verhindert nur ein mysteriöser Vulkanausbruch auf den Feuerinseln den Großangriff Kolarons. Denkbar schlechte Bedingungen für Havald, um beim Kronrat Gehör zu finden, denn die Menschen der betroffenen Regionen wissen nichts vom Feind und geben stattdessen ihm und seinen Gefährten die Schuld an den Verwüstungen.
1. Ankunft
Die beiden Leuchtfeuer standen so hoch am nächtlichen Himmel, dass ich kaum glauben wollte, dass die dunklen Türme der Seemauern, auf denen sie standen, wirklich von Menschenhand erschaffen worden waren.
Ich befand mich zusammen mit den anderen auf dem Achterkastell der Sturmtänzer, einem kaiserlichen Schwertschiff, das uns vor wenigen Tagen vor einem nassen Grab bewahrt hatte. Als die dunklen Schatten der mächtigen Seemauer näher kamen, konnte ich kaum fassen, dass die lange Reise endlich zu Ende war.
Erst als wir langsam durch das mächtige Seetor fuhren, erkannte ich das ganze Ausmaß der riesigen Anlage: Die Seemauer schien mir fast breiter als die Sturmtänzer lang. Vor uns öffnete sich der Hafen der alten Kaiserstadt, und ich kam mir vor wie ein kleiner Junge, der staunend etwas betrachtete, das er weder verstehen noch glauben konnte. Der Hafen von Aldar war mir groß erschienen, der der Feuerinseln noch größer, aber das alles war nichts gegen den Anblick, der sich mir nun bot, denn dieser Hafen allein war größer als meine Heimatstadt Kelar!
In der Ferne sah ich mächtige Mauern aufsteigen, und noch weiter hinter diesen Mauern ragte ein hell erleuchtetes massives Rund in den klaren Nachthimmel.
»Was …«, begann ich, doch ich fand die richtigen Worte nicht.
»Das ist Askir«, sagte Serafine leise an meiner Seite. »Doch was du hier siehst, ist nur der kleinste Teil der Stadt, der Hafen. Dort hinter der Mauer, die den Hafen umschließt, liegt die Zitadelle, der Sitz der Macht des Alten Reichs.«
Ich nickte nur, sah mich staunend um und suchte nach Zeichen dafür, dass diese mächtige Stadt kürzlich angegriffen worden wäre, doch ich fand keine. Dafür bemerkte ich gut ein halbes Dutzend Jagdboote, die uns mit schäumenden Rudern entgegenkamen. Ein heftiger und kühler Wind wehte, und mich fröstelte.
Von hinten schmiegte sich Leandra schon fast Schutz suchend an mich. »Ich glaube«, sagte sie fast flüsternd, »wir sind endlich angekommen.«
»Wenn ihr mich fragt«, meinte Zokora, »wurde es auch langsam Zeit.«
Damit hatte sie unbestritten recht. So lange waren wir schon unterwegs, dass ich Mühe hatte, die Tage und Wochen auseinanderzuhalten. Waren es wirklich nur sechs Wochen gewesen? So viel war geschehen, dass sie mir wie Jahre vorkamen.
Ich spürte den warmen Atem Leandras in meinem Nacken, während ich meinen Umhang fester um mich zog. Nach der Zeit in Bessarein war mir dieses Klima entschieden zu kühl.
Eine schlanke Gestalt kam den Aufgang hoch und gesellte sich zu uns, um dann forschend in die Nacht zu spähen. »Endlich zu Hause«, seufzte sie, und ihre Stimme klang belegt. Dies war Schwertmajorin Elgata, Kommandant der Schneevogel. Vor wenigen Tagen erst war das stolze Schiff gesunken, nachdem es Stürmen, Wyvern, Nekromanten und der größten Welle getrotzt hatte, die es wohl jemals gegeben hatte. Sie hatte nicht nur ihr Schiff verloren, sondern auch den größten Teil ihrer Mannschaft, darunter gute Freunde wie ihr Erster Offizier Leutnant Mendell und ein Korporal namens Amos, der mir erst den Schädel eingeschlagen und dann das Leben gerettet hatte.
Mendell besaß Familie hier. Doch diesmal würde niemand auf ihn warten. Seine Angehörigen wussten bereits, dass er den Tod auf See gefunden hatte.
Nicht nur er.
Kurz nachdem wir mit Hilfe der Elfen, die seit Neuestem eine Allianz mit Bessarein eingegangen waren, von den Feuerinseln hatten fliehen können, war der Vulkan, der diesen Inseln ihren Namen gab, in einer mächtigen Eruption ausgebrochen. Seitdem die Sturmtänzer uns aufgenommen hatte, waren ständig Nachrichten mit den Semaphorentürmen entlang der Küste ausgetauscht worden, und so wussten auch wir mittlerweile vom ganzen Ausmaß dieser Katastrophe.
Während wir die letzten Tage ohne Probleme und Störungen hinter uns gebracht hatten, hatte das Alte Reich schwer gelitten. Janas, die Küstenstadt des Turms, nur wenige Seemeilen von dem Vulkan entfernt, hatte es am schlimmsten getroffen. Eine Woge, so hoch wie fünf Häuser, war über die Stadt hinweggefahren, hatte sie in Trümmer gelegt und alles vor sich hergetragen, was man sich denken konnte. Anders als die Städte meiner Heimat war Bessarein dicht besiedelt, und nach dem, was wir gehört hatten, waren unzählige Menschen in den Fluten umgekommen.
Die Welle hatte entlang der gesamten Küste des Alten Reichs Tod und Verderben gebracht; selbst in der viele Seemeilen entfernten Stadt Aldar, der Hauptstadt des Königreichs Aldane, hatte es Opfer gegeben. Ein großer Teil der königlichen Flotte dort war auf ihren Liegeplätzen versenkt oder schwer beschädigt worden. Die Schiffe, die sich auf See befunden hatten, waren nicht mehr zurückgekehrt.
Selbst hierhin, so weit vom Ursprung der Katastrophe entfernt, hatte der Wind die Asche der fernen Inseln getragen. Auch die Sturmtänzer trug Spuren davon, obwohl die Seesoldaten ihr geliebtes Schiff ständig schrubbten. Der feine graue Staub fand sich nicht nur auf dem Boden und den Planken, sondern auch in jedem Gewand, er knirschte zwischen den Zähnen, war schlichtweg überall und hatte sogar das Meer an manchen Stellen grau gefärbt.
In dieser einen Nacht waren Soltar reichlich Seelen zugeflogen. Das Letzte, was ich an Schätzungen gehört hatte, ergab eine Opferzahl von fast einhunderttausend toten oder vermissten Menschen, ein Vielfaches davon hatte Haus, Herd und jeglichen Besitz verloren. Eine Zahl, die mir unvorstellbar hoch erschien.
Elgata hatte einen Bericht abgesetzt, der die Geschehnisse auf der Pirateninsel schilderte, danach hatte sich der Tonfall der Nachrichten geändert und jede einzelne der folgenden Botschaften hatte nur noch einen einzigen Kern besessen: Gab es etwas, irgendetwas, das wir getan hatten, um den Vulkan ausbrechen zu lassen?
Denn wir waren dort gewesen, Leandra, ich, ein Elf mit Namen Artin und der blutige Marcus, der für kurze Zeit König der Piraten gewesen war. Dort im Inneren des Vulkans waren wir von Feuer und Hitze geprüft und verbrannt worden und hatten mit eigenen Sinnen die mächtige Magie gefühlt, die diese Glut so lange in ihrem Bann gehalten hatte.
Die Frage beschäftigte auch uns. Wieder und wieder waren Leandra und ich durchgegangen, was wir dort getan hatten. Drei Türen hatten wir geöffnet, uns an einer vierten versucht, mehr war es nicht gewesen. Aber wir waren dort gewesen, und nur wenige Stunden später war der Vulkan ausgebrochen.
Doch so schlimm die Katastrophe auch war, in anderer Hinsicht hatte sie uns gerettet. Im uneinnehmbaren Hafen der Feuerinseln hatte unser Erzfeind, der Nekromantenkaiser Kolaron Malorbian, Herrscher eines mächtigen Reichs weit im Süden, eine gewaltige Flotte zusammengezogen, groß genug, um zwei volle Legionen an den Gestaden Aldanes anzulanden. Nicht ein Schiff, nicht ein einziger Soldat dieser riesigen Streitmacht konnte den Ausbruch überlebt haben.
Wäre diese Armada an unseren Küsten gelandet, hätte sich das Alte Reich kaum gegen sie behaupten können.
»Hm«, meinte die Schwertmajorin und riss mich aus meinen Gedanken. »Man hat uns wohl doch nicht alles berichtet.«
In meinen Armen regte sich Leandra und sah die Majorin mit violetten Augen fragend an. »Wie meint Ihr das?«, fragte sie und fuhr sich mit der freien Hand über ihr kurzes weißes Haar, das wie ein Helm aus Flaum aussah.
Auch die anderen blickten die Majorin fragend an, nur Zokora schien anderweitig beschäftigt zu sein und schaute hinüber zu den Kaianlagen, denen wir uns langsam näherten. Ich folgte ihrem Blick: Dort stand, etwas abseits von den Seeschlangen, eine Frau mit langen schwarzen Haaren, vornehm gekleidet und stolz und aufrecht, als wäre sie eine Königin. Sie war zu weit weg, um sie richtig erkennen zu können, außerdem war es dunkel, dennoch spürte ich, wie die ferne Frau den Blick von der dunklen Elfe löste und sich mir zuwandte. Es war, als hätte mich ein Schlag getroffen, der mir den Atem nahm. Ich kannte diese Frau, es war etwas an ihr, das mir so vertraut war wie ein alter Schuh, und dennoch … Sie war mir vollkommen fremd. Wie sollte auch jemand, den ich kannte, hierher gelangt sein?
»Dort drüben ist der Werfthafen«, erklärte Elgata. Die kurze Ablenkung reichte: Eben hatte die Frau noch dort gestanden, jetzt war sie verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. »Seht die Schiffe, die dort ausgerüstet werden. Es ist früh am Morgen, die Sonne wird erst in zwei Kerzenlängen aufgehen, und dennoch herrscht dort eine Betriebsamkeit, wie ich sie niemals zuvor gesehen habe. Und da … diese drei Schiffe sind neu. Und riesig. Ich wusste nicht, dass auch wir solche Schiffe besitzen.«
Dass die Schiffe neu waren, sah man an dem hellen Holz. Sie lagen so hoch im Wasser, dass man sogar die kupfernen Bleche erkennen konnte, die den Rumpf vor dem Schiffswurm schützten. Auf einem der Schiffe waren neue Masten errichtet worden, es waren vier an der Zahl, und das Schiff war nur wenig kleiner als die schwarzen Riesenschiffe des Feindes, die uns einen solchen Schrecken eingejagt hatten.
»Schaut, wie scharf ihre Linien sind«, meinte Elgata fast ehrfürchtig. »Man kann förmlich sehen, wie sie durchs Wasser schneiden werden! Ich zähle allein drei große Ballistenplätze an jeder Seite und noch einmal vier für mittlere Ballisten. Könnt Ihr Euch vorstellen, wie es sein wird, diese Schiffe im Kampf zu erleben?«
»Ja«, sagte ich bitter. Ich erinnerte mich nur zu gut, wie es gewesen war, als die Schneevogel den Kampf mit einem ähnlichen Giganten aufgenommen hatte. Nur Glück und ungeheure Kunst im Umgang mit einer Balliste hatten uns den Sieg davontragen lassen, aber die Verluste waren groß gewesen.
»Solche Schiffe entstehen nicht über Nacht. Als wir ausliefen, wusste ich, dass neue Schiffe gebaut werden sollten, aber nicht, dass es solche Ungetüme sein würden.« Sie drehte sich aufgeregt zu mir herum. »Es dauert Monate, manchmal Jahre, solche Schiffe zu fertigen, und ich weiß beim besten Willen nicht, wie unsere Schiffsbauer das schaffen konnten. Kommandant Keralos muss von der Gefahr schon gewusst und sie ernst genommen haben. Aber das ist noch nicht alles. Überall im Hafen sind zwischen hohen Stangen stabile Netze gespannt, als würde man mit einer Bedrohung aus dem Wasser rechnen. Dann die anderen Schiffe hier im Hafen, seht Ihr? Viele sind beschädigt, aber an allen wird fieberhaft gearbeitet.« Sie schaute sich weiter im Hafen um und deutete dann auf zwei große Handelsschiffe, dickbäuchige Walfische, die im Schein großer Laternen entladen wurden. Sie waren anders geformt als die mir bislang bekannten Schiffe: Der Kiel war an Bug und Heck weit hochgezogen und endete in Schnitzereien, deren Form den Köpfen unbekannter Bestien glichen. »Das sind Handelsschiffe aus den Varlanden, und sie entladen Säcke voller Getreide.« Sie wandte sich uns zu. »Wir beziehen unser Getreide aus Bessarein und Aldane, nicht von den Varländern, weil sie davon zu wenig haben, um es günstig verschiffen zu können.«
Serafine räusperte sich, und ich blickte zu ihr hin. Ich konnte nur erahnen, wie es ihr erging, als sie diese Stadt nach siebenhundert Jahren wiedersah.
»Ich denke, ich kenne den Grund«, ließ sie uns mit ihrer weichen Stimme wissen. »Janas ist verwüstet, und damit auch der größte Hafen Bessareins. Aldanes Flotte ist in großen Teilen zerstört, und sie werden in diesem Notfall ungern ihre Kornreserven verkaufen wollen. Nur die Varlande werden noch liefern können. Und das zu einem hohen Preis.« Der Ausdruck auf ihrem Gesicht war schwer zu deuten, als sie weitersprach. »Korn, Havald. Korn und seine Preise! Darauf beruht der Frieden jeder Stadt. Wenn jeder genug zu essen hat, gibt es keinen Grund zur Unruhe. Aber wenn der Magen darbt und der Arme sieht, wie der Reiche fetter wird, während er sich selbst am Verhungern wähnt … dann wird es unschön. Dass sie teures Korn kaufen, ist kein gutes Zeichen.«
»Ich dachte, die Stadt würde selbst gute Ernten einfahren«, warf ich ein.
Sie trat an die Hecklaterne und fuhr mit ihrem Finger über ein Ornament, das einer der Seesoldaten nicht sorgfältig genug geputzt hatte. Sie zeigte mir den grauen Staub des Vulkans auf ihrer Fingerkuppe. »Das hier«, sagte sie, »verändert alles.«
»Da habt Ihr recht«, stimmte Elgata zu. »Es wird dauern, bis die Kornschiffe wieder fahren.«
»Das meinte ich nicht«, antwortete Serafine. »Wenigstens nicht allein. Noch immer ist der Himmel trüb, noch immer regnet Asche auf uns herab. In wenigen Jahren wird diese Asche in weitem Umkreis alles fruchtbar machen, doch die Ernte, die in Bessarein jetzt gerade auf den Feldern steht, wird darunter leiden. Ihr habt selbst die Botschaften gelesen. An manchen Stellen fiel der Ascheregen so dicht, dass er das Land unter sich begrub. Es sind die Küstenstreifen mit den feuchten Winden, in denen sich die meisten Felder befinden. Wenn der größte Teil der Ernte eingeht, wird es Hungersnöte geben.« Ihre Hände ballten sich zu Fäusten. »Mein Vater durchlitt schlaflose Nächte bei dem Gedanken. Und das war zu einer Zeit, als das Alte Reich noch bestand und weitaus größere Reserven hatte, als ich es mir für heute denken kann.« Serafines Vater war zu den Endzeiten des Alten Reichs Gouverneur von Gasalabad gewesen, und damals waren noch weite Teile des Landes mit Korn bepflanzt, dort, wo heute nur noch Wüste anzutreffen war.
»Dann wollen wir hoffen, dass es nicht so schlimm kommen wird«, sagte ich. Etwas Besseres fiel mir nicht ein.
Als wir an Land gingen, warteten fünf Soldaten der Bullen auf uns, ein Stabsleutnant trat vor, salutierte vor mir und schluckte.
»Stabsleutnant Neder, Fünfte Bulle, Vierte Lanze. Ser.« Er holte tief Luft. »Ich muss Euch und eine gewisse Sera Maestra Leandra di Girancourt bitten, uns Folge zu leisten.« Er griff in die Stulpe seines Plattenhandschuhs und holte ein schmal gefaltetes Pergament heraus, das er mit einer geübten Bewegung aufschlug, sodass er es lesen konnte.
»Im Namen des Handelsrats wird angeordnet, Graf Roderic von Thurgau und Sera Leandra di Girancourt in freundlichen Gewahrsam zu nehmen und zur Vernehmung dem Handelsrat der kaiserlichen Stadt Askir vorzuführen, auf dass sie sich zu denen ihnen gegenüber erhobenen Vorwürfen äußern können. Gezeichnet, Antonis, Gildemeister der Kornhändler.«
Er faltete das Pergament wieder mit einer Hand, ein Kunststück, wie ich fand, und steckte es in seinen linken Stulpen zurück, um dann Haltung anzunehmen.
»Gegen Eure anderen Kameraden liegt nichts vor, sie können gehen. Willkommen in Askir. Wenn Ihr mir nun bitte folgen wollt, Sera, Lanzengeneral?«
Ich rührte mich nicht von der Stelle.
»Steht bequem«, wies ich ihn an, woraufhin er seine Füße einen Daumenbreit weiter auseinandersetzte und die Hände hinter den Rücken nahm. Ob dies nun viel bequemer war als die vorherige Haltung, wagte ich zu bezweifeln. »Was bedeutet ›freundlicher Gewahrsam‹?«
Er schluckte erneut.
»Personen im freundlichen Gewahrsam sind mit dem ihnen zustehenden Respekt zu behandeln und behalten das Recht auf die Unversehrtheit ihrer Person und Ausrüstung. Dienstbuch der Legionen, Band zwölf, Seite vierhunderteins, Paragraph 14, ›Regelung des Umgangs mit Respektpersonen im Falle einer Verhaftung‹, Absatz vier. Ser! Lanzengeneral. Ser!«
»Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt«, schmunzelte Varosch. »Habt Ihr die ganzen Dienstbücher auswendig gelernt, Stabsleutnant?«
Noch bevor der Stabsleutnant antworten konnte, erweckte eine Bewegung hinter ihm meine Aufmerksamkeit. Dort kam gerade ein sehr großer und kräftiger Mann heran. Er trat zur Seite, als zwei Seeschlangen einen ihrer verletzten Kameraden von Bord trugen, beugte sich sogar kurz zu diesem herab, um ihn mit Handschlag und einem breiten Grinsen zu begrüßen, dann richtete er sich auf und kam gemächlich in unsere Richtung. Einer der vier Bullen stöhnte hörbar auf, was dem Neuankömmling ein schadenfrohes Grinsen entlockte.
Er trug einen langen, schweren nachtblauen Mantel, ein schlankes Schwert und einen Umhang mit Kapuze.
»Hallo, Neder«, meinte der große Mann, was den Leutnant vor mir mitten im Wort regelrecht zusammenzucken ließ. Der Neuankömmling übertraf mich nicht nur in der Größe, sondern auch in der Breite; wenn seine Schultern nicht gepolstert waren, dann mochte er gut die Hälfte mehr wiegen als ich. »Habt Ihr Euch verlaufen?«
Der Stabsleutnant stöhnte leise auf und warf mir einen undeutbaren Blick zu, bevor er sich umdrehte. »Santer … Ihr kommt ungelegen, das hier ist ohne Euch schon schwer genug!«
»Das sehe ich anders«, meinte der Mann namens Santer und ließ seinen Blick über unsere kleine Gruppe schweifen. »Ich gedenke, es Euch einfach zu gestalten.« Neben mir zog Leandra scharf die Luft ein, der Grund dazu prangte, wie ich jetzt sehen konnte, auf der linken Brust des Mannes: das silberne Symbol einer Eule. Nun war auch zu erkennen, dass der Mantel nicht aus Stoff bestand, sondern aus sehr feinen Kettenringen, die im Licht der Hecklaterne in dunklem Blau schimmerten.
Eine Eule? Ich hatte bis eben gedacht, es gäbe sie nicht mehr!
Elgata überraschte mich, indem sie laut auflachte und sich dann bequem gegen einen Stoffballen lehnte.
»Was willst du hier, Neder?«, fragte Santer, der sich mit meiner Vorstellung der legendären Kriegsmagier des Alten Reichs kaum deckte. Dieser Mann sah so aus, als würde er lieber seine Fäuste bemühen als Magie – und daran auch mehr Freude empfinden.
»Santer, Meister Antonis gab mir die Anweisung, die Sera Leandra di Girancourt und den Lanzengeneral dem Handelsrat vorzuführen. Meine Idee war das gewiss nicht!«
»Das will ich hoffen, Neder.« Santer lächelte drohend und zeigte weiße Zähne. »Richtet Gildenmeister Antonis aus, er möge sich mit seinem Anliegen an den Inquisitor wenden. Er wird sein Ansinnen prüfen und den Meister wissen lassen, was er entscheidet.«
»Also überschreitet der Stabsleutnant seine Befugnisse?«, fragte ich den großen Mann.
»Er nicht − der Handelsrat«, teilte mir Santer freundlich lächelnd mit. »Neder möchte am liebsten ganz woanders sein, nicht wahr?«
»Aber …«, begann Neder hilflos, während wir zwischen ihm und Santer hin und her sahen, als gäbe es ein Ballspiel zu verfolgen. Serafine tat es mittlerweile Elgata gleich und lehnte sich neben die Schwertmajorin an einen Ballen am Kai, verschränkte die Arme unter ihrem Busen und schien sich ebenfalls darauf vorzubereiten, einer netten Posse beizuwohnen.
»Neder. Ich weiß, Ihr seid ein Bulle und denkt nur mit Euren Eiern. Aber da ich gut gelaunt bin, helfe ich Euch. Seht Ihr das Schwert an der Seite des Generals? Es ist ein Bannschwert. Und das Schwert auf dem Rücken der Sera mit den weißen Haaren? Seht Ihr es? Das mit dem Griff in der Form eines Drachenkopfs, der Euch ansieht, als ob er Euch fressen will? Das ist ebenfalls ein Bannschwert. Sie ist zudem eine Maestra. Bannschwerter«, erklärte Santer in dem geduldigen Tonfall, den man gegenüber Kindern oder geistig Schwachen anwendet, »sind Schwerter, denen eine Magie innewohnt. Eine Maestra ist der Magie kundig. Magie wiederum ist Sache der Eulen und nicht des Handelsrats. Tut mir nun folgenden Gefallen, Neder: Verlasst diesen Ort, nehmt Eure vier Stiere mit und teilt dem Gildenmeister mit, dass er sich seine Order dahin stecken kann, wo selbst die Götter nicht hinsehen wollen. Ihr braucht nicht diplomatisch zu sein, Neder. Und jetzt verschwindet.«
»Santer. Ich …«
Der große Mann zog eine Augenbraue hoch. »Ich dachte, ich wäre so deutlich gewesen, dass auch ein Bulle es versteht. Möchtet Ihr, dass ich deutlicher werde?«
»Nein, Ser!«, beeilte sich der Stabsleutnant zu sagen, drehte sich zu uns herum und salutierte erneut vor mir. »Ser! Ich bitte die Störung zu entschuldigen. Ich hatte Order, Ser, Lanzengeneral. Ser!«
Ich nickte großmütig, erwiderte den Salut, und wir sahen zu, wie die fünf Bullen hastig das Weite suchten, während die Soldaten der Seeschlangen sie mit spöttischen Blicken bedachten.
Sie waren noch nicht verschwunden, als Elgata losprustete und so herzhaft lachte, dass ihr fast die Tränen kamen.
»Santer!«, rief sie erfreut und schlug dem Mann hart auf die Schulter. »Du alter Mistkerl! Ich bin froh zu sehen, dass du noch lebst. Ich habe gehört, dein Schiff sei gesunken, und für dich gebetet!«
»Ich war nicht an Bord«, lächelte Santer. »Ich wurde zum Kindermädchen der Eule befördert und durfte nicht mehr mit Seeschlangen spielen.«
»Dann bist du wirklich eine Eule?«, fragte Elgata ungläubig. »Da ist man ein paar Wochen auf See, und dann so etwas! Was, bei allen Höllen, hast du mit den Eulen zu schaffen?«
»Später, Elgata«, meinte Santer. »Wenn du die Geschichte hören willst, musst du mir ein Bier ausgeben. Aber ich bin nicht zufällig hier.«
Er verbeugte sich vor uns und sah dann zur Seite, von wo Zokora ihn mit einem langen Blick bedachte.
»Seid Ihr wahrlich eine Eule?«, fragte Leandra, und ich spürte, wie aufgeregt sie war. »Ich dachte, es gäbe keine mehr … Ich bin froh zu hören, dass es anders ist!«
Santer lächelte. »Ja, es gibt wieder eine Maestra vom Turm. Ich bin jedoch nur der Adjutant der Prima und selbst kein Maestro. Ihr seid Maestra di Girancourt, nicht wahr?«
»Die bin ich.«
»Dann soll ich Euch ausrichten, dass die Prima der Eulen begierig darauf ist, Euch kennenzulernen.« Er warf mir einen erheiterten Blick zu. »Ich hörte von Euch, Lanzengeneral, und Euren Gefährten – und sehe, dass nichts davon übertrieben ist.« Sein Blick streifte über uns. »Ihr beweist Geschmack in der Auswahl Eurer Kameraden!« Er zwinkerte den Seras zu. »Euch steht einiges bevor, denn Desina, die Eule, ist nicht die Einzige, die Euch sprechen möchte. Auch der Kommandant wünscht Euch zu sehen und hat für den morgigen Nachmittag eine Audienz vorgesehen. Doch zunächst bringe ich Euch zu Stabsobrist Orikes, der Euch über das aufzuklären wünscht, was Euch hier erwartet. Er ist der kommandierende Offizier der Federn und engster Berater des Kommandanten. Anschließend wird man Euch in Eure Quartiere geleiten. Dort könnt Ihr dann bis zum Mittag Ruhe finden. Eines noch.« Er verbeugte sich überraschend elegant. »Wir begrüßen unsere Helden und Verbündeten üblicherweise freundlicher. Seid willkommen in Askir, der Ewigen Stadt! Und jetzt lasst uns von hier verschwinden. In der Zitadelle ist es wärmer als hier, und Orikes pflegt seine Gäste gut zu bewirten.«
»Einer unserer Kameraden ist verletzt. Wir …«, begann ich, doch Santer nickte bereits.
»Dafür ist gesorgt.« Er wies den Kai entlang, wo eine große vierspännige Kutsche herangefahren war. An der schwarz lackierten Tür prangte in Gold ein Wappen, das ein Rad, einen Amboss und einen Hammer führte.
»Die Eule bat ihren Großvater, Euch seine Kutsche zur Verfügung zu stellen. Sie ist groß genug, sogar ein Nordmann sollte darin Platz finden.«
»Ah«, sagte Angus, als er sich in die weichen Polster der Kutsche fallen ließ. »So mag ich es. Eine schöne Frau an jeder Seite … Da will ich mich nicht beschweren, auch wenn keine von euch meinen Reizen verfallen ist!«
»Dafür danke ich den Göttern«, meinte Sieglinde, die neben ihm saß, mit Inbrunst in der Stimme. Kaum mehr etwas erinnerte noch an die Wirtstochter, die ich so zu schätzen gelernt hatte. Ich hätte schwören können, dass sie dafür geboren wurde, eine Bardin zu sein, doch das Schicksal hatte sie dafür bestimmt, ein Bannschwert zu führen, Eiswehr, jene Klinge, in der Serafines Seele Jahrhunderte überdauert hatte. Für lange Zeit hatte die blonde Kriegerin auch Serafines Geist in ihrem Körper eine Heimat geboten. Die beiden waren immer noch sehr miteinander vertraut und die letzten Tage auf See unzertrennlich gewesen. Auch jetzt wechselten die beiden Frauen amüsierte Blicke, als Angus übertrieben mit den Augen rollte. »Ihr wisst eben nicht, was ihr verpasst«, meinte der Varländer und strich sich selbstgefällig über den Bart, der in drei ordentliche Zöpfe geflochten war. Sah man von den Tätowierungen auf seinem kahl geschorenen Schädel ab, konnte man ihn im ersten Moment sogar für zivilisiert halten.
Wie die meisten von uns trug auch er die Lederrüstung einer Seeschlange, auch wenn bei ihm der Brustpanzer an der Seite auseinanderklaffte. Zwischen seinen Beinen hielt er seine Axt, während sein linker Arm ein kleines Bierfass umschloss. Ein Fass, über das er die ganze Reise von Gasalabad nach Askir eifersüchtig gewacht hatte.
»Warum hat mich niemand geweckt, als diese Bullen kamen?«, beschwerte Angus sich jetzt und rückte sein frisch geschientes Bein etwas bequemer zurecht. Mir schien es so, als ob er den Bruch kaum mehr beachtete, er kam auch mit der Schiene beachtenswert gut zurecht. »Ihr könnt mich doch nicht schlafen lassen, wenn Ihr verhaftet werdet!«
»Wie Ihr seht, war es möglich«, gab Sieglinde spitz zurück. »Mir war es lieber, Euch schnarchen zu lassen, als Eure übertriebenen Komplimente ignorieren zu müssen.« Ihre Hand strich über Eiswehrs Heft. »Ich überlegte schon, Euch anderweitig zum Schweigen zu bringen.« Sie sah zu Serafine hin. »Wie hast du es nur geschafft, ihn zu ertragen!«
»Er hat seine Qualitäten«, entgegnete Serafine lächelnd, während die Kutsche anfuhr.
»Wenn du darum bittest, stelle ich sie auch gern unter Beweis«, meinte Angus und zwinkerte Sieglinde zu, die nur die Augen verdrehte.
»Varosch«, meinte Zokora im Plauderton, »bist du dir sicher, dass es ungerecht wäre, ihm die Zunge herauszuschneiden?«
»Ja«, schmunzelte Varosch. »Es steht nicht unter Strafe, so zu tun, als wäre man der Held aller Seras.«
»Schade«, meinte Zokora dazu und warf dem Nordmann einen langen Blick aus dunklen Augen zu. Da man bei ihr nie wissen konnte, ob sie scherzte oder nicht, zeigte der Nordmann Vernunft und schluckte herunter, was er eben hatte sagen wollen.
Dass die Kutsche wogte wie ein Schiff bei heftigem Seegang, war meinem Magen überhaupt nicht recht. Ich ließ das Fenster herunter und war froh um die kühle Luft, die in die Kutsche wehte. Die Wellenkrankheit hatte mir übel mitgespielt, ich hatte mich darauf gefreut, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Was nicht viel half, jetzt war es das feste Land, das sich zu heben und zu senken schien.
Neben mir lehnte Leandra ihren Kopf an meine Schulter; auch sie war still und nachdenklich, und für einen langen Moment sagte niemand mehr etwas. Das Geräusch der eisenbeschlagenen Räder und der Hufe auf dem Pflaster, das Schnauben der Pferde und das Knarzen der Kutsche, wenn sie in der weichen Federung schwankte, hatten etwas Einlullendes an sich. Mein Körper bettelte um Schlaf, doch mein Geist war hellwach.
Zudem gab es durch das Kutschenfenster viel zu sehen.
Schnell kam das Gefährt nicht voran, ständig musste der Kutscher die Pferde zügeln, denn auch mitten in der Nacht herrschte hier im Hafen Hochbetrieb, und es brannten derartig viele Laternen und Fackeln, dass der Kai fast so hell erleuchtet war wie am Tag. Allein schon der Militärhafen war so groß wie der Hafen von Kelar, Schiff an Schiff lag hier und wurde repariert oder ausgerüstet, überall herrschte eine emsige Betriebsamkeit, die mich daran erinnerte, wie die schwarze Legion Besitz von den Feuerinseln ergriffen hatte.
Gerade in den letzten Tagen, als es für uns nicht mehr zu tun gab, als darauf zu warten, dass die Sturmtänzer Askir erreichte, und uns von den Strapazen zu erholen, hatte ich Muße gehabt, über das nachzudenken, was wir erfahren hatten.
Die Gewalten der Natur mochten die Pläne unseres Feinds vorerst zerschlagen haben, doch ich bildete mir nicht ein, dass der Kampf damit zu Ende war. So groß die feindlichen Verluste durch die Katastrophe auch waren, sie hatte uns nicht viel mehr als Zeit erkauft.
Das Reich Thalak war unter der Führung seines unsterblichen Nekromantenkaisers weitaus größer und mächtiger, als es unsere dunkelsten Albträume hatten befürchten lassen. Größer als das Alte Reich, schien es uns in allen Dingen überlegen. Während im Alten Reich die Magie verpönt und gefürchtet war, und jemand mit einer magischen Begabung eher auf dem Scheiterhaufen landete, als eine Ausbildung zu erfahren, war das in Thalak anders.
Der Nekromantenkaiser hatte einen Weg gefunden, die verfluchte Gabe der Nekromantie auf andere zu übertragen, und führte diesen Verfluchten nunmehr gezielt talentierte Opfer zu, sodass auch diese neu erzeugten Nekromanten über mächtige Fähigkeiten verfügten.
Am schlimmsten aber war, dass dieses ferne Reich nach dem Modell des Alten Reichs angelegt schien. Während in unserer Heimat die Hauptmacht des Feindes aus in den Dienst gepressten Bauern und Sklaven bestand, waren die feindlichen Soldaten auf der Feuerinsel gut ausgebildet und gerüstet gewesen und standen denen des Alten Reichs in keiner Weise nach. Die fanatische Loyalität der Anhänger und Soldaten des Nekromantenkaisers war erschreckend, umso mehr, als sie bereit schienen, sich für ihren Kaiser ohne Bedenken zu opfern – und mit jedem einzelnen Tod in seinem Namen ihn seinem Ziel, selbst ein Gott zu werden, einen Schritt näher brachten.
Zokora hatte den Begriff des dunklen Spiegels geprägt, er passte allzu gut: Es war, als ob der Feind all das verwendete, was das Alte Reich und Askir einst so groß und mächtig hatte werden lassen, und es nun gegen uns einsetzte.
Während ich meinen Gedanken nachhing und durch das Kutschenfenster zusah, wie Askir an uns vorüberglitt, spürte ich Leandras warmen Atem an meinem Hals. Irgendwie kam die Müdigkeit dann doch, ich döste, hörte Sieglinde über etwas lachen, das Serafine ihr erzählte … und schlief ein.
Leandra rüttelte mich wach, ich blinzelte und sah gerade noch, wie wir durch ein langes, tunnelartiges Tor fuhren, das von Soldaten der Legion bewacht wurde. Die Räder unserer Kutsche hallten in der Höhlung, dann öffnete sich vor uns ein großer Hof, kreisrund und von hohen, mächtigen Mauern umgeben, an deren Fundamente sich niedrigere Gebäude drückten.
Links sah ich einen fensterlosen Turm, dessen Sinn sich mir nicht erschloss, doch als die Kutsche herumschwenkte und ich die Zitadelle erblickte, verschlug es mir fast den Atem. Sie war ein mächtiger und trutziger Block, ein Rund aus weißem Stein mit mindestens sieben hohen Stockwerken und vielen schmalen Fenstern, die mit wehrhaften Läden geschlossen werden konnten. Hinter den meisten dieser Fenster brannte auch zu dieser frühen Stunde noch Licht – oder es brannte schon wieder –, denn in der Ferne zeigte sich bereits das Morgenrot. Die Reise in der Kutsche hatte wohl doch länger gedauert als gedacht.
Ein Soldat der Federn, dem Teil der Streitkräfte, der sich um Logistik und Schreibarbeiten kümmerte, öffnete mir mit einem Salut die Tür.
Mir fiel auf, dass man Zokora keine weitere Beachtung schenkte. Zwar war eine dunkle Hautfarbe für das Alte Reich nicht ungewöhnlich, dennoch hätte ich erwartet, dass sie Aufmerksamkeit erregte. Sie und Varosch entschieden sich dafür, sich sogleich zur Ruhe zu betten. Angus dachte erst gar nicht daran, etwas anderes zu tun, als sich nach der nächsten Schenke zu erkundigen, und war enttäuscht, dass in der Nähe keine geöffnet hatte. Plötzlich schien ihn sein verletztes Bein nur noch wenig zu behindern. Sieglinde lehnte ebenfalls dankend ab, so blieben nur Leandra, Serafine und ich, die dem Soldaten der Federn folgten.
Die Zitadelle war nicht ganz der mächtige Bau, der er von außen zu sein schien. Als wir durch ein großes Tor im Inneren geführt wurden, zeigte sich, dass ein großer Teil des Runds aus einem Garten bestand. In dem Durchgang, der groß genug für drei Kutschen war, wandte sich der Soldat nach links, wo sich eine eiserne Tür befand, und ging an vier Bullen vorbei, die dort standen und mich misstrauisch beäugten. Überraschenderweise gab es hier niemanden, der salutierte.
Was durchaus einen Sinn ergab, denn an diesem Ort kämen sie wohl gar nicht mehr dazu, etwas anderes zu tun, als Offiziere zu grüßen. Während wir die breite Treppe hinaufgingen, kamen uns auch schon zwei weitere Offiziere entgegen, die mir zunickten und zugleich zu grübeln schienen, wer ich wohl war.
Es ging die Treppe ganz hinauf bis unter das Dach, dort öffnete sich die Treppe zu einem breiten Absatz. Hier standen vier weitere Bullen Wache, und es gab einen Tisch, hinter dem ein Soldat der Federn saß, der aufsprang und uns die Tür öffnete, die in einen breiten, von magisch leuchtenden Kugeln erhellten Gang führte. Nahezu jedenfalls, denn an einigen Stellen fehlten die Kugeln.
Wieder gelangten wir an eine bewachte Tür, einer der Soldaten zog sie für uns auf, und wir waren angekommen.
2. Orikes
Wir fanden uns in einer Zimmerflucht wieder, die ganz und gar nicht dem entsprach, was ich vom Quartier eines hochrangigen Offiziers erwartete. Wir standen in einer Art Salon, großzügig mit Teppichen ausgestattet, und gegenüber gab es zwei große Fenster, die auf den Innenhof hinausgingen und wenig mit den Schießscharten gemein hatten, die wir von der Außenwand imperialer Gebäude kannten. Zwischen diesen Fenstern stand auf einem Stehpult ein kleiner Schrein mit dem Zeichen Borons daran, der Rest des Raums war ausgestattet mit einem niedrigen Tisch und bequemen, lederbezogenen Sesseln. Die Wände waren verdeckt von Regalen, die mehr Bücher und Bände enthielten, als ich jemals gesehen hatte.
Im ersten Moment waren wir allein in dem Raum, dann öffnete sich links die Tür, und der Stabsobrist kam herein, verbeugte sich leicht vor den Seras und musterte uns mit einem aufmerksamen Blick.
Der Mann war nicht besonders groß, dafür stämmig, sein Haar war von eisgrauer Farbe, und er trug es kurz geschoren. Unter buschigen Augenbrauen funkelten graublaue Augen, und sein Lächeln war freundlich.
Von den kurzen Haaren und den Muskeln abgesehen, die verrieten, dass auch er es gewohnt war, den schweren Plattenpanzer des Kaiserreichs zu tragen, schien er mir eher einem Priester zu ähneln als einem Krieger. Er salutierte nicht, sondern begrüßte mich mit einem überraschend kräftigen Handschlag, den Seras gegenüber verbeugte er sich höflich. Der Obrist schien über fünfzig Jahre alt zu sein, aber er hielt sich noch immer gerade und bewegte sich mit der Leichtigkeit eines weit jüngeren Mannes.
»Ich bin Stabsobrist Orikes«, stellte er sich vor und wies mit der Hand auf die bereitstehenden Sessel um den niedrigen Tisch. Auf der polierten Tischplatte stand eine Schale mit frischem Obst, auf einem silbernen Tablett dampften zwei große Kannen aus gebranntem Ton, daneben stapelten sich mehrere Tassen, auch eine Schale mit Rohrzucker stand bereit. »Mir ist bewusst, dass Ihr müde sein müsst, deshalb habe ich mir erlaubt, frischen Kafje und etwas Obst aufzutischen. Greift zu, wenn es Euch danach verlangt.«
Er stand da, rieb sich die Hände, während wir uns setzten, und suchte sich dann den Platz am Tisch, der es ihm erlaubte, uns alle drei anzusehen. Seelenreißer und Steinherz standen neben unseren Plätzen, doch er gönnte ihnen nur einen kurzen Blick und beugte sich dann vor, um uns mit aufmerksamen Augen zu mustern.
»Bei mir laufen alle Berichte zusammen, die das Reich erhält. Verzeiht, wenn ich auf das Protokoll verzichte, doch mir kommt es vor, als ob ich Euch schon lange kennen würde. Hier haben wir den Lanzengeneral einer verschollenen Legion, dort die mächtige Maestra, die den Blitz beherrscht wie keine Zweite, und zuletzt Serafine, die Tochter des Wassers, wiedergeboren durch ein Wunder, eine Zeugmeisterin der Zweiten Legion, eine legendäre Gestalt, von der man eher hätte erwarten können, dass sie einen Thron besteigt, als dass sie in einer kalten Höhle endet – um heute neugeboren hier zu sitzen.« Er lehnte sich zurück und strahlte uns an. »Ich weiß, wer die Berichte schreibt, also weiß ich auch, dass ich ihnen trauen kann, und doch muss ich gestehen, dass mir vieles unglaublich erscheint.« Er wies auf Schale und Kannen. »Kafje oder Obst? Greift zu, dies ist kein Verhör, sondern eine freundschaftliche Besprechung.«
»Ähm …«, begann ich und sah Hilfe suchend zu Leandra, die von dieser Begrüßung nicht weniger erschlagen wirkte als ich. Einzig Serafine schien dies alles sehr gelassen zu nehmen.
»Zu viel auf einmal?«, fragte Orikes, als auch Leandra zögerte. »Ich habe einfach zu lange auf Euch warten müssen«, erklärte er und lachte leise. »Gut, wie wäre es, wenn ich die Fragen stelle?«
»Wenn Ihr uns auch einige Fragen beantwortet«, sagte nun Leandra, während ich mir eine Kanne griff und die beiden Seras fragend ansah. Beide nickten, also füllte ich vier Becher mit dem dampfenden Gebräu.
»Fangen wir mit einer Frage an«, sagte ich, während ich einen der Becher dem Obristen hinüberschob. »Gab es vor zehn Tagen einen magischen Angriff auf diese Stadt?«
Er blinzelte und wurde schlagartig ernst. »Ja. Der Feind versuchte, in der Stadt ein Tor zu errichten, das wahrhaftig zur anderen Seite der Welt führte. Dieser Angriff konnte abgeschlagen werden, und ein Teil der gegnerischen Truppen wurde vernichtet.« Er nahm seinen heißen Becher und drehte ihn zwischen den Fingern. »Woher wisst Ihr davon, General?«
»Der Kriegsfürst Celan hat es uns berichtet. War es schwer, dem Angriff standzuhalten?«
»Es war nicht einfach«, sagte der Obrist verhalten. »Es brauchte Glück und Opfer dazu, denn er war von langer Hand vorbereitet, und es gab einen Moment, in dem uns die Lage hoffnungslos erschien.«
»Habt Ihr die Agenten des Nekromantenkaisers ausfindig machen können?«, fragte Leandra. »Oder müssen wir davon ausgehen, dass sie noch in großer Anzahl tätig sind? Habt Ihr herausgefunden, wer es war, der dem Feind half, und könnt Ihr uns sagen …«
Orikes hustete dezent und hob die Hand, um sie zu unterbrechen. »Verzeiht, Maestra, aber wäre es möglich, dass ich zuerst meine Fragen stelle?«, fragte er höflich.
»So fragt«, antwortete Leandra.
Es zeigte sich, dass Orikes ausgesprochen viele Fragen hatte. Er fing am Anfang an, fragte nach dem, was im Hammerkopf geschehen war, und führte uns dann in gerader Linie bis zu den jüngsten Geschehnissen in Gasalabad. Wie er es fertigbrachte, verstand ich nicht, doch schon nach einer halben Kerzenlänge war es, als ob wir einem alten Freund von unserem Abenteuer berichteten. Selbst Leandra lachte und scherzte, als ob sie ihn schon ewig kennen würde. Aber er verlor niemals seinen Faden, und die sorgsam formulierten Fragen zeigten, wie aufmerksam er jeden Bericht studiert hatte.
Die Zeit verging wie im Flug, ein Soldat brachte uns ein zweites und ein drittes Mal volle Kannen, und erst als ich ein ausgiebiges Gähnen wirklich nicht mehr unterdrücken konnte, brachte er die Befragung zu einem vorläufigen Ende.
»Ich sehe«, sagte er zerknirscht, nachdem wir ihm von Prinzessin Marinaes Befreiung und Serafines Wiedergeburt berichtet hatten, »dass es doch länger dauern wird als gedacht.« Er warf einen Blick zum Fenster hinaus, es war schon lange Tag. »Ich will für jetzt nicht weiter in Euch dringen, in wenigen Kerzenlängen wird der Kommandant Euch erwarten, und ich bin sicher, dass Ihr etwas Rast und Ruhe wünscht.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und massierte sich die Schläfen; auch er war jetzt müde. »Der Kommandant ist ein harter, aber gerechter Mann mit einer Geistesschärfe, die man nicht unterschätzen darf. Auch ich werde anwesend sein, doch ich gebe Euch jetzt schon einen Rat: Er erkennt, wenn man etwas vor ihm zu verbergen sucht, und schätzt Offenheit fast schon in brutaler Weise. Er wird Euch nach dem fragen, was ich noch nicht berühren konnte, nämlich wie es kam, dass dieser Vulkan ausbrach. Antwortet ihm so geradeheraus wie möglich.« Sein Blick wanderte von mir zu Leandra, die auf einmal hellwach erschien. »Er versteht genug vom Wirken der Magie, dass Ihr Euch nicht zu scheuen braucht, ihm auch diese Sicht der Dinge darzulegen. Es ist nötig, dass diesem Vorwurf begegnet wird, denn wenn es gelingt, Euch für die Katastrophe verantwortlich zu machen, wird das alles gefährden, für das Ihr gekämpft und gelitten habt. Hier im Alten Reich kennen bislang nur wenige das Ausmaß der Bedrohung durch Thalak, dafür sind alle auf der Suche nach einem Schuldigen für die Toten der Flut.«
»Obrist …«, begann Leandra, doch er hob wieder die Hand.
»Ich verspreche Euch, dass zu einem anderen Zeitpunkt alle Eure Fragen Antwort finden. Aber jetzt läuft uns doch die Zeit davon, also beantworte ich Euch die Fragen, die Ihr schon gestellt habt.« Er holte tief Luft. »Ein Teil der gegnerischen Agenten wurde gestellt und erschlagen. Doch zur Zeit müssen wir davon ausgehen, dass es noch mindestens einen oder sogar mehrere Nekromanten in der Stadt gibt, und auch noch andere Agenten, die für den Feind arbeiten. Der Vorwurf, dass Ihr es wart, die für den Vulkanausbruch verantwortlich seid, kommt nicht von ungefähr. Es ist möglich, dass sich jemand verplappert hat, aber es sind nur wenige, die von Eurer Rolle dabei wissen. Und dennoch wurde schon mit dem Finger auf Euch gezeigt, noch bevor die Sturmtänzer Euch gefunden und geborgen hat. Diese Gerüchte gewinnen im Handelsrat mehr und mehr an Gewicht. Und es ist dieser Rat, der die Geschicke der Stadt lenkt, und selbst der Kommandant hätte Mühe, sich über ihn hinwegzusetzen. Ein Letztes noch: Wir lernten auf die harte Art, dass es niemanden gibt, dem man vollends trauen kann. Der Feind hat Möglichkeiten, auch die treueste Seele zu verführen, zu täuschen oder zu verblenden. Erst vor zwei Tagen wurde ein Anschlag auf die Eule verübt, von einem unserer Soldaten, der dem Kaiser treu ergeben ist und niemals auf einen solchen Gedanken gekommen wäre. Schlimmer noch, er konnte sich an die Tat nicht einmal mehr erinnern. Ich muss Euch raten, Euch nicht darauf zu verlassen, hier sicher zu sein. Der Feind hat mit Gewissheit ein Interesse daran, Euch alle tot zu sehen.«
»Aufmunternde Worte«, meinte Leandra bitter, und der Obrist nickte, sein Lächeln war ihm vergangen. »Bessere habe ich nicht für Euch«, sagte er und erhob sich.
Die seltsame Audienz war damit beendet.
3. Ein Freundschaftsdienst
Hier oben im siebten Stock der Zitadelle lagen auch die Privatgemächer des Kommandanten und anderer wichtiger Offiziere. Es gab keinen sichereren Ort im ganzen Reich als diesen. Genau deshalb gab es mir zu denken, als ich herausfand, dass man hier auch uns drei Gemächer zur Verfügung gestellt hatte. Ein Gutes hatte es: Leandra ließ sich leicht überzeugen, meine Gemächer mit mir zu teilen.
»Ist dir etwas aufgefallen?«, fragte sie und unterdrückte ein Gähnen. Sie ließ achtlos ihr Gewand fallen, setzte sich auf das breite Bett und stellte Steinherz zur Seite.
»Nur, dass diese Räume im Schnitt denen des Obristen ähneln. Aber sie sind karger. Die gute Nachricht ist, dass es hier eines dieser wundersamen Bäder gibt, die du so liebst.«
»Das ist gut zu wissen«, meinte sie und lehnte sich im Bett zurück. »Aber das ist nicht das, was ich meinte. Der Obrist war voller Fragen an mich und auch Serafine, die ihn zu faszinieren scheint. Aber dich hat er sehr wenig gefragt.«
»Vielleicht war ich nur noch nicht dran«, meinte ich und legte mich neben sie. »Wir …«
Ihr leises Schnarchen unterbrach mich und ließ mich schmunzeln. Fünf Kerzenlängen waren es nur noch bis zur Audienz, doch der Obrist hatte versprochen, uns rechtzeitig wecken zu lassen. Ich legte mich in die Kissen, zog die Decke über uns und schlief ebenfalls ein.
Serafine weckte uns. Leandra nuschelte etwas und kuschelte sich tiefer in die Laken, während ich mich festhielt, um nicht aus Versehen aus der Hängematte zu fallen, wie es mir so oft an Bord der Schneevogel ergangen war. Es war eine Erleichterung festzustellen, dass dieses Bett nicht schwankte.
»Was ist?«, fragte ich und schüttelte den Kopf wie ein nasser Hund. Fetzen eines dunklen Traums hingen mir noch nach. »Ist es denn schon so weit?«
»Nein«, sagte Serafine leise. »Du kannst sie schlafen lassen. Es geht um Angus.«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Der Nordmann war uns in Gasalabad mehr als hilfreich gewesen, und im Schmugglerhafen Alderloft hatte er mir und Serafine wahrscheinlich das Leben gerettet, als er eine Kriegsbestie aus Thalak erschlug, jedoch schien er eine Neigung zu besitzen, in Schwierigkeiten zu geraten.
»Er und Sieglinde machten sich auf die Suche nach einem guten Bier und fanden eine Taverne, in der auch Varländer verkehrten. Dort kam es zu einem Streit, und dann erschienen Soldaten, um ihn zu verhaften. Er befindet sich in einer Zelle auf der Hafenkommandantur.«
»Wegen einer Schlägerei?«, fragte ich müde, während ich nach meinem Hemd griff, um es mir überzuziehen. Ich ließ den Kopf hängen und massierte mir den Nacken. Ich war sehr versucht, den Nordmann in Soltars Höllen zu wünschen und weiterzuschlafen.
»Nicht ganz«, erklärte Serafine. »Es war nicht wegen der Schlägerei. Einer der anderen Varländer meinte ihn zu erkennen und warf ihm Verrat und Feigheit vor. Die Seeschlangen haben Angus verhaftet, aber der Auftrag dazu kam aus der Botschaft der Varlande hier in Askir. Sie verlangt seine Auslieferung mit dem Ziel, ihn hinzurichten. Diesmal geht es nicht um Weiberröcke, er ist in ernsten Schwierigkeiten. Sieglinde kam zu mir, um davon zu berichten, und sie sagte, dass man wohl kaum noch etwas tun könnte.«
In meinem Kopf begann es zu pochen. Mit dem Stiefel in der Hand sah ich zu ihr hoch. »Ich befürchte, sie wird recht behalten. Wir können kaum etwas tun«, teilte ich ihr leise mit, noch immer darauf bedacht, Leandra nicht zu wecken. Zu spät, wie sich nun zeigte, denn sie hob ihren Kopf aus den Kissen und richtete sich auf.
»Es wäre tatsächlich ein Fehler«, sagte sie. Sie wirkte noch verschlafen, doch ihre Stimme war klar und hart. »Wir werden die Unterstützung der Varländer in diesem Krieg brauchen, also erscheint es mir nicht sinnvoll, sie zu verstimmen. Es ist Angus’ eigene Schuld. Was auch immer er getan hat, es ist nicht unsere Sorge.«
Ich sah sie überrascht an. »Er war bereit, für dich zu sterben, Leandra«, erinnerte ich sie.
Ihr Kopf schnellte herum, und sie bedachte mich mit einem Blick aus rot glühenden Augen. »Aber ich bin nicht bereit, meine Mission für ihn zu gefährden, Havald! Hier geht es um Größeres. Er war uns eine Last, wie die Läuse, die er uns so überreichlich mitgebracht hat! Seitdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, brachte er uns nur Zwietracht und Verdruss und reichlich Ärger! Wenn die Varländer ihn hängen, ist es seine eigene Schuld. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht!«
Ihr Ausbruch überraschte mich. »Ich wusste nicht, dass du ihn derart wenig schätzt.«
»Er ist dein Freund, Havald, nicht meiner. Es hat mich nicht wenig Anstrengung gekostet, ihn zu ertragen. Ohne deine Fürsprache hätte ich ihn nie in meiner Nähe geduldet. Ich kann ihn nicht leiden, und das, Havald, musst du akzeptieren, ob es dir nun passt oder nicht!«
»Er ist nicht mein Freund«, widersprach ich milde, auch wenn es mir schwerfiel, ruhig zu bleiben. Es war die Wahrheit, denn etwas an Angus kam mir unecht vor, ich konnte ihm noch nicht in allem vertrauen.
»Gut. Dann sehe ich auch kein Problem. Der Kommandant erwartet uns in Kürze, das ist wichtiger. Ich wünsche Angus keinen Schaden, aber er hat sich selbst ein Bett gemacht, nun soll er darin liegen.«
»Er hat nicht einen Lidschlag gezögert, sich für dich einzusetzen, Leandra«, meinte jetzt auch Serafine und musterte Leandra überrascht.
»Es war seine Entscheidung«, beharrte Leandra stur. »Gebeten habe ich ihn nicht darum.« Sie funkelte mich an. »Lass ihn fahren, Havald, wir haben genügend andere Probleme!«
Einen langen Moment zögerte ich, dann stand ich auf und ergriff Seelenreißer. »Das kann ich nicht«, entgegnete ich. »Er ist einer von uns.«
»Er ist einer von den Deinen, Havald«, sagte sie und ließ sich ins Bett zurückfallen. »Tu, was du willst. Aber sieh zu, dass er unsere Mission nicht gefährdet!«
»Leandra …«, begann ich, doch sie schnitt mir das Wort ab.
»Ich will munter sein, wenn wir zur Audienz gehen. Den Kommandanten zu überzeugen, ist der wichtigste Schritt auf dem Weg, Thalak zu besiegen. Ich lasse mich dabei von niemandem aufhalten.« Sie schloss die Augen. »Geht«, fügte sie hinzu, »und lasst mich schlafen.«
»So kenne ich sie nicht«, meinte Serafine, als sie die Tür hinter uns ins Schloss zog. »Was ist mit ihr?«
Ich wartete, bis die Wachen vor der Tür uns nicht mehr hörten.
»Ich denke«, sagte ich, »dass es mit Steinherz zu tun hat. Sie hat auf seine Klinge geschworen, die Mission zu beenden, und du weißt, wie Steinherz ist.«
Sie nickte knapp. »Während Leandra gefangen war, habe ich es getragen, von den anderen war ja keiner dazu fähig. Ich … ich fühlte es. Es war, als ob es mir ständig über die Schulter sah und alles missbilligte, was ich tat und dachte.«
Ich konnte mir das gut vorstellen, denn diese dunklen Augen aus Rubin hatten mich schon immer abschätzig gemustert.
»Hast du die Klinge blankgezogen?«, fragte ich sie.
»Ich vermute, ich wäre dazu imstande gewesen«, meinte sie nach kurzem Nachdenken, während wir eilig die breite Treppe hinabgingen. »Aber ich wollte es nicht. Ich kenne Eiswehr und habe erlebt, wie Seelenreißer sein kann, doch Steinherz ist anders als die anderen Bannschwerter. Es berührt das Herz. Selbst mit Seelenreißer bist du imstande, Gnade zu üben, Leandra kann das nicht. Außerdem befürchte ich, dass Steinherz nicht nur einen Schwur auf seine Klinge zu seiner Mission macht, sondern jeden vorschnellen Entschluss als seine Aufgabe versteht.« Sie blieb auf einer Stufe stehen. »Er lässt seinem Träger wenig Spielraum, das ist es, was ich sagen will.«
Ich nickte langsam. In vielen Dingen war Seelenreißer eine fürchterliche Waffe, und auch meine Klinge beeinflusste mein Handeln, doch nicht in diesem Maße. Jedes dieser Schwerter war in meinen Augen eher ein Fluch als ein Segen.
»Wie verhält es sich mit Eiswehr?«, fragte ich. »Ist es auch so schlimm?«
»Sie«, meinte Serafine. »Sie ist weiblich. Und nein. Sie ist anders … nicht so zielgerichtet, dafür um ein Vielfaches anpassungsfähiger. Sie ist ein eher freundliches Geschöpf.«
»Hört sich seltsam an, von einem Schwert so zu sprechen«, meinte ich, während wir durch den Hof der Zitadelle schritten. »Meint du, es … sie lebt?«
»Sie ist zumindest von Leben erfüllt«, erklärte Serafine. »Sie hielt uns geborgen, und es war wie ein langer kühler Traum. Und dennoch ließ sie unsere Seelen nicht frieren. Es ist schwer zu beschreiben, und ich will es nicht noch einmal erleben, aber sie ist gütig. Ihr liegt mehr am Beschützen als am Töten.«
Wenn ich bedachte, mit welcher Gier Seelenreißer einst nach Leben getrachtet hatte, war es in der Tat seltsam, Serafine so von einem Bannschwert sprechen zu hören. Einen Moment lang wünschte ich, man hätte mir damals Eiswehr in die Hände gelegt statt Seelenreißer.
»Eiswehr passte sehr gut zu Jerbil«, sagte Serafine leise, als hätte sie meine Gedanken gelesen. »Sie war sein Schwert. Dass du nun ein anderes führst, hat sicher einen Grund.«
So schnell und zügig, wie wir gingen, dauerte der Weg hinunter in die Hafengarnison nicht ganz so lange wie mit der Kutsche. Mit Besorgnis sah ich die Sonne steigen, noch war Zeit, aber nicht mehr allzu viel. Die Wachen an der Hafengarnison schienen nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen; sie erwiderten meinen Salut, musterten meine Uniform mit Misstrauen und schickten jemanden, den diensthabenden Offizier zu rufen.
Eine zierliche Frau mit einem Blick, dem sicher selten etwas entging, kam heran und stellte sich als Schwertmajorin Rikin vor. Sie hörte uns an und bedeutete uns mit einer knappen Geste, ihr zu folgen.
»Elgata lobt Euch in höchsten Tönen«, teilte sie mir mit, als sie uns eine Treppe hinunterführte und durch einen langen Gang. »Euer Rang allein hätte nicht gereicht, Euch Zugang zum Gefangenen zu gewähren. Dass Elgata zu Euch steht, gab den Ausschlag.« Sie winkte einen Korporal herbei, der uns eine schwere Tür aus Stahl aufschloss. In der kargen, fensterlosen Zelle hinter dieser Tür saß unser Nordmann niedergeschlagen auf seiner Pritsche, den Kopf schwer in seine Hände gestützt. Er sah auf, als er die Tür hörte, und seine Augen weiteten sich ungläubig.
»Ihr habt ein Viertel einer Kerze Zeit, nicht mehr«, erklärte uns die Majorin und schloss hinter uns die Zellentür.
»Havald«, rief der Nordländer erstaunt und eilte auf uns zu. »Ich hätte nicht gedacht, dass du noch für mich Zeit finden würdest!« Weit kam er nicht, denn eine klirrende Kette an seinem linken Knöchel hielt ihn zurück.
»Setz dich«, wies ich ihn an. »Viel Zeit haben wir wahrlich nicht. Ich bin hier, um zu hören, was du zu sagen hast. Verlier keine Zeit und spar dir die Umwege! Bist du schuldig an dem, was man dir nachsagt, oder nicht?«
Er setzte sich und sah mit gequälter Miene zu mir auf. »Ich fürchte, dass ich es bin.«
Ich seufzte. Ich hatte es erwartet, aber etwas anderes gehofft. »Was genau ist geschehen?«
»Ich war einst ein geachteter Krieger des Wolfsklans meiner Heimat«, begann er leise. »Ein Prinz meines Volkes, der Jüngste von fünf, wollte sich auf eine Erkundungsreise um die Welt begeben und suchte unter den besten Kriegern meiner Heimat zehn, die ihm als Leibgarde dienen sollten. Die Kämpfe um diese Ehre waren hart, doch das Glück war mir gewogen, als Letzter der zehn wurde ich dazu bestimmt, für ihn sterben zu dürfen. Ich erhielt den Armreif meiner Würde und ging stolz und von vielen beneidet an Bord des Schiffs des Prinzen. Ach, Havald«, seufzte er, »es war ein glorreicher Tag, der beste meines Lebens! Aber bald zeigte sich, dass diese Reise unter einem ungünstigen Stern stand. Der erste Teil der Reise verlief ganz nach Wunsch, doch kurz vor Aldar begann das Unglück. Der Mast brach, und wir mussten in Aldar warten, bis ein neuer angefertigt werden konnte. Vier Wochen später als geplant liefen wir dann endlich aus, doch jetzt begann die Zeit der Stürme. Einer ereilte uns kurz vor Janas, und als die Wolken sich verzogen, wussten wir, dass uns die Götter nur verspotteten, denn der neue Mast war jetzt ebenfalls gebrochen, das Schiff so zerschlagen, dass es kaum mehr schwamm, und am Horizont erblickten wir die Segel der Piraten. Unter anderen Umständen hätten wir über sie gelacht, doch bei einem waidwunden Schiff fanden auch diese Hyänen der Meere ihren Mut.« Er ballte seine Fäuste, sah auf sie hinab und entspannte sich mit sichtlicher Mühe, bevor er mit rauer Stimme weitersprach. »Doch es war nicht alles verloren. Es waren nur zwei Schiffe, und wir entschieden uns, sie anzugreifen, bevor sie damit rechnen konnten. Zweimal zehn von uns gingen ins Wasser und warteten auf den Feind, und als er näher kam, um das Schiff anzugreifen, griffen wir die Ruder und stürmten an Bord. Zehn von uns gegen einhundert oder mehr … Niemals wieder habe ich einen solchen Kampf gesehen! Schwer verletzt überstanden der Prinz, ich und zwei meiner Kameraden diese Schlacht. Auch wenn die anderen beiden nicht überleben würden, so hatten wir doch gesiegt. Auch das andere Schiff brannte, und schon wollten wir jubeln, als ein drittes Schiff herankam. Wir hatten Zeit genug erkauft, den Mast zu kappen, der Prinz ließ die Ruder ausbringen und gab den Befehl zum Angriff, und ich sah noch, wie er auf den Gegner deutete, aber dann ereilte mich ein Unglück. Ein Tau, das im Kampf beschädigt worden war, riss, und eine Rah fiel auf mich, um mich halb zu zerschlagen und fast in Soltars Arme zu schicken. Als ich wieder zu mir kam, waren meine Kameraden an ihren Wunden gestorben, ich war allein auf einem Schiff voll von Toten, von den anderen und auch vom Schiff des Prinzen gab es keine Spur. Ich weiß nicht mehr, wie ich an Land gelangen konnte, doch ich schaffte es irgendwie. Wochenlang irrte ich umher, bis ich dann Gasalabad erreichte, eine Stadt, so fremd wie keine andere. Dort dann traf ich einen aus meinem Land, und der erzählte mir, dass der Prinz den Tod gefunden hatte. Man hatte die Reste seines Schiffs zerschlagen an der Küste gefunden.« Seine Augen waren tränennass, und seine Lippen bebten, als er mühsam weitersprach. Er griff nach meiner Hand, umfasste und presste sie so hart, dass ich um meine Knochen fürchtete, doch ich wollte sie ihm nicht entziehen. »Ich hatte vor allen Göttern geschworen«, fuhr er mit gebrochener Stimme fort, »dass ich vor dem Prinzen sterben würde. Dass es anders kam, ist eine Schande, die keiner gleichkommt, die du kennst. Kein Nordmann kann so leben, und ich entschloss mich, meinem Dasein ein Ende zu setzen. Aber dann kam die letzte Schande über mich, denn ich vermochte es nicht zu tun. Was ich tat, Freund Havald, ist das schlimmste aller Verbrechen: Ich fürchtete den Tod und ließ meinen Prinzen vor mir sterben.« Er schüttelte langsam den Kopf und sah mich mit treuen Hundeaugen an. »Ich bin schuldig, Havald, und selbst du kannst hier nichts tun. Ich bin froh darum, dass ich nun sterben werde, es erfüllt mich mit Abscheu, dass mir der Mut fehlt, mich selbst zu richten.«
»Deshalb also warst du so erpicht darauf, im Kampf zu sterben«, sagte Serafine leise, während ich versuchte zu verstehen, was er mir sagen wollte.
»Aye, Helis«, gab er leise Antwort. »Auch meine Prahlerei hat darin ihren Ursprung, und die Jagd nach jedem Weiberrock. Meine Schande lastet schwer auf mir, der Tod macht mir Angst und ist doch eine Sucht. Nur zwischen den Lenden einer Frau spüre ich das Leben und kann vergessen, für einen kurzen, glorreichen Moment! Nur dort finde ich Erlösung, bis die Verzweiflung wiederkehrt!« Er seufzte tief und lang. »Es ist wahr, Havald«, gestand er. »Ich bin froh, dass das Spiel nun ein Ende finden wird.« Er holte tief Luft, stand auf und sah mich mit diesen treuen Augen an. »Verzeihst du mir, dass ich dich hintergangen habe?«, fragte er leise.
»Da gibt es nichts zu verzeihen«, antwortete ich. »Uns gegenüber hast du jeden Eid gehalten, mein Freund.«
»Bin ich das?«, fragte er zögernd. »Dein Freund?«
»Ja, das bist du«, sagte ich und meinte es auch so. Schon lange hatte ich gewusst, dass er etwas zu verbergen hatte, zu kindlich und zu aufgesetzt war seine Rolle gewesen, auch Serafine hatte es schon längst bemerkt. Jetzt, da ich wusste, was sein »Verbrechen« war, verstand ich ihn nur zu gut. Ich wusste, wie bitter die Verzweiflung schmeckte, weiterzuleben, während andere, die hätten leben sollen, vor einem den Weg zu Soltars Hallen gegangen waren.
Er schluckte, trat an mich heran, schluckte erneut und umarmte mich. Ich hielt ihn, als er weinte.
Schweigend öffnete uns Schwertmajorin Rikin die Zellentür, ihrem Blick nach hatte sie alles mitgehört. Sie sagte nichts, und auch mir fiel nicht ein, was ich noch sagen sollte. Im Türrahmen hielt ich inne, drehte mich um und sah, wie Serafine den Nordländer umarmte und wie er nickte und mühsam lächelte, als sie ihm etwas ins Ohr flüsterte.
Sie löste sich und kam zu mir, da schaute er zu Rikin. »Ihr habt mir ein Fass abgenommen, das mir nicht gehört«, sagte er flehend. »Es ist ein Geschenk an diesen Mann, Havald. Majorin, erfüllt Ihr mir den Wunsch und gebt es ihm?«
»Das werde ich tun, Nordmann«, versprach sie, und er nickte dankbar, bevor er zu mir aufsah.
»Es gibt kein besseres Bier auf dieser Welt, mein Freund! Nimm mein Geschenk, Havald, zapf es noch heute an, trink auf mich und sei versichert, es gibt niemanden, der es mehr verdient als du. Der Inhalt dieses Fasses ist mein Erbe an dich, das Einzige von Wert, das ich noch besitze. Und, so Soltar will, diene ich dir in meinem nächsten Leben.«
Was sollte ich sagen? »Ich werde auf dich trinken«, versprach ich ihm. »Der Götter Geleit für dich, mein Freund.« Rikin gab dem Korporal ein Zeichen, und dieser schloss die feste Tür. Langsam gingen wir davon, und ich hörte ihn noch weinen.
»Das«, sagte ich mit rauer Stimme, als ich mit Angus’ Fass unter meinem Arm hoch zur Sonne blinzelte, »hatte ich nicht erwartet.«
Viel Zeit war nicht vergangen, dennoch kam es mir wie eine Ewigkeit vor. Es war früh genug, zur Zitadelle zurückzukehren, vielleicht auch für ein Bad und eine Rasur. »Fast schäme ich mich dafür, dass ich ihm misstraut habe.«
Serafine fiel in meinen Schritt ein und berührte leicht meinen Arm, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
»Du kannst nicht alles tragen, Havald«, sagte sie. »Manches ist, wie es ist. Und du hast ihn selbst gehört. Er hofft, endlich Frieden zu finden.«
»Es kommt mir ungerecht vor«, meinte ich, während wir weitergingen. »Er hat nichts getan, das einer Strafe bedarf. Nur in den Augen der Nordländer ist das so, und in seinen. Ich kann es nicht als Verbrechen werten, zu leben, wenn andere gestorben sind, sonst müsste ich mich selbst verdammen.«
»Tust du das denn nicht?«, fragte sie zögernd.
»Ich tat es. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass am Ende meiner Reise der Gott mir den Sinn des Ganzen eröffnet, aber jetzt schon fühle ich, dass es einen geben wird.«
Sie blieb stehen und sah mich überrascht an. »Meinst du das ernst, Havald?«
»Ja«, gab ich ihr Antwort. »Ich sagte dir ja, dass ich meinen Frieden mit Soltar gefunden habe.«
»Fein, denn es ist nicht gut, mit seinem Gott zu hadern.« Sie pochte mit dem Fingerknöchel gegen das kleine Fass. »Wenn du es öffnest, lädst du mich dann ein?«
Ganz voll war es nicht, sonst hätte es nicht so hohl geklungen, dennoch, es war schwer genug für mehr als einen Becher.
»Danach hättest du nicht fragen brauchen.«
Den Rest des Wegs gingen wir schweigend und in Gedanken.
»Was ist mit Angus?«, fragte mich Leandra, als ich die Tür zu unserem Gemach hinter mir schloss. Sie saß auf dem Bett und probierte eine Perücke an. »Es ist nicht so«, sagte sie, als ich nicht sofort Antwort gab, »dass ich alles an diesem Mann verachte, aber genug ist genug, und er hat uns mehr als seinen Teil an Schwierigkeiten bereitet.«
»Er wird dich nicht mehr belästigen«, sagte ich, stellte das Fass auf einen Tisch nahe der Tür und ging an ihr vorbei ins Bad.
»Havald, ich …«, begann sie, doch ich hatte die Tür schon zugezogen.
Es hatte noch zur Rasur gereicht, ich trocknete mir gerade das Gesicht ab, als ein Soldat der Federn an unserer Tür klopfte, uns mitteilte, dass der Kommandant demnächst für uns Zeit hätte, und höflich andeutete, dass es wohl besser wäre, wenn wir dann ebenfalls bereit wären.
Leandra hatte sich umgezogen, sie trug ihre alte Rüstung mit dem in die Kette eingearbeiteten Symbol des Greifen, aber alles andere, auch der bodenlange Umhang, bestand aus neuem weichem, blendend weißem Leder. Diese Sachen hatte ich an ihr noch nie gesehen. Auf die Perücke hatte sie verzichtet, sie lag, in eine kunstvolle Frisur gelegt, achtlos neben der Wand auf dem Boden. Ich bemerkte dort auch drei Haarnadeln, die ihre Flugbahn zur Wand markierten. Wir beide hatten uns auf den Feuerinseln übel verbrannt, doch dank Zokoras Heilkunst waren wir fast vollständig genesen. Die neue Haut hatte noch nicht die Bräune der unverbrannten Zonen; ich war fleckig, Leandra dagegen hatte einen Weg gefunden, die neue Haut zur alten passend einzubräunen. Der Kontrast zu ihrem Haar war beeindruckend und verlieh ihr eine gewisse Dramatik.
Leandra hatte auf das Klopfen hin die Tür geöffnet, jetzt schloss sie sie und lehnte sich mit dem Rücken gegen das Türblatt, um mich durchdringend zu mustern. Ich trug die Uniform eines Generals der Legionen, die Stiefel hatte ich geputzt, einen neuen Fleck weitestgehend weggerieben, viel konnte sie nicht daran auszusetzen haben.
»Was ist mit Angus?«, sagte sie in einem Tonfall, der verriet, wie viel Mühe es ihr bereitete, ruhig zu klingen. Ganz gelang es ihr nicht, denn kleine Funken überliefen sie, wahrscheinlich bemerkte sie sie nicht einmal.
»Er ist schuldig, wird hingerichtet werden und stellt für deine Mission keine Bedrohung dar«, teilte ich ihr mit. »Deine Befürchtungen waren unnötig.«
»Es könnte von Nachteil für uns sein, wenn er …«
»Nein«, unterbrach ich sie. »Es hat mit uns und dir nichts zu tun, es ist etwas aus seiner Vergangenheit. Etwas, das die Varländer unter sich zu regeln wünschen.«
»Warum bist du wütend auf mich?«, fragte sie. Das Gleiche hätte ich sie fragen können, doch es wäre vergebens gewesen.
»Ich bin nicht wütend«, knirschte ich. »Nicht auf dich. Gehen wir?« Steinherzens Rubinaugen sahen mich spöttisch von ihrem Platz über ihrer Schulter an. Du kannst nicht gewinnen, teilten sie mir mit, du hattest schon verloren, bevor du sie zum ersten Mal gesehen hast, denn sie ist mein.
»Doch, du bist wütend. Erklär mir, warum. Du weißt, wie wichtig meine Mission ist.« Ihre Mission, nicht mehr die unsere.
»Es gibt Dinge im Leben, die auch dann noch wichtig sind, wenn man eine Mission zu erfüllen hat.« Ich wollte mich nicht darauf einlassen, doch es fiel mir schwer. »Manchmal wünschte ich mir, dass wir uns kennengelernt hätten, bevor du deinen Schwur auf diese Klinge geleistet hast. Steinherz verändert dich, Leandra.«
»Du irrst«, teilte sie mir erhaben mit. »Ohne die Mission hätten wir uns nicht kennengelernt. Und nur, weil du mit deinem Schwert im Zwist liegst und mit dem Schicksal haderst, brauchst du nicht zu denken, dass es bei mir auch so wäre. Steinherz und ich sind eins, und so sollte es auch sein, dafür sind die Schwerter gemacht.«
Es hatte keinen Sinn. Genauso gut könnte man gegen eine Wand rennen.
»Wir sollten gehen«, erinnerte ich sie. »Es wäre der Mission abträglich, wenn wir einen schlechten Eindruck machen, indem wir zu spät kommen.«
»Du hast recht«, sagte sie. »Das darf nicht geschehen.«
Ja, dachte ich, ich weiß.
4. Der Kommandant