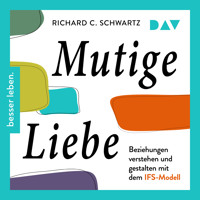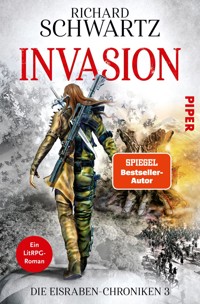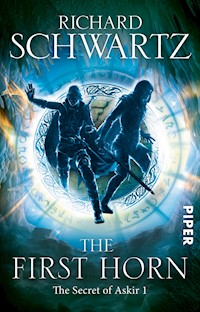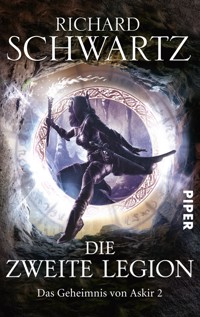8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein dunkler Schatten liegt über der Stadt Aryn: Der sagen umwobene Falke, ein mächtiges Artefakt der Göttin Isaeth, wurde gestohlen – und damit das empfindliche Gleichgewicht zwischen Macht, Intrige und Verrat ins Wanken gebracht. Die Soldatin Lorentha wird nun in die kaiserliche Enklave entsandt, um den Falken mit allen Mitteln zurückzugewinnen. Doch sie ist nicht die Einzige, die nach dem wertvollen Artefakt sucht: Der Magier Lord Raphanael wird Lorentha gegen ihren Willen als Beobachter zugeteilt – und sorgt mit seiner leichtfertigen Art dafür, dass die disziplinierte Soldatin vor ihrer größten Prüfung steht. Werden sie sich in den dunklen Gassen Aryns behaupten oder mit dem Falken untergehen? »Richard Schwartz lässt die Konkurrenz weit hinter sich!« Carsten Kuhr, phantastik-couch.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy: Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2012 entspricht 2. Auflage 2012 ISBN 978-3-492-95863-9 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2012 Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Uwe Jarling Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Dieses Buch widme ich der Leserunde bei Piper-Fantasy.de, deren Teilnehmer mit ihrer Kritik und ihren Vorschlägen maßgeblich dazu beitrugen, dass aus dem »Falken« ein besseres Buch wurde: Uwe »Dnob« Gabriel »Cepheid« Philipp »Phantolemchen« Marina »Noa« Jan Jendrik »Shurti« Maurice »Halmachi« Timo »Omti«
Ein später Gast
1Als der ungesehene Gast das Arbeitszimmer des hageren Mannes betrat, stand dieser am Fenster und schaute auf den nächtlichen Garten hinaus.
»Ihr seid unvorsichtig, Herr«, stellte der späte Gast fest und legte seinen breitkrempigen Hut auf einen der Sessel ab. »Ihr habt die Tür unverschlossen gelassen.«
»Seht es als eine Form der Höflichkeit«, antwortete der hagere Mann, bevor er sich seinem Gast zuwandte und ihn mit einer Geste aufforderte, in einem der Sessel Platz zu nehmen.
Wie üblich lehnte der Angesprochene mit einem leichten Kopfschütteln ab.
»Ihr habt Neuigkeiten für mich?«
»Ihr Vertrag wird nicht verlängert, und man hat sie für die nächsten Wochen vom Dienst freigestellt. Sie wurde letzte Woche verwundet, das hat als Vorwand wohl genügt.«
»Verwundet?«, fragte der hagere Mann erschrocken. »Wie schlimm ist es?«
Sein Gast tat die Frage mit einer nachlässigen Geste ab. »Ein Kratzer, nicht mehr.«
Der Hagere entspannte sich ein wenig. »Diesmal«, sagte er leise. »Diesmal ist es nur ein Kratzer.« Einen langen Moment herrschte Schweigen in dem abgedunkelten Arbeitszimmer. »Was noch?«
»Sie hat eine Passage mit dem nächsten Kurierschiff nach Aryn gebucht.«
Ein Seufzen war zu vernehmen. »Es war abzusehen, dass sie irgendwann dorthin zurückkehren wird.«
Der andere straffte seine breiten Schultern und nickte langsam. »Ihr denkt, dass sie den Mörder ihrer Mutter suchen wird?«
Ein knappes Nicken. »Folgt ihr dorthin. Haltet Euch bereit, wenn sie ihn findet.«
»Es ist über zwanzig Jahre her«, gab sein Gast zu bedenken. »Selbst mir ist das damals nicht gelungen.«
Der hagere Mann schaute zu ihm hinüber. »Ich hege allerhöchsten Respekt für Euch und Eure Fähigkeiten, mein Freund«, sagte er bedächtig. »Aber Ihr seid nicht sie. Sie wird ihn finden. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Euch nach Aryn senden werde.«
Es war nicht leicht, seinen Gast zu überraschen, aber diesmal war es dem Hageren gelungen. Auch wenn der Breitschultrige nur einmal blinzelte.
»Warum dann?«
»Man plant dort eine Rebellion.«
»Eine Rebellion? In Aryn?«
»Ja. Meine Quellen berichten mir davon, dass man dort einen Aufstand plant.«
»Warum lasst Ihr sie dann dorthin gehen?«
Sein Gastgeber schnaubte ungläubig. »Meint Ihr wahrhaftig, ich könnte sie davon abhalten?«
Der breitschultrige Mann nickte langsam. So, wie er die Majorin kannte, war das in der Tat unwahrscheinlich. »Dennoch …«
»Ich kann sie nicht daran hindern, ihrem Schicksal zu folgen. Es ruft sie nach Aryn, schon bevor sie geboren wurde«, meinte der Gastgeber mit einem traurigen Lächeln. »Einmal versuchte ich schon, dagegen anzugehen, Ihr wisst, wohin es führte.« Er schluckte schwer. »Seht zu, dass es sich diesmal so nicht wiederholt.«
Der breitschultrige Mann nickte und griff nach seinem Hut. »Ihr habt bezahlt dafür.«
Ankunft in Aryn
2 Der Hafen von Aryn, dachte Lorentha grimmig, während das Lotsenboot das angeschlagene kaiserliche Kurierschiff Morgenbrise langsam zu seinem vorbestimmten Anlegeplatz schleppte. So viele schlechte Erinnerungen banden sie an diesen Ort, und nur so wenig gute. Ein kühler Wind von See her ließ sie frösteln, und sie zog ihren Umhang enger um sich, obwohl es nicht die Kälte war, die sie frieren oder ihr den Magen krampfen ließ. Hätte sie den Ort nie wieder gesehen – selbst das wäre zu früh gewesen!
Wenngleich es schon nach Sonnenuntergang war, herrschte hier noch immer Betrieb, und durch den Wald der Masten konnte sie die Laternen der Schiefen Bank sehen, wo sich Hurenhäuser und Tavernen dicht an dicht reihten.
Tagsüber bot sich ein anderes Bild, das einer wichtigen Handelsstadt, mit unzähligen Kränen, die keinen Stillstand kannten, Ladung löschten oder prall gefüllte Netze in die Frachträume der Schiffe abließen, ein Bild von Reichtum und Wohlstand. Glänzende Kutschen rollten dann über die Hafenpromenade, die sich um das gesamte Hafenbecken zog, brachten reich gekleidete beleibte Herren her, die eifersüchtig darüber wachten, ob ihre Ladung auch gut und unversehrt angekommen war, um dann in den zahllosen Kontoren und Lagerhäusern im West- und Südteil des Hafens zu verschwinden, während Hunderte Hafenarbeiter schwitzten und sich den Rücken buckelig schufteten, um für einen kargen Lohn die Taschen der Reichen zu füllen.
Doch kaum war die Sonne untergegangen, wandelte sich das Bild. Wer dann noch im Hafen lag und die Ebbe verpasst hatte, der blieb auch über Nacht. Während die Kontore und Lagerhäuser ihre Tore schlossen und sich, meist gut bewacht, auf die Nacht einrichteten, erwachte die Schiefe Bank zum Leben. Mit dem Löschen der Ladung wurden die Kapitäne ausgezahlt, und die wiederum zahlten ihren Leuten die Heuer aus, Lohn für oftmals lange Wochen harter Arbeit und Entbehrungen auf See. Wehe dem Kapitän, der versuchen würde, seine Mannschaft vom ersehnten Landgang abzuhalten, denn auf der Schiefen Bank fand sich alles, was man auf See vermisst hatte. Ob Wein, Bier, Rum oder Schnaps, solange noch ein Kupfer von der Heuer übrig war, vermochte man hier seinen Durst zu löschen, und wem das nicht reichte, der fand andere Vergnügungen, meist in den roten Häusern oder auch davor und überall im Viertel, wo Huren versprachen, den Seeleuten den Weg zum Paradies zu zeigen. Im Lauf der Nacht torkelten oder krochen sie dann wieder zurück auf ihre Schiffe, mit leeren Taschen, pochenden Schädeln und meist um eine Erfahrung oder ein paar Beulen reicher. Ihr Schiff lief aus … und ein anderes nahm seine Stelle ein. Fast jede Nacht blieb dabei irgendjemand auf der Strecke, wurde vom Hafen aufgefressen und später wieder ausgespuckt oder aus dem dunklen Wasser gezogen …
Lorentha kannte dieses Spiel und diesen Hafen, war so oft von ihm fast aufgefressen worden, dass es ein Wunder war, dass sie noch lebte.
Entschlossen wandte sie den bunten Laternen den Rücken zu und sah zu der Anlegestelle hin, die nun, da das Lotsenboot das angeschlagene Schiff um einen großen Kahn herumgezogen hatte, auch für sie frei einsehbar war. Hier, im Südteil des Hafens, war es ruhiger, die meisten der Anlegestellen lagen hinter gut bewachten Toren, den reichsten Händlern vorbehalten, oder, wie in diesem Falle, der Marine des Kaiserreichs. Vier Liegeplätze gab es dort, drei davon besetzt, zwei davon von einem Linienschiff, das wie ein Riese unter Zwergen wirkte, mit vier Masten und vierundfünfzig Kanonen, eine Demonstration kaiserlicher Macht, die etwas an Wirkung verlor, kam man, wie sie jetzt, nahe genug heran und konnte nur zu gut sehen, wo die Farbe Risse hatte oder die Takelage zu verrotten begann. Vielleicht, dachte die Majorin, war es sogar dasselbe Schiff, das schon damals hier verrottet war, für den Fall war es allerdings ein Wunder, dass es noch immer schwamm.
Auf der anderen Seite löste gerade ein anderes Schiff die Leinen, ebenfalls ein Kurier, mit schmalen Flanken und einem scharfen Bug, ein Schwesternschiff der Morgenbrise, nur dass die Morgentau – Lorentha schüttelte verständnislos den Kopf, wer kam nur auf solche Namen? – noch beide Masten besaß. Dahinter lag das kaiserliche Trockendock, später würde man dort versuchen, ihrem Schiff einen neuen Mast zu geben, doch für jetzt blieb nur eine Liegestelle übrig.
Wie es aussah, erwartete man das Schiff schon sehnlichst. Ein schwerer Kastenwagen und ein Kontingent von zehn Marinesoldaten standen bereit, einmal alle drei Monate brachte eins dieser Schiffe den kaiserlichen Sold, und diesmal war es ihr Schiff gewesen.
Sie erinnerte sich noch gut daran, wie sie und Raban von dem Dach dort hinten aus mit brennenden Augen zugesehen hatten, wie die schweren Kisten verladen wurden und davon träumten, einen Weg zu finden, die fränkischen Soldaten um ihren Sold zu erleichtern. Vielleicht sollte sie mal nachfragen, ob es jemals jemandem gelungen war, dachte Lorentha mit grimmiger Erheiterung, sie hatte ihren Zweifel daran.
Die beiden anderen Wagen waren für die Post bestimmt, die säckeweise den Laderaum der Morgenbrise füllte, doch bei dem Anblick der schwarz lackierten Kutsche mit dem kaiserlichen Wappen an dem Schlag krampfte sich ihr Magen nur noch mehr zusammen. Mit der Kutsche wartete ein livrierter Diener, dessen goldene Livree keinen Zweifel daran ließ, dass er in den Diensten des Gouverneurs stand, und noch bevor die ersten Leinen an Land geworfen wurden, konnte sie bereits den gesiegelten Umschlag erkennen, den der Mann in Händen hielt.
So viel also zu der Ruhe, die sie sich hatte gönnen sollen.
»Nehmt Euch eine Auszeit, Lorentha«, hatte Oberst von Leinen zu ihr gesagt. »Gönnt Euch Ruhe, bis Ihr wieder ganz erholt seid.« Er hatte freundlich, ja, schon fast väterlich dazu gelächelt. »Jeder wird es verstehen, es wird auch Zeit, dass Hauptmann Janiks etwas von der Verantwortung erlernt, die es braucht, will man die Garda führen.« Unüberhörbar natürlich die Andeutung, dass sie darin versagt hatte. Also hatte man Janiks schon als ihren Nachfolger bestimmt.
»Wie lange?«, hatte sie gefragt.
»Ach, vier Wochen sollten reichen«, war von Leinens nachlässige Antwort gewesen. Er hatte auf die Unterlagen auf seinem Tisch herabgesehen, als ob er mit den Gedanken schon ganz woanders wäre. »Bis dahin wird sich der Stich gegeben haben, dann werden wir wohl weitersehen.«
Jetzt sah sie auf ihre Hände herab, die sich in das Holz der Reling krallten, und zwang sich dazu, ruhig zu bleiben. Von Leinen war ihr Vorgesetzter, er war für die südliche Garda verantwortlich, und die Garda in Augusta unterlag ebenfalls seiner Verantwortung. Dennoch hatte sie ihn in den fünf Jahren, in denen sie die Garda in der Hauptstadt kommandiert hatte, selten genug zu Gesicht bekommen. Auch wenn er freundlich getan hatte und die Worte anders klangen, wusste sie, dass dieses Gespräch für sie das Ende ihrer Zeit in der Garda eingeläutet hatte.
Er hätte auch gleich sagen können, dass die Kommission entscheiden würde, ihr Patent nicht zu verlängern. In zwei Monaten waren es zwölf Jahre, die sie der Garda diente. Nach zwölf Jahren musterte ein Offizier nicht ab, der Viertelsold, den man als Ruhegeld erhielt, reichte nicht ansatzweise für ein Leben, erst nach vierundzwanzig Jahren erhielt man den ersehnten halben Sold, von dem es sich dann leben ließ.
Doch um Sold war es weder ihr noch dem Herrn Oberst gegangen. Vielmehr darum, dass sie zwei Tage zuvor einen Mann in schweren Fesseln in eine Zelle hatte verbringen lassen, den sie selbst auf frischer Tat ertappte, als er einem anderen mit seinem Gehstock den Schädel eingeschlagen hatte.
Schon zwei Stunden später hatte ein steifer Advokat ihr die Papiere vorgelegt, die besagten, dass ihr Gefangener tatsächlich der war, der er angegeben hatte zu sein, und dass es für sie Konsequenzen haben würde, einen Grafen des Reichs, ja mehr noch, einen Berater am Hofe Kaiser Heinrichs, derart öffentlich gedemütigt zu haben. Bei der Erinnerung daran schnaubte Lorentha verächtlich, die verantwortungsvolle Aufgabe des Grafen bestand darin, darauf zu achten, dass es immer genügend Fasanen in den Gärten gab!
Von dem erschlagenen Müller, der dazwischenging, als der Graf sich an seinem Weib vergriff, war schon nicht mehr die Rede gewesen.
Die Garda schützte das Recht des Kaiserreichs. Ein gleiches Recht für alle. So hieß es. Doch die Wahrheit sah anders aus.
Schon am nächsten Tag hatte eine Kommission befunden, dass Graf von Bergen berechtigt gewesen war, sich bei einem Angriff auf Leib und Leben zu verteidigen, vor allem, da es ein Bürgerlicher gewesen war, der es gewagt hatte, die Hand gegen einen Adeligen zu erheben, womit der Fall dann abgeschlossen war. Bis darauf, dass der Graf darauf bestand, eine schriftliche Entschuldigung von Lorentha zu verlangen.
Er bekam sie noch am selben Tag. Schon als sie schrieb, wie sehr sie es bedauerte, mit dem Grafen so verfahren zu sein, wie es die Vorschrift der Garda für den Fall verlangte, dass man einen Mörder auf frischer Tat ertappte, wusste sie, dass sie damit auch gleich ihren Dienst hätte quittieren können.
Vielleicht war es ihr Weg gewesen, die Entscheidung zu erzwingen, die schon seit Jahren überfällig gewesen war.
Jetzt, als die Mannschaften die Leinen festzogen und die Planke ausbrachten, konnte sie nur bitter darüber lachen, mit welchem jugendlichen Idealismus sie damals zur Garda gegangen war, ein trotziges Kind, das alle Warnungen in den Wind geschlagen hatte, das sogar mit seinem Vater darüber brach, das zeigen wollte, dass man die Welt verändern konnte, so man es nur wollte.
Für eine gewisse Zeit schien es auch, als wäre es möglich. Sie hatte in der Tat ein Händchen dafür gehabt, Verbrechen aufzuklären. Wie hatte ein Subaltern damals gesagt? Als ob sie in die Köpfe der Verbrecher sehen könnte. Nur war ihm gar nicht klar gewesen, wie recht er damit hatte. Sie wusste, wie sie dachten, weil sie selbst eine Verbrecherin gewesen war.
Recht früh hatte sie die Aufmerksamkeit eines Mannes erregt, der sie lachend darin bestärkt hatte, das Unmögliche zu wagen. Erst nur ihr Vorgesetzter, später Freund und Lehrmeister und ganz zum Schluss auch Liebhaber, war Herzog Albrecht, der jüngere Bruder Kaiser Heinrichs, kein Mann, der das Wort »unmöglich« kannte.
Unter seinem Schutz war ihr Licht hell erstrahlt, war sie von Erfolg zu Erfolg geeilt, bis man ihr das Kommando über die Garda der Hauptstadt übertragen hatte. Doch dann, nach dem feigen Mord an ihm, hatte es sich sehr schnell gezeigt, welcher Neid, welche Missgunst sich vor seinem strahlenden Licht versteckt hatte, und wäre sie klug gewesen, dachte sie jetzt, hätte sie damals schon ihren Abschied genommen. Doch sie war besessen davon gewesen, den Mord an dem zweitmächtigsten Mann des Kaiserreichs aufzuklären, getrieben davon, den Mörder ihres Mentors zu stellen und ihn hängen zu sehen.
Doch mittlerweile hatte sie einsehen müssen, dass es zu viele gegeben hatte, die dem Herzog Übles wollten, die es nicht hatten dulden wollen, dass sein Glanz sie alle überstrahlte. Von einem Herzriss sprach man, dachte sie jetzt bitter, und man hatte es ihr mehr als deutlich gemacht, dass auch sie nicht anders davon sprechen sollte.
Herzog Albrecht war eine überlebensgroße Gestalt gewesen, ein robuster Mann mit einem schallenden Lachen, der nichts ernst zu nehmen schien und gar nicht bemerkte, wie sich gewöhnliche Sterbliche um das mühten, was ihm mit Leichtigkeit gelang. Hinter der Maske von Ehrerbietung und Unterwürfigkeit waren ihm Neid und Missgunst auf dem Fuß gefolgt, ohne dass er es je bemerkte, und zum Schluss hatte sein Stern so hell geleuchtet, dass sich Lorentha in dunklen Momenten wie diesen sogar fragte, ob er nicht selbst für Kaiser Heinrich zu hell gewesen war.
Doch jetzt, als sie sich straffte und das Kinn anhob, war der Majorin von diesen düsteren Gedanken wenig anzusehen. Sie rückte ihr Schwert zurecht und zog einen Riemen gerade, um, kaum dass die Planke ausgebracht war, an Land zu gehen. Das schmale Holz wippte unter ihrem Gewicht, oft genug hatten andere darauf ihr Gleichgewicht verloren und Bekanntschaft mit dem Wasser gemacht, sie jedoch schien keinen Gedanken daran zu verschwenden.
Der Diener, dem man aufgetragen hatte, auf sie zu warten, schluckte, als er sie näher kommen sah. »Er wird sie leicht erkennen können«, hatte ihm der Sekretär gesagt, als er ihm die Order für die Majorin in die Hand gedrückt hatte. »Sie ist eine große Frau und wird die lederne Rüstung der Garda tragen.«
Groß war untertrieben, dachte der Diener, als er nun staunend zu ihr aufsah, sie mochte fast sechs Fuß erreichen! Mit ihrem scharf gezeichneten Gesicht, den festen blonden Haaren, welche sie achtlos zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, und den dunkelgrünen Augen einer Katze sah sie für ihn verwegen aus. Fast wäre er sogar vor ihr zurückgewichen, doch dann trat sie vor ihn, um ihm eine Hand in festem Handschuh entgegenzuhalten.
»Major Sarnesse«, stellte sie sich ihm mit einer dunklen Stimme vor. »Hat Er Nachricht für mich?«
»Ja«, sagte der Mann und schaute blinzelnd zu ihr hoch, als er ihr die Nachricht reichte. »Von Seiner Exzellenz dem Gouverneur. Er …«
Sie hob die Hand, und eingeschüchtert hielt er inne. »Ich kann es mir denken«, meinte sie müde, während sie das Siegel brach und die kurze Nachricht überflog. Es war leicht zu erkennen, wie wenig ihr gefiel, was sie da las, ihre Wangenmuskeln mahlten, dann schaute sie zu ihm. Diesmal wich er doch vor ihr zurück, doch der Zorn in ihren Augen galt nicht ihm. »Es gibt nur eine Seekiste als Gepäck, kümmere Er sich um sie.«
Der Diener nickte hastig und eilte zum Lademeister hin, um ihn zu drängen, diese Kiste noch als Erste auszuladen. Verstohlen sah er zu ihr zurück, doch sie achtete nicht auf ihn, ihr Blick war gen Norden gerichtet, wo in der Ferne, im Mondlicht nur schattenhaft zu erkennen, die hohen Türme des Tempels zu sehen waren.
Wer auch immer es war, dem dieser Zorn galt, dachte der Diener eingeschüchtert, er würde nicht mit ihm tauschen wollen. Aber bevor ihr Blick doch noch einmal auf ihn fiel, erinnerte er sich, sollte er wohl besser darauf achten, dass ihre Kiste nicht einen Kratzer abbekam oder am Ende noch ins Wasser fiel.
Eine erzwungene Audienz
3 Es gab einen Audienzsaal im Palast des Gouverneurs, wenn sie sich recht erinnerte, stand sogar ein Thron darin, aber dorthin führte sie der Diener nicht, vielmehr ging es durch einen langen Gang, von dessen hohen Wänden ihre Schritte widerhallten. Der Mann ging durch eine hohe Tür, die zu einem großen Vorzimmer führte, das jetzt leer und verlassen lag, an zwei Schreibtischen vorbei zu einer anderen hohen Tür, an der er klopfte und die er dann für sie aufzog.
Dieser Raum war überraschend freundlich eingerichtet, mit hohen verglasten Türen, die zum Garten des Palasts führten und nun mit schweren Vorhängen verhangen waren, einem Kamin aus Marmor, einer hohen Decke mit einem Gemälde daran, das leicht bekleidete Schäferinnen bei einem Tanz auf einer Wiese zeigte. Links von ihr sah ein alter Mann mit einem steifen Kragen von seinen Akten auf und lächelte sie freundlich an.
Die Feder in seiner Hand und die Tintenflecken an seinen Ärmeln und, vor allem, die runde Brille auf seiner Nase erinnerten sie an einen Mann, jünger damals, der als Einziger freundlich zu ihr gewesen war, als man sie damals mit rauen Soldatenhänden, nass und verdreckt, durch diese selbe Tür gestoßen hatte. Fellmar hieß er, erinnerte sie sich, und schenkte ihm ein freundliches Lächeln, um dann zu dem Mann hinzusehen, der sie hierhergeordert hatte.
Seine Exzellenz, Graf Montagur Mergton, Gouverneur der kaiserlichen Stadt Aryn und damit, leider, auch jedem Offizier der Garda vorgesetzt, den es in die Stadt verschlagen würde. Also, in diesem Fall, ebenfalls ihr.
Vor ihm breitete sich ein Schreibtisch aus, groß genug, um darauf ein Manöver abzuhalten. Er war leer bis auf ein silbernes Tablett mit Gebäck und eine Kanne mit zwei Tassen. Und eine gut fingerdicke Akte, die das Siegel der kaiserlichen Garda trug. Lorentha fragte sich, wann er sie hatte anfordern lassen, eigentlich hätte sie gedacht, dass nicht genug Zeit dafür gewesen wäre.
Jetzt hörte sie sein Korsett knirschen, als er sich etwas vorbeugte, um sie mit einem freundlichen Lächeln zu begrüßen.
»Ah, Major, schön, Euch zu sehen«, meinte er, als hätte er sie nicht noch am späten Abend herbefohlen. »Ich hoffe, Ihr habt eine angenehme Überfahrt gehabt? Wir waren schon besorgt.«
»Nein«, antwortete sie kühl. »Wir gerieten in einen Sturm, der zu einem Mastbruch führte, und bis wir vorhin in den Hafen einliefen, hielt die Mannschaft die Lenzpumpen in Betrieb.«
Mittlerweile war Meister Fellmar an sie herangetreten, um von ihr Umhang, Handschuhe und Schwert entgegenzunehmen.
Ihre scharfe Antwort ließ den Grafen blinzeln. »Das ist bedauerlich«, erwiderte er knapp. »Ich weiß nicht, ob Ihr Euch an mich erinnern könnt, Lorentha. Wir haben uns schon einmal gesehen, ich habe damals Eurer Mutter meine Aufwartung gemacht, Eure Frau Mutter und ich waren gut miteinander befreundet.«
Richtig. Damals hatte er noch mehr Haare gehabt und war deutlich schlanker gewesen. Er hatte im Salon auf ihre Mutter gewartet, Lorentha freundlich angelächelt, als er sie sah, und dann mit ihr gesprochen, als wäre sie drei Jahre alt und nicht fast schon neun. Gut befreundet? Nur mit Mühe unterdrückte sie ein Schnauben. Ja, er war ihrer Mutter ein Jugendfreund gewesen, hatte ihr sogar den Hof gemacht. Früher. Aber damals, vor über zwanzig Jahren, als er sie aufgesucht hatte, hatten sie sich bereits seit Jahren nicht mehr gesehen. An jenem Abend war er mit Blumen gekommen, um der alten Zeiten willen, und hatte ihre Mutter dazu gedrängt, ihm zu erlauben, sie zu einem Ball zu führen. Sie hatte ihn lachend gebeten, sie nicht zu sehr zu bedrängen, sie wäre eine verheiratete Frau, und er hatte es ihr dann auch versprochen. Ihre Mutter hatte es nicht ernst genommen, aber Lorentha erinnerte sich nur zu gut an den brennenden Blick, mit dem er ihre Mutter angesehen hatte, wenn er dachte, sie würde es nicht bemerken. Jetzt daran anknüpfen zu wollen, war ein Fehler des Herrn Grafen, denn angenehm war er ihr nicht in Erinnerung geblieben.
»Ja«, sagte sie distanziert. »Ich erinnere mich.«
Seine Augen zogen sich etwas zusammen, als er den Unterton in ihrer Stimme spürte, aber sie hielt ihr Gesicht neutral, sah nur geradeaus auf die Wand hinter ihm. Er hatte sie als Soldatin herbefohlen, wollte er es anders haben und sich in Erinnerungen ergehen, hätte er sie auch zum Tee laden können. Nur, dass sie dann nicht gekommen wäre. Jetzt gab es nur noch einen Grund mehr, die Vorschrift zu verfluchen, die von ihr gefordert hatte, sich schriftlich bei ihm anzumelden.
Auf eine Geste des Grafen hin schob Meister Fellmar ihr einen Stuhl zu, sie lächelte ihn dankbar an und setzte sich. Ihr Lächeln erstarb jedoch sogleich wieder, als sie den Grafen direkt ansah.
»Mit Verlaub, darf ich fragen, warum Ihr mich habt rufen lassen?« Eigentlich erstaunlich, dachte sie, als sie sah, wie sehr sein steifer Kragen auf sein Doppelkinn drückte, dass er in dem Korsett noch Luft bekam. So freundlich dieser Raum ihr am Anfang auch erschienen war, jetzt schien er sie erdrücken zu wollen.
»Wir brauchen nicht so förmlich zueinander zu sein, Lorentha«, meinte der Graf nun mit einem Lächeln, das ihr sogar echt erschien. Er wies auf ein silbernes Tablett, auf dem sich Gebäck befand. »Wollt Ihr vielleicht etwas Gebäck und Tee? Ich darf Euch doch Lorentha nennen? Schließlich kannte ich Euch schon als Kind.«
»Wenn es Euch beliebt«, antwortete sie. Es war deutlich zu erkennen, dass er sich um sie bemühte, etwas, das ihr selten genug widerfuhr, nur dass, ihrer Erfahrung nach, jemand nur dann freundlich zu ihr war, wenn er etwas wollte.
»Ihr seid so direkt wie Eure Mutter«, sagte er jetzt, während sein Lächeln ein wenig dünner wurde. »Also gut. Ich weiß, warum ihr nach Aryn gekommen seid.«
Was auch nicht schwer zu erraten war. Er schien auf ihre Antwort zu warten, doch sie sah ihn nur gleichgültig an.
Er seufzte. »Gut, wenn Ihr es deutlich haben wollt: Ich weiß, dass Ihr hergekommen seid, um den Mord an Eurer Mutter aufzudecken.« Sein Blick fiel nun auf die goldene Marke mit dem Löwenkopf daran, die sie auf ihrer linken Schulter trug. »Eure Zeit bei der Garda hat Euch in dieser Beziehung viel gelehrt, ich hörte so einiges von Euren Erfolgen.«
Was erwartete er von ihr zu hören? Wollte er, dass sie ihm von diesen Erfolgen, so sie denn welche waren, erzählte? Sollte sie ihn in dem Glauben lassen, dass es Rache war, die sie hierhergetrieben hatte? Oder sollte sie ihm erzählen, dass es in ihr eine Verzweiflung, eine Wunde in ihrem Herzen gab, dass es ihr nur um Antworten ging, nur um das Warum? Dass sie verstehen wollte, wer und was sie war? Götter, warum zitierte er sie mitten in der Nacht herbei, nur um dann alte Wunden aufzureißen?
Also sah sie ihn nur an, mit diesem kalten Blick, der ihr bislang am besten geholfen hatte, und der mühsam erlernten Geduld und dem Wissen, dass die, die etwas sagen wollten, es auch sagen würden. Das galt wohl ebenfalls für ihn.
»Lorentha«, meinte er, nachdem ihm das Schweigen zu lange geraten war. Er beugte sich etwas vor, um sie eindringlich anzusehen. »Ihr scheint da etwas misszuverstehen. Ihr seid hier unter Freunden. Ich selbst habe mich die ganzen Jahre darum bemüht, den Mord an Eurer Mutter aufzuklären, doch es ist mir nicht gelungen. Zwar fehlt mir die Erfahrung in solchen Dingen, die Ihr ja nun besitzt, aber ich werde Euch nach Kräften unterstützen. Ich will Euch auch nicht davon abhalten, und wäre dies alles, hätte ich Euch morgen oder übermorgen meine Aufwartung gemacht und gefragt, wie ich Euch helfen kann. Doch es hat sich etwas ergeben, das, wie ich fürchte, Eure Pläne zunichte macht.«
»Und was?«, fragte sie abweisend. Was dachte er denn, was ihre Pläne wären?
»Was wisst Ihr noch über die Stadt Aryn, Kaiser Pladis und Prinzessin Armeth von Manvare?«
»Nicht viel mehr, als alle wissen«, gab sie ungehalten zurück, während sie sich fragte, was das alles sollte. »Er kam als junger Prinz hierher, wurde am hiesigen Königshof vorgestellt, verliebte sich in Prinzessin Armeth, sie heirateten, und sie brachte die Stadt als Mitgift in die Ehe mit. Sie schenkte ihm einen Erben, doch Kind und Mutter starben im Kindbett, und es gab Gerüchte, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre. Dies führte zu einem Aufstand der manvarischen Adeligen in der Stadt, der jedoch blutig von kaiserlichen Marinesoldaten niedergeschlagen wurde. Seitdem halten wir die Stadt … und Manvare das Umland. Das ist jetzt knapp zweihundert Jahre her.« Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich mich kaum noch an die Stadt erinnere und mich die Geschichte wenig interessiert. Können wir die Geschichtslektion für den Moment vergessen und zum Punkt kommen?«
»Nur Geduld«, bat er sie, obwohl er wissen musste, dass Geduld nicht ihre Stärke war. »Die Geschichtslektion ist der Punkt. Denn genau darum geht es. Ihr habt recht, die Prinzessin brachte Aryn als Mitgift in die Ehe mit, doch sie erhielt ein Brautgeschenk von dem Prinzen, das ebenfalls von unschätzbarem Wert war, vor allem für die Manvaren: den Falken von Aryn. Eine lebensgroße, reich verzierte Statue eines Falken, der Göttin Isaeth geweiht. Der Falke spielt eine besondere Rolle hier in Aryn. Denn es gibt eine Legende …« Mergton atmete tief durch. »Die Stadt hatte ihren Anfang als Tempeldorf, bis heute ist der Tempel von Isaeth ein Wallfahrtsort für die Gläubigen. Damals war Manvare noch zersplittert, und Kriegsherren kontrollierten das Land, und einer von ihnen plante, die Hohepriesterin der Isaeth als Unterpfand zu nehmen, um sie zu zwingen, seine Herrschaft zu bestätigen. Der Legende nach schickte die Göttin ihrer Priesterin einen Falken, um sie zu warnen. Als der Kriegsfürst eintraf, fand er sich einem Tempel gegenüber, dessen Tore fest verschlossen waren – und der damaligen Hohepriesterin mit dem Falken auf ihrer Schulter, die ihn darüber in Kenntnis setzte, dass die Truppen seines Erzrivalen bereits auf dem Weg waren, um ihn zu schlagen. Wutentbrannt stürzte sich der Kriegsherr auf die Priesterin, doch der Falke warf sich dem Mann entgegen, fing den für die Priesterin gedachten Schwertstreich mit seinem Körper ab und schlug, sterbend, dem Kriegsherrn seine Krallen so tief ins Auge, dass dieser geblendet wurde und zu Tode kam.«
Lorentha erinnerte sich daran, wie ihre Mutter davon gesprochen hatte, von der Verzweiflung, die diese Priesterin empfunden hatte, von dem Mut, den sie gebraucht hatte, um dem Kriegsherrn entgegenzutreten, was es brauchte, um so zu glauben! Es war eine der Geschichten, die sie als Kind immer zutiefst bewegt hatten, doch so, wie der Graf davon sprach, waren es nur staubige Seiten zwischen alten Aktendeckeln.
»Ich kenne die Geschichte«, stellte Lorentha unbewegt fest. »Was hat dies alles mit mir zu tun?«
»In vier Wochen jährt sich der Tag der Hochzeit zwischen Prinz Pladis und Prinzessin Armeth und damit auch die Übergabe der Stadt an das Kaiserreich zum zweihundertsten Mal. Ein Tag, der die Geschicke eines jeden, der hier lebt, entscheidend prägte. Ihr könnt Euch denken, dass dieser Tag für jeden in der Stadt wichtig ist, und man wird ihn, wie jedes Jahr, mit einem Umzug und einem Fest feiern. In diesem Umzug wird der Falke von Aryn in einer feierlichen Prozession durch die Straßen der Stadt getragen, unten am Marktplatz und auch vor dem Palast wird man schöne Reden halten und die Menschen daran erinnern, dass dies der Tag war, an dem die Blütezeit der Stadt eingeläutet wurde.«
»Blütezeit?«, fragte sie und hob wieder eine Augenbraue. »Ich dachte, man hätte sich gegen den Kaiser erhoben?«
»Das war damals«, winkte Mergton gelassen ab. »Indem der Kaiser der Stadt die Zölle erlassen hat, ist Aryn mittlerweile eine der reichsten Städte des Kaiserreichs … und die Manvaren verdienen daran kräftig mit. Für den Prinzen und seine Prinzessin ist es eine tragische Geschichte gewesen, nicht umsonst erhielt der Kaiser später den Beinamen »der Schwermütige«, doch für das Kaiserreich und Manvare hat es sich als ein Glücksfall herausgestellt, auch wenn es noch einige Dickschädel gibt, die davon träumen, dass Aryn wieder an Manvare fällt.« Er schnaubte abfällig. »Wenn wir heute Aryn an König Hamil übergäben, würde der nur höflich Danke sagen und uns die Stadt gleich wieder in die Hand drücken, denn ohne die Zollfreiheit würde Aryn in der Bedeutungslosigkeit versinken.«
»Dann ist doch alles bestens«, stellte Lorentha ungerührt fest.
»Nicht ganz«, meinte Mergton kalt. »Falken sind für die Manvaren heilig, sie sind für sie die Boten der Göttin. Der goldene Falke, den Prinz Pladis damals für Prinzessin Armeth anfertigen ließ, gilt allgemein als der Grund dafür, weshalb die Hohepriesterin der Göttin seinerzeit der Vermählung des Prinzenpaars zustimmte. Wenn er in der Prozession durch die Straßen der Stadt getragen wird, erinnert er jeden hier daran, dass damals nicht nur die Hochzeit, sondern auch die Übergabe der Stadt mit Isaeths Segen stattfand.« Mergton lehnte sich zurück und zog ein Tuch heraus, mit dem er seine Stirn abtupfte. »Der andere Teil der Botschaft ist der, dass sich jeder, der die kaiserliche Herrschaft über Aryn anzweifeln will, damit zugleich auch gegen den Willen der Göttin stellen würde.«
Sie pfiff leise durch die Zähne. »Pladis war gerissener, als ich dachte«, meinte sie dann anerkennend. »Wo ist der Haken?«
»Kein Haken«, sagte er. »Niemand, der noch klar bei Verstand ist, würde am gegenwärtigen Zustand etwas ändern wollen. Es verdienen zu viele zu gut daran. Es gibt nur ein kleines Problem.«
»Und welches?«, fragte sie. Vielleicht kam er jetzt endlich zum Punkt, ihre Geduld war schon lange ausgeschöpft.
»Der Falke wurde aus dem Tempel der Isaeth gestohlen.«
»Ah«, sagte sie. »Wir kommen der Sache näher. Ich nehme an, ich soll den Falken für Euch wiederfinden?«
»Nicht ganz«, antwortete der Graf mit einem schwachen Lächeln. »Ihr sollt verhindern, dass dem manvarischen Adeligen Lord Raphanael Manvare, der von König Hamil entsendet wurde, um das Verbrechen aufzuklären, etwas zustößt. Denn das käme uns im Moment entschieden ungelegen.« Er bedachte sie mit einem langen Blick. »Allerdings wäre es mir lieber, wenn Ihr weniger auffällig wäret. Hier in Manvare tragen Frauen keine …«
»Keine Hosen?«, fragte Lorentha scharf.
»Ich wollte Schwerter sagen«, verbesserte der Graf sie milde. »Aber wenn wir schon von Röcken und von Kleidern sprechen, ich hoffe, Ihr habt welche eingepackt?«
»Nein«, sagte sie und hob eine Augenbraue. »Ich habe nur meine Uniform und meine Rüstung dabei. Warum sollte ich Kleider einpacken?«
»Weil Ihr sie noch brauchen werdet«, meinte der Graf sichtlich erstaunt. »Könnt Ihr Euch das nicht denken? Bei der Bedeutung, die der Falke für die Menschen hier hat, müssen wir uns diskret verhalten. Die einfachste Art, Euch und Lord Raphanael bekannt zu machen, ist auf einem Ball, den Lord Simer morgen Abend geben wird.«
»Ich gehe nicht auf Bälle«, teilte sie ihm ruhig mit. »Richtet es anders ein.«
»Auf diesen, Major, werdet Ihr gehen«, sagte Mergton, und obwohl sein Lächeln sich kaum verändert hatte, sagte ihr sein Blick, wie ernst es ihm war. »Ich fürchte, ich muss darauf bestehen.«
Ein Ball, dachte sie betroffen. Vor zwölf Jahren hatte sie sich von dieser Gesellschaft abgewendet, alles aufgegeben, was ihr Name und Titel ihr an Privilegien gab, und nun zwang er sie in diese Welt zurück?
»Dann werde ich Uniform tragen«, teilte sie ihm steif mit. »Ein Rock gehört dazu.«
Der Graf schien gar nicht mehr bei der Sache, für ihn war das alles wohl schon abgeschlossen. »Richtig«, bestätigte er und stand auf, wobei sein Korsett laut knirschte. »Nur, dass wir vermeiden wollen, alle mit der Nase darauf zu stoßen, dass Ihr bei der Garda seid. Tragt ein Kleid. Wenn es sein muss, ist das ein Befehl.« Er sah kurz zu ihr auf. »Das wäre alles, Major«, sagte er kühl, offenbar hatte er es aufgegeben, sie mit Freundlichkeit für sich zu gewinnen. »Ich habe mir die Freiheit erlaubt, Euer Gepäck bereits zu Gräfin Alessa vorzuschicken. Sie ist unterrichtet und versprach mir, Euch nach Kräften zu unterstützen. Sie wird Euch sicherlich auch in der Kleiderfrage helfen können. Die Kutsche steht bereit, um Euch zu ihr zu bringen.«
»Danke, nein«, erwiderte die Majorin, als sie ihr Schwert von Meister Fellmar entgegennahm. »Ich denke, ich finde den Weg.«
Nachdem er sie hinausgeleitet hatte, kehrte Meister Fellmar rasch zu dem Grafen zurück und schloss sorgfältig die Tür.
»Ihr solltet Euch schämen«, sagte er, während er zum Fenster ging. »Sie so unter Druck zu setzen. Wolltet Ihr sie nicht mit Freundlichkeit gewinnen?«
Der Graf schnaubte. »Sie sieht aus wie ihre Mutter, aber sie ist kalt wie Eis. Ihr habt doch gesehen, was Freundlichkeit mir brachte.«
»Ihr habt sie mitten in der Nacht hierherzitiert, was habt Ihr erwartet?«, meinte Fellmar und schüttelte unverständig den Kopf. »Wenn Ihr auf ihre Hilfe hofft, hättet Ihr es anders angehen können.« Er musterte den Grafen prüfend. »War es denn nötig, sie in der Nacht noch kommen zu lassen?«
Er war seit zwanzig Jahren der Sekretär des Grafen und in vielen Dingen sein Freund und Vertrauter. Da ihn der Graf in diese Angelegenheit mit eingebunden hatte, fand er, dass er es sich erlauben konnte, sich dazu zu äußern. Zudem war er anderer Ansicht. Ihr Lächeln zur Begrüßung sprach mehr davon, dass sie sich auch nach langen Jahren an Freundlichkeit erinnerte.
Der Graf tat eine verächtliche Geste in Richtung des Hafens. »Wäre ihrem verdammten Schiff nicht der verfluchte Mast gebrochen, hätten wir mehr Zeit gehabt. Dann hätte ich sie zum Tee laden und nett plaudern können … aber die Zeit haben wir nun nicht mehr!«
»Dennoch …«, begann der alte Sekretär, doch der Graf schüttelte den Kopf.
»Du weißt selbst, dass ich es anders habe angehen wollen! Nur, dass dieser verfluchte Falke uns dazwischenkam. Was beschwerst du dich? Ich rücke doch nur gerade, was einst aus dem Lot geraten ist.«
»Genau das ist es«, meinte Fellmar. Er trat an dem Grafen vorbei ans Fenster und schob mit einem Finger den Vorhang zur Seite. Von hier aus hatte man einen guten Blick über den Kaiserplatz, und obwohl es schon dunkel war, fiel es ihm nicht schwer, die hochgewachsene Gardistin auszumachen, die mit schnellen Schritten den Platz überquerte. »Wie fühlt es sich denn an, Schicksal zu spielen?«
Der Graf schnaubte. »Bis jetzt? Gut, würde ich sagen. Fellmar, vergiss nicht, wir gleichen hier ein altes Unrecht aus.«
»Habt Ihr sie gefragt, ob sie das will? Sie sah nicht so aus, als ob sie Eure Hilfe zu schätzen weiß.«
»Ja«, knurrte der Graf. »Das hat sie deutlich genug gemacht. Dennoch wird sie meine Hilfe brauchen. Die letzten Berichte aus der Hauptstadt zeigen, dass sie nicht weiß, wie sie mit solchen Dingen umzugehen hat. Sie ist wie ihr Vater darin, der hat sich auch nie um die Feinheiten geschert, man sieht ja jetzt, wohin es sie gebracht hat!«
»Dennoch wollt Ihr sie auf diesen Ball zwingen. Ist das denn klug?«
»Sie ist nicht nur eine Soldatin, Fellmar«, erinnerte ihn der Graf. »Sie ist eine Baroness. Ihre Mutter beherrschte jeden Ball, auf dem sie jemals war, es liegt ihr im Blut, auch wenn sie es nicht wahrhaben will. Gräfin Alessa wird sich um alles kümmern, was noch zu tun bleibt. In der Hauptstadt ist man schmählich mit ihr umgegangen, doch wenn sie auf diesem Ball erscheint, wird jeder wissen, dass sie über unsere Unterstützung verfügt!«
»Ihr habt aber nicht vergessen, dass diese Stadt eine lange Erinnerung besitzt und es solche gibt, die dafür töten würden, damit all das, was damals geschah, verborgen bleibt?«
»Ich schulde es ihrer Mutter«, wiederholte Mergton und stand ebenfalls auf, um sich zu Fellmar an das Fenster zu gesellen, doch es war zu spät, sie war nicht mehr zu sehen.
»Nicht, wenn es ihre Tochter umbringt«, gab der alte Sekretär zu bedenken.
»Das wird schon nicht geschehen«, sagte der Graf nachlässig. »Du hast dich um alles gekümmert?«
Fellmar zuckte mit den Schultern. »Die Gräfin weiß Bescheid. Götter«, seufzte er. »Ihr und die Gräfin seid wie zwei alte Kriegspferde, die den Ruf zur Schlacht vernehmen, sie zitterte schon an den Flanken, bevor ich ihr alles habe erklären können.«
»Lasse sie nur nicht hören, dass du so von ihr denkst«, lachte der Graf.
»Ich bin nicht lebensmüde«, antwortete der Sekretär steif. »Seid Ihr denn sicher, dass Ihr nicht doch die Toten schlafen lassen wollt? Es ist nicht zu spät, um noch alles abzubrechen.«
Der Graf wandte sich vom Fenster ab und musterte den Mann, der ihm schon so lange Vertrauter und Freund zugleich war. »Wir sind jetzt beide in die Jahre gekommen, Tomas. Hast du dich noch nie gefragt, ob es Dinge in deinem Leben gibt, die du heute anders angegangen wärst? Würdest du nicht auch die Gelegenheit ergreifen, altes Unrecht wieder auszugleichen?«
»Ja, Herr Graf«, sagte der Sekretär leise. »Das würde ich. Aber ist es klug?«
Der Graf seufzte. »Das wird sich zeigen.« Er ließ den Vorhang fallen und trat an seinen Schreibtisch, um die Akte darauf nachdenklich anzusehen und dann mit seinem Finger gerade zu rücken. »Das wird sich zeigen.«
Die Schiefe Bank
4 Zu behaupten, dass Lorentha, Baroness Sarnesse, Major der kaiserlichen Garda, den Gouverneurspalast mit gemischten Gefühlen verließ, wäre eine Untertreibung gewesen. Tatsächlich gab sie sich Mühe, sich nichts anmerken zu lassen, als sie mit langen Schritten den Kaiserplatz überquerte.
Zum einen war da Graf Mergton. Ein freundlicher, kleiner Mann, rundlich, mit blitzenden Augen und einem Lächeln, das überraschend viel Wärme zeigte. Jemand, dem sie vertrauen konnte. Der es gut mit ihr meinte. Jedenfalls war das der Eindruck, den er auf sie hatte machen wollen.
Sie schnaubte verärgert. Der Mann war seit über dreißig Jahren Gouverneur einer Stadt, die seit zwei Jahrhunderten nicht zur Ruhe gekommen war. Ein Mann, der es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte, die kaiserlichen Interessen hier zu vertreten. Jemand, der sich – alleine schon, um so lange auf einem solchen Posten zu überleben – sehr gut mit den Spielregeln von Intrigen und Macht auskennen musste. War es nicht zudem so, dass ein Gouverneur immer auch dem kaiserlichen Geheimdienst vorstand? Dennoch sagte Lorentha ihr Bauchgefühl, dass er es gut mit ihr meinte. Allerdings sagte ihr dasselbe Bauchgefühl, dass er Dinge vor ihr verbarg.
Wäre schön, dachte sie unzufrieden, wenn ihre Gefühle sich mit sich selbst einigen könnten, sie hasste es, wenn sie nicht wusste, wie sie einen Menschen einzuschätzen hatte.
Zum anderen Fellmar. Sie lächelte, als sie sich erinnerte, wie erfreut er gewesen war, sie zu sehen. Wenn sie in dem Palast einen Freund besaß, dann war es dieser alte Sekretär. Vielleicht war es ja wirklich so, dass der Graf ihr ebenfalls freundlich gesonnen war, aber er verfolgte auf jeden Fall auch eigene Ziele.
Sie sah sich um. Wenn sie sich richtig erinnerte, führte die Kerbergasse von hier aus hinüber zum Altmarkt, und von dort aus war es nicht weit hinunter zum Hafentor. Jeder andere Weg wäre ein Umweg, doch die Gasse war nur spärlich erleuchtet und zudem noch lang und verwinkelt. Zwar war dies eine der sichersten Gegenden der Stadt, zumal viele von denen, die in der Stadt Rang und Namen besaßen, sich hier niedergelassen hatten, und die Mächtigen mochten keinen Ärger. Doch im Moment war weit und breit keine Streife der gefürchteten Nachtwache zu sehen.
Dennoch … der Weg durch die Kerbergasse war der kürzeste zum Hafen. Das passt zu dir, Lorentha, dachte sie erheitert, als sie ihre Schritte in Richtung der Gasse lenkte. Du machst dir um diese Gasse Sorgen … und vergisst dabei ganz, wohin du gehen willst! Gut, viele Dinge mochten sich in den letzten vierzehn Jahren verändert haben, aber es war kaum davon auszugehen, dass der Schiefe Anker sich zu einem Ort entwickelt hatte, an dem die Damen ungestört ihren Tee zu sich nehmen konnten!
Eine leichte Brise wehte ihr die fast vergessen geglaubten und doch so bekannten Gerüche des Hafens entgegen, vermischt mit dem Geruch der Stadt selbst. Jede Stadt, dachte sie, besaß einen einzigartigen Geruch, und sie hätte diesen mit verbundenen Augen wiedererkannt. Götter, dachte sie und schüttelte über sich selbst erheitert den Kopf. Die sieben Jahre, die sie hier verbracht hatte, gehörten zu den schlimmsten ihres Lebens, warum nur hatte sie das Gefühl, ihnen nachgetrauert zu haben? Schon als sie die Morgenbrise verlassen und den Fuß auf festes Land gesetzt hatte, hatte sie sich gefühlt, als wäre sie endlich nach langer Zeit und vielen Irrwegen nach Hause gekommen. Das ergab wenig Sinn, und doch war es so. Auch wenn sie der Gedanke frösteln ließ und ihr den Magen zusammenzog.
Sosehr sie in ihren Gedanken versunken gewesen war, die langen Jahre im Dienst der Garde hatten sie doch darin geübt, ihre Aufmerksamkeit auf das zu richten, was sich gern verborgen hielt. Man lebte einfach länger, wenn man darauf achtete, wohin man ging und ob einem leise Schritte folgten.
Sie blieb stehen und drehte sich um. Dort vorne in einem dieser dunklen Schatten schien ihr etwas in der Bewegung zu erstarren.
Sie lockerte ihr Schwert und ihren Dolch und tippte kurz mit dem Zeigefinger ihrer rechten Hand auf das goldene Schild mit dem Wolfskopf, das sie auf ihrer linken Schulter trug.
»Ich würde es sein lassen«, riet sie dem Unbekannten freundlich. »Ich gehöre der Garda an und bin heute nicht sonderlich gut gelaunt. Dies ist eine neue Rüstung, und ich habe keine Lust auf blutige Flecken darauf. Verzieh dich, dann kannst du noch etwas länger leben.«
Wie zu erwarten war, erhielt sie keine Antwort, doch als sie weiterging, folgten ihr die Schritte nicht mehr.
Da soll noch mal einer behaupten, alle Straßenräuber wären dumm.
Das Tor zum Hafen war bereits geschlossen, und der Sergeant der Wache musterte erst sie und dann ihr Schild mit gesundem Misstrauen, als sie ihm ihre Papiere reichte.
»Ich wusste gar nicht, dass sie Frauen in die Garda lassen«, knurrte er. »Oder dass es euch noch in nüchtern gibt. Seid Ihr sicher, dass Ihr zum Hafen wollt? Dort ist es nachts nicht sicher.«
Sie weitete erschrocken ihre Augen. »Oh, danke, Sergeant, beinahe hätte ich vergessen, wie hilflos ich bin, obwohl ich doch ein Schwert trage!«
»Macht Euch nur lustig«, schnaubte der Sergeant, gab ihr ihre Papiere zurück und gab einem seiner Männer das Zeichen, den schweren Riegel von der kleinen Tür zu nehmen, die des Nachts den Durchgang durch das Tor erlaubte. »Ich tue nur meine Arbeit.« Er musterte sie erneut. »Bei uns tragen die Seras Röcke.«
»Das Problem ist, Sergeant«, gab Lorentha lachend zurück, als sie sich durch das kleine Portal duckte, »dass die Garda für ihre Rüstungen keine Röcke zulässt.«
»Es ist Euer Begräbnis«, knurrte der Sergeant. »Wenn sie Euch erschlagen, kommt nur nicht wieder und beschwert Euch, dass ich Euch nicht gewarnt hätte!«
»Keine Sorge«, rief sie fröhlich zurück. »Ich glaube kaum, dass dies geschehen wird!«
Obwohl, dachte sie, als sie ein paar Schritte vor dem Tor stehen blieb, auf den Hafen mit seinem dunklen Wald von Masten hinabsah und tief die Seeluft einatmete, die Tausende Gerüche und Erinnerungen brachte, wenn es eine Stadt gab, in der Magie und Aberglauben nicht voneinander zu trennen waren, dann war es Aryn. Dennoch, schmunzelte sie bei sich, wenn ich als Wiedergänger wiederkomme, werde ich wohl anderes tun, als mich bei ihm zu beschweren.
Irgendwie hat sich alles verändert, dachte sie, als sie weiter die Hafenstraße entlangging, nach Norden, wo die ganzen Lichter waren. Dort, die drei Häuser waren neu, ein Kontor, keine Kneipe mehr. Und doch war alles beim Alten geblieben.
Selbst zu dieser späten Stunde waren die mächtigen Kräne in Bewegung, holperten schwere Karren auf eisernen Reifen über die unebenen Steine des Kais und konnte man die Vorarbeiter der Lademannschaften fluchen hören.
Je weiter sie die Hafenstraße nach Norden ging, umso mehr veränderte sich das Bild, umso mehr sah sie Seeleute aus aller Herren Länder, denen ihre Heuer in der Tasche brannte und die sich eilen mussten, sie auszugeben, bevor ihr Schiff am Morgen wieder auslief.
Um ihre Heuer loszuwerden, sind sie hier richtig, dachte sie bitter, es wäre doch eine Schande, wenn das gute Gold wieder seinen Weg zur See finden würde, Schiffe konnten untergehen, da war es fast schon ein gutes Werk, den Seeleuten das Gold aus der Tasche zu ziehen, bevor sie es in ihr nasses Grab mitnahmen.
Doch das Herz des Hafens waren nicht die eng gedrängten Häuser an der Hafenfront, zumindest nicht bei Nacht, denn dann war die Schiefe Bank das schillernde und verdorbene Herz der Stadt. Hier reihten sich Tavernen und Hurenhäuser aneinander, schrien sich die Werber gegenseitig nieder, um die Vorzüge von heißen Frauen und kaltem Bier anzupreisen.
Manche lebten gut davon, an anderen Stellen war das Elend offensichtlich, die junge Hure dort drüben, die einem Seemann gerade schöne Augen machte, wäre wohl auch lieber an einem anderen Ort.
Was wäre wohl geschehen, fragte Lorentha sich, während sie langsam weiterging. Würde sie jetzt dort stehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre sie schon lange tot. Sie und Raban hatten ein gefährliches Spiel gespielt, eines, das man nicht auf Dauer gewinnen konnte. Sie hatten es beide gewusst, nur hatten sie keine andere Möglichkeit gesehen. Rabans Vater hatte es mit Ehrlichkeit versucht, hatte ein Leben lang hier im Hafen geschuftet, dann löste sich ein Netz und eine schwere Kiste fiel auf ihn herab, zerschmetterte ihm das Bein, ein paar Tage später war er tot, gestorben am Wundfieber und, wie Raban sagte, an Verzweiflung.
An diesem Tag hatte Raban zum ersten Mal gestohlen. Eine Kerze, mit der er zum ersten Mal in den Tempel gegangen war, um sie für seinen Vater anzuzünden, um für ihn zu beten. Es war zudem der Tag gewesen, an dem er ihr das Leben gerettet hatte. Auch zum ersten, aber nicht zum letzten Mal.
Ein Ruf riss sie aus der Erinnerung, und sie sah auf. Ein Seemann torkelte auf sie zu. »Hey, Schöne«, rief er. »Was … oh …« Er blieb vor ihr stehen und sah sie an, nur langsam schien er zu verstehen, dass irgendetwas an ihr anders war. »Ah!«, meinte er mit einem breiten Grinsen und beugte sich vor, um mit dem Finger auf ihr goldenes Schild zu zeigen. »Du bist bei der Garda!«, stellte er fest.
»Ganz recht«, antwortete sie kalt und schob ihn mit der Hand zurück, als er näher kommen wollte. »Und du gehst jetzt besser weiter.«
»Lass das!«, beschwerte er sich. »Ich hab doch nix getan!«
»Komm, Süßer!«, rief die Hure und zwinkerte Lorentha dabei zu. »Komm besser her zu mir, ich zeig dir was Schönes, sie ist doch viel zu groß für dich!«
Der Angesprochene sah nun zu Lorentha hoch und schien jetzt erst zu bemerken, dass sie ihn um einen guten Kopf überragte. »Stimmt!«, stellte er mit schwerer Zunge fest und ging schwankend auf die Hure zu.
Lorentha sah ihm nach und schüttelte ungläubig den Kopf, nickte dankend der Hure zu, die dies mit einem breiten Grinsen quittierte, und ging dann weiter.
Reiß dich zusammen, dachte sie, während sie sich zwang, ihre Hand zu entspannen, die sich so fest um den Schwertgriff gelegt hatte, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Er hat doch gar nichts getan. Wenn ich in Augusta nachts auf Streife gehe, gerate ich doch auch nicht in Panik, wenn mich einer nur schief ansieht! Geh gerade, herrschte sie sich selbst an. Zeig, dass du Herr der Lage bist. Sie wissen nicht, wie es in dir aussieht, und sie haben alle Angst, wahrscheinlich sogar mehr als du. Du bist nicht hilflos, du bist es, die hier ein Schwert trägt.
Aber Augusta war nicht Aryn. Dort gab es nicht an jeder Straßenecke eine Erinnerung an eine Zeit, als alles um sie herum größer und bedrohlicher war, als jedes falsche Wort oder eine falsche Geste zu einem schlimmen Ende führen konnte. Doch in Aryn war sie zweimal schon gestorben, so hatte es sich wenigstens angefühlt, das letzte Mal war nicht weit von hier gewesen.
Damals hatte dort auch eine Hure gestanden, erinnerte Lorentha sich und sah auf das schwarze Wasser des Hafens hinaus, nur war die nicht so hilfsbereit gewesen. Vierzehn Jahre war das her. In dieser Nacht hatten Raban und sie es endlich geschafft, hatten einen reichen Kaufmann ausgenommen, der mit einer viel zu dicken Börse unterwegs gewesen war.
Taschendiebstahl war eine Kunst, dachte sie jetzt, als sie ihre Schritte langsam in Richtung Schiefe Bank lenkte, aber sie war darin gut gewesen, hatte, wie Raban immer sagte, die flinksten Finger im ganzen Hafen gehabt. Raban hatte den Händler abgelenkt, und sie nahm sich im Vorübergehen den Beutel, ohne dass er es bemerkte. Sie hatten sich dort in diese dunkle Gasse zurückgezogen, um zu sehen, wie sehr es sich gelohnt hatte, als plötzlich Robart vor ihnen stand, gerade als sie Raban den Beutel gab.
Robart. Selbst nach all der Zeit ließ die Erinnerung sie frösteln. Ein Riese von einem Mann, mit Händen so groß wie Schinken. Er und seine Leute hatten damals den Hafen in der Hand. Die Woche vorher hatte er Raban schon einmal gedroht, ihm versprochen, dass es übel mit ihm enden würde, sollte Raban sich nicht seiner Bande anschließen. Für Lorentha hatte er eine andere Verwendung, wie er damals sagte, und hatte sie schon an einen Hurenhüter verkauft.
Jetzt stand er da, groß, dunkel und drohend, und hatte Raban am Kragen gepackt, um mit der anderen Hand auszuholen. Der große Mann, so viel wusste man, gefiel sich darin, seine Opfer zu Tode zu prügeln, und Raban hatte bereits bei anderen Gelegenheiten seine brutalen Schläge einstecken müssen.
»Ich habe dir doch gesagt, wenn du hier stiehlst, gehört die Hälfte mir! Doch jetzt gehört mir alles, gib den Beutel her!«
So schwer, wie der Beutel war, musste er Gold enthalten, vielleicht sogar genug, um sich hier endlich aus dem Staub zu machen. Raban hatte sich das wohl auch gedacht, vielleicht zudem, dass es ihre letzte Hoffnung war, dem Hafen zu entkommen. Also hatte er eines seiner Messer gezogen und Robart in den Arm gerammt, vielleicht in der Hoffnung, der große Mann würde seinen Griff lockern, doch weit gefehlt, es half nur, Robart noch mehr zu erzürnen.
Achtlos hatte der das Messer aus seinem Arm gezogen, Raban fester ergriffen und gegen die nächste Wand gedrückt, um ihn dann zu erwürgen.
Selbst heute wusste sie nicht mehr, woher sie den Mut genommen hatte, Rabans Messer aufzunehmen und Robart wie eine Katze auf den Rücken zu springen. Der Angriff hatte den Bandenführer so sehr überrascht, dass er einen Lidschlag lang zu erstarren schien, lange genug für sie, um ihm Rabans Messer durch die Kehle zu ziehen. Zuerst schien es der große Mann gar nicht zu bemerken, fast hatte sie schon befürchtet, er würde Raban doch zu Tode würgen, aber dann ließ er doch endlich ab von Raban, taumelte zurück und griff nach seiner Kehle … In genau diesem Augenblick kam einer von Robarts Schlägern um die Ecke.
Sie rannten, es fiel ihnen nichts Besseres ein, bekam er sie in die Finger, waren sie beide tot.
Jetzt, Jahre später, sah Lorentha es vor ihrem geistigen Auge, als wäre es eben erst geschehen, und unwillkürlich fröstelte sie, als sie sich daran erinnerte, wie sich das schwarze Wasser über ihr geschlossen hatte und sie hilflos in die Tiefe gesunken war. In ihren Albträumen verfolgte es sie noch immer.
Sie waren hier entlanggekommen, hatten sich hinter ein paar Kisten versteckt, doch als der Schläger um die Ecke kam, war es die Hure, die damals hier gestanden hatte, die sie verraten hatte, indem sie ihm zurief, wohin die beiden geflohen waren.
»Er ist nur einer«, hatte Raban gekeucht, als sie weiterrannten. »Wir müssen uns trennen!«
»Nein!«, hatte sie widersprochen. »Findet er einen von uns allein, ist der eine tot!«
»Ich werde ganz bestimmt nicht sterben!«, hatte Raban ihr noch zugerufen … und ihr dann einen Stoß gegeben, der sie in das Hafenbecken beförderte. Sie konnte schwimmen, das hatte Raban gewusst, doch dass in dem schwarzen Wasser ein alter Balken trieb, auf den sie aufschlug, hatte er nicht wissen können.
Damals war sie zum zweiten Mal gestorben.
Raban
5 Die Frage war nur, ob Raban noch am Leben war.
Nun, dachte Lorentha und sah sich um, das ließ sich wohl leicht klären. Dort drüben machte sich gerade ein Dieb an einen Händler heran. Als der Junge ihn breit angrinste und mit der hohlen Hand eine milde Gabe forderte, um seine Mutter und seine sieben Geschwister besser ernähren zu können, trat Lorentha rasch zur Seite und streckte einen langen Arm aus, um einen anderen Jungen, der sich gerade hatte verdrücken wollen, am Schlafittchen zu packen.
»Ich hab nix gemecht!«, beschwerte sich der Junge in einem breiten Dialekt, während er versuchte, sich aus ihren Händen zu winden. Jeder Dieb lernt die Tricks und Kniffe früh, tat man es richtig, konnte man kaum gehalten werden. Es sei denn, diejenige, die einen halten wollte, wäre eine Majorin der Garda, die diese Tricks bereits gelernt hatte, bevor die Götter noch daran gedacht hatten, diesen Burschen auf die Welt loszulassen.
»Weiß ich«, meinte Lorentha knapp zu ihm. »Beruhige dich, ich will dich nur etwas fragen.«
»Du bist Garda!«, beschwerte er sich vorwurfsvoll. »Dir sach ich gar nix.«
Sie lachte, während sie aus den Augenwinkeln Ausschau nach dem anderen Burschen hielt. Im Allgemeinen legten sich die Kinder nicht gerne mit ihren Opfern an, auf der anderen Seite gab es kaum etwas Schärferes als die kleine gekrümmte Klinge, mit der sie die Beutel schnitten, und sie wussten damit umzugehen. »Das hättest du dir vorher überlegen können, hast du meine Marke nicht gesehen?« Sie tippte auf den Wolfskopf an ihrer Brust.
»Nee«, beschwerte er sich. »Sonst hätt ich mich gleich aus dem Staub gemacht!«
Gutes Argument, dachte Lorentha und hätte beinahe laut gelacht.
»Ich will wissen, ob dir der Name Raban etwas sagt.«
Der Junge wurde bleich und verdoppelte seine Anstrengungen, sich aus ihrem Griff zu winden. »Nee!«, behauptete er keuchend, während er sich abstrampelte. »Noch nie nich gehört!«
»Danke«, sagte Lorentha höflich und ließ den Jungen los, der wie durch Zauberei einen Lidschlag später wie vom Erdboden verschluckt war.
Also lebte Raban wahrscheinlich noch, und zwar dort, wohin der Junge eben hastig geblickt hatte: Sie sah hinüber zu der mit gleich vier Laternen erleuchteten Fassade des Schiefen Ankers.
Beinahe hätte sie laut gedacht, darauf hätte sie auch selbst kommen können! Der Schiefe Anker hatte sich wenig genug geändert, irgendwann hatte jemand die Fassade neu gestrichen, jetzt war sie rot, wo sie früher blau gewesen war, aber die Farbe blätterte an verschiedenen Stellen wieder ab. Die Tür war wie immer weit geöffnet und gewährte einen Einblick in die Kneipe, die offenbar gut besucht war. Die Stimmung war wohl gut, jemand spielte Laute und sang zotige Lieder, und die Menge grölte eifrig mit.
Vor der Tür standen zwei verschlagen aussehende Kerle, Veteranen unzähliger Straßenkämpfe, die Lorentha misstrauisch beäugten, als sie einen betrunkenen Matrosen zur Seite schob, um dann vor ihnen stehen zu bleiben.
»Ich glaub, Ihr seid hier falsch«, meinte der eine höflich, während er gedankenverloren in seinem Haar nach einer Laus suchte.
Der andere nickte träge. »Wir wollen keinen Ärger, aber Garda haben wir hier nich so gern.«
»Ich will nur etwas trinken und einen alten Freund besuchen«, meinte Lorentha freundlich.
»Klar«, meinte der Erste, der die Laus nun gefunden hatte, sie zunächst inspizierte, um sie dann zwischen dreckigen Fingernägeln zu knacken. »Un’ ich hab eine Schwester, die noch Jungfrau is.«
»Wollt Ihr mir den Zugang verwehren?«, fragte Lorentha und legte die Hand auf den Griff ihres Schwerts.
»Nich doch«, meinte der andere. »Ich sach ja, wir wollen kein’ Ärger … wir machen auch keinen, aber …« Er wies mit seinem Daumen über seine Schulter auf den Eingang in seinem Rücken. »Da drin sin so einige, die vielleicht Ärger wollen, wenn sie Eure Marke sehen … aber das is dann Euer Problem. Aber sacht nachher nich, wir hätten Euch nich gewarnt.«
»Ich weiß Eure Fürsorge zu schätzen«, meinte Lorentha. »Wie ich sagte, ich will nur einen alten Freund besuchen.«
»Un, wer is Euer alter Freund?«, fragte der eine, der sich nun hinter dem Ohr kratzte, offenbar war die Jagd noch nicht beendet.
»Er heißt Raban«, meinte sie mit einem Lächeln. Die beiden schienen zu erstarren, dann schüttelte der eine bedächtig den Kopf. »Nie gehört, den Namen.«
»Ja«, sagte Lorentha, als sie sich zwischen den beiden durchdrückte. »Das habe ich mir schon gedacht.«
Feuchtwarme Luft schlug ihr entgegen und trug all die Gerüche an sie heran, von feuchter Wolle, ungewaschenen Leibern, ranzigem Bier und so vielem anderen, das ihre Nase gar nicht riechen wollte.
Es war ein lang gestreckter Raum, mit von Alter geschwärzten Deckenbalken, die so niedrig waren, dass sie achtgeben musste. Ganz am Ende befand sich die Theke, kaum zu sehen, so sehr war sie belagert, rechts daneben die kleine Bühne, auf der sich ein junger Spielmann redlich bemühte, die Menge in Stimmung zu versetzen, dazwischen lange Bänke, eine jede überfüllt, und dazwischen lange Tische, die sich unter der Last der unzähligen Flaschen, Becher und Krüge fast zu biegen schienen. Gut ein Dutzend Schankmädchen, die meisten recht offenherzig gekleidet, eilten lachend umher, wanden sich geschickt aus gierigen Händen, die nach ihnen griffen, oder ließen hier und da doch zu, dass sie auf fremde Schöße gezogen wurden, für einen Moment, bevor sie ihrem Verehrer das Ohr umdrehten, um dann lachend zu entfliehen.
So, wie das Bier hier floss, war es kein Wunder, dass es bei dem einen oder anderen schon seine Wirkung getan hatte, Trunkenheit machte blöde, vielleicht auch blind. Nur so war es zu erklären, dass ein langer Arm sie um die Hüfte griff und sie zu seinem Besitzer zog, der ihr lachend einen Becher an den Mund zu halten versuchte, während er geflissentlich die erschrockenen Gesichter und den angehaltenen Atem seiner nüchterneren Trinkkameraden ignorierte.
Nicht zu fassen, dachte Lorentha ungläubig, dass ich damit nicht gerechnet hatte. Üblicherweise kannte man die Rüstung, die sie trug, oder auch die Marke mit dem Wolf, selbst Trunkenbolde wussten es besser, als sich mit der Garda anzulegen, doch Aryn lag weit vom Rest des Kaiserreichs entfernt, und hier sah man den Wolf wohl nicht so oft, auf jeden Fall schien der Seemann nicht zu wissen, wen er sich da eben aus der Menge gefischt hatte.
»Komm«, rief er gutmütig. »Komm, Täubchen, trink einen Schluck, du siehst aus, als könntest du es gebrauchen, mach dem alten Hannes eine Freude!«
Zwar hielt er sie mit dem anderen Arm noch fest, doch es war klar zu erkennen, dass der alte Mann es nicht böse meinte, also ergab sie sich ihrem Schicksal und ergriff den Becher, um einen tiefen Schluck zu nehmen. Wenigstens, dachte sie, als sie sich den Schaum vom Mund wischte, hatte er das Gold gehabt, um sich gutes Bier zu leisten, nicht die dünne Eselspisse, die hier meistens ausgeschenkt wurde.
»Danke«, rief sie lachend und stellte den Becher wieder ab. »Das habe ich gebraucht, aber jetzt muss ich leider weiter!«
Er lockerte seinen Griff um ihre Hüfte und lächelte etwas wehmütig. »Du siehst aus wie meine Frau, möge die Göttin sie in Frieden ruhen lassen … hier«, sagte er und hielt ihr ein Goldstück hin. »Kauf dir etwas Nettes und pass auf dich auf … und danke, dass du einem alten Mann eine Freude bereitet hast.«
Sie drückte lächelnd seine Hand zur Seite. »Behaltet das Gold«, flüsterte sie ihm zu und gab ihm einen schnellen Kuss auf seine stoppelige Wange. »Und seht zu, dass Ihr sicher Euer Schiff erreicht.«
»Das wird er«, sagte einer der anderen Seemänner überraschend ernst, während sie sich aus dem lockeren Griff des alten Seemanns befreite. »Er ist ein guter Mann und der beste Kapitän, den ich je hatte, er ist nur traurig, weil er seine Frau verloren hat.« Er wies mit seinem Blick auf den goldenen Wolf an ihrer Schulter. »Lieb von Euch, dass Ihr es ihm nicht verübelt habt.«
Was nur wieder zeigte, dachte sie, dass es auch an solchen Orten noch die Rechtschaffenen zu finden gab. Sie zwinkerte dem alten Mann noch einmal zu und ging dann weiter, diesmal auf der Hut vor solcherart Attacken.
Vor der kleinen Bühne gab es einen Tisch, der überraschend wenig gefüllt war, nur drei Männer saßen dort und steckten ihre Köpfe zusammen, einer davon ein Mohr, dessen krauses Haar genauso schwarz war wie seine lederne Rüstung oder das Kreuzband mit den vierzehn flachen Wurfmessern, die er daran trug.
Die beiden anderen redeten auf ihn ein, während er mit seinem Becher spielte. Auf der dunklen Haut seiner Hand zeichneten sich indessen die Spuren von Hunderten feiner Schnitte deutlich ab.
Eine der älteren Schankmägde stellte sich ihr in den Weg, sah sie mit weiten Augen an und schüttelte warnend den Kopf. »Keine gute Idee, Kindchen«, sagte sie leise. »Und wenn Ihr zehnmal Garda seid, sucht Euch keinen Ärger.«
Sie hätte die Frau nicht wiedererkannt, sie sah älter aus als ihre Jahre, aber die dunkelblauen Augen und ihre Stimme ließen Lorentha an ein junges Mädchen denken, das sich immer scheu im Hintergrund gehalten hatte.
»Danke, Elspeth«, sagte Lorentha leise. »Aber ich glaube kaum, dass ich hier Ärger bekomme.«
»Göttin«, entfuhr es der Magd, als sie erbleichte und überrascht zurückwich, um hastig das Zeichen der Göttin über ihrem Busen auszuführen. »Loren? Du bist doch tot, bist du ein Geist?«
»In beiden Fällen: nein«, lächelte Lorentha und schob die Magd sanft zur Seite, um dann an den Tisch zu treten und hart mit dem Knöchel auf die Tischplatte zu klopfen. Alle drei Männer sahen verblüfft auf. »Ihr beide«, sagte sie zu den anderen. »Verzieht euch.«
»Willst du was aufs Maul?«, fragte der eine und hob drohend eine Faust. »Kannst du haben!«
»Vorsicht«, sagte der Mohr, dessen Augen sich bei ihrem Anblick geweitet hatten, bevor sein Lächeln immer breiter wurde und er nun strahlend weiße Zähne zeigte. »Sie zieht dir die Ohren lang.«
»Weil sie bei der Garda ist?«, fragte der andere verächtlich. »Sie hat hier nichts zu suchen, und es wird Zeit, dass sie es kapiert.«
»Nein«, sagte der Mohr gefährlich leise, ohne den Blick von ihr zu wenden. »Weil es dumm von dir wäre, dich mit jemandem anzulegen, der besser ist als ich.« Er tat eine nachlässige Handbewegung. »Ihr habt sie gehört. Verzieht euch.«
Widerwillig, mit leisen Flüchen und bösen Blicken machten sich die beiden anderen davon.
»Ich dachte, du lägest schon lange bei den Fischen«, sagte Raban und schüttelte dann mit einem ungläubigen Lächeln den Kopf. »Ich hätte wissen müssen, dass du nicht so leicht zu töten bist.«
»Du hättest dir mehr Mühe geben sollen«, meinte sie und setzte sich ihm gegenüber. »Du wusstest doch, dass ich schwimmen kann.«
»Ich wollte dich ja gar nicht töten«, sagte er gelassen und hob die Hand, um eine der Mägde heranzurufen, es war dann Elspeth, die ängstlich von Lorentha zu Raban schaute und auf ihrer Unterlippe kaute. »Es war nur, um dich in Sicherheit zu bringen.« Er schaute zu der Magd auf. »Bier«, sagte er und wandte sich dann mit einem fragenden Blick an die Majorin. »Und … Wein? Ein Roter? Wie früher?«
»Ja«, nickte Lorentha. »Aber nicht mehr so verwässert, ich bin jetzt alt genug.«
Elspeth tat hastig einen kleinen Knicks und floh, während Rabans dunkle Augen auf dem goldenen Wolfskopf ruhten.
»Garda, huh?«
»Schon seit fast zwölf Jahren«, nickte sie mit einem feinen Lächeln. »Es füllt den Magen, und es ist im Prinzip das Gleiche, was ich vorher tat, nur eben auf der anderen Seite.« Sie beugte sich vor. »Sag mir, hat der alte Visal hier immer noch das Sagen?«
»Nö«, gab Raban Antwort. »Der hat sich vor ein paar Jahren verschluckt und biss dann ins Gras. Inzwischen ist Valkin Visal am Ruder. Er hat seinen Vater beerbt, ist jetzt Lord Visal und hält sich damit erst recht für wichtig. Behauptet immer noch, dass das Kaiserreich ihn um sein Erbe betrogen hätte. Warum?«
»Also immer noch die alte Leier«, meinte sie und zuckte mit den Schultern. »Ich wollte ihm nur ein paar Fragen stellen …« Was jetzt nicht mehr möglich war, sie konnte den alten Visal also getrost von ihrer Liste streichen.
»Er wird sich nicht freuen, dich wiederzusehen«, meinte Raban.