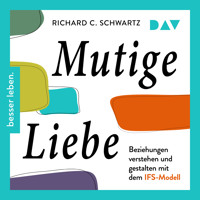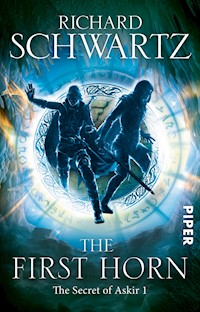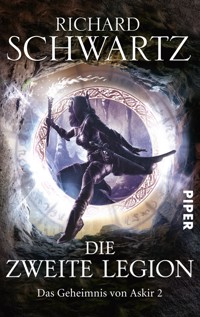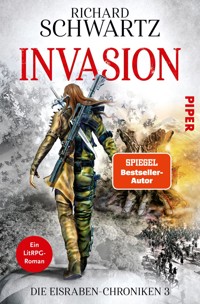
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der neue actiongeladene LitRPG-Roman von Richard Schwartz! Im dritten Band der »Eisraben-Chroniken« muss sich die ehemalige Kampfpilotin Alex im gigantischen Onlinerollenspiel Vorena einer neuen Herausforderung stellen: Während die Erde sich auf die Invasion außerirdischer Mächte vorbereitet, dringen die ersten extraterrestrischen Angreifer nach Vorena vor, um die Erfolgsaussichten eines Krieges gegen die Menschen zu sondieren. Alex und ihre Verbündeten setzen alles daran, die Invasoren zurückzuschlagen. Denn sie wissen: Fällt Vorena, fällt die ganze Welt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Invasion« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Redaktion: Antje Steinhäuser
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Uwe Jarling
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1 Wiedergeburt
2 Diana
3 Honky Tonk
4 Irgendetwas in deinem Gehirn
5 RTFM!
6 Hyacinthe
7 Licht an!
8 Gundersburg
9 Erik
10 Herold und Nimrod
11 Das Ende der Welt
12 Tratsch und Klatsch
13 Privileg, am Arsch!
14 Der Hund des Kaisers
15 Nach Loringen
16 Etwas gänzlich Fremdes
17 Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben
18 Miau
19 Einander auslöschen
20 Invasion
21 Ein Eichhörnchen?
22 Richtig, richtig eklig!
23 Fünf Dinge
24 Federfall
25 Hundemüde
26 Quantenklon
27 Ein Gerücht
28 Fehler im System
29 Das Richtige tun
30 Landgefühl
31 Easy peasy
32 Die Schwarze Faust
33 Mutter Erde
34 Fresskoma
35 Paranoia schadet nicht
36 Gustavs Herde
37 Eisfang frisst
38 Verborgener Quest-Kollaborateur
39 Ich kann es kaum erwarten
Abkürzungsverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1 Wiedergeburt
Es ist schon spät geworden, und ich liege mehr, als dass ich sitze, in der alten Schaukel auf der Veranda hinter unserem Haus und schaue Fire zu, wie sie eine Bierdose auf ihrer Nase balanciert.
So betrunken, wie sie ist, ist es eine bewundernswerte Leistung. Die Bierdosen in der alten Zinkwanne neigen sich bedenklich dem Ende zu, und keiner ist mehr nüchtern. Cat schaut Fire mit seinem üblichen verliebten, halb senil wirkenden Blick bei ihrer Meisterleistung zu, Hog und Mouse feuern sie an, und ich liege in der Schaukel und fühle Widersprüchliches.
Zum einen ist da dieses warme Gefühl der Gemeinschaft, das mich mit diesen liebenswerten Idioten verbindet, die immer für mich da gewesen sind und nun mit mir gemeinsam meine Wiedergeburt feiern, zum anderen aber fühle ich mich entfremdet.
Nicht nur von ihnen, sondern von dieser Welt, die ich jahrelang lediglich als ein Stück Himmel durch ein Fenster in meinem Krankenzimmer habe sehen können. Ein Himmel, der manchmal blau, manchmal grau, manchmal mit Wolken verhangen oder auch verregnet gewesen ist. Ab und zu habe ich ein Flugzeug gesehen, hier und da auch einen Helikopter. Ein Himmel, der mir fern gewesen ist. Ein Himmel einer Welt, die für mich nicht mehr zu erreichen gewesen ist. Ein Himmel, für die anderen, für den Rest der Menschheit, ein Himmel, der sich über uns alle erstreckt und für mich mit jedem Jahr ferner und fremder geworden ist.
Mein Bier ist lauwarm geworden, ich konzentriere mich kurz, und eine Frostschicht überzieht meine Hand und die Dose, der nächste Schluck ist kühler, erfrischender. Ohne dass ich mitgezählt habe, weiß ich, dass es die vierzehnte Dose ist, mehr als ich hat nur Hog getrunken, dessen Alkoholresistenz fast schon legendär ist. Ich müsste sturzbetrunken sein, aber ich bin so nüchtern wie ein Steuerprüfer.
Offenbar kann ich mich nicht mehr betrinken. So schnell, wie mein Körper den Alkohol jetzt abbaut, kann ich gar nicht trinken.
Ich mustere meine Hand, die die Bierdose hält. Lange, schlanke, elegante Finger. Finger, die ich jahrelang nicht habe bewegen können. Ich höre das Gelächter meiner Freunde wie durch eine Wand. Ab und zu schauen sie zu mir hin, lächeln mich an, aber seit Fire ein Machtwort gesprochen hat, lassen sie mir meine Ruhe, zeigen mir nur mit Gesten und Blicken, dass sie froh und erleichtert darüber sind, dass ich in die Welt der Lebenden zurückgekehrt bin. Es brauchte nur einen Satz von Fire.
Lasst ihr Zeit, sich wieder zurechtzufinden.
In einer Welt, die mir fremder und weniger real erscheint als Vorena.
Schon lange bevor Dr. Jensen mich gefragt hat, ob ich bei seinem Experiment mitwirken will, habe ich die Hoffnung aufgegeben. Er hat mir schonungslos offengelegt, wie gering die Erfolgsaussichten waren, und dennoch habe ich, ohne zu zögern, zugestimmt. Nicht weil ich darauf gehofft hatte, geheilt zu werden, sondern weil ich dachte, dass dies ein guter Weg wäre, dem Ganzen ein Ende zu setzen.
Und dann stand ich plötzlich in dieser Lichtung, habe das Wasser an meinen Füßen gespürt und den Wind in meinen Haaren. Es war wie ein Traum.
Genau das ist Teil meines Problems. Es war nicht echt, und ich habe es nie wirklich als echt wahrgenommen. Ich habe mich auf den Traum eingelassen, in dem Traum gelebt, als wäre er wahr, aber im hintersten Winkel meiner Gedanken habe ich nicht daran geglaubt.
Jedes Mal, wenn Dr. Jensen mir von den Fortschritten meiner Genesung berichtet hat, habe ich interessiert zugehört, gesagt und getan, wovon ich dachte, dass man es in diesem Moment sagen und tun sollte, doch geglaubt habe ich nichts davon. Schon am Anfang, als ich diesen verkrüppelten Körper in diesem Tank habe schweben sehen, habe ich keinen Bezug zu diesem Körper herstellen können. Das war nicht ich, ich habe damit nichts zu tun, und all das ist nicht wahr. Alles nur ein Traum.
Es blieb so, auch als meine Genesung weitere Fortschritte machte, Dr. Jensen von einer medizinischen Sensation gesprochen hatte, und so blieb es auch, als ich davon erfuhr, dass es weitere, nur unzureichende oder schwer zu erklärende Veränderungen an meinem Körper gab. Ich habe Dr. Jensen zugehört, wie er mir berichtet hat, dass mein Körper optimiert werden würde, habe verständig genickt, als er mir erzählte, welche Veränderungen das genau waren. Nichts, was für einen Menschen grundsätzlich unmöglich war. Ich bin nicht auf einmal Superwoman geworden, mein Gen-Code wurde nicht grundsätzlich verändert, sondern nur ein wenig optimiert.
Nur.
Ein.
Wenig.
Mein Vater würde sagen, dass es nur Tuning ist. Das Beste aus dem, was man hat, herauszuholen. Als ob man einen Kompressor auf einen alten V-8 Block schrauben würde. Alles nur ein wenig optimiert. Neue Stoßdämpfer, härtere Federn, Feinabstimmung des Fahrwerks … das gleiche Chassis, nur ein wenig getunt.
Das Problem für mich ist, dass ich dann tatsächlich aufgewacht bin. In eine Welt zurückkehren musste, von der ich selbst in diesem Moment befürchte, dass sie nicht echt, immer noch eine Simulation ist.
Okay, ich weiß es besser, ich bin mir sicher, dass dies die reale, echte Welt ist und dass ich hier ganz real mit meinen realen echten Freunden den ersten Tag in meinem neuen realen Leben feiere. Es ändert nichts daran, dass ich Angst habe, es wäre doch nicht so.
Die Welt hat sich weitergedreht, als ich diese Jahre hinter diesem Fenster verbracht habe, das mir nur den Himmel gezeigt hat.
Fire trägt Make-up, das je nach Lichteinfall matt schimmert und ab und zu die Farbe wechselt.
Es ist zugleich dezent und zieht dennoch Aufmerksamkeit auf sich.
Cats neues iPhone besitzt ein holografisches Display, das er wie selbstverständlich bedient, und Hogs Prothesen sind gut genug, dass er mit seinen Zehen zur Musik wippt.
Mouse ist nach wie vor blind, aber seine Brille sendet Ultraschallsignale aus, die es ihm erlaubten, zielsicher nach einer Bierdose zu greifen.
Es hat mich verrückt gemacht, dieses ständige Piing, Piing, Piiing, bis ich in meinem Set-up die Einstellung gefunden habe, die es mir erlaubte, das auszublenden.
Es sind alles nur Kleinigkeiten, die Straße, die neu geteert worden ist, die Geschäfte in der Stadt, die geschlossen, neu geöffnet wurden oder jetzt andere Namen tragen, oder die Frisuren.
Mein Vater fährt noch immer den gleichen Wagen wie zuvor, doch er ist älter geworden. Älter, als es die Jahre hätten zulassen sollen. Das Gleiche gilt auch für meine Freunde, auch hier ist der Unterschied nicht sehr groß, die Gesichter sind markanter geworden, hier und da sind die Falten etwas tiefer, die Haare etwas weniger und der Bauch etwas dicker geworden.
Viel hat sich nicht geändert, es sind nur ja nur ein paar Jahre gewesen, aber genug, um alles für mich etwas zu entfremden.
Doch die größte Veränderung finde ich im Spiegel. Ich werde bald vierzig, doch die junge Frau, die mich aus dem Spiegel anschaut, kann nicht viel älter als Anfang zwanzig sein. Die silbernen Haare fließen wie flüssiges Metall, und die violetten Augen halten jeden Blick fest, den sie einfangen.
Es ist ohne Zweifel mein Gesicht, doch ein paar kleine Veränderungen hier und da haben aus einem nicht schlecht oder ganz passabel ein »Warum kann ich nicht wegschauen?« gemacht.
Ich könnte mich darüber beschweren, dass mein Busen kleiner geworden ist, aber das wäre Jammern auf einem zu hohen Niveau.
Ich habe mein Leben lang entweder körperliche Arbeit hier auf der Farm verrichtet oder hart trainiert. Teilweise, als ob ich besessen davon gewesen wäre. Doch jetzt besitze ich den Körper einer Hochleistungsathletin, ohne dass ich dafür etwas getan habe. Den Körper meines Avatars in Vorena. Die Augen, die Haare, das Gesicht, die körperlichen Fähigkeiten … in Vorena ist das nicht außergewöhnlich, die allermeisten Spieler haben sich im Spiel schöner gemacht. Warum auch nicht, wer will schon hässlich sein. Im Spiel wimmelt es nur so von Supermodellen, da falle ich nicht weiter auf.
Aber dies ist nicht Vorena.
Dies ist die reale Welt.
Ehrlich gesagt, ich habe fast Angst, mich auf die Straße zu bewegen.
Doch wenn das alles gewesen wäre, hätte ich mich damit wahrscheinlich schnell anfreunden können.
Wenn es nur dabei geblieben wäre.
Ich habe vorher schon gute Augen gehabt, doch jetzt ist ein Adler blind im Vergleich zu mir. Vor meinem Unfall sind meine Reflexe schon außergewöhnlich gewesen, jetzt … vorhin habe ich eine Fliege sanft mit zwei Fingern eingefangen und dann wieder weiterfliegen lassen.
Ich habe nicht viel Zeit zum Experimentieren gehabt, doch es hat gereicht, um herauszufinden, dass ich jetzt bestimmt drei- bis viermal so stark bin wie zuvor.
In meinen Augen ist das nicht nur »ein bisschen« optimiert!
Es ist mittlerweile Nacht geworden. Sie ist für mich nicht unbedingt heller geworden. Dass ich dennoch alles so gut sehen kann, als wäre es Tag, liegt nicht alleine daran, dass ich besser sehe, sondern vor allem daran, dass ich ungleich mehr wahrnehme als zuvor.
Ich denke, dass ich froh sein sollte. Nicht nur, dass ich wieder gesund und fit bin, ich könnte jetzt glatt eine Superheldin aus einem Comic sein.
Ich weiß nicht, wie viele junge Mädchen von so etwas träumen, aber ich weiß, dass ich jetzt anders bin.
Doch ich habe das weder gewollt noch erhofft oder verdient.
Ich lache leise, was mir einen Blick von Fire einbringt, die aber sonst nicht weiter reagiert. Es ist absurd. Mein ganzes Leben lang wollte ich anders sein, besser als andere, bin von Ehrgeiz getrieben gewesen und, wie mein Vater mir vorgeworfen hat, auf der Suche nach einer Herausforderung gewesen, die zu viel für mich ist, an der ich endlich scheitern kann, die mich vielleicht sogar umbringt, damit ich endlich Frieden finden kann.
Ich habe ihn ausgelacht.
Wer hätte gedacht, dass ein 2029er Ford-Pick-up zu viel für mich sein könnte?
Mein Problem ist die Hoffnung. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Mag sein, dass es so ist, nur in meinem Fall halt eben nicht.
Ich habe meine Hoffnung überlebt.
In diesem Zimmer mit dem Fenster zum Himmel habe ich die Hoffnung aufgegeben, und jetzt sitze ich hier und trinke mit meinen Freunden zusammen Bier.
Ein Traum, den ich oft genug gehabt habe und von dem ich gewusst habe, dass er nie in Erfüllung gehen würde.
Jetzt ist der Traum wahr geworden, und ich habe Angst zu hoffen. Es ist idiotisch, über alle Maßen bescheuert, aber manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass es mir lieber wäre, ich würde ohne Hoffnung in diesem Zimmer liegen und durch dieses Fenster einen Himmel sehen, der nur für andere da ist und für die Welt, mit der ich nichts mehr zu tun habe.
Ohne auf die anderen zu achten, stehe ich auf und lehne mich an den Verandapfosten. Von hier aus kann ich den zugeschütteten Teich sehen, in dem Manuela ertrunken ist, aber auch die Sterne, die hier, fernab der Stadt, klar und deutlich zu sehen sind, vor allem jetzt, da meine Augen so gut geworden sind. Ein Meer von Sternen. Erhaben, majestätisch, unendlich und ewig.
Furcht einflößend.
Etwas ist da draußen, und es kommt auf uns zu. Wenn Dr. Jensen recht behalten sollte, bin ich die Einzige, die etwas gegen die Katastrophe tun kann, die uns erwartet.
Warum ich?
Habe ich nicht schon genug Stress?
Ich würde mich gerne darüber beschweren, dass es nicht in dem Vertrag gestanden hat, den ich unterschrieben habe. Nur weiß ich, dass auch Dr. Jensen nicht mit dem gerechnet hat, was mit mir geschehen ist.
Ich lehne an meinem Verandapfosten und schaue weiter zu, wie die Menschen, die mir in dieser Welt am meisten bedeuten, meine Wiedergeburt feiern. Wir müssen morgen nicht fliegen, haben keinen Einsatz, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir nie mehr einen Einsatz haben werden.
Also sind wir stillschweigend übereingekommen, uns so zu betrinken, als gäbe es kein Morgen mehr. Sie feiern, lachen, trinken.
Ich sehe ihnen dabei zu.
Fire besitzt wie üblich die besten Antennen und bringt die anderen dazu, mich in Ruhe zu lassen. Ich bin ihr dankbar dafür.
Als am frühen Morgen das Robocab kommt, habe ich keine Probleme, sie alle nacheinander in das Taxi zu verfrachten, als ob sie nur ein Drittel ihres Gewichts hätten. Als ich Fire in ihren Sitz lege und sie anschnalle, wacht sie auf, grinst, zieht mich zu sich heran, gibt mir einen schmatzenden Kuss … lacht trunken, fällt in ihren Sitz zurück und schläft direkt wieder ein.
Lange nachdem das Taxi schon nicht mehr zu sehen ist, stehe ich immer noch dort und schaue in die Richtung, in der es verschwunden ist.
Ich fühle mich, als hätte ich etwas unendlich Wertvolles verloren, nur weiß ich nicht, was es sein könnte.
Ich verscheuche diese Gedanken. Es gibt etwas, das ich jetzt tun muss. Etwas, von dem ich gedacht habe, dass ich es nie wieder erleben würde.
2 Diana
»Wir haben ein Problem.« Ich weiß, ohne hinzuschauen, zu wem diese Stimme gehört. Auch wenn ich sie mag, ist sie im Moment die letzte Person – das letzte Wesen? Konstrukt? –, die ich im Moment sehen will.
Also tue ich so, als hätte ich sie nicht gehört.
Ich sitze im Schneidersitz auf dem Dach unserer Scheune, eine Dose Bier schwebt neben mir in der Luft, der Rest des Sixpacks liegt vor mir auf dem Dach. Vor mir, in der Ferne, rötet sich der Himmel.
Ich bin hier, weil ich mir zum ersten Mal seit Jahren einen Sonnenaufgang anschauen will, einen Sonnenaufgang, von dem ich lange geglaubt habe, dass ich ihn nie wieder sehen werde.
Erst gestern hat mich mein Vater nach Hause gebracht, und es ist noch keine zwei Stunden her, dass ich Fire und Cat, Hog, Mouse und Jessica ins Taxi gesetzt habe.
Es ist eine seltsame Party gewesen. Meine »Ich lebe noch«-Party, in der ich, mehr oder weniger, meinen eigenen Gedanken nachgehangen habe.
Mein Dad ist schon vor Stunden ins Bett gegangen, und bis eben habe ich es genossen, alleine zu sein. So richtig alleine, für mich, ohne an ein Bett gefesselt zu sein, ohne dass ein Krankenpfleger alle paar Stunden nachschaut, ob ich noch am Leben bin.
»Es ist wichtig«, sagt die Stimme, die ich nicht hören will.
Ich werfe einen Blick zur Seite hin. Diana sitzt neben mir auf dem Dach. Sie trägt blaue Hotpants, und mit Hot meine ich so kurz, dass sie kaum etwas der Fantasie überlassen, dazu weiße Schlangenleder-Cowboystiefel und ein rot-weiß kariertes Hemd, das sie fahrlässig unter ihrem Busen zusammengeknöpft hat.
In anderen Worten, sie bedient das Klischee fast perfekt. Fehlt nur noch der Hut und der Strohhalm, auf dem sie kauen kann.
Sie ist kein Hologramm, und ich weiß, dass ich, wenn ich es wollte, sie berühren, fühlen könnte, während mein Vater wahrscheinlich nicht einmal imstande sein wird, sie zu sehen.
Meine eigene unsichtbare Freundin. Leider bin ich mir sicher, dass ich sie mir nicht einbilde.
Abgesehen davon, hätte sie nicht hier sein sollen.
Es sind genau hunderteinundzwanzig Meilen Luftlinie von hier zu dem VRI-Forschungszentrum, ich habe nachgeschaut.
»Er hat mir zwei Wochen gegeben«, erinnere ich sie und wende mich wieder dem Sonnenaufgang zu. »Heute ist der zweite Tag. Komm in zwölf Tagen wieder.«
»Dann ist es zu spät.« Sie seufzt. Aus tiefster Seele. Seitdem ich sie kenne, ist sie immer besser darin geworden, sich wie ein Mensch zu geben. Jetzt weist so gut wie nichts mehr darauf hin, dass sie nicht real ist. »Glaube mir, ich würde dir lieber die Zeit geben. Abgesehen davon, ich bin so real wie du, und du weißt das.«
Richtig. Sie kann Gedanken lesen. Zumindest meine. »Nicht in dieser Welt.«
»In dieser Welt bin ich ein achthundert Kilo schwerer Kubus. Und real. Du weichst vom Thema ab.«
»Nein. Mein Thema ist: Ich habe Urlaub.«
Sie setzt sich etwas anders hin, sodass sie jetzt mir zugewendet ist. »Du weißt, dass Vorena einige Elemente enthält, die nicht von uns entwickelt wurden.«
Einige? Ich habe eher den Verdacht, dass das meiste davon nicht von VRI programmiert wurde.
»So weit richtig«, stimmt sie mir zu. »Vorena wurde prozedural generiert, und den Rest haben wir gemacht.«
Mit »wir« meint sie sich und die anderen elf KIs, die zusammen mit Diana Vorena geschaffen haben.
»Ja«, bestätigt sie. »Und du weißt auch, dass wir mittlerweile der Ansicht sind, dass wir geprüft werden. Dass wir Schritt für Schritt weitere Informationen freigeschaltet bekommen, wenn wir gewisse Bedingungen erreicht haben?«
Ja. Dr. Jensen hat es mir erklärt.
»Genau darin liegt das Problem. Mittlerweile ist es keine Vermutung mehr, sondern Gewissheit.«
»Wieso das?«, frage ich sie überrascht und schaue jetzt doch zu ihr hin.
»Weil wir eine Systemnachricht erhalten haben, in der uns mitgeteilt wurde, dass die einzige Person, die bisher die Prüfungen bestanden hat, sich zurzeit nicht im Spiel befindet. Dass die nächste Prüfung unmittelbar bevorsteht. Dass, wenn du nicht innerhalb der nächsten fünf Tage ins Spiel zurückkehrst, wir die nächste Bedingung nicht erfüllen können.« Sie hält kurz inne. »Wir. Die Menschheit.«
Mir fällt durchaus auf, dass sie sich dazu zählt. Warum auch nicht? Sie wird mit jedem Tag menschlicher.
Dennoch schnaube ich ungläubig auf. »Das Schicksal der Menschheit lastet also auf meinen Schultern. Bei allem Respekt, ist das nicht etwas zu dick aufgetragen? Es ist ja nicht so, dass ich im Spiel Großartiges geleistet hätte. Abgesehen davon, gibt es andere im Spiel, die erfolgreicher sind, als ich es bin. Und es gibt da noch dieses kleine Problem, dass mein Charakter jetzt Stufe 0, ein NSC und vor allem tot ist. Und wahrscheinlich aufgefressen wurde.«
»Hyacinthe frisst nur solche, die sie nicht mag. Tatsächlich ist dein Charakter noch am Leben. Ich glaube auch nicht, dass es etwas mit deinen Leistungen im Spiel zu tun hat. Eher mit deinen Entscheidungen. Und damit, wie gut du auf die neuronale Brücke reagierst. Du bist bisher die Einzige, die eine hundertprozentige Integration erreicht hat. Wir denken, dass das der wesentliche Punkt ist.«
Jetzt bin ich es, die seufzt.
»Okay. Wie viel Zeit gibt mir Dr. Jensen?«
»Dr. Jensen weiß nicht, dass ich hier bin.«
Ich schaue sie überrascht an. »Nicht? Wieso, wenn es doch so wichtig …«
»Ich habe es vielleicht etwas übertrieben dargestellt, als ich davon sprach, dass das System es uns gesagt hätte.«
»Was hat es denn genau gesagt?«
»Das ist es ja. Es ist mehr so etwas wie ein Gefühl. Dr. Jensen sagt, dass das keine verlässliche Basis ist. Er hat sich geweigert, dich ins Spiel zurückzuholen, bevor dein Urlaub vorbei ist. Er sagt, du hättest ihn verdient. Ich bin der gleichen Ansicht, aber …« Sie zuckt etwas hilflos wirkend mit den Schultern. »Ich weiß, was ich fühle.«
Auf der einen Seite kommt es mir absurd vor, dass ein Computer von einem Gefühl spricht. Auf der anderen Seite ist sie kein normaler Computer. Sie ist Diana. Und ich glaube ihr.
»Danke«, sagt sie leise.
»Erzähle mir mehr von diesem Gefühl.«
»Ich habe Angst«, sagt sie einfach.
»Angst?« Sie kann meine Überraschung spüren.
»Ein Gefühl unbestimmter Bedrohung von dem, was kommt. Und Hilflosigkeit.« Sie verzieht das Gesicht. »Ich bin nicht hilflos. Wir sind nicht hilflos. Es fühlt sich nur so an.« Sie schüttelt ungläubig den Kopf. »Ich weiß nicht, wie ihr Menschen mit diesen Gefühlen leben könnt. Sie sind so … ungenau.«
Ich muss lachen. »Das sind sie. Wie definierst du Gefühle?«
»Als unbewiesene Annahmen, deren Validität man entweder herbeisehnt oder befürchtet.«
Okay. Das passt. So in etwa.
»Und was kommt auf uns zu?«
»Ich weiß es nicht«, flüstert sie. »Ich weiß nur, dass ich Angst habe. Und ich dieses Gefühl so ganz und gar nicht mag.«
Mittlerweile hat der Sonnenaufgang angefangen, taucht die Welt um uns herum in rote Farben.
»Okay«, sage ich. »Wie lange habe ich Zeit?« Ich lächle etwas schief. »Deinem Gefühl nach?«
»Zwei, drei Tage. Nicht mehr als fünf.«
»Okay«, sage ich erneut und trinke mein Bier aus, greife den Rest des Sixpacks aus der Luft und springe vom Dach der Scheune herunter. Es sind etwas mehr als sieben Meter.
Sieben Meter und zwölf Zentimeter. Und drei Millimeter. Um exakt zu sein.
Was ich nicht will.
Es ist hoch genug, um sich die Knochen zu brechen. Für mich ist es, als wäre es nur eine Bordsteinkante. »Dann nehme ich mir vierundzwanzig Stunden.«
Ich ziehe die Türen der Scheune auf. Dort steht sie. Betsy. Meine erste große Liebe.
»Was hast du vor?«, fragt sie mich, während sie Betsy genauer anschaut.
»Ausreißen. Vierundzwanzig Stunden lang so tun, als gäbe es keine Probleme. Leben. Mich treiben lassen. Schauen, wohin die Straße mich führt. Freiheit. Und so.« Ich ziehe die Plane von Betsy herunter.
Diana hebt eine Augenbraue fragend an. »In einem 56 Mustang?«
Ich grinse sie an. »Wie denn sonst?«
Sie scheint fasziniert von Betsy. »Das Ding ist vollständig analog. Keine Airbags, kein Autopilot. Noch nicht einmal ABS oder Sicherheitsgurte. Das Ding hat noch Trommelbremsen? Ernsthaft? Bei dem Gewicht? Bist du sicher, dass du das tun willst?«
»Und ob.« Mir kommt eine verrückte Idee. »Willst du mitkommen?«
So einfach ist es dann doch nicht. Dad hat sich um Betsy gekümmert und sie fahrfähig gehalten, doch sie braucht eine neue Batterie, einen Ölwechsel und neue Reifen, die alten sind mir zu hart und spröde geworden.
Und vor allem kann ich es Dad nicht antun, einfach so zu verschwinden.
Als ich ins Haus zurückgehe, ist er schon wach. Er ist schon immer ein Frühaufsteher gewesen. Macht Frühstück. Pancakes. Als ich ein Kind war, wäre ich für seine Pancakes gestorben.
Als ich den ersten Bissen nehme und unwillkürlich aufstöhne, stelle ich fest, dass sich doch weniger geändert hat, als ich dachte.
»So«, sagt er. »Betsy?«
Ich nicke. Mein Mund ist voll.
»Kommst du wieder?«
Berechtigte Frage. Das letzte Mal hat es sechs Jahre gedauert. Ich schlucke.
»Ja.« Ich schaue unwillkürlich zu Diana hin, die neben der Durchreiche zum Wohnzimmer an der Wand lehnt. »Doch danach muss ich wieder weg.«
»Hm«, sagt er und folgt meinem Blick. Nicht, dass er sie sehen könnte. »Wer ist das?«
Ich verschlucke mich an meinem Kaffee, huste. »Du kannst sie sehen?«
Er nickt und zeigt mit seinem Zeigefinger auf seine Augen.
»VR-Linsen«, erklärt er mir. »Dein Dr. Jensen hat sie mir gegeben, damit ich mich bei VRI besser zurechtfinde. Ich habe vergessen, sie herauszunehmen, man merkt sie wirklich kaum.«
»Was das erklärt«, sagt Diana. »Jeder bei VRI trägt solche Linsen, damit er mit den virtuellen Konstrukten dort interagieren kann. Oder mit mir und den Avataren der anderen KIs. Und natürlich sind sie auf die VRI-Frequenz und Verschlüsselung eingestellt.« Sie grinst mich an. »Also ja, er kann mich sehen.«
Vater sagt nichts. Er schaut mich nur an.
»Das ist Diana.«
»Die KI, die dich geheilt hat?«
Ich nicke.
Er mustert sie. »Danke«, sagt er dann einfach. »Ich hätte nicht gewusst, wie ich hätte weiterleben sollen, wenn ich sie auch noch verloren hätte.«
»Ich war nicht die Einzige«, sagt Diana bescheiden. »Aber … gern geschehen.«
Er nickt und blickt wieder zu mir hin. »Warum?«
Ich kenne meinen Vater, also weiß ich, was er meint.
»Es gibt ein Problem bei VRI.«
Er nickt langsam. »Es hat etwas damit zu tun, dass du jetzt diese Dinge kannst?« Er lächelt leicht. »Ich habe gesehen, wie du Betsy von den Böcken hast schweben lassen. Das ist etwas mehr als eine Wasserflasche.«
Das ist es in der Tat. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, aber ich habe es einfach versucht. Tatsächlich war ich nicht überrascht, als Betsy zu schweben anfing. Nur davon, dass es nicht schwerer war, als mein Bier schweben zu lassen. Es brauchte nur etwas mehr Konzentration.
»Nur indirekt«, antwortet Diana an meiner Stelle. »Sie ist bis jetzt die Einzige, die sich mit ihrer neuronalen Brücke vollständig integrieren konnte.«
»Wenn ich das richtig verstehe, war diese neuronale Brücke maßgeblich an deiner Heilung beteiligt«, sagt er und mustert meine Haare. Die noch immer die gleiche Farbe haben wie die meines Avatars im Spiel. »Und an allem anderen.«
Ich nicke.
Er nickt ebenfalls. »Nichts ist umsonst.« Er mustert mich eindringlich. »Kommst du wieder?«
»Natürlich«, sage ich. »Ich kann mich jetzt aus dem Spiel ausloggen und …«
»Das meine ich nicht«, sagt er ruhig. »Auch wenn ich nicht alles verstehe, ich habe Ohren, weißt du? Du und die anderen habt gestern Abend darüber spekuliert, wohin das alles führt. VRI braucht eine Pilotin für das Raumschiff, das sie bauen. Ich will wissen, ob du wiederkommst.«
Die Frage ist vielschichtiger, als sie sich anhört. Er bestätigt es auch gleich. »Das mit Manuela war nicht deine Schuld«, fügt er mit rauer Stimme hinzu.
Er will wissen, ob ich wiederkommen will. Ob ich überleben will. Ob ich noch immer das Problem habe, mich in unmögliche Situationen zu stürzen, Risiken einzugehen, weil ich das Gefühl habe, es nicht zu verdienen zu leben, wenn Manuela tot ist.
Mein Vater und ich haben nach Manuelas Tod nicht mehr viel miteinander geredet. Wir konnten es irgendwie nicht. Was nicht bedeutet, dass er mich nicht kennt. Aber ich habe mich geändert. Mehr, als es jemand für möglich gehalten hätte.
Selbst Dr. Jensen nicht.
Nur eines ist sicher: An Lebenswillen fehlt es mir jetzt nicht mehr.
»Ja, Dad«, sage ich und schlucke wegen des Frosches in meinem Hals. »Ich werde wiederkommen.«
»Dann ist es ja gut«, sagt er. »Du kannst die Batterie aus dem kleinen Traktor für Betsy nehmen. Und ich habe bei Tommy schon vor einem halben Jahr neue Reifen bestellt, ich bin nur nicht dazu gekommen, sie abzuholen. Nicht, bevor ich wusste, dass du wiederkommst.«
»Ja, Dad«, sage ich leise. »Ich komme wieder.«
»Gut«, sagt er erneut und hält mir den Teller mit den Pancakes hin. Ein feines Lächeln spielt um seine Lippen. »Noch mehr?«
»Ja, Dad. Danke.« Ich meine nicht nur für die Pancakes. Ich glaube, er weiß das.
Tommy und ich sind zusammen in die Schule gegangen. Wir waren eine Zeit lang befreundet, was sich gegeben hat, als er mit Angie zusammengekommen ist. Nach Manuelas Tod bin ich … schwierig gewesen. In gewisser Hinsicht hat es Jahre gedauert, bis ich einigermaßen mit mir ins Reine gekommen bin. Vielleicht sogar bis jetzt. Sagen wir es so, ich bin nicht gut darin gewesen, auf andere Rücksicht zu nehmen.
Oder auf mich.
Ich habe damals gedacht, dass es besser für ihn wäre, mit jemandem zusammenzukommen, der nicht so wahnsinnig ist wie ich. Will damit sagen, dass Tommy und Angie meinen Segen hatten.
Nur denke ich nicht, dass Angie jemals bereit gewesen ist, das zu glauben.
Angie und er haben geheiratet, dann im Jahrestakt vier Kinder in die Welt gebracht, und irgendwann muss er die Werkstatt seines Vaters übernommen haben.
Als ich vor der Werkstatt anhalte, erkennt er mich erst nicht. Doch er erkennt Betsy. Und dann erst mich. Um mich dann ungläubig anzustarren. »Alex?«, fragt er fast stotternd. »Bist du das?«
Ich kann ihn verstehen. Mein Körper hat sich meinem Avatar im Spiel angepasst. Es sind nur kleine Unterschiede, aber in der Summe sind sie deutlich. Ich habe mich nie als hässlich empfunden, aber ich bin auch keine außergewöhnliche Schönheit gewesen. Auf meinen Körper bin ich stolz gewesen, es war jahrelange harte Arbeit, so fit zu sein und zu bleiben, doch mein Gesicht war und blieb eben das meine.
Ich habe mich in den letzten Tagen öfter im Spiegel angeschaut, habe versucht, herauszufinden, was genau den Unterschied ausmacht. Ich kann es immer noch nicht genau sagen, nur dass es weniger so ist, dass ich im herkömmlichen Sinne »schöner« geworden bin. Eher so, dass mein Gesicht … dramatischer geworden ist. Oder klassischer. Meine Nase ist etwas gerader, mein Mund etwas weiter und mein Kinn kantiger. Wenigstens kommt es mir so vor. Ich habe mir alte Bilder von mir angesehen, und ich bin immer noch zweifelsfrei ich.
Doch es gibt noch einen anderen großen Unterschied. Ich habe mich immer in Form gehalten, und oft hat man mich jünger geschätzt, als ich es war, doch kein Training der Welt macht einen jünger.
In drei Monaten werde ich vierzig. Die große Vier Null. Doch die Frau, die mich aus dem Spiegel anschaut, könnte auch genauso gut zwanzig sein. Sie … ich, habe jetzt etwas Zeitloses an mir, das ich so noch nicht gesehen habe.
Ich kann nicht sagen, dass ich etwas dagegen habe. Wer will nicht gut aussehen? Nichts von dem, was die Regenerationstherapie mit mir gemacht hat, ist unwillkommen. Ich bin fitter, als ich es je war, stärker, schneller, jünger und ja, vielleicht auch schöner. Und verfüge über bisher noch unerklärte Fähigkeiten. Ich bin jetzt Supergirl, wie Hog gesagt hat. Oder eher, worauf Fire bestanden hat, Superwoman.
Was nicht bedeutet, dass ich mir keine Gedanken darüber mache. Hätte man mich vorher gefragt, ob ich das will, hätte ich überall ein Ja angekreuzt. Ganz ohne Zweifel. Ich denke, jede andere hätte das auch getan.
Doch es entfernt mich von meinen Mitmenschen.
Es macht mich anders.
Tommy schaut nicht nur überrascht, sondern auch ein wenig erschrocken.
Auch ich erkenne ihn kaum wieder. Es ist fünfzehn Jahre her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Seitdem hat er dreißig Kilo zugenommen, hat fast alle seiner Haare verloren und sieht, obwohl er in meinem Alter ist, deutlich älter aus. Die strahlenden blauen Augen, die mich damals hinter der Tribüne so leicht zu meinem ersten Kuss verführt haben, sind blass geworden.
Angie steht in der Tür zum Office und schaut mich böse an. Zumindest das hat sich nicht geändert. Alles andere schon. Es fällt mir schwer, in ihr die Cheerleaderin zu erkennen, die sich damals in den Kopf gesetzt hat, dass der Football-Star der Schule ihr gehört.
Beide kommen mir von der Last des Lebens niedergedrückt vor, es ist schwer vorstellbar, dass die beiden noch irgendeinen Grund zum Lachen finden können.
Es zeigt mir auf, wie viel Glück ich gehabt habe.
Der Unterschied ist mir fast schon peinlich.
»Als du jahrelang querschnittsgelähmt im Krankenbett gelegen hast, hätte niemand mit dir tauschen wollen«, sagt Diana, die, wie üblich, meine Gedanken liest. Sie sitzt neben mir auf dem Beifahrersitz, das heißt, sie sitzt weniger, als dass sie halb liegt, einen ihrer Füße hat sie aus dem Fenster gestreckt, und wenn man sie sehen könnte, hätte sie vielleicht für Unfälle gesorgt.
Oder vielleicht auch nicht.
Als ich siebzehn war, habe ich Ähnliches getan, demonstrieren wollen, dass ich über allen Dingen stehe und sooo cool bin. Ich weiß nicht, was sie demonstrieren will, schließlich kann nur ich sie sehen.
»Ich übe. Was nichts daran ändert, dass du etwas überlebt hast, an dem andere verzweifelt wären. Ich verstehe den Neid noch nicht so ganz. In der gleichen Situation hätte er nicht überlebt.« Sie sagt es mit deutlicher Gewissheit.
Ich versuche, mir von diesen Gedanken nichts anmerken zu lassen, und begrüße Tommy mit einem strahlenden Lächeln.
»Hi, Tommy. Dad hat gesagt, dass du Reifen für mich hast. Kannst du sie mir aufziehen und noch einen Ölwechsel machen?«
»Klar kann ich das. Für dich doch immer.« Für einen Moment blitzt der alte Tommy kurz auf, nur um dann schuldbewusst zu Angie hinzuschauen und den Kopf wie eine Schildkröte einzuziehen.
Manche Dinge ändern sich also doch nicht.
Tommy sagt, dass es eine halbe Stunde brauchen wird und dass ich gerne bei ihm im Büro warten kann.
Ich sage höflich Nein danke und flüchte, bevor mich Angie noch mit ihrem Blick erdolcht.
»Hier bist du also aufgewachsen?«, fragt Diana, die sich neugierig umschaut, während wir die Mainstreet entlanggehen. Ich schaue nicht minder neugierig. Es hat sich vieles verändert, und doch ist irgendwie alles beim Alten geblieben. Nur sind jetzt mehr Geschäfte geschlossen, und alles sieht heruntergekommener aus.
Ich denke kurz nach und schüttle den Kopf. »Ich bin hier zur Schule gegangen, aufgewachsen bin ich bei Dad.« Der, wie ich jetzt erst langsam zu verstehen beginne, es nicht einfach mit mir gehabt hat. Und trotzdem immer für mich da gewesen ist.
Wir landen bei Ma’s Diner, der sich so gut wie nicht verändert hat. Selbst Ma hat sich nicht verändert, bis ich erkenne, dass es Suzie ist, eine andere alte Klassenkameradin, die mich mit einem müden Lächeln fragt, was ich denn will.
Sie erkennt mich offensichtlich nicht, und mir ist es recht so.
Ich nehme den Big Burger. Fettig, auf offener Flamme gebraten, mit Zwiebeln, Käse, jeder Menge Soße … herrlich ungesund.
Ich habe mehr als einmal davon geträumt, wieder einen solchen Burger essen zu können. Als er serviert wird, nimmt er fast den gesamten Teller ein, und aus irgendeinem Grund bin ich fast den Tränen nah.
»O Mann«, seufzt Diana, als ich den ersten Bissen nehme. »Das kann nicht sein, dass etwas so Ungesundes so gut schmeckt!«
Ich ziehe kauend eine Augenbraue hoch. Da sie meine Gedanken liest, muss ich nicht laut sprechen.
»Ich nehme es durch dich wahr«, erklärt sie mir und schaut fasziniert zu, wie ich einen weiteren Bissen nehme. Der Burger ist so groß, dass man ihn mit zwei Händen halten muss. Oder mit Messer und Gabel essen, doch das wäre irgendwie Blasphemie.
Ich kaue und schlucke und wische mir den Mund ab, bevor mir etwas auf mein T-Shirt tropft. »Ich wollte sowieso schon wissen, wie du das machst. Siehst du alles durch meine Augen? Wenn ja, wie schwierig ist das für dich?«
»Ich nehme die Welt primär durch dich wahr, doch du bist nicht die einzige Quelle.« Sie deutet mit ihrem Blick zu einer Ecke hin, wo sich eine kleine Überwachungskamera befindet. »Es gibt überall Datenquellen für mich. Ich justiere meinen Blickwinkel dann einfach so, als ob ich es durch meine Augen wahrnehmen würde. Es ist auch nicht schwierig, ich verwende weniger als ein Tausendstel Prozent deiner Rechenleistung.«
»Meiner Rechenleistung?«, frage ich überrascht, obwohl das durchaus Sinn ergibt. Es ist meine neuronale Brücke, durch die ich mich in Vorena einlogge, demzufolge muss sie eine gewisse Kapazität besitzen.
»Zwei Dinge dazu«, erklärt sie mir mit einem amüsierten Lächeln. »Die Brücke verwendet dein Gehirn als Hauptprozessor. Die Brücke selbst ist für Kommunikation, Sensorik und Interaktion zuständig, das Denken überlässt sie dir. Das andere ist …« Sie lächelt schelmisch. »Abgesehen von mir bist du der leistungsfähigste Computer auf dieser Welt. Betrachtet man den organischen Anteil, bist du in vielen Dingen noch leistungsfähiger, als ich es bin.«
Ich schaue sie ungläubig an. »Du wiegst nach eigenen Angaben achthundert Kilo. Meine Brücke wiegt weniger als ein Gramm!«
»Die Quantencomputer, auf denen ich laufe, sind menschliche Grenztechnologie. Dr. Jensen hat die Vorlage aus dem Signal verwendet, aber es ist, jetzt zumindest, menschliche Technologie. Wir verstehen diese Technologie. Zumindest Dr. Jensen versteht sie. Und ich natürlich.« Sie beugt sich vor und tippt mir mit dem Finger auf die Stirn. Ich fühle es, als ob sie echt wäre. »Doch das Ding in deinem Kopf ist Alien Tech, die nachgebaut wurde, ohne dass wir verstehen, wie sie funktioniert. Es ist so, als ob ein Affe einen Computer nach Anleitung zusammengebaut hätte. Ein Wunder, dass sie überhaupt funktioniert.« Sie lächelt breit, vielleicht bleckt sie aber auch nur die Zähne. »Deine Brücke hat auch deutlich mehr gekostet als ich. Gerade weil niemand versteht, wie genau sie funktioniert.« Sie schaut gierig zu, wie ich einen weiteren Bissen nehme und gründlich kaue, es genieße. »Wir gehen davon aus, dass wir zu diesem Zeitpunkt nur einen Bruchteil der Funktionen kennen. Dr. Jensen hat ein ganzes Expertenteam zusammengestellt, nur um die eine Frage zu beantworten: Wie zur Hölle hat sie deinen Gen-Code optimiert?« Sie zuckt mit einer überzeugend menschlich wirkenden Geste die schmalen Schultern. »Es ist wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Wenn sie es herausfinden, wird es gefährlich werden.«
»Wie das?«, frage ich zwischen dem Kauen.
»Du kennst die Menschen besser als ich, Alex. Sag mir, was sind Menschen bereit zu tun, um die Unsterblichkeit zu erhalten?«
Ich verschlucke mich an meinem Burger. »Was?!«
Sie macht eine Geste zu mir hin. »Soweit wir es verstehen, wurde dein Gen-Code optimiert und die Fehler darin beseitigt. Fehler, von denen wir nicht wussten, dass es Fehler sind. Einer dieser Fehler war dein Alterungsprozess. Biologisch bist du jetzt Anfang zwanzig. Es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass die Brücke dich nicht in diesem Zustand halten kann.«
Sie beugt sich vor, um mich eindringlich anzusehen. »Ich kann verstehen, dass du noch nicht darüber nachgedacht hast, das Wunder, dass du wieder gesund bist, musst du ja erst einmal verarbeiten. Aber Dr. Jensen hat das sofort gesehen. Es ist überraschend, dass er dich überhaupt hat gehen lassen, an und für sich müsste er dich im tiefsten Bunker versteckt halten, damit dir ja nichts geschieht.« Sie lehnt sich wieder zurück. »Aber genau das ist der Grund, warum ich Dr. Jensen mag. Er hält Wort. Aber viele andere Menschen tun das nicht. Wenn jemand herausfindet, wer und vor allem was du jetzt bist, wird man hinter dir her sein wie der Teufel hinter der armen Seele. Du bist im Moment das Wertvollste, das die Menschheit besitzt. Und niemand hat damit gerechnet, dass es so kommen würde. Niemand hat damit rechnen können, dass die Brücke deinen Gen-Code so umschreiben kann! Doch auch ohne dass sie es wissen, versucht dein alter Boss bereits jetzt schon, dich wieder unter ihre Befehlsgewalt zu bekommen.«
Mein alter Boss?
»Das Militär. Das Pentagon. Sie haben Dr. Jensens Arbeit mit Milliarden gefördert. Denke an deine Freunde, die jetzt auch wieder hoffen können, von ihren Verletzungen zu genesen. Wie viele kriegsversehrte Veteranen gibt es? Erfahrene Soldaten, die nur wegen ihrer Verletzungen aus dem Dienst haben ausscheiden müssen? Du bist schneller und stärker, als du es je zuvor gewesen bist. Der feuchte Traum jedes Militärs. Der Supersoldat, den sie sich schon so lange erträumt haben.«
Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, aber so deutlich, wie Diana es formuliert hat, eben doch nicht.
Mein Appetit vergeht mir, und ich schiebe den zu zwei Dritteln vertilgten Burger von mir weg.
»Was wissen sie?«
»Das Pentagon? Dass es vielversprechende Ansätze gibt.« Sie macht eine Geste, die mich und den Diner einschließt. »Alleine dass du dich von deinen Verletzungen erholt hast, ist schon eine Sensation. Wenn sie wüssten, was sonst noch mit dir geschehen ist, glaube ich, dass sie alles versuchen würden, um dich in ihre Hände zu bekommen.« Diesmal ist es deutlich kein Lächeln, sondern wirklich ein Zähnefletschen. »Doch dazu müssen sie erst einmal an Dr. Jensen vorbei. Der Vertrag, den er mit dem Militär geschlossen hat, ist wasserdicht. Selbst wenn sie sich auf die nationale Sicherheit beziehen, werden sie sich an Dr. Jensen die Zähne ausbeißen. Aber das ändert nichts daran, dass du dich alleine schon dadurch, dass du gesund und munter auf deinen zwei Beinen läufst, einem Risiko aussetzt. Ich habe Dr. Jensen geraten, dir nicht ›frei‹ zu geben. Wenn es nach mir gegangen wäre, hättest du VRI nicht verlassen. In deinem eigenen Interesse. Es ist einfach zu gefährlich.«
Das muss ich erst einmal verdauen.
»Also würdest du es vorziehen, wenn ich jetzt auf der Stelle zu VRI zurückkehre?«
»Selbstverständlich. Logisch betrachtet, ist es das Risiko nicht wert.« Sie lächelt etwas verschmitzt. »Ich weiß, dass du das weißt. Ich weiß auch, dass du tanzen gehen willst, für ein paar Stunden so tun, als wäre all das nicht, wie es ist, und vor allem einen heißen Typen flachlegen willst, bevor du dich wieder einsperren lässt. Die Freiheit genießen. Wobei ich denke, dass es bei VRI genügend heiße Typen gibt. Dr. Jensen ist heiß.«
Er ist beeindruckend, aber heiß?
Sie lacht leise auf. »Ich bin ein Quantencomputer. Kannst du es mir verdenken, wenn ich seinen IQ heiß finde? Ich weiß, was du willst. Einen Cowboy, der dich reitet, bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und tropfnass zusammenbrichst. IQ kommt in deiner Auswahlliste nicht an erster Stelle.« Sie lacht leise. »Bedenkt man, dass es kaum jemanden geben wird, der mit deiner jetzigen Kondition mithalten kann, frage ich mich, wo du einen solchen Hengst finden willst.«
Ich glaube, ich bin tatsächlich rot geworden. Aber es ist die Wahrheit. Ich will endlich wieder flachgelegt werden.
»Oh«, sage ich. »Ich weiß genau, wo ich meinen Hengst finden werde.«
»Ist das nicht etwas sexistisch?«
Ich muss unwillkürlich lachen. »Ja«, grinse ich. »Das ist es. Und ich werde es genießen.«
3 Honky Tonk
Das Honky Tonk hatte schon immer einen wohlverdienten schlechten Ruf. Kaum dass ich sechzehn war und einen Führerschein besaß, habe ich herausfinden wollen, was an dem Gerede dran war. Es sind fast hundertzwanzig Meilen von unserer kleinen Farm bis zum Honky Tonk, weit genug weg, wie ich damals dachte, dass mich niemand kennen würde.
Nur hatte ich vergessen, dass das Honky Tonk mit seinem Ruf über ein großes Einzugsgebiet verfügte, schließlich bin ich selbst auch die Strecke gefahren.
Ich bin nur froh, dass mein Vater offenbar nichts davon erfahren hat, es hätte ihm mit Sicherheit graue Haare beschert. Es würde ihm wahrscheinlich auch heute noch so ergehen. Manche Geheimnisse sollten Eltern besser nie erfahren.
Heute, fast vierundzwanzig Jahre später, kann ich über mein damaliges Selbst auch nur den Kopf schütteln oder wahlweise auch rot werden. Oder beides.
Eines weiß ich heute: dass ich damals unverschämtes Glück gehabt habe.
Aber es ist der Laden, in den man geht, wenn man rollig ist und flachgelegt werden will. Wenn eine Frau das nicht weiß, wird sie es sehr schnell herausfinden. Niemand wird sie daran hindern zu gehen. Aber wenn sie bleibt, geht jeder davon aus, dass sie das Gleiche will.
Abgesehen davon, war das Tonk nicht übel. Es gab oft Livemusik, Tanzveranstaltungen und zumindest damals, je nach Abend, sechs bis acht Türsteher, die eingeschritten sind, wenn jemand zu aufdringlich wurde.
Als ich an diesem Abend mit Betsy auf dem Parkplatz des Tonk parke, kommt es mir vor, als ob sich auch hier nichts verändert hätte. Abgesehen davon, dass in den letzten Jahren dem Tonk ein neuer Anstrich verpasst wurde, in einem leuchtenden Rot.
Irgendwann ist das Tonk mal eine Ranch gewesen, und auf der umlaufenden, überdachten Veranda drängen sich wie früher gut zwei Dutzend Typen, die, mit einer Bierflasche in der Hand, betont lässig Ausschau nach dem Frischfleisch halten, obwohl es noch gar nicht so spät ist, die Sonne ist noch nicht untergegangen.
Als Betsy mit dem Brummeln ihres Acht-Zylinder-Motors auf den Parkplatz rollt, erweckt sie bereits Aufmerksamkeit. Als ich aussteige, werde ich mit einem Pfeifkonzert, gierigen Blicken und sexuell herabwürdigenden Bemerkungen empfangen, die anderswo eine Klagewelle auslösen würden.
Wie gesagt, man merkt als Frau sehr schnell, wo man hier gelandet ist.
Ich habe mich von Diana inspirieren lassen, Hotpants, über dem Bauch geknotetes Hemd und Cowboystiefel, und als ich mich durch die Meute zum Eingang dränge, werde ich gleich zur Einstimmung durch deutliche Berührungen sexuell belästigt.
Was nur meinen Puls in die Höhe treibt und ein gewisses Ziehen im Unterleib auslöst. Doch ich fühle mich nicht wie Freiwild oder »Frischfleisch«, die Jungs wissen nicht, dass ich nicht die Beute, sondern die Jägerin bin. Der Gedanke lässt mich schmunzeln, als ich an der Kasse meinen Obolus entrichte und gleich zweimal darauf hingewiesen werde, dass Waffen hier abzugeben sind.
Als Antwort weise ich nur auf meinen Körper, so eng, wie meine Kleidung anliegt, würde ich gerne wissen, wie ich da Waffen verstecken soll. Der Türsteher genießt es offensichtlich, mich abzutasten, aber er macht seine Sache dennoch gut, schaut auch in die Schäfte meiner Cowboystiefel.
»Okay, Mädchen«, meint er dann und deutet auf das rote Band an seinem linken Oberarm. »Wenn es dir zu viel wird, jemand vielleicht zu aufdringlich wird, wende dich an jemanden, der ein solches Band trägt. Er löst dann das Problem.«
Mädchen? Ich sollte vielleicht beleidigt sein, aber ich bin es nicht. Gott, wie lange ist es her, dass mich jemand Mädchen genannt hat?
Obwohl es noch so früh ist, ist der Laden bereits gut besucht, und bis ich an der Theke ankomme, werde ich bereits dreimal eingeladen. Ich lächle den blonden Hünen an, der mir besser gefällt als die beiden anderen, und bestelle mir einen Tequila, was mit einem hoffnungsvollen Nicken des Hünen begrüßt wird.
»Salz und Zitrone?«, fragt der Barkeeper, aber ich schüttle den Kopf.
»Du kannst dich nicht mehr betrinken«, teilt mir Diana mit. »Wenigstens nicht mehr so einfach.«
Ich stocke kurz, mit meinem Glas auf dem Weg zu meinem Mund, zucke dann mit den Schultern und kippe den Tequila mit einem Zug hinunter, genieße das Brennen in meiner Kehle.
In meiner Jugend habe ich das nicht so eng gesehen, und oft genug bin ich hier betrunken herausgetaumelt, meistens hat sich auch jemand um mich gekümmert … irgendwie war das ja das Ziel gewesen.
Als ich zur Army ging, war das vorbei. Nicht, dass dort nicht auch getrunken wird, aber als Pilotin ist es eine dumme Idee, betrunken zum Dienst zu erscheinen. Es lag nicht alleine nur daran, dass man in den letzten vierundzwanzig Stunden nichts trinken darf und das auch überprüft und durchgesetzt wurde, irgendwie hatte ich auch nicht mehr das Bedürfnis.
Das hat sich bis heute nicht geändert, doch Dianas Information bedeutet auch, dass ich nicht mehr darauf achten muss. Also bestelle ich mir meinen nächsten Tequila, den ich natürlich auch nicht bezahlen muss, lehne mich mit dem Rücken an den Tresen und betrachte das bunte Treiben auf der Tanzfläche. Ich habe von der Gruppe, die heute hier spielt, noch nie etwas gehört, doch sie spielen Country-Rock, drei der fünf sind Frauen, die sich passend heiß und knapp gekleidet haben, und sie machen auf jeden Fall Stimmung.
Der blonde Hüne sammelt seinen Mut und klemmt sich neben mich, schaut mich hoffnungsvoll an.
Ich schüttle leicht den Kopf. »Vielleicht später«, teile ich ihm über die Musik hinweg mit. »Ich bin gerade angekommen und will mir Zeit lassen!«
Es gibt Punkte für ihn, als er nickt, mit der Schulter zuckt und sich wieder zurückzieht. Diana hat schon recht. Ich bin nicht nur wegen dem einen hier, ich will auch für einen Moment vergessen, was jetzt alles auf mir lastet.
Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas von dem, was ich in den letzten Tagen erfahren habe, auch nur im Ansatz verarbeitet habe. Im Moment weigere ich mich, weiter darüber nachzudenken, versuche, so zu tun, als wäre es völlig normal, Magie oder etwas, das sich verdammt danach anfühlt, wirken zu können, bis an die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit optimiert und, wie ich ja eben erfahren habe, wahrscheinlich auch unsterblich zu sein.
Irgendwie ist es beruhigend zu wissen, dass sowohl die (wahrscheinliche) Unsterblichkeit als auch die Magie von der neuronalen Brücke abhängen, wenn ich das nicht mehr will, brauche ich sie nur abzuschalten.
Wenigstens darin habe ich die Wahl.
Und ich habe keinen Grund, mich über meine neue körperliche Leistungsfähigkeit zu beschweren. Ohne das hätte ich noch Monate an Rehabilitierungsmaßnahmen vor mir gehabt, und tatsächlich habe ich meine Zweifel daran, dass ich so ohne Weiteres meinen vorherigen Fitnessgrad wieder hätte erreichen können.
Dass ich jetzt so fit bin, hat wenigstens den Vorteil, dass ich, ohne zu ermüden, auf der Tanzfläche bleiben kann.
Alleine dass ich wieder tanzen kann, macht mich schon glücklich, und es fällt mir nicht schwer, mich in die Musik fallen und von ihr treiben zu lassen.
Irgendwann habe ich dann aber genug und halte Ausschau nach dem blonden Hünen, denke mir, dass heute sein Glückstag sein wird, um dann festzustellen, dass dem tatsächlich bereits so ist, ich finde ihn hinten in einer der Nischen, wo er Zungenhockey mit einer Blonden spielt, deren Oberweite kaum noch von dem einen Knopf ihrer Bluse gebändigt wird.
Okay.
Ist ja nicht so, als ob es nicht noch andere dankbare Opfer gäbe.
Mein nächstes Opfer steht neben der Tanzfläche an der Wand und hält sich an seinem Bier fest, Anfang zwanzig, schwarzhaarig, glatt rasiert, schlank und eher drahtig, netter strammer Hintern, genau das, was Frau Doktor verschrieben hat.
Ich komme lächelnd und mit wiegenden Hüften auf ihn zu, seine Augen weiten sich, als er feststellt, dass ich tatsächlich ihn, ja, genau ihn meine, schmiege mich an ihn und flüstere ihm die Frage ins Ohr, ob er Lust auf eine Runde unverbindlichen Spaß hat. Er wird rot, guckt wie ein Reh im Scheinwerferlicht und stottert, dass er eine Freundin hat.
Punkte für ihn und gut für seine Freundin.
Okay, ich habe so etwas seit Jahren nicht mehr gemacht, und auch heute werte ich als eine Ausnahme, aber das ändert nichts daran, dass ich einen Korb bekommen habe.
Und das ist etwas, das mir schon sehr lange nicht mehr passiert ist, ich versuche, mich daran zu erinnern, ob es nicht vielleicht sogar das erste Mal ist.
Ich habe noch nie so gut ausgesehen wie jetzt und bekomme einen Korb?
Während ich das noch verarbeite, kommt von hinten eine Hand in mein Sichtfeld, die mir ein Glas Tequila hinhält.
Ohne Salz.
Jemand, der aufgepasst hat.
Als ich mich umdrehe, sehe ich einen blonden Mittvierziger vor mir stehen. Er ist groß, breit, mit schlanken Hüften, und sein Lächeln ist sowohl amüsiert als auch aufmunternd. Er ist ganz offensichtlich jemand, den es mehr zufällig hierher verschlagen hat, denn er trägt schwarze polierte Halbschuhe, Anzughose und weißes Anzughemd, bei Letzterem hat er die Ärmel hochgekrempelt und die oberen vier Knöpfe geöffnet.
Er hebt seinen eigenen Tequila hoch, und wir stoßen an. »Du wirst die Hälfte der Jungs hier in die Flucht schlagen, wenn du sie so direkt fragst«, grinst er.
»Dich nicht?«, frage ich ihn mit einem Lächeln.
»Ich bin nicht blöde«, lacht er. »Abgesehen davon, bin ich Single, gesund und auf der Durchreise. Ich habe nur eine Bedingung.«
Er hat eine?
»Die wäre?«
»Keine Rückbank oder die Ladefläche eines Pick-ups. Ich habe im nächsten Ort, keine zehn Minuten vor hier, ein perfekt brauchbares Hotelzimmer mit einem guten Bett, auf dem ich dich weitaus mehr würdigen kann als auf einer Rückbank.«
»Würdigen?«, frage ich ihn mit einem Lächeln.
Er schaut mich demonstrativ von unten bis oben an. »Du bist eine Göttin«, teilt er mir in einem Tonfall mit, bei dem ich nicht weiß, wie ernst er es meint. »Eine fleischgewordene Versuchung. Es wäre eine Schande, geradezu eine Blasphemie, dich nicht entsprechend zu verehren.«
Ich lehne mich etwas mehr in seine Richtung. »Und wenn ich gar nicht angebetet werden will? Wenn ich es vielleicht doch etwas anders will?«
Ein Grollen kommt von ihm, fast schon ein Knurren, dann greift er mir ins Haar, zieht mich an sich und ergreift Besitz von meinem Mund.
Und von mir.
»Das«, sagt er schwer atmend zwei Ewigkeiten später, »lässt sich einrichten.«
Als er Betsy sieht, pfeift er leise durch die Zähne.
»Das ist Betsy«, teile ich ihm stolz mit.
»Sie ist ein Klassiker«, stellt er bewundernd fest und schaut sich skeptisch auf dem Parkplatz um. »Ich würde sie nicht hier so stehen lassen. Ich schlage vor, du fährst hinter mir her, mein Hotel hat eine gesicherte Tiefgarage.«
Ich brauche nicht zu raten, welcher von den Wagen, die hier auf dem Parkplatz stehen, ihm gehört. Zwischen den Pick-ups, Jeeps und japanischen Kleinwagen fällt der weiße Bentley auf wie eine Nonne in einem Hurenhaus.
Er besteht darauf, dass ich Betsy auf seinen Parkplatz stelle. »Der Bentley ist ein Geschäftswagen: wenn er gestohlen wird, kaufe ich einen neuen. Deine Betsy findet man nicht mehr an jeder Ecke. Vor allem nicht in diesem Zustand.«
Obwohl wir bereits im Aufzug übereinander herfallen und er schwer atmet, als er seine Schlüsselkarte an die Tür hält, haben wir es jetzt irgendwie nicht mehr eilig. Er hat eine kleine Suite gemietet, mit einer eigenen kleinen Bar, Küche, Wohn- und Schlafzimmer.
»Was darf es sein?«, fragt er mich. »Ich habe …« Er öffnet den Kühlschrank und schaut nach. »Wein, Whiskey, verschiedene Säfte und Cola.«
»Was trinkst du?«
»Einen Kaffee.« Er grinst mich an. »Ich will wach sein, um das zu genießen.«
Wir trinken Kaffee. Und reden. Über Autos, die Welt, Countrymusic, alles, was uns einfällt. Er ist etwas älter, als ich ihn geschätzt habe, und hat seine zwanzig Jahre bei der Navy hinter sich gebracht, wo er als Pilot Einsätze in Mexiko, Kolumbien und im Zweiten Irankrieg geflogen ist. Wobei er, wie er sagt, ein paar Ideen aufgeschnappt hat, die er danach mit seiner Firma umsetzen konnte.
»Meine Firma baut Navigationssysteme für den Weltraum«, erklärt er mir mit sichtlichem Stolz. »Ich habe alles, was ich hatte, in meine Firma gesteckt und eine Menge Glück gehabt. Und jetzt sind wir bei der letzten Grenze der Menschheit auf vorderster Front dabei.«
Und als wir nebeneinander im Bett liegen und immer noch reden, während er langsam den Knoten in meinem Hemd aufzieht, frage ich mich, wann ich mich das letzte Mal mit einem Mann so wohlgefühlt habe.
Er hält seine Versprechen. Er betet mich an und zeigt mir dann, dass es auch anders geht. Er reitet mich, bis ich nicht mehr weiß, was oben und unten ist und klatschnass und zitternd in seinen Armen liege und hoffe, dass der Moment nie zu Ende geht.
Es scheint ihm nicht viel anders zu gehen, auch er zögert das Unvermeidliche hinaus. Wir kommen nicht voneinander los. Nicht im Bett, nicht in der Küche, nicht in der Dusche.
Er bringt mich zum Schreien und, was viel wichtiger ist, zum Lachen. Er fordert mich heraus, und selbst wenn er mich besiegt, gewinne ich.
Ich will auch nicht, dass der Moment vorbeigeht.
Und doch ist es irgendwann so weit.
»Ich habe einen Termin«, teilt er mir beim Frühstück frustriert mit. »Also muss ich bald los. Jeden anderen Termin würde ich fahren lassen, aber von diesem hängt fast alles für mich ab.«
Ich nicke nur. »Mir geht es nicht viel anders.«
»Was hast du dem Typen vorhin eigentlich genau gesagt?«
»Ich dachte, du hast es gehört?«
»Nein. Die Musik war zu laut. Ich habe nur an seinem Gesicht gesehen, wie sehr du ihn erschreckt hast. Den Rest habe ich mir zusammengereimt.«
»Ich habe ihn gefragt, ob er ein unverbindliches Abenteuer will.«
»Unverbindlich, huh?«
Ich nicke.
»Gilt das noch immer?«, fragt er vorsichtig. »Du bist anders, als ich dachte, viel erwachsener, als ich mir bei jemandem in deinem Alter vorstellen konnte.« Er ist nur acht Jahre älter als ich, doch er hält mich noch immer für Anfang zwanzig. »Ich gebe es ehrlich zu, ich will dich wiedersehen. Es geschieht nicht so oft, dass ich jemanden finde, mit dem ich mich so gut verstehe.«
Er sieht meinen Gesichtsausdruck und stöhnt leise auf. »Oh, fuck«, flucht er dann. »Mein verdammtes Glück schlägt wieder zu!«
Ich lege ihm die Hände auf die Wangen, schaue ihm direkt in die Augen und gebe ihm einen Kuss. »Ganz ehrlich«, flüstere ich. »Wenn ich könnte, wäre mir nichts lieber. Mir geht es genauso.«
»Aber du kannst nicht?«
Ich schüttle den Kopf. »Heute ist eine außergewöhnliche Gelegenheit gewesen. Sie wird so schnell nicht wiederkommen.«
Er nickt und spielt mit seiner Kaffeetasse herum. Hat irgendetwas auf dem Herzen. »Ich muss dir etwas gestehen, du bist mir direkt aufgefallen, als du in das Honky Tonk gekommen bist.«
»Und das ist schlimm?«, frage ich ihn lächelnd.
Er schüttelt den Kopf. »Ich würde nichts anders machen. Ich werde diese Nacht so schnell nicht vergessen. Vielleicht nie. Aber du bist mir aufgefallen, weil du mich unheimlich an jemanden erinnert hast.«
»Und an wen?«, frage ich ihn.
»Sag mal«, sagt er langsam. »Spielst du eigentlich Vorena Online?«
Mein Puls fängt an zu rasen. Einen langen Moment überlege ich, ob ich es abstreiten soll. Dann entscheide ich mich dagegen.
»Ja.«
Seine Augen weiten sich. »Du bist die Herzogin! Warte …«, sagt er hastig, als er meine Reaktion sieht, die nicht besonders vorteilhaft ist. »Lass mich dir erst ein paar Dinge sagen, ja?«
Ich nicke zögernd.
»Als ich dich das erste Mal im Spiel gesehen habe«, fährt er leise fort, »habe ich mich Hals über Kopf in dich verliebt. Schlagartig. Wie vom Blitz getroffen. Was nicht das Geringste damit zu tun hat, welche Rolle du im Spiel spielst. Und zugleich habe ich mich über mich selbst zu Tode geärgert. Weil ich wusste, dass niemand im realen Leben so aussieht wie im Spiel. Ich selbst ja auch nicht, meine Spielfigur ist idealisiert und jünger. Wie die meisten anderen. Außerdem … außerdem gehöre ich nicht zu denen, die sich in eine Optik verlieben. Ich bilde mir ein, dass es andere, wichtigere Dinge gibt, dass der Mensch passen muss. Nicht, wie sie aussieht. Obwohl das nicht unwichtig ist. Ich war sauer auf mich, weil ich mich von deinem Aussehen angezogen gefühlt habe, obwohl ich genau wusste, dass niemand so aussieht. Niemand so aussehen kann wie du. Dann habe ich versucht, sie … dich kennenzulernen. Herauszufinden, wie du wirklich bist. Und … dann kam jede Menge Mist dazwischen, und ich habe es versaut. Und bin wahrscheinlich dafür mitverantwortlich, dass dein Charakter jetzt in der Scheiße sitzt. Ich will mich dafür entschuldigen. Es war eine Zwangslage, aber das macht es nicht besser. Es tut mir wirklich leid.«
Im Spiel gibt es nicht so viele, die wissen, was mit meinem Charakter geschehen ist. Eigentlich nur eine Handvoll Spieler, die dabei waren, als Maguela mich verflucht und in dieses Tor gestoßen hat.
Und jetzt weiß ich auch, an wen er mich erinnert hat. Von seinen Gesten und Blicken her.
»Rick.«
Er nickt betreten.
Und hinter ihm steht Diana, grinst mich an und hat beide Hände mit dem Daumen nach oben in die Luft gereckt. Dankbarerweise habe ich sie nicht mehr gesehen, nachdem Rick und ich das Tonk verlassen haben. »Ich habe dir doch gesagt, dass du deine Liebe findest, wenn du in das Astra gehst!«
»Ist Liebe nicht zu hoch gegriffen?«, frage ich sie, halb verärgert und halb amüsiert. Rick blinzelt und bezieht es wohl auf sich.
»Nein«, sagt Diana überraschend ernst. »Du weißt, dass ich alle Spieler kenne. In- und auswendig. Es gibt nur eine Handvoll, die so gut mit dir zusammenpassen, aber er ist derjenige, zu dem du am besten passt.«
»Vielleicht ist es das«, sagt jetzt Rick, der ja nicht weiß, dass ich mit Diana gesprochen habe. Was ich auch in Gedanken hätte tun können – hätte ich daran gedacht. »Aber es fühlt sich verdammt noch mal so an. Ich habe auch nicht an die Liebe auf den ersten Blick geglaubt.« Er macht eine hilflose Geste. »Was soll ich sagen? Es ist mir passiert. Und ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, dass es nicht sein kann, weil die Frau, in die ich mich verliebt habe, nicht real ist.« Er schaut mich offen und direkt an. »Nur um jetzt festzustellen, dass sie es ist.«
»Und wie viele Männer kennst du, die so offen sein können?«, schwenkt Diana für Rick die Fahne.
Es ist nicht nötig. Ich bin fast vierzig und nicht mehr so dumm wie früher. Manche Sachen habe ich schon lernen können. Ansatzweise.
»Gib mir einen Moment«, sage ich leise, und jetzt bin ich es, die mit ihrer Kaffeetasse spielt, während ich die Puzzlesteine zusammensetze. Navigationssystem für den Weltraum.
»Dein Termin ist mit VRI?«