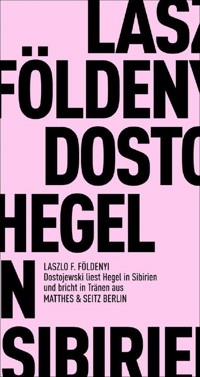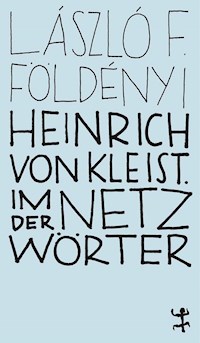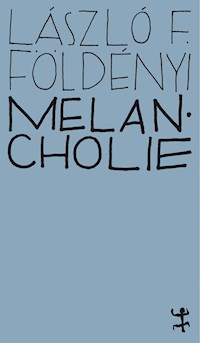Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schon vor der Französischen Revolution gab es gelegentliche Hinrichtungen durch das Fallbeil, aber erst ab 1791 kommt der Tod auf dem Schafott flächendeckend und für alle zum Einsatz. Bis dahin entschieden der gesellschaftliche Stand und die Art des Verbrechens über die Wahl der Hinrichtungsmethode. Nun hält die Industrialisierung des Tötens Einzug. Denn vor der Guillotine werden alle gleich. Und während die Zeitgenossen angesichts all der abgeschlagenen Köpfe noch rätseln, ob das Bewusstsein der Geköpften vom Körper getrennt noch weiterleben kann, entwirft László F. Földényi in seinem bildreichen Essay seine ganz eigene Erzählung des langen 19. Jahrhunderts – ausgehend von unserem Eintritt in die Kopflosigkeit. Zur gleichen Zeit hält auch die neue Technik der Fotografie Einzug. Erst ihre flächendeckende Verbreitung ermöglicht es, den Moment aus der Vergänglichkeit des Lebens zu lösen, ihn gleichermaßen zu verewigen wie zu töten. Das führt nicht nur zu einem neuen Verständnis von Zeit und Raum, sondern zu einer Veränderung der Wahrnehmung selbst. Als würde der Schnitt des Fallbeils sich ab da unendlich fortsetzen, wirkt fortan alles fragmentiert: die Körper, die Stadt, die Dichtung und die Malerei. Ein ganz und gar neues Bild des Menschen entsteht, das ihn als ein bizarres, ein gewaltlüsternes, ein kopfloses Wesen zeichnet und das bis in unsere Gegenwart fortwirkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der lange Schatten der Guillotine
László F. Földényi
Der lange Schatten der Guillotine
Lebensbilder aus dem Paris des neunzehnten Jahrhunderts
Aus dem Ungarischen von Akos Doma
Le député Guillotin
Dans la médecine
Très expert et très malin
Fit une machine
Pour purger le corps français
De tous les gens à projets
C’est la guillotine, ô gué
C’est la guillotine
Pour punir la trahison
La haute rapine
Ces amateurs de blasons
Ces gens qu’on devine
Voilà pour qui l’on a fait
Ce dont on connaît l’effet
C’est la guillotine, ô gué
C’est la guillotine
A force de comploter
La horde mutine
A gagné sans y penser
Migraine maline
Pour guérir ces messieurs-là
Un jour on les mènera
A la guillotine, ô gué
A la guillotine
De la France on a chassé
La noble vermine
On a tout rasé, cassé
Et mis en ruine
Mais de noble on a gardé
De mourir le cou tranché
Par la guillotine, ô gué
Par la guillotine
Messieurs les nobles mutins
Dont chacun s’échine
Soufflant par des efforts vains
La guerre intestine
Si nous vous prenons vraiment
Vous mourrez très noblement
A la guillotine, ô gué
A la guillotine
Le dix nous a procuré
Besogne de reste
Les traîtres ont abondé
C’est pis qu’une peste
Comme on n’en veut pas manquer
On punit sans déplanter
La machine reste, ô gué
La machine reste
La guillotine permanente – Die beständige Guillotine
Ein Lied aus der Zeit der Französischen Revolution
Dieses Buch schrieb sich von selbst. Es ist nicht das Ergebnis langer Planung, es gab keine mühsame Vorbereitung, ich verlebte keine unruhigen Tage davor. Eine Zeichnung, die ich in einem Album erblickt hatte – damit fing alles an. Eine Jugendzeichnung des französischen Malers Ingres, die in ewige Vergessenheit geraten wäre, wären nicht später die berühmten Gemälde hinzugekommen und Ingres zu dem geworden, was er ist. Der sich im Hintergrund bleich abzeichnende Luftballon und der unweit davon sichtbare Fallschirm hatten meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und gleich darauf das Fernrohr, das das Mädchen in der Zeichnung in der Hand hält. Wer war sie, wo saß sie, wie war sie dorthin gekommen? Und überhaupt: Was war das Ganze? Ich musste nicht lange recherchieren, schon fand ich mich inmitten einer Geschichte wieder, deren Stränge aus der ruhigen und friedlichen Schweiz in das revolutionäre Paris führten. Von da an gab es kein Halten mehr. Worauf kann sich ein Theaterglas alles richten? Auf einen Luftballon, einen Fallschirmsprung. Und darüber hinaus auf alles, was sich in einem Theater, einer Oper abspielt. 1797, als Ingres diese Zeichnung schuf, war auch Paris selbst ein riesiges Theater, dessen Bühne und dessen Zuschauerraum nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren. Ungefähr so, wie es sich nicht lange zuvor Rousseau gewünscht hatte: Wahres Theater sei schließlich, wenn das Volk sich selbst feierte. Auch das Mädchen in der Zeichnung sitzt inmitten eines Festes, auch wenn es sich dabei um eines der blutigsten Feste der Geschichte handelt. Immer lauter hört man beim Betrachten der Zeichnung von fern das Beil der Guillotine niedersausen. Dieser Klang erfüllte zu jener Zeit ganz Paris, er läutete ein neues Zeitalter ein.
Als ich das vernahm, führte mich das Mädchen in der Ingres-Zeichnung weiter zur Guillotine, und die an den Haaren hoch gehaltenen Köpfe zu einer neuen Vorstellung des Menschen, die ihrerseits auf eine Neugestaltung der Lebensumstände hin drängte, die jedoch mit der Zerstörung der Stadt einherging, was wiederum an die Hinrichtungen durch die Guillotine erinnerte. Und das alles trug zur Beschleunigung des Alltags bei, wobei die Eindrücke immer fragmentarischer und zufälliger wurden – die Aufnahme der Welt ringsum zersplitterte … und so weiter. Ich schritt von einem Kapitel zum nächsten voran und verstrickte mich in jedes von ihnen, ohne anfangs überhaupt absehen zu können, wohin es mich führen würde. Aber eines wusste ich bereits nach der Niederschrift der ersten paar Seiten: Die Enthauptung durch die Guillotine hing irgendwie mit der Art und Weise zusammen, wie man später versuchen würde, die Gehirne der Menschen zu formen, zu beeinflussen, zu waschen – oder auch herauszuschneiden. In seinem Gedicht »Das Lied der Enthirnung«, schon lange ein Favorit von mir, hatte das Alfred Jarry fast auf den Tag genau hundert Jahre nach Ingres’ Zeichnung prophezeit. Möge dieses Gedicht das Ende stiften.
Das Buch schreitet also nicht nach strenger Logik, sondern nach Assoziationen und Analogien voran, von der Enthauptung bis zur Gehirnwäsche. Wären die Genrebezeichnungen nicht schon so besetzt, neigte ich dazu, von einem Roman zu sprechen. Denn als ich eines der Kapitel (Die Inkohärenten) im Voraus veröffentlichte, waren manche Leser ungläubig und meinten, ich hätte mir das Ganze nur ausgedacht. Bewusst willkürlich stehen hier Seite an Seite Henkersgeschichten und Bildbeschreibungen, ärztliche Berichte und mit der Lupe untersuchte Fotografien, Gedichte und Zeitungsannoncen, Stadtpläne und fantastische Monster, Straßenreklamen und Romanfiguren. Alles da, in Paris. Und alles hängt hier nicht nur mit allem zusammen, alles ist auch der Widerhall von allem. Wie Baudelaire, einer der Protagonisten des Buches, in seinem Gedicht »Entsprechungen« (Correspondances) schreibt: »Wie lange Echos von ferne verschwimmen / Zu dunkler und tiefer Einheit«.
»Das Lied der Enthirnung« ist ein notgedrungener Schluss. Die unendliche Ausdehnung der Dinge reißt nicht ab. Weder räumlich noch zeitlich. Die Auswirkungen der Ereignisse im Paris des neunzehnten Jahrhunderts sind über Millionen von Haaradern auch später noch zu spüren, suchen uns in Geistergestalt auch heute noch heim. Die Enthauptungen von einst wichen dem Herausschneiden der Gehirne. Die Enthirnung hat nie aufgehört. Auch in unseren Tagen setzt sie sich fort, ungebremst. Der Schatten der Maschine wächst.
Inhalt
I.
Ein unerwidertes Gefühl
Restifs einsamer Mörder
Körper und Seele
Zähneknirschen
Das Fernrohr
Die Guillotine
Die denkende Maschine
Leben nach der Enthauptung
Der Schatten der Guillotine
Der Nullpunkt des Daseins
Die moderne Schönheit
Kopflos
II.
Das Doyenné-Viertel
Der Place du Carrousel
Die umgestülpte Stadt
»discors concordia«
Demokratische Anblicke
Momentaufnahmen
Intelligente Fotografien
Das Licht sehen
Das Sichtbare und das Unsichtbare
Wieder im Doyenné-Viertel
Reklamen und Annoncen
Das Kaleidoskop
Die Weltausstellung
III.
Hamlet
Marville
Place Saint-André-des-Arts
Samenkorn und Trümmerstück
Ruinen
Schlammmeer
Das Bizarre und der Fortschritt
Regenschirm und Nähmaschine
Das Surreale
Improvisation
Vaporisation
Die Lust
IV.
Acéphale
Kopflose Disjektums
Die Inkohärenten
Jarry und Grabbe
Monster
Ubu, das Monster
Action gratuite
Die Pataphysik
Der Künstler-Henker
Die im Portemonnaie eingeschlossene Seele
Die Gleichung des Fortschritts
Die verliebte Maschine
Die Enthirnung
Nachweise
Literatur
I.
Ist es nicht merkwürdig, daß in diesen letzten Sekunden so selten ein Verurteilter in Ohnmacht fällt? Im Gegenteil, das Gehirn lebt unheimlich intensiv, arbeitet rastlos, unermüdlich und stark, stark, stark, wie eine Maschine in vollem Gang; ich bilde mir ein, sie stampfen nur so durchs Gehirn, diese verschiedenen Gedanken, die man alle nicht zu Ende denkt, und vielleicht sind es sogar sehr lächerliche, so nebensächliche Gedanken … Und sich vorzustellen, daß sich das so bis zur allerletzten Viertelsekunde fortsetzt, wenn der Kopf schon auf dem Block ruht und wartet und … weiß, und plötzlich hört, wie über ihm das Fallbeil ins Gleiten kommt! Das hört man noch bestimmt! Ich würde, wenn ich so daläge, absichtlich hinhorchen und es noch vernehmen! Hier handelt es sich vielleicht nur um den zehntel Teil eines Augenblicks, aber man hört es unbedingt! Und denken Sie sich, bis jetzt noch streitet man darüber, ob nicht der Kopf, wenn er schon abgeschlagen ist, möglicherweise noch eine Sekunde lang weiß, daß er jetzt abgeschlagen ist und herunterfliegt – können Sie sich das vorstellen? Und wenn er es nun ganze fünf Sekunden lang weiß?
Dostojewski, Der Idiot (dt. v. E. K. Rahsin)
Jean-Auguste-Dominique Ingres:
Barbara Bansi
, 1797.
Ein unerwidertes Gefühl
Wir befinden uns in Paris, schreiben das Jahr 1797. Es ist Ende Oktober. Das Mädchen ist neunzehn Jahre alt, der Junge siebzehn. Sie unterhalten sich auf Französisch, obwohl die Muttersprache des Mädchens Schweizerdeutsch ist. Schon seit elf Jahren lebt sie mit ihren Züricher Pflegeeltern in Paris und lernt Malerei. Ihre Bilder hat sie noch nicht ausgestellt. 1797 fühlt sie sich bereit, ihr Talent auf die Probe zu stellen, doch entfällt der Salon in jenem Jahr. Erst im Jahr darauf, 1798, kann sie sich im Salon de Musée als Malerin vorstellen. Eines ihrer Gemälde befindet sich unter den 508 ausgestellten Werken.
Von so etwas kann der Junge im Herbst 1797 nur träumen – er wird noch fünf Jahre warten müssen. Doch schon jetzt steht ihm eine verheißungsvolle Laufbahn bevor: Er darf im Atelier des angesehensten französischen Malers Jacques-Louis David lernen. Erst drei Monate zuvor war er nach Paris gekommen, noch ist er dabei, die Stadt kennenzulernen. Und Kontakte zu Menschen zu knüpfen. So trifft er im Kreise der jungen Maler das Mädchen, das bei Joseph-Benoît Suvée gelernt hat und Davids Malerei überhaupt nicht mag. Noch ahnen beide nicht, dass einmal eine Zeit kommen wird, da sich des Mädchens niemand mehr erinnern, der Junge hingegen ins Pantheon der Unsterblichen aufgestiegen sein wird.
Barbara Bansi und Jean-Auguste-Dominique Ingres kennen sich erst seit wenigen Wochen, doch schon ist sie bereit, ihm Modell zu sitzen, und er fertigt eine großformatige Kreidezeichnung von ihr an.
Bansi hat ein offenes Gesicht, doch wohnt ihrem sanftmütigen Blick etwas Täuschendes inne; andere bringt sie gewiss leicht zum Sprechen, von sich gibt sie kaum etwas preis. Sie kann gut zuhören. Was in ihr selbst vorgeht, verrät sie aber nicht. Ihr bisheriges Leben hat sie gelehrt, wie sie das Vertrauen anderer gewinnen kann. 1783, als sie sechs Jahre alt war, hatte ihr Vater Heinrich Bansi, ein Prädikant, in St. Moritz den wohlhabenden, kinderlos gebliebenen Züricher Kaufmann Johann Caspar Schweizer kennengelernt. In der Hoffnung, dass seine Tochter in guten Verhältnissen aufwachsen möge, vertraute Bansi sie der Vormundschaft des Kaufmanns an. Schweizer und seine Frau erfreuten sich allgemeiner Bekanntheit; in ihrem Haus verkehrten auch Lavater, Goethe, Pestalozzi. Von der neuen Pflegemutter schuf Johann Heinrich Füssli mehrere Zeichnungen und auf Bitten Goethes sogar ein Gemälde. 1786 zogen die Schweizers mit dem Mädchen nach Paris um, wo sie weiterhin ein offenes Haus führten. Schweizer betätigte sich als Händler und Bankier, er war ein Freund Mirabeaus. Seine Geschäfte liefen jedoch immer schlechter, sodass er Ende 1794 im Auftrag des französischen Wohlfahrtsausschusses in die Vereinigten Staaten umzog, wo er wegen diverser Spekulationen zwischenzeitlich sogar unter Arrest stand. Als Barbaras Vater davon erfuhr, dass Schweizer nach Amerika abgereist war, wollte er seine Tochter wieder zu sich in die Schweiz holen, sie weigerte sich jedoch, mit ihm zu gehen.
Die Familie Schweizer hatte Barbara von Anfang an eine liberale Erziehung zukommen lassen, und sie genoss es, ihre eigene Herrin zu sein und keinem gehorchen zu müssen. Laut den Erinnerungen ihres etwas älteren Cousins David Hess hatte sich Barbara oder Babette, wie sie in der Familie genannt wurde, schon in frühen Jahren als unzuverlässig und als notorische Lügnerin erwiesen, angesichts der wachsenden materiellen Sorgen ihrer Pflegeeltern kühlte sich ihr Verhältnis zu ihnen immer mehr ab, und sie knüpfte bald Verbindungen zu Männern. Seit November 1794 führte die siebzehnjährige Barbara eine eigenständige Existenz und stürzte sich ins Pariser Leben. Konsequent verfolgte sie ihre Karriere als Malerin. Sie wurde die Geliebte ihres Lehrers Joseph-Benoît Suvée, eines in Paris lebenden flämischen Malers, der übrigens ein Rivale Davids war, der wiederum der Lehrer von Ingres war. Später wurde sie kurzzeitig auch die Geliebte von François Gérard, eines bereits namhaften Malers, der im Louvre ein Atelier besaß. Um diese Zeit lernte sie den zwei Jahre jüngeren Ingres kennen. Dass dieser sich nicht Hals über Kopf in das sowohl menschlich als auch fachlich erfahrenere Mädchen verliebt hätte, ist ausgeschlossen.
Schon Barbaras Kleidung wirkt aufreizend auf ihn. Während er zeichnet, tastet er mit der schwarzen Kreide ihren Körper durch das Kleid förmlich ab. Der weiße Musselin knittert und fällt derart sinnlich, dass man glaubt, ihn berühren zu können; der Seidenschal und damit auch die Träger ihres Kleides sind dabei, ihr von den Schultern zu rutschen; unter dem Saum ihres Kleides kommt ihr Schuh aufreizend zum Vorschein, obwohl die damalige Etikette verlangt, dass er verdeckt bleibe. Als folgte sie dem Rat, den Balzac vierzig Jahre später gab: »Was nutzten ihr die nagelneuen grauen Seidenstrümpfe, die Schnürschuhe aus Satin, wo sie doch nicht das Geringste von der Kunst verstand, im entscheidenden Moment einen hübschen Fuß vorzustrecken, um ihn unter einem halb hochgezogenen Kleid hervorlugen zu lassen und dem Begehren neue Aussichten zu eröffnen!«
Sogar die Marmorbank, auf der sie sitzt, ist derart sinnlich gezeichnet, dass man meinen könnte, Ingres wollte für die Zeit der Zeichnung eins mit ihr werden. Er beneidet den kalten Marmor darum, dass Barbara darauf sitzt. Im Vergleich dazu wirkt der Körper, der in diese erotische Kleidung gehüllt ist, relativ plump: der Unterarm und die Hand sind fast unförmig, und gewiss war auch der Hals im wirklichen Leben zierlicher. Und würden die Träger ihres Kleides ganz hinabrutschen, ließe vielleicht auch die Form ihrer Brüste zu wünschen übrig.
Es ist Oktober 1797, genau genommen: der 22. Oktober. Hinter der Frau sieht man einen Fallschirm in der Luft, rechts darüber einen davonfliegenden Heißluftballon. Wegen dieses Ballons hatte man Ingres’ Modell lange Zeit für die Frau oder die Tochter eines der beiden Luftschiffer gehalten, für Madame oder Mademoiselle Montgolfier also. Der verwaiste Heißluftballon hatte die Orientierung in dem Moment verloren, als sein Passagier André-Jacques Garnerin den ersten modernen Fallschirmsprung vollführt hatte.
André-Jacques Garnerin im Jahr 1797, Postkarte, 1895.
Jahrelang hatte sich der damals achtundzwanzigjährige Garnerin auf den Sprung vorbereitet. Der Offizier der französischen Armee und besessene Flieger hatte 1793 von einem Heißluftballon aus die Bewegungen der feindlichen Truppen beobachtet; sein Ballon wurde getroffen, aber er gelangte glücklich zur Erde zurück. Trotzdem geriet er in Gefangenschaft. Die Österreicher brachten ihn nach Buda, wo er zwei Jahre im Gefängnis einsaß, aus dem er mithilfe eines selbst gebastelten Fallschirms zu entkommen versuchte, was ihm allerdings nicht gelang. Nachdem er infolge eines Gefangenenaustauschs nach Paris zurückgekehrt war, vervollkommnete er seine Pläne und hob am späten Nachmittag des erwähnten Tages unter großer Anteilnahme des Pariser Publikums im Parc Monceau ab. Während er nach oben entschwebte, dürfte er das Gleiche erlebt haben wie bei einem Aufstieg in London fünf Jahre später: »Ich war gerade dabei, das Seil durchzuschneiden, das mich zwischen Himmel und Erde hängen ließ […], und ermaß mit den Augen den gewaltigen Raum, der mich von den übrigen Mitgliedern der menschlichen Rasse trennte«. Auch diesmal in Paris durchschnitt er, wie er später berichtete, um 17 Uhr 29 Minuten in tausend Metern Höhe das Seil, das die Gondel mit dem mit Wasserstoff gefüllten Ballon verband, und landete mit seinem aus Seide gefertigten, sieben Meter Durchmesser breiten Fallschirm anderthalb Kilometer vom Ort des Abflugs entfernt unversehrt – von einem verstauchten Fuß abgesehen – auf der Erde.
Ingres hielt also einen Augenblick am späten Nachmittag des 22. Oktober 1797 fest. Realitätsgetreu, fast fotografisch. Dennoch wirft der Anblick des Luftschiffs und des Fallschirms im Hintergrund Fragen auf: Warum beobachtet Barbara Bansi dieses denkwürdige Ereignis nicht? Warum kehrt sie ihm den Rücken, obwohl angeblich ganz Paris das Ereignis aufgeregt verfolgt? Der Sprung dauert nicht lang; vielleicht gerade so lang, wie Bansi nicht hinsieht. Oder ahnt sie womöglich gar nicht, was am Himmel hinter ihr vor sich geht? Das ist ausgeschlossen, schließlich hält sie ein Fernrohr in der Hand; sie wird es nicht zufällig mitgebracht haben. Es herrscht eine eigenartige Spannung. Als befände sie sich gar nicht im gleichen Raum wie die beiden blass gezeichneten Flugobjekte, das Luftschiff und der Fallschirm. Sie nimmt derart wenig Kenntnis von ihnen, dass ich bei längerem Hinsehen den Eindruck gewinne, Ingres hätte beide erst im Nachhinein hinzu gezeichnet.
Verdächtig ist auch die Kleidung des Mädchens. Die Mode der weißen Musselinkleider und des vorne gebundenen Schals, des unverhüllten Halses und der unverhüllten Arme kam erst 1798/99 auf, mehr als ein Jahr nach Garnerins Vorführung. Erst da wurde die als à la grecque bezeichnete Mode aktuell. Frauen, die sich so kleideten, sahen sich oft sogar dem Vorwurf des Exhibitionismus ausgesetzt. 1799 hieß es in einem Brief an das Pariser Journal des Dames et des Modes bezüglich Frauen, die sich à la grecque und à la romaine kleideten: »Die Frauen haben für sich die Kostüme von Psyche, Venus und der Nymphen gewählt. Sie ziehen mit ihrer bezaubernden Kluft unsere Blicke auf sich und fesseln sie. Die betörende Form ihrer Brüste, deren Bewegungen unsere Begierde wecken, werden vom leichten Stoff kaum verhüllt […] alles an dieser neuen Mode weckt die Wollust; und doch beklagen sich die Frauen, dass die Männer um sie herum kaum mehr den Anstand wahren«. 1800, drei Jahre nach Garnerins Fallschirmvorführung, malt David Madame Récamier, die ein auffällig ähnliches Kleid trägt wie Barbara Bansi. Die dreiundzwanzigjährige junge Dame, die als die schönste Frau von Paris gilt, ist die personifizierte Zurückhaltung. Und Unnahbarkeit. Sie ist die Gattin von Monsieur Récamier, eines Bankiers, und es ist allgemein bekannt, wie viele Männer hoffnungslos in sie verliebt sind – darunter Benjamin Constant, Lucien Bonaparte, Prinz August von Preußen oder Chateaubriand. Sie erweist sich allerdings als unzugänglich, obwohl sie es vermutlich genießt, die Leidenschaft der Männer aufzupeitschen. Auf Davids Gemälde sieht man eine junge Frau, die ganz und gar Herrin der Lage ist. Verführerisch wendet sie sich dem Betrachter zu (wie später Ingres’ große Odaliske, die das allerdings schon nackt tut), gebietet gleichzeitig aber auch Halt – ihr Kleid suggeriert jungfräuliche Reinheit. Ingres kannte dieses Gemälde gut, David hatte ihn mit dem Malen des Kandelabers beauftragt, und er fertigte noch im gleichen Jahr eine Grafit-Kreide-Kopie davon an.
Das alles weckt den Verdacht, dass das Bild, das die Szene vom 22. Oktober 1797 zeigt, nicht 1797, sondern erst ein, zwei Jahre später entstand. Es gibt auch noch ein weiteres verdächtiges Moment: den Hintergrund. Die Häuser, die hinter dem Geländer zu sehen sind, erinnern keineswegs an die Umgebung des Parc Monceau. Das ist vielmehr Italien, in Paris würde die Pinie nicht gedeihen, in Rom sehr wohl. Wie der Fallschirm erweckt auch dieser Hintergrund den Eindruck, als wäre er erst im Nachhinein auf die Zeichnung geraten.
Jacques-Louis David:
Madame Récamier
, 1800.
Wie mag es dazu gekommen sein?
Barbara Bansi zog 1802 nach Rom. Und Ingres gewann 1801 den Großen Preis der Pariser Akademie (Prix de Rome), der ein vierjähriges Stipendium in Rom bedeutete. Allerdings reiste er erst später, 1806, dorthin. Kurz nach seiner Ankunft vor Ort traf er Napoleons jüngeren Bruder Lucien Bonaparte, von dem er auch eine Zeichnung anfertigte. Da dieser wusste, dass Ingres bei der Entstehung des Gemäldes von Madame Récamier ständig vor Ort gewesen war und sie vermutlich auch gut kannte, erzählte er ihm wohl von seiner hoffnungslosen Liebe zu ihr, und dass er seinerzeit zurückgewiesen worden sei. Währenddessen begegneten sich Ingres und Barbara Bansi wieder – vielleicht sogar in Gesellschaft Lucien Bonapartes, da Barbara zu jener Zeit die Gesellschafterin Letizia Bonapartes war, der ebenfalls in Rom ansässigen Mutter von Lucien und Napoleon. Barbara lebte nach wie vor allein – sie sollte erst zwei Jahre später heiraten. Ingres kam in Rom als Bräutigam an: Noch in Paris hatte er sich mit Julie Forestier verlobt. Nachdem er sich in Rom eingerichtet hatte, löste er die Verlobung mit seiner Braut auf, die in Paris geblieben war. Die Zeichnung von Bansi hatte Ingres vermutlich nach Rom mitgenommen – zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch kein Hintergrund darauf, weder ein Luftballon noch ein Fallschirm. Jahrzehnte später, 1847, wird er sich erinnern, das Bild zwischen 1797 und 1806 in Paris angefertigt zu haben. Das belegt auch die Signatur: jngres. eleve de David – »Ingres. Schüler von David«. In Paris war er es noch gewesen, in Rom nicht mehr. Da er Barbara Bansi nun wieder begegnet, nimmt er die 1798/99 entstandene Zeichnung wieder zur Hand und beginnt erneut daran zu arbeiten. Er zeichnet den römischen Hintergrund. Und den Heißluftballon sowie den Fallschirm. Was eben auf ein konkretes Datum verweist, den 22. Oktober 1797. Für Ingres war das Datum wohl nicht wegen des Spektakels im Parc Monceau denkwürdig. Irgendetwas muss an jenem Tag zwischen dem neunzehnjährigen Mädchen und dem siebzehnjährigen Jungen passiert sein – vermutlich hatte sie seinen Annäherungsversuch an jenem Tag abgewiesen, wobei ihre Kleidung damals noch nicht so aufreizend gewesen sein mag, ihr Benehmen hingegen sehr wohl.
Jean-Auguste-Dominique Ingres:
Lucien Bonaparte
, um 1807.
So bekennt Ingres in Rom, unter Pinien, seine Gefühle von vor zehn Jahren. Und wäre es nach ihm gegangen, hätte er das Mädchen gewiss so gezeichnet, wie eines auf dem kurz darauf entstandenen Bild Die große Badende zu sehen sein wird – nackt, den Rücken dem Betrachter halb zugekehrt. Damit hatte Ingres das große Thema seines Lebens gefunden: die zurückhaltende und doch erregende, kokette und doch schamhafte, wollüstige und doch kühle nackte Frau. Das Mädchen indessen betrachtet den Maler, dem sie Modell sitzt, sanftmütig; ihr Gesicht zeigt Bedauern und Verständnis zugleich, suggeriert aber klar: bis hierher und nicht weiter. Oft kann auch ein nichtssagendes Lächeln allzu vielsagend sein.
Restifs einsamer Mörder
Ist es wirklich so passiert? Vielleicht ja, vielleicht nein. Verlassen wir jedenfalls Ingres und wenden wir uns Barbara Bansi zu.
Der Händler Johann Caspar Schweizer siedelte 1786 mit seiner Frau aus der Schweiz nach Paris um. Ihre damals neunjährige Pflegetochter Barbara Bansi nahmen sie mit. Schweizer wurde 1789 ein bedingungsloser Anhänger der Revolution, Mirabeau wurde einer seiner engsten Freunde, zu seinen guten Bekannten zählten aber auch der Schauspieler-Dichter Fabre d’Églantine, der Erfinder des französischen Revolutionskalenders, sowie Danton. Die Mutter führte auch in Paris einen großen Salon, in dem unter anderem La Fayette, der Abbé Sieyès, der Moralist Chamfort, der Naturwissenschaftler und Weltreisende Georg Forster sowie die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, Mutter der damals noch nicht geborenen Autorin von Frankenstein, verkehrten. Schweizers Unternehmen löste die daran geknüpften Hoffnungen nicht ein; alsbald verkaufte er es und begann über neue Geschäftsideen nachzudenken. Währenddessen trat er dem Jakobinerklub bei, wo er das Vertrauen der radikalsten Kräfte Saint-Just und Robespierre genoss. Mit den Mitgliedern des radikalen Flügels der Revolution stand er in täglichem Kontakt und teilte ihre Ansichten. Das hinderte ihn allerdings nicht, unter Einsatz seines Lebens mehrere Landsleute zu retten, als am 10. August 1792 in der Nähe der Tuilerien fast siebenhundert Soldaten der Schweizergarde niedergemetzelt wurden und alle um ihn herum brüllten: »Mort aux Suisses!« Als Ausländer waren sowohl er als auch seine Frau verdächtig, allerdings stand die Familie unter dem persönlichen Schutz Robespierres. Nichtsdestotrotz fürchteten sie sich; eines Nachts begab sich seine Frau sogar zur Guillotine am Place de Grève, um nachzuzählen, wie viele Stufen sie würden hinaufsteigen müssen, sollten sie an die Reihe kommen. Im August 1792 begannen die Massenverhaftungen, oft aufgrund fingierter Beschuldigungen; jeder in Frankreich wurde verdächtig, jeder musste befürchten, unter irgendeinem erfundenen Vorwand verhaftet und hingerichtet zu werden. 1793 erreichte jenes Phänomen seinen Höhepunkt, das Edmund Burke bereits 1790 den »rauen, schneidenden Wind des Mordes und Hochverrats« genannt hatte: der Terror.
Dank den Verbindungen ihres Pflegevaters konnte seine nunmehr sechzehnjährige Adoptivtochter aus nächster Nähe die Machtübernahme der Jakobiner und die Ereignisse des Terrors mitverfolgen. Regelmäßig besuchte sie die Sitzungen des frisch eingerichteten Revolutionstribunals, war anwesend bei den Verhandlungen, in denen den Angeklagten untersagt war, sich um juristischen Beistand zu bemühen oder Zeugen zu laden. Am 17. April notierte sie in ihrem Tagebuch: »Noch zittere ich, wann ich denke, daß es izt, in einem Jahrhundert, wo alle Künste und Wissenschaften am aufgeklärtesten sind, selbst die Seele ist von allem Aberglauben befreyt, die den Pöbel [und] auch die vornehmen Leüte vorher viele grausame Thaten zu verfertigen nöthigte, und noch viel abscheulicher geht es izt zu. Man ermordet und selbst gibt es Leute, die davon leben, für ein Assignat bleiben sie den ganzen Tag an einem Gefängnis um die Verbrecher, die viel unschuldiger als sie sind, zu töden. Viele Soldaten und Mezger verlassen ihre Pläze, um sich ein bischen zu ergezen und um der Nation einen grossen Dienst zu leisten. Aber nichts mehr von dem, ich vergesse mich noch«.
Ein halbes Jahr später, während der Septembermassaker, konnte sie Augenzeugin noch schrecklicherer Szenen werden. Laut dem Enkel des berühmtesten Henkers der Französischen Revolution Charles-Henri Sanson, der auch Ludwig XVI. enthauptete, waren die Pariser nur mit den wüstesten Barbaren der Vorzeit zu vergleichen. Da die Familie Schweizer großen Wert darauf legte, dass ihre Tochter bei den besten Künstlern von Paris lernen konnte, erzählte ihr Schweizer vermutlich auch, dass er am Abend des Massakers an den Soldaten der Schweizergarde auch den Maler David gesehen hätte, wie er zwischen den Leichen umherging und den einen oder anderen mit dem Fuß umdrehte und ihn, wenn jener ihm geeignet erschienen, in sein Atelier bringen ließ, um anschließend Skizzen von ihm anzufertigen. David besuchte auch Verurteilte, die auf ihre Hinrichtung warteten, um sie zu zeichnen. Vielleicht erzählte Barbara Ingres auch davon, als er vier Jahre später in Paris eintraf und ein Schüler von David wurde. Wie die große Mehrheit der Pariser gewöhnte sich auch Barbara, die in der Familie nur Babette genannt wurde, an die vielen Grausamkeiten. In seiner Biografie Schweizers führt David Hess, der Sohn des Bruders von Barbaras Pflegemutter, die zunehmende Verdorbenheit seiner Cousine auf die Erfahrung des Terrors zurück: »Ungehorsam, Eigenmacht und Verrath waren an der Tagesordnung und das Beispiel der allgemeinen Zügellosigkeit hatte bald so tief bei ihr gewirkt, daß sie einst während der Schreckensepoche und wie Magdalena kindische Vergehungen an ihr rügte, ihre treue Pflegemutter mit einer Anklage bei dem Revolutionstribunal bedrohte«.
Möge das Blut der Verräter der »erste Holocaust der Freiheit« (»le premier holocauste«) sein. So stand es auf einer der beliebten Wandzeitungen, verfasst von dem bekannten Schauspieler und Komödienschreiber Fabre d’Églantine, der auch ein enger Freund von Barbara Bansis Pflegevater war und zwei Jahre später gemeinsam mit Danton unter der Guillotine endete. Als lebten alle im Delirium. Als Präsident der Section des Piques ordnete der Marquis de Sade am 1. August 1793 allen Hausbesitzern in dem ihm unterstellten Pariser Bezirk an, Folgendes auf ihre Hauswand zu schreiben: FREIHEIT, GLEICHHEIT, BRÜDERLICHKEIT ODER TOD. Dazu wird Baudelaire – wenn auch nicht im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1790, aber auch auf sie anwendbar – später schreiben: »Ich sage ›es lebe die Revolution!‹ wie ich sagen würde ›es lebe die Zerstörung! es lebe die Buße! es lebe die Züchtigung! es lebe der Tod!‹«
»Vive la Mort!« – »Es lebe der Tod!« Tatsächlich rief das jemand unter dem Fenster des Romanciers Restif de la Bretonne in der Nacht vom 2. auf den 3. September 1792, als das Massaker zwischen zwei Uhr und drei Uhr morgens seinen Höhepunkt erreichte. Und als er am nächsten Tag in der Rue Saint-Antoine spazieren ging, wurde er Zeuge, wie ein Passant aus einer momentanen Laune heraus einen Mann niederstach, der auf der Flucht vor Verfolgern war. Eine action gratuite, würde hundert Jahre später André Gide dazu sagen: eine unmotivierte, jeder vorherigen Überlegung entbehrende Handlung. Der Passant, der den flüchtenden Mann niedergestochen hatte, hielt sich zufällig dort auf, gehörte nicht zu denjenigen, die dafür auserkorene Opfer systematisch ermordeten. Was mochte diesen Mann, der sonst vielleicht keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, zu einer Tötung veranlasst haben? »Ein Mann, der nicht zu den Mördern gehört, aber eine dieser Maschinen, die nicht überlegen, wie es ihrer so viele gibt«, schreibt über ihn Restif.
Eine Maschine, die Teil einer noch größeren Maschinerie ist. Dabei ist das Ganze lebendig, pulsierend, organisch. Die Handlungen der Menschen werden nicht von Einsicht oder Besonnenheit geleitet. Aber auch nicht unbedingt vom bloßen Instinkt, dem archaischen Wunsch zu morden. Natürlich spielt beim Morden auch dieses und jenes eine Rolle. Und doch scheinen die Menschen einem fremden Willen zu gehorchen, einem Gesetz, das von ihnen unabhängig ist. »Sehr mit Recht hat man bemerkt, daß die französische Revolution die Menschen mehr lenkt, als die Menschen sie«, schrieb Joseph de Maistre 1796. »Diese Beobachtung trifft durchaus zu. Sie läßt sich zwar auf alle großen Umwälzungen anwenden, ist aber nirgends schlagender gewesen, als zu dieser Zeit. Selbst die Verbrecher, die die Revolution zu lenken scheinen, sind bloße Werkzeuge […]. Die, welche die Revolution errichteten, taten es, ohne es zu wollen und ohne zu wissen, was sie taten. Sie wurden durch die Ereignisse dazu gedrängt«. Ähnliches schreibt über die Französische Revolution vierzig Jahre später auch Georg Büchner in einem Brief: »Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allen und Keinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich«. Im Strudel der Revolution, im rasenden Sog der Ereignisse verwandeln sich die Menschen in Puppen, Marionetten geradezu. Restif, der seine nächtlichen Streifzüge in einem eigenen Buch festgehalten hat und der als einer der ersten flâneure gelten kann (auch wenn das Wort erst später, 1806, zum ersten Mal auftaucht), beobachtet bei seinen regelmäßigen Spaziergängen zwischen 1788 und 1794 erstaunt, dass sich die Menschen in den Straßen von Paris zu Taten hinreißen lassen, zu denen man sie früher nicht für fähig gehalten hätte. Und sie sich selbst auch nicht. Eine unbekannte Kraft erwacht in ihnen zum Leben und bewegt sie mittels unsichtbarer Fäden, Drähte. »O ihr Franzosen, o Mitbürger von Paris! Welches Ungeheuer ist mit seinem schwarzen Geist in euch gefahren?«, ruft Restif aus, während er schildert, was er bei einem nächtlichen Ausflug beobachtet hat. »Von euch aus hättet ihr nie und nimmer solche Widerwärtigkeiten, der Kannibalen würdig, vollbracht«, fährt er fort. »Ein Ungeheuer trieb euch; und selbst die Bauern sind, trotz ihrer Bitternis, menschlich, des Mitleids fähig. Ein Ungeheurer hatte sein Gift in ihre verhärmten Herzen gespritzt.« Restif spricht von Kannibalen. Ein zeitgenössischer, englischer Reisender berichtet, dass einzelne Frauen, »Furien der Guillotine […] bei den barbarischen Festen aushalfen, wo die Herzen der Opfer von Loyalität und Ehre geröstet serviert und als köstlichste Brösel verzehrt wurden«.
Als wären die Automaten, die Henri-Louis Jaquet-Droz 1774 vorgestellt hat, zur Zeit des Terrors zum Leben erwacht. Droz’ Automaten waren den Menschen derart ähnlich, dass die Zeitgenossen sie Androiden nannten. Restif hingegen beobachtet Menschen, die so sehr an Automaten erinnern, dass man sie Maschinen nennen könnte. Schon ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Julien Offray de La Mettrie von Maschinenmenschen geschrieben (l’homme machine). Laut ihm waren das Maschinen, die jedoch lebendig seien. Sie würden nicht vom Intellekt oder einem moralischen Sinn bewegt, sondern vom physikalischen Gesetz. Während einer seiner nächtlichen Streifzüge bemerkt Restif in der Nähe der Tuilerien einen Hals über Kopf flüchtenden Menschen: »Ich verspürte in meinem Inneren eine heftige Bewegung; es war mir, als elektrisierte mich die Aufregung der Flüchtenden. Sollte mitunter die Physik beim Menschen das Gefühl ersetzen?«
Die Menschen, die Restif in den Straßen von Paris sieht: die Menschen der Zukunft. Im Vergleich zu den Menschen von früher: Androiden.
Körper und Seele
Einige Jahre später grübelt in Preußen Heinrich von Kleist in seiner Schrift Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden über die Frage, was im Menschen plötzliche Entscheidungen oder Entschlüsse hervorruft, was ihn zu unerwarteten Taten verleitet, an die er bis dahin nicht einmal im Traum gedacht hätte. Als Beispiel führt er dazu Mirabeau an, einen Vertrauten der Familie Schweizer. Als dieser nach der Auflösung der Stände durch den König in den Sitzungssaal zurückkehrt, beginnt er zu sprechen, ohne zu wissen, was er sagen will: »da er den Mund aufmachte, noch nicht wußte, was er sagen würde«. Der Anblick des Zeremonienmeisters, der die Botschaft des Königs übermittelt, hat ihn in eine gereizte Stimmung versetzt und verleitet ihn in einer auch ihm unbegreiflichen Weise zu Aussagen, an die er Sekunden zuvor noch gar nicht gedacht hat. Unter dem Eindruck seiner inneren Anspannung beginnt er zu reden, ohne zu wissen, wohin seine Worte ihn führen werden. Und auf Umwegen gelangt er zu einer Einsicht, an die er bis dahin überhaupt nicht gedacht hat, nämlich dass nur die Bajonette die Stände dazu zwingen könnten, ihren Platz zu räumen. Wie konnte es dazu kommen? Kleist schreibt: »Und wie in dem elektrisierten dadurch, nach einer Wechselwirkung, der in ihm inwohnende Elektrizitätsgrad wieder verstärkt wird, so ging unseres Redners Mut, bei der Vernichtung seines Gegners, zur verwegensten Begeisterung über.« Und daraus folgert er: »Dies ist eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen den Erscheinungen der physischen und moralischen Welt, welche sich, wenn man sie verfolgen wollte, auch noch in den Nebenumständen bewähren würde«.
Damit ist eine der großen Fragen der Zeit formuliert. Sie betrifft das Verhältnis zwischen der physischen und der moralischen Sphäre im Menschen. Auch Restif hatte den Finger schon daraufgelegt, als er von der Elektrizität, vom automatischen, vom mechanischen Handeln sprach. Zwei Jahre nach der obigen Aufzeichnung griff in London ein gewisser Mr. Urban, ein Autor des Gentleman’s Magazine, beim Erörtern der Gefahren des modernen Romans zum Beispiel zur Formulierung, Liebesromane hätten »wie Elektrizität auf den großen Körper der Nation gewirkt«. Demnach ist ein Bereich von physischen Erscheinungen gegeben, die vom Menschen unabhängig und von ihm nicht zu beeinflussen sind, die nicht nur auf seinen Körper, sondern auch auf seine Seele und seinen Geist zurückwirken. Die Elektrizität stellt hier kein Gleichnis dar, keine metaphysische Analogie, sondern ist ein physisches Phänomen, das genauso offenkundig ist wie die Rationalität oder das moralische Empfinden. In den 1780er- und 1790er-Jahren waren die Experimente Luigi Galvanis bereits in ganz Europa bekannt. 1786 schrieb Galvani, nachdem er die Muskeln eines geschundenen Frosches durch Elektrizität in Bewegung versetzt hatte, von »tierischer Elektrizität«. Fortan nahmen Tierversuche dieser Art kein Ende. 1803 hielt Galvanis Landsmann Giovanni Aldani in London eine Vorführung, bei der er die Muskeln toter Tiere in Bewegung versetzte. Später wurde auch mit menschlichen Leichen experimentiert, und auch hierbei wurden die oft entsetzten Zuschauer Zeugen von Bewegungen und Muskelkontraktionen. Das Phänomen der Elektrizität gewann immer größere Bedeutung, da man darin das Rätsel des Lebens zu entdecken wähnte. Galvani hegte sogar die Hoffnung, dass man mithilfe der Elektrizität auch Tote würde wieder zum Leben erwecken können.
Auch der namhafte französische Arzt und Physiologe Pierre-Jean-Georges Cabanis befasste sich – auf Galvanis Erkenntnisse gestützt – eingehend mit der bei der Muskelkontraktion auftretenden Elektrizität und der auf elektrischem Wege vonstatten gehenden Weiterleitung der Reizungen in den Nerven. Das brachte ihn dazu, die Verbindung zwischen dem Nervensystem und der Funktionsweise des Bewusstseins zu untersuchen. Um menschliches Verhalten zu deuten, suchte er nicht nach einer metaphysischen, sondern nach einer physischen Erklärung und verwendete als Nachweis für die Einheit der moralischen und der physischen »Welt« das zu jener Zeit modische, sogenannte physiologische Argument. Das Verhältnis zwischen der physischen und der moralisch-rationalen Sphäre war ein bevorzugtes Thema des achtzehnten Jahrhunderts. Cabanis interessierte sich für den Zusammenhang zwischen dem, was wir durch unsere Sinnesorgane erfahren, und dem, was wir denken oder fühlen, was wir für gut und richtig oder auch sündhaft und verwerflich halten.
Und überhaupt: Existiert der menschliche Geist ohne die sinnliche Wahrnehmung, oder bedingen sich beide gegenseitig? Handelt es sich bei ihnen womöglich um zwei Seiten desselben Phänomens? Hinzu kommt, wie viele festgestellt haben, dass der Mensch vieles von dem wahrnimmt, was mit oder in seinem Körper vor sich geht, während er gleichzeitig vieles, was mit oder in seinem Körper geschieht, auch gar nicht wahrnimmt. Ob diese nicht wahrgenommenen, körperlichen Abläufe wohl eine Rückwirkung auf das Bewusstsein haben, das nicht einmal ahnt, was da alles auf es einwirkt?
Cabanis’ Rapports du physique et du moral de l’homme erschien 1802, die deutsche Übersetzung Ueber die Verbindung des Physischen und Moralischen in dem Menschen folgte 1804. Als Kleist um 1805/6 seine Arbeit über das eigenartige Verhältnis zwischen dem Nervensystem und dem Bewusstsein schrieb, nahm er das Buch von Cabanis als Grundlage. Von dem Buch könnte Kleist aber auch schon vor der deutschen Ausgabe erfahren haben, womöglich hatte ihm ein berühmter deutscher Arzt zum ersten Mal davon erzählt, der ihn im Dezember 1803 bei sich in Mainz aufnahm. Nachdem Kleist über ein Jahr fieberhaft an seinem Drama Robert Guiskard gearbeitet hatte, hatte er im Herbst 1803 in Paris das Manuskript in einem Anfall von Verzweiflung zerrissen und ins Feuer geworfen – auch das: action gratuite – und war in selbstmörderischer Absicht nach Norden gereist, um sich Napoleons Heer anzuschließen. Als früherer preußischer Offizier wurde er verständlicherweise für einen Spion gehalten, verhaftet und dann auf Intervention des preußischen Gesandten in Paris aus Frankreich abgeschoben. Die erste Stadt auf seinem Heimweg war das damals zu Frankreich gehörende Mainz, wo er im Herbst 1803, wie er später schreibt, »endlich krank niedersank, und nahe an fünf Monaten abwechselnd das Bett oder das Zimmer gehütet habe«. Was in dieser Zeit geschah, ist nicht bekannt – es ist ein weißer oder besser schwarzer Fleck in Kleists Leben. Höchstwahrscheinlich ist er einer schweren Psychose erlegen. Die Monate zwischen Dezember 1803 und Juni 1804 verbrachte er im Haus des allgemein angesehenen Arztes Georg Christian Wedekind, unter dessen Aufsicht. Wedekind dürfte ihm vom Verhältnis zwischen der moralischen und der physischen Sphäre erzählt haben. Nicht zuletzt, weil das Verhältnis zwischen dem Nervensystem und dem Bewusstsein beziehungsweise die Rolle, die die Reize dabei spielten, auch ihn selbst beschäftigte, und er über das Thema wiederholt schrieb.
Zähneknirschen
Am 21. November, ein paar Tage vor Kleists Ankunft in Mainz, kam es dort gegen Mittag zu einer Gruppenhinrichtung. Auch Kleist muss davon erfahren haben, denn die Nachricht der Hinrichtung beschäftigte alle Bewohner der Stadt. Man hatte sämtliche Mitglieder einer zwanzigköpfigen Räuberbande zum Tode verurteilt, an ihrer Spitze Johannes Bückler, allgemein bekannt als Schinderhannes. Schinderhannes war schon zu Lebzeiten ein legendärer Wegelagerer, und sein Ruf dauerte fort. Baudelaire erwähnte ihn wie später auch Apollinaire, der in seinem 1913 veröffentlichten Band Alkohol sogar ein Gedicht mit dem Titel »Schinderhannes« über ihn schrieb, und auch Paul Celan berief sich in seinem Gedicht »Huhediblu« auf ihn. Fast vierzigtausend Menschen versammelten sich am Schauplatz der Hinrichtung, Massen von Neugierigen strömten von fern herbei. Die Verurteilten wurden auf fünf Karren durch die überfüllten Straßen zum schwarz verhangenen Schafott gebracht, dessen Balken rot angemalt worden waren. Die Enthauptungen wurden durch eine Guillotine vollzogen, innerhalb von sechsundzwanzig Minuten waren alle Räuber hingerichtet. Hundertfünfzig Schritte vom Richtplatz entfernt warteten bereits die örtlichen Ärzte, Kollegen Wedekinds, in einem eigens zu diesem Zweck errichteten, provisorischen Gebäude auf die abgeschnittenen Köpfe und Leichen, um sie mit Hilfe von Volta-Elementen, Leidener Flaschen und Elektrisierapparaten diversen Experimenten zu unterziehen. Man wollte herausfinden, ob es in einem abgeschnittenen Kopf noch Spuren von Bewusstsein oder Empfindung gab. Noch am Fuß der Guillotine mussten zwei junge Gehilfen prüfen, ob die frisch abgeschnittenen Köpfe irgendein Lebenszeichen von sich gaben. Als sie den Kopf des Schinderhannes in die Hand nahmen, riefen sie ihm von beiden Seiten ins Ohr: »Hörst du uns?« Alle Köpfe, in denen man noch Lebenszeichen vermutete, wurden umgehend zu den Ärzten gebracht. Diese Köpfe wurden galvanisiert, wobei unterschiedlichste Bewegungen beobachtet wurden. Die Gesichtsmuskeln zuckten, die Zähne knirschten, das Spiel der Gesichtszüge erschreckte sogar die Ärzte, die die Experimente durchführten. Wie ein Arzt und Augenzeuge berichtet: »20 Minuten nach dem Tode brachte eine Volta’sche Säule von 120 Kupfer- und Zinkplattenpaaren bey der Armatur des äußern Gehörganges und mehrerer, theils präparirten, theils unentblößten Gesichtsnerven beträchtliche Zuckungen in den Gesichtsmuskeln bis zum Zähneknirschen hervor. Bey der Auftragung des Wasserstoffpoles auf den Zungenschlundnerven reckte der Cadaver die Zunge aus der Mundhöhle. Das Lippenspiel war sehr lebhaft«. Und als man den Enddarm des bäuchlings liegenden, kopflosen Stumpfes reizte, spannten sich seine Hände an und der Rumpf hob sich, während aus den Lungen pfeifend Luft entfloh. Schließlich stellte man fest, dass Rumpf und Kopf desto lebhafter auf Reizungen reagierten, je weniger Zeit zwischen der Hinrichtung und dem Experiment vergangen war.
Hinrichtung von Schinderhannes
, 1803.
Anfang 1804 berichtete die lokale Mainzer Zeitung mehrmals über weitere Experimente der Ärztegruppe, die an Tieren durchgeführt wurden. Im April 1804, als Kleist noch in Mainz weilte, erschien der Bericht über die Experimente an den Hingerichteten von Ende November auch als eigenständige Ausgabe (Galvanische und elektrische Versuche an Menschen- und Thierkörpern). Darin konnte man sich unter anderem auch über Folgendes informieren: »Die mit der größten Geschwindigkeit abwechselnden Zusammenziehungen aller Gesichtsmuskeln, verbunden mit dem durch die Bewegung des Unterkiefers entstandenen Knirschen der Zähne, stellten augenblickliche, schnell vorübergehende, unter sich sehr verschiedene Physionomien desselben Gesichtes dar; ein am entseelten Körper, vermittelst der noch vorhandenen Erregbarkeit der Organe, durch die Kunst nachgeahmtes Minenspiel, welches den Nichtunterrichteten zu täuschen und zu schrecken im Stande war«. Dass sich in Wedekinds Arbeitszimmer kein Exemplar dieser Ausgabe befunden hätte, ist ausgeschlossen, schließlich hatte er sich Jahre zuvor aktiv am wissenschaftlichen Disput über die abgeschnittenen Köpfe beteiligt. Und gewiss hatte es der für okkulte Erscheinungen stets anfällige Kleist auch gelesen. Das Thema war zu jener Zeit genauso aktuell wie zweihundert Jahre später, zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, die Frage der künstlichen Intelligenz. Immer mehr Menschen in ganz Europa schrieben und sprachen davon. Die Frage, ob ein abgeschnittener Kopf noch lebte, und wenn ja, ob er noch etwas fühlte oder wahrnahm, beziehungsweise ob er noch ein Ich-Bewusstsein hätte, hing mit einem anderen großen Thema zusammen, der Frage nach dem Verhältnis zwischen der moralischen und der physischen Welt, zwischen Materie und Geist. Und dieses Thema war wiederum mit der radikalen Umwandlung der bis dahin geltenden Vorstellungen über den Menschen verquickt.
Was würde ein abgeschnittener Kopf sagen, wenn man ihn wirklich zum Sprechen bringen könnte? Und was hätte wohl der Kopf des Schinderhannes auf die Frage geantwortet, ob er die Anwesenden hörte? Vermutlich das Gleiche, was M. Valdemar sagt, der Protagonist von Poes Erzählung Die Tatsachen im Falle Valdemar, als er bereits im Sterben liegt, und der Erzähler um jeden Preis bemüht ist, ihn durch Mesmerismus am Leben zu erhalten. Valdemar, dessen Geschichte von Baudelaire ins Französische übersetzt wurde, »überlebt« seinen eigenen Tod und antwortet, als er angesprochen wird, mit den Worten: »Ich sage Ihnen, ich bin tot!«
Ich weiß, dass ich gestorben bin.
Lebt ein abgeschnittener Kopf noch? Die Frage beschäftigte immer mehr Zeitgenossen. Die Guillotine hatte das bis dahin gültige Bild des Menschen gründlich durcheinandergebracht.
Das Fernrohr
Kehren wir zu Barbara Bansi zurück, der Schülerin der Malerei aus der Schweiz. Im September 1792, inmitten des Blutvergießens, stellt ein jakobinischer Abgeordneter einer Freundin gegenüber in einem Brief erleichtert fest, dass »Ihre schönen Augen nicht durch die widerlichen Bilder besudelt wurden, die wir dieser Tage vor uns sahen«. Der Blick Barbara Bansis war wohl kaum so unschuldig geblieben. Sie hatte sehr wohl die Grausamkeiten gesehen, die Hinrichtungen, wie wenig ein Menschenleben zählte, dass es kaum mehr als ein Spielball des Zufalls war. Zwar bedauert sie den König, als er am 21. Januar 1793 hingerichtet wird, doch schwärmt sie gleichzeitig für Marat, dessen Leiche der Maler David, ein Anhänger von Marat und Robespierre, später einbalsamieren lässt, bevor er dann das berühmte Gemälde des in der Badewanne sitzenden, toten Revolutionärs malt, aus dessen Brustwunde das Blut bis heute strömt. Ingres und Barbara Bansi kannten das Bild sicher, da es 1795 wieder in Davids Atelier zurückgekehrt war.
In Barbara Bansis Tagebuch wechseln sich Notizen zur Kunst mit Berichten über die Hinrichtungen ab. Mal bedauert sie die Verwüstung der Pariser Parkanlagen, mal hält sie einen flüchtigen Eindruck fest, von dem sie glaubt, er sei es wert, als Zeichnung verewigt zu werden. Ihre Aufmerksamkeit schweift zwischen den Erscheinungen hin und her, es fehlt der starke Leitfaden, der ihr helfen würde, sich im Labyrinth der Eindrücke nicht zu verirren. Natürlich ist sie nicht die Einzige, die in Paris den Eindruck hat, in ein Labyrinth geraten zu sein – das wird zum allgemeinen Eindruck werden, der auch nicht mehr vergehen wird. Das sechzehnjährige Mädchen irrt genauso ratlos inmitten der Weltereignisse umher wie später in Stendhals Die Kartause von Parma der Protagonist Fabrizio del Dongo auf dem Schlachtfeld von Waterloo; auch er nimmt alles wahr, ohne das Ganze je überblicken zu können.
Auf Ingres’ Zeichnung von ihr sieht man den Luftballon, der im Oktober 1797 im Parc Monceau abgehoben hat. Nur ein paar Minuten von dort entfernt lag der am 5. März 1793 wiedereröffnete Friedhof Cimetière des Errancis, in dem bis zu seiner Schließung am 23. April 1797 die Leichen von 1119 Menschen beerdigt wurden, die durch die Guillotine hingerichtet worden waren – darunter auch die von Robespierre und Saint-Just. Anwohner in der Nachbarschaft beklagten sich über den ständigen Gestank.
Als es am 22. Oktober zur Fallschirmvorführung kam, befand sich Barbara Bansi keineswegs auf irgendeinem beliebigen Gelände. Wohin sie auch ging, überall stieß sie auf Spuren des Todes. Und das Fernrohr hatte sie bei sich. Nicht nur um den Fallschirmspringer zu beobachten, dem sie übrigens den Rücken kehrte, sondern um die Millionen von Ereignissen besser sehen zu können, die ihr mit »bloßem Auge« vielleicht entgangen wären. 1793/94 reiste der deutsche Naturwissenschaftler Georg Forster in das durch die Revolutionswirren aufgewühlte Paris, wo er auch den Salon von Barbara Bansis Pflegemutter mehrmals besuchte. Inmitten der unzähligen Eindrücke musste auch ihm schwindelig werden. Ihm war, als schlügen die Ereignisse wie Wellen über seinem Kopf zusammen, und er könne das Gesehene nicht mehr zusammensetzen. Alles war zersplittert. Jeder hätte sich von der Revolution etwas anderes erwartet, konstatiert er, darum wären alle etwas enttäuscht: »Sobald wir aber erkennen müssen, daß die Vorsehung durch die Revolution ganz andre Zwecke, als die Befriedigung der Leidenschaften einer Handvoll Ehrgeitziger, erreichen will, – und dies ist augenscheinlich, indem die Revolution von diesen einzelnen Personen unabhängig ist –: so bald gewinnt auch diese große, und in mancher Rücksicht beispiellose Begebenheit in ihren allgemeinen Verhältnissen eine so überwiegende Wichtigkeit, und ihr Totaleindruck wird so kolossalisch, daß ich mich nie genug wundern kann, wenn Menschen mit gesunden Augen nach dem Vergrößerungsglase greifen, um in der Atmosphäre dieses Kometen Sonnenstäubchen tanzen zu sehen«. Von einem »großstädtischen Chaos« spricht auch Restif de la Bretonne, auch er im Jahr 1793. In diesem völligen Durcheinander gibt es nur eine Gewissheit: den Tod. Alles andere befindet sich in einem Zustand völliger Zerrüttung. Wenn etwas scharf zu sehen ist, wird alles andere unscharf. Da kommt ein Fernrohr gelegen.