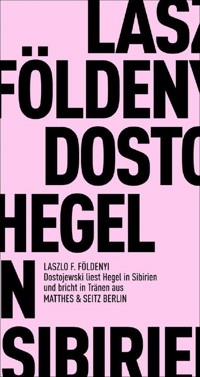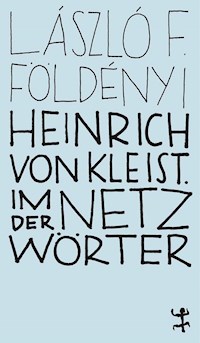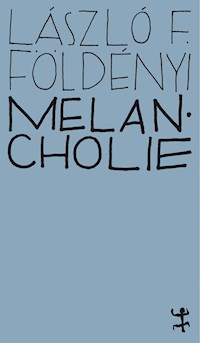
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einer der brillantesten Essayisten der Gegenwart wendet sich mit seiner charakteristischen Fülle an literarischen, ästhetischen und historischen Einsichten der Melancholie zu. Sein Buch, teils Geschichte des Begriffs und teils Analyse der melancholischen Disposition, taucht weit in die Vergangen heit, um die Zweideutigkeiten der Melancholie zu untersuchen. Unterwegs entdeckt Földényi die Melancholie als Energie und Kreativitätsquelle wieder, die in der Lage wäre, uns inmitten unserer verhärteten Gegenwart in Bewegung zu setzen. "Das Leben heute ist ja so geplant, dass man eigentlich nicht Melancholiker sein darf. Als ich dieses Buch geschrieben habe, versuchte ich eine Art unterirdischer Geschichte von Europa aufzudecken, und ich glaube, dass der Melancholiker dadurch ausgezeichnet ist, dass er sich vor dieser Welt verstecken möchte, er will aber nicht ins Jenseits flüchten, vielmehr ist er vertraut mit einer Geschichte, die verschwiegen und verdrängt wird."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
László F. Földényi
MELANCHOLIE
Aus dem Ungarischenvon Nora Tahy
Durchgesehenvon Gerd Bergfleth
Marianne Bara gewidmet
INHALT
Vorwort
Die Eingeweihten
Das Gefängnis der Temperamente
Die Ausgesperrten
Die Herausforderung des Schicksals
Die Bestechlichen
Der frühe Tod der Romantiker
Liebe und Melancholie
Die Krankheit
Die Angst vor der Freiheit
Die Leere der Schöpfung
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Personenregister
VORWORT
Der Beginn unter Qualen zeugt von der Schwierigkeit des Unterfangens.
Unter der Hinzuziehung von Begriffen müssen wir über etwas sprechen, was die Begriffe erst angreift, um sie dann, einer Fata Morgana gleich, jeder Erreichbarkeit zu entreißen. Es ist die Grammatik der Wörter, der Klang der Sätze, an die wir uns um Hilfe wenden, doch versuchen sie gerade das zu thematisieren, übersichtlich und einkreisbar zu machen, was diesen Wörtern und Sätzen vorausgeht. Die Sprache ist klangvoll, doch muss sie früher oder später verstummen: Auch sie ist ein Kind des Schweigens. Die Wörter, sie sagen weniger, als wir durch sie auszudrücken wünschen – sie leiten uns fehl, entführen unsere Gedanken ihrem eigentlichen Ziel, und zwar solcherart, dass wir beim Sprechen vielleicht selbst erstaunt feststellen mögen: Wir wollten eigentlich etwas anderes sagen, als die Wörter, die Intonationen und die sprachlichen Strukturen glauben machen. Das Wort sagt weniger, als wir mitteilen möchten – doch die Tatsache, dass sich die Missverständnisse niemals aus unserem Leben verbannen lassen, weist darauf hin, dass es sich hier nicht lediglich um eine technische Unvollkommenheit handelt, sondern um das ureigenste Paradoxon von Sprache, des Sich-Mitteilens: Die Wörter verraten wenig, weil sie zu viel Inhalt in sich tragen; gleich was wir sagen, worüber wir reden, unsere Wörter drücken nicht nur das aus, was wir mitzuteilen wünschen. In ihren Tiefen hält sich eine andere, nicht mitteilbare Welt verborgen, die aber gerade auch diesen Wörtern Leben gibt. Selbstverständlich können wir über diese andere Welt Bemerkungen fallen lassen – aber damit haben wir sie nicht liquidiert, sondern lediglich ihre Grenzen ein wenig hinausgeschoben, indem wir den für uns niemals erreichbaren Horizont etwas erweitert haben. Wörter, Begriffe, der Wichtigkeit des Sprechens bereitet all dies keinen Abbruch – doch muss das Wort, um wahrhaftig Bedeutsamkeit und Bedeutung zu erlangen, mit seinem eigenen Ausgeliefertsein rechnen, seiner eigenen Zerbrechlichkeit gerecht werden. Der Held einer »exemplarischen« Novelle von Cervantes hatte ein Wundermittel eingenommen, um daraufhin dem Gefühl zu erliegen, dass seine Seele sowie sein Körper aus durchsichtigem Glas seien – und je stärker die Angst und der Wahnsinn in ihm überhandnahmen, umso mehr verstärkten sich bei ihm auch Klarsicht und Urteilsvermögen. Und so verhält es sich in etwa auch mit den Wörtern.
Diese eingestandene Schwäche ist tatsächlich eine Schwäche – dies muss festgehalten werden, bevor das mit den Begriffen durchgeführte Spiel es uns vergessen ließe. Im vorliegenden Falle ist dies vielfach richtig. Und eine Folge dieser Unzulänglichkeit der Begriffe ist unter anderem die Melancholie; diese Unzulänglichkeit ist aber nicht bestimmbar so oder so geartet, sodass man ihre Hinfälligkeit ausmerzen und mit der Zeit vielleicht aufheben könnte, sondern etwas, ohne das eine Begriffsbildung unvorstellbar ist. Und wenn von dem Klarsehen und dem Maß der Endgültigkeit, auf denen vielerlei Einsichten beruhen, die eine Säule gebildet wird, dann die andere von der Trübheit der Unfassbarkeit, der Unbegreiflichkeit und der Unbefriedigtheit. Vielleicht daher die Traurigkeit, die den Grund einer jeden den Anspruch auf Endgültigkeit erhebenden Formulierung durchzieht, die Untröstlichkeit, die auch die geschlossensten Gebilde angreift.
Unsere Kultur verwendet in diesem Zusammenhang gern den Begriff der Negativität, des Mangels, doch fragt sich, und dafür liefert uns ebenfalls die Melancholie den Ansatz, ob dasjenige als »Negativität«, als Mangel angesehen werden kann und darf, was aus dem menschlichen Leben nicht wegzudenken ist. Aus einer Art eschatologischer Sicht höchstwahrscheinlich, doch, und auch daran erinnert uns die Melancholie, ist der eschatologische Glaube selbst eine Erscheinung des zur Verdüsterung neigenden menschlichen Seins; und dürfen wir denn nach göttlicher Art aus unserer menschlichen Grundsituation heraus strenge Grenzen zwischen Negativität und Positivität ziehen? Extreme, äußerste Punkte und Grenzen, die gibt es; wird dies doch nicht nur durch unsere Endlichkeit in Gestalt der Vergänglichkeit oder des Todes bezeugt, sondern auch durch jene Grenzen, an die jedes menschliche Bestreben früher oder später gelangt. Es umgrenzen uns aber die letzten, äußersten menschlichen Grenzen nicht gleichsam kreisförmig von außen her, sondern sie sind ureigenste, innerste, zu jeder Zeit und an jedem Ort zu entdeckende Knotenpunkte unseres Seins. Deshalb ist, was von außen als Mangel erscheint (gemeint ist damit, dass die menschliche Existenz begrenzt und nicht allmächtig ist), von innen her als Vollendung zu verstehen; was mit den Augen Gottes gesehen Hinfälligkeit ist, ist nach menschlichem Maße innere Kraft, Fähigkeit. Die Untröstlichkeit ist auch im tiefsten Klarsehen, das Dunkel auch im genauesten Gedankengang enthalten. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich gegenseitig ausschalten. Denn wir durchleben unser Leben voneinander abweichend, unvergleichbar, auf einzigartige Weise, und es gibt keine zwei Menschen, in denen Klarsicht und Dunkel, die sich auf das Unendliche richtende Sehnsucht und das zur letztendlichen Hinfälligkeit verdammte Sein in gleichem Verhältnis aufgeteilt wären. In diesem findet sich, wie es erneut von der Melancholie angedeutet wird, die Voraussetzung des Lebens, aber auch des Todes. Nicht die Schwäche und nicht die Kraft, nicht das Klarsehen und nicht das Dunkel ist das, woran wir sterben, sondern die Tatsache, dass ein jedes derselbe Mangel des anderen und Vollendung seiner selbst ist.
Ja, die Melancholie mahnt immer wieder erneut; doch ihre Mahnung kommt nicht von außen, sondern spricht von innen her zu uns. Sie bedarf aber nicht unbedingt der Worte. Sie ist gleichzeitig diesseits und jenseits der Worte gegenwärtig. Sie bringt jene Worte, die sie schließlich ausnehmen, hervor. Damals, als sie einige Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung zum ersten Mal in Worte gefasst wurde, waren die Geburtswehen, die nicht nur das Auf-die-Welt-Kommen der Melancholie, sondern auch des Menschen begleitet hatten, schon in Vergessenheit geraten. Nun steht die Melancholie in voller Rüstung vor uns (obwohl das Bild ziemlich irreführend ist), und die Wörter, die über sie fallen gelassen werden, sind überwiegend beschreibend, gegenständlich. Später, als sich diese Wörter vermehrten, kam jene Zeit, in der sie durch die gesprochenen Wörter geschaffen wurde, in der die Menschen melancholisch zu sein versuchten – doch hatte diese Modeströmung wenig mit der Melancholie an sich gemein. Da aber in diesen Worten, wie allgemein in allen verbalen Erscheinungen, das Äußerste an Irrungen und Wirrungen enthalten ist, ist das sich auf die Melancholie beziehende Gerede ein ausgesprochen schauerliches Unterfangen. Es bedarf eines peniblen Gleichgewichts der Begriffe: Man darf nicht nur über das reden, worum es geht, sondern muss auch die Frage des »Wie« eines solchen Sprechens zum Gegenstand machen. Diese Spirale aber ist unendlich: Über das als Gegenstand behandelte »Wie« muss man auch in irgendeiner Form Wörter bilden. Und diese Form beansprucht wiederum, dass man sie als Gegenstand behandle. In dem Fall von einander aufreibenden und einander abnutzenden Gegenständen und Formen gibt es keine endgültige Lösung: Es geht um die Melancholie, obwohl es doch eigentlich thematisch um die melancholische Grundlage der Wörter gehen müsste. Es ist unser eigener Haarschopf, den wir zur Errettung unserer selbst zu packen versuchen.
Zu jener Zeit, da die Melancholie zum ersten Mal als Begriff erschien, war über sie schon alles gesagt worden. Doch von Anbeginn an ist die Ungenauigkeit des Begriffs, an der auch spätere Epochen nichts ändern konnten, auffallend. Es gibt keine eindeutige und genau treffende Bestimmung der Melancholie. Die Geschichte der Melancholie ist auch die Geschichte einer nie zum Abschluss kommenden Präzisierung der Begriffsprägung, und gerade daraus ergibt sich der Zweifel: Sprechen wir über die Melancholie, so ist sie gar nicht Gegenstand unseres Sprechens, es handelt sich vielmehr um einen Versuch, mit den über sie geprägten Begriffen unsere eigene Lage zu erkennen. Somit vervielfachen sich die Qualen eines Einstiegs, denn wo liegt denn der Beginn? Dort, wo das Thema als Begriff zum ersten Male auftaucht (in der Antike), oder dort, wo unser eigenes Leben sich an den Begriff bindet, um sich nie wieder von ihm zu lösen? Dort, wo sie sich der Form des Begriffs unterwirft, oder dort, wo unser Leben vor dem Begriff zurückschreckend gleichsam zu ihr gelangt? Wir haben gesagt, dass sie dort, wo sie uns erstmals gegenübertritt, mit aller Macht präsent ist. Die Vorsicht, und vielleicht auch die Angst, die am Grunde jeder Vorsicht in uns arbeitet, fordert den Beginn beim Worte, verlangt also, dem Schicksal des Begriffs auf der Spur zu sein. Wenn sich nämlich, wie wir angenommen haben, die Melancholie, die die Worte angreift und sie der Lüge überführt, sowieso in den Worten verborgen hält, dann können wir auch die Fragen unseres eigenen Lebens sowie unsere Zweifel verständlicher, wenngleich nicht antwortfertig, formulieren.
DIE EINGEWEIHTEN
Διὰ τί πὰντες ὅσοι περιττοὶ γεγόνασιν ἄνδρες ἢκατὰ φιλοσοφίαν ἢ πολιτικὴ ἢ ποίησιν ἢ τέχνας φαίνονταιμελαγχολικοὶ ὄντες
»Warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker?«1 Dieser Satz, mit dem der 30. Abschnitt der in der Schule des Aristoteles zusammengestellten Problemata Physica beginnt, scheint an den Anfang unseres Gedankengangs zu gehören, und an seiner Gültigkeit hat er bis in die heutige Zeit nichts eingebüßt. Und obzwar er aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Feder jenes Theophrast von Eresos stammt, der nach Diogenes Laertios das erste, jedoch verschollene Buch über die Melancholie geschrieben haben soll, hielt die Allgemeinheit seit der Antike daran fest, die Autorschaft Aristoteles zuzuschreiben. Bleiben auch wir dabei. Die Begriffe der »herausragenden Persönlichkeit«, der »Außerordentlichkeit« und der »Melancholie« werden hier zum ersten Mal, was zunächst erstaunlich wirken kann, miteinander verwoben und in Zusammenhang gebracht. Die Melancholie, wortwörtlich die schwarze Galle (μελαινα χολή), war im ursprünglichen Sinne des Wortes ein Charakteristikum des Körpers; die Vorzüglichkeit eines Philosophen, Politikers oder Künstlers liegt aber im Geiste, und dies beides, die Zweiheit von Körper und Seele, lässt sich der neueren Anschauung gemäß höchstens mithilfe einer Metapher verbinden und zusammenziehen. Diese Metapher aber fehlt: Die Entsprechung ist bei Aristoteles nämlich direkt; aus diesem Grunde müssen wir versuchen, eine innere Beziehung der beiden Begriffe herauszuarbeiten. Die Begriffe der herausragenden Persönlichkeit und der Außerordentlichkeit sollten auf ihre ursprünglichen Bedeutungen zurückgeführt werden. (Das Verb περττεύω drückt nicht nur Reichhaltigkeit, sondern auch Überfluss an etwas aus.) Wer herausragend, außerordentlich ist, verfügt über etwas, woran es den anderen fehlt: Er ist im Besitz nichtalltäglicher Eigenschaften. Und da das »Herausragen« gleichermaßen körperliches Überragen wie auch geistige Überlegenheit bedeuten kann, ist die Frage, ob wir es als ein geistiges oder als physisches Charakteristikum betrachten, zweitrangig. (Die geistigen Folgen einer körperlichen Veränderung zeigen, dass die Außerordentlichkeit nicht nur auf das eine oder andere beschränkt werden kann.) Wer herausragend ist, sei er es als Dichter, Philosoph, Politiker oder Künstler, ist es nicht nur geistig, sondern dieses sein geistiges Herausragen ist selbst die Folge einer sich in der Tiefe vollziehenden und selbstverständlich nicht nur rein körperlichen bzw. geistigen Veränderung: Wir müssen darin die eigentümliche Beziehung des Menschen zum Leben, besser gesagt, zu seinem eigenen persönlichen Schicksal bemerken. Entscheidend ist dabei das entschiedene Sich-dem-Schicksal-Entgegenstellen, das Aufsichnehmen des Schicksals und seine gnadenlose Verwirklichung. Dies folgt aus der Einsicht, dass das Leben, dessen geistige und körperliche Merkmale zweitrangig und schwer voneinander abgrenzbar sind (wie viele sterben an ihrer Außerordentlichkeit, und wie viele große Geister gehen an irgendeinem körperlichen Gebrechen zugrunde, wie wir zu sagen pflegen, obwohl wir genau spüren, dass es sich jeweils nicht nur um den Körper bzw. nur um den Geist handeln kann), unvergleichlich ist (περισσός bedeutet in der griechischen Arithmetik so viel wie ungerade). Wer herausragend ist, hat seine Außerordentlichkeit der Einmaligkeit des Lebens (seiner Unteilbarkeit und der Unmöglichkeit, es zu vervielfachen) zu verdanken; daher scheint es verständlich, dass dieses eigentümliche Geschenk nicht Frohsinn, auch nicht vertrauensvolle Hoffnung, sondern Melancholie hervorruft. Dadurch wird der scheinbare Widerspruch des aristotelischen Satzes gewissermaßen gedämpft. Doch wie steht es mit der Melancholie, der schwarzen Galle? Selbst eine nur oberflächliche Kenntnis der griechischen Kultur reicht aus, um sagen zu können, dass die Trennung der vergangenen 2 000 Jahre von Körper und Seele, von Geist und Materie in zwei Bereiche, ihr weder als Erfahrung noch als Einsicht bekannt war, dass sie somit die körperlichen Eigentümlichkeiten der schwarzen Galle nicht ausschließlich als körperliches Merkmal betrachtete, sondern sie in die geistige Welt und damit in die Beurteilung des Ganzen des Kosmos hinüberhob; sie hatte solcherart jene Zweiheit, die wir als den Gegensatz von geistigem Herausragen und der für den Körper bezeichnenden schwarzen Galle kennengelernt haben, nicht nur nicht vollendet, sondern von vornherein auch niemals erfahren. Die begriffliche Entfaltung der Melancholie, der schwarzen Galle, verschafft uns tieferen Einblick in diese Anschauung.
Auf erste Spuren eines Zusammenhangs zwischen Galle und Geist (Gemüt) stoßen wir bei Homer, der zwar die schwarze Galle als solche nicht erwähnt, jedoch die schwarze Farbe mit der Vernebelung des Gemüts in Zusammenhang bringt. »Das finstere Herz« des wütenden Agamemnon, »von der Galle schwarz umströmt«,2 ist, obschon unausgesprochen, genauso eine Folge der Veränderung der Galle wie seines Grolls wegen der Weissagung von Kalchas. Zusammen spielen die Galle und die schwarze Farbe erst in Sophokles’ Tragödie Die Trachinierinnen eine Rolle: die »gallichtschwarze Brut«3 des Lernadrachen, die den Pfeil getränkt hat, ist nach den Worten des Dichters giftig (der schwarze Saft, auf griechisch wörtlich μελαγχόλος). Somit hielt der Dramatiker, der als Priester zugleich Arzt war, die schwarze Galle für einen schädlichen Saft, nämlich für ein Gift des Körpers. Die Beschreibung und die Beurteilung dieses Giftes, der schwarzen Galle, wird an den Namen des Hippokrates (Ende des 5. Jahrhunderts) geknüpft. »Der Körper des Menschen enthält in sich Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, und diese Säfte machen die Natur (Konstitution) seines Körpers aus, und wegen dieser (Säfte) ist er krank oder gesund.«4 Hippokrates führte die Krankheit namens Melancholie zunächst auf ein Sichverfärben der Galle ins Schwarze zurück (μελαγχολία ist eine Krankheit des durch die Galle bestimmten Typs – ό χoλώδhς), nicht direkt auf die schwarze Galle wie in seinen späteren Schriften. Wenn das Verhältnis bei der Mischung der Säfte nicht ausgewogen ist, wähnte er, nachdem er den Begriff der schwarzen Galle eingeführt hatte, bzw. wenn sich einer der Säfte nicht mit den anderen entsprechend vermengt, dann wird der Körper krank. Die Konstitution des menschlichen Körpers hängt von diesem Verhältnis ab, und so bezeichneten die Griechen Beschaffenheit und Vermengung mit ein und demselben Wort: ἡ κρᾶσις. Die kosmozentrische Anschauung der Griechen betrachtete den Menschen als organischen Bestandteil des Alls, sie stellte ihn nicht diesem gegenüber. Die Vermengung, deren Begriff sich ursprünglich auf eine Verbindung der Bestandteile bezog, ist für alles verantwortlich: ebenso für den Zustand des Kosmos wie für den des Menschen, also sowohl für seine Gestalt als auch seinen Charakter, und, wie bald Ptolemäus im Tetrabiblos ausführen wird, auch für jene Kraft, durch die die Sterne beeinflusst werden. Hippokrates selbst befasst sich auffallend wenig mit der Geistigkeit der Gestalt, er wendet seine Aufmerksamkeit eher den körperlichen Komponenten zu – doch trägt jene Anschauung, die sich zur Einheit von Körperzustand und Kosmos bekennt, unausgesprochen auch die Einheit von Körper und Geist in sich. Die Melancholie, sagt Hippokrates, ist eine Krankheit des Körpers: Der dickflüssige Saft der schwarzen Galle erlangt im Verhältnis zu den anderen, dominierenden Körpersäften Dominanz und kann, da das Blut somit vergiftet ist, nun verschiedene Krankheiten, von den Kopfschmerzen über Bauch- und Leberbeschwerden bis hin zur Lepra, erzeugen. Das Blut aber ist die Wiege der Vernunft, des Geistes, so Hippokrates, und daraus lassen sich die geistigen Folgen der das Blut vergiftenden Galle erklären. Die schwarze Galle ist demnach nicht an sich schon eine Krankheit, sondern wird erst durch das schlechte Verhältnis der Mischung dazu. Die sich in erster Linie auf einen geistigen Zustand beziehende Melancholie (schwarze Galle) ist ein ganz eigentümlicher Fall schlechter Mischungsverhältnisse, bei dem sich der körperliche Zustand mit Angst und Niedergeschlagenheit vereint. Es sind die trockenen Typen, die, der Meinung des Hippokrates nach, verstärkt zu dieser Krankheit neigen, die mit dem Austrocknen und der Verdickung der Galle einhergeht, was auch jeweils unter dem Einfluss der Wetterverhältnisse und Jahreszeiten geschieht. In seiner medizinischen Abhandlung Über Luft-, Wasser- und Ortsverhältnisse schreibt er: »Wenn […] in dieser Jahreszeit [Sommer, L. F.] Nordwind herrscht, wenn sie regenarm ist und weder beim Erscheinen des Hundesternes noch bei dem des Arkturos Regen fällt, dürfte es wohl Menschen mit schleimiger Konstitution, denen mit feuchter Konstitution und den Frauen am meisten nützen, für die Menschen mit galliger Konstitution aber ist dies am schädlichsten; dann werden sie allzu trocken, und es treten bei ihnen trockene Augenentzündungen und akute sowie lange Zeit anhaltende Fieberanfälle auf, bei manchen aber auch Melancholie (μελαγχολία)«.5 Obwohl also diese, nämlich die Melancholie, eine durch die Galle erzeugte Krankheit, also körperlichen Ursprungs ist, wirkt sie sich in dem beschriebenen Fall auch auf das Gemüt aus. In dem 3. Buch seiner Epidemien behandelt Hippokrates die Melancholie körperlichen Ursprungs als gestörten Seelenzustand: Die untersuchte, erkrankte Frau leidet unter erhöhtem Schlafbedürfnis, Appetitlosigkeit und schwindenden Kräften, »ihr Gemütszustand ist melancholisch«6 (τὰ περὶ τὴν γνώμην μελαγχολικά). υώμη bedeutet gleichermaßen Gemüt, Sinn, Vernunft, Verstand, Geist, Gefühl, Neigung, Einsicht – all diese Bedeutungen sind in diesem einzigen griechischen Wort enthalten, diese Kargheit an Begriffen erinnert uns an einen relativen Reichtum: Man kann diese Fähigkeiten der Seele und des Geistes nicht verschiedenen Bereichen zuordnen, denn sie repräsentieren eine Einheit in der Seinsanschauung und dem Seinsverständnis, wenn auch im Verborgenen fest mit der vielschichtigen Welt des Körpers verwoben. Das Gemüt und die Gestalt, der Geist und der Körper, und die Melancholie ist ihre Krankheit, υώμη und κρᾶσις: die Einheit der Seele und die auch den körperlichen Zustand bestimmende Vermengung der kosmischen Elemente. Das Sichauflösen und das Erkranken dieser Zweiheit ist die Melancholie – gibt es eine ärztliche Anschauung, die großzügiger und mutiger wäre? Ihr Ursprung ist körperlicher Natur1 (Hippokrates erzählt, dass Demokrit, der nicht nur melancholisch war, sondern über diese Krankheit angeblich auch ein Buch verfasst hat, als er ihn besuchte, gerade ein Tier seziert habe, um den Sitz der Melancholie zu finden), ihre Folge aber weitgehend geistiger Natur. Und umgekehrt: Der Ursprung ist, da körperlich, zugleich kosmisch und übermenschlich (ein Ergebnis des Zusammenspiels von Wind, Land, Jahreszeit und Himmelsrichtung und sogar von Kometen und Sternen), doch zeigt sich die Wirkung im Geistigen und schlägt sich in der von jeder anderen unterschiedenen, unvergleichlichen und sich niemals wiederholenden seelisch-geistigen Individualität nieder. Die Melancholie als Krankheit ist, so Hippokrates, daher das Ergebnis einer Art von Entgleisung, das Gleichgewicht von Mikro- und Makrokosmos hat sich verlagert, die Ordnung (der Kosmos) hat sich gelockert, es hat sich eine Störung eingestellt, und die betreffende Person ist nicht mehr in der Lage, den untrennbaren Gesetzen des Alls und des eigenen Schicksals zu gehorchen. Solcherart spricht Hippokrates einmal von den Melancholikern als den aus sich selbst Heraustretenden, sich in Ekstase Befindlichen, und die Verwendung des medialen, reflexiven Verbes (ἐξισταμένοισι) deutet auf tief greifende Beobachtungen hin: Das Subjekt ist nicht nur einem ihm selbst fremden Willen ausgeliefert, sondern auch Gegenstand seines eigenen Handelns. Der Melancholiker: Er steht außerhalb der gewohnten Gesetze des Lebens, doch das Schicksal, das es so gewollt hat, ist auch sein Schicksal; sein Leben, sein Verhältnis zum Schicksal, bestimmt seinen Zustand (seine Krankheit) mindestens ebenso wie der von ihm nicht überprüfbare Kosmos. Doch sind dies nicht mehr die Worte des Hippokrates – in seiner Welt der aus sich heraus selbstverständlichen Erscheinungen wäre eine Ausführung dieser Gedankengänge fast schon verdächtig gewesen.
Dem am Anfang unseres Gedankengangs stehenden Aristoteles-Zitat haben wir uns ein wenig genähert. Die Melancholiker sind herausragend, sagt der Philosoph, und dies knüpft an die hippokratische Vorstellung an: Wer melancholisch ist, der leidet an alles überschreitenden und sich auf alles erstreckenden Gleichgewichtsstörungen. Hippokrates betrachtet die Melancholie als Krankheit,2 Aristoteles als solch einen erhabenen Zustand, in dem der Kranke zur Hervorzauberung gesunder, den Zeitgeist überdauernder, jeden mit sich reißender Werke in der Lage ist. Aristoteles geht, getreu der hippokratischen Tradition, von der Beobachtung des Körpers aus: Auch er hält einen Überschuss an schwarzer Galle im Vergleich zu den anderen Körpersäften für ungesund, doch als ausschlaggebende, beeinflussende Kraft sieht er die Temperatur der schwarzen Galle an. Derjenige, in dem sich die schwarze Galle allzu sehr erhitzt, ist unbegründeterweise überfröhlich, er wird guter Laune (daraus resultiert auch die aus der Antike stammende Vorstellung einer Beziehung zwischen Melancholie und Manie); bei dem aber, bei dem diese Temperatur zu sehr sinkt, zeigt sich Niedergeschlagenheit und Traurigkeit. Für den Melancholiker als Typ ist bezeichnend, dass sich die Temperatur der Galle auf ein Mittelmaß beschränkt (πρός τὸ μέσον), da er aber demzufolge ein Typ des Mittelmaßes ist, ist er gesund, und da sich in ihm Wärme und Kälte optimal vermengen, ist er zu vielerlei befähigt – er kann in der Politik, in der Kunst, in der Philosophie, in der Dichtkunst Bedeutendes vollbringen, doch befindet er sich wegen der möglichen Erwärmung bzw. Abkühlung der schwarzen Galle zugleich in beständiger Gefahr. Für den melancholischen Menschen ist also ein immerwährender, außerordentlicher Zustand bezeichnend: Einerseits gibt es in ihm ein Übermaß an schwarzer Galle, und das scheint im Verhältnis zu der durchschnittlichen Verteilung der anderen Körpersäfte ungesund zu sein, andererseits ist aber gerade auch in diesem Zustand des Überschusses ein Mittelmaß, das heißt die Gesundheit als Möglichkeit, gegeben. Für die Säfte ist eine schlechte Mischung (δνςκρασία) bezeichnend, für die Temperatur aber die gute, richtige Vermengung (εὐκρασία), das heißt, das Beisammensein von Mittelmaß und Äußerstem charakterisiert den Typ des Melancholikers. Beides schließt sich nicht aus. So steht in der Nikomachischen Ethik zum Beispiel (in einem anderen Zusammenhang): »[D]er Hochsinnige stellt sich durch das hohe Maß der Selbsteinschätzung auf steile Warte. Insofern dieses Maß jedoch ein richtiges ist, trifft er die Mitte«.7Und ebenfalls Aristoteles ist es, der über das Himmelszelt schreibend bemerkt: »Das Äußerste und der Mittelpunkt sind seine Grenzen«.8 Und ob den Melancholiker eigentlich nicht das charakterisiert, was zugleich Äußerstes und Mittelpunkt ist? Doch bedeutet dies bei Weitem keine unbedingte, friedliche Harmonie: Das Auf und Nieder zwischen den beiden schafft das Gleichgewicht, welches das Zustandebringen von großen Werken und Taten ermöglicht, doch dieses Schwanken macht auch ein beständiges Überschreiten der Grenzen unvermeidlich, ohne das große Werke und große Taten ebenfalls unvorstellbar wären. Die Ordnung des Kosmos wird so vom Melancholiker in einer beständigen Verletzung dieser Ordnung erahnt. Wer daher ein Melancholiker ist, ist keinesfalls eine durchschnittliche Persönlichkeit – aber auch seine Überdurchschnittlichkeit bedeutet nicht, dass er krank sei, ganz im Gegenteil: Wenn man so will, ist er zu gesünderem Leben fähig als der Durchschnitt. Die Kriterien dieser »herausragenden Gesundheit« (vom Standpunkt der Nüchternheit her gesehen: Krankheit) sind jedoch andere als die der durchschnittlichen Gesundheit.
Außerordentliche Persönlichkeiten sind die Melancholiker: Doch was ist es, worin sich diese Außerordentlichkeit zeigt? Darauf gibt Aristoteles keine Antwort, benennt jedoch einige sich allgemeiner Bekanntheit erfreuende Persönlichkeiten, die er für Melancholiker hält: Aias, Sohn des Telamon, Bellerophontes, Herakles, Empedokles, Platon, Sokrates und Lysander. Die drei Erstgenannten sind Helden der griechischen Mythologie, die nächsten drei Philosophen, und der Letztgenannte ist Politiker (Staatsmann). Worin sie gleich auf den ersten Blick übereinstimmen, das ist die übermenschliche Leistung, die sie vollbracht haben. Die Aufgaben von Herakles sind bekannt; ebenso die Gedankenwelten von Platon, Sokrates und Empedokles. Lysander hat den höchsten Gipfel der Macht erklommen, der zu seiner Zeit erreichbar war, Bellerophontes von Korinth hat über die Chimaira, die Solymer und die Amazonen den Sieg errungen. Aias aber, der Sohn des Telamon, König von Salamis, war einer der stärksten, ausgezeichnetsten Krieger des gegen Troja kämpfenden Heeres. Gemein haben sie die Größe, den Heldenmut, die Außerordentlichkeit – aber nicht nur das: Ihre Überdurchschnittlichkeit zeigt sich auch an den Schattenseiten ihrer Lebensläufe.
Aias erhielt noch in seiner Kindheit von Herakles die Gabe der Unverwundbarkeit. Nachdem man ihn aber, seinem Gefühl nach unrechtmäßig, der Waffen des gefallenen Achilles beraubt hatte und sie dem verschlagenen Odysseus zukommen ließ, wurde sein Geist verwirrt. Er schwor sich gegen die Griechen Rache, aber Athene trübte sein Augenlicht, und statt unter seinen Kameraden richtete er unter den in der Nähe weidenden Schafen ein Blutbad an. Als er wieder zu sich kam, war er außerstande, diese Schande zu ertragen, und beging Selbstmord. Aias, »den gefangen hält ein unnahbares Schicksal«,9 so Sophokles, trug die menschliche Natur in sich, doch war diese nicht das Maß seiner Sehnsüchte. Als stärkster Krieger übertraf er alle; wies Athenes Hilfe, darauf vertrauend, dass ihm das Kampfesglück aus eigener Kraft heraus hold sei, zurück. Diese Kraft, das herausragende Heldentum, isolierte ihn aber auch von den anderen; daher der Spott, den sie ihm angedeihen ließen, das Unverständnis, das ihn umgab. Es war nicht sein Verstand, sondern seine körperliche Kraft, die ihn berühmt gemacht hatte, und dennoch, der Überschwang an körperlicher Kraft hat ausgereicht, dass »einsam weidend in seinem Sinn«,10 wie er war, irgendetwas ihn leicht erschüttern und zu Fall bringen konnte. Denn »er liegt da, krankend an düsteren Stürmen«,11 sagen die Kameraden über den nun im Wahnsinn wütenden Aias, der, wieder zu sich kommend, erkennt, dass seine Welt unrettbar erschüttert worden ist: Die körperliche Würde vereint sich hier mit Nichtigkeit. (Ist es denn nicht als Schwäche anzusehen, wegen irgendwelcher Waffen verrückt zu werden?) Doch ist die geistige Schwäche auch ein Zeichen der Maßlosigkeit: Wer so sehr Sehnsucht empfinden kann und auch so sehr in Aufruhr zu geraten vermag, dass ihn der Wahnsinn packt, der muss auch die gewohnte Ordnung der Welt für nichtig halten. Seine Ehre hat er nicht nur gegenüber den Menschen verloren, sondern auch den Göttern gegenüber, die den Wahnsinn auf ihn herabließen. Aus Aias Sicht kann man seinen Zustand aber auch so verstehen, dass die Menschen für ihn im selben Maße aufgehört haben zu existieren, wie sie für ihn an Wichtigkeit verloren haben, und so auch die Götter. Legen wir ihm die Worte des Sophokles in den Mund: »Bin ich doch nicht mehr wert, / Weder zu der Götter Geschlecht noch dem / Der Tageswesen nach Hilfe zu schauen, der Menschen«.12 Er hat seine Beziehungen zur irdischen wie zur göttlichen Welt verloren, er befindet sich außerhalb des Alls. Εκστατικὸς ἐγένετο, sagt Aristoteles; einen ekstatischen Zustand erlangend, gelangt er aus sich selbst heraus. Die innere Störung, die mit einer Auflösung der Weltordnung einhergeht, treibt ihn zum Selbstmord.
Dasselbe gilt für Bellerophontes von Korinth. Seine Heldentaten haben ihn dazu ermächtigt, sich selbst als über-allemstehend zu betrachten. Die Folge war, dass er an der gegebenen Ordnung des Lebens zu zweifeln begann: Wer die alltäglichen Gesetze der Welt überschreitet, empfindet unweigerlich Neugier auf weitere Grenzen und unbekannte Gesetze. Bellerophontes begann, da ihm garantierte Gültigkeit und Sinn der Welt abhandengekommen waren, an den Göttern zu zweifeln. »Und da behauptet man, im Himmel lebten Götter? Dort leben keine, keine –«,13 legt Euripides ihm in seinem Dramenfragment Bellerophontes in den Mund. Mit seinem Pferd, Pegasus, steigt er gen Himmel, um den Göttern auf die Spur zu kommen, doch gelangt er nicht bis zu ihnen: Die Götter stoßen ihn zur Erde zurück. Über die Gewissheit des einfachen Glaubens hinaus sind die Götter nicht nur unnahbar, sondern auch grausam. Bellerophontes stürzt auf die Erde zurück, und das Bewusstsein von der Sinnlosigkeit des Seins nimmt in ihm überhand: »Aber nachdem auch jener den Himmlischen allen verhaßt ward, irrt’ er einsam umher, sein Herz abzehrend3 im Kummer, durch die aleische Flur, der Sterblichen Pfade vermeidend«,14 berichtet Homer, und das Wörtchen »auch« deutet an, dass Bellerophontes das Opfer irgendeiner fürchterlichen Gesetzmäßigkeit geworden ist. »Ein Gelüsten, das die Gebühr übertritt, das endet bitter«,15 schreibt Pindar mahnend. Die tief liegende Verzweiflung treibt ihn zwar nicht in den Selbstmord wie Aias, doch sein Ausgestoßensein kommt dem Tode gleich. »Ich glaube, was in aller Munde ist: Gar nicht geboren sein – das Beste ist es für den Menschen«.16 Der Chor im Ödipus auf Kolonos spricht die gleichen Worte (was später Kierkegaard mit Vorliebe zitieren wird): Am glücklichsten ist, wer gar nicht geboren wird. Das Menschenleben ist zum Misserfolg verdammt, und der Misserfolg stellt sich nicht ein, denn er ist pausenlos und fortwährend gegenwärtig. Bellerophontes spricht von jenen, für die »menschlich ist, was wir erleiden«,17 von jenen, die zwei Leben leben: das Leiden und dasjenige, welches sich darüber im Klaren ist. Der Mensch leidet nicht nur darunter, dass er Mensch ist, sondern auch darunter, dass er auf sein eigenes Menschsein herabblickt. Heldenmut und Niedergeschlagenheit zeigen sich im selben Menschen an, und ein Zweifel kommt auf; ob die Niedergeschlagenheit und der unrettbare Misserfolg, das Gefühl der Sinnlosigkeit Bellerophontes nicht darum mit sich gerissen haben, weil er zu herausragenden Taten geboren worden war?
Leiden und Tod des Herakles scheinen dies zu bekräftigen. Der von einer irdischen Mutter und einem göttlichen Vater abstammende Herakles ist eine der eigenartigsten Figuren der griechischen Mythologie: Er ist zugleich sehr menschlich und übermenschlich, sodass sein Auf-sich-allein-gestellt-Bleiben fast schicksalhaft anmutet. Er hat keine Freunde, keine Verbündeten; seine Feinde verlieren sich im Dunkel, so wie sich auch seine Frau und seine Kinder in den Hintergrund zurückziehen. Herakles steht wie eine Statue vor uns, in solchem Maße beziehungslos, dass er alles beherrscht, wo immer er erscheinen mag. Er macht die Wirklichkeit, die Welt unglaubwürdig; dort, wo er geht und seine Taten ausführt, verändert er sie märchenartig und hält das ganze Sein wie unter Zauber gebannt.4 Die zwölf Heldentaten muten selbst in der an sich schon an Märchen erinnernden Mythologie märchenhaft an: Die fest stehenden Grenzen des Seins fallen hier in sich zusammen, und im Vergleich zur fantastischen Atmosphäre der Heldentaten erscheinen die übrigen Erzählungen der Mythologie fast prosaisch. Das Lebenselement des Herakles ist die Grenzenlosigkeit: Nichts ist ihm unmöglich, und er kommt darauf (was die irdischen Menschen nicht zu ihren Erfahrungen zählen können), dass auch in der ihn umgebenden Welt alles möglich ist. Die kristallartig begrenzte, denkmalartig abgerundete Figur erweckt deshalb ein Gefühl der Unendlichkeit: Es scheint, als ob sich Raum und Zeit nach seinem Willen verhalten würden. Doch seine Kraft ist zugleich seine Schwäche: Seine Kraft, nicht nur seine physische, sondern auch seine »weltschöpfende« Macht, verdankt er dem Umstand, dass er kein Mensch, aber auch kein Gott ist, sondern ein Mittelding, ein in beiden Welten verankertes Wesen.5
Doch bedeutet das auch, dass er nirgendwo richtig zu Hause ist. »Nicht lebenswert ist heut wie immer schon mein Dasein«,18 sagt er, und das sind Worte der euripideischen Tragödie, die eines Heros unwürdig zu sein scheinen; wo dann aber auch noch Folgendes zu lesen ist: »Wer stets in Unglück weilt, der leidet nicht, dem ist sein Elend wohl vertraut«.19 Die metaphysische Heimatlosigkeit lässt sich nicht beenden. (Als Odysseus in die Unterwelt hinabsteigt, trifft er dort nur auf den Körper von Herakles, seine Seele nämlich ist in göttliche Regionen gelangt, das heißt, die Heimatlosigkeit, die Zerrissenheit findet selbst im Tode kein Ende.) Da es keinerlei Anhaltspunkte gibt, mittels deren man die Welt ergreifen und heimatlich gestalten könnte. Von woher auch ausgehen, wohin auch gelangen? Von all dem ahnt Herakles anfänglich gar nichts; wahrscheinlich erscheint das Schicksal erst vor seinen Augen, als er sich, vor seinem Abstieg in die Unterwelt, in die Mysterien von Eleusis einweihen lässt. Die einander ergänzenden Begriffe von Leben und Tod, das schicksalhafte, sich in die Grenzenlosigkeit vertiefende Vergessen, die Beklemmung in der Endlichkeit erscheinen hier das erste Mal vor ihm, und wahrscheinlich ist es diese Anschauungsweise höherer Ordnung, die er sich solcherart aneignet, die für die endlich-irdischen Wesen eine Öffnung fantastischen Ausmaßes bedeutet und die ihm jenen niemals mehr aufzuhebenden Bruch offenbart, den er seinem menschlich-göttlichen, sterblichen und ewigen Charakter verdankt. Nach seiner Rückkehr aus der Unterwelt beginnt man ihn auch bei dem Namen Charops zu nennen (dieses Namenszeichen ist jenem des Charon verwandt), was nun auf den unerwartet fürchterlichen Charakter des veränderten Herakles hinweist. Und jener Wahnsinn, der, der Einweihung in die Mysterien und dem Ausflug in die Unterwelt folgend, Besitz von ihm ergreift und der, als äußere Kraft, ihn seine eigenen Kinder hinrichten lässt, unterscheidet sich nicht vom Wahnsinn des Bellerophontes und des Aias. »Warum Zeus hast du solchen Groll auf deinen Sohn gefaßt, in solch ein Meer des Jammers ihn getrieben«,20 fragt der Chor, dem Geschehen verständnislos gegenüberstehend, im euripideischen Drama Herakles. Τὸ κακόν bedeutet neben Jammer und Gram bzw. Schwermut und Trübsinn auch Ungeeignetheit, Schwäche, das im moralischen Sinne Schlechte, Würdelosigkeit, Armut, Leiden, Elend und Unglückseligkeit. Τὸ κακόν ist nichts anderes als die jedes bezugnehmenden Vergleichs ermangelnde Nichtentsprechung. Je mehr der Mensch diesem Umstand ausgeliefert ist, desto weniger sieht er sich in der Lage zu erkennen, was dasjenige war, in Bezug auf das er gefehlt hat. »Wenn du dein Inneres öffnest, wirst du eine buntgefüllte und leidensvolle Vorrats- und Schatzkammer von Übeln (κακῶν) finden«,21 sagt Demokrit. Der Schatz, auf den er da trifft, ist sein nicht wiedergutzumachendes Verurteiltsein zu Fehlschlägen, die mit der Zeit immer schwerer wiegen. Das Meer, in das Herakles versinkt, ist im Endeffekt der Entzug von etwas überhaupt, das Meer des Mangels. Der Wahnsinn und das vom Wahnsinn hervorgerufene Leiden werden erstaunlicherweise dadurch vertieft, dass das alles überwölbende Gefühl des Mangels die Krönung dieser alles überragenden, vollkommenen Heldentaten ist. Der Wahnsinn ist die Belohnung für die alles übertreffende Außerordentlichkeit und für das Herausragen6 – zumindest scheint die Lebensgeschichte dieser drei Heronen dies zu beweisen.
Die Haltung, Wahnsinn und Melancholie in eine verwandtschaftliche Beziehung zu bringen, schließt den Problemkreis in unserer heutigen, voreingenommenen Zeit der klinischen Psychiatrie und Psychologie scheinbar kurz. Der Wahnsinn ist im vorliegenden Fall aber auch ein Teil der mythologischen Erzählungen, und wie das Ganze des Mythos, so haben auch seine einzelnen Teile tiefer gehende Bedeutung, als die traditionelle Anschauung es auf den ersten Blick annehmen möchte. Der Mythos lässt sich nicht enträtseln, höchstens endlos rationalisieren – wir sollten nicht zögern, ihn auf unsere eigene Situation zu beziehen, die sich selbst nicht von einem Labyrinth unterscheidet und deren Grund keinesfalls fester ist als jener der Mythologie. Für den Begriff des Wahnsinns trifft dasselbe zu. Verantwortlich für den Wahnsinn ist die Göttin Lyssa – sie ist es, die den Wahnsinn in den Geist des Herakles gesät hat. Die Mutter von Lyssa ist die schwarze Nacht, ihr Vater Uranos, und dieser Stammbaum zeigt, dass der Wahnsinn in einem größeren Zusammenhang zu sehen ist. Uranos ist der Gott des Himmels, so lässt sich der Wahnsinn väterlicherseits bis zum Anbeginn des Seins zurückführen. Mütterlicherseits stammt er aus der Nacht, aus dem Reich der unsichtbaren Dinge. Die Nacht hatte bei den Griechen nicht die Funktion, Dinge zu verdecken, wie die Welt des Traumes, sondern sie hat auch das Unsichtbare sichtbar gemacht.7 Nachts eröffnet sich eine neue Welt: Diese ist aber nicht irgendeine erträumte Vorstellung der Welt der Träume, sondern steht auch mit der Welt des Tages in Beziehung. In der kurzen Abhandlung Das Hellsehen betreffs des Schlafes gibt Aristoteles jener verbreiteten griechischen Vorstellung Raum, gemäß welcher sich im Traum vor dem Träumenden Grundwahrheiten offenbaren. Die Nacht ermöglicht das Gewahrwerden unsichtbarer Dinge, und daraus folgend auch das Wahrsagen. Das Weissagen ist damit dem Wahnsinn verwandt, und das findet auch im Geist der Sprache seinen Beweis: Die Worte »wahrsagen« (μαντεύω) und »im Wahnsinn wüten« (μαίνομαι) gehen auf einen gemeinsamen Stamm zurück. (Zunächst möchten wir nur kurz darauf verweisen, dass Aristoteles mit der Nacht auch die Melancholie in Verbindung gebracht hat;8 aber das lag sowieso auf der Hand: Der Kontext der im Wahnsinn wütenden und melancholischen Heroen, aber auch der noch im Detail abzuhandelnde Zusammenhang von Melancholie und Weissagen bot von jeher an, die Nacht und die Melancholie in eine innere Beziehung zu bringen.) Der Stammbaum des Wahnsinns verzweigt sich daher: Er lässt sich väterlicherseits bis zum Beginn des Daseins, mütterlicherseits bis in das Reich der unsichtbaren Dinge zurückverfolgen. So durfte Platon mit Recht sagen, »daß auch unter den Alten die, welche die Namen festgesetzt, den Wahnsinn nicht für etwas Schändliches oder für einen Schimpf hielten«,22 und an gleicher Stelle fuhr er fort: »[E]r [der Wahnsinn, L. F.] sei etwas Schönes, wenn er durch göttliche Schickung entsteht«.23 Der Wahnsinn ist eine göttliche Gabe, zumindest dann, wenn er in den oben genannten Zusammenhang hineinpasst. Platon selbst schreibt auch über jenen Wahnsinn, welcher nicht als göttliche Gabe, sondern als Vernebelung des Verstandes vom Menschen Besitz ergreift; und wie er in der Liebe zwischen dem göttlichen, dem maßvollen und dem hemmungslosen, unbändigen und zügellosen Eros unterscheidet, so vollzieht er diese Aufteilung auch beim Wahnsinn. Zugleich – und es lohnt sich, dabei einen Moment zu verweilen – hält er gerade die Melancholie für eine Form des irdischen und vernebelnden Wahnsinns. Im Timaios24 behandelt er die Leiden der Seele im Detail und gelangt dabei, ohne sie namentlich zu erwähnen, auch zu einer Bestimmung der Melancholie. In der Politeia25 und im Phaidros26 nennt er die Melancholie bzw. den Melancholiker beim Namen und verwendet die Begriffe in beiden Fällen im Sinne des erdgebundenen Narren. Der Begriff der Manie, des Im-Wahnsinn-Wütens, führt aber in die außerirdische Welt: Das von den Göttern auf uns Niedersinkende erlaubt einen Einblick in die höheren Sphären des Seins: »[D]erjenige, der bei dem Anblick der hiesigen Schönheit, jener wahren sich erinnernd, neubefiedert wird und mit dem wachsenden Gefieder aufzufliegen zwar versucht, aber unvermögend ist, nur wie ein Vogel hinaufwärts schauend, was drunten ist, jedoch gering achtend, beschuldigt wird seelenkrank zu sein«.27 Diese platonische Zweiheit des göttlichen, in den Himmel lockenden Wahnsinns und des dem Menschen an die Erde bindenden Wahnsinns (Melancholie) hat Aristoteles aufgehoben; die metaphysisch angehauchte Manie hat er mit naturwissenschaftlichem Sinn versehen, den Begriff aber des ärztlich zu verstehenden, aufgrund der körperlichen Symptome zu erklärenden Wahnsinns, der Melancholie, hat er ausgeweitet. Er hat die metaphysischen Eigenheiten der Manie mit den bezeichnenden Merkmalen der Melancholie vereint und hat damit einem völlig neuen Melancholiebegriff den Weg geebnet. Die Melancholie körperlichen Ursprungs verdankt es bei Aristoteles der metaphysischen Beziehung, dass man den Zustand des Herausragens und den der Außerordentlichkeit mit ihr begründen konnte. (Im Verlauf des Mittelalters werden wir Zeuge, wie die metaphysischen Merkmale zunehmend abgebaut werden und erst im 15. Jahrhundert bei Ficino ihre aristotelischen Rechte zurückerhalten.) Für die Melancholie sowie für den Wahnsinn ist die Ekstase, das Aus-sich-selbst-Heraustreten im weiteren Sinne des Wortes, eine Neuschöpfung der Seinsgesetze bezeichnend; zur Zeit des Aristoteles hat man das Verb »wüten« sogar in Verbindung mit der Melancholie verwendet. So wird der Wahnsinn der drei Helden zur Quelle ihrer Melancholie; doch ist der Wahnsinn – und das Ganze des Lebens jener drei Helden beweist dies – nicht an sich Ursache der Melancholie. Dazu gehört auch das Vollbringen großer Taten, das Vollstrecken übermenschlicher Handlungen, das Besiegen der Mächte des Dunkels. Die Helden sind nicht deshalb Melancholiker, weil sie wahnsinnig sind, und nicht deshalb, weil sie außerordentliche Kraft und Talente haben, sondern weil in ihnen beides voneinander untrennbar ist: Der Wahnsinn ist eine Folge der Außerordentlichkeit, ihre Außerordentlichkeit aber verdanken sie der Tatsache, dass sie die Möglichkeit des Wahnsinnigwerdens in sich tragen. Da ihre Außerordentlichkeit kein irdisches Maß hat, ist ihr Wahnsinn auch durch kein irdisches Heilmittel endgültig heilbar, es wäre sogar gerade ein solches Heilverfahren, das ihre wahre Vernichtung bedeuten würde.9 Ihr Wahnsinn hat uns das Tor zu einer neuen Welt eröffnet, und indem wir es durchschreiten, verliert die Einrichtung der irdischen Welt ihre Bedeutung, und vor uns erscheinen Horizonte, die alles Seiende in einem von Grund auf neuen Licht erblicken lassen. Über die Manie schreibt noch Platon: »Ebenso hat auch von Krankheiten und den schwersten Plagen […] ein Wahnsinn, der auftrat und vorhersagte, denen es not war, Errettung gefunden, welcher, zu Gebeten und Verehrungen der Götter fliehend und dadurch reinigende Gebräuche und Geheimnisse erlangend, jeden seiner Teilhaber für die gegenwärtige und künftige Zeit sicherte, dem auf rechte Art Wahnsinnigen und Besessenen die Lösung der obwaltenden Drangsale erfindend«.28 Die Melancholie, die bei Aristoteles (wie auch bei Hippokrates) untrennbar mit der Manie verbunden ist, befähigt die daran Teilhabenden, die allgemeinen Grenzen eines menschlichen Seins zu überschreiten, um sich den Forderungen des Alltags zu entziehen. Mit den Worten des Heraklit gesprochen, werden sterbliche Unsterbliche zu Erlebenden ihres Todes und zu ihrem Leben Sterbenden. Die Fesseln des Alltags lösen sich (die melancholischen Helden zweifeln sogar an den das Sein garantierenden Göttern), und (um uns hier der platonischen Ausdrucksweise zu bedienen) sie werden zu Beobachtern und Erleidenden des »Werdens zur Seinshaftigkeit«,29 das heißt des beständigen Wechsels von Sein und Nichtsein.
Das erklärt die von den Alten beobachtete und aufgezeichnete, erstaunlich genaue Befähigung zur Weissagung seitens der Melancholiker. In der erwähnten Schrift lenkt Aristoteles unsere Aufmerksamkeit darauf, dass Melancholiker mit erschütternder Genauigkeit weiszusagen vermögen; in seinen jungen Jahren, als er noch an den göttlichen Ursprung der Träume glaubte, brachte er dies auch mit dem Schlaf in Zusammenhang: Die Melancholiker haben verschwimmende Träume, und sie werden von Vorstellungen wie die Fieberkranken gequält – doch werden uns durch sie tiefere Zusammenhänge des Seins eröffnet. Den Wahrsager muss man sich deshalb nicht im heutigen Sinne als jemanden vorstellen, der in der Gegenwart stehende Aussagen zu irgendwie beschaffenen Ereignissen der Zukunft macht, sondern als einen Menschen, der außerhalb der Zeit an sich steht. Über Kalchas, den Wahrsager, schreibt Homer: »Wieder erhub sich Kalchas, der Thestoride, der weiseste Vogelschauer, der erkannte, was ist, was sein wird oder zuvor war«.30 Für Kalchas besteht kein entscheidender Unterschied zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft: Wer sich über alles im Klaren ist, der hört und sieht alles gleichermaßen,10 das heißt, die Bedeutung der Zeit wird für ihn zweitrangig. So verkündet Xenophanes, dass auch die Zeit Teil des Scheinmeinens und der Welt der Doxa sei, die die Wahrheit erkennende Vernunft aber sei der Zeit nicht ausgeliefert: Im Verhältnis dazu, dass etwas war oder sein wird, ist es unvergleichlich wichtiger, dass es Teil des Zeit schaffenden Seins ist. Denn das Sein, das IST (ἔστιν), ist das, was nach Parmenides »ungeboren ist […] auch unvergänglich, denn es ist ganz in seinem Bau und unerschütterlich sowie ohne Ziel und es war nie und wird nie sein, weil es im Jetzt zusammen vorhanden ist als Ganzes, Eines, Zusammenhängendes«.31 Jenseits der Welt des Scheins findet der Wahrsager seine Heimat; dort, wo er kein Gefangener irgendwie gearteter grammatikalischer Zeiten ist und wo er deshalb die durch die Zeit gebildeten Grenzen der Dinge ungestraft überschreiten darf. Der Wahrsager bewegt sich frei in Raum und Zeit; statt auf Meinungen und Aberglauben richtet sich sein Augenmerk immer auf die Wahrheit, die sich nicht nur auf Wirkung seines Blicks hin auftut, sondern die es ohne diesen Blick eigentlich gar nicht gäbe. Als ob das Wort des Wahrsagers direkt aus dem Inneren des Seins hervorbräche. Nicht umsonst hielt man das Orakel von Delphi für den Nabel der Erde, an dem jeder Sterbliche erfahren konnte, was ist und was sein wird. Dieser Nabel aber ist der Sitz des Auserwählten, den sowieso nur derjenige zu erkennen vermochte, den die Götter für würdig hielten. »Denn weder war mitten auf der Erde ein Nabel«, schreibt Epimenides, »noch auf dem Meere; wenn es einen gibt, so ist er nur den Göttern offenbar, den Sterblichen aber unsichtbar«.32 Man muss zum Gott werden, um den Nabel erblicken zu können; ein Auserwählter der Götter zu werden, ist die Voraussetzung dafür, auf dem Nabel sitzend wahrsagen zu können. Deshalb sind die Wahrsager geheimnisvoll und furchterregend, so wie die Sibylle, die, wie Heraklit schreibt, »mit rasendem Munde Ungelachtes und Ungeschminktes und Ungesalbtes redet […]. Denn der Gott treibt sie«.33 Das Wüten ist die Manie, die den Wahrsager emporhebt; und im Verlaufe dieses Emporgehobenwerdens entfaltet sich die Wahrheit der zurückgelassenen irdischen Welt. Sie nimmt die Form »gottbegeisterter Weissagungen […] göttliche[n] Gesicht[s] oder Wort[es]«34 an, schreibt Platon. Doch es erhebt sich ein Zweifel, ob das nicht nur deshalb, weil die erkannte Wahrheit das Geheimnis selbst ist, möglich sei. Der Wahrsager überschreitet die Grenzen, und die restlose Fremdheit nimmt in seiner Persönlichkeit Gestalt an. Und da er selbst nicht Gott, sondern lediglich göttlich ist, wird die sich in ihm verkörpernde Fremdheit zur Quelle des Schmerzes. Aus diesem Grunde verfügt der wahre Weissager über einen doppelten Blick: Mit menschlichen Wörtern verkündet er die nichtmenschliche Wahrheit; er wird von Gott ergriffen, und dennoch ist er selbst es, der spricht; wegen seines menschlichen Schicksals ist er weniger als Gott, doch wegen seines göttlichen Wissens mehr als die Menschen – gleichsam wie der melancholische Herakles. Das Schicksal des Wahrsagers ist das Durchleben der vernichtenden Kraft, der Heimatlosigkeit, der Unfassbarkeit. »Dich heget ew’ge Nacht«,35 das sind des Ödipus Worte über den Wahrsager Tiresias, womit er sich nicht nur auf die erblindeten Augen des Wahrsagers bezog. Der Wahrsager hat an einer Erhellung teil, doch ist dieses Erstrahlen das Licht der Nacht. Platon hält den göttlichen Enthusiasmus für eine Quelle der Seherkraft; und daran anschließend schreibt Philon von Alexandrien das Folgende: »Immer wenn göttliches Licht erstrahlt, geht das des Menschen zur Neige […]. Das tritt bei der Art der Propheten ein […], sobald der göttliche Strahl erscheint (πνεύματος). Und wenn der von dannen zieht, erscheint erneut unserer; da es nicht gestattet ist, dass der Sterbliche mit dem Unsterblichen zusammenruhe. Darin liegt der Grund, dass das Zurneigegehen des Argumentierens (λογισμός), was von der Dunkelheit begleitet wird, die Ekstase und die göttliche Manie zeigt«.36 Philon stempelt die Melancholie als Krankheit ab; und dennoch: Er bringt die Ekstase nicht nur mit dem Enthusiasmus göttlichen Ursprungs in Verbindung, sondern auch mit der Melancholie, und macht damit den Zusammenhang zwischen der Fähigkeit des Wahrsagens und der Melancholie spürbar. In der Ekstase gelangt der Mensch aus sich selbst heraus, ohne auch nur eine Ahnung zu haben, woher das Hinaustreten kommt und wohin es führt. Wie könnte er auch, ist sie doch die Verdichtung des Augenblicks, jener xenophanisschen Zeit, in dem der Richtungen und Plätze einnehmende Raum, in dem die Zeit zu nichts zusammenschrumpft. Der Melancholiker empfindet sein Leben als aus einer Reihe solcher Augenblicke bestehend und legt, die Welt aus dieser Position heraus betrachtend, von seiner Fähigkeit des Weissagens Zeugnis ab. Aus dieser seiner eigentümlichen Position heraus versinkt er im Werden zur Seinshaftigkeit, von woher er zu uns spricht, die lediglich Beobachter dieses Vorgangs sind und ihn immer nur im Nachhinein, nach der Erstarrung einzelner Momente desselben zu deuten in der Lage sind. Für den Wahrsager ist dieses Werden kein Gegenstand, da er selbst darin versinkt, und auch das Sein selbst keine Anhäufung seiner Gebilde, sondern ein beständiges Verändern und Werden. Der Name des düsteren und geheimnisvollen Heraklit erscheint vor uns; desselben Mannes, der, wenn man Diogenes Laertios glauben darf, einen Teil seiner Werke aufgrund seiner Melancholie unvollendet und den Magikern und Wahrsagern große Verehrung zukommen ließ; jenen Heraklit, der die Zufälligkeit eindeutiger Dinge erblickte, den Kampf von Sein und Nichtsein verzweifelt erkannte und daran litt, können wir im tieferen Sinne des Wortes auch als Wahrsager bezeichnen. Da, wo er schreibt: »Für die Menschen wäre es nicht besser, wenn ihnen alles zuteilwird, was sie wollen«,37 legt er von seiner tiefen Begabung zum Weissagen Zeugnis ab, denn wer am Werden zur Seinshaftigkeit teilhat, der wird unvermeidlich zum Augenzeugen schicksalhafter Vergänglichkeit. Nicht jener Vergänglichkeit, die irgendwann einmal zur gegebenen Stunde eintritt, sondern jener beständig drohenden und jeden Moment unseres Lebens gestaltenden Vergänglichkeit. So schreibt Heraklit über die, die das Leben der Sterblichen und den Tod der Unsterblichen erleben: über die Relativität von Leben und Tod, über die Instabilität. Zum echten Weissagenden wird nicht der, der kundtut, was morgen ist, sondern der sagt, was jetzt ist; derjenige, der uns unser ureigenes Innerstes eröffnet, und jener, der uns unser sich irgendwann verwirklichendes Ich entgegenhält. Γνῶθι σεαυτόν steht auf der Fassade des Orakels von Delphi: Die Zukunft ist in uns, nicht außerhalb von uns; wir selbst machen das Kommende zur Zukunft, die Zeit zur Zeit, das heißt mit anderen Worten, wir sind nicht der Zeit, sondern einzig und allein uns selbst ausgeliefert. Über den echten Wahrsager wird der Bruder Leo folgende Lehre vom heiligen Franziskus empfangen: »[E]r könnte […] nicht nur künftige Dinge, sondern auch die Geheimnisse der Gewissen und Seelen kundtun«.38 Und aus diesem Grunde stellt Empedokles bei der Aufzählung der vier bedeutendsten menschlichen Berufe den des Wahrsagers an die erste Stelle, ihm folgen die Dichter von Hymnen, die Ärzte und die Herrscher – jene also, die auf ihre Art die Ausformung ihres gegenwärtigen Lebens und das Aufdecken seiner Gesetzmäßigkeiten als die Aufgabe ihres Lebens ansehen. Deshalb verwendet Platon das Verb wahrsagen (μαντεύω) im Zusammenhang mit der Dichtung und der Philosophie im Passiv: Mit der infinitiven Verbalform (μαντεύεσθαι) verweist er auf jene innere Begeisterung, jene innere Verklärung, dank welcher der Philosoph zur Aufdeckung der in der Tiefe verborgenen Wahrheiten, nicht der kommenden Ereignisse gelangt. Der Wahrsager ist in dem, worüber er spricht, mitenthalten, erleidet dasselbe und steht ihm nicht neutral, wie von außerhalb gegenüber,11 und deshalb ist er, besser als irgendein anderer, geeignet, ins rätselhafte Dasein, das für den alltäglichen Menschen eine jede Rätselhaftigkeit entbehrende Gegebenheit12 ist, zu schauen. Der Wahrsager (μάντις) ist nicht nur etymologisch, sondern auch schicksalsmäßig ein Verwandter des Wahnsinnigen (μανικός), der wiederum ein Zwilling des Melancholikers ist – diese engen Beziehungen zeigen, dass alle drei Teile eines Zusammenhangs sind, der in unserer Kultur schon in Vergessenheit geraten ist: Heute sehen wir den Wahrsager als Scharlatan, den Wahnsinnigen als geistesgestörten Kranken, den Melancholiker einfach als Trübsinnigen an.
Der Melancholiker steht im Grenzbereich von Sein und Nichtsein – solcherart haben wir bisher den Wahnsinnigen und den Wahrsager charakterisiert, und so können wir auch die melancholischen Heroen bestimmen. Der Fall des Bellerophontes zeigt aber, dass diese Grenzsituation den Melancholiker mit Wissen, Einsicht und Weisheit ausrüstet. Vergleichen wir dies mit dem, was wir über den Wahrsager und über den von den Göttern abstammenden Wahnsinn gesagt haben, dann dürfen wir dieses Wissen als ein tieferes betrachten und darin auch den Ursprung der Philosophie sehen. In einem in seinen Jugendjahren verfassten und uns fragmentarisch erhalten gebliebenen Dialog über die Philosophie verfolgt Aristoteles die Liebe zur Weisheit historisch bis zur urhellenischen Theologie, zu den orphischen Lehren und bis zu den persischen Magiern zurück und hält den Vorgang der Verinnerlichung der Philosophie für verwandt mit dem des Eingeweihtwerdens in die Mysterien (denken wir nur an Herakles, der infolge der Einweihung wahnsinnig, melancholisch – und tief blickend wurde), und ähnlich wie Platon bezeichnet er die in die Mysterien Eingeweihten als Philosophen. Wir haben gesehen, dass Platon der Verklärung der Wahrsager durch den Gebrauch des Verbes »wahrsagen« in der Passivform Ausdruck verleiht, und auch der junge Aristoteles betrachtet die Passivität als den für die Einzuweihenden bezeichnenden Zustand (das heißt derjenigen, die der Weisheit zugänglich sind und zur philosophischen Sicht vorbereitet werden sollen). »Jene, die eingeweiht werden, sollen die Dinge nicht aufgrund ihres Sinnes zu erfassen suchen (μαϑεῖν), sondern sich eine Art inneren Zustand zu eigen machen (μαϑεῖν)«.39 Das Pathos bedeutet gleichsam Leidenschaft, Schicksal, Leiden und Erleben – das heißt, im Gegensatz zu der Mathesis, zum Erkennen, meint es keine objektive, rationale Erfassung der Dinge (wobei der Ausdruck »rational« kaum dazu angetan ist, diesen Hergang zu charakterisieren), sondern die innerliche Vereinigung mit denselben, ihr Erleiden im weiteren Sinn des Wortes. Das Pathos, bzw. seine Ausübung, führt zu jener Erleuchtung, die bei Platon der Schlüssel zum Erblicken der Ideen, bei Aristoteles der zum tieferen Verständnis des Seins geworden ist (ἔλλαμψις). Der echte Philosoph ist daher auch ein Wahrsager, da ihn aber dadurch, dass er auch Wahrsager ist, gewisse Stränge an den Wahnsinn binden, ist er gleichzeitig ein Melancholiker. Auch er steht im Grenzbereich zwischen Sein und Nichtsein und ist, wie der Wahrsager Heraklit, gezwungen, immer wieder an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren: zur Negativität nämlich; die aber nicht das Gegenteil eines als positiv empfundenen Seinszustands darstellt, sondern das Sein selbst, die vollkommene, einzige Wirklichkeit ist. Ich weiß, dass ich nichts weiß – dieser Ausdruck des melancholischen Sokrates (denn auch ihn hielt Aristoteles für einen Melancholiker) ist nicht etwa eine Wortspielerei, sondern vielmehr ein Ausdruck der Ironie, der auf Bestürzung und Betroffenheit folgt. Und als er auf die Frage, ob es sich lohne, in den Ehestand zu treten, den Aufzeichnungen des Diogenes Laertios zufolge,40 antwortete: Egal was du auch tust, du wirst es bereuen, legte er wiederum von der tieferen Berufung des Philosophen Zeugnis ab: den Lernbegierigen an die Grenzen von Sein und Nichtsein zu verbannen, nicht, um ihn der Verzweiflung preiszugeben, sondern damit er mit sich selbst ins Reine komme. (Die teuflische Schlussfolgerung, dass wir gerade dann der Verzweiflung anheimfallen, wenn wir mit uns selbst ins Reine gekommen sind, ist schon das Werk der barocken Seinsauffassung bzw. des treuesten Sokrates-Schülers Kierkegaards.) »Was verdiene ich zu erleiden oder zu erlegen, weshalb auch immer ich in meinem Leben nie Ruhe gehalten, sondern unbekümmert um das, was den meisten wichtig ist, um das Reichwerden und den Hausstand, um Kriegswesen und Volksrednerei und sonst um Ämter, um Verschwörungen und Parteien, die sich in der Stadt hervorgetan, weil ich mich in der Tat für zu gut hielt, um mich durch Teilnahme an solchen Dingen zu erhalten, mich mit nichts eingelassen«.41(Aufzeichnungen über den anderen melancholischen Philosophen, Empedokles, zeigen ebenfalls, dass er die Freiheit liebte, jede Art der Macht verachtete und das ihm angebotene Amt des Königs zurückgewiesen hat.)
Der melancholische Sokrates, der besessene Erforscher der Wahrheit – sein Wahnsinn, seine Liebe zur Weisheit (Philosophie) und die daraus folgende schwere Melancholie erlauben es ihm, verborgendste Geheimnisse zu schauen. Der Vorwurf, den die Athener gegen ihn vorgebracht haben und der bei Sokrates folgendermaßen Niederschlag fand: »mich […] beschuldigt haben ohne Grund, als gebe es einen Sokrates, einen weisen Mann, der den Dingen am Himmel nachgrübele und auch das Unterirdische alles erforscht habe«,42 war im tieferen Sinne richtig: Hat Sokrates selbst nicht mehrmals betont, dass sein Geist (δαίμων) ihm immer das Kommende verkünde? Doch der Dämon, der sich erst viel später als böser Geist entpuppte, ist nicht nur für das Zukünftige verantwortlich, sondern auch Ursprung der Besessenheit – und Ursache seiner Melancholie ist vielleicht gerade diese nie endgültig geklärte Beziehung zur außerirdischen Welt. Dies führte bei Bellerophontes zum Wahnsinn, dieses unnahbare Schicksal verstörte Aias, und die Heimatlosigkeit des zwischen dem göttlichen und dem irdischen Sein Stehenden führte Herakles zuerst in den Wahnsinn, später dann auf den von ihm selbst errichteten Scheiterhaufen. Und dasselbe beunruhigte den sizilianischen Empedokles, dessen Name ebenfalls unter den von Aristoteles aufgezählten melancholischen Philosophen zu finden ist: »Denn sie [die Gottheit, L. F.] ist auch nicht mit menschenähnlichem Haupte an den Gliedern versehen, nicht schwingen sich fürwahr vom Rücken zwei Zweige, nicht Füße, nicht schnelle Knie, nicht behaarte Schamglieder, sondern ein Geist, ein heiliger und übermenschlicher regt sich da allein«.43 Dies war es, was den Geist des Bellerophontes vernebelte, und auf seine Art ist auch Empedokles als Besessener zu betrachten, der zwar nicht an den Göttern zweifelte, ihr Sein aber so weit auflöste, dass er gezwungen war, den Pfad in Richtung Mystik einzuschlagen. Er selbst rief sich zum Gotte aus, der als Sühne seiner im früheren Leben begangenen Sünden lange Zeit außerhalb der Welt der Götter, auf dem mühseligen Pfad des Lebens wandelnd, verweilen musste: »[M]ehr bin [ich] als die sterblichen, vielfachem Verderben geweihten Menschen«:44 unsterblicher Gott (Θεός ἄμβροτος), der sich über alle Rätsel des irdischen Lebens im Klaren und diese aufgrund seines Wissens von außen zu betrachten in der Lage ist: »Denn engbezirkt sind die Sinnes Werkzeuge, die über die Glieder gebreitet sind; auch dringt viel Armseliges auf sie ein, das stumpf macht die Gedanken. Und schauten sie in ihrem Leben vom (All)leben nur kleinen Teil, so fliegen sie raschen Todesgeschicks wie Rauch in die Höhe getragen davon, von dem allein überzeugt, worauf jeder einzelne gerade stieß bei seinen mannigfachen Irrfahrten, und doch rühmt sich jeder das Ganze gefunden zu haben. So wenig ist dies für die Menschen erschaubar oder erhörbar oder mit dem Geiste umfaßbar«.45 Das Leben des Menschen ist ewiges Leiden: »O ewiges Geheimnis! was wir sind und suchen, können wir nicht finden; was wir finden, sind wir nicht«.46
Das sind schon Hölderlins Worte in seinem über Empedokles verfassten Drama, und wie die Heroen irrt auch Empedokles am Grenzrain jenseits des Menschseins, aber diesseits des Gottseins umher. Sein Wissen berechtigt ihn, über alles ein Urteil zu fällen, doch ist es gerade dieses Wissen, das ihn aus dem Rahmen des irdischen Seins verbannt hat: Wer alles durchschaut, dessen Heimat ist die Unendlichkeit oder, besser gesagt, die Heimatlosigkeit. Ob Empedokles, diese historische Figur, wirklich alles gewusst hat, bleibt als offene Frage stehen (seine Zeitgenossen meinten »ja«, und auch Lukrez schrieb später über ihn: »Ut vix humana videatur stirpe creatus«47 – als ob sein Vater kein Sterblicher gewesen wäre); wichtiger aber ist, dass er selbst in dieser Überzeugung gelebt hat. Diese Überzeugung aber reichte aus, dass ihm das gleiche Schicksal zuteilwurde wie den Heroen: Seine übermenschliche, außerordentliche Leistung (er war der ausgezeichnetste Arzt seiner Zeit), sowie die Zerklüftung seiner Seelenbereiche (er war Philosoph, das heißt Wahrsager, demzufolge Wahnsinniger bzw. Ekstatiker) sind voneinander nicht zu trennen. »So ward auch mir das Leben zum Gedicht«,48 legt ihm wiederum Hölderlin in den Mund, nicht ohne eine gewisse romantische Voreingenommenheit einer scheinbaren Abrundung gegenüber (denn was von außen gesehen als Dichtung erscheint, erscheint von innen her als eine Anhäufung prosaischer Zerrissenheit). Es gibt aber keine Abrundung: Auf dem Empedokles darstellenden Gemälde von Luca Signorelli im Dom von Orvieto scheint der die Sterne beobachtende Philosoph aus dem Bilde herauszufallen, womit die geschlossenen Regeln der Renaissance-Perspektive ziemlich zerstört werden. Das ist der Fall des Empedokles (natürlich auch bei Hölderlin), und er war es, dem sich Hölderlin verwandt fühlte, auch Novalis, und über den – und zwar in alle Maße entbehrender Prosa – Nietzsche eine Tragödie verfassen wollte. Seine Melancholie ist eine vielfach zusammengesetzte: Der Glaube an seine eigene Göttlichkeit machte ihn im platonischen Sinne zum Besessenen; die Erforschung der Vergänglichkeit führte ihn über die Grenzen des Seins hinweg: Seinem Schüler Pausanias vermittelte er, wie der Scheintote ins Leben zurückzuholen sei, und den Erzählungen des Herakleides Pontikos zufolge hat er viele Menschen aus dem Reiche Persephones zurückgebracht; an die Grenzen von Sein und Nichtsein gelangend, erhielt er Einblick in die Rätsel des Seins. Deshalb ist auch sein Tod kein alltäglicher: Wer das Leben und den Tod zu relativieren vermag, für den ist auch der Tod kein Tod als solcher, sondern eine Vervollkommnung. Nicht im christlichen Sinne, sondern dem griechischen Gedankengut entsprechend: Im Verhältnis zur Ausschließlichkeit des Seins werden Leben und Tod zweitrangig. Das Sein beansprucht uns auch jenseits des Todes; die Erkenntnis dieses Tatbestandes ist für den Menschen zugleich erhebend und niederschmetternd. Notwendigerweise sind uns auch über den Tod des Philosophen zwei Berichte überliefert worden. Dem einen zufolge haben ihn seine Genossen am Morgen nach dem Opferfest nicht mehr aufgefunden. Ein Diener berichtete ihnen, dass er gegen Mitternacht von der Stimme des Empedokles aufgeweckt worden sei und, sich von seinem Lager erhebend, ein loderndes, fackelartiges himmlisches Licht erblickt habe. Pausanias, der Schüler von Empedokles, habe dann das Rätsel entwirrt; die Götter hätten Empedokles zu sich gerufen, und er habe die Welt nicht als Mensch, sondern als Gott hinter sich gelassen. Dem zweiten Bericht zufolge haben die Götter Empedokles nicht zu sich gerufen: Er selbst habe seinem Leben ein Ende bereitet und sich, um seine Göttlichkeit zu beweisen, in den Krater des Ätna hinabgestürzt. Doch auch dieser Sprung hat seinen tieferen Sinn: Einerseits betrachteten die Griechen den Sprung in die Tiefe als eine Form der Ekstase und somit als einen schönen Tod (εὺJάνατος) (denken wir hier an die göttliche Verbindung von Melancholie und Ekstase), andererseits aber brachte das Verbrennen im Feuer Reinigung. Von der irdischen Schlacke wird der Sterbliche im Feuertod gereinigt (καJάρσιον πῦρ), und deshalb ist das Feuer auch die Bedingung zum Eintritt in ein Leben höherer Ordnung.13 Dem griechischen Denken gemäß sicherte der Feuertod des Herakles, der eine unvermeidliche Konsequenz seiner Melancholie war, ihm ebenso die Unsterblichkeit wie dem Philosophen Empedokles.14 So wird das Feuer zur Quelle eines Lebens höherer Ordnung: es ist Geist, Logos (Heraklit).15 Der selbst gewählte Feuertod des Philosophen Empedokles vollzog sich im Banne des »Auferstehens« und führte ihn aus jener irdischen Welt heraus, die für Platon Gefängnis, für Empedokles aber Hölle war. (So Schiller über den vergeistigten Herakles, der den Feuertod erlitt: »Er ist des Irdischen entkleidet.«) Dem Tode folgte aber nicht unbedingt ein Auferstehen; wie der echte Wahrsager außerhalb der Zeit stehend auf die Beschaffenheit der menschlichen Zeit herabblickt, so ist auch die Auferstehung kein sich innerhalb der Zeit vollziehender Akt. Er überschreitet das Leben ebenso wie den Tod. Wie aber der Tod nicht für jeden die Auferstehung bedeutet, so haben auch nur wenige schon im Leben an der Auferstehung teil. Die Auferstehung ist, wie schon der Begriff andeutet, eine seelisch-körperliche Erscheinung; ihre griechische Entsprechung (ἔγερσις) bedeutet auch Erwachen, was so viel wie Heraustreten aus einem vorangehenden Zustand ist. Und da dieses Heraustreten (ἔκστασις) an einen Augenblick geknüpft ist, hat es (nicht nur grammatisch gesehen) absolut gegenwärtigen Charakter. Aus unserem bisherigen Gedankengang folgt, dass die