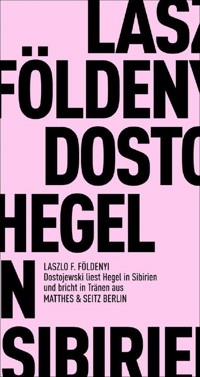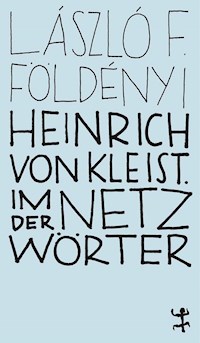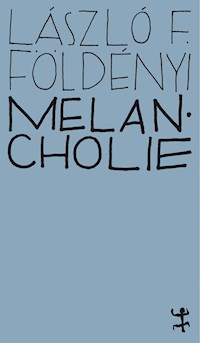Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Batterien
- Sprache: Deutsch
Was ist Mystik? László F. Földényi untersucht in diesem klassischen Essay jene Augenblicke, die in der abendländischen Tradition als mystisch, kathartisch, erschütternd oder ekstatisch beschrieben werden. Die kulturgeschichtliche, religiöse und mythische Tradition dieser Erlebnisse im Blick, versucht er ihre Rolle von der Antike bis in unsere Zeit zu beschreiben. Földényi deckt auf, dass gerade diese scheinbaren zeit- und raumlosen Augenblicke den wahren Charakter des immer zeit- und raumgebundenen Lebens erleuchten. Dabei versucht er jenen Augenblick, von dem auch sein eigenes Schreiben durchdrungen ist, lebhaft zu machen und nicht als neutralen Gegenstand zu behandeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
| Batterien NF n° 011 |
László F. Földényi
Starke Augenblicke
Eine Physiognomie der Mystik
László F. Földényi
Starke Augenblicke
Eine Physiognomie der Mystik
Aus dem Ungarischen von Akos Doma
Inhalt
Vorwort
1. Gotteserlebnis und Gottesglaube (Im Schnittpunkt des Kreuzes)
2. Wer blitzt?
3. Das Mysterium des Nabels
4. Die Grenze und das Grenzenlose
5. Das gähnende Chaos
6. Das Unmögliche
7. Die Kraft des Augenblicks
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort
»Aus Nichts schafft Gott, wir schaffen aus
Ruinen! Erst zu Stücken müßen wir
Uns schlagen, eh’ wir wissen, was wir sind
Und was wir können!«1
Christian Dietrich Grabbe
In der Tragödie »Don Juan und Faust« (1829) des romantischen Dramatikers Christian Dietrich Grabbe begehrt Faust, seiner Gewohnheit treu, auch diesmal viel. Er will das, was angeblich nur Gott zusteht, aus eigener Kraft schaffen. Dazu muss er aber Gott selbst trotzen. Auch er will einen Schöpfungsakt vollbringen. Die Gegebenheiten und Möglichkeiten, die ihm dabei zur Verfügung stehen, unterscheiden sich jedoch fundamental von denen seines vermeintlichen Gottes. Gott schuf etwas aus dem Nichts, Faust dagegen hat nur noch die Möglichkeit, aus etwas bereits Bestehendem etwas Neues zu schaffen. Damit dieses Etwas aber genauso fest und endgültig wird wie das, was Gott geschaffen hat, muss es das von Gott geschaffene Etwas überbieten. Da Gott aber das »Höchste« ist, d.h. über allem steht, kann dieses »Überbieten« nur in die entgegengesetzte Richtung gelingen. Um Gott zu überbieten, muss er »unterboten« werden. Etwa so wie es Heinrich von Kleist in seiner kurz vor Grabbes Drama entstandenen Schrift »Über das Marionettentheater« skizziert hat: Wir »müßten (...) wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen. Allerdings (...) das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt.«2
Gott zu unterbieten heißt, sein Werk, die Schöpfung, auszuklammern. Und damit auch das auszuklammern, was der Schöpfung vorausgegangen ist: das Nichts. Während er sich in Stücke schlagen will, nimmt Grabbes Held auch ein geistiges Abenteuer auf sich. Gott schuf die Welt aus dem Nichts: Diese Aussage behauptet nichts weniger als, dass allem, was ist (der Welt, dem Etwas, dem Seienden), etwas vorausgeht, das man nicht als Welt, als Etwas, als Seiendes bezeichnen kann und das folglich auch mehr als diese ist. Was könnte das anderes sein als das Nichts oder — mit Heidegger gesprochen — das Sein? Der Gott zugeschriebene Schöpfungsakt lenkt die Aufmerksamkeit auf die fundamentalste Tradition des europäischen Denkens, das metaphysische Denken, auf dessen theologische Natur Heidegger hingewiesen hat: »Seit der Auslegung des Seins als ἰδέα ist das Denken auf das Sein des Seienden metaphysisch, und die Metaphysik ist theologisch. Theologie bedeutet hier die Auslegung der ›Ursache‹ des Seienden als Gott und die Verlegung des Seins in diese Ursache, die das Sein in sich enthält und aus sich entläßt, weil sie das Seiendste des Seienden ist.«3
Grabbes Faust will zu Beginn des 19. Jahrhunderts also nichts weniger, als von dieser auf über zweitausend Jahre zurückblickenden, metaphysischer Tradition Abschied zu nehmen. Und er möchte sich ein für allemal auch von einer anderen Idee, die sich beharrlich im europäischen Denken festgesetzt hat, verabschieden: Von der Vorstellung, dass das Nichts, da es allem anderen vorausgeht, reicher ist als das, was aus ihm geschaffen wurde. Faust glaubt nicht an das Nichts, er glaubt an die Schöpfung. Und damit initiiert er eine neue Tradition, deren Einfluss auf die europäische Kultur seit der Romantik immer spürbarer wird, und die sich zu Beginn des dritten Jahrtausends im philosophischen Denken genauso eingebürgert hat wie die metaphysische Haltung zwei Jahrtausende zuvor. Diese neue Tradition möchte den tiefen Abgrund zwischen dem Sein und dem Seiendem zuschütten, den Unterschied zwischen beiden aufheben. Faust ist bestrebt, das traditionelle, eindimensionale, metaphysische Denken zu dekonstruieren — um es mit einem modernen Begriff auszudrücken. Aus Ruinen schaffen oder uns zu Ruinen zertrümmern, um zu erfahren, wer und was wir sind: Das bedeutet, die Idee eines allem vorausgehenden Nichts zu verwerfen, den Glauben aufzugeben, dass es möglich sei, früher oder später einen letzten — oder ersten — Halt, die Gewissheit einer Ganzheit und Vollkommenheit, die als Sonne alles überstrahlt, was ihm folgt (oder ihm vorausgeht), zu finden.
Die traditionelle Metaphysik war durchdrungen von der sicheren Annahme eines letzten, positiven Sinnes. Da dieser Sinn ein letzter ist, ist er auch isoliert von all dem, was er mit Sinn durchdringt. Diese traditionelle Vorstellung von Sinn, ein solcher zwischen dem Sein und dem Seienden eingekeilter Abgrund, lockt mit dem Glauben an eine neue Welt, die zwar jedem offen steht, die aber nur dann betreten werden kann, wenn man allem, was ist, den Rücken kehrt, auf alles verzichtet, was ohne Sinn zu sein scheint. Und weshalb wirkt das verlockend? Weil das, was ist, also das Seiende, wie ein Zwang wirkt, der die Menschen daran hindert, das zu tun, wonach sich auch Grabbes Faust sehnt: zu erfahren, was wir sind und was wir können.
Anstelle des infolge seiner Diesseitigkeit fragmentierten Ich-Bildes steht das metaphysische Denken im Bann eines festen, infolge seiner Endgültigkeit vermeintlich göttlichen Ich-Bildes, das uns angeblich irgendwo erwartet, nur eben schwer zu entdecken ist. Grabbes Faust bestreitet die Existenz eines solchen essenziellen Ich-Bildes, mit dem sich jeder identifizieren könnte, und das über Jahrhunderte einer der Ecksteine der europäischen Zivilisation war. Doch spätestens seit der Romantik traten die inneren Risse des traditionellen, metaphysischen Denkens immer offensichtlicher zutage. Diese Risse nahmen ihren Anfang mit der Erschütterung des Glaubens an die traditionelle Gottesvorstellung. Diese Erschütterung ging mit der Infragestellung des vermeintlich göttlichen Ich-Bildes einher, bis schließlich in der Mitte des 20. Jahrhunderts Czesław Miłosz schreiben konnte: »Die menschliche Person, die stolz mit dem Finger auf sich selbst zeigt: ›ich‹, erwies sich (...) als Täuschung, denn sie ist lediglich ein von ein und derselben Epidermis zusammengehaltenes Bündel von Reflexen.«4
Aber lässt sich noch von einer »inneren« Identität sprechen, wenn das Ich lediglich von einer Epidermis zusammengehalten wird? Diese Frage ist deshalb berechtigt, weil Grabbes Faust — bleiben wir der Einfachheit halber bei ihm — das traditionelle, essenzielle Ich-Bild zwar ablehnt, aber keineswegs aufhört, sich selbst zu suchen. Ja, indem er sich selbst erkennt, möchte er — in Vorwegnahme Nietzsches — sich auch selbst erschaffen. Er wendet sich von der Metaphysik ab, ohne sich dabei auf eine bloße Epidermis reduzieren zu lassen — er will sich nicht einem Denken ausliefern, das man am Ende des 20. Jahrhunderts am ehesten als pragmatisch bezeichnen würde. Vom pragmatischen Standpunkt aus gesehen verrät die vergebliche Sehnsucht nach einer »inneren Identität« eine Nostalgie nach Metaphysik. Richard Rorty zum Beispiel schreibt bezüglich Freud: »Indem er uns half, uns selbst als ohne Mitte zu sehen, als eine beliebige Zusammensetzung kontingenter und idiosynkratischer Bedürfnisse statt als eine mehr oder weniger adäquate Veranschaulichung einer allgemeinmenschlichen Essenz, eröffnete uns Freud neue Wege zu einem ästhetischen Leben. (...) Das hat es uns erheblich erleichtert, uns von der Vorstellung zu befreien, wir hätten ein wahres Selbst, das wir mit allen anderen Menschen gemeinsam haben.«5
Faust — wie auch der Verfasser dieses Buches — vertritt dagegen einen anderen Standpunkt. Er bestreitet zwar nicht, dass das traditionelle, metaphysische Denken seine Allgemeingültigkeit verloren hat, ja er vertritt lange vor Freud die These, dass das Ich nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. Allerdings belässt er es nicht dabei. Er will nicht hinnehmen, dass das »Haus« nunmehr leer ist, sondern er sucht weiter. Er hofft, den Fremden zu finden, der das Haus besetzt hat. Faust reißt das Haus ab, zertrümmert alles, um diesen Fremden, der von seinem eigenen Ich kaum zu unterscheiden und dennoch unendlich fern und anders als er selbst ist, zu finden. Er weist die Herrschaft (den Terror) des gemeinsamen und essenziellen Ich zurück, ohne aber die Persönlichkeit dem hohlen Spiel der Zufälligkeiten und Beliebigkeiten zu überlassen. Auch er bestreitet nicht, dass das »Ich« eine bloße Illusion ist, dass seine Umrisse unbestimmbar sind, dass es kaum mehr als ein Konglomerat von Schablonen und Mustern ist, das sich nach dem Gebot der jeweiligen Interessen und Gegebenheiten zu immer neuer Gestalt zusammensetzt. Aber er akzeptiert auch die Gültigkeit einer anderen, damit schwer zu vereinbarenden Matrix und hält an der Einheit der Identität fest, einer Identität allerdings, die sich nicht auf das Ich beschränkt. Er ist der Überzeugung, dass die Persönlichkeit sowohl fest als auch formbar ist, dass sie über ein einziges Antlitz verfügt und sich dennoch nicht ins Auge schauen lässt. Die Persönlichkeit ist also — um es in der Sprache der europäischen Kultur auszudrücken — die unendliche Spiegelung einander spiegelnder Spiegel, gleichzeitig aber auch der Abglanz des Göttlichen.
Dieses »Göttliche« tritt von hinten an den von den traditionellen Religionen ausgearbeiteten, positiven »Gott« und überwältigt ihn, indem es ihn gleichsam unterbietet. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, kaum hundert Jahre nach Grabbe, schreibt Alfred Jarry: »Wir haben beileibe nicht alles zerstört, wenn wir nicht auch die Trümmer zerstören! Doch sehe ich keine andere Möglichkeit, als sie in erbaulichen, wohlangeordneten Bauwerken zu bewahren.«6 Dem tiefsten Inneren des Nihilismus kann ein neues Persönlichkeitsbild entspringen — der Abriss der traditionellen, starren Metaphysik öffnet den Horizont für eine neue, dynamische Metaphysik. Die europäische Kultur hat in den letzten zweihundert Jahren ihren Bezug zur Metaphysik verloren. Der Mensch kann sich aber, wie Leszek Kołakowski in seinem Buch »Horror metaphysicus. Das Sein und das Nichts« (1988) ausführt, niemals von seinem Heimweh nach Transzendenz und Metaphysik befreien. Wenn nicht aus anderen Gründen so ist er schon infolge seines Wissens um die eigene Vergänglichkeit zur Metaphysik verdammt. Faust bewahrt also seine Zuneigung zur traditionellen Metaphysik, ohne sich deshalb in die Gefängnisse einsperren zu lassen, die man in ihrem Namen errichtet hat. Seinem Beispiel folgt der Verfasser dieses Buches. Er unternimmt in den folgenden sieben Essays den gleichen Versuch wie Grabbes Held: durch Abreißen aufzubauen. Die sieben Kapitel behandeln jeweils etwas anderes (den Schnittpunkt des Kreuzes, den Blitz, die Mitte, das Überschreiten der Grenze, das Chaos, das Unmögliche und die überwältigende Kraft des Augenblicks) und doch versuchen sie alle, das Denken nach dem gleichen, unsichtbaren Fokus auszurichten.
Grabbes Figur spricht von Gott. Nicht nur deshalb, weil er schaffend Gott trotzen muss, sondern auch, weil das metaphysische Denken unweigerlich von der Gestalt (der Vorstellung) Gottes überschattet wird. Es ist schwer, ihn zu umgehen — selbst für einen, der, wie der Verfasser dieses Buches, sich für nicht gläubig hält und in keiner Religion Zuflucht sucht. Dennoch verwende ich in diesem Buch oft das Wort »Religion«, genauer das Adjektiv »religiös«, und zwar in dem Sinn, in dem es auch der ungarische Philosoph Béla Hamvas verwendet hat. Hamvas hat einmal gesagt: Ich bin nicht religiös, aber alle wichtigen Erlebnisse in meinem Leben waren religiöse Erlebnisse. Als religiös bezeichne ich ein Erlebnis dann, wenn es einem hilft, seine inneren, vermeintlich unumstößlichen Schranken zu überwinden. Das hat wenig mit Glauben zu tun, und eine kanonisierte Religion lässt sich daraus erst recht nicht schmieden. In den Momenten des religiösen Erlebnisses fühlt man sich schrankenlos und grenzenlos. Man könnte ein solches Erlebnis auch als kathartisch, erschütternd, erhebend bezeichnen. Mit einem Wort als mystisch. Oder noch besser als ekstatisch. Das mystische Erlebnis ist deshalb ekstatisch, weil es den Menschen aus sich, aus seinem bis dahin vermeintlich natürlichen Umfeld heraustreten lässt und ihm Horizonte eröffnet, die sein Dasein in einem neuen Licht zeigen. Mehr noch, sie machen ihm bewusst, dass er »existiert«. Genauer, dass er existiert, obwohl es ebensogut sein könnte, dass er überhaupt nicht existiert. Religionen wollen den Menschen davor bewahren, sich zu verlieren. Mystische Erlebnisse dagegen nähren sich gerade aus diesen »Verlusten«, sie verwandeln diese in Gewinne. In den Momenten des mystischen Erlebnisses erlebt man sich plötzlich konzentrierter als je zuvor — als habe man die eigene Identität soeben erst entdeckt. Gleichzeitig fühlt man sich aber auch verwaist: Indem man aus sich heraustritt, wird einem gerade die eigene Identität fragwürdig. Das macht ein solches Erlebnis zu einem paradoxen Zustand: Man wird gerade dann identisch mit sich, als diese Identität immer weniger greifbar wird. Bei einem solchen Erlebnis enthüllt sich die widersprüchliche Natur des Lebens: Man ist gerade dessen am wenigsten Herr, was der höchste Beweis seiner Existenz ist — seines Lebens.
»Über Göttliches kann (...) nur in Begeisterung gesprochen werden«7, schrieb der junge Hegel. Dasselbe gilt auch für das religiöse Erlebnis — mit der nicht unwesentlichen Einschränkung, dass der »religiöse« (begeisterte, ekstatische) Ton dabei durchaus verständlich sein muss. Dieses Buch setzt sich zum Ziel, die Wesensmerkmale des religiösen Erlebnisses abzugehen. Damit das Erlebnis aber nicht versiegt und zu etwas »Sachlichem« verdörrt, muss man unter Wahrung der Besonnenheit immer wieder auch dem Schwindel anheimfallen, unter Wahrung der Distanz auch aufdringlich werden. Das Ziel besteht darin, das die Gedanken umgebende Undenkbare, das jenseits der Worte verborgene Unsagbare fühlbar werden zu lassen. Eine Lösung bietet die Gattung des Essays, der im ursprünglichen Sinn des Wortes Versuch bedeutet. Der Essay ist die Versuchung des Unmöglichen: das Heraufbeschwören jener Grenzenlosigkeit, die dem Menschen in den Momenten des religiösen Erlebnisses zuteil wird. Ein Essay ist nicht nur deshalb authentisch, weil er mit Leben pulsiert, sondern auch weil die Bedrohung dieses Lebens darin zum Vorschein kommt. Im Essay erdehnt sich ein einziger feuerballartiger Augenblick zur Zeit. Gerade diese bewusst in Kauf genommene Widersprüchlichkeit des Schreibens garantiert, dass die Einheit des ursprünglichen Erlebnisses gewahrt bleibt. Der Essay ist ein Versuch; dieser Versuch ließe sich aber nicht durchführen, wenn den Essayisten nicht selbst etwas versucht hätte. Der Essayist vertieft sich in seinen Gegenstand (erleidet ihn), gleichzeitig bewahrt er aber auch seine Freiheit. Der Gattung des Essays bedarf es dann, wenn das, wovon er handelt, einen persönlichen Einsatz hat. Das Persönliche ist hier jedoch: das Zeichen der Versuchung, das einem, um zum vorausgehenden Gedanken zurückzukehren, ein Erlebnis beschert, das auch die Grenzen des Persönlichen nichtig werden lässt.
Dem religiösen Erlebnis wohnt etwas Schwindelerregendes inne. Der Reiz des Essays besteht darin, diesen Schwindel fühlbar zu machen, und darum sehe ich die Kulturgeschichte im Folgenden nicht als bloße Fundgrube von Daten und Ereignissen, sondern als einen großen Strudel, in dem kein Punkt privilegierter als ein anderer ist. Die Fußnoten, Verweise und häufigen Zitate scheinen dazu im Widerspruch zu stehen. Es besteht die Gefahr, dass sie statt einen Strudel zu bilden sich ungewollt zu einem großen System zusammensetzen, das von Über- und Unterordnung zusammengehalten wird. Meine Absicht besteht jedoch nicht darin, anzuklagen, zu beweisen oder zu verteidigen, sondern fühlbar zu machen, dass das, worauf die gegenwärtigen Gedanken sich richten, auch schon von anderen Menschen der unterschiedlichsten Epochen und Kulturen erlebt worden ist. Indem ich mich auf andere berufe, möchte ich keine abschreckenden Steinstatuen und Autoritäten zitieren, sondern versuche vor allem meine Zeitgenossen in ihnen zu entdecken — von Heraklit bis Bataille, Basilides bis Cioran. Ich will die Verweise und Zitate nicht zu harter Erde feststampfen; mich reizt nicht die positivistische Philologie mit ihrem ausufernden, kritischen Apparat. Ich suche vielmehr Vorbilder, wie es die barocken, englischen Denker des 17. Jahrhunderts Robert Burton und Thomas Browne gewesen sind. Wie auch ihr späterer Nachfahre Borges hielten sie die Kulturgeschichte nicht für ein entschlüsselbares Rätsel, sondern für ein großes Labyrinth, in dem alle mit ähnlichen Fragen ringen müssen.
Abb. Günter Brus, Aktion »Selbstverstümmelung«, 1965 (Foto: Helmut Khasaq).
Der ganze Körper verblasst; entlang einer einzigen Linie versucht das Leben aus ihm auszubrechen. Er birst, wie von einem Blitz gespalten; einem Kriechtier gleich versucht der Mensch dem Leben zu entkommen und setzt seine ganze Hoffnung auf etwas, das nicht einmal mehr als Leben bezeichnet werden kann. Aber ist er nicht gerade dann am meisten mit sich eins, wenn er am bedürftigsten ist? Ist er nicht dann am gewichtigsten, wenn er nur noch mit dem sich verflüchtigenden Abdruck seines Selbst eins ist?
Die Glieder bewegen sich nicht mehr; die Zunge zieht sich ermattet ins Dunkel der hallenden Mundhöhle zurück. Im Augapfel spiegelt sich das Unmögliche. Das entlang der Mittellinie verlaufende Blutrinnsal ist das Zeichen des auch den Körper zerreißenden, inneren Kreuzes. Das Leben ist auf sein eigenes Kreuz aufgespannt. Sind wir Zeugen des Mysteriums der vernichtenden Erfüllung?
1. Gotteserlebnis und Gottesglaube (Im Schnittpunkt des Kreuzes)
»Die Zeit ist abgeflossen, wo mir noch Zufälle begegnen durften; und was könnte jetzt noch zu mir fallen, was nicht schon mein Eigen wäre! Es kehrt nur zurück, es kommt mir endlich heim — mein eigen Selbst, und was von ihm lange in der Fremde war und zerstreut unter alle Dinge und Zufälle. (...) Gipfel und Abgrund — das ist jetzt in Eins beschlossen! (...) Du gehst deinen Weg der Größe: hier soll dir keiner nachschleichen! Dein Fuß selber löschte hinter dir den Weg aus, und über ihn steht geschrieben: Unmöglichkeit.«8
Friedrich Nietzsche
»Diesmal widerfuhr mir (...) etwas Sonderbares«, erzählt der Verfasser der apokryphen Johannes-Akte über Jesus. »Ich versuchte ihn nämlich in seiner eigentümlichen Wesenheit zu schauen, bemerkte aber, dass er nie mit den Wimpern zuckte, sondern die Augenlider stets offen hielt.«9 Aber nicht nur das fiel ihm auf. Abgesehen von seinen stets geöffneten Augen besaß Jesus auch viele andere sonderbare Fähigkeiten. So erschien er später mal als Kind, mal als Greis; mal zeigte er sich als Riese, mal als Zwerg; meist hatte er einen Körper, aber zuweilen war er auch gänzlich vergeistigt; mal war er identisch mit sich, mal verdoppelte er sich; meist trat er als Jesus auf, aber es kam auch vor, dass er mit Johannes verschmolz. Es ist also nicht verwunderlich, dass dieser Jesus von der Methode der Überredung, der logischen Argumentation nicht viel hielt. Vor seiner Gefangennahme brach er stattdessen in Gesang aus, begann zu tanzen und forderte schließlich auch seine Jünger zum Tanz auf. Nach dem Tanz geriet er wahrhaftig in Ekstase und ließ die Umherstehenden und Tanzenden dadurch das unaussprechliche, unlösbare Geheimnis schauen. Später behauptete er, zu Ehren des Vaters getanzt zu haben, und deutete den Tanz als eine Form von Leiden. Doch weshalb hat er gelitten? Das verrät er nicht. Er glaubt, über dieses Leiden schweigen zu müssen. Deshalb sagt er daraufhin zu Johannes: »Wer ich aber wirklich bin, das weiß ich allein und kein Anderer. Lass mich denn das Meine bewahren und begnüge dich, das Deine durch mich zu schauen. Mich aber in Wahrheit schauen, das ist, wie ich dir sagte, unmöglich. Du vernimmst, dass ich litt; aber ich litt nicht. Und du vernimmst, dass ich nicht litt; aber ich litt doch!«10
ENTLEERUNG, AUFLADUNG
»Schaue das Deine durch mich«. Was mag dieser Jesus damit gemeint haben? Es ist sonderbar, dass er, obwohl er sich nicht sehen lässt, Johannes auffordert, ihn zu schauen. Und Johannes muss dem nicht blinzelnden Jesus starr in die Augen sehen. Er muss ihn so lange anstarren, bis es ihm vor den Augen zu flimmern beginnt. Aber da sieht er nicht mehr Jesus. Was er eigentlich sieht, ist schwer zu sagen. Vielleicht erkennt er sich in dessen Zügen selbst wieder. Es ist aber auch vorstellbar, dass sich ihm einfach nur alles im Kreise zu drehen beginnt und ihm schwindlig wird. Wie auch immer, der Logos, dessen Verkörperung Jesus zu sein behauptet, und auf den Johannes seinen Blick richtet, eignet sich nicht, Schicht für Schicht geöffnet und enthüllt zu werden. Er ist nicht einmal zu verstehen. Bei ihm versagt die hermeneutische Methode. Denn dieser Jesus und dieser Logos sind nicht identisch mit dem Jesus und dem Logos der Theologen und der Philosophen. Ein Abgrund trennt sie beide von jenen, die sie erkennen wollen.
Der Jesus der Johannes-Akte spielt mit Johannes wie ein Verführer. Er bietet sich ihm an und tut so, als lasse er sich sehen, in Wahrheit verbirgt er sich aber, und am Ende blickt ihn Johannes wie eine Fata Morgana an. Er tut so, als sei er greifbar, stattdessen schlüpft er aber selbst in Johannes. Wer ihn erkennen will, muss sich erst selbst erkennen — muss den Fremden, der in ihn eingekehrt ist, erwischen. Dieser Jesus verhält sich also wie ein Psychotherapeut: Er verhilft dem, der ihn beobachtet, zur Selbsterkenntnis. Er gibt den anderen »Substanz«, obwohl er ihnen nur seinen eigenen Mangel offenbart. Ein bisschen benimmt er sich natürlich auch so, als würde er Johannes an der Nase herumführen. Wenn man Johannes fragen würde, würde er gewiss erwidern, dass er nicht geführt werde. Und doch fühlt er sich wie benommen, ihm wird schwindelig, und während er den nicht blinzelnden Jesus betrachtet, beginnt sich ihm allmählich alles im Kreis zu drehen.
Dieser Jesus verheißt Johannes die Erfüllung, indem er ein immer größer werdendes Mangelgefühl in ihm erzeugt. Er verheißt ihm Selbsterkenntnis (»Schaue das Deine durch mich«), lässt ihn aber auch außer sich geraten. Bevor Johannes Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen musste, hatte er sich gewiss wie an einen Sachbearbeiter an ihn gewandt. Wie Gläubige im Allgemeinen erhoffte auch er sich von Jesus eine Bewältigung seiner Probleme. Er stellte sich ihn wie jemanden vor, der ihm in allem vorausging, und zwar nicht nur einen Schritt. Die vielzitierte Unfassbarkeit Gottes weckte auch in ihm die Vorstellung, jener sei ungleich geschickter als der Mensch, habe eine Tarnkappe auf, die ihn unsichtbar machte, und ließe sich aus irgendeinem Grund nicht sehen. Als er sich nun diesem sonderbaren, sich menschlich und doch nicht menschlich benehmenden Jesus gegenübersieht, muss er die Erfahrung machen, dass der Ausdruck »Hinwendung zu Gott« eine absurde sprachliche Wendung ist. Eine unbrauchbare Metapher. Die Idee einer »Hinwendung zu Gott«, ja selbst das Wort »Gott« findet nur dann Anwendung, wenn der Mensch seine Lebensumstände für mitteilbar hält. Wenn er von Gefährten umgeben ist, also in einer Gemeinschaft lebt, die in Gott (in der Religion, der religio) eines ihrer wichtigsten Bindemittel hat. Dann erscheint das Wort (»Gott«) als etwas Substanzielles, das sich sogar institutionalisieren lässt. Es eignet sich sogar, Kirchen darauf zu gründen.
Bei einem Erlebnis dagegen, wie es auch Johannes zuteil wird, entleert sich das Wort. Genauer, es lädt sich mit neuem Gehalt auf. Mit einem Gehalt, der auch den Mangel fühlbar machen kann, den Johannes beim Anblick des nicht blinzelnden Jesus empfindet. Johannes wird schwindelig, die Welt (die »Gemeinschaft«) verliert ihre Konturen, seine Seele aber wächst ins Gewaltige an. Sie wird derart groß, dass sie die ganze Welt einzuverleiben vermag. Johannes wird ein sonderbares Erlebnis zuteil: Er findet zu sich, indem er die gewohnte Welt verliert und anstelle ihrer eine neue bekommt. Das Wort »Gott« wird nicht vernichtet, sondern stülpt sich gleichsam um: Es bleibt verständlich und klar und erweckt doch den Eindruck eines dunklen Tunnels. Wie auch die Johannes-Akte als Ganzes den Eindruck erweckt, als sei ihre Sprache unterminiert und könne jede Sekunde explodieren.
»Schaue das Deine durch mich«. Johannes wird ein Erlebnis zuteil, das in der Sprache der europäischen Tradition gewöhnlich als mystisch bezeichnet wird. Jesus bringt Johannes dazu, sich vom Gott der Institutionen und der Gewohnheit abzuwenden, und konfrontiert ihn mit der Einsicht, dass Gott nur ein einziger »Ort« vorbehalten ist: jener Bruch, der im Menschen dann entsteht, wenn ihm seine eigene Identität zweifelhaft wird. In dem nicht blinzelnden Jesus erkennt Johannes sich selbst wieder, auch wenn dessen Züge sich von den seinen natürlich unterscheiden. Johannes sucht das Seine im Anderen, nähert sich seinem Selbst also auf dem Umweg des Anderen, der ihm im Vergleich zu seinem eigenen Selbst fremd ist. Sein »Ich« lädt sich mit etwas auf, das strenggenommen nicht zu seinem »Ich« gehört.
Aus dem »Abenteuer« des Johannes lässt sich aber auch noch eine andere Lehre ziehen. Sein Fall belegt auch, dass es nicht darum geht, dass ein »Ich« existiert, das vor allem anderen da ist und sich dann wie ein Gefäß aufzuladen beginnt, sondern dass das »Ich« überhaupt erst dadurch entsteht, dass es sich mit etwas aufzuladen beginnt, das strenggenommen kein Teil von ihm ist. »Ich sah mich mich sehen«: Diesen an den Sprachgebrauch der Johannes-Akte erinnernden Satz erörtert zweitausend Jahre später Jacques Lacan in seinem Seminar »Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse« (Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse), als er die Grundlagen des Bewusstseins analysiert.11 Bewusstsein ist für Lacan untrennbar verbunden mit Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis dagegen lässt sich nicht auf das Bewusstsein reduzieren. Sie ist weit mehr als das. Schon hundert Jahre vor Lacan hatte für Nietzsche Selbsterkenntnis auch Selbsterschaffung bedeutet: Indem die Persönlichkeit sich selbst erkennt, ruft sie sich auch ins Leben.
Als Jesus Johannes auffordert, ihn anzusehen, stellt er ihn damit vor eine Entscheidung. Johannes hatte sich Gott früher vermutlich als jemanden vorgestellt, der einem immer voraus war, einen in allem überragte. Zu dieser essenziellen Gottesvorstellung gesellte sich ein wohl ebenfalls essenzielles Ich-Bild hinzu. Aber während er den nicht blinzelnden Jesus betrachtet, wird Johannes eine radikal andere Erfahrung zuteil. Gott ist ihm nicht voraus, sondern entsteht erst in dem Moment in ihm, wie auch sein Ich erst in dem Moment plastische Formen anzunehmen beginnt, als er sich von sich selbst zu entfernen beginnt. Um sich eines bewusst paradoxen Bildbruchs zu bedienen: Das Größere (Gott) manifestiert sich im Kleineren (Johannes), das Vollkommene im Mangelhaften. Johannes steht am Scheideweg von Maß und Maßlosem. Entweder akzeptiert er das Maß als alleingültig und klammert die Tatsache aus, dass auch das Maß auf etwas gründet, das strenggenommen nicht messbar ist. Oder er bejaht das Maßlose, was hier jedoch nicht zu Chaos und Kopflosigkeit führt, sondern zur paradoxen Einheit von Maß und Maßlosem. Entweder er schließt aus oder er nimmt auf.
Wer wie Johannes Jesus von Angesicht zu Angesicht sieht und fühlt, wie der Gott in ihm zu entstehen beginnt, greift infolge dieser paradoxen Paarung von Maß und Maßlosem bevorzugt auf privative Affixe zurück. Sie alle — von Origenes bis Simone Weil, von Plotin bis Georges Bataille, von Meister Eckhart bis E. M. Cioran, um die Gnostiker und Mystiker nicht zu vergessen — sind Stilisten der negativen Theologie. Die Lehren von der Nicht-Greifbarkeit Gottes sind Bestätigungen — oder auch poetische Formulierungen — dieses Paradoxes, in ein theologisches Gewand gehüllt. Die unvermeidliche Unklarheit bei den großen Gnostikern und Mystikern ist nicht auf unpräzise Formulierung zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass das, worauf die Sprache sich richtet, einerseits ihr Gegenstand ist, andererseits sich aber auch schon in der sprachlichen Formulierung eingenistet hat. Das, was sie mittels Worte einfangen wollen, befindet sich von vornherein in ihrem Besitz; sie verfolgen etwas, das schon hinter ihnen ist. Ein gutes Beispiel dafür bietet das fast schon komische krampfhafte Bemühen des Gnostikers Basilides aus dem 2. Jahrhundert, die jedem Sprachgebrauch hohnsprechende Berührung des »Überseienden« und des »Nichtseins« fühlbar zu machen. »Es war eine Zeit, da nichts war; doch nicht einmal das Nichts war etwas, sondern in schlichten und ungedeutelten Verstande des Wortes war es schlechterdings gar nicht. (...) Da nun nichts war, weder Stoff noch Wesen, noch Wesenloses, noch Einfaches, noch Zusammengesetztes, noch Unfaßbares, noch Unempfundenes, noch Mensch, noch Engel, noch Gott, noch überhaupt etwas Genanntes, durch Wahrnehmung Erkanntes oder Gedachtes, da wollte der Gott, der nicht war, gedankenlos, empfindungslos, willenlos, vorsatzlos, leidlos, begierdelos — die Welt machen. Wenn ich aber sage ›er wollte‹, so sage ich das nur zur Andeutung von dem Willenlosen, Gedankenlosen und Empfindungslosen. (...) So hat der Gott, der nicht war, die Welt gemacht, die nicht ist, aus dem, was nicht ist.«12
Basilides’ Worten wird man nur dann gerecht, wenn man sie nicht um jeden Preis in die Sprache des Verstandes zu übertragen versucht. »Übersetzt« lautete das Zitat: »Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde«. (Der erste Satz der Bibel genügt den Erfordernissen des Verstandes. Aber nur scheinbar. Auch dieser Satz ist durchaus zerbrechlich. Auch in ihm lauert die Idee eines jede Vorstellungskraft übersteigenden »Überseienden« beziehungsweise eines ebendies ausschließenden »Nichts«.) Basilides möchte jedoch weniger die Geschichte der Schöpfung erzählen als vielmehr ein Erlebnis interpretieren, wie es wohl auch Johannes zuteil wurde, während er den nicht blinzelnden Jesus betrachtete. Basilides versucht, die mythische Schöpfungsgeschichte in die Sprache der persönlichen Erfahrung zu übertragen und der persönlichen Erfahrung gleichzeitig einen mythischen Rahmen zu geben. Diese Erfahrung würden wir heute folgendermaßen formulieren: Alles, was ist, war früher nicht, das heißt, alles, was geworden ist, verdankt seine Entstehung etwas, das mit ihm nicht identisch ist. Basilides behauptet nichts anderes, als dass der letzte Grundstoff des sich in ständigem Werden befindlichen Daseins etwas ist, das nicht ist. In der Sprache der negativen Theologie ausgedrückt, heißt das: Der höchste Beweis für die Existenz Gottes ist gerade seine Nichtexistenz.
Es ist kaum zu übersehen, dass Basilides’ spitzfindigem Gedankengang die Erfahrung von Unzufriedenheit mit dem Dasein innewohnt. Er muss einen tiefen Mangel gespürt haben, um so zu formulieren. Die Wurzel dieses Mangels ist der Bruch, den er zwischen sich und der Welt empfunden haben mag. Er konnte seine Erfahrung aber ins Mythische steigern, indem er seinen Mangel nicht mit einem negativen Vorzeichen versah. Er erkannte darin vielmehr eine Chance, eine Quelle von Energie. Und das anfängliche Gefühl der Beraubtheit verwandelte sich wie durch einen Zauberschlag in Aufladung. Der Mangel, den er im Dasein empfand, schlug unerwartet in Erfüllung um. Es handelt sich nicht um einen allmählichen Übergang, sondern um eine Katastrophe im ursprünglichen Sinn des Wortes — um eine »Wende von Damaskus«. Eine solche Wende wird in der Sprache der europäischen Tradition als Erleuchtung, als »Konversion«, als Bekehrung13 bezeichnet — etwas, das jedwedem mystischen Erlebnis zugrunde liegt.
»Die persönliche Begegnung mit Gott«, die gewöhnlich als das primäre Kennzeichen der Mystik bezeichnet wird, ist ein den Anschein von Maß wahrender Ausdruck dafür, dass ein Mystiker einen gegebenen Augenblick (den Augenblick der »Bekehrung«) sowohl als Beraubtheit als auch als überfließende Ganzheit erlebt hat. Die Kraft von Basilides’ Worten liegt nicht in der theologischen oder ontologischen Wahrheit, die sie vermitteln, sondern in der Vermittlung dieser Erfahrung. Die Lektüre seiner erhalten gebliebenen Fragmente legt nahe, dass er wohl als erster die bekannte Heideggersche Frage gestellt hat: »Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?«14
AUGENBLICKE DER ANNÄHERUNG AN GOTT
Als der heidnische Prediger Apollonios von Tyana aus dem 1. Jahrhundert während seiner Wanderschaften der Weisheit (Sophia) begegnete, sprach sie ihn, den viele wegen seiner Lehren und Wundertaten noch höher achteten als Christus und den die Kirche bei ihrer späteren Institutionalisierung erfolgreich aus dem Gedächtnis verbannt hat: »Wenn du aber rein bleibst, werde ich dir die Voraussicht verleihen und deine Augen mit solchen Strahlen des Lichtes erfüllen, dass du einen Gott und einen Heros erkennst und die Schattengebilde entlarvst, wenn sie Menschengestalt vortäuschen.«15 Die Weisheit bestimmte die Reinheit zur Bedingung der Gottesschau. Aber wovon muss man sich reinigen? Apollonios selbst nennt die Bedingung der Reinheit, wenn er sagt, man könne Gott nicht »einen, irgendwie der Sinnenwelt angehörigen Namen beilegen«16. Man muss also aus der Sinnenwelt heraustreten, um in die Welt der Götter zu gelangen. Wenn man sich ihnen aber nähert, lässt man nicht nur die Sinnenwelt hinter sich, sondern auch die Welt des Maßes. Denn gerade Apollonios sagt, dass das Maß ausschließlich in der Welt (dem Kosmos) existiert.17 Man reinigt sich, indem man, wenn man sich den Göttern nähert, auch die Welt des Maßes hinter sich lässt. Der Prediger von Tyana behauptet nichts anderes, als dass man Gott dann nahekommt, wenn man sich dem Strudel überlässt, der einen außer sich geraten lässt. Wenn man das Leben also nicht als ein Ensemble von Übergängen, Wegen und Brücken, sondern als einen nie zuzuschüttenden Abgrund erlebt.
Die Weisheit versprach Apollonios, dass er die Götter schauen werde. Einige Jahrhunderte zuvor hatte Sokrates die Menschen aber gerade deshalb zur Liebe der Weisheit, also zur Philosophie zu überreden versucht, weil nur diese sie auf den Tod vorbereiten konnte. Während die Weisheit Apollonios raffiniert damit vertröstete, dass er die Götter schauen werde, wollte sie ihm eigentlich klarmachen, dass er in der Nähe der Götter erkennen werde, dass der Grundstoff der Existenz etwas ist, das selbst gar nicht ist, und von dem man deshalb nicht einmal sagen kann: »das«, sondern — unter Verletzung der Sprachregeln — höchstens: »das, was nicht das ist«. Und das wird die wichtigste Erfahrung sein, die Apollonios erwartet. Nicht die Götter werden es ihn lehren, sondern umgekehrt: Erst wenn er diesen Mangel, der sich durch das ganze Dasein zieht, erlebt hat, wird er sich den Göttern nähern — wird Gott in ihm geboren werden. Dieser Gott »in der Einzahl« ist der Gott des Mangels; seine Aufgabe wird es sein, den Menschen wie von Sokrates vorgeschrieben auf den Tod vorzubereiten.
GOTTESERLEBNIS UND GOTTESGLAUBE
Die Eingeweihten der Mithras-Mysterien, die einen auf die Unsterblichkeit vorbereiten, suchten ein Erlebnis, wie es der Jesus der Johannes-Akte Johannes gewährte, während dieser ihn ansah. Sie wollten sehen, wie die Götter sie ansahen. Sie hofften, die Seele würde nicht nur aus sich heraustreten, während ihr Blick dem Blick der Götter begegnete, sondern auch in etwas anderes hineintreten.
Das Sehen gehört demnach zu den Bedingungen der Einweihung. Genauer jenes Sehen, bei dem der Blick sich nicht mehr auf etwas richtet, sondern in sich einkehrt. Der in sich versunkene Blick ist für die Mystiker ein Zeichen für die Entdeckung Gottes. Das mag der Ire Scottus Eriugena im Sinn gehabt haben, als er im 9. Jahrhundert schrieb, dass sich das Sehen vom Sein nicht unterscheide.18 Das Gotteserlebnis geht mit einem gesteigerten Sehen einher (verbunden mit einem gesteigerten Gehör- und Tastsinn). Doch seltsamerweise wird auch die Tatsache, dass Gott unsichtbar, unhörbar, ungreifbar ist, gerade dann erfahrbar, wenn man sich ihm nähert. Tacitus notierte in Hinblick auf die Germanen: »sie geben die Namen von Göttern jener weltentrückten Macht, die sie allein in frommen Erschauern erleben«19. Paradoxerweise wird in den Augenblicken des Gotteserlebnisses gerade das zum Objekt sinnlicher Erfahrung, was nicht erfahrbar ist. In solchen Momenten sieht man, dass man nichts sieht, hört man, dass man nichts hört. »I have nothing to say / and I am saying it« (Ich habe nichts zu sagen und ich sage es), so begann John Cage seine »Lecture on Nothing«. Ein Mystiker würde es so ausdrücken: ›Ich sehe Gott nicht und so sehe ich Gott; ich höre Gott nicht und so höre ich Gott‹.
An diesem Punkt scheiden sich das Gotteserlebnis und der Gottesglaube. Während beim Gotteserlebnis das Nicht-Erfahrbare zum Objekt der Erfahrung wird — das Maßlose im Maß erscheint —, unterscheidet der Gottesglaube zwischen Wissen und Erlebnis, Maß und Maßlosem. Ersteres konfrontiert den Menschen mit der Wirklichkeit, ohne die Bürde der Endlichkeit von seinen Schultern zu nehmen; letzterer hält die Bürde der Endlichkeit (Vergänglichkeit) für reduzierbar (denkt sich diese nicht als endgültige Vernichtung). Das Gotteserlebnis ist intensiv, brennend, augenblicklich, es berücksichtigt weder die Vergangenheit noch die Zukunft, denn es hat keinen Bezug zur Zeit. Die völlige Ziellosigkeit ist für solche Momente genauso bezeichnend wie die restlose Erfüllung. Deshalb lässt sich dabei auch von heiligen Momenten sprechen. Es ist nicht verwunderlich, dass das Gotteserlebnis aus der Sicht des Gottesglaubens — suspekt ist. Deshalb stand das Wort »das Heilige« in den diversen Kulturen nicht nur für Sauberkeit, sondern auch für Beschmutzung. Das griechische ἅγιος (hagios) und das lateinische sacer bezogen sich nicht nur auf das Heilige, sondern auch auf die Verdammnis,20 das gleiche gilt aber auch für den arabischen, hebräischen oder ägyptischen Gebrauch des Wortes.21 Was bewiese das anderes, als dass das Gotteserlebnis letztlich kein Maß kennt: Beim Gotteserlebnis wird einem das Heiligtum der Anarchie zuteil. Mit anderen Worten: Der Mensch wird offen, ohne überhaupt zu wissen, was ihn erwartet. Das ist der Zustand der Freiheit, eine Fundgrube der Möglichkeiten, ohne dass man im Voraus erahnen könnte, welche Form diese Freiheit annehmen wird.
Der Gottesglaube dagegen hat ein Maß. Es ist kein Zufall, dass dieser im Gegensatz zum Gotteserlebnis sehr wohl geeignet ist, institutionalisiert zu werden. Natürlich kann der Gottesglaube das Problem von Tod und Vergänglichkeit genauso wenig befriedigend klären, wie es das Gotteserlebnis zu tun vermag; aber statt diesen offensichtlichen und tragischen Selbstwiderspruch des Daseins restlos (das heißt maßlos) auszuleben, verdrängt er die Option der Verzweiflung genauso wie die Erfahrung der extremen Verlorenheit.
In ihrem Disput mit den Gnostikern kämpften die frühen Kirchenväter mit Feuer und Schwert für die Einführung eines beruhigenden Gottesbildes. In einer aus der Feder eines unbekannten Autors stammenden, gnostischen Schrift aus dem 3. Jahrhundert erscheint ein Prophet namens Phôsilampês, der, nachdem er eingesehen hat, dass die Allheit in etwas Unbeschreiblichem, Unaussprechlichem, Unüberwindlichem ruht, dessen Göttlichkeit einer, der nicht göttlich ist, nicht zu beschreiben vermag, so spricht: »Um seinetwillen ist das in Wirklichkeit (ὄντως) wahrhaftig Existierende und das wahrhaftig Nichtexistierende«.22