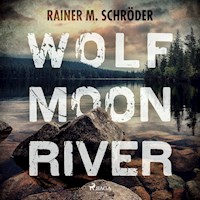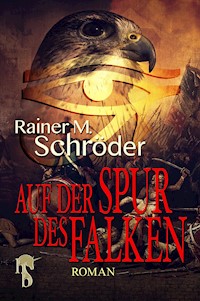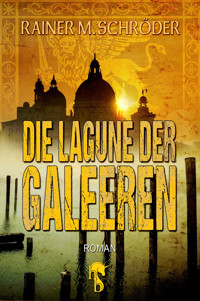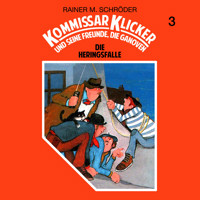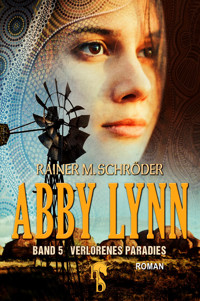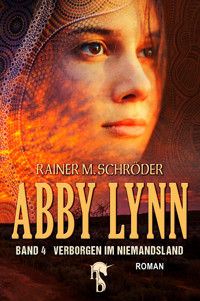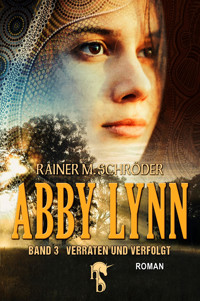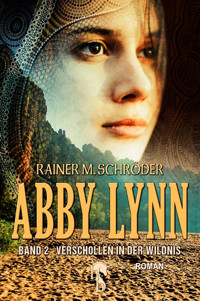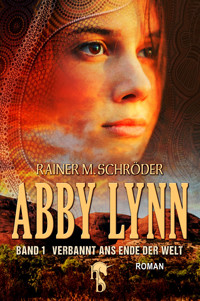6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach der Scheidung von seiner High-Society-Ehefrau ist Dan Stafford auf den Bahamas gestrandet: Auf Paradise Island verdient er sich mit seinem Wasserflugzeug »Hurricane« seinen Lebensunterhalt. Als er den ominösen Geschäftsmann Benson nach Miami fliegen soll, ahnt er noch nicht, dass dieser Flug sein Leben verändern wird. Nach einer Notlandung auf einer einsamen Insel gerät er zwischen die Fronten zweier konkurrierender Drogendealer in einem 10-Millionen-Dollar-Geschäft. Stafford wird zur Marionette in einem Spiel, in dem andere die Fäden in der Hand haben – bis er den Spieß umdreht und den Dealern seine Regeln aufzwingt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Der letzte Flug der Hurricane
Roman
Für Graham Thomas, der meinem Leben neuen Schwung gab und mich durch das Tal der Demut führte.
1
Es gibt Tage, die sollte man ganz aus seinem Leben streichen können – mit all ihren Folgen. Ich hätte eine ganze Liste von Tagen, die diesem Radierstift des Lebens zum Opfer fallen könnten, ohne dass sich in mir auch nur das leiseste Bedauern regen würde. Einer läge mir jedoch ganz besonders am Herzen, und zwar jener heiße Freitag im September vor gut fünf Jahren, als die Karibik von ungewöhnlich vielen Wirbelstürmen heimgesucht wurde und es bei uns auf den Bahamas bis zum Einfall der ersten Jumboladungen von snow birds – so nennt man die amerikanischen Touristen auf den Inseln – noch gut zwei Monate hin war.
Später habe ich mich oft gefragt, was wohl geschehen wäre, wenn ich in der Nacht zu jenem Freitag mit Sabrina an der Bar des Cable Beach Casino völlig versumpft wäre und die Flüge am folgenden Tag hätte ausfallen lassen.
Eigentlich wäre es meine Pflicht gewesen, auch wenn es nur sechs, sieben Drinks gewesen waren, die ich mir erlaubt hatte. Doch ich zählte nun mal nicht zu den seltenen Exemplaren unter den Inselpiloten, die sich immer hundertprozentig an die Vorschriften halten und schon Angst um ihre Lizenz haben, wenn es bei einem Essen Rumkuchen zum Dessert gibt.
Ich glaubte die Vorschriften für mich etwas großzügiger auslegen zu dürfen, denn was riskierte ich schon, wenn ich mit etwas Restalkohol im Blut aufstieg? Im schlimmsten Fall doch meine eigenen Knochen, ein paar Dutzend Kisten mit Gemüse und anderer schnell verderblicher Fracht sowie die Existenz meines Ein-Mann-Unternehmens namens Island Cargo Air in Form einer betagten Mallard, die in ihren über zwanzig Dienstjahren als Wasserflugzeug unter guten und schlechten Piloten schon unzählige rüde Starts und nicht weniger raue Landungen klaglos weggesteckt hatte. Denn Passagiere beförderte ich, zu meinem Leidwesen, nur ganz selten.
Doch ich konnte es auch keinem verdenken, wenn er einem Flug in meiner Maschine wenig Geschmack abgewinnen wollte, roch es in ihr doch meist nach verfaulten Obst- und Gemüseresten. Wie in einer Markthalle nach Verkaufsschluss. Dieser Geruch hatte sich im Laufe der Zeit einfach in ihr festgefressen, wie sehr ich mich auch anstrengte, den Frachtraum so sauber wie möglich zu halten. Hinter irgendeiner Strebe blieb doch immer wieder mal eine halbe Tomate oder ein Stück zerquetschte Kartoffel hängen.
»Gurken-Express« und »Broccoli-Bomber« gehörten noch zu den wohlwollenden Spitznamen, die andere Piloten meiner Mallard verpasst hatten. Dagegen klang Hurricane – so hatte ich sie getauft – wie ein geschmackloser Euphemismus. Dabei hatte sie sich diesen Namen meiner Meinung nach redlich verdient, hatte sie doch einen ausgewachsenen Hurricane überstanden und war sicher in einer geschützten Bucht vor Green Turtle Cay heruntergekommen, wenn auch nicht ganz ohne Blessuren an Schwimmern, Rumpf und Leitwerk. Die Firma, für die sie bis dahin geflogen war – die letzten vier Jahre mit mir am Steuerknüppel –, hatte es vorgezogen, die Kosten für die Reparaturen zu sparen und sie dafür äußerst preiswert zum Verkauf anzubieten. Es war sowieso schon geplant gewesen, sie auszumustern und durch eine fabrikneue zu ersetzen.
Für mich war das die Chance für den Sprung in die Selbstständigkeit gewesen. Lange genug geträumt davon hatte ich ohnehin schon. Mit viel Optimismus, großem Arbeitseifer und einem noch größeren Berg Schulden war ich also ins Air-Cargo-Geschäft eingestiegen. Zwei Jahre hatte ich verbissen geschuftet, um mich gegen die Konkurrenz zu behaupten und so weit zu kommen, dass unter dem Strich jeden Monat für mich in etwa so viel übrigblieb, wie ich vorher als angestellter Pilot verdient hatte, und das war nicht gerade berauschend gewesen.
Doch immerhin gehörte die Island Cargo Air mir, zumindest nach außen hin. Denn wenn ich auch schon einen Teil meiner Schulden beglichen hatte, waren meine Verbindlichkeiten gegenüber der Bank doch noch hoch genug, dass immer noch sie der wirkliche Eigentümer war. Aber aus diesem Blickwinkel betrachtet, gehört den Banken heutzutage ja mindestens jede zweite Firma und sogar der eine oder andere internationale Konzern, so dass ich mich also in prominentester Gesellschaft befand.
Alles in allem konnte ich eigentlich recht optimistisch in die Zukunft blicken und damit rechnen, dass ich in etwa fünfzehn Jahren, also mit dreiundfünfzig, schuldenfrei sein würde und dann die Früchte meiner Plackerei genießen und ein sorgloses Leben führen konnte – sofern einige nicht ganz unwesentliche Kleinigkeiten, die ich meiner Rechnung zugrunde gelegt hatte, auch tatsächlich wie geplant eintrafen. So durfte ich keinen meiner guten Kunden verlieren und niemals länger als zwei Tage krank sein. Zudem durften sich die fixen Kosten für Versicherungen, Ersatzteile und Wartung nur so langsam verteuern, wie auch mein bescheidener Profit wuchs. Doch hauptsächlich musste mir das Wunder gelingen, die Hurricane noch fünfzehn Jahre in der Luft zu halten, denn die enormen Anschaffungskosten für eine neue Maschine waren in meiner Hochrechnung natürlich nicht enthalten.
So jedenfalls stand es um mich und die Island Cargo Air bestellt, als jener Freitag im September heraufdämmerte. Wie zuvor schon gesagt, die Frage, was wohl passiert wäre, wenn ich den Freitag ganz von meinem Flugplan gestrichen hätte, beschäftigt mich seither immer wieder.
Vielleicht wäre der eine oder andere heute noch am Leben, wenn ich an diesem Morgen einige Entscheidungen anders oder gar nicht getroffen hätte. Aber daran glaube ich eigentlich wirklich nur dann, wenn ich zwei, drei Margaritas beziehungsweise Gin Tonics zu viel getrunken habe, doch Margaritas sind in diesem Teil Afrikas, in den es mich seit den blutigen Ereignissen von vor fünf Jahren verschlagen hat, eher eine Seltenheit wie unbestechliche Beamte und allmählich auch große Elefantenherden in freier Wildbahn.
Viel wahrscheinlicher ist, dass es gar nichts geändert hätte, auch wenn ich den ganzen Tag nicht aus dem Bett gekommen wäre. Ich stand auf ihrer Liste, seit Langem schon. Damit war die einzig wichtige Entscheidung, die etwas ausgemacht hätte, schon gefallen. Ich war einfach nur eine Figur auf dem Schachbrett ihrer Millionengeschäfte, ein gesichtsloser Bauer, den sie gedankenlos für ihre Pläne einsetzten und ebenso gedankenlos auch opferten, wenn er seinen Zweck erfüllt hatte oder gar störend wurde.
Es war ein Tag, der so zärtlich begann, wie ich ihn mir zärtlicher nicht hätte wünschen können, und der mit einem Verbrechen endete. Mit einem rätselhaften Mord, der meinem Leben eine neue Richtung geben sollte – geradewegs ins nächste Grab, wie es schien.
2
Es war erst kurz nach fünf und noch dunkel über Nassau auf New Providence Island, als mich ein veränderter Klang im vertrauten Klappern der Klimaanlage weckte. Ein Streifen Metall schien sich im Gehäuse der alten Amana-Air-condition losgerissen zu haben und schepperte nun hell im Gebläse, das auf vollen Touren lief.
Ich richtete mich halb auf, fuhr mir mit der Hand über das Gesicht und überlegte, ob ich aufstehen und die Anlage abstellen sollte. Doch ich verspürte wenig Lust dazu, und noch weniger, als mein Blick auf Sabrina fiel.
Sie lag auf der Seite, das Gesicht mir zugewandt und die Beine leicht angewinkelt. Das dünne Laken hatte sie wie üblich im Laufe der Nacht ans Bettende geschoben, so dass sich mir ihr sinnlicher Körper in voller Nacktheit darbot. Mein Blick ging über ihr tiefschwarzes Haar, das sich wie eine schwarze Flut über das weiße Kopfkissen ergoss und ihr hübsch geschnittenes Gesicht umschloss, verweilte kurz auf ihren schönen Brüsten und folgte dann den sanften verführerischen Linien ihres Leibes hinunter zu ihren Hüften und makellosen Beinen. Ihr Körper war sonnengebräunt, blieb ihr doch als Hotelfotografin hier im British Colonial tagsüber Zeit genug, um am Strand oder am Pool in der Sonne zu liegen. Aber zu dieser Bräune gesellte sich bei ihr noch eine sanfte Naturtönung der Haut, wie man sie nur bei Bahamanern findet, die im Stammbaum ihrer Vorfahren nicht nur Weiße führen. Zweiunddreißig war Sabrina, doch die meisten schätzten sie gerade auf Mitte zwanzig.
Ich streichelte sie, und ein Lächeln auf ihren dunkelroten Lippen verriet mir, dass sie wach war, noch bevor sie die Augen öffnete und mich ansah. Das geschah erst viel später, als sie sich schon längst mit einem wohligen Seufzer auf den Rücken gedreht und ich ihre Brüste geküsst hatte.
»Das ist die einzig zivilisierte Art, geweckt zu werden«, sagte sie mit einer Stimme, die ich immer mit dunklem Samt assoziierte.
»Und ich dachte bisher, du wärst mehr für das Wilde«, neckte ich sie und streichelte die Innenseiten ihrer Schenkel, die sich unter meinen Liebkosungen öffneten.
»Erst danach, Dean«, sagte sie mit einem leisen Lachen und schlug nun die Augen auf.
Ich strich ihr das Haar aus dem Gesicht, und sie ließ ihre Hände über meinen Körper gleiten, um meine Erregung noch zu steigern. Als auch sie es nicht länger aushalten konnte, zog sie mich auf sich. Voller Begehren kam sie mir mit ihrem Schoß entgegen. Als ich in sie eindrang, schlang sie ihre Beine um meine Hüften, als wollte sie mich so tief wie möglich in sich spüren und mich nie wieder freigeben.
Vertraut mit dem Körper und der Lust des anderen, bewegten wir uns erst langsam, fast wie in Zeitlupe. Sabrina sah mir dabei mit einem erwartungsvollen Lächeln in die Augen. Dann jedoch wurde unser Rhythmus immer leidenschaftlicher und wilder, und ihr Blick verklärte sich. Schließlich setzte Sabrina sich auf mich, während ich vor Wollust nicht mehr wusste, ob ich meine Hände auf ihre wippenden Brüste legen oder ihr straffes Gesäß umfassen sollte.
Danach lagen wir glücklich ermattet im Dämmerlicht des neuen Tages, noch von der Nachglut unserer Leidenschaft erhitzt, und schwiegen eine Weile.
»Dean?«
»Mhm …«
»Was hältst du davon, wenn wir uns ein langes Wochenende gönnen?«
»Viel«, sagte ich und dachte an die Gemüsekisten, die in Miami für mich bereitstanden und auf den Biminis, Walker’s Cay und Abaco erwartet wurden.
»Wir könnten nach Harbour Island hinüberfliegen, ein Katzensprung von einer halben Stunde mit der Hurricane, hast du mal gesagt, und durch Dunmore Town schlendern, so lange es nicht zu heiß ist«, schlug sie vor, an meine Brust geschmiegt.
»Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Es wird heiß sein, sowie die Sonne zwei Handbreit über dem Horizont steht.«
Sie ignorierte meine trocken sachliche Feststellung, weil es nicht wirklich darum ging, wie schnell es wie heiß im September auf den Bahamas werden kann. Das wusste sie genauso gut wie ich.
»Wir hätten um diese Jahreszeit den Pink Sand Beach ganz für uns und könnten für zwei Nächte im Coral Sand Hotel bleiben. Brett King wird uns bestimmt einen Sonderpreis machen.«
»Klingt wirklich verlockend«, räumte ich ein, obwohl ich wusste, dass daraus nichts werden würde. Ich hatte Aufträge nicht nur für den Freitag, sondern auch für Samstag standen einige Flüge auf meiner Liste, und ich war dankbar dafür. Es konnte ein passabler September für mich werden, vorausgesetzt, der Reifen für das Bugrad hielt noch eine Weile. Es war unverschämt, was der Händler für einen neuen verlangte.
»Und wenn du genug von mir hast, kannst du ja mit Brett an der Yellow Bird Cocktail Bar übers Fliegen fachsimpeln«, sagte sie scherzhaft.
»Keine Sorge, ich wüsste schon etwas Besseres mit so einem langen Wochenende auf Harbour Island anzufangen«, versicherte ich und wäre glücklich gewesen, wenn ich ihr den Wunsch erfüllen hätte können – und nicht nur diesen.
»So? Und das wäre?«
»Nun, Geschäftspapiere aufarbeiten zum Beispiel oder Angebote für neue Kunden kalkulieren«, flachste ich, während ich über ihre kleine, feste Brust strich.
Sie richtete sich auf und sah mich ernst an. »Aber es wird nichts daraus, Dean, nicht wahr? Du kannst nicht, stimmt’s?«, fragte sie traurig.
»Ja, ich kann nicht. Mein Boss hätte ganz sicher etwas dagegen«, erklärte ich und versuchte die Sache ein wenig ins Scherzhafte zu ziehen.
»Ich dachte, du wärst dein eigener Boss, Dean?« Der Anflug eines Vorwurfs schwang in ihrer Stimme mit.
»Ich bin solange mein eigener Boss, wie ich meine Versicherung, die Bankraten, meinen Mechaniker und die Treibstoffrechnungen bezahlen kann. Lange Wochenenden auf Harbour Island kommen da leider erst an letzter Stelle, vor allem dann, wenn ich ein paar lukrative Flüge auf meiner Liste stehen habe«, sagte ich und bereute augenblicklich den letzten Satz, der gänzlich überflüssig war und sie ja nur verletzen musste, was nicht in meiner Absicht lag.
Ich rechnete mit verständlicher Gekränktheit, doch Sabrina überraschte mich einmal mehr mit ihrer Reaktion. Sie steckte immer voller Überraschungen, in jeder Hinsicht. Und meistens war ich es, der dabei besser wegkam.
»Tut mir leid, dass ich davon angefangen habe, auch wenn ich nur laut vor mich hin geträumt habe. Ich wusste ja von vornherein, dass es nicht geht. Natürlich sind ein paar lukrative Flüge zehnmal wichtiger als alles andere. Bitte sei mir nicht böse«, entschuldigte sie sich, gab mir einen Kuss und lächelte mich an, als müsste ich ihr verzeihen.
»Ich bin ja wohl der Letzte, der hier Grund hätte, böse zu sein«, sagte ich und hatte Gewissensbisse. Sabrina gab mir so viel und ich ihr so wenig. Und dabei meinte ich nicht nur die Tatsache, dass sie mich in ihrem Zimmer im British Colonial aufgenommen hatte, als ein gar nicht mal so heftiger Sturm das Dach des viertklassigen Apartmenthauses abgedeckt hatte, in dem ich in den letzten Jahren mehr schlecht als recht zwei Zimmer bewohnt hatte – immerhin mit Blick aufs Meer.
Bulldozer und Abrissbirne hatten das zweistöckige Gebäude schon fünf Tage später dem Erdboden gleichgemacht, und eine Baufirma zog mittlerweile einen neuen, modernen Komplex mit Luxusapartments hoch, deren Miete bei Weitem das übertraf, was ich im Laufe eines guten Monats erwirtschaftete.
Die Bahamas sind zwar ein Sonnen- und Steuerparadies, doch auch dieses Paradies hat seine Schönheitsfehler. Die hohen Lebenshaltungskosten gehören zu den Schattenseiten, ganz besonders aber die astronomischen Mieten am schmalen, goldenen Rand der Insel, wo der Blick ungehindert über weite, mehlweiße Strände und grünblaues Meer geht und nicht hinüber ins Gestrüpp oder auf die schäbigen Siedlungen im Inland, wo der größte Teil der dunkelhäutigen Bevölkerung lebt.
Sabrina streckte sich neben mir und holte mich aus meinen Gedanken. »Es ist noch so früh, Dean. Lass uns noch etwas schlafen. Du hast mich so herrlich entspannt«, sagte sie und rollte sich wie eine Katze zusammen. Wenige Momente später atmete sie tief und gleichmäßig, die Augen fest geschlossen, ein kaum merkliches Lächeln auf den Lippen.
Sie besaß die bewundernswerte Gabe, sich von allen Sorgen und Zweifeln freizumachen, das Dunkel der Welt einfach wie einen hässlichen Putzlappen wegzulegen, in einen Schrank zu sperren, und das Schöne des Augenblicks ungetrübt zu genießen. Sie quälten keine Wünsche, deren Erfüllung verbissenen Ehrgeiz, große Anstrengungen und eisernes Durchsetzungsvermögen erforderlich gemacht hätten. Sie war eine ausgezeichnete, ja sogar höchst talentierte Fotografin, doch ihr fehlte einfach der Ehrgeiz, etwas aus ihrer Begabung zu machen. Sie war zufrieden damit, im B. C., wie das British Colonial von Einheimischen und langjährigen Bahamas-Touristen genannt wurde, abends in der Bar oder am Pool Hotelgäste zu fotografieren und so ihr sicheres Auskommen zu haben, das neben freier Kost und Logis aus einem besseren Taschengeld bestand – zumindest verglichen mit dem, was sie hätte verdienen können, wenn sie ihr Talent genutzt und ihren Beruf unabhängig und auf eigene Rechnung ausgeübt hätte.
Für mich war an Schlaf nicht mehr zu denken, und so stand ich vorsichtig auf, trat an eines der beiden großen Fenster, die zum Meer hinausgehen, und drehte die Jalousien in die Waagerechte. Unten im Palmengarten waren schon die Gärtner damit beschäftigt, abgefallene Palmwedel aufzuheben und die Plattenwege zwischen den üppigen Büschen und Blumenbeeten zu fegen. Hellblau schimmerte das Rechteck des Pools im Licht der Unterwasserstrahler zwischen den hohen Palmen zu mir herauf, während die Wellen, die sanft gegen den sichelförmigen Privatstrand des Hotels anrollten, und die dahinterliegende Fläche der See noch in graue Dunkelheit getaucht waren. Erst im Licht der Sonne würden die unglaubliche Brillanz und Vielfalt der grünblauen Farbtöne, die für die Inselwelt im blauen Golfstrom so bezeichnend sind, zur Entfaltung kommen.
Linker Hand blinkte das Signal des kleinen Leuchtturms, der auf der äußersten westlichen Spitze von Paradise Island steht und den Kreuzfahrtschiffen die Einfahrt in den Hafen von Nassau anzeigt.
Es war noch zu früh für mich, um nach Paradise Island hinüberzufahren, von wo aus ich meine Island Cargo Air betrieb. Deshalb beschloss ich, mein morgendliches Lauftraining, das ich in den letzten Wochen so sträflich vernachlässigt hatte, wieder aufzunehmen. Ich bezweifelte, dass ich noch in der Lage war, einen Marathon unter drei Stunden zu schaffen, geschweige denn meine frühere Bestzeit von zweieinundvierzig zu erreichen.
Aber wichtiger als magische Zahlen war das Gefühl, endlich wieder etwas für mich zu tun und meinen Körper beschäftigt zu wissen, während meine Gedanken ihre eigenen Wege gingen.
Leise zog ich meinen Trainingsanzug über, verließ das Zimmer und fuhr mit dem Fahrstuhl in die ausgestorbene Lobby hinunter. Träge drehten sich die Ventilatoren unter der Decke über hochlehnigen Korbsesseln. In einem Seitengang lärmte ein Staubsauger.
Als ich die stille Bay Street, die Haupteinkaufsstraße und das Herz Nassaus, nach Osten hinunterlief, war die Luft schon warm und schwer von Feuchtigkeit, obwohl die Sonne sich gerade erst anschickte, sich vom Horizont zu lösen und den Himmel hochzusteigen.
Ich lief unter den Arkaden der alten, hölzernen Häuser entlang, die die Bay Street säumen und zum Teil noch aus dem vorigen Jahrhundert stammen. Zweistöckige Häuser mit überdachten Veranden im Obergeschoss und in den verschiedensten Pastellfarben gehalten, von dezentem Gelb über Grün und Hellblau bis hin zu Rot und Violett. Viele hätten längst eine gründliche Renovierung nötig gehabt, zumindest jedoch einen neuen Anstrich. Doch was anderswo einfach nur schäbig wirkt, verwandelt sich im Licht der karibischen Sonne und in der Umgebung von Palmen und subtropischen Gewächsen in eine trügerisch malerische Kulisse, mit dem brüchigen Charme einer ehemals hübschen, nun ins Alter gekommenen Dame, deren Schminke die Falten und Furchen nur noch aus der Entfernung zu kaschieren vermag.
Ich blieb auf der Bay Street und folgte ihrer Verlängerung, der East Bay Street, immer parallel zum Wasser, bis hin zur High Bridge, und ich fühlte mich gut. An der Brücke, die wie ein stark gespannter Bogen die nur knapp dreiunddreißig Kilometer lange und zwölf Kilometer breite Insel New Providence mit der sehr viel kleineren Paradise Island verbindet, auf der sich die meisten der exklusiven Hotels drängen und die schönsten, meilenweiten Strände zu finden sind, gönnte ich mir eine kurze Atempause.
Die Sonne hatte schon Kraft, und ich war verschwitzt, als ich ins B. C. zurückkehrte. Dabei war es erst kurz nach sieben. Der Freitag versprach ein sehr heißer Tag zu werden.
Sabrina schlief noch tief und fest. Sie war es gewöhnt, erst gegen Mittag aufzustehen. Manchmal beneidete ich sie darum. Ich hasse wie sie das Aufstehen, liebe jedoch die Morgenstunden. Ich duschte und zog mich an.
»Bis heute Abend, und pass auf dich auf, Dean«, sagte Sabrina schläfrig, als ich mich über sie beugte und ihr einen Kuss gab.
»Du auch«, erwiderte ich automatisch. Doch worauf sollte sie schon groß aufpassen? Dass sie nicht die falsche Blende einstellte oder das falsche Hintergrundmotiv wählte? Diese Handgriffe beherrschte sie schon seit Jahren im Schlaf.
Ich nahm meinen abgewetzten Pilotenkoffer, der meine Papiere, Flips und Karten enthielt, und verließ das Zimmer. Blendender Stimmung trat ich hinaus in den strahlenden Morgen, ging zu meinem 72er Ford Mustang hinüber, klappte das Verdeck zurück und fuhr über die Shirley Street nach Osten. Als ich die gebührenpflichtige High Bridge nach Paradise Island überquerte, liefen schon einige schneeweiße Yachten und Charterboote mit schäumender Bugwelle und quirligen Heckseen aus den zahlreichen Marinas zu meiner Rechten, in denen es von Booten aller Art und Größe nur so wimmelte. Links von mir lag der farbige Flickenteppich der Häuserzeilen von Nassau.
Hinter dem Kassenhäuschen bog ich gleich links in den Paradise Beach Drive ein, passierte die Brücke über den Kanal, der zum Paradise Lake führt, und hatte dann nur noch knapp fünfhundert Yards zum Firmengelände meiner Island Cargo Air.
Es war eigentlich nicht mehr als ein großer, nachlässig betonierter Platz direkt am Ufer mit einer Betonrampe, die sanft ins Wahr führte. Neben meiner bauchigen Mallard mit ihren hochangesetzten Tragflächen, deren Spannweite über sechsundsechzig Fuß betrug, stand auf diesem Platz nur noch ein flacher blaugrauer Wellblechschuppen, und zwar am linken Rand, wo hohe Kiefern ein wenig Schatten spendeten. Der langgestreckte Schuppen beherbergte mein Büro, ein dahinterliegendes Zimmer, das etwas privater eingerichtet war und wo auch eine Schlafcouch stand, sowie eine kleine Werkstatt und zwei große Lagerräume. Vor dem flachen Gebäude, gleich neben der Tür zum Büro, standen ein runder, steinerner Gartentisch mit einem Sonnenschirm in der Mitte und zwei halbrunde Bänke aus Beton.
Vor dem Schuppen parkte ein rostiger Chevy Pick-up. Nelson war also schon da, was mich überraschte. Schließlich war ich eine gute halbe Stunde zu früh.
Nelson Darville, ein hagerer, dunkelhaariger Mischling von gerade dreißig Jahren, war mein einziger Angestellter, mein Mädchen für alles sozusagen. Er be- und entlud die Maschine, transportierte mit seinem Pick-up Fracht von und zum Flugfeld, wenn keine anderen Arrangements getroffen waren, erledigte einen Teil des Bürokrams, nahm Anrufe entgegen und vertröstete verärgerte Kunden, wenn mein Flugplan mal wieder durcheinandergeriet, weil ich in Miami festsaß oder sich das Entladen auf einer der abgelegenen Out Islands verzögerte. Er hielt auch meinen alten Mustang in Schuss und wartete fachmännisch die Hurricane.
Kurzum, er war eine wahre Perle, eigentlich unbezahlbar, und hätte ein Vielfaches der hundertachtzig Dollar, die er wöchentlich von mir bekam, verdienen können. Als gelernter Flugzeugmechaniker hätte er einen gutbezahlten Job bei einer der großen Fluglinien drüben auf dem Nassau International Airport haben können – wenn er nicht diesen fatalen Hang zum Alkohol gehabt hätte. Nicht, dass er täglich an der Flasche hing oder betrunken zum Dienst kam. Nicht einmal habe ich ihn bei der Arbeit einen Tropfen Alkohol anrühren sehen. Wenn er zum Dienst erschien, dann so stocknüchtern wie ein strenggläubiger Baptist.
Es konnte Wochen gut mit ihm gehen. Doch dann kam irgendwann unweigerlich der Tag, an dem ich vergebens auf ihn wartete, weil er im nächsten Schnapsladen den halben Rumbestand aufgekauft hatte. Ich brauchte mir gar nicht erst die Mühe zu machen, nach ihm zu suchen. Wenn der Rum ihn in seinen Fängen hatte, hielt er sich nicht zu Hause auf. Er versackte irgendwo in den Slums der Schwarzen und war dann »over the hill«, wie er es nannte.
Over the hill – so heißen in Nassau die schäbigen Schwarzenviertel, die jenseits einer Hügelkette liegen, so dass die Touristen, die sich nur am schmalen paradiesischen Küstenstreifen, in den Marinas und Luxushotels aufhalten, diese hässliche Seite der Insel nicht zu Gesicht bekommen.
Als ich den Mustang neben seinem Chevy abstellte, kam Nelson gerade von der Mallard zum Schuppen herüber. Er trug eine ausgefranste Jeans, deren Hosenbeine er kurz über den Knien abgeschnitten hatte, und ein verblichenes T-Shirt, dessen Aufdruck It’s better in the Bahamas kaum noch zu lesen war.
»Hi, Boss!«, grüßte er.
»Tag, Nelson.«
»Ich hab die Türen schon mal aufgerissen, damit ’n bisschen frische Luft in die Maschine kommt, bevor Sie rein müssen.« Er deutete mit dem Kopf zur Hurricane hinüber.
»Wird wohl heute nicht viel bringen«, meinte ich und blickte zum Windsack hinüber, der schlaff vom hohen Fahnenmast neben der Rampe herunterhing und sich nur ab und zu einmal träge bewegte. Es war fast windstill. »Aber dennoch danke, dass du daran gedacht hast.«
»Klar doch, Boss.« Er grinste zuversichtlich. »Wird schon noch Wind aufkommen. Gibt’s doch gar nicht, dass der Südost einmal ganz einschläft.«
»Dein Wort in Gottes Ohr.« Mir klebte schon jetzt das Hemd am Leib. »Irgendwelche Post?« Individuelle Postzustellung gibt es auf den Bahamas nicht, und es gehörte zu Nelsons Aufgaben, morgens gleich auf seinem Weg die Post aus dem Schließfach zu holen.
»Liegt drinnen auf der Theke«, sagte er und fügte dann mit einer gewissen Schadenfreude hinzu: »Einiges sieht mir ganz nach Rechnungen aus.«
»Du scheinst mir keine glückliche Hand zu haben, Nelson! Ich sollte mich vielleicht doch nach einem anderen umsehen, was meinst du?« Ich bedachte ihn mit einem spöttischen Blick, wurde aber schlagartig ernst, als ich bemerkte, dass er gar nicht gut aussah. Er hatte Schatten unter den Augen, und sein hageres Gesicht war angespannt und blasser als sonst.
»Ist dir heute nicht gut?«
»Mir? Warum soll mir nicht gut sein?«, fragte er zurück und sah mich dabei an, als müsste er vor etwas auf der Hut sein.
»Ganz einfach: Weil du so aussiehst wie sonst nur nach einem Drei-Tage-Trip over the hill, mein Freund!«
Er lachte gequält. »Keine Angst, Boss. Ich hab keinen Schluck getrunken.«
Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Musste ich damit rechnen, dass er bald wieder für ein paar Tage ausfiel? »Aber vielleicht bist du scharf darauf, es zu tun!«
Er schüttelte heftig den Kopf. »Das wird so schnell nicht wieder passieren!«, versicherte er.
Ich blieb skeptisch. »Und wieso siehst du so aus, als hättest du einen Gang durch die Leichenhalle hinter dir?«
»Das kommt von der schlechten Luft und der Wärme in der Maschine, Boss!«
»Ach nein«, sagte ich gedehnt.
»Ich hab nämlich schon die Kisten verladen, die nach Miami rüber müssen. Hat ’ne Weile gedauert, und Sie wissen ja, dass ich den Mief da drin morgens nicht abkann«, beteuerte er und fingerte nervös an seiner schweren, goldenen Halskette mit dem Adlerkopf als Anhänger, der so groß war wie mein Handteller.
»So, du kannst also den Mief nicht ab. Nun, da bist du nicht der Einzige«, sagte ich, nicht völlig überzeugt, dass seine Blässe wirklich davon kam, ließ es aber dabei bewenden. Ich konnte es ja doch nicht verhindern, auch wenn ich gewusst hätte, dass er schon wieder den Drang zur Rumflasche verspürte.
Wir gingen ins Büro. Ein Raum sechs Schritte im Quadrat. Unter einem vergitterten und mit Moskitodraht verhängten Fenster ein alter stählerner Schreibtisch, auf dem es trotz bester Vorsätze meinerseits immer so aussah, als hätte gerade jemand die vier Aktenschränke, die rechts und links davon standen, auf ihm geleert. Dazu ein kleiner Rolltisch mit einer knallroten IBM-Schreibmaschine, zwei Stahlrohrsessel mit Kunstlederbezug, der Brandlöcher und mit Plastikfolie überklebte Risse aufwies, ein weißer, mit Messingbeschlägen verzierter Ventilator unter der Decke, der seine Mucken hatte, ein Klotz von einem Eisschrank, der schon so uralt war, dass er auf einem Antiquitätenmarkt sicher einen guten Preis gebracht hätte, daneben ein weiterer Aktenschrank, auf dem die Kaffeemaschine und ein Durcheinander von Filtertüten, Zuckerbeuteln, Bechern und Dosen verschiedensten Inhalts standen, und gleich zwei Schritte hinter der Tür eine brusthohe Theke als Raumteiler. An den Wänden alte Kalenderblätter von Piper und Grumman sowie ein paar verblichene Poster vom bahamanischen Fremdenverkehrsamt.
Nelson hatte die Kaffeemaschine schon angestellt, und die Kanne war inzwischen vollgelaufen. Ich füllte meinen Becher, verzichtete nach kurzem Zögern auf den Zucker und verrührte einen Löffel Trockenmilch, während ich an die Theke trat und die Post im Stehen durchging. Es waren wirklich mehrere Rechnungen darunter.
»Na, prächtig. Da hat man doch gleich viel mehr Freude am neuen Tag.« Ich sortierte die Rechnungen aus. Später, wenn ich meine Flüge hinter mir hatte, wollte ich sie mir vornehmen.
Nelson zündete sich eine Zigarette an. »Ich hab auch den Anrufbeantworter schon für Sie abgehört«, sagte er und schlürfte seinen Kaffee.
»Und?«, fragte ich, während ich den Brief eines potenziellen Kunden, der eine große Ferienanlage auf Cat Island hochzog, aufriss. Er schrieb, dass er sich noch nicht entschieden habe, ich jedoch noch mit im Rennen um den Auftrag läge. Keine Zusage, aber auch keine Absage.
»Es war ’n Anruf von Ihrer Frau drauf.«
»Exfrau!«, korrigierte ich ihn und schlitzte den nächsten Brief auf.
»Sorry, Boss.«
»Und? Was wollte Lilian?«
»Sich beschweren, dass Sie nie zu erreichen sind, höchstens so früh am Morgen, wenn zivilisierte Leute noch im Bett liegen«, sagte Nelson mit einem breiten Grinsen. »Und Ihre Blechstimme auf dem Anrufbeantworter mache jedes Mal die Bemühungen ihres Psychiaters zunichte, dem sie zweimal die Woche hundert Dollar für seine Aufmunterungen zahle, sich nicht mehr über Sie zu ärgern.«
»Vorsicht, mein Freund!«
»Das hat sie gesagt, sogar fast wörtlich.«
»Das hast du aber schön behalten, Nelson.«
»Hab’s mir ja auch ’n halbes Dutzend Mal angehört, Boss.«
»Ich glaub’s dir. Klingt wirklich Originalton Lilian. Sie sollte es mal spät am Abend versuchen. Aber dann hetzt sie ja von einer Vernissage zur anderen High-Society-Party«, spottete ich. »War das alles, was sie wollte?«
»Nein. Sie sagte noch, dass sie eine Abrechnung fertig hätte und Sie gefälligst kommen sollten, um sich das Geld abzuholen, falls das von einem halb bankrotten Inselspringer nicht zu viel verlangt sei«, zitierte Nelson Darville genussvoll. »Sollten Sie aber nicht mehr genug Geld oder Kredit haben, um die paar Gallonen Sprit für den Flug nach Miami bezahlen zu können, wäre sie unter Umständen bereit, für Sie den Geldkurier zu spielen.«
Ich seufzte. »Wie rücksichtsvoll und besorgt sie doch ist, nicht wahr?«
»Ja, klang mir auch so, Boss.« Er zeigte seine fleckigen Zähne. Doch der unruhige Blick seiner Augen passte irgendwie nicht zu dem leicht spöttischen Tonfall, der gewöhnlich zwischen uns herrschte.
»Ich werde Lilian anrufen, wenn ich in Miami bin«, sagte ich und schmiss die Reklamesendungen, die einem den Ausverkauf der Welt in bequemen Teilzahlungsraten schmackhaft zu machen versuchten, gleich ungelesen in den Papierkorb.
Lilian, von der ich nun schon gut sechs Jahre geschieden war, half mir dabei, ein paar Hunderter nebenbei zu verdienen. Ich versorgte sie mit naiver bahamanischer Holzschnitzkunst, die sie in der von ihr gemanagten Galerie im Miami-Nobelviertel Coconut Grove verkaufte. Damit tat sie mehr mir einen Gefallen als ich ihr, denn die nette Provision, die ich einstrich, hätte sie sich sparen können. Sie hätte bloß alle paar Monate einmal auf die Bahamas fliegen und den Einkauf bei den einheimischen Künstlern persönlich tätigen müssen. Aber sie beharrte darauf, vor mir die Illusion aufrechtzuerhalten, dass unsere jetzige Regelung für beide Seiten von Vorteil war. Es fragte sich nur, wo für sie der Vorteil lag. Dass sie mich nicht aus den Augen verlor? Wie auch immer, ich konnte das Geld auf jeden Fall gut gebrauchen.
»Sonst noch was?« Es wurde Zeit, dass ich mich hinter den Steuerknüppel meiner Hurricane klemmte und in die Luft kam.
»Ja! Das hätte ich doch fast vergessen!« Nelson zündete sich an der Glut der alten eine neue Zigarette an und hustete. »Dieser Mister Cranston hat angerufen, Sie wissen doch, der mit den Elektrowagen für die Golfplätze.«
Ich horchte auf. »Na, komm schon, lass dir nicht immer jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen! Was hat er gesagt?«
»Die Sache geht klar. Sie müssen aber schon heute die ersten sechs Wagen in Miami abholen und nach Great Abaco bringen.«
»Du hast ihm doch hoffentlich gesagt, dass das kein Problem ist, oder?« Sechs in ihre Einzelteile zerlegte und in Kisten verpackte Golfwagen waren für den Frachtraum der Hurricane kein Problem. Und diese sechs sollten erst der Anfang sein.
»Klar hab ich das, Boss!«, versicherte Nelson. »Mister Cranston schickt um halb drei einen Mister Benson hierher, der offensichtlich so etwas wie seine rechte Hand ist. Er wird mit Ihnen nach Miami fliegen und sehen, wie alles klappt.«
»Ruf ihn an und sag ihm, dass er sich seinen Aufpasser sparen kann. Er wird zufrieden sein. Zerlegte Golfwagen sind bestimmt nicht so empfindlich wie Tomaten.«
»Er hat darauf bestanden, Boss.«
»Davon ist vorher aber nie die Rede gewesen.«
»Na und? Ich meine, wenn er dafür bezahlt, soll es Ihnen doch egal sein, ob Ihnen beim ersten Transport jemand auf die Finger schaut, oder?«
Ich zögerte.
»Außerdem hat dieser Benson auch die Papiere für den Zoll«, fügte Nelson hinzu. »Wird Ihnen wohl nichts anderes übrigbleiben, als ihn mitzunehmen. Vielleicht ist der Typ ja auch ganz in Ordnung.«
»Du hast recht, Nelson, mir soll’s letztlich egal sein, wenn ich dafür den fetten Auftrag an Land ziehen kann«, sagte ich, regelrecht beschwingt von der Aussicht, mit Mister Cranston ins Geschäft zu kommen.
»Also denken Sie daran, Boss: Mister Benson will noch vor drei hier abfliegen. Würde sich nicht gut machen, wenn Sie ihn ’ne Stunde warten ließen, um dann drüben in Miami vielleicht auf verschlossene Lagerhallen zu stoßen.«
»Danke für die Erinnerung, Nelson. Ich werde pünktlich zurück sein«, versprach ich, leerte meinen Becher und ging aufs Rollfeld hinaus.
Es war ein leichter Wind aufgekommen, ganz wie Nelson gesagt hatte. Noch waren kaum Wolken am Himmel, doch das würde sich ändern. In ein paar Stunden bildeten sich bei diesen Temperaturen über der Landmasse der größeren Inseln Kumuluswolken, und gegen Mittag war mit diesigem Himmel und verminderter Sicht zu rechnen.
Nachdem ich, wie vor jedem ersten Flug des Tages, den Außencheck der Maschine hinter mich gebracht hatte, stieg ich die acht Metallstufen der kleinen, rollbaren Gangway hoch und betrat die Hurricane durch die Ladeluke am Heck, und der ganz eigene Geruch meines »Broccoli-Bombers« schlug mir entgegen.
»Guten Flug, Boss!«, rief Nelson mir zu und zog dann die Treppe von der Maschine an den Rand des Rollfelds.
Ich nickte ihm zu und verriegelte die Ladeluke. Als die Hurricane noch im reinen Passagierflugdienst eingesetzt gewesen war, hatten in ihr zweiundzwanzig zahlende Fluggäste und im Cockpit ein Team aus Pilot und Copilot Platz gefunden. Bis auf die erste Sitzreihe gleich hinter der Flugkanzel hatte ich alle Sitze herausgerissen. An ihrer Stelle hatte ich den Raum in verschieden große Frachtkäfige aus Stahldraht aufgeteilt. Diese wiederum wurden von leichten horizontalen Alu-Gittern unterteilt. Auf diese Träger schob ich die Kisten mit Obst und Gemüse, ohne befürchten zu müssen, dass die Kisten und Kartons bei Turbulenzen verrutschten oder in kritischen Flugsituationen als lebensgefährliche Geschosse durch die Kabine flogen. Hatte ich sperrige Fracht zu transportieren, bedurfte es nur weniger Minuten, um die Gitter und Zwischenteiler auszuhängen und so Raum zu schaffen.
Ich freute mich auf den Tag, der vor mir lag, und konnte es nicht erwarten, vom Boden zu kommen. So klemmte ich mich hinter den Steuerknüppel, nahm die Checkliste zur Hand und ging gewissenhaft alle Positionen durch. Es war manchmal enervierend, jedoch unerlässlich, und ich zwang mich stets dazu, keine Positionen zu überschlagen, nur weil ich zu wissen meinte, es sei ja alles in Ordnung, da stets bestens gewartet. Ich habe einige Piloten gekannt, hervorragende sogar, die das Opfer ihrer eigenen Erfahrung und einer damit oftmals Hand in Hand gehenden Nachlässigkeit geworden waren.
Schließlich ließ ich die beiden Motoren an, erst den linken, dann den rechten. Zweimal sechshundertachtzig PS röhrten los, ließen die Hurricane erzittern und waren Musik in meinen Ohren. Ich setzte die Kopfhörer auf, und während die Motoren warmliefen, gab ich meinen Flugplan über Frequenz 128.0 auf und holte mir dann von der ATIS, dem Airport Terminal Information Service, auf 118.3 die Informationen über das Wetter am Platz. Der Wind blies jetzt mit zwei Knoten aus Ostsüdost.
Schließlich war ich bereit. Nelson hatte schon die Bremsklötze weggenommen, stand in sicherer Entfernung von den Propellern und streckte mir die geballte Faust mit hochgestelltem Daumen entgegen. Ich erwiderte das Okay-Zeichen, löste die Bremsen und schob die Gashebel ein wenig vor.
Die Hurricane bewegte sich schwerfällig wie eine übermästete, fette Gans über das Betonfeld, rollte dann die Rampe hinunter und glitt sanft ins kristallklare Wasser. Hier war das Flugboot in seinem Element.
Ich fuhr das Fahrwerk ein und lenkte die Hurricane dann in die Mitte der Wasserstraße, drehte die Nase in den Wind, in Richtung Hochbrücke, so dass Paradise Island nun zu meiner Linken und Nassau und der Yachthafen zu meiner Rechten lag. Ich musste einen Augenblick warten, weil zwei Glasbodenboote die Fahrrinne kreuzten und ein kleiner Frachter auf Potters Cay zuhielt. Dann jedoch war die grünblaue Startbahn klar für mich, und ich schob beide Gashebel bis fast zum Anschlag vor.
Das Dröhnen der Motoren schwoll an, und der leicht nach innen gewölbte, einem Boot nachempfundene Rumpf der Hurricane schnitt elegant durch das Wasser, von den beiden Schwimmern an den Spitzen der Flügel stabilisiert. Ein Rucken, begleitet von einem trockenen Schlagen, ging durch die Maschine, als sie die Heckseen des Frachters teilte.
Sechzig, siebzig, fünfundsiebzig Knoten. Mit rasch zunehmender Geschwindigkeit raste die Hurricane zwischen den hoch aufragenden Stützpfeilern der Brücke hindurch.
Die Nadel passierte die Achtzig-Knoten-Marke. Ich hatte nicht viel geladen, also zog ich den Steuerknüppel sanft an, und augenblicklich, als wäre sie selbst begierig, sich in die Lüfte zu erheben, löste sich die Hurricane vom Wasser, reckte die Nase in den blauen Himmel und stieg leicht wie eine Feder im Wind empor.
Ich zog die Maschine in eine weite Kurve um Paradise Island herum, während ich mit fünfhundert Fuß pro Minute meinen Aufstieg fortsetzte.
Schnell fielen Paradise Island und New Providence mit Nassau unter mir zurück, schrumpften zu langgestreckten dunklen Flächen mit hellen Rändern, wo weiße Strände die Küsten säumten.
Es war noch früh am Tag und die Sicht dementsprechend gut. In allen nur denkbaren Variationen von Grün und Blau schimmerte das Meer unter mir. Deutlich waren Sandbänke und Riffe, an denen sich die Wellen mit schäumender Gischt brachen, zu erkennen. Dort, wo das Wasser in dunkle Tiefen abfiel, war es von einem unglaublichen Königsblau, während es in flachen Lagunen smaragdgrün und türkis leuchtete. Und in dieser sonnenüberfluteten See intensivster Grün- und Blautöne, die sich von Horizont zu Horizont erstreckte, schwammen Hunderte von kleinen und großen, meist unbewohnten Inseln. Manche von Palmen, Kiefern und Mangroven bewachsen und mehrere Meilen lang, andere unwirtlich kahl und kaum größer als ein Tennisfeld. Und überall Riffe, die einige dieser Inseln, ob nun ausgedehnt oder aus der Höhe kaum als solche zu erkennen, mit einem perfekten Schutzring aus scharfkantigem Korallgestein umgeben.
Was immer mich auch an Problemen bedrückte und beschäftigte, diese Sorgen fielen von mir ab und waren vorübergehend ohne Bedeutung, sowie ich in der Luft war und das tat, was ich am meisten liebte und auch heute noch liebe: Fliegen.
Es war kein euphorischer Zustand, der mich blind und taub für alles andere im Leben machte, sondern vielmehr ein eher stilles Gefühl der Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, das mich erfüllte und mich mit allem versöhnte, was ich an Ungerechtigkeiten und Handikaps ertragen zu müssen glaubte.
Aber Flüge zwischen den über siebenhundert Inseln der Bahamas und dem amerikanischen Festland dauern nicht ewig, von Nassau bis nach Miami sind es noch keine hundertsechzig nautische Meilen, für die Hurricane gerade eine knappe Flugstunde, vorausgesetzt, ich ließ es sehr gemütlich angehen und holte nicht die Spitzengeschwindigkeit von über zweihundertdreißig Knoten aus ihr heraus. Somit waren meine Perioden innerer Ausgeglichenheit immer nur von kurzer Dauer. Doch ich genoss davon jede Minute, während ich das VOR-Funkfeuer von Bimini einstellte und die Maschine auf Kurs 292 legte.
3
Die Hitze wurde gegen Mittag unerträglich. Ich hatte im Cockpit alle Frischluftdüsen aufgedreht und zusätzlich noch die beiden Ventilatoren auf höchster Stufe laufen, und doch rann mir der Schweiß in Strömen über das Gesicht. Mein Mund war ausgedörrt, und meine Zunge fühlte sich wie ein trockener Lappen an. Und dabei hatte ich vor einer halben Stunde in Rock Sound noch zwei Dosen Tonic-Wasser geleert, leider aber vergessen, meine Getränkekühlbox wieder aufzufüllen.
Unbarmherzig brannte die Mittagssonne herab. Ich hatte die Sonnenbrille mit der stärksten Tönung aufgesetzt, die einen sonnigen Tag normalerweise in einen frühen Abend verwandelte. Doch diesmal nützte sie wenig. Die Augen taten mir weh. Der Himmel war wie ein gigantisches Seidentuch, das mit blendender Helligkeit das Licht von tausend Flutlichtstrahlern zu reflektieren schien – und zwar mir direkt in die Augen, als ich um kurz nach zwei über dem Hafen von Nassau herunterging. Ich nahm die Geschwindigkeit zurück, fuhr die Landeklappen bis auf dreißig Grad aus und setzte die Hurricane mit achtzig Knoten auf der glitzernden Wasseroberfläche auf, genau auf der Höhe der BASRA-Station, der Bahamas Air Sea Rescue Association, einer freiwilligen Rettungsorganisation.
Ich hatte mich beeilt, und was die Geschäfte betraf, war es bis dahin ein guter Tag gewesen. So gesehen hatte sich der Schweiß gelohnt.
Die Motoren der Hurricane erstarben. Als ich aus der Maschine stieg, warf mir das Betonfeld die Hitze wie ein Heizstrahler entgegen.
»Boss, das ist der Mann von Mister Cranston«, sagte Nelson, als ich in das um einige Grad kühlere Büro trat und geradewegs auf den Kühlschrank zusteuerte. Mir klebten Hemd und Hose am Leib, als hätte ich einen Saunagang in voller Montur hinter mir, was der Sache ja auch recht nahe kam.
Benson war ein stämmiger, untersetzter Mann Anfang Vierzig mit einem kräftigen Hals, kurzen Armen und wellig braunem Haar, das sich über der hohen Stirn schon stark lichtete. Sein gerötetes, fülliges Gesicht wurde von einer zu klein geratenen Nase und hellen, intensiven Augen beherrscht. Seine Kleidung war dem heißen Wetter angepasst, sportlich und ohne Zweifel teuer. Wie wohl auch die diamantenbesetzten Ringe an seinen manikürten Fingern und die flache goldene Armbanduhr. Man sah ihm an, dass er sein Geld nicht mit körperlicher Arbeit verdiente. Er war nicht mein Typ, aber das traf auf viele zu, mit denen ich Geschäfte auf den Inseln und in Miami machte. »Roy Benson«, stellte sich Cranstons Aufpasser vor. »Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mister Stanford.«
»Ganz meinerseits, Mister Benson«, erwiderte ich höflich. »Komme ich zu spät, oder sind Sie zu früh?«
»Letzteres. Ich dachte, ich bin etwas eher da, damit wir noch Zeit genug haben, um einiges zu besprechen, was Mister Cranston und damit auch mir auf dem Herzen liegt.«
»Nichts dagegen. Aber geben Sie mir noch einen Augenblick, dann stehe ich ganz zu Ihrer Verfügung«, bat ich ihn.
»Gern«, sagte Benson, zündete sich eine Zigarette an und rauchte in kurzen, hastigen Zügen, als könnte er das Nikotin nicht schnell genug in seine Lungen pumpen.
Ich riss den Kühlschrank auf, griff nach einer vollen Literflasche Club-Soda und leerte sie zur Hälfte, bevor ich sie zum ersten Mal absetzte.
Roy Benson schaute mir mit einem leicht spöttischen Lächeln zu. »Sie haben einen beachtlichen Schluck, Mister Stanford«, sagte er anerkennend und musterte mein klatschnasses Hemd. »Scheint mir kein geruhsamer Job zu sein, den Sie sich da ausgesucht haben, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben.« Er drückte seine Zigarette aus, um sich augenblicklich eine neue anzustecken – mit einem goldenen Dunhill-Feuerzeug.
Ich verzog das Gesicht. »Und Sie haben sich vermutlich den heißesten Tag des Jahres ausgesucht, um mit mir nach Miami zu fliegen – in einer Maschine ohne Klimaanlage.«
Er zuckte nur die Achseln. »Wenn alles so reibungslos läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, wird es mein erster und einziger Flug mit Ihnen sein. Und ich werde gut dafür bezahlt«, versicherte er.
»Keine Sorge, es wird keine Schwierigkeiten geben, Mister Benson.«
»Nein, damit rechne ich auch nicht«, stimmte er mir zu.
Nelson räusperte sich. »Ich geh schon mal raus, die Kisten einladen«, sagte er. »Gecheckt sind sie ja schon.«
»Welche Kisten?«, wollte ich wissen.
»Einige persönliche Dinge von mir, die ich bei dieser Gelegenheit gleich nach Miami schaffen möchte«, erklärte Roy Benson mit beiläufigem Tonfall. »Ich werde für Mister Cranston in Zukunft mehr Geschäfte auf dem Festland wahrnehmen, deshalb habe ich mir in Miami ein kleines Studio gemietet. Natürlich können Sie das mit auf die Rechnung setzen. Es sind vierundneunzig Kilo. Der Bursche hat’s schon abgewogen.« Er deutete mit dem Kopf zu Nelson hinüber, der abwartend an der Tür stand.
»Ganz wie Sie wünschen«, sagte ich. Mir sollte es nur recht sein, wenn ich Mister Cranston noch ein paar Dollar mehr berechnen konnte. Ich nickte Nelson zu, der uns wortlos verließ.
»Zoll und Einreise werden uns aber Zeit kosten.« Ich fühlte mich verpflichtet, ihn zu warnen.
»Unser Mann in Miami wartet schon«, erwiderte er. »Aber wir können ja auch gleich losfliegen, nachdem ich Ihnen erklärt habe, wie sich Mister Cranston die weitere Zusammenarbeit vorstellt, Mister Stanford.«
Er kam nicht mehr dazu, mir die Vorstellungen von Mister Cranston zu unterbreiten, denn in diesem Moment ging die Tür auf – und eine Frau betrat das Büro.
Warum habe ich mir nicht zuerst frische Sachen angezogen, statt hier in dem verschwitzten Zeug herumzustehen und mit diesem Benson zu quatschen, was ich doch auch noch in der Maschine hätte tun können!, war mein erster Gedanke. Es war ein verrückter Gedanke, aber genau das ging mir in dem Augenblick durch den Kopf, als ich Shirley Lindsay zu Gesicht bekam.
»Island Cargo Air?«, fragte sie zögernd und blickte sich unsicher um, als bezweifelte sie, am richtigen Ort zu sein. Ich verstand sie. Dieser Schuppen war kaum der rechte Platz für eine Frau wie sie. »Bin ich hier richtig?«
Sie war eine Schönheit von der Art, die einem den Atem nimmt wie ein Sprung in eiskaltes Wasser. Ja, ich war wirklich im ersten Moment sprachlos vor Überraschung und Bewunderung. Vielleicht lag es aber auch an dem extremen Kontrast, den ihre Erscheinung zu meinem schäbigen, stickigen Büro und zu mir darstellte.
Goldblondes, hübsch gelocktes Haar umfloss ein herzförmiges Gesicht, das makellos geschnitten war. Unter sanft geschwungenen Brauen und langen, dichten Wimpern lagen dunkelbraune Augen. Perfekt auch die Nase und die vollen, himbeerroten Lippen. Erregend die Formen ihrer Brüste, die sich unter einem goldfarbenen Seidentop abzeichneten. Ihr enger cremefarbener Leinenrock betonte ihre schlanke Taille und endete ein gutes Stück oberhalb der Knie, so dass ihre langen Beine zur Geltung kamen. Die passende Jacke hielt sie zusammen mit einer Handtasche aus Gobelinstoff in der linken Hand, in der rechten eine Sonnenbrille mit großen, verspiegelten Gläsern. Ihr Alter schätzte ich auf Anfang Zwanzig.
Ich fasste mich wieder. »Wenn Sie zur Island Cargo Air wollen, sind Sie hier goldrichtig«, sagte ich und fragte mich insgeheim, was sie wohl bei mir verloren hatte.
Sie musterte mich mit ihren dunkelbraunen Augen. »Sind Sie der Pilot der Maschine da draußen?«, fragte sie. Ihre Stimme war hell und melodisch, hatte aber einen angespannten Unterton.
»Pilot und Inhaber der Island Cargo Air und noch einiges andere mehr«, antwortete ich und nannte ihr meinen Namen. »Was kann ich für Sie tun?«
Sie schloss die Tür hinter sich, sah kurz zu Benson hinüber, der sie nicht weniger bewundernd angestarrt hatte und nun ihren Blick mit einem selbstbewussten Grinsen erwiderte, und wandte sich dann wieder mir zu. »Man hat mir gesagt, dass Sie auch Passagiere mitnehmen, Mister Stanford. Stimmt das?«, fragte sie hoffnungsvoll.
»Ja, aber es kommt nicht oft vor. Die Leute, die bei mir einsteigen, haben meist einen sehr guten Grund, warum sie sich die Unbequemlichkeit antun«, sagte ich und versuchte mir sie in meiner Hurricane vorzustellen, auf einem der durchgescheuerten Sitze und schweißüberströmt. Es wollte mir nicht so recht gelingen.
»Den habe ich auch«, versicherte sie. »Und mir ist es egal, wenn es unbequem ist, Mister Stanford. Hauptsache, ich komme noch rechtzeitig nach Miami und verpasse dort nicht meinen Anschlussflug nach London. Sie fliegen doch nach Miami, nicht wahr?«
»Ja, schon«, sagte ich und fragte mich, woher sie das wusste. Sie beantwortete mir diese Frage schon im nächsten Moment. »Ich hatte einen Flug bei Chalk’s gebucht, bin aber im Hotel so lange aufgehalten worden, dass ich gerade noch gesehen habe, wie meine Maschine die Rampe hinuntergerollt ist. Und da hat man mich an Sie verwiesen und mir gesagt, dass Sie wohl auch nach Miami fliegen.«
Chalk’s war eine kleine, aber äußerst profitable Fluglinie, die keine zweihundert Yards oberhalb von meinem Firmengelände operierte. Ihre Flugboote pendelten mehrmals am Tag zwischen den Bahamas und Florida hin und her. Chalk’s besaß eine eigene kleine Pass- und Zollstation, die mit einem Beamten besetzt war. Meist tat Gregg Finley, ein grauhaariger Schwarzer, dort Dienst. Mit ihm, den Piloten und den Managern von Chalk’s verstand ich mich blendend, denn ich war jahrelang Pilot bei dieser Fluglinie gewesen, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte. Gab es bei mir Zoll- und Passformalitäten zu erledigen, übernahm das Gregg Finley oder der Kollege, der ihn vertrat, wenn er krank oder in Urlaub war. Ein Anruf genügte, und er kam auf seinem Fahrrad kurz zu uns herüber. Da Nelson vorhin gesagt hatte, Bensons Kisten wären bereits gecheckt, war Gregg Finley also schon vor meiner Rückkehr hier gewesen, und daher wusste man also bei Chalk’s, dass ich noch einen Flug nach Miami auf meinem Flugplan stehen hatte.
»Nehmen Sie mich mit?«, bat sie.
»Haben Sie es schon bei Bahamasair versucht?«, mischte sich Benson in das Gespräch. »Die fliegen doch fast jede Stunde nach Miami.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nichts zu machen. Alle Flüge sind ausgebucht. Auch bei Eastern und Trans Island Airways«, sagte sie mit einem Anflug von Verzweiflung. »Sogar auf den Standby-Listen hätte ich kaum noch eine Chance, rechtzeitig rüberzukommen. Es ist eben Wochenende.«
»Sie kommen bestimmt noch mit einer der nächsten Maschinen mit, wenn Sie sofort zum Flughafen fahren«, versicherte Benson. »Ich kenne das Spiel mit der Überbuchung. Geschäftsleute, die nicht genau wissen, wann sie fliegen können, buchen telefonisch drei verschiedene Flüge, um für alle Fälle eine Reservierung sicher zu haben. Ich mache das oft genug selber. Wenn es dann zum Abflug kommt, sind immer noch Plätze frei.« Ich sah ihn verwundert an, denn er klang so, als wollte er sie unter keinen Umständen an Bord haben.
»Das Risiko, dennoch zurückzubleiben und meinen Atlantikflug zu verpassen, möchte ich aber nicht eingehen«, erwiderte sie.
»In der Maschine ist kein Platz mehr frei«, sagte Benson ungehalten. »Außerdem habe ich während des Flugs mit Mister Stanford wichtige geschäftliche Dinge zu besprechen. Es tut uns also leid.«
Sie ignorierte ihn und sah mich eindringlich an. »Bitte, nehmen Sie mich mit, Mister Stanford! Ich setz mich auf irgendeine Kiste, wenn ich nur rechtzeitig nach Miami komme. Ich zahle Ihnen natürlich den regulären Flugpreis!«
Benson wollte etwas sagen, doch ich kam ihm zuvor. Es ärgerte mich, dass er mir indirekt vorschreiben wollte, wen ich mitnehmen durfte und wen nicht. Cranston hatte die Hurricane ja nicht voll gebucht, sondern mir nur einen Transportauftrag erteilt. Was ich mit dem restlichen Frachtraum und den beiden Sitzplätzen machte, war allein meine Angelegenheit.
Ich lächelte sie aufmunternd an. »Wenn Sie die Unbequemlichkeit in Kauf nehmen möchten, sind Sie herzlichst eingeladen, mit uns zu fliegen«, sagte ich und wandte mich Benson zu: »Wir werden schon noch Zeit zum Reden finden. Oder möchten Sie diese junge Lady in Tränen aufgelöst hier zurücklassen?«
Er seufzte. »Okay, okay, wenn Sie es so wollen«, brummte er und griff wieder zu seinen Zigaretten. »Es ist Ihre Entscheidung.«
Sie strahlte mich an. »Danke, Mister Stanford.«
»Haben Sie Gepäck?«, wollte ich wissen.
»Ja, einen Koffer. Ich habe ihn draußen stehenlassen.« Ich nickte, ging zum Telefon und rief bei Chalk’s an. Gregg Finley hatte schon damit gerechnet, noch einmal bei uns seines Amtes walten zu müssen.
»Ich bin sofort bei euch, Dean.«
Die Formalitäten waren schnell erledigt. Gregg warf einen kurzen Blick in ihren amerikanischen Pass, setzte den Ausreise-Stempel mitten auf eine freie Seite und streifte ihren Koffer, der die Initialen eines Pariser Modeschöpfers trug, mit einem flüchtigen Blick. »Einen guten Flug, Miss Lindsay«, wünschte er und grinste mich an, bevor er das Büro verließ.
»Es wird Zeit«, mahnte Benson und klopfte auf das Zifferblatt seiner Uhr.
»Wir können sofort fliegen«, versicherte ich und sah durch den Glaseinsatz im oberen Teil der Bürotür Nelsons Pick-up zurückkommen. Mit dem Beladen hatte er sich wahrlich nicht beeilt. »Bitten Sie Nelson, dass er Ihren Koffer schon in die Maschine bringt«, sagte ich zu meinem unverhofften Passagier. »Ich ziehe mir nur schnell frische Sachen an.«
Fünf Minuten später hatte ich mir das Gesicht gewaschen, ein bisschen Ordnung in mein zerzaustes Haar gebracht und mich umgezogen. Doch statt nach meinen unempfindlichen Hemden und Hosen aus Khaki zu greifen, die im Schrank aufgestapelt lagen, hatte ich eine dunkelblaue Tuchhose und ein hellblaues Hemd angezogen, auf dessen Schulterlaschen noch die Klappen mit den vier goldenen Streifen des Piloten steckten, wie ich sie früher bei Chalk’s getragen hatte.
Benson warf mir einen spöttischen Blick zu, als er mich sah, und ich kam mir plötzlich wie ein Idiot vor. Doch sich jetzt noch einmal umzuziehen, hätte einen noch größeren Narren aus mir gemacht.
Nelson hatte sich noch nicht blicken lassen. Deshalb nahm ich ihren Koffer und trug ihn selbst zur Hurricane hinüber. Er war leicht, und als ich ihn zwischen Bensons Gepäck schob, das aus vier Kartons und einem Schrankkoffer bestand, las ich ihren Namen auf dem Gepäckanhänger: Shirley A. Lindsay.
»Enger kann’s auch in einem U-Boot nicht sein«, meinte Benson, als er sich naserümpfend in der Maschine umsah, und fragte dann: »Haben Sie was dagegen, wenn ich mich vorn neben Sie setze?«
»Nein, natürlich nicht«, log ich, weil ich ihn und damit vielleicht Cranston nicht noch mehr verärgern wollte. Dabei hatte ich beabsichtigt, Shirley Lindsay den Platz des Copiloten anzubieten. Sie gab sich aber klaglos mit dem Sitz hinter ihm zufrieden. Erste Schweißperlen zeigten sich schon auf ihrer Stirn, als sie sich anschnallte, ihre Handtasche auf den Schoß nahm und die helle Jacke darüber legte.
Benson klemmte seinen ledernen Aktenkoffer rechts zwischen Bordwand und Sitzverankerung. »Ganz schöner Brutkasten«, murmelte er.
Ich lachte nur, ließ die Motoren an, nahm auf Frequenz 118.7 Kontakt mit Clearance Delivery auf, gab mein Kennzeichen durch und meldete einen Flug unter Sichtbedingungen nach Miami an: »Island Cargo Air Six-Eight Delta Sierra, VFR nach Miami.«
»Six-Eight Delta Sierra, squawk zero-four-one-four«, knatterte es aus meinen Kopfhörern, als man mir meinen Transponder-Code zuwies, der nun im Tower auf dem Radarschirm erscheinen und den Controllern dort dabei helfen würde, den Überblick über die Flugbewegungen im überwachten Luftraum zu bewahren.
Minuten später waren wir in der Luft. Ich stieg bis auf dreitausendfünfhundert Fuß und nahm Kurs auf Miami, das wir meiner Berechnung nach noch vor halb vier erreichen würden. Fünfundzwanzig Meilen außerhalb von Nassau endet das Gebiet, für das sich die Radarcontroller interessieren. Und so meldete sich die Departure Control wie gewohnt auf 125.3 ab: »Six-Eight Delta Sierra: radar service is terminated, squawk one-two-zero-zero.«
Bis zu den Biminis waren es noch gut siebzig nautische Meilen.
Dort würde ich meine Flughöhe verlassen und auf unter dreitausend Fuß hinuntergehen, um nicht in die TCA-Zone, die Terminal Control Area, von Miami zu geraten, die der Tower den großen Passagierjets und Jumbos, die wir Flieger ›Big Irons‹ nennen, vorbehalten sehen möchte.
Benson saß schweigend neben mir und zeigte kein Interesse an einem Gespräch, was mir ganz recht war. Er blickte aber häufig auf die Instrumente, als verfolgte er unseren Kurs.
Ich achtete nicht weiter auf ihn, schaltete das Unicorn ein und vertrieb mir die Zeit damit, den Funkverkehr zwischen den Flugzeugen abzuhören, ohne mich daran zu beteiligen. Manchmal war das Gerede der Piloten ganz amüsant, denn sie tauschten nicht nur Wetterinformationen und Flugbedingungen untereinander aus, sondern auch Klatsch.
Die Biminis kamen in Sicht, und ich streckte die Hand aus, um die Frequenz 126.7 von Miami Radio einzustellen. Doch Benson schlug meine Hand zur Seite.
»Lassen Sie das!«, rief er mir mit scharfer Stimme zu.
Mehr verblüfft als verärgert fuhr ich zu ihm herum – und starrte in die Mündung einer Pistole. Im ersten Augenblick dachte ich, Halluzinationen zu haben. Doch die Waffe, die er auf mich gerichtet hielt, war keine Einbildung, sondern real. Sehr real sogar. Es war eine 10 mm Delta Elite Automatik von Colt.
Shirley Lindsay schrie auf, als sie die Waffe in Bensons Hand sah. »Um Gottes willen, was soll …!«
»Halten Sie den Mund!«, schnitt Benson ihr scharf das Wort ab und befahl mir: »Und Sie nehmen die Hände nicht vom Steuerknüppel, Stanford! Sie tun nichts, was ich Ihnen nicht befehle!«
Ganz langsam erhob er sich aus dem Sitz, schob sich an mir vorbei, ohne die Waffe auch nur einen Augenblick sinken zu lassen, und stellte sich in den Mittelgang, so dass er sich nun schräg hinter mir auf der Seite des linken freien Sitzplatzes befand. Von dort aus konnte er sowohl mich als auch Shirley Lindsay gut im Auge behalten.
»Ist das eine Entführung?«, fragte sie spitz. Sie war blass geworden, zeigte jedoch keine Angst. »Dann haben Sie sich die Falschen ausgesucht, zumindest was mich betrifft. Für mich zahlt keiner auch nur einen Dollar, und in meiner Tasche habe ich nur …«
»Du sollst dein Maul halten, Püppchen! Kein Mensch will deine paar Kröten!«, herrschte er sie an, packte mit der linken Hand Tasche und Jacke und schmiss beides hinter sich zwischen das Gepäck. »Leg den Gurt wieder an und die Händchen hübsch in den Schoß. Wenn du tust, was ich dir sage, passiert dir nichts, kapiert? Dasselbe gilt auch für Sie, Stanford!«
»Schon gut. Regen Sie sich nicht so auf.« Seine schrille Stimme warnte mich, ihn bloß nicht zu reizen. »Was wollen Sie?«
»Gehen Sie mit der Geschwindigkeit runter. Hundertfünfundfünfzig Knoten! Los!«
Ich tat, was er wollte.
»Und jetzt runter auf zweitausendfünfhundert Fuß!«
»Warum nicht zweitausend?«, fragte ich ihn. Es war ein Test.
»Weil wir nach Westen fliegen und demnach ungerade Flughöhen einzuhalten haben!«
»Sie verstehen ja wirklich was vom Fliegen.«
»Mehr als Ihnen lieb sein mag! Also glauben Sie bloß nicht, mich irgendwie reinlegen zu können!«, erwiderte er schroff. »So, und jetzt geben Sie eine Änderung Ihres Flugplans durch. Miami ist gestrichen. Gehen Sie auf Kurs Null-Sieben-Zwo!«
Ich sah die Karte vor meinem geistigen Auge. Zweiundsiebzig Grad. Nordost. Great Abaco Island lag in dieser Richtung. Es machte keinen Sinn. Eigentlich machte überhaupt nichts Sinn. »Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, Benson, aber wenn Sie nicht bald aufhören, mit dem Ballermann vor meinem Gesicht herumzufuchteln, handeln Sie sich eine Menge Ärger ein. Oder wollen Sie die Maschine selbst fliegen?«, fragte ich ungehalten.
»Sie fliegen, Mann, und Sie fliegen die Kiste so, wie ich es Ihnen befehle! Notfalls fliegen Sie das Scheißding auch mit gebrochener Schulter, haben wir uns verstanden?«, drohte er, ohne dabei eindeutig die Frage zu beantworten, die mich beschäftigte – nämlich ob er im Notfall in der Lage war, die Mallard zu fliegen.
»Hören Sie …«, begann ich.
»Schnauze, verdammt noch mal!«, schnitt er mir das Wort ab. »Tun Sie gefälligst, was ich Ihnen befehle, oder ich knöpf mir die Kleine vor, für die Sie sich so herausgeputzt haben, Stanford!«
Ich grinste gequält. »Sie sind ein richtiger Macho, was? Eine Knarre in der Hand macht erst den ganzen Mann, richtig?«, konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen.
»Noch so ein blöder Spruch, und ich blase Ihnen das Ohr weg. Das brauchen Sie ja nicht zum Fliegen, oder? Und jetzt ändern Sie Ihren Flugplan! Geben Sie an, dass wir auf Craig Cay landen werden. Und dann bringen Sie Ihre verdammte Kiste endlich auf den neuen Kurs!« Er stieß mir das kalte Metall der Pistole hinter das rechte Ohr, was mich veranlasste, seiner Aufforderung ohne weiteren Widerspruch Folge zu leisten.
Ich ging auf die verlangte Höhe hinunter, gab die Änderung meines Flugplans durch und überlegte, was zum Teufel er bloß auf dieser einsamen Insel wollte. Auf Craig Cay gab es zwar ein paar Ferienbungalows, aber sonst nichts. Um dort hinzukommen, hätte er mir keine Pistole unter die Nase zu halten brauchen. Ein Hundertdollarschein hätte es auch getan, und wir wären sogar Freunde geblieben. Ich bezweifelte, dass die Ferienanlage jetzt im heißen September überhaupt schon ihren Betrieb aufgenommen hatte. Gut möglich, dass auf Craig Cay noch alles dicht war. Aber vielleicht war es gerade das, was die Insel für ihn so interessant machte.
»Gehen Sie noch weiter runter. Auf fünfhundert Fuß!«
»Bis nach Craig Cay dauert es noch eine Weile, Benson. Wozu also jetzt schon …«, begann ich zu protestieren.
Er knallte mir das Griffstück seiner Pistole auf den rechten Schulterknochen, und der Schmerz ließ mich vergessen, was ich hatte sagen wollen. Benson wurde mir nun wirklich unsympathisch.
»Ich warne Sie, Stanford! Sie sollen nicht mit mir diskutieren, sondern tun, was ich Ihnen befehle!«, zischte er. »Runter habe ich gesagt! Auf fünfhundert Fuß! Oder ich verpass Ihnen mit dem Ding hier noch eine Aufmunterung!«
Diesmal ersparte ich mir einen Kommentar. Der Schmerz in meiner Schulter beraubte mich vorübergehend jeder Lust an sarkastischen Bemerkungen. Mit verkniffenem Gesicht schob ich den Steuerknüppel nach vorn und ging auf fünfhundert Fuß hinunter. Gut dreißig Meilen flogen wir schweigend nach Nordosten.
Benson ließ die Anzeigen nicht aus den Augen. »Melden Sie, dass Sie auf Craig Cay gelandet sind, und schließen Sie Ihren Flugplan!«, forderte er mich dann auf, und ich griff widerspruchslos zum Mike, um der Aufforderung Folge zu leisten. Craig Cay war noch mindestens vierzig Meilen entfernt, doch es mochte hinkommen: Wäre ich mit voller Leistung geflogen, hätte Craig Cay jetzt unter uns liegen können.
»Okay, und nun gehen Sie auf Kurs Zwei-Eins-Null!«, verlangte er danach. »Und bleiben Sie so lange auf dieser Höhe, bis ich Ihnen was anderes sage!«
»Mein Fluglehrer hatte denselben charmanten Tonfall wie Sie, Benson. Nur hab ich von ihm eine Menge gelernt«, sagte ich mit grimmigem Spott, während ich eine Kurve flog und die Hurricane auf südsüdwestlichen Kurs brachte.
Er lachte höhnisch auf. »Sie werden schon noch was lernen, Stanford, darauf können Sie Gift nehmen!«