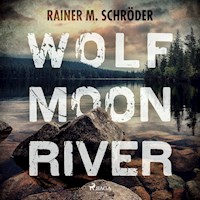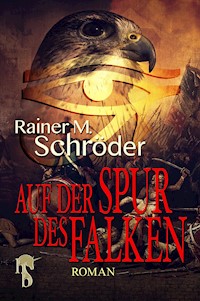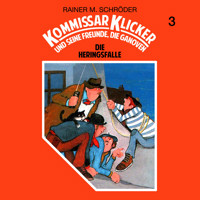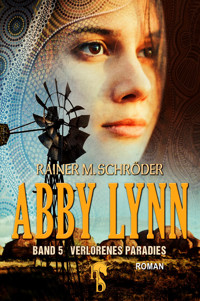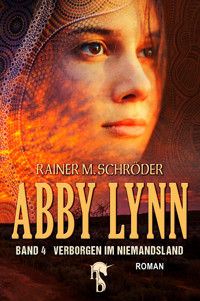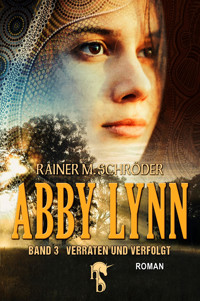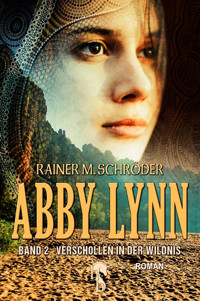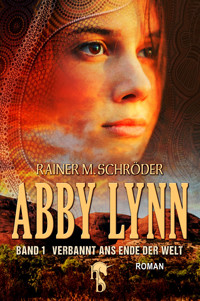
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
London, 1804: Die 14-jährige Abby Lynn macht sich an einem eisigen Februartag auf die Suche nach etwas Brot für ihre kranke Mutter. Auf dem Markt wird sie unschuldig in einen Diebstahl verwickelt und festgenommen. Monatelang wartet sie im berüchtigten Gefängnis von Newgate auf ihren Prozess und muss lernen, sich gegen Aufseher und Mitgefangene durchzusetzen. Das Urteil lautet: Verbannung und sieben Jahre Sträflingsarbeit in der neuen Kolonie Australien. Auf dem Weg nach Portsmouth, Ausgangspunkt für die Verschiffung der Verbannten, freundet sie sich mit Rachel an und kümmert sich aufopferungsvoll um sie, als sie schwer erkrankt. Ihre Wege trennen sich vorübergehend nach einer ersten gemeinsamen Zeit im Arbeitslager in Australien. Abby hat Glück und die freie Farmerfamilie Chandler holt sie, wie auf der Überfahrt versprochen, zu sich auf ihre neu gegründete Farm in der Wildnis. Als Sträfling und Verbannte, aber nun in relativer Sicherheit, beginnt für Abby auf Yulara ein neues Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Abby Lynn
Verbannt ans Ende der Welt
Roman
Erstes BuchEngland
Februar – Juni 1804
Erstes Kapitel
Ein eisiger Windstoß blies durch die Fensterfugen der Dachkammer. Die Kerze auf dem Küchentisch flackerte, beugte sich unter dem frostigen Hauch des Februarmorgens und erlosch. Ein dünner Rauchfaden kräuselte vom kohleschwarzen Docht, wurde von der Zugluft erfasst und verwirbelt, bevor er noch die niedrige Decke der armseligen Dachgeschosswohnung erreicht hatte.
Das dunkelblonde Mädchen mit dem blassen Gesicht saß gedankenverloren am Küchentisch und beobachtete, wie das flüssige Wachs um den Docht schnell erkaltete und sich auf der Oberfläche eine erste dünne Schicht bildete. Wie die Haut, die auf heißer Milch schwimmt.
Heiße Milch!
Abigail Lynn versuchte sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal heiße Milch getrunken hatte. Vergeblich. Es lag schon zu lange zurück. Viele Jahre. Seit ihr Vater auf der Fahrt von Indien zurück nach England mit dem Schiff untergegangen war. Er hatte sein ganzes Vermögen in die Schiffsladung gesteckt. Bis auf den letzten Penny, wie ihre Mutter immer wieder mit Verbitterung betonte, wenn sie von den Zeiten erzählte, als sie noch zu den angesehenen Kaufmannsfamilien in London gehört, in einem eigenen Haus gewohnt und mehrere Dienstboten gehabt hatten.
Nur ganz schwach konnte Abigail sich noch an das Haus mit den silbernen Kerzenleuchtern, den Teppichen und Bildern und dem herrschaftlichen Treppenaufgang erinnern. Gerade sechs war sie damals gewesen. Und acht Jahre in drückender Armut waren eine lange Zeit, in der Erinnerungen an eine längst vergangene, glückliche Kindheit ihre scharfen Konturen verlieren wie Zeichnungen auf Papier, die zu lange der Sonne ausgesetzt sind und immer mehr verblassen.
Abigail wünschte, sie könnte die Kerze wieder anzünden. Die kleine Flamme war das einzig Wärmende und Trostspendende an diesem kalten Februarmorgen gewesen. Doch es war schon hell über London, und die Kerze jetzt noch einmal in Brand zu setzen, wäre eine unverzeihliche Verschwendung von Wachs und Zündhölzern gewesen.
Ein anhaltender, trockener Husten aus der hinteren Ecke der Dachkammer riss Abigail aus ihren Gedanken. Ihre Mutter war aufgewacht.
»Abby?«
Abigail erhob sich vom Küchentisch und ging schnell zur Bettstelle hinüber. »Hast du Durst? Soll ich dir etwas Tee bringen?«, fragte sie besorgt und wünschte, sie hätten wirklich ein wenig frischen Tee. Das Gebräu, das sie seit über einer Woche tranken, war der ungezählte Aufguss einer einzigen Handvoll Teeblätter. Sie waren schon so ausgelaugt, dass sie kaum noch das Wasser färbten.
Margaret Lynn nickte und Abby holte eine Blechtasse voll Tee. Ihre Mutter trank gierig und sank dann in die Kissen zurück. Die Krankheit, die sie nun schon gute sechs Wochen ans Bett fesselte, hatte deutliche Spuren hinterlassen. Abby kannte ihre Mutter nur als hagere Frau mit schmalen Lippen und einem verkniffenen Gesichtsausdruck, der ihre unversöhnliche Verbitterung über den tiefen Fall widerspiegelte. Doch nun war sie regelrecht abgemagert. Ihr Gesicht war eingefallen, die fahle Haut schien sich über den spitz hervortretenden Wangenknochen bis zum Zerreißen zu spannen und in ihren Augen, die in tiefen Höhlen lagen, brannte das Fieber.
»In der Schüssel ist noch etwas kalte Grütze«, sagte Abby und hielt die Hand ihrer Mutter. »Eine halbe Tasse voll.«
»Brot! … Du musst Brot kaufen, Abby!«
»Es ist längst kein Geld mehr da.«
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »In der Dose hinter der alten Kanne ist noch Geld. Nimm es und kauf einen Laib Brot!« Ihre Stimme war schwach.
Abby zögerte.
»In der Dose müssen ein paar Sixpence und Pennys liegen. Das Geld habe ich für Notzeiten weggelegt«, stieß Margaret Lynn unter schnellem, flachem Atem hervor. »Nimm es und kauf ein. In ein paar Tagen wird es mir schon wieder besser gehen und dann kann ich auch wieder arbeiten. Warum gehst du nicht?«
Abby brachte es nicht über sich, ihr zu sagen, dass nicht ein einziger Penny mehr in der Dose lag und sie schon längst anschreiben ließ.
»Ja, ich werde das Geld aus der Dose nehmen und einen Laib Brot kaufen«, sagte sie und wandte sich schnell ab, weil sie Angst hatte, ihr Blick könnte verraten, wie hoffnungslos ihre Lage war.
Abby wickelte sich einen Schal um, hängte sich ihren abgewetzten Umhang um die Schultern und nahm den binsengeflochtenen Korb vom Wandhaken.
»Ich bin gleich wieder zurück, Mutter!«, rief sie von der Tür über die Schulter zurück. Sie konnte nicht ahnen, dass sie ihre Mutter nie wieder sehen würde.
Zweites Kapitel
Es war ein kalter Morgen und der Himmel über London war von seltener Klarheit. Die unzähligen roten und braunen Schornsteine, aus denen blauer Rauch in dicken Wolken quoll, hoben sich scharf von dem wolkenlosen Himmel ab.
Die vielen Rauchfahnen erinnerten Abby schmerzlich daran, dass sie keine Kohle und kein Brennholz mehr hatten. Sie fröstelte und zog den Umhang enger. Es fehlte ihnen an so vielem.
Es war Markttag in Haymarket und so herrschte an diesem frühen Morgen schon ein geschäftiges Leben und Treiben in den Straßen und Gassen. Kutschen, Wagen und Karren machten sich die Fahrbahn streitig. Das Schnauben nervöser Zugpferde, aus deren Nüstern der Atem wie Dampf kam, vermischte sich mit den Flüchen der Kutscher und dem scharfen Knall ihrer Peitschen.
Ohne Eile ging Abby an den Geschäften und Läden entlang, die die Straße zu beiden Seiten säumten. Sie sog die vielfältigen, bunten Eindrücke wie ein trockener Schwamm in sich auf. Wie sie das pulsierende Leben um sie herum genoss! Es gab ihr für eine kurze Zeit die Möglichkeit, die eigenen bedrückenden Sorgen zu vergessen. Die Luft war erfüllt von einem Gewirr aus vielen Stimmen, Geräuschen und Gerüchen. Schon jetzt drang aus den Tavernen das Lachen und Grölen jener Zecher, denen der Tag für ein Glas Branntwein, Port oder Ale nie zu jung oder zu alt war.
Wortreich priesen Straßenhändler mit Bauchläden ihre zweifelhaften Gesundheitswässerchen und Tinkturen an, und Dienstboten, von ihrer Herrschaft zum Einkauf geschickt, standen für ein paar Minuten in kleinen Gruppen zusammen und tauschten mit lachenden, geröteten Gesichtern den neusten Klatsch aus.
Doch beim Anblick der Straßenmädchen und der zerlumpten Bettler wurde Abby an ihre eigene, trostlose Situation erinnert. Das Hungergefühl stellte sich wieder ein. Und als sie die ersten Marktstände erreichte, krampfte sich ihr der Magen zusammen.
Sehnsüchtig blickte sie auf die andere Seite der Straße hinüber, wo zwischen einem schmalen Tabakladen und einer Schusterei die prächtige Bäckerei von Jonathan Walpole lag. Ihr war, als könnte sie schon über die Straße hinweg den herrlichen Duft frischer Brote und köstlicher Backwaren riechen.
Sie wartete sehnsüchtig eine günstige Gelegenheit ab und lief dann zwischen zwei schwer beladenen Pferdewagen über die Straße. Eine junge Frau, einen voll bepackten Einkaufskorb am Arm, verließ gerade die Bäckerei.
Abby warf einen ängstlichen Blick durch die Schaufenster in den Laden. Denn wenn Jonathan Walpole hinter der Theke stand, brauchte sie ihr Glück erst gar nicht zu versuchen. Sie wusste, dass er ihr keinen weiteren Kredit mehr einräumen würde. Bei Charlotte, seiner fülligen Frau mit den rosigen Pausbacken, lagen die Dinge anders. Ging das Geschäft gut und litt sie nicht gerade unter Kopfschmerzen, nahm sie es mit dem Anschreiben nicht ganz so genau. Doch verschenken tat auch sie nichts.
Hoffnung regte sich in ihr, als sie sah, dass Mrs. Walpole allein im Laden war. Schnell lief sie die drei Stufen hoch und betrat die Bäckerei. Eine helle Glocke schlug an, als sie die Tür öffnete und hinter sich schloss. Die bullige Wärme der Bäckerei schlug ihr wie eine Woge entgegen und nahm ihr für einen Moment den Atem. Nach der klammen Kälte der Dachkammer und dem frostigen, schneidenden Wind der Straße fühlte sie sich von dem Wärmeschwall angenehm benommen.
Mit einem freundlichen Lächeln drehte sich die Bäckersfrau um. Sie trug ein blütenweißes Häubchen und eine ebenso weiße Schürze. Als sie anstelle zahlungskräftiger Kundschaft das dunkelblonde, ärmlich gekleidete Mädchen vor der Ladentheke stehen sah, verschwand das Lächeln von ihrem vollen Gesicht.
»Was willst du, Abby?«, fragte sie argwöhnisch, als wüsste sie, dass sie vor ihrer eigenen Weichherzigkeit auf der Hut sein musste.
Abby schluckte. Der Geruch, der den mit Brotlaiben und Kuchen aller Art vollgestellten Regalen entströmte, ließ ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen und machte sie zittrig auf den Beinen. Sie richtete den Blick zu Boden und umklammerte den Tragbügel ihres leeren Korbes. »Einen Laib Brot, Mrs. Walpole … bitte«, brachte sie nur mühsam hervor.
»Du hast natürlich auch heute keinen Penny dabei und willst, dass ich es wieder anschreibe, nicht wahr?«
Abby nickte stumm.
»Warum kommst du immer wieder zu mir, Abby?«, fragte die Bäckersfrau vorwurfsvoll und rang die Hände, als hätte sie das Schicksal schwer gestraft. »Weißt du nicht ganz genau, dass ich deiner Mutter schon mehr Kredit eingeräumt habe, als ich verantworten kann? Wenn mein Mann erfährt, wie viel ihr uns schon schuldet, wird er mir Vorhaltungen machen. Jeder weiß, dass er ein guter Mann ist und kein Herz aus Stein hat. Aber er kennt das rechte Maß der Mildtätigkeit besser als ich. Ja, ja, ich bin es doch, die es letztlich auszubaden hat.«
»Aber zu wem soll ich denn sonst gehen? Bitte, Mrs. Walpole, nur noch einen einzigen Laib!«, flehte Abby und blickte ihr nun ins Gesicht. In ihren dunklen Augen lag mehr inständiges Flehen, als sie mit Worten hätte ausdrücken können.
Die Bäckersfrau zögerte sichtlich. Sie sah die Hilflosigkeit und Verzweiflung im Blick des Mädchens, sah ihr blasses Gesicht und ihren viel zu dünnen Umhang. Doch das allein reichte nicht. Täglich betraten Bettler ihren Laden, unter denen sich auch Jungen und Mädchen befanden, die Abby um ihre abgetragenen Kleider und um ihre Bettstelle in der Dachkammer beneidet hätten. Und so fragte sie scheinbar zusammenhanglos: »Wie geht es deiner Mutter?«
Abby verstand sofort, und sie zuckte nicht mit der Wimper, als sie log: »Viel besser, Mrs. Walpole. Sie ist über den schlimmen Husten hinweg. In ein paar Tagen kann sie wieder arbeiten und dann bekommen Sie jeden Penny zurück.« Sie war klug genug, um nicht eifrig und beteuernd zu klingen, sondern gab ihrer Stimme einen müden Klang. Was ihr nicht allzu schwer fiel. »Ich soll Ihnen und Mr. Walpole Grüße ausrichten und sagen, wie dankbar sie Ihnen dafür ist, dass Sie uns in den letzten Wochen …«
»Schon gut, schon gut«, fiel Charlotte Walpole ihr mit einem Anflug von Verlegenheit ins Wort. »Wenn deine Mutter ihre Arbeit bald wieder aufnehmen kann, will ich nicht so sein. Du sollst dein Brot bekommen.«
Abby machte einen Knicks und dankte ihr vielmals. Sie fühlte sich ganz schwach und flau vor Erleichterung, der Bäckersfrau doch noch einen Laib abgeschwatzt zu haben. Dabei ging es ihrer Mutter keineswegs besser. Hätte sie jedoch die Wahrheit gesagt, hätte sich auch Mrs. Walpole nicht erweichen lassen.
Die Bäckersfrau wandte sich zum Brotregal und nahm nach kurzem Zögern einen Laib vom Lattenrost, der gut und gerne seine fünf Pfund auf die Waage brachte.
Im selben Augenblick wurde die Schwingtür, durch die man nach hinten in die Backstube gelangte, aufgestoßen, Jonathan Walpole brachte ein großes Blech mit ofenfrischen Backwaren in den Laden. Er war ein kräftiger, breitschultriger Mann mit einem buschigen Backenbart, der stellenweise mehlbestäubt war. Sein merkwürdig kantiges, jedoch nicht unsympathisches Gesicht war gerötet. Schweißperlen glitzerten auf der Stirn und an den Schläfen. Sein Hemd wies unter den Armen und auf der Brust dunkle Schwitzflecken auf. Schon lange vor Sonnenaufgang hatte er mit der Arbeit in der heißen Backstube begonnen. An Markttagen konnte er kaum so schnell mit frischen Backwaren nachkommen, wie sie von den Regalen verschwanden. Noch war es ruhig. Doch in ein, zwei Stunden würden sich die Kunden die Türklinke gegenseitig in die Hand geben. Und für diesen Ansturm musste mit vollen Regalen Vorsorge geschaffen werden.
»Schau an!«, sagte Jonathan Walpole grimmig und knallte das Blech auf die Ladentheke. »Die kleine Abby Lynn!«
Nicht nur Abby erschrak bei seinem Anblick, sondern auch die Bäckersfrau. Sie zuckte zusammen, als hätte er sie bei einer unrechten Handlung ertappt.
»Hat sie wieder so lange gebettelt und dich beredet, dass du nicht anders konntest, als ihr einen Brotlaib zu geben?«, fragte der Bäcker ärgerlich. »Hast du denn vergessen, was ich dir schon hundertmal gesagt habe, Frau?«
»Sie sagt, ihrer Mutter geht es schon viel besser und sie wird bald wieder arbeiten können«, führte sie zu ihrer Entschuldigung an.
»Das freut mich zu hören. Aber Geld hat sie keins dabei, nicht wahr?«
»Nein«, räumte die Bäckersfrau ein.
»Dann gibt es auch kein Brot!«, erklärte Jonathan Walpole streng, nahm ihr den Laib ab und legte ihn ins Regal zurück.
Abby hörte, wie die Glocke hell und melodisch hinter ihr anschlug. Zwei Frauen betraten den Laden. Sie wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb, den Bäcker vielleicht doch noch umzustimmen.
»Bitte, nur noch dieses eine Brot!«, bat sie ihn inständig. »Sie werden Ihr Geld bestimmt wiederbekommen, das schwöre ich Ihnen. Und wenn ich betteln gehen müsste!«
Jonathan Walpole schaute sie an und für einen kurzen Augenblick trat so etwas wie Mitgefühl in seine Augen. Doch im nächsten Moment war dieser Ausdruck schon wieder verschwunden.
»Ich bin kein Unmensch, Abby. Und ich habe deiner Mutter vier Wochen lang Kredit eingeräumt, wie ich das bei all meinen Stammkunden zu tun pflege«, sagte er nun geschäftsmäßig. »Doch länger als vier Wochen schreibe ich nicht an. Und Ausnahmen gibt es bei mir nicht!«
Nicht dass er ein schlechter, hartherziger Mensch gewesen wäre. Doch er hatte nun einmal seine Prinzipien, von denen er nicht abrückte. Es waren harte Zeiten, gewiss, doch wer sich vom Elend zu sehr rühren ließ, lief Gefahr, über kurz oder lang auch zum großen Heer der Bedürftigen zu zählen, die London überschwemmten.
Abby spürte die ungehaltenen Blicke der beiden Frauen. Sie hielten sichtlichen Abstand, als wollten sie zum Ausdruck bringen, dass sie mit einem bettelnden Mädchen nichts zu tun haben wollten. Armut war wie eine hässliche ansteckende Krankheit, der man am besten dadurch vorbeugte, dass man ihr aus dem Weg ging und sie dort ignorierte, wo man ihr wider Willen begegnete.
In ihrer Verzweiflung suchte Abby nach Worten, die Jonathan Walpole doch noch umstimmen könnten. Doch es wollte ihr nichts Überzeugendes in den Sinn kommen und so schaute sie ihn nur hilflos an.
»Steh hier nicht im Laden herum. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Versuche dein Glück anderswo, Abby«, sagte der Bäcker unbeugsam und fuhr dann seine Frau vorwurfsvoll an: »Wir haben Kundschaft! Seit wann ist es unsere Art, zahlende Kunden warten zu lassen?«
Abby sah, wie der Bäckersfrau das Blut ins Gesicht schoss, wandte sich beschämt ab und stürzte aus dem Geschäft in die schneidende Kälte des Morgens. Sie hätte weinen mögen. Warum hatte der Bäckermeister das Kuchenblech auch gerade in dem Augenblick bringen müssen? Nur eine Minute später, und sie wäre mit dem schweren, knusprig-frischen Brotlaib schon auf dem Heimweg gewesen. Was nun?
Abby wusste sich keinen Rat und lief ziellos durch die belebten Straßen und Gassen. Sie konnte unmöglich mit leerem Korb nach Hause kommen. Doch wer würde ihr noch etwas geben? Ihre Mutter hatte weder Verwandte noch Freunde, die ihnen hätten beistehen können. Und in den anderen Geschäften des Viertels gab man ihr schon seit Wochen keine Lebensmittel mehr auf Kredit. Charlotte Walpole war ihre letzte Hoffnung gewesen.
Drittes Kapitel
Müde und hungrig setzte sie sich schließlich am Rande des Marktes neben einem Torbogen auf einen hüfthohen Steinsockel. Den Korb auf dem Schoß und die Arme darüber verschränkt. Der schneidende Wind hatte sich gelegt und eine blasse, kraftlose Sonne stand über der Stadt an der Themse. Ein Schwarm Tauben kreiste über den Häuserdächern und ließ sich dann mit lautem Flügelschlag auf einer Regenrinne nieder. Gurrend blickten sie auf das lärmende Treiben hinunter.
»Was bleibt mir anderes als das Betteln«, dachte Abby, während sie den einbeinigen Bettler mit dem von Pockennarben entstellten Gesicht beobachtete. Er saß ihr schräg gegenüber auf dem kalten Straßenpflaster vor der Taverne The Fox and Bull und bat die Vorübergehenden um eine milde Gabe. Seine Stimme drang nicht bis zu ihr herüber, doch sie sah die Bewegungen seiner Lippen. Aber nicht einer warf ihm etwas in die knöchrigen, ausgestreckten Hände.
Es bevölkerten einfach zu viele Bettler die Straßen von London. Zehntausende. Und um jeden guten Platz wurde erbittert gekämpft. Auch unter dem Abschaum der Straße gab es Könige, die das Leben in der Gosse und in den Elendsvierteln mit gnadenloser Härte bestimmten. Sie schickten Banden von Taschendieben auf Beutezug aus und kontrollierten mit eiserner Hand das abscheuliche Geschäft mit den Straßenmädchen, die oftmals noch im Kindesalter waren. Einige von diesen »Königen des Elends« herrschten über Armeen aus Hunderten von Bettlern. Gehörte man nicht zu den großen, organisierten Bettlerbanden, hatte man kaum eine Chance, sich auf der Straße zu behaupten.
Tiefe Niedergeschlagenheit erfasste Abby. Arbeit gab es für sie keine. Und angenommen, sie würde sich zu den anderen Bettlern gesellen und von ihnen auch geduldet werden: Wer würde ihr schon etwas geben? Charlotte Walpole hatte recht. Sie war noch längst nicht tief genug gesunken, um Mitleid zu erregen. Dafür zählte bittere Armut viel zu sehr zum normalen Straßenbild der Stadt: Männer, die sich selbst verstümmelten, um als Bettler ein wenig Mitgefühl zu erregen und so ihr Überleben zu sichern. Halbwüchsige, denen der baldige Tod durch Unterernährung und Krankheit ins Gesicht geschrieben stand. Frauen, die in ihrer Not ihre Kinder schon mit sieben Jahren an die Besitzer von Bergwerken oder Spinnereien verkauften –, wo sie zumeist auch starben. An Kälte, Hitze, ungenügender Ernährung, Peitschenschlägen und völliger Erschöpfung durch unmenschliche Schinderei.
Abby seufzte. Ihre Lage war bedrückend, doch noch längst nicht hoffnungslos. Sie konnten immer noch das eine oder andere Kleidungsstück versetzen und einige Gerätschaften zum Pfandleiher bringen. Das Beste war, sie fing schon gleich damit an, wie schwer es ihr auch ankommen mochte. Sie würde Schal und Umhang versetzen. Viel würden die abgetragenen Sachen ja nicht bringen, und sie würde in der ungeheizten Dachkammer frieren, doch von dem Erlös würde sie einkaufen können. Außerdem: Blieb ihr überhaupt eine andere Wahl? Sie mussten essen, brauchten Brot, und vielleicht reichte es sogar noch für etwas Tee.
»Hoffentlich kommt der Frühling schnell«, dachte Abby. Sie wusste jedoch, dass die ersten warmen Tage noch lange auf sich warten lassen würden, und wünschte, sie hätte noch einen gewichtigen Grund, um den Gang zum Pfandleiher auf einen späteren Zeitpunkt verschieben zu können.
Es gab keinen. Die Straße begann vor ihren Augen zu verschwimmen. Hastig und verstohlen wischte sie sich die Tränen aus den Augenwinkeln und blinzelte mehrmals. Eine Lynn weint nicht. Niemals. Das hatte ihre Mutter ihr immer und immer wieder eingeschärft.
»Träume sind wie Wolken. Sie sind unnütz. Man lässt sie ziehen und hängt ihnen nicht nach. Und Weinen ist ein Zeichen von Schwäche«, pflegte sie voller Verachtung zu sagen, wenn sie Abby in einem Augenblick melancholischer Träumerei oder mit tränenschimmernden Augen überraschte. Und dann setzte sie gewöhnlich zu einer ihrer »erzieherischen Predigten« an. So nannte Margaret Lynn zumindest ihre Monologe, die sie mit kalter Unversöhnlichkeit vortrug.
»Wer seine Schwäche preisgibt«, fuhr sie dann gewöhnlich fort, »wird in dieser Welt über kurz oder lang daran zugrunde gehen. Nur Härte zählt und hindert deine Mitmenschen daran, dir an die Kehle zu gehen. Zeig keinem, was du denkst oder fühlst, und vertraue niemand! Wenn du dich daran hältst, wird dir das Leben so manch bittere Erfahrung ersparen. Hältst du dich jedoch nicht daran, wird es dir ergehen wie mir. Du wirst mehr verlieren, als du jemals zu besitzen geglaubt hast. Ja, höre mir nur gut zu, Abby! Das Leben ist grausam und nimmt auf die Schwachen, die Zaghaften und Glücklosen keine Rücksicht. Es geht über sie hinweg, drückt sie in den Dreck und vernichtet sie. So wie eine Feuersbrunst in einer Nacht ganze Städte in Schutt und Asche legt, so gnadenlos rafft das Leben die Schwächlinge dahin und die Verblendeten, denen die Gunst der Stunde einmal hold gewesen ist und die von nun an dem selbstzerstörerischen Wahn verfallen, das Glück für sich gepachtet zu haben. Nein, mein Kind. Die wirklich Glücklichen haben ihr Glück mit Härte, eiserner Willensstärke, Gerissenheit und zäher Ausdauer erkämpft – und sich niemals eine Blöße gegeben. Sie haben sich der Schwachen, der Zaghaften und der Glücklosen bedient. Ihre eigenen Schwächen haben sie so geschickt vor der Welt verborgen, wie man einen bösen Fluch aus seinem Leben zu verbannen sucht! Hast du mich verstanden, Abby? Statt Schwäche zu zeigen, musst du härter sein als die anderen!«
Abby versuchte zu verstehen. Doch manches klang so fremd, so kalt und voller Argwohn, als wären sie allein und nur von Feinden umgeben. Sie wusste nicht, ob es richtig war, härter als die anderen zu sein und niemals zu weinen. Ihre Mutter lebte zumindest nach ihrer Überzeugung. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sie auch nur einmal mit tränenfeuchten Augen, geschweige denn weinen gesehen zu haben.
Deshalb schämte sie sich, wenn ihr manchmal nachts die Tränen kamen und sie nicht zu sagen vermochte, weshalb sie weinte, nur dass sie sich hinterher leichter und irgendwie befreit fühlte. Sie hatte jedoch Angst, von ihrer Mutter dabei ertappt zu werden.
Abby zwang sich, diesen trüben Gedanken nicht weiter nachzuhängen, und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf das rege, lärmende Treiben. Das Gedränge war jetzt so groß, als wäre halb London nach Haymarket geströmt.
Ein schlaksiger, schwarzhaariger Junge in einer Flickenjoppe tauchte eben in diesem Moment drüben auf dem Gehsteig vor der Taverne auf. Er lungerte vor dem Eingang herum, nicht weit von der Stelle, wo der Bettler am Boden kauerte. Er mochte siebzehn sein, also drei Jahre älter als sie.
Abby kannte ihn ganz flüchtig, eigentlich mehr vom Sehen her. Er trieb sich gelegentlich in dieser Gegend herum. Sie glaubte, ihm schon mehrfach im Gedränge des Marktes begegnet zu sein und gehört zu haben, wie ihn jemand Edmund oder Edward gerufen hatte. Aber das war auch schon alles, was sie über ihn wusste. Ihre Mutter ließ ihr nicht viel Zeit für Nichtstun. Sie musste ihr bei der Arbeit zur Hand gehen und ihren Teil zum Lebensunterhalt beitragen.
Sie vermochte nicht zu sagen, was sie veranlasste, dem Jungen ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht ahnte sie, dass es ihm nicht viel besser erging als ihr. Was auch immer der Grund sein mochte, sie ließ ihn auf jeden Fall eine geraume Zeit lang nicht aus den Augen.
Sie verlor jedoch bald das Interesse an ihm, denn viel zu beobachten gab es da nicht. Er tat nichts. Weder bettelte er noch schien er auf irgendjemanden zu warten. Er lehnte einfach nur an der Hauswand neben der Taverne und beobachtete scheinbar völlig teilnahmslos den dichten Verkehr auf der Straße und den scheinbar endlosen Strom vorbeiziehender Passanten.
Abby seufzte. Es wurde Zeit, dass sie weiterging. Die Kälte zog schon vom Steinsockel durch die Kleider. Und ihr stand ja noch der schwere Gang zum Pfandleiher bevor. Gerade wollte sie von ihrem harten Sitz herunterrutschen, als etwas passierte, was ihre Aufmerksamkeit auf sich zog.
Eine Mietkutsche hatte ein Stück oberhalb des Wirtshauses gehalten. Ein gut gekleideter Herr von gedrungener Statur und beachtlicher Leibesfülle stieg aus, strich seinen weinroten Gehrock glatt und drückte dem Kutscher ein paar Münzen in die Hand.
Dann geschah auf einmal so unglaublich viel in so kurzer Zeit!
Abby sah nicht den Hagel kleiner, spitzer Steine, der das Pferd der Droschke traf. Sie sah nur, wie der schon betagte Grauschimmel mit einem erschrockenen, schrillen Wiehern aufstieg, die Oberlippe weit über die dunklen Zähne hochzog und das Weiße im Auge zeigte. Wild warf er den Kopf hin und her, dass seine zottelige Mähne flog.
Die Kutsche rollte zurück und der stämmige Mann auf dem Kutschbock stemmte sich nach Halt suchend gegen das Trittbrett, zerrte an den Zügeln, rief dem Grauschimmel einen scharfen Befehl zu und ließ die Peitsche knallen.
Der korpulente Mann sprang erschrocken zurück und stieß gegen den Jungen in der Flickenjacke, der plötzlich nur einen Schritt hinter dem Dicken stand.
Und Abby sah es, obwohl der Junge bewundernswert schnell und geschickt war: Ein blitzschneller Griff, und er hatte dem Mann die Geldbörse aus der Rocktasche gezogen.
Sie saß wie erstarrt und hielt unwillkürlich den Atem an. Ihr Herz schlug plötzlich wie wild, als hätte sie eine unvorstellbare Entdeckung gemacht … oder als wäre sie selbst an diesem frechen Taschendiebstahl beteiligt. Würde er mit seiner Beute entkommen? Es wurde ihr gar nicht bewusst, dass sie bangte, das Verbrechen könnte noch von anderen bemerkt worden sein.
Edmund, oder wie auch immer er heißen mochte, handelte kaltblütig, eben nach den Regeln seines verbrecherischen Gewerbes. Er drehte sich um und entfernte sich ganz ohne Eile, die Verdacht hätte erregen können. Der Kutscher war noch immer mit seinem Grauschimmel beschäftigt, der sich noch nicht beruhigt hatte.
»Mein Gott, es ist ihm wirklich gelungen!«, dachte Abby schon. Zu früh, wie sich im nächsten Moment zeigte.
Der Dieb hatte vielleicht ein Dutzend Schritte zwischen sich und sein Opfer gebracht, als der Bestohlene plötzlich in seine Rocktasche fasste. »Man hat mich bestohlen!«, rief er mit unmännlich schriller, erregter Stimme, fuhr herum und suchte nach dem Dieb. Sein Blick fiel auf den Jungen in der Flickenjacke. Er erkannte ihn, erinnerte sich an die flüchtige Rempelei und setzte ihm nach. »Das ist der Dieb! Haltet ihn! … Haltet den Lump! Er hat mich bestohlen!«, schrie er und deutete auf den Jungen, der nun sein Heil in der Flucht suchte.
Der Dicke wusste, dass er es mit dem jungen Burschen nicht aufnehmen konnte und ihn allein nie zu fassen kriegen würde. Und so brüllte er, so laut er konnte: »Haltet den Verbrecher! Drei Shilling für den, der ihn fängt!«
Der Ruf »Haltet den Dieb!« wurde nun von den Umstehenden aufgenommen und erhielt ein gellendes, vielstimmiges Echo. Überall blieben die Leute stehen, irritiert erst und dann voller Neugier und Sensationslust. Der Verkehr auf der Straße geriet ins Stocken. Verwirrung machte sich breit. Es war alles so schnell gegangen, dass nur ganz wenige mitbekommen hatten, wer nun der Bestohlene war und wer der Dieb.
Zwei, drei Beherzte versuchten sich die Belohnung zu verdienen. Sie stellten sich dem flüchtenden Taschendieb in den Weg und einer von ihnen bekam ihn sogar am linken Jackenärmel zu fassen. Doch er riss sich los, schlug einen Haken und rannte zwischen den Fuhrwerken hindurch über die Straße.
Abby, die längst aufgesprungen war, erschrak. Der Junge lief direkt auf sie zu! Ganz deutlich sah sie sein schmales, verzerrtes Gesicht mit den angsterfüllten Augen und seinen dampfenden, stoßhaften Atem.
Vier, fünf Sätze war er noch von ihr entfernt, als sich ihre Blicke begegneten. Und dann hörte sie seine Stimme, während er keuchend auf sie zulief. »Wir teilen! … Später! … Hau ab damit!«
Etwas fiel in ihren Korb.
Dann war er auch schon an ihr vorbei.
Fassungslos blickte Abby in den Korb und sah eine pralle, mit Goldfäden durchwirkte Geldbörse. Sie allein war schon viel wert. Wie viel Geld wohl in der Börse steckte? Sicherlich ein kleines Vermögen. Warum hatte er das nur getan?
Sie hatte das Gefühl, etwas völlig Unwirkliches zu erleben. Einen schrecklichen und zugleich doch faszinierenden Tagtraum. Sie war nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Es waren Gedankenbruchstücke, die sich in wirrer Folge hinter ihrer Stirn jagten.
Abby wusste überhaupt nicht, was sie tat, als sie zwei zögernde Schritte machte, weg vom Steinsockel, in Richtung Torbogen, durch den man in eine schmale Gasse gelangte. Sie war wie in Trance.
»Die Geldbörse! … Sie ist Diebesgut! … Ich muss sie zurückgeben!«, schoss es ihr durch den Kopf.
Fast im selben Augenblick schallte der empörte, anklagende Ruf einer Marktfrau vom Sitz eines mit Kartoffeln beladenen Fuhrwerkes über die Straße: »Sie hat die Geldbörse! Das Mädchen da! Das im braunen Umhang!«, geiferte sie vom Kutschbock. »Ich habe gesehen, wie er sie ihr zugesteckt hat! Das ist seine Komplizin! Dieses verdorbene Flittchen da drüben hat die Börse!«
Die Bezichtigung traf Abby wie ein unerwarteter Peitschenhieb. Entsetzt blickte sie auf und sah, wie die Marktfrau mit einem knorrigen Stock in ihre Richtung fuchtelte.
Bevor Abby wusste, was sie tat, rannte sie auch schon wie von Furien gehetzt durch den Torbogen die Gasse hoch. Es kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, den Korb mit der gestohlenen Geldbörse von sich zu schleudern, so verstört war sie. Nur ein einziger Gedanke beherrschte sie: Weg von hier! Weg von dem schreienden Mob, der ihr auf den Fersen war!
Das laute Klappern vieler Schuhe über Kopfsteinpflaster begleitete das wilde Geschrei der Verfolger, die ihr nachhasteten. Die schrillen Stimmen schmerzten ihr in den Ohren. Was wollten sie von ihr? Sie hatte doch nichts getan. Warum rannte sie überhaupt?
Sie sah vor sich eine Gestalt, die aus einem Hauseingang trat, und wollte ihr ausweichen. Doch ein kräftiger Arm schoss wie ein Riegel vor und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Sie stolperte und stürzte der Länge nach auf das harte Kopfsteinpflaster. Der Korb entglitt ihrer Hand, Stoff riss, und eine scharfe Steinkante zog eine lange, blutige Linie über ihren rechten Unterarm.
Benommen blieb Abby liegen.
Doch nicht lange.
Kaum hatten ihre Verfolger sie erreicht, da packten auch schon derbe Hände nach ihr und zerrten sie unsanft hoch, begleitet von einer Mischung aus triumphierenden und bösartigen Zurufen.
»Wir haben sie!«
»Sie haben das Verbrecherflittchen erwischt!«
»Sie hat die Geldbörse wirklich im Korb gehabt! Hier ist sie! … Die drei Shilling gehören mir!«
»Auspeitschen sollte man diese elende Brut! … Man ist sich heute noch nicht einmal am helllichten Tag seines Lebens sicher!«
»Verbrecherpack!«
»Hurengesindel!«
Ein Meer von hassverzerrten Gesichtern umschloss Abby. Sie wollte zurückweichen, doch man hielt sie fest. Speichel traf sie ins Gesicht. Entsetzen und Ekel erfassten sie.
»Ein Konstabler! … Da kommt ein Konstabler!«, rief jemand in der Menge.
»Die sind nie zur Stelle, wenn man sie braucht«, schimpfte ein anderer. »Sie tauchen immer erst dann auf, wenn schon alles vorbei ist.«
»Lasst mich durch! Zum Teufel noch mal, lasst mich durch!«, rief der Dicke, dem die Geldbörse gestohlen worden war. Mühsam bahnte er sich einen Weg durch die Menschenmenge, die im Handumdrehen die schmale Gasse verstopft hatte.
Abby sah sich umringt von vielen Gesichtern, die von reiner Neugier über Schadenfreude bis hin zum Hass alles zeigten – nur kein Mitgefühl. Die Angst legte sich wie eine eiskalte Klaue um ihre Kehle und drückte ihr die Luft ab. Sie wollte vor diesen Augenpaaren, die das Urteil über sie schon gesprochen hatten, zurückweichen. Doch die beiden Kerle, die sie hochgezerrt hatten, hielten sie fest. Die schwieligen Männerhände umschlossen ihre Arme und umklammerten schmerzhaft ihre Schultern. Einer von ihnen stank entsetzlich nach Fisch.
Der schwergewichtige Mann im weinroten Gehrock hatte sich indessen durch die Menschenmenge zu ihr vorgedrängt. »Meine Geldbörse!«, war das Erste, was ihm über die Lippen kam. »Wo ist meine Geldbörse?«
Der sehnige, nach Fisch stinkende Mann hielt ihm den prallen, goldbestickten Beutel hin. »Hier, mein Herr«, sagte er eifrig und mit unterwürfigem Tonfall. »Und wenn Sie gütigst an die versprochenen drei Shilling denken würden …«
Mit einem Seufzer großer Erleichterung nahm der Dicke seine Geldbörse entgegen. »Du sollst die drei Shilling haben.« Sein Blick richtete sich nun auf Abby. Zorn und Abscheu traten auf sein Gesicht. Wie ein Hahn, der nach etwas Lebendigem pickt, stieß er seinen runden, fleischigen Schädel vor, spuckte sie an und zog den Kopf schnell wieder zurück. »Hurenbrut! … Elendes Miststück!«, beschimpfte er sie. »Das hast du dir mit deinem Komplizen ja klug ausgedacht! Aber jetzt wird euch das Handwerk gelegt. Wie heißt es doch: ›Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis der Henkel bricht.‹ Und dir wird der Strick den Hals brechen!«
»Ich … bin nicht seine Komplizin … und ich habe nichts damit zu tun«, brachte Abby nun mühsam hervor.
Die Umstehenden quittierten ihre Worte mit höhnischem Gelächter.
»Was geht hier vor?«, fragte eine scharfe, Respekt heischende Stimme. Es war der Konstabler. Die Leute traten unwillkürlich zurück und bildeten eine Gasse.
Der Konstabler, ein kräftig gebauter Mann mit buschigen Augenbrauen und irgendwie groben Gesichtszügen, ging forschen Schrittes durch die Gasse. Er hatte die aufrechte Haltung eines uniformierten Mannes, der sich seiner Stellung und Macht bewusst war.
Mit leicht gespreizten Beinen, die hohe Stirn gefurcht, stellte er sich neben den Bestohlenen. Die stechenden Augen auf Abby gerichtet, fragte er knapp: »Also, was ist mit ihr?«
»Galsworthy ist mein Name, Konstabler, Samuel Galsworthy aus Bristol. Ex- und Import von Weinen. Ich halte mich geschäftlich in London auf«, stellte sich der dickliche Kaufmann aufgeregt vor und begann umständlich den Hergang des Diebstahls zu berichten.
»Aber das stimmt nicht!«, fiel Abby ihm in die Rede, als er sie erneut als Komplizin des Taschendiebes bezichtigte. »Ich bin unschuldig, Konstabler!«
»Und ich bin die Jungfrau von Kastilien!«, grölte eine Stimme in ihrem Rücken, gefolgt von bösartigem Gelächter.
»Meine Mutter liegt krank zu Bett … Ich wollte Brot kaufen … nur einen Laib Brot … und dann zum Pfandleiher … und ich habe mich dort am Torbogen nur einen Moment ausgeruht, als es geschah«, beteuerte Abby und verhaspelte sich. Panik wallte in ihr auf.
»Sicher wolltest du Brot kaufen – von meinem Geld!«, fuhr Samuel Galsworthy sie an.
»Vergessen Sie nicht, mir die zugesagten drei Shilling Belohnung auszuzahlen, mein Herr«, erinnerte ihn der Fischverkäufer, besorgt darüber, er könnte in der allgemeinen Aufregung um die ihm zustehende Belohnung geprellt werden.
»Ja, ja, alles zu seiner Zeit«, erwiderte der Kaufmann, ohne ihn dabei anzusehen.
»Nein! … So ist es nicht gewesen! Ich kenne den Dieb überhaupt nicht! Habe nie mit ihm gesprochen. Es war Zufall, dass er mir die Geldbörse in den Korb geworfen hat. Er wollte sie los sein und ich stand nun mal da«, sprudelte sie überhastet hervor und hatte das entsetzliche Gefühl, sich im nächsten Augenblick übergeben zu müssen. »Konstabler, Sie müssen mir glauben! Ich …«
Der Polizist brachte sie mit einer herrischen Handbewegung zum Schweigen. »Warum bist du dann mit dem Diebesgut weggerannt, statt stehen zu bleiben und Mr. Galsworthy seine Börse zurückzugeben?«, fragte er scharf.
»Eine treffliche Frage, Konstabler!«, kommentierte der Kaufmann wichtigtuerisch.
»Weil ich Angst hatte«, sagte Abby mit zitternder Stimme. »Diese Frau auf dem Fuhrwerk … sie zeigte auf mich, als hätte ich etwas verbrochen. Und dann zeigten auch die anderen auf mich und schrien und liefen auf mich zu … und da bekam ich es mit der Angst zu tun und bin gerannt … ohne zu denken … ich wollte nicht mit der Geldbörse flüchten … daran dachte ich in dem Augenblick überhaupt nicht mehr. Ich … ich habe einfach nicht gewusst, was ich tat …«
»Was du da sagst, ist dummes Zeug!«, fuhr der Konstabler sie an. »Ausflüchte. Nichts als Ausflüchte. Wer ein reines Gewissen hat, braucht keine Angst zu haben! Und wer nichts verbrochen hat, hat auch keinen Grund zum Weglaufen! Ich glaube dir kein Wort! Du steckst mit dem Schurken unter einer Decke. Dafür gibt es Zeugen! Also lüge mich nicht weiter an.«
»Aber …«
»Schweig!«, donnerte der Konstabler. »Ich will von dir keine Unschuldsbeteuerungen mehr hören! Du verschlimmerst deine Lage damit nur noch mehr. Wenn du klug bist, gibst du den Namen deines Komplizen preis und sagst uns, wo er sich mit dir treffen will. Ihr habt doch sicher ein Versteck, wo ihr zusammenkommt, um eure Diebesbeute aufzuteilen!«
»Nein! Es gibt kein Versteck! Und ich bin auch nicht seine Komplizin! Ich weiß nur, dass er Edmund heißt! Das ist alles!«, entfuhr es Abby in ihrer Erregung unbedacht. Und kaum hatte sie die inhaltsschweren Worte ausgesprochen, da traf sie auch schon die schockartige Erkenntnis, welch einen verhängnisvollen Fehler sie begangen hatte.
In den kühlen Augen des Konstablers, denen der Anblick von Verbrechern aller Art so vertraut war wie Fischen die vielseitigen Gesichter der See, blitzte es triumphierend auf.
»Schau an, erst behauptest du, den Dieb nicht zu kennen, und jetzt weißt du auf einmal seinen Namen!«, hielt er ihr mit grimmiger Genugtuung vor. Seine Vorgesetzten würden mit ihm zufrieden sein, dass sein gestrenges Verhör eine entscheidende Lüge zutage gebracht hatte. Eine Lüge, die sie der verbrecherischen Komplizenschaft zweifellos überführte. »Edmund heißt dein Komplize also! Endlich kommst du der Wahrheit näher! Also, wo versteckt er sich jetzt? Heraus damit! Leugnen hilft dir jetzt nicht mehr! Du hast dich selbst verraten und alle haben es gehört!«
»Bei Gott, das kann ich bezeugen!«, bekräftigte Samuel Galsworthy.
»Meine drei Shilling«, beharrte der Mann an Abbys Seite. »Sie haben mir noch nicht die drei Shilling Belohnung gegeben!«
»Macht das unter euch aus!«, beschied der Konstabler ihn, ungehalten über die Unterbrechung seines Verhörs.
»Bei allem, was recht ist, Konstabler«, antwortete der Fischhändler höflich, jedoch mit einem aufbegehrenden Unterton in der Stimme, »aber drei Shilling demjenigen, der ihm die Geldbörse wiederbeschafft, das waren die Worte des Herrn hier aus Bristol. Und ich kann nicht länger warten. Ich muss zu meinem Fuhrwerk zurück. Allein wird meine Frau nicht …«
»Du bleibst und kommst mit auf die Wache!«, schnitt der Konstabler ihm die Rede ab. »Deine Aussage muss aufgenommen werden. Es sei denn, du legst ein Geständnis ab!« Scharf fasste er Abby dabei ins Auge, als wollte er sie kraft seines Blickes zwingen, ihre verbrecherische Schuld einzugestehen.
»Ich weiß nicht, ob er wirklich Edmund heißt oder Edward«, versuchte Abby den Schaden wiedergutzumachen, den sie angerichtet hatte. Tief im Innern wusste sie jedoch, dass es dafür längst zu spät war. »Und ich kenne ihn auch nicht. Auf dem Markt ist er mir mal begegnet, und ich glaube, jemand hat ihn Edmund oder Edward gerufen.«
Wachsende Verzweiflung bemächtigte sich ihrer. Es war wie ein entsetzlicher Albtraum, dass sie hier vor dem Konstabler stand, bedrängt von böswilligen Menschen, die sich an ihrer unverhohlenen Angst weideten, und wie gefangen in einem Netz aus Verdächtigungen und beängstigenden Halbwahrheiten. Warum löste sich dieser grässliche Albtraum nicht auf und sie erwachte aus einem kurzen unruhigen Schlaf, auf dem Steinsockel neben dem Torbogen sitzend? Doch der Konstabler und die höhnischen Gesichter verflüchtigten sich nicht. Und die Schmerzen, die die groben Männerhände ihr zufügten, waren ebenso Wirklichkeit wie das Blut, das aus ihrer langen Schnittwunde am Unterarm sickerte.
»Sobald sie den Mund aufmacht, kommt ihr ein Schwall Lügen über die Lippen! Ist doch immer das Gleiche mit diesem Verbrechergesindel. Man kann diese Brut auf frischer Tat ertappen, und sie versuchen dennoch, sich wie eine Natter aus der drohenden Schlinge zu winden!«, rief eine Frau mit aufgebrachter, sich überschlagender Stimme aus der Menge und erhielt lärmende Zustimmung. »Gleich wird sie noch behaupten, eine gottesfürchtige Klosterschülerin zu sein!«
»Warum macht man mit diesem Abschaum der Straße nicht kurzen Prozess? Man sollte ihr erst die Diebeshand abhacken und sie dann gleich aufhängen!«, forderte ein schmächtiger, abgehärmter Mann mit einer speckigen Lederschürze vor dem Bauch. Er stand in der vordersten Reihe und funkelte Abby so hasserfüllt an, als wäre nicht der dicke Kaufmann, sondern er bestohlen worden. Er machte den Eindruck, als wollte er seine blutrünstige Forderung am liebsten gleich selber in die Tat umsetzen. »Dann sind wir sie ein für alle Mal los. Es wächst ja auch so noch genug Verbrecherpack nach!«
»Ja, knüpft sie auf!«, schallte es aus der Menge wider. »An den Galgen mit dem Hurenmädchen!«
»Schluss damit!«, erhob der Konstabler seine befehlsgewohnte Stimme und das tumultartige Geschrei erstarb. »Wenn ihr jemand den Strick um den Hals legt, dann wird es der Henker sein. Das Gericht wird schon eine gerechte Strafe aussprechen.«
Ungläubig starrte Abby ihn an, von lähmendem Entsetzen gepackt. Dann löste sich der Bann des Schreckens. Heftig schüttelte sie den Kopf, dass ihre schulterlangen, sanft gewellten Haare flogen, und versuchte sich loszureißen. Doch gegen die rohe Kraft der beiden Männer vermochte sie nicht das Geringste auszurichten. Im Gegenteil. Sie packten nur noch schmerzhafter zu.
»Ich bin unschuldig!«, brach es in einem Schrei ohnmächtiger Verzweiflung aus ihr heraus. »Ich habe nichts mit dem Dieb zu schaffen! … Mein Gott, warum glaubt mir denn niemand!? … Ich war es nicht! … Ich bin unschuldig!«
Eine schallende Ohrfeige riss ihren Kopf zur Seite. Ihre Wange brannte wie mit heißem Öl übergossen. »Schweig!«, fuhr der Konstabler sie an. »Du bist verhaftet! Was du zu deiner Verteidigung anzuführen hast, kannst du vor Gericht sagen! Im Gefängnis wirst du Zeit genug haben, dir deine Worte gut zu überlegen!«
Viertes Kapitel
Der eisige Nachtwind heulte durch die Gitterstäbe des schmalen Fensters, das hoch oben in der dickwandigen Mauer des Kerkers eingelassen war. Ein fahler Streifen milchigen Mondlichtes drang durch den Fensterschacht. Er fiel auf die gegenüberliegende Steinwand und hob eine vom Schimmelpilz überwucherte Fläche aus der Dunkelheit. Weiter hinunter in den Kerker reichte der schwache Lichtschimmer jedoch nicht. Das Elend der über zwanzig Inhaftierten, die sich diese kleine Zelle mit Schwärmen von Läusen, Kakerlaken und gelegentlich auch mit Ratten teilen mussten, blieb in Finsternis getaucht. Noch nicht einmal tagsüber wurde es am Boden der Zelle richtig hell. Dämmerlicht herrschte vor.
Abby sehnte den Schlaf herbei, der ihr wenigstens für ein paar Stunden Vergessen bringen würde. Doch sie fror so sehr, dass sie nicht in den barmherzigen Schlaf zu sinken vermochte. Sie zitterte wie Espenlaub. Wie zu einem Ball zusammengerollt lag sie zwischen den anderen Gefangenen. Nur eine dünne Lage fauligen Strohes bedeckte den kalten Steinboden.
Sie war nicht die Einzige, die keinen Schlaf finden konnte. Die Dunkelheit war erfüllt von einem auch tagsüber nie enden wollenden Strom schreckensvoller Geräusche. In den Husten und schweren Atem der Kranken mischten sich das Weinen der Verzweifelten, das Wimmern und Stöhnen der von Schmerzen oder Albträumen Geplagten und die gottlosen Flüche und Verwünschungen der Abgebrühten. Es war ein entsetzlicher Chor, der auch nachts aus allen Zellen in die Gänge drang und niemals verstummte.
Es war die dritte Nacht, die sie in dieser Gefängniszelle verbrachte. Erst drei Tage waren seit dem verhängnisvollen Morgen in Haymarket vergangen. Doch ihr schien es, als läge mittlerweile ein ganzes Leben dazwischen.
Nach dem Verhör hatte man sie in das Gefängnis von Newgate gebracht und in eines der überfüllten, stinkenden Löcher geworfen, die sich Kerker nannten. Es war ein Abstieg in Regionen menschlichen Elends, gnadenlosester Erniedrigung und tiefster hoffnungsloser Verzweiflung, wie sie Abby nie für möglich gehalten hätte. Selbst für das übelste Volk, das die Straßen Londons unsicher machte und kaum etwas fürchtete, war das Gefängnis von Newgate das Sinnbild der Hölle.
»Lieber ein schneller Tod am Galgen, als durch das Fegefeuer von Newgate zu gehen und bei lebendigem Leib langsam zu vermodern!«, hieß es auch bei den abgebrühten Verbrechern.
Newgate war das Hauptgefängnis von London und im Jahre 1804 schon über 600 Jahre alt. Es war ein widerlicher Ort. Offene Abwasserkanäle, in denen sich Ratten tummelten, zogen sich durch die überfüllten Zellen. Der Gestank von Kot und Gefängnisfeuchtigkeit war unbeschreiblich. Und die Ungezieferplage war so groß, dass man keinen Schritt tun konnte, ohne dass man Läuse und anderes Getier zertrat. Unausrottbar bevölkerte das Ungeziefer das Gefängnis, das zudem noch als privates Unternehmen geführt wurde.
Zwar schmückten die Statuen der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und der Wahrheit die Fassade über dem Haupttor, doch mit der Wirklichkeit von Newgate hatten diese noblen Grundsätze nicht das Geringste zu tun. Die Wärter waren gefühllos gegenüber dem sie umgebenden Elend, oftmals sadistisch und ausnahmslos bestechlich. Die Gefangenen mussten Unterkunft und Verpflegung selber bezahlen. Wer genügend Geld besaß, konnte sich in einem gesonderten Trakt, der sich master side nannte, einen verhältnismäßig komfortablen Gefängnisaufenthalt erkaufen – in einer Einzelzelle und mit allen Annehmlichkeiten. Gelegentlich ließ sich sogar die Freiheit erkaufen. Es war nur eine Frage von genügend Goldstücken. Wer jedoch wenig oder überhaupt kein Geld aufbringen konnte, war der Unbarmherzigkeit der Wärter ausgeliefert. Ohne Geld war Newgate ein Ort ohne Hoffnung.
Abby hatte nicht einen Penny gehabt und so hatte ihr der Wärter kurzerhand den Umhang abgenommen. Es berührte ihn überhaupt nicht, dass er ihre Überlebenschance damit erheblich verringerte. Er stieß sie in eine der dreckigsten Zellen, in der schon mehrere Dutzend Frauen und Mädchen hausten, einige von ihnen seit Jahren. Er griff auch nicht ein, als sich zwei gewissenlose Mitgefangene sofort auf sie stürzten und ihr Schuhe, Strümpfe und Schal abnahmen. Auf ihr flehentliches Bitten, ihr doch nicht noch das Letzte zu nehmen, erntete sie nur höhnisches, verächtliches Gelächter. Sogar der Wärter stimmte darin ein. Die stinkenden, höhlenartigen Löcher von Newgate waren nun mal eine Welt, in der nur die Widerstandsfähigsten und die Rücksichtslosesten eine Überlebenschance besaßen …
Während Abby zitternd im feuchten Stroh lag und die Kälte durch ihren Körper kroch, dachte sie immer wieder daran, was der Wärter gesagt hatte, als er die Gittertür der Zelle verriegelte und sich zum Gehen wandte: »Wieder eine mehr, die nicht über den Winter kommt. Keine vier Wochen gebe ich ihr.« Er hatte es mehr zu sich selbst und mit völlig teilnahmsloser Stimme gesagt, so wie man eine unabänderliche und zugleich bedeutungslose Tatsache feststellte.
Ein Schauer entsetzlicher Kälte durchlief sie. Er hatte nichts mit dem eisigen Wind zu tun, der durch das Gitterfenster wehte. Er kam aus dem Innern, geboren aus grenzenloser Angst.
Fünftes Kapitel
Grau und nebelig zog der neue Tag über London herauf. Abby erwachte aus einem unruhigen Schlaf. Ihre Hände und Füße waren so eiskalt, dass sie fast kein Gefühl mehr in ihnen hatte. In die Menge eng aneinander gedrängter Leiber kam Bewegung. Wie ein ins Wasser geworfener Stein, der seine Kreise zog. Die zerlumpten, von Furunkeln, Geschwüren und Ausschlag befallenen Frauen richteten sich im Stroh auf. Stöhnend, fluchend, hustend und spuckend.
Abby nahm eine Handvoll Stroh und rieb ihre nackten eiskalten Beine. Sie massierte sie so lange, bis sie ein Kribbeln spürte und wieder Gefühl in ihnen hatte.
Auf einmal kam Unruhe unter den Zelleninsassen auf. Vier, fünf Gestalten stürzten zur Gittertür. »Es ist Putney, der Mistkerl von einem Wärter!«, rief eine der Frauen.
»Dreimal die Pest über ihn und sein versoffenes Weib!«, fluchte ein hageres ausgezehrtes Mädchen, das Abby gegenübersaß und keine zwanzig Jahre alt war. Sie konnte kaum noch aufstehen, weil ihre Beine unförmig angeschwollen waren. Es hieß, sie würde es nicht mehr lange machen und den Frühling mit Sicherheit nicht erleben.
Philip Putney war nicht der schlechteste unter den Wärtern, doch gemein und raffgierig genug, um ihn aus tiefster Seele hassen zu können. Seine stämmige Frau Sarah stand ihm in nichts nach. Sie ging ihm regelmäßig bei der Essensausgabe zur Hand, schleppte das angeschimmelte Brot, den von Maden wimmelnden Zwieback oder den Kessel mit der meist schon lauwarmen Wassersuppe, einer ekelerregenden Brühe. Dennoch stürzten sich die Gefangenen mit Gier darauf, denn man setzte ihnen nicht alle Tage etwas Warmes vor.
Der flackernde Schein einer blakenden Fackel kam näher und fiel dann durch die vergitterte Tür in die Zelle. Ungeziefer huschte aus dem Licht, verkroch sich im feucht-modrigen Stroh oder gesellte sich zu seinen Artgenossen, die sich schon in den Lumpen oder im Haar der Gefangenen eingenistet hatten.
»Weg von der Tür!«, brüllte Putneys dunkle, voluminöse Stimme, die Abby jedes Mal an das Grollen eines gefährlichen Raubtiers denken ließ.
Die Frauen ließen augenblicklich die Eisenstäbe los und wichen von der Tür zurück.
Keine Sekunde zu spät.
Ein armlanger Schlagstock, der bis auf das geriffelte Griffende eisenbeschlagen war, krachte mit brutaler Gewalt gegen die Gitterstäbe der Zellentür. Der scharfe, metallische Knall war wie ein ohrenbetäubender Pistolenschuss und hallte noch im nächsten Gefängnistrakt durch die kalten Gänge. Philip Putney, ein wahrer Bulle von einem Mann mit einem grobflächigen Gesicht und einem geteerten Haarzopf im Nacken, wusste sich Respekt zu verschaffen.
»Zurück!«, befahl er, während er die Fackel in den Haltering an der Wand rammte, zum Schlüsselbund griff und aufsperrte.
Es war still geworden in der Zelle. Der Wärter war ohne seine Frau. Damit war klar, dass er nicht gekommen war, um ihnen Wasser und Brot zu bringen. Sein Erscheinen musste einen besonderen Grund haben.
Putney stieß die Tür auf. Sein massiger Körper füllte den Rahmen völlig aus. Er starrte in das Zwielicht des Kerkers, ließ seinen Blick über die Gesichter der Gefangenen wandern. Auf Abby Lynn blieb er liegen.
»Du da!«, sagte er schroff und wies mit seinem Schlagstock auf sie. »Steh auf und komm her!«
Abby fuhr erschrocken zusammen. Was wollte er von ihr?
»Hast du nicht verstanden?«, brüllte Putney. »Du sollst herkommen!«
Abby kam hastig auf die Beine, stieg über die Leiber der Mitgefangenen und näherte sich dem Wärter voller Angst, aber auch mit einem schwachen Funken neu erwachter Hoffnung. Hatte sich ihre Unschuld möglicherweise doch noch herausgestellt?
»Brauchst du vielleicht ’n neues Liebchen?«, höhnte eine der älteren Frauen.
Der Wärter ging auf den Zuruf nicht ein. Er musterte Abby kurz und nicht gerade freundlich. Umso verwunderter war sie, als er den Frauen nun den barschen Befehl erteilte, ihr alles zurückzugeben, was sie ihr abgenommen hatten: Strümpfe, Schuhe und Schal.
Erst erfolgte keine Reaktion. Teils trotziges, teils erwartungsvolles Schweigen breitete sich aus.
»Her mit dem Zeugs!«, donnerte Putney und drohte ihnen: »Ich zähle bis fünf. Wenn die Kleine bis dahin ihre Sachen nicht wieder hat, kriegt ihr die nächsten Tage nichts zu fressen. Dann könnt ihr den Schimmel von den Wänden kratzen und euch den Bauch mit Stroh füllen!«
»Fahr zur Hölle!«, verwünschte ihn das Mädchen mit den angeschwollenen Beinen.
»Los, rückt die Klamotten raus!«, rief eine andere Gefangene mit schriller, aufgeregter Stimme. »Sonst geht es uns allen an den Kragen! Cathy … Lydia! Gebt die Sachen her. Wenn nicht, bekommt ihr es mit uns zu tun. Oder glaubt ihr, wir wollen euch zuliebe hungern?«
Der Wärter begann zu zählen. »Eins … zwei … drei …«
Abbys Schuhe flogen, begleitet von einer vulgären Verwünschung, durch den Kerker und knallten neben ihr an die Wand.
»Vier …«
Strümpfe und Schal landeten vor Abbys Füßen. Schnell nahm sie die Sachen an sich, wickelte sich den Schal um den Hals, zog die Strümpfe über und fuhr in die Schuhe. Es erschien ihr wie ein kostbares Geschenk, nun nicht mehr mit nackten Füßen über den kalten Boden laufen zu müssen. Und sie hatte ganz vergessen, wie warm der Schal doch hielt.
Philip Putney trat zurück. »Komm mit!«, herrschte er sie an.
Abby war geschwächt und wankte aus dem stinkenden Loch in den Gang. Die Zellentür fiel mit einem lauten, metallischen Dröhnen hinter ihr zu.
Der Wärter schloss ab, nahm die Fackel aus dem Halter und versetzte Abby dann einen unerwarteten, schmerzhaften Stoß in den Rücken. Sie schrie auf, taumelte nach vorn und stürzte zu Boden.
»So etwas machst du nicht noch mal, hast du mich verstanden?«, fuhr er sie ärgerlich an. »Ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn man mich für dumm verkaufen will. Und jetzt komm hoch!«
»Ich … ich verstehe nicht, was … Sie … meinen«, stammelte Abby völlig verstört, rappelte sich auf und versuchte mit seinem forschen Tempo Schritt zu halten. »Ich … habe Ihnen doch nichts getan …«
»Du hast mich angelogen!«, fauchte Putney, während sie eine Steintreppe mit ausgetretenen Stufen hochstiegen. Die Fackel hatte er gelöscht, denn Helligkeit flutete hier durch vergitterte Fenster in den Gefängnisgang. »Du hast gesagt, du hast kein Geld und niemanden da draußen, der für dich bezahlen kann …«
»Aber das ist die Wahrheit!«
Der Wärter blieb stehen, fasste sie scharf ins Auge und runzelte dann die breite Stirn. Er begriff, dass sie ihn nicht angelogen hatte, und schüttelte verständnislos den Kopf. »Du hast Besuch.«
»Besuch?«, wiederholte Abby ungläubig.
»Ja.« Philip Putney ging weiter.
Die Nachricht machte sie ganz schwindelig vor Freude und erstarkter Zuversicht. Besuch. Das konnte nur ihre Mutter sein. Wer sonst sollte sie auch besuchen kommen? Es musste ihre Mutter sein!
Doch schon im nächsten Moment schlichen sich Zweifel in ihre Zuversicht ein. Noch vor vier Tagen war ihre Mutter so geschwächt und fiebrig gewesen, dass ihr schon das Sprechen das Letzte an Kraft abverlangt hatte. Nichts hatte auf eine Besserung ihres Zustandes hingedeutet, ganz im Gegenteil. Sie war von Tag zu Tag mehr in sich zusammengefallen.
Abby biss sich auf die Lippen, wollte fragen, brachte jedoch kein Wort über ihre Lippen. Sie fürchtete sich vor Putneys Antwort.
Der Wärter blieb vor einer schweren Bohlentür stehen. Rechts davon stand eine schwere Seemannskiste mit Messingbeschlägen, die im Laufe der Jahre von Grünspan befallen waren.
Abby stutzte. Ihr Umhang lag über der Kiste.
Putney bemerkte ihren erstaunten Blick. »Nur zu, nimm ihn dir«, forderte er sie mit dem müden Lächeln eines Mannes auf, der schon vor Jahren zu dem Schluss gelangt war, dass Gefühle bei seiner Arbeit nichts zu suchen hatten, und der auch nach dieser Überzeugung handelte. »Er gehört dir wieder. Ist bezahlt wie alles andere.«
Wie ein Strohfeuer fiel Abbys Hoffnung in sich zusammen. Ihre Mutter konnte es also nicht sein, denn sie hatte nicht einen Penny, um irgendetwas zu bezahlen. Doch sie nahm die Pelerine und hängte sie sich um. Zum ersten Mal seit vier Tagen fühlte sie sich nun einigermaßen warm. »Wer … wer besucht mich?«, fragte sie.
»Was fragst du mich? Seinen Namen hat er nicht genannt. Und wenn er es getan hätte, hätte es auch nichts bedeutet. Er hat gezahlt und mehr interessiert mich nicht«, erklärte der Wärter gleichgültig. »Zwanzig Minuten gebe ich euch. Mehr ist nicht drin!«
Jenseits der schweren Bohlentür lag ein großer, quadratischer Raum. Eine gut sechs Yard lange Gitterwand, die vom Boden bis unter die Decke reichte, teilte den Raum in zwei gleiche Hälften. Zu beiden Seiten der Gitterwand zogen sich einfache Holzbänke entlang. In jeder Raumhälfte gab es ein vergittertes Fenster, das sich nach außen hin wie eine zu groß geratene Schießscharte verjüngte, und eine Tür, neben der ein dreibeiniger Schemel stand.