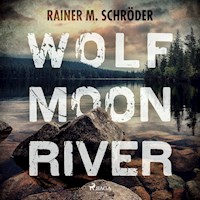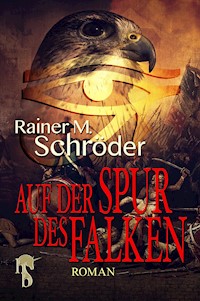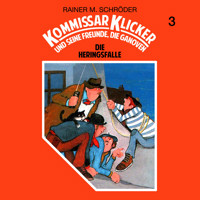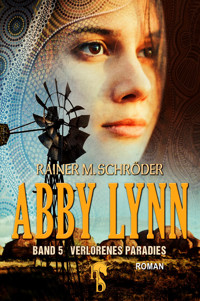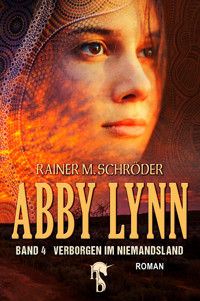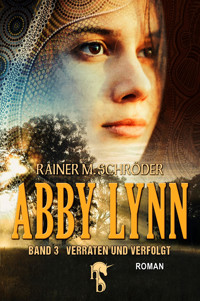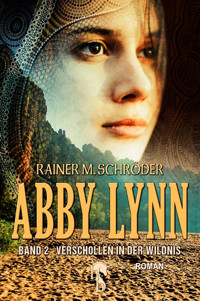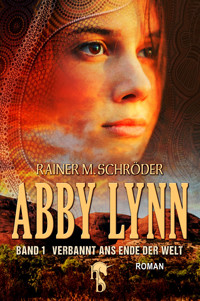9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Heimatlos und doch voller Hoffnung
Alija Bet – das ist der Codename für die illegale Einwanderung in das britische Mandatsgebiet Palästina. Und es ist der Hoffnungsschimmer am Horizont für Leah und Jannek – die beide als einzige ihrer Familien die KZs überlebt haben und nun 1946 traumatisiert als lebende Tote durch das zerbombte München ziehen. Sie hören von der gefahrvollen und teuren Überfahrt auf überfüllten Schrottdampfern, den vielen ertrunkenen oder in Internierungslagern der Briten inhaftierten Flüchtlingen, den Kämpfen mit den arabischen Einwohnern vor Ort. Aber sie haben keine Alternative. Und so machen sich die beiden als illegale Flüchtlinge auf den Weg über das Mittelmeer – mit der Hoffnung auf eine neue Heimat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015
© 2015 bei cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © iulias; ONiONA; vividvic;
TashaNatasha / Shutterstock
Die Zitate aus Thomas Wolfes Schau heimwärts, Engel sind der von
Irma Wehrli übersetzten und 2009 beim Manesse Verlag
erschienenen Ausgabe entnommen. Ihr Abdruck erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des Verlags.
Lektorat: Frank Griesheimer
kg · Herstellung: uk
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-16203-0
www.cbj-verlag.de
Den bisherigen und zukünftigen Opfern
des Antisemitismus und des Nahostkonfliktes
gewidmet.
Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit.
Das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut.
Perikles
Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt,
beherzt ist, wer die Angst kennt und sie überwindet.
Khalil Gibran
Solange der Geist sich nicht wandelt,
ist jede äußere Wandlung nichtig.
Walt Whitman
Inhalt
Erster Teil
Hachshara
September – November 1946
Zweiter Teil
Alija Bet
November 1946 – Januar 1947
Dritter Teil
Genesis
Januar 1947 – Juni 1948
Erster Teil
Hachshara
September – November 1946
1
»Na los, beweg dich, Göre! Merkst du nicht, dass du hier im Weg liegst?«
Die Stimme war so grob wie der Stoß mit dem Koffer gegen die Schulter, der Leah Friedberg abrupt aus ihrem albtraumhaften Schlaf holte. Sie schreckte hoch und riss die Augen auf. Ihr Atem ging stoßhaft und kalter Schweiß perlte auf ihrer Stirn. So war es immer, wenn sie aus der Hölle von Theresienstadt1 zurückfinden musste in die Wirklichkeit, denn im ersten Moment erschienen ihr die entsetzlichen Träume oft wirklicher als ihr leeres, entwurzeltes Leben in der Nachkriegswelt.
Leah kauerte halb ausgestreckt im Gang eines Eisenbahnwaggons, die Rolle einer alten Armeedecke, die sie aus einem britischen Auffanglager bei Berlin hatte mitgehen lassen, hatte sie sich als Nackenstütze unter den Kopf geschoben. Der Zug war heillos überfüllt. In den Abteilen der dritten Klasse drängten sich die Leute auf den hölzernen Bänken. Selbst auf dem schmutzigen Boden des Gangs hatte sie am Vormittag in Frankfurt nur noch mit Mühe einen Platz vor der Tür gefunden. Es roch nach Kohlenruß, Bier, Schweiß, fetter Wurst, Tabakrauch, Erbrochenem, Schmierseife und regennasser Kleidung. Irgendwo weiter hinten im Waggon weinten Kinder, zwei Frauenstimmen stritten miteinander und in der Nähe mischte sich ein trockener, anhaltender Husten in das allgemeine Stimmengewirr. Dazu gesellte sich jetzt eine blechern scheppernde Lautsprecheransage, die durch ein halb offenes Schiebefenster zu ihnen in den Waggon drang. Die seelenlos klingende Stimme kündigte die Einfahrt ihres Zuges aus Frankfurt im Münchener Hauptbahnhof an und forderte zum Zurücktreten vom Gleis auf.
»Was ist, haste was an den Ohren? Beweg dich gefälligst!« Wieder versetzte ihr der Kerl einen Stoß mit seinem Koffer. »Du blockierst den Ausgang, falls du Träne das noch nicht kapiert hast!«
»Lassen Sie das bitte!«, fauchte Leah, rappelte sich auf und hätte um ein Haar das Gleichgewicht verloren, als der Zug in dem Moment mit einem Ruck zum Stehen kam. Schnell bückte sie sich nach ihrer Deckenrolle, die mit drei Stück Paketschnur verschnürt und einem ledernen Trageriemen versehen war, und hängte sie sich über die Schulter. Es war ihr ganzes Hab und Gut.
Wütend funkelte sie den Mann hinter ihr im Gang an, der ihr mit seinem Koffer zugesetzt hatte. Er war um die dreißig und sah, im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der anderen Reisenden, nicht nur gut genährt, sondern auch wie aus dem Ei gepellt aus. Eleganter hellbrauner Filzhut, gleichfarbiger Anzug aus bester Qualität, seidige Krawatte mit einer grauen, goldgefassten Perle als Krawattennadel und darüber ein lässig gegürteter Ami-Trenchcoat, der bestimmt frisch aus dem Regal einer amerikanischen Bekleidungskammer auf den Schwarzmarkt gewandert war. Dazu dann noch ein arroganter, irgendwie verschlagener Ausdruck auf dem kantigen Gesicht.
Diese Sorte von Leuten war Leah inzwischen bestens bekannt. Jedenfalls zweifelte sie nicht daran, dass sie einen Schieber vor sich hatte, einen jener gerissenen Kriegsgewinnler, die illegal Zugang zu den vielen knappen, rationierten Gütern hatten, damit auf dem Schwarzmarkt im großen Stil Geschäfte machten und sich an der Versorgungsnot der Bevölkerung eine goldene Nase verdienten.
»Immer schön mit der Ruhe! Sie kommen noch früh genug zu Ihren miesen Schiebergeschäften!«, raunzte sie grimmig, reckte ihm das Kinn entgegen und strich sich mit der linken Hand eine widerspenstige Strähne aus der Stirn. Dabei rutschte ihr der Ärmel ihres verschlissenen Kleides, an dem der Knopf fehlte, bis zum Ellbogen hoch. Sie ließ den Arm schnell wieder sinken.
Aber der Mann hatte längst gesehen, was sich unter dem Ärmel auf ihrem linken Unterarm abzeichnete. »Ach nee! Wohl durch den Rost gefallen, was, Judenbalg?«, zischte er, während ein Eisenbahner die Waggontür von draußen öffnete und rußige Dampfschwaden vorbeitrieben. Und schon zwängte der Schiebertyp sich mit seinem Koffer an ihr vorbei und stieg aus.
»Braune Ratte!«, rief sie ihm nach und wünschte, sie hätte ihm ins Gesicht spucken können. Aber wenn sie jedem ins Gesicht spucken wollte, der jetzt, fast anderthalb Jahre nach Kriegsende, im Herzen noch immer ein Nazi war, dann käme sie wohl aus dem Spucken nicht mehr heraus.
Der Mann machte eine obszöne Geste, ohne sich zu ihr umzudrehen, eilte mit seinem Koffer voller Schieberware davon und tauchte Augenblicke später im tristen, grauen Menschengewimmel unter.
Leah stieg aus und schlug den Kragen ihrer gerade mal hüftlangen, mit Flicken ausgebesserten Jacke hoch. Ihr war kalt, die schwarzen Wollstrümpfe kratzten, sie fühlte sich zerschlagen und Hunger hatte sie auch. Aber nichts davon war neu.
München begrüßte sie mit dünnem, kaltem Nieselregen – so wie Frankfurt sie am Vormittag verabschiedet hatte. Damit begann der September so triste und regnerisch, wie der August geendet hatte. Sie war jedoch dankbar, dem überfüllten Zug entkommen und an der frischen Luft zu sein.
Die Fahrt hatte fast den halben Tag gedauert. Nicht nur, weil ihre Lokomotive, die wohl noch aus der Zeit des Kaiserreiches stammte, mit minderwertiger Schlackenkohle und Kohlenstaub befeuert wurde, wie einer der Schaffner geklagt hatte, sondern auch wegen der vielen Unterbrechungen auf freier Strecke. Immer wieder hatte ihr Zug auf ein Abstellgleis ausweichen und warten müssen, um einen Militärtransport der alliierten Besatzungsmächte passieren zu lassen. Noch immer war ein Großteil der Gleise in Deutschland zerbombt und vielerorts konnten Strecken nur eingleisig befahren werden. Da genossen die Transporte der Besatzungsmächte natürlich Vorrang.
Dass auch München von den Bombenangriffen schwer gezeichnet war, ließ schon der Bahnhof erkennen. Die einst prächtige Eisen-Glas-Konstruktion, die sich über einer Vielzahl den Bahnsteigen wölbte, bot ein jämmerliches Bild. Von ihr existierte nur noch ein Wrack aus zertrümmertem Glas und verbogenen Stahlstreben, die die wenigen befahrbaren Gleise überwölbten. An vielen Stellen regnete es in diese düstere, weitläufige Halle mit ihrem Gewirr trübseliger Gerüste herein. Zwar herrschte ein reges Kommen und Gehen, aber ohne die heitere, erwartungsfrohe Stimmung, die früher gemeinhin die Atmosphäre eines großen Bahnhofs gekennzeichnet hatte. Zwischen all den ärmlichen, abgerissenen Gestalten der Zivilisten sah Leah Besatzungstruppen, die auf ihre Verladung warteten oder Militärzügen entstiegen waren und die mit ihrem Gepäck und mürrischem Gesicht durch das schlammige Wasser der Pfützen stiefelten. In einigen Ecken, die halbwegs überdacht oder mit Brettern verschlagen waren, drückten sich merkwürdige und zum Teil unheimliche Gestalten herum. Leah nahm an, dass es sich um einen Bahnhofsschwarzmarkt handelte.
Jede Stadt hatte immer gleich mehrere dieser illegalen Handels- und Tauschbörsen. Und nichts – auch die vielen Razzien nicht – vermochte sie aus der Welt zu schaffen, solange die Menschen mit ihren Lebensmittelkarten und Bezugsscheinen nur das gerade Allernötigste zum Überleben bekamen und es in den Geschäften des legalen Marktes an so vielem fehlte.
Leah blieb kurz stehen, legte sich ihren selbst gestrickten Wollschal zum Schutz vor dem Nieselregen wie ein Kopftuch um, knöpfte die Jacke bis hoch zum Hals zu und sah sich in der Halle um.
So wie es überall Schwarzmärkte gab, so hatte auch jede Stadt und insbesondere jeder Bahnhof seine oft meterlangen Bretterwände mit Vermisstenanzeigen. Leah fand die Wand hier im Hauptbahnhof, ohne lange danach suchen zu müssen. Die Menschentrauben, die sich hinten in der Halle beim Nordausgang zur Arnulfstraße drängten, sagten ihr schon von Weitem, wohin sie sich zu wenden hatte.
Auf dieser Wand herrschte gute deutsche Ordnung, wie sie Augenblicke später gleich auf den ersten Blick sah. Die Zettel, Hunderte an der Zahl, hingen nach den Namen der Vermissten alphabetisch sortiert. Die meisten waren von Hand geschrieben, einige mit der Schreibmaschine getippt und ein kleiner Teil auf einer Walze billig vervielfältigt.
Leah wusste nicht, vor wie vielen derartigen Wänden und ähnlichen Anschlägen sie schon gestanden und in wie vielen Büros von Hilfsorganisationen sie endlos lange Namenslisten durchgegangen war. Und obwohl sie in ihrem Innersten längst wusste, dass es keine Hoffnung gab und sie besser erst gar nicht mehr nach vertrauten Namen auf diesem Meer von Zetteln suchte, überfiel die Hoffnung sie doch jedes Mal wieder aufs Neue, sowie sie auf einen derartigen Vermisstenanschlag stieß. Hatte es denn nicht selbst in den Konzentrationslagern so etwas wie Wunder gegeben?
Aber auch diesmal blieb das Wunder aus, und die flüchtig aufgeflackerte Hoffnung verwandelte sich wieder in tiefe Niedergeschlagenheit. Mit einem Gefühl der Verlassenheit trat sie auf der Nordseite aus dem Hauptbahnhof und hinaus auf die regennasse Arnulfstraße. Jenseits des Vorplatzes, dem Bahnhofsskelett gegenüber, erstreckte sich ein weites Trümmerfeld. Gras und Gestrüpp wuchsen aus den Ritzen der Geröllmassen, in denen die Ratten hausten.
Zerbombte Häuser, ganze Straßenzüge brandgeschwärzter Ruinen, wahre Gebirge aus Gebäudeschutt, tiefe Bombentrichter und aus den Trümmerfeldern geisterhaft aufragende, mehrstöckige Fassaden mit nichts hinter den toten Augen ihrer glaslosen Fensteröffnungen bestimmten, ähnlich wie in vielen anderen Städten, das Zentrum von München. Schwabing und die Innenstadt waren von Zehntausenden Spreng- und Brandbomben zu fast neun Zehntel zerstört worden. Es herrschte überall katastrophale Wohnungsnot. Wo es noch halbwegs unbeschädigten Wohnraum gab, stieß man in jedem Zimmer auf behördlich angeordnete Überbelegung und drangvolle Enge. Alle anderen mussten mit irgendwelchen Notunterkünften, Verschlägen, einstigen Luftschutzbunkern oder Kellerlöchern vorliebnehmen.
Nur zögerlich und gegen einen starken innerlichen Widerstand ankämpfend machte sich Leah auf den Weg. Es musste sein. Sie hatten diesen schweren Gang schon lange genug vor sich hergeschoben, nämlich ein volles Jahr und drei Monate. Sie kam einfach nicht darum herum, egal wie lange sie auch damit wartete. Niemand würde es ihr abnehmen. Es war ihre Pflicht, sie schuldete es den Toten. Außerdem konnte sie nur so letzte Gewissheit erhalten. Und dann würde sie vielleicht neue Kraft finden … ja, doch Kraft wofür?
2
Der sprichwörtliche Londoner Nebel würde nicht mehr lange auf sich warten lassen, das spürte Sophie Buchheim förmlich in den Knochen, als sie mit hochgeschlagenem Mantelkragen in die White Horse Street einbog. Die Luft schmeckte rußig. Eine dichte Wolkendecke saß wie eine schmutzige Glocke über der Stadt und der Wind drückte den Rauch aus dem schier endlosen Meer der Schornsteine hinunter in die noch regennassen Straßen.
Ja, die ersten Nebelschwaden würden schon bald vom Fluss her durch die ufernahen Viertel kriechen und sich mit den Rauchschwaden der unzähligen Kohlenfeuer zu einer dicken, gelblichen Suppe vermengen, in der man nicht mehr die eigene Hand vor Augen sehen konnte. In den fast sechs Jahren, die sie nun schon mit ihrer Familie hier in der Stadt an der Themse lebte, hatte sie gelernt, die Zeichen für das baldige Einsetzen des berüchtigten Londoner fog zu deuten.
Es galt sich also zu beeilen, denn ohne die Einkäufe, die ihre Mutter ihr aufgetragen hatte, durfte sie nicht nach Hause kommen, schon gar nicht ohne das Kopfschmerzpulver. Jetzt rächte es sich, dass sie so lange in der Bücherei herumgetrödelt hatte. Aber so erging es ihr jedes Mal, wenn sie zwischen den langen Buchregalen aus dunklem Holz nach ihrer nächsten Lektüre stöberte. Die Bücherei war trotz Missis Wickhams bösen Blicken für sie eine Oase, die sie am liebsten gar nicht mehr verlassen hätte und wo jedes Buch eine lockende Verheißung auf viele wunderbare Lesestunden war. Unendlich kostbare Stunden, die sie aus ihrem bedrückenden Alltag in Welten davontrugen, in denen sie vergessen konnte, dass sie als Jüdin in diesem Land unwillkommen war.
»Also wenn es nach mir ginge, dürften sich diese Deutschen bei uns kein einziges Buch ausleihen!«, hatte Sophie erst vor Tagen Missis Wickham zu einer anderen Frau sagen gehört, und die Leiterin der Bücherei hatte sich dabei keine Mühe gegeben, ihre Stimme zu dämpfen, obwohl sie ganz in ihrer Nähe gestanden und Missis Wickham in ihre Richtung geschaut hatte. Sie hatte wohl jedes Wort hören sollen! »Aber was soll man machen, wenn diese Deutschen einem einen gültigen Ausleihausweis vorlegen? Wo bleibt da die Gerechtigkeit, frage ich Sie?«
Auch an diesem Nachmittag hatte Missis Wickham ihren Ausweis wieder einmal erst hin und her gedreht, als suchte sie nach einem Vorwand, um ihn als ungültig zurückweisen zu können. Sophie war es schwergefallen, dabei still und mit sittsam gesenktem Blick vor ihr zu stehen und zu warten, bis sie endlich so gnädig war, ihr mit einem missbilligenden Schnauben die Ausleihe zu erlauben und den entsprechenden Eintrag in die Karteikarte vorzunehmen. Dabei stand ihr die Benutzung der Bücherei in ihrem Viertel doch von Rechts wegen zu!
Aber richtig wütend sein konnte sie auf die Büchereileiterin dennoch nicht. Missis Wickham hatte in den letzten Monaten des Krieges ihren Mann verloren. Eine deutsche V2-Rakete, die an seiner Arbeitsstelle einschlug und dort den halben Straßenzug in Trümmern legte, hatte sie zur Witwe gemacht. Seitdem unterschied sie nicht mehr zwischen deutschen jüdischen Flüchtlingen und deutschen Nazis. Ihr Hass galt allen Deutschen.
Sophie Buchheim presste den Leinenbeutel mit ihrem neuen Buch zum Schutz vor dem nasskalten Wetter unter ihren linken Arm. Dabei war das Buch zusätzlich noch in altes Zeitungspapier eingeschlagen. Aber sie konnte nicht vorsichtig genug sein. Es durfte nicht der geringste Fleck auf das Buch kommen, sonst würde Missis Wickham das zum Vorwand nehmen, um ihr weitere Ausleihen zu verwehren.
Sie beeilte sich, erst zur Apotheke zu kommen und dann zur Metzgerei der Braxtons oben an der Ecke White Horse und Bale Street. Letzterer Einkauf lag ihr schon jetzt wie ein Stein im Magen, und sie wünschte, ihre Mutter hätte sich gut genug gefühlt, um diesen Einkauf selbst übernehmen zu können. Aber das war mal wieder leider nicht der Fall gewesen. Nicht, dass Sophie nicht bereit gewesen wäre, ihren Beitrag zur häuslichen Arbeit zu leisten. Mit ihren sechzehn Jahren hatte sie in diesen schweren Zeiten nun mal mehr Pflichten zu übernehmen als ihr jüngster Bruder, der gerade erst achtjährige Felix. Aber besonders dieser Gang fiel ihr jedes Mal schwer, zumal wenn Dayna, die feiste Metzgersfrau mit dem Oberlippenbart, hinter der Theke stand. Sophie hatte mal gehört, wie eine Bekannte ihrer Eltern das Mundwerk dieser Frau als »wahre Giftspritze« bezeichnet hatte.
Wenn sie doch bloß die freie Wahl unter den Metzgern gehabt hätten! Aber das ließen die Behörden nicht zu. Die Versorgungslage war noch immer schlecht, und so war jeder mit seiner Lebensmittelkarte bei einem bestimmten Metzger, Bäcker und Lebensmittelhändler seines Viertels registriert. Ihnen, der fünfköpfigen Familie Buchheim, war in ihrem Londoner Stadtviertel Stepney nun unglücklicherweise ausgerechnet der Metzgerladen der Braxtons zugewiesen worden. Nur dort konnten sie kaufen, was ihnen an Fleischwaren zugeteilt worden war.
Aber sosehr es Sophie auch widerstrebte, diesem scharfzüngigen und boshaftem Mannweib unter die Augen zu treten und sich von ihr wie eine dahergelaufene Bittstellerin behandeln zu lassen, sie musste in den Laden. Und je schneller sie das hinter sich brachte, desto besser.
Sophie legte noch einen Schritt zu. Zu ihrer Linken erstreckten sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite die ausgebrannten Ruinen von einem halben Dutzend einstiger Mietshäuser. Eine der vielen klaffenden Wunden, die die Brand- und Sprengbomben der deutschen Luftwaffe in dem langen Zermürbungskrieg in das Häusermeer der Stadt gerissen hatten.
Flüchtig gingen ihre Gedanken zurück in jene kurze, glückliche Zeit, als sie sich in diesem Land willkommen und in ihrem heimeligen Cottage in Cambridge wohlgefühlt hatte. Gerade mal ein Jahr war ihr und ihrer Familie vergönnt gewesen. Dabei hatte ihr Vater das heraufziehende Unheil in Deutschland vorausgesehen und alles richtig gemacht.
Als im November 1938 in ganz Deutschland die Synagogen2 brannten, Wohnungen und Geschäfte jüdischer Bürger systematisch zerstört und geplündert wurden und in wenigen Tagen Hunderte Juden ermordet oder in den Selbstmord getrieben wurden, hatte ihr Vater Herschel, Professor der Literaturwissenschaft an der renommierten Berliner Humboldt-Universität, nicht mehr länger gezögert, das Land zu verlassen – im Gegensatz zu so vielen anderen Juden, die noch immer an der Hoffnung festhielten, irgendwann werde es schon wieder besser werden. Er hatte das Angebot des altehrwürdigen Clare College in Cambridge angenommen, dort zu unterrichten, und sie waren schon in der letzten Novemberwoche mit dem wenigen Hab und Gut, das ihnen die Nazis mitzunehmen erlaubt hatten, an diesen idyllischen Ort übergesiedelt.
Doch mit Ausbruch des Krieges kaum ein Jahr später änderte sich das alles schlagartig. Vergessen war plötzlich, dass Herschel Buchheim ein angesehener Wissenschaftler und erklärter Feind der Nazis war. Es zählte allein, dass er Deutscher war – und keinem Deutschen war über den Weg zu trauen. England fiel in eine geradezu hysterische Hysterie und Deutschen-Phobie. Und so kam es, dass ihr Vater seine Professur am Clare College verlor, man ihr und ihrem älteren, mittlerweile neunzehnjährigen Bruder Marius das Schulstipendium strich – und sie alle unter dem Generalverdacht möglicher Spionage und Sabotage für das Nazi-Regime in ein Internierungslager eingewiesen wurden, wie Zehntausende andere deutsche Flüchtlinge. Selbst wer schon seit vielen Jahren in England lebte, kam in Baracken hinter Stacheldraht. Und als man sie dann endlich wieder daraus entließ, war ihr Leben zerstört.
Die Erinnerung an das, was einmal war, schmerzte so sehr, dass Sophie sich schnell auf die Lippen biss. Dieser Gegenschmerz half meist, die Tränen zurückzuhalten. Und in Gedanken schalt sie sich, dass sie immer wieder den vergangenen Zeiten nachhing. Was war, das war und ließ sich nicht mehr zurückholen. Jetzt galt es, das Beste aus dem zu machen, was ihnen geblieben war. Und das war nicht wenig, wenn man in der Zeitung von den unvorstellbaren Gräueln las, die während Hitlers Schreckensherrschaft verübt worden waren. Dass sie bei deutschen Luftangriffen auf London zweimal ausgebombt worden waren, dass sie nun in zwei kleinen Zimmern zur Untermiete wohnten und der Vater Schreibmaschinen reparierte und Marius Handlanger bei einem Schrotthändler war, all das, so bitter es sein mochte, waren dagegen nicht mehr als Unannehmlichkeiten und Nackenschläge eines unfreundlichen Schicksals, aber kein Grund zu lauter Klage und Selbstmitleid – wie ihr Vater zu betonen nicht müde wurde.
Welch ein Glück, dass es Bücher gibt, fuhr es Sophie tröstlich durch den Kopf, und sie beeilte sich, das Aspirin-Pulver in der Apotheke zu besorgen. Es ging schnell, weil kein anderer Kunde im Geschäft war und sie sofort bedient wurde.
Wenig später betrat sie die Metzgerei der Braxtons. Ihr Herz sank, als sie die lange Schlange der Frauen sah, die darauf warteten, an die Reihe zu kommen. Kaum hatte sie sich hinten angestellt, als das Gespräch einiger Frauen vor ihr sie aufhorchen und innerlich verkrampfen ließ. Die Engländerinnen vor ihr unterhielten sich nämlich äußerst unbefangen und freimütig über die Juden. Ob es sich um einen Zufall handelte oder ihr Erscheinen die Ursache dafür war, wusste sie nicht, es war jedoch auch ohne Bedeutung.
»Früher habe ich immer die Underground zur Arbeit genommen, aber jetzt nehme ich lieber den Bus. Neuerdings fahren mir zu viele von diesem auserwählten Volk mit der Underground«, sagte eine der Frauen.
»Das kann ich gut verstehen, Lizzy! Nicht dass ich ein Antisemit wäre, aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die Juden nun mal nicht leiden kann«, pflichtete eine andere ihr bei.
Nun mischte sich eine dritte Frau mit einer schwarzen Armbinde ein. »Der Jude ist gerissen. Während wir Engländer mit ehrlicher Muskelkraft unser Brot verdienen, arbeitet der Jude mit Tücke und macht dicke Geschäfte. Ich denke, die haben ein Gutteil Schuld an dem, was ihnen da unter Hitler widerfahren ist!«
Sophie brannten die Wangen, und sie wäre am liebsten aus dem Laden gerannt. Aber sie presste die Lippen zusammen und gab vor, nichts davon zu hören. Doch jedes Wort stach wie eine glühende Nadel.
Es ging eine Weile so weiter, bis die Frauen sich einem anderen Thema zuwandten, nämlich einem in wilder Ehe lebenden Paar in der Nachbarschaft, über das sie sich ähnlich empören und sich das Maul zerreißen konnten. Aber es warteten noch einige Boshaftigkeiten auf Sophie.
»Ah, da haben wir ja eine aus dem auserwählten Volk!«, begrüßte Dayna Braxton sie, als sie endlich an der Reihe war.
Sophie schluckte und reichte Missis Braxton ihre Lebensmittelkarte. »Meine Mutter lässt fragen, ob Sie diesmal vielleicht ein gutes Stück …«
»Gibt heute nur Würste!«, unterbrach die Metzgerfrau sie barsch, griff nach einem braunen Einpackpapier und knallte vier Würste hinein, deren graugrüne Farbe vermuten ließ, dass die Därme überwiegend mit Schlachtabfällen gefüllt waren.
»Ich wusste ja gar nicht, dass die Buchheims hier bei dir einkaufen, Dayna!«, wunderte sich eine Frau hinter Sophie scheinheilig. Denn natürlich wusste sie ganz genau, dass es sich niemand aussuchen konnte, wo er einkaufen wollte. »Wo er doch ein Studierter ist und sie erwartet, dass man sie mit ›Frau Professor‹ anspricht!«
»Ja, und jetzt wollen sie auch noch ein Land ganz für sich!«
»Soll mir recht sein«, sagte Dayna Braxton, knallte die vier eingewickelten Würstchen vor Sophie auf die Ladentheke und sagte dabei: »Dann verschwinden sie wenigstens aus unserem Land!«
Sophie musste an sich halten, um nicht dem ersten Drang nachzugeben und fluchtartig aus dem Laden zu rennen. Diesen Triumph wollte sie der Metzgersfrau und ihren Gesinnungsgenossinnen jedoch nicht gönnen. Es gelang ihr sogar noch, einen höflichen Dank zu murmeln. Doch als sie sich umwandte und den Laden verließ, senkte sie nicht den Blick vor den anderen Kundinnen im Geschäft, so wie sie es vorhin noch in der Bücherei getan hatte, um Missis Wickham nicht zu reizen. Es kostete sie große Überwindung, zwar nicht herausfordernd, aber doch erhobenen Hauptes den abschätzigen Blicken der Frauen zu begegnen. Andererseits sträubte sich alles in ihr dagegen, sich kleinzumachen. Nein, sie hatte keinen Grund, sich für ihre Herkunft und ihre Religionszugehörigkeit zu schämen. Was jedoch nichts daran änderte, dass es wirklich schwer geworden war, damit unter den Einheimischen zu leben.
Auf dem Heimweg registrierte Sophie mit geschärftem Bewusstsein die Schilder, die am Vorgartenzaun einer Pension und in den Schaufenstern von zwei Geschäften angebracht waren. In allen drei Fällen suchten die Inhaber Arbeitskräfte für ihre Betriebe, doch bei keinem Schild fehlte die deutlich hervorgehobene Einschränkung Aliens & Jews need not apply! Und derartig unverblümt diffamierende Schilder waren leider keine Seltenheit auf den Straßen in London und auch anderswo. Sophie verabscheute diese Stadt und das Leben hier aus tiefster Seele, genau wie ihr Bruder, aber sagen konnte sie das keinem, nicht einmal ihren Eltern. Es hätte sie nur noch trauriger gemacht.
Der Regen setzte wieder ein, und sie war froh, als sie endlich in der Skidmore Street war. Das Mietshaus, in dem man ihnen im dritten Stock zwei Räume zugewiesen hatte, lag fast am Ende der Straße und damit nur einen Steinwurf vom Regent’s Canal entfernt, der ein Stück weiter südlich bei Limehouse in das große gleichnamige Hafenbecken an der Themse mündete. Es gab weitaus gesündere und ansprechendere Gegenden in London, aber sie mussten dankbar sein, überhaupt ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett und ihre Lebensmittelmarken zu haben.
Als Sophie das Treppenhaus hinaufstieg, in dem es irgendwie immer nach verkochtem Kohl, penetrantem Bohnerwachs und Mottenkugeln roch, hörte sie schon zwei leider nur zu gut vertraute Stimmen. Die eine gehörte ihrer Nachbarin Evelyn Clifford, die andere deren jüngerer Schwester Phoebe, die ständig bei ihr aufkreuzte. Die ewig miesepetrige Missis Clifford hatte für die im Haus zwangseinquartierten Juden so viel übrig wie die Metzgersfrau, und ihre Schwester war von der gleichen Sorte.
Sophie blieb kurz auf dem Absatz des zweiten Stocks stehen, stieß einen schweren Stoßseufzer aus und wappnete sich innerlich schon gegen die bissigen Kommentare der Clifford-Schwestern. Heute blieb ihr wohl wirklich nichts erspart!
3
Ja, wofür soll ich denn bloß meine ziellose Rastlosigkeit aufgeben und wofür neue Kraft finden? Nach all dem, was hinter mir liegt, was kann da noch Sinn ergeben?
Leah verdrängte diese lähmenden Gedanken, wie schon so oft zuvor, und schlug die Richtung zum alten Nordfriedhof mit seinen Arkadengrüften ein. Ihr Weg führte sie kurz darauf an einer fast gänzlich zerstörten Kirche vorbei. Nur eine der mächtigen Säulen, die wohl einst das Hauptschiff getragen hatten, ragte wie ein bizarres Mahnmal mehrere Meter hoch aus dem Schutt auf. Direkt zu ihren Füßen lag in den Trümmern der brandgeschwärzte, vom Rumpf gerissene Kopf einer steinernen Christusstatue mit völlig intaktem Dornenkranz. Die Augen des christlichen Heilands starrten nach unten in den nassen Dreck, der ihm bis über den Mund reichte. Er schien darin ertrunken zu sein.
Geschäftig eilten die Menschen an ihr und den zahllosen klaffenden Wunden der Stadt vorbei, zumeist ärmlich bis schäbig gekleidet. Viele waren mit Leiterwagen, Schubkarren, Fahrrädern mit kleinen Anhängern oder einachsigen Handkarren unterwegs, andere hatten Kinderwagen als Transportmittel umfunktioniert, in denen sie Brennholz, Kohle oder sonst was von hier nach dort brachten. Kinder spielten in dem Urwald aus Trümmern.
Not macht erfinderisch und Improvisation war in dieser schweren Zeit Trumpf. Wenn Leah durch die Straßen lief, stieß sie etwa auf ausgediente Omnibusse, die man in eine Lücke zwischen Schuttbergen geschoben hatte und die nun als Verkaufsräume dienten. Ein Kutscher hatte aus Mangel an Benzin, das streng rationiert und nur mit Ausnahmegenehmigung erhältlich war, vor einen alten, verbeulten Mercedes ohne Fensterscheiben kurzerhand ein Pferd gespannt und auf die Türen mit weißer Farbe Taxi gemalt.
Dass nur wenige Automobile auf den Straßen zu sehen waren und dann fast ausnahmslos Militärlaster und Jeeps mit Fahrern in Uniform, daran war Leah längst aus den anderen Städten ihrer ziellosen Odyssee durch das zerstörte Deutschland gewöhnt. Private Autos waren noch immer eine Seltenheit, hatten die Besatzungsmächte bei Kriegsende diese doch bis auf wenige Ausnahmen für sich und ihr Verwaltungspersonal beschlagnahmt. Und die wenigen, die doch noch privat unterwegs waren, fuhren nicht mit Benzin, sondern wurden überwiegend über Holzvergaser angetrieben, sie verbrannten sogenanntes »Tankholz«.
Auf Schritt und Tritt prägten zivile Kriegsversehrte jeden Alters und beiderlei Geschlechts das Straßenbild, zusammen mit jenen Soldaten, die zwar das Gemetzel auf den Schlachtfeldern überlebt hatten, aber um den Preis schwerer Verwundungen, die zu Amputationen von Gliedmaßen oder dem Verlust des Augenlichts geführt hatten. Gebrochen und kraftlos klang zumeist auch ihre Stimme, mit der sie Streichhölzer, Garn, Nähnadeln, halbe Bleistifte, Wäscheklammern und andere Pfennigwaren zum Verkauf anboten.
Leah kam an einer Gruppe von gut zwei Dutzend Frauen unterschiedlichen Alters vorbei, alle mit den gleichen groben Arbeitskitteln und Kopftüchern aus ähnlich derbem Stoff bekleidet. Sie lasen auf einem großen Trümmerfeld Ziegelsteine auf, klopften Putz- und Mörtelreste mit einem Werkzeug ab und schichteten die gesäuberten Backsteine zum Wiederaufbau am Straßenrand auf. Aber mit tapferen Trümmerfrauen, die mit gutem Beispiel vorangingen und tatkräftig Hand anlegten, damit der Wiederaufbau endlich sichtbare Fortschritte machte, hatten diese Frauen nichts zu tun. Was auf den ersten Blick wie ein freiwilliges Unternehmen aussah, erwies sich beim Näherkommen nämlich als Strafkommando für einstige hochrangige Mitglieder der Nazi-Partei. Das war den bissigen Zurufen der beiden weiblichen Aufseherinnen in amerikanischen Uniformen sowie den Mienen der Zwangsverpflichteten unschwer zu entnehmen.
Auch die kommen viel zu billig davon, wie all die anderen, die untergetaucht sind oder sich einen »Persilschein«3 bei irgendeiner Entnazifizierungskommission erschlichen haben!, ging es Leah bitter durch den Kopf. Aber immerhin standen einige der schlimmsten Kriegsverbrecher seit letztem November vor Gericht, und wie es hieß, sollten in diesen ersten Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen4 schon bald die Urteile fallen.
Vom Bahnhof bis an die Ecke Schelling- und Schraudolphstraße war es kein allzu weiter Weg. Doch je näher Leah der Kreuzung kam, desto schwerer wurde ihr jeder Schritt. Ihr Herz begann zu rasen, und dann sah sie es:
Der repräsentative Häuserblock, wo einst eine herrliche Wohnung im dritten Stock ihr Zuhause gewesen war, wo sie ihrer kleinen Schwester Rachel im lichten Kinderzimmer die Zöpfe geflochten, der Vater ihr Klavierunterricht gegeben und die Mutter sie alle mit unerschöpflicher Liebe und Geduld umsorgt und ihnen Gutenachtgeschichten vorgelesen hatte, von diesem Paradies ihrer Kindheit war nichts mehr übrig. An seiner Stelle befand sich ein weiteres von Unkraut heimgesuchtes Trümmerfeld. Und dieses Trümmerfeld setzte sich im Hintergrund mit der ausgebrannten Ruine der Neuen Pinakothek fort.
Alles zerstört!
Nichts war von ihrer geliebten Nachbarschaft geblieben als eine graue, schmutzige und trostlose Ruinenlandschaft!
Leah fühlte sich so leer und ausgebrannt wie die Ruinen. Mit hängenden Schultern stand sie da und fragte sich, was jetzt geschehen sollte. Das Elternhaus war weg, Eltern und Schwester tot, all ihre Verwandten und einstigen Freundinnen aus Schule und Nachbarschaft tot oder verschollen. Wofür war sie bloß am Leben geblieben?
Sie fürchtete plötzlich, dass all ihre Anstrengungen, das Grauen zu überleben, sinnlos gewesen waren. Wofür hatte sie all das ertragen und überlebt?
Leah fühlte irgendwie nicht, dass sie wirklich lebte. Vor einiger Zeit hatte sie im Schaukasten eines Zeitungsverlages gelesen, dass es rund acht Millionen Menschen gab, die so wie sie vertrieben und entwurzelt waren und nicht wussten, wohin sie jetzt gehörten und wie es mit ihrem Leben weitergehen sollte.
Acht Millionen!
Und sie, Leah Friedberg, war eine Träne in diesem Ozean, sie zählte zu diesem gewaltigen Strom der Entwurzelten, die durch das Land irrten, ohne Heimat, ohne Familie – und ohne Hoffnung.
4
Abrupt wandte Leah sich von den Ruinen ihres einstigen Zuhauses ab und rannte davon, als könnte sie dadurch auch dem brennenden Schmerz der Erinnerungen entfliehen.
Einige Straßenzüge weiter hatte sie sich wieder einigermaßen gefasst, zumindest so weit, dass sie fähig war, sich über das Allernötigste Gedanken zu machen. Dazu gehörte, sich bei einer öffentlichen Suppenküche einen Teller warmes Essen zu beschaffen und dann hoffentlich irgendwo einen trockenen Schlafplatz zu finden.
Leah lenkte ihre Schritte zurück in Richtung Bahnhof. Da fiel ihr Blick auf zwei GIs. Die beiden amerikanischen Soldaten kamen aus einer Kellergaststätte und gingen auf einen am Straßenrand parkenden Jeep zu. Einer der beiden jungen Uniformierten hatte eine Zigarette zwischen den Lippen. Er sprang in den offenen Jeep, startete den Motor – und warf dann die Zigarettenkippe achtlos hinter sich auf den Bürgersteig, bevor er Gas gab und mit seinem Kameraden davonfuhr.
Sofort lief Leah auf die Stelle zu, wo der Zigarettenstummel am Bordsteinrand lag. Es war eine mittlerweile fast schon automatische, instinktive Reaktion. Ami-Zigaretten waren die Leitwährung im Nachkriegsdeutschland, und zwar nicht nur auf dem Schwarzmarkt. Eine Zigarette war je nach Marke und Ort zwischen zehn und zwanzig Reichsmark wert. Und aus dem Resttabak von sieben Kippen, die man fand, konnte man gewöhnlich eine neue ganze drehen. Nur musste man dafür nicht nur wachsam durch die Straßen gehen, sondern auch schnell sein, sobald man jemanden eine Kippe wegwerfen sah. Denn in jeder Stadt gab es unzählige Arbeitslose und berufsmäßige Kippensammler, die sich darauf spezialisiert hatten, sich an die Fersen von Zigarettenrauchern zu heften. Vorzugsweise Besatzungssoldaten, die nicht unter einem Mangel an Glimmstängeln litten und es deshalb auch nicht nötig hatten, sie bis auf die Fingerkuppen aufzurauchen, geschweige denn auch noch die Stummel zu sammeln.
Gerade wollte sich Leah nach der noch glühenden Kippe bücken, als von rechts eine Gestalt in einem alten feldgrauen Soldatenmantel wie ein dunkler Schatten heranflog, sie rüde mit der Schulter aus dem Weg stieß und ihr die Kippe vor der Nase wegschnappte.
Leah taumelte zur Seite, fing sich gerade noch und gab einen wütenden Aufschrei von sich. »He, was fällt dir ein? Das war meine!«, protestierte sie in hilfloser Ohnmacht, wohlwissend, wie sinnlos ihr Protest war.
»Ja, die hättest du wohl gern gehabt! Aber da must du schon früher aufstehen, wenn du mir zuvorkommen willst!«, sagte die Gestalt mit leicht rauer Männerstimme, drückte die Glut zwischen Daumen und Zeigefinger aus und ließ die Kippe schnell in der Manteltasche verschwinden.
Leah wollte dem Mann schon ein Schimpfwort an den Kopf werfen und weitergehen, als sie plötzlich stutzte.
Kam ihr diese Stimme mit ihrem Reibeisenklang nicht bekannt vor?
Erst jetzt schenkte sie dem Mann, der vor ihr stand, einen aufmerksamen, forschenden Blick. Er war jünger, als seine Stimme vermuten ließ. Der viel zu große Wehrmachtsmantel, vielfach geflickt, umschlotterte eine hagere, aber irgendwie doch kräftig gebaute Figur. Hager war auch das blasse Gesicht, das leicht slawische und trotz aller Entbehrung ansprechende Züge bewahrt hatte und klare hellgraue Augen besaß. Das kurze, lockige Haar, das unter einer feldgrauen, abgewetzten Landsermütze mit kurzem Schirm hervortrat, war kohlrabenschwarz und sah wie Drahtwolle aus. Eine weißliche Narbenlinie zog sich über die linke Stirn.
Und ob sie ihn kannte! Auch wenn sie ihn nicht als einen jungen Mann und mit einer Narbe auf der Stirn in Erinnerung hatte, sondern als gerade mal zwölfjährigen Jungen in kurzer Lederhose und mit ständig aufgeschürften Knien!
»Jannek?«, stieß sie fassungslos hervor und glaubte, ihren Augen nicht trauen zu dürfen. Die Freude schoss wie eine heiße Stichflamme in ihr auf. »Jannek Raskowitz? Bist du es wirklich?«
Ihre Frage war überflüssig, denn natürlich war er es. Die leichte Reibeisenstimme, die prägnanten Gesichtszüge, die Augen und die schwarze, drahtige Putzwolle auf dem Kopf, das war ohne jeden Zweifel ihr Jugendfreund Jannek aus dem Hinterhaus, der Sohn ihres jüdischen Hausmeisters polnischer Herkunft Stanislaw Raskowitz. Der Junge, der ihr im Hinterhof das Federballspiel beigebracht, mit dem sie an der Hauswand neben der Kellertreppe um Glasmurmeln gespielt und an der Isar zum ersten Mal geangelt und der sie vor den bösartigen Nachstellungen der Schilling-Zwillinge aus dem Nachbarhaus beschützt hatte! Achtzehn musste er jetzt sein, war er ihr doch im Alter ein gutes Jahr voraus, wie sie sich sofort erinnerte.
Auch auf seinem Gesicht erschien nun ein ungläubiger Ausdruck. »Mensch, ich werd verrückt! … Leah, die kleine Fee von oben aus 3B!«, stieß er hervor und strahlte sie an. »Hol mich doch der Teufel! Du hast überlebt!« Er schien sie spontan umarmen zu wollen, beließ es dann jedoch dabei, sie auf etwas unbeholfene Art an den schmalen Schultern zu packen und sie freundschaftlich zu rütteln.
»Ja, es sah oft nicht danach aus, aber ich habe es irgendwie geschafft«, erwiderte sie mit einem etwas gequälten Lächeln und berührte seine Hand. Sie war kalt und die Haut rau und rissig.
Er verzog das Gesicht zu einer ähnlichen Grimasse. »Wem sagst du das! Hab oft genug gedacht, jetzt heißt es den Löffel abgeben …« Er brach ab und zögerte kurz. »Und was ist mit deiner Familie?«
Leah schüttelte nur stumm den Kopf und blickte zur Seite. Irgendwie fühlte sie sich beschämt, ja fast schuldig, dass von ihrer Familie nur sie dem fürchterlichen systematischen Morden der Nazis entkommen war.
Er verstand und nickte. »Als müsste man es sich zum Vorwurf machen, nicht mit draufgegangen zu sein, nicht wahr? Hab das eine Zeit lang auch gedacht. Denn von meinen Leuten ist außer mir auch keiner durchgekommen. Sind alle auf zu Gott durch die Schornsteine der Krematorien!«, sagte er und lachte dazu noch trocken auf.
Sie zuckte zusammen und sah ihn sichtlich verstört an.
»Entschuldige, mit dem Spruch haben bei uns die Aufseher die Leute in die Gaskammern getrieben. Und wenn man ihn nur lange genug hört, verliert er irgendwann seinen Schrecken.« Er machte eine kurze Pause. »Ich weiß ja nicht, wie es dir ergangen ist, aber mir ist der Glaube an Gott im KZ abhandengekommen, weiß der Teufel wieso.«
Leah lachte bitter auf und nickte. »Das mit dem auserwählten Volk müssen wir Juden wohl mächtig falsch verstanden haben …«
Er zuckte die Achseln und wechselte rasch das Thema. »Wie auch immer, es ist, wie es ist! Komm, lass uns da drüben eine rauchen. Da sind wir aus dem Regen«, sagte er und wies auf eine Ruine mit einer erhaltenen Tordurchfahrt auf der anderen Straßenseite.
Sie ging mit ihm hinüber in den Schutz der Wölbung. Sie setzten sich auf einen Steinhaufen, der von hinten aus dem Hof in die einstige Durchfahrt gerutscht war, und Jannek zog eine verbeulte Blechschachtel hervor. Dem zerkratzten bunten Aufkleber auf dem Deckel nach hatte sie einst Pfeifentabak enthalten. Er klappte die Schachtel auf und ein halbes Dutzend Zigaretten kamen zum Vorschein. Jedoch keine aus Kippenresten selbst gedrehten, sondern richtige Ami-Zigaretten. Und damit sie in der Blechschachtel nicht lose hin und her rollten und dabei Schaden nahmen, hatte Jannek sie in Stroh gebettet.
»Was willst du? Ich bin gut sortiert, ich habe Chesterfield, Camel und Lucky Strike! Such dir was aus! Du hast zur Feier des Tages freie Wahl!«
»Nee, die sind doch viel zu teuer, um sie zu verqualmen!«, sagte sie abwehrend. »Hast du denn keine aus Kippen?«
»Quatsch, dass du unter den Lebenden bist und wir uns hier nach all den Jahren über den Weg laufen, muss doch gefeiert werden!«, erklärte er und nahm ihr die Entscheidung kurzerhand ab. »Hier, nimm ’ne Lucky Strike, das sind die besten!«
Sie lachte unsicher, gab jedoch nach. »Na gut, wenn du darauf bestehst.«
»Ja, tue ich!«
Er riss ein Streichholz an und gab ihr Feuer.
»Na?«, fragte er nach den ersten Zügen und grinste sie an.
Leah nickte ihm mit einem dankbaren Lächeln zu. »Erster Klasse!«, versicherte sie und meinte es auch so. Eine Lucky Strike war der unbestrittene König unter den Zigaretten, und sie wusste es zu schätzen, dass er darauf bestanden hatte, seine beiden letzten Luckys mit ihr zu teilen. Die Zigarette tat richtig gut, auch wenn sie sie ein wenig schwindelig machte, aber das war in Ordnung so. Nie hätte sie als junges Mädchen geglaubt, dass sie einmal rauchen würde. Aber Jahre bitteren Hungers hatten sie gelehrt, dass gegen das quälende Nagen im Magen eine Zigarette fast so gut war wie ein, zwei Scheiben Brot.
Sie ließ einen Augenblick verstreichen und fragte dann, was sie fragen musste, weil es längst zwischen ihnen unausgesprochen im Raum hing. »Wohin hat man euch gebracht?«, erkundigte sie und erinnerte sich daran, dass die Familie Raskowitz lange vor ihnen abgeholt worden war.
»Zuerst ging’s kurz nach Sachsenhausen5, dann nach Auschwitz6«, sagte er zwischen zwei Zügen mit einer bestürzend gleichmütigen Stimme, als nannte er die Namen von zwei unbedeutenden Ausflugszielen in den Alpen und nicht industriell betriebene Vernichtungslager. Er zog den linken Mantelärmel zurück und hielt ihr seinen Unterarm hin, damit sie die dort in die Haut eintätowierte rotviolette Häftlingsnummer sah. Es war eine sechsstellige Zahl, die mit einer Eins begann.
Leah wusste, was die verhältnismäßig niedrige Nummer bedeutete. Nämlich dass Jannek schon früh in das wohl entsetzlichste aller KZ gekommen war und dort jahrelang überlebt hatte. Denn Millionen Juden waren durch Auschwitz gegangen, sodass die Nummern der Häftlinge letztlich siebenstellig geworden waren.
»Und ihr?«, fragte er, als wäre mit der Nennung der beiden Konzentrationslager alles gesagt, was es dazu zu sagen gab. Und in gewisser Weise war es das auch, wenn man selbst ein KZ überlebt hatte.
»Zuerst kamen wir nach Theresienstadt …«
»Ah, Hitlers Geschenk an die Juden!« Er lachte kurz und sarkastisch auf.
Leah nickte. Mit dieser zynischen Bezeichnung hatte die Propaganda der Nazis die Gettostadt den Juden im Reich und der Weltgemeinschaft als harmlos verkauft, nämlich als eine angebliche idyllische Musterstadt und ein exklusives Altersgetto für ausgesuchte Juden von Rang und Namen, in dem es ihnen an nichts fehlte und wo sie das Leben wie in einem eleganten Kurbad führen konnten. Und die Welt hatte sich von der Propaganda täuschen lassen, vermutlich weil die Politiker und Abgesandten diese Lügen einfach hatten glauben wollen. Denn andernfalls hätten sie ja etwas zur Rettung der Juden tun müssen und daran war kein Land ernsthaft interessiert gewesen. Es galt ja einen Krieg zu gewinnen und dabei die Macht in der Welt nach den jeweils eigenen Interessen neu zu ordnen, nicht jedoch die Juden vor der industriellen Vernichtung zu bewahren.
»… und später kam ich dann nach Buchenwald7«, führte sie ihren Satz zu Ende.
Ein freudloses Lächeln glitt flüchtig über sein Gesicht. Er nickte, als erinnerte er sich an etwas, und während er Asche von seiner Zigarette in den nachlassenden Regen schnippte, sagte er, als würde er ein Zitat aussprechen: »Jedem das Seine.«
Überrascht sah sie ihn an. »Du kennst es?« Der Schriftzug Jedem das Seine war in das schmiedeeiserne Gitter des Torhauses von Buchenwald eingelassen. Wohl jeder, der in das KZ gebracht worden war, hatte dieses Gittertor passiert und die in Eisen gegossene Infamie gelesen. »Sag bloß, du bist auch noch in Buchenwald gewesen?«
»Ja, der Name steht auf auch meiner KZ-Besuchsliste«, bestätigte er trocken. »Bin ganz schön weit herumgekommen, was?«
Sophie furchte die Stirn. »Und warum hast du es eben nicht erwähnt? Gibt es dafür einen Grund?«
»Ich zähle es eigentlich nicht mit«, sagte er. »Buchenwald war ja nur meine letzte Station. Da endete für uns, die wir durchgekommen sind, der Todesmarsch8. Und danach hat die Befreiung durch die Amerikaner ja nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die kamen ja schon nach ein paar Wochen.« Er sagte das alles in einem ruhigen, fast teilnahmslosen Tonfall, als steckte nicht hinter jedem Satz eine Welt unsäglichen Leids und Grauens.
Leah sah ihn an und schluckte unwillkürlich. Ein kalter Schauer fuhr ihr den Rücken hinunter. Jannek hatte auch noch den Todesmarsch im Januar ’45 überlebt! Als die Rote Armee damals angerückt war, hatten die Nazis Auschwitz räumen lassen und diejenigen Insassen, die noch kräftig genug waren, mitten im eisigen Winter auf einen mörderischen Todesmarsch nach Buchenwald geschickt. Zig Tausende waren unterwegs krepiert oder von den Wachen erschossen und erschlagen worden, weil sie nicht mehr weiter konnten.
Sie erinnerte sich noch sehr gut an das Eintreffen der Überlebenden in Buchenwald, und es fiel ihr schwer, zu verarbeiten, dass er unter den geisterhaften Gestalten gewesen war, die sich Mitte Januar mit letzter Kraft ins Lager geschleppt hatten.
»Dann waren wir ja die letzten Wochen im selben Lager – und haben es nicht gewusst«, murmelte sie aufgewühlt.
Jannek nickte nur, als berührte ihn das nicht, weil er längst aufgehört hatte, sich über irgendetwas zu wundern. Er drückte die Glut seiner weit heruntergerauchten Zigarette aus, steckte die Kippe in eine leere Streichholzschachtel und starrte schweigend hinaus in den grauen Septembernachmittag, als hätte er ganz vergessen, dass sie neben ihm saß. Auch als sie ihm ihre Kippe überließ, sagte er kein Wort. Er schien unendlich weit weg zu sein.
Schließlich erhob sie sich. »Ich glaube, ich mach mich dann mal wieder auf den Weg.« Es wurde Zeit, die nächste Küche des Roten Kreuzes oder einer anderen Hilfsorganisation zu finden und sich für einen Blechteller mit dünner Suppe und ein Stück Brot in die sicherlich endlos lange Schlange einzureihen. Und dann musste sie sich um einen Schlafplatz für die Nacht kümmern. Nun, notfalls würde sie sich irgendwo in der Bahnhofshalle in ihre Decke einrollen, das war sie gewohnt. Die Bahnhöfe waren in diesen Zeiten längst nicht mehr nur Beginn und Ende einer Reise, sondern auch Sammelplatz für all die Gestrandeten, die nirgendwo sonst ein Dach über dem Kopf fanden. Außerdem gab es im Bahnhof immer ein wenig Licht und eine gewisse Sicherheit vor kriminellem Gesindel, das einen ausrauben und vergewaltigen wollte.
Jannek nickte und kam nun auch vom kalten Bauschutt hoch. »Ja, ich muss auch los, noch was organisieren.«
Einen Augenblick standen sie sich gegenüber, unschlüssig und seltsam steif und verlegen, weil sie nicht wussten, wie sie sich voneinander verabschieden und was sie dabei sagen sollten. Schließlich streckten sie einander fast im selben Moment die Hand entgegen. Sie lachten wie über etwas besonders Komisches.
»Man sieht sich, okay?«, sagte Jannek und schüttelte ihre Hand kräftig, als betätigte er den Eisenschwengel einer Brunnenpumpe.
»Ja, bestimmt!«, sagte Leah und dachte sofort, wie dumm und unwahrscheinlich das klang. Sie wünschte, ihr würde noch etwas einfallen, was sie ihm sagen und den Abschied noch etwas hinauszögern konnte, aber es fiel ihr nichts ein. Jedenfalls nichts, was nicht lächerlich und gekünstelt geklungen hätte. Und so bemühte sie sich um ein Lächeln, gab seine Hand frei und ließ ihn mit den Worten »Also dann, mach’s gut, Jannek!« gehen.
»Ja, du auch, Leah!« Schnell trat er aus dem Torweg und wandte sich nach rechts und damit in die dem Bahnhof entgegengesetzte Richtung. Er drehte sich noch einmal kurz nach ihr um und winkte ihr zu. Dann schlug er den Kragen seines Soldatenmantels hoch, vergrub die Hände tief in den Taschen, zog den Kopf zwischen die Schultern und ging schnellen Schrittes die Straße hinunter.
Leah blickte ihm mit einem schmerzhaften Gefühl in der Brust nach und wurde sich plötzlich mehr als in den Monaten zuvor bewusst, wie einsam, ziellos und verloren sie war.
5
Als Sophie die letzten knarrenden Stufen zum dritten Stock heraufkam, warf Phoebe Clifford ihr einen überraschten Blick zu und sagte zu ihrer älteren Schwester, die in der offenen Wohnungstür stand: »Was, sind die immer noch hier, Eve? Der Krieg ist doch längst vorbei! Also sollen sie doch endlich dahin zurückkehren, woher sie gekommen sind!«
»Ja, da fragt man sich allmählich, in was für einem Land wir leben und wem es gehört!«, grollte Evelyn Clifford und verschränkte die fleischigen Arme vor der Brust. Sie trug wie üblich eine ihrer bunt geblümten Kittelschürzen und um den Kopf gewickelt ein ähnlich gemustertes Tuch, unter dem dicke Lockenwickler hervorschauten. »Wird höchste Zeit, dass die Juden endlich aus unserem Land verschwinden! Die haben lange genug auf der faulen Haut gelegen und sich von uns durchfüttern lassen!«
Am liebsten hätte Sophie ihnen vor die Füße gespuckt und ihnen an den Kopf geworfen, dass sie ganz und gar nicht faul waren, obwohl die Regierung ihnen das Arbeiten verbot, aber das ging natürlich nicht. Aber die Frauen sollten nicht glauben, sie mit ihren Verleumdungen getroffen zu haben. Deshalb zwang sie ein zuckersüßes Lächeln auf ihr Gesicht und grüßte mit sarkastischer Artigkeit: »Ja, Ihnen auch noch einen schönen Abend, die Damen!« Und mit einer geschmeidigen Bewegung wandte sie ihnen den Rücken zu und verschwand auf der anderen Flurseite hinter ihrer Wohnungstür, bevor die beiden Clifford-Schwestern sich von ihrer Verblüffung erholen und ihr noch etwas Gemeines hinterherrufen konnten.
Sophie blieb einen Augenblick im kurzen, dunklen Schlauch der Diele stehen und atmete durch. Gleich links von der Tür ging es in die kleine Kammer, die sie sich mit ihren Brüdern teilte. Das Gemeinschaftsklo befand sich draußen im Zwischenstock des Treppenhauses. Dann gab sie sich einen Ruck, öffnete die schmale Zwischentür und trat in den gerade mal fünfeinhalb Meter langen und vier Meter breiten Raum, der Küche, Wohnstube und für die Eltern auch noch Schlafzimmer in einem war.
Die Einrichtung bestand aus einer kurzen Küchenzeile mit einem Herd, einem einfachen Holztisch mit fünf Stühlen, einem in die Ecke gequetschten Sessel mit abgewetztem Polster und hinten an der Rückwand einem ähnlich abgenutzten Sofa, zu dem ein Bettkasten gehörte. Nachts wurde die zweite Hälfte des Sofas unter dem Bettkasten vorgezogen und zum Bett für die Eltern. Auf dem Bettkasten standen die wenigen Bücher, die der Vater von seiner einst umfangreichen Bibliothek hatte retten können, eine Menora9, und das alte Grammofon, das mit seinen sechs Schellackplatten mit klassischer Musik wundersamerweise selbst die Internierungszeit einigermaßen heil überstanden hatte.
Ihr kleiner siebenjähriger Bruder Felix hockte in seiner kurzen Hose am Boden und schraubte aus den Teilen seines Trix-Metallbaukastens etwas zusammen, das wie ein Baukran aussah. Mit seinem honigblonden Lockenhaar, den unverschämt langen Wimpern und den ausnehmend hübschen Zügen war er der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Er war der Liebling der Familie, der Sonnenschein und Nachzügler, gezeugt und geboren in der trügerischen »Freiheit« ihres Exils in England. Insgeheim beneidete sie Felix um diese wunderbaren Gaben der Natur, kam sie mit ihrem schwarzen Haar und den blassblauen Augen doch mehr nach ihrem Vater, nur mit dem großen Unterschied, dass ihr Pa das hatte, was man einen Charakterkopf nannte, während sie ihrer Überzeugung nach ganz ordinäre, durchschnittliche und einfach nichtssagende Gesichtszüge besaß. Wenn sie endlich ihren altmodischen Zopf abschneiden und eine moderne, frechere Frisur haben dürfte, sähe sie bestimmt nicht mehr ganz so altbacken aus. Aber davon wollte ihre Mutter nichts wissen.
»Hast du mein Kopfschmerzpulver?«, war Margot Buchheims erste bange Frage, als ihre Tochter zur Tür hereinkam. Sie lag auf dem Sofa, eine noch immer bildhübsche Frau von einundvierzig Jahren – bis auf den harten, verbitterten Zug, der sich in den letzten Jahren um ihren Mund herum eingenistet hatte.
ENDE DER LESEPROBE