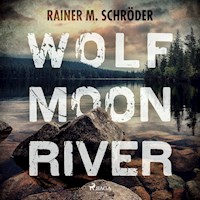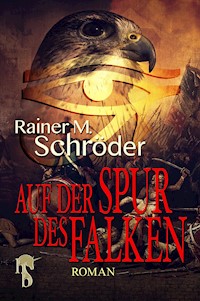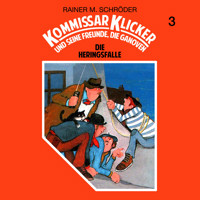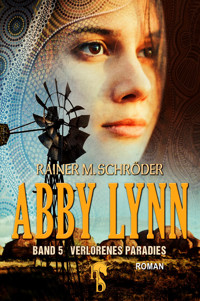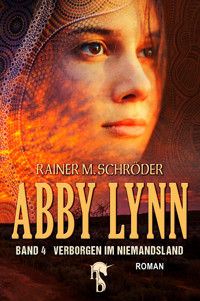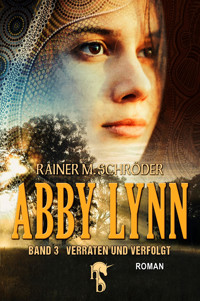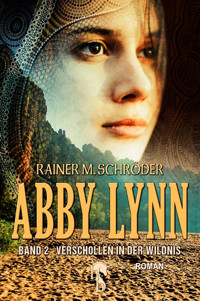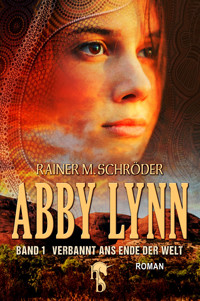6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Akkon, 1291 – die Kreuzzüge stehen vor ihrem dramatischen Höhepunkt. Eine gewaltige muslimische Armee ist bereit, die letzte christliche Bastion im Morgenland zu stürmen. Die tapferen Templer, Johanniter und Deutschritter wissen: Ihre Niederlage ist unausweichlich. Doch inmitten der drohenden Vernichtung erhalten vier junge Tempelritter – Gerolt, Maurice, Tarik und McIvor – einen Auftrag, der ihr Schicksal für immer verändern wird. Der alte Abbé Villard enthüllt ihnen das Geheimnis der Arimathäer-Bruderschaft und weist sie an, den Heiligen Gral – das heiligste aller Relikte – vor den finsteren Iskaris zu retten. Ihre Mission: Den Gral sicher nach Paris bringen. Mit einem der letzten Schiffe entkommen sie dem Inferno von Akkon, doch ihre Flucht endet in den Fängen eines mächtigen Sultans. Während Tarik in Kairo die Freiheit erlangt, kämpft er verzweifelt darum, den Gral und seine Gefährten zu retten. Ein episches Abenteuer voller Gefahren, Verrat und heldenhaftem Mut beginnt. Der erste Band der Roman-Trilogie "Die Bruderschaft vom Heiligen Gral", packend erzählt von Erfolgsautor Rainer M. Schröder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Die Bruderschaft vom Heiligen Gral
Der Fall von Akkon
Roman
In fester Treue und Liebefür Helga & Elisangela,die hingebungsvollsten und tapfersten Ri
»Wahre Hingabe ist sich selbst genug:nach dem Himmel nicht verlangen,die Hölle nicht fürchten.«(Rabia el-Adawia) »Allein vermagst du nichts: Such einen Freund.Könntest du den geringsten Bissendeiner Schalheit schmecken,du würdest zurückschaudern vor dir.«(Nisami, Schatzkammer der Geheimnisse)
Erster Teil
Die letzte Festung
Prolog
Reglos stand er auf dem Verfluchten Turm von Akkon. Die von Zinnen gesäumte Plattform erhob sich hoch über der breiten Festungsmauer der zweiten, inneren Wallanlage. Auf den offenen Handflächen seiner weit ausgestreckten Arme hielt er das von Meisterhand geschmiedete Damaszenerschwert, bei dem die beiden Enden der breiten Parierstange quer über dem Griffstück sowie der Knauf in fünfblättrigen goldenen Rosen ausliefen. Er stand mit dem Gesicht nach Osten, als wollte er die kostbare Waffe dem nächtlichen Himmel als Opfergabe darbieten. Der Widerschein der Fackeln auf den trutzigen Wehrgängen unter ihm und der vereinzelten Brände, die im dicht gedrängten Häusermeer der belagerten Hafenstadt hier und da die nächtliche Dunkelheit mit ihrem flackernden Flammenschein aufrissen, tanzte wie ein glutrotes Irrlicht über den blanken Stahl der beidseitig geschliffenen Klinge.
Die beiden in braune Umhänge gekleideten und schwertbewehrten Gefolgsmänner, die mit ihm auf das viereckige Bollwerk gestiegen waren, hielten einen respektvollen Abstand von mehreren Schritten. Sie folgten dem Tun ihres Herrn mit höchster Aufmerksamkeit. Nichts entging ihnen, auch wenn schon seit vielen Jahrzehnten kein Bild mehr durch den leblosen, milchig trüben Schleier vor ihren Augen gedrungen war. Sie mochten blind sein, aber dennoch »sahen« sie auf ihre Art mehr als manch einer, der sich seines Augenlichts freuen durfte.
»Die Nacht ist vorgerückt und der Tag nahe gekommen! Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts!« Der Mund des Mannes mit dem hoch erhobenen Schwert bewegte sich kaum, als er die Worte des heiligen Paulus aus seinem Brief an die Römer zitierte, sprach er doch allein zu sich selbst. Und dass sie ihm zu dieser weit vorgerückten, nächtlichen Stunde einmal mehr über die Lippen gekommen waren, wurde ihm erst bewusst, als er dem Klang seiner eigenen, geflüsterten Worte nachlauschte.
Wie oft er diese Aufforderung in seinem Leben schon ausgesprochen hatte! Diesmal jedoch war es anders. Die Anbeter des Bösen rotteten sich dort draußen zusammen, lauerten im Rücken des feindlichen Heeres und streckten ihre Klauen nach dem heiligen Quell des Lebens aus, der grenzenloses Verderben über die Welt bringen würde, wenn er ihnen in die Hände fiele. Er wusste, dass die Zeit des Handelns, die Zeit für seine letzte große Aufgabe gekommen war, doch er wartete noch auf das göttliche Zeichen, das ihm den Weg weisen musste. Jeden Moment würden die finsteren Heerscharen der Nacht den lichten Fluten des neuen Tages weichen und es würden die ersten Sonnenstrahlen hinter dem Tell el-Fukar aufleuchten.
Über diese weitläufige, baumbestandene Anhöhe, die sich etwas weniger als anderthalb römische Meilen1 vor den Mauern von Akkon aus der Ebene erhob, war das gewaltige Belagerungsheer der Mamelucken2 vor anderthalb Wochen hinweggeflutet wie eine stürmische Brandungswelle über einen flachen Strand. Ein Meer von Zelten und Pavillons bedeckte seit jenem Tag nicht nur den Tell el-Fukar, sondern erstreckte sich auch entlang der Straße nach Shafra’amr und al-Kadisiya, es hatte von den grünen Ufern des kleinen Flusses Belus Besitz ergriffen und reichte bis weit in das Hinterland nach Samaria hinein. Ein zweites, nicht ganz so gewaltiges Heerlager, das die Sarazenen aus Damaskus und Hamah mit ihren Vasallen bildeten, hatte sich im Norden vor der Stadt zu beiden Seiten der Landstraße nach Tyrus ausgebreitet und den Belagerungsring um die befestigte Halbinsel von Akkon geschlossen.
Der Mann, der sich in Begleitung der beiden blinden Schwertträger zu dieser frühen Morgenstunde auf der Plattform des Verfluchten Turms eingefunden hatte, war von hochgewachsener Gestalt. Dichtes eisgraues Haar fiel ihm auf die hageren Schultern und nicht weniger dicht wallte ihm der Vollbart wie ein aus Silber gesponnenes Schild bis auf die Mitte der Brust herab. Er trug den weißen Mantel der Tempelritter mit dem blutroten Tatzenkreuz. Der Umhang wies ihn trotz des regelwidrig langen Haupthaars als einen jener furchtlosen Kriegermönche aus, deren Mut und Todesverachtung schon seit Jahrhunderten legendär waren und deren unbeugsamer Kampfgeist von keinem anderen Ritterorden erreicht, geschweige denn übertroffen wurde.
In seinem ledrig verwitterten Gesicht, das mit seinem Labyrinth aus zahllosen Furchen und Linien viel Ähnlichkeit mit einem alten, zerschundenen Stück Treibholz besaß, zuckte keine einzige Wimper, als jetzt ein Geschoss von einem der mameluckischen Katapulte wie ein feuriger Komet aus dem Schlund der Hölle heranflog, den äußeren Befestigungswall bei König Hugos Rundturm um wenige Armlängen verfehlte und nur wenige Dutzend Schritte zu seiner Linken an der inneren Festungsmauer zerschellte. Der mit griechischem Feuer gefüllte Tonbehälter zerbarst zu einem hell auflodernden Feuerball, der sich jedoch augenblicklich in unzählige Flammenzungen auflöste. Sie leckten mit gieriger Vernichtungswut über Mauerwerk und Zinnen und sprangen jeden an, der dahinter in Stellung stand und sich nicht schnell genug zur Seite geworfen hatte. Wehe dem, den auch nur eine Handvoll dieser teuflischen Mischung aus Schwefel, Harz, Erdöl, Asphalt, Steinsalz und gebranntem Kalk traf, brannte griechisches Feuer doch sogar unter Wasser unerbittlich weiter!
Der weißbärtige Mann auf der Mauerkrone des Verfluchten Turms hatte schon viele derartige Belagerungen und blutige Gefechte mitgemacht und dabei dem Tod zu oft ins Auge geblickt, um in einem solchen Moment die Ruhe zu verlieren und um sein Leben zu fürchten. In ihm weckte der Tod keinen Schrecken mehr, vielmehr betrachtete er ihn längst als einen Freund, der schon viel zu lange auf sich warten ließ. Und das galt auch für seine beiden Gefolgsleute. Wie heftig die feindlichen Katapulte und Schleudern die eingeschlossene Hafenstadt auch unter Beschuss nahmen, der Geschosshagel um ihn herum konnte seine tiefe Konzentration nicht brechen. Er schenkte auch dem dramatischen Geschehen vor der Templerschanze weit im Westen der Umfassung von Akkon keine Aufmerksamkeit. Seine geschärften Sinne richteten sich auf völlig andere, viel gewaltigere Kräfte, die zu erkennen und zu deuten nur ganz wenigen Sterblichen vergönnt war.
Eine leichte Brise, die von der nahen See herkam, fuhr durch das herabfallende Silberhaar, bewegte die Clamys, das weiße Gewand mit dem roten Templerkreuz auf der linken Seite, und hob für einen Moment sanft wie die Hand eines vorwitzigen Kindes das silbrige Vlies seines Bartes. Die salzige Seeluft führte auch den Rauch der Brände mit sich, die in den Straßen von Akkon loderten. Seine Arme, die das Damaszenerschwert emporhielten, bewahrten ihre gestreckte Haltung ohne jedes Zittern, trotz seines biblischen Alters und trotz des Gewichtes, das auf seinen Handflächen ruhte. Ihn fröstelte jedoch, obwohl hier an der Nordspitze der weiten Bucht von Haifa mittlerweile auch nachts schon wieder angenehm milde Temperaturen herrschten.
Es war denn auch eine tiefe innere Müdigkeit, die ihn unter dem Umhang erschauern ließ. Ihn drückte die Last der Verantwortung, die er zu viele Jahre lang hatte tragen müssen. Dazu kamen die Einsamkeit seines geheimen Amtes und der immer stärker gewordene Schmerz, die rasche Vergänglichkeit jener hinnehmen zu müssen, die sein Leben für eine viel zu kurze Wegstrecke mit ihrer kostbaren Kameradschaft und Treue begleitet hatten. Seine innere Anspannung wuchs. Er spürte förmlich, wie die heraufsteigende Sonne im Osten hinter dem Tell el-Fukar schon die schwarze Hülle der Nacht kraftvoll durchstieß und mit ihrer unbezwingbaren Leuchtkraft aus der Tiefe emporstieg. Gleich würde … gleich musste es geschehen!
Ohne das Gesicht zu wenden und ohne den Blick von dem am östlichen Horizont fixierten Punkt zu nehmen, forderte er seine hinter ihm stehenden Begleiter auf: »Bismillah! … Dschullab! … Sprecht die heiligen Worte!« Und sogleich zitierten die beiden blinden Schwertträger wie aus einem Mund feierlich und beschwörend die Worte aus dem Matthäusevangelium: »Gleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht mehr geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und wehklagen werden alle Stämme der Erde. Sie werden den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird seine Engel mit gewaltigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten sammeln aus den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum andern.«
Die göttliche Prophezeiung war noch nicht ganz verklungen, als die Sonne hinter dem Tell el-Fukar aufstieg. Licht flutete in einer goldroten Woge über das riesige Heerlager der Mamelucken, hob die zahlreichen vor den Mauern von Akkon in Stellung gebrachten Katapulte und Riesenschleudern aus der Dunkelheit und fiel auf die erdrückende Übermacht der muslimischen Krieger.
Einer der ersten Lichtstrahlen, die Akkon erreichten und über die mächtigen Mauern in die Stadt drangen, traf das breite Blatt des Schwertes genau an jenem Punkt, wo auf der Klinge ein Templerkreuz mit einer Rose zwischen den gleich langen Balken prangte. Der Stahl blitzte mit ungewöhnlich blendender Helligkeit auf. Ohne zu wanken und ohne auch nur einmal zu blinzeln, blickte der weißhaarige Mann in den grellen Schein, der eigentlich seinen Augen unerträgliche Schmerzen hätte bereiten müssen. Doch das gleißende Licht floss vielmehr wie ein heißer Strom in ihn hinein und erfüllte ihn bis in die letzte, tiefste Faser seines Körpers. Im nächsten Augenblick nahm er den vertrauten weißen Greifvogel wahr, der in dieser Säule aus Licht aus der unendlichen Tiefe des Himmels herabschwebte. Mit majestätisch ausgebreiteten Flügeln glitt der königliche Vogel heran und verharrte schließlich inmitten der gleißenden Woge, als trüge ihn nicht die Luft, sondern allein jener Lichtstrahl. Das Zeichen, auf das er gewartet hatte! Wie in einem Rausch, der die völlige Kontrolle über all seine Sinne und Empfindungen übernommen hatte, sah er Bilder und Gesichter in rascher Folge. Was nur wenige Sekunden währte, entzog sich allen menschlichen Maßstäben von Zeit und Raum. Dann glitt der blendend helle Lichtfinger von der Schwertklinge und verlosch in dem breiten, alltäglichen Morgenschein. Gleichzeitig entschwand der weiße Greif mit atemberaubender Schnelligkeit aus seinem Blickfeld.
Er ließ das Schwert sinken, führte die Klinge kurz an die Lippen und steckte die kostbare Waffe dann in die Scheide zurück. Nun wusste er, was er zu tun hatte und dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Ihnen allen blieb nicht mehr viel Zeit. Die letzte Mission seines Lebens wartete auf ihn – und sie würde die wichtigste sein, damit das Große Geheimnis im sicheren Schutz geweihter Hüter blieb. »Was habt Ihr gesehen, Abbé?3«, fragte einer der blinden Gefolgsleute ahnungsvoll. »Das Auge Gottes«, antwortete der Grauhaarige und beugte das Knie zum Gebet.
1
Je näher die Morgendämmerung rückte, desto mehr nahm der nächtliche Beschuss durch die Mamelucken an Heftigkeit zu. Das Trommelfeuer der Wurfmaschinen galt einem knapp fünfhundert Schritt langen Teilstück der äußeren Festungsmauer zu beiden Seiten des St.-Antons-Tores. Verbissen schlug Gerolt von Weißenfels mit einer wassertriefenden Kamelhaut auf die Flammen ein. Sie züngelten fast brusthoch über den Wehrgang, der so breit angelegt war, dass auf ihm zwei klobige Fuhrwerke einander bequem passieren konnten. Ihm rann der Schweiß in Strömen über das Gesicht. Unter Helm und Wattekappe klebte ihm das sandfarbene, lockig kurze Haar klatschnass am Kopf. Das Schwertgehänge mit der schweren Waffe an der linken Hüfte behinderte ihn sehr. Und insbesondere das eiserne, knielange Kettenhemd unter der ärmellosen Templertunika, das mit einem breiten Ledergürtel über dem Waffenrock getragen wurde, machte bei der hektischen Bekämpfung des griechischen Feuers jede Bewegung zu einer schweißtreibenden Anstrengung. Zu seiner Rechten mühte sich ein anderer Templer ab, den er nur unter seinem sehr zutreffenden Spitznamen »Wilhelm der Narbige« kannte. Die gellenden Schreie der Verletzten, die von Kameraden aus dem Gefahrenbereich und zur nächsten Verbandsstelle getragen wurden, versuchte er, so gut es ging, zu ignorieren. Mit den anderen Rittern, die von drei Seiten auf den Feuerteppich vorrückten, konzentrierte er sich darauf, die tückischen Flammen so schnell wie möglich zu ersticken, doch ohne großen Erfolg.
Ein Tontopf mit griechischem Feuer, abgefeuert von einer der fast zweihundert Wurfmaschinen, die der ägyptische Mameluckenherrscher Sultan el-Ashraf Khalil vor den Mauern von Akkon in Stellung gebracht hatte, war an der Eckkante eines der Wehrtürme auf der äußeren Festungsmauer zerschellt. Dabei hatte der Feuertopf nicht nur die umlaufende hölzerne Turmgalerie auf der Westseite in Brand gesetzt, sondern einen Gutteil seines teuflischen Inhaltes über den darunter liegenden Wehrgang verspritzt. Nicht jeder hatte sich dort schnell genug vor der zähen, brennenden Flüssigkeit in Deckung gebracht.
»Fester! … Schlagt fester mit den Häuten zu!«, brüllte einer der kommandierenden Ritter vom Johanniterorden, die auf diesem Abschnitt der Wallanlage das Sagen hatten und wegen ihres schwarzen Umhangs mit weißem Kreuz auch die »schwarzen Ritter« genannt wurden. »Und wo zum Teufel bleiben die Turkopolen4 mit dem Sand?«
»Gute Frage, Schwarzmantel!«, stieß Wilhelm der Narbige neben Gerolt grimmig hervor. »Ohne Sand kriegen wir das verfluchte griechische Feuer nicht in den Griff, und wenn mir der Schweiß auch noch so vom Gesicht rinnt! … Hölle und Pest über die ungläubigen Feuerspucker! Mögen ihnen die Drehseile reißen und die Wurfarme verfaulen!«
Endlich kamen die dunkelhäutigen Turkopolen mit sandgefüllten Eimern die Rampe hochgerannt und die Ordensritter, die mit nassen Häuten auf das widerspenstige Feuer eingeschlagen hatten, sprangen erleichtert zur Seite. Höchste Eile war geboten.
Denn jeden Moment konnte ein neues Geschoss diesen Mauerabschnitt treffen. Einige der Riesenschleudern und Katapulte trugen aus gutem Grund so vielsagende Namen wie »Der Wütende« oder »Die Siegreiche«. Diese Giganten unter den muslimischen Belagerungsmaschinen konnten eine Festung nicht nur mit dickbäuchigen, tönernen Feuertöpfen beschießen, sondern auch zentnerschwere Felsbrocken erschreckend zielgenau schleudern. Aber auch die leichten Katapulte vermochten mit der Zeit sogar die dicksten Festungsmauern mürbe zu trommeln und schließlich eine genügend breite Bresche für den Sturmangriff der Fußtruppen zu schlagen.
Der Beschuss von Akkon und seinen Befestigungsanlagen hatte in dieser Nacht einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Angriff konzentrierte sich dabei auf den Mauerabschnitt der Johanniter, die wegen ihrer selbstlosen Krankenpflege auch Hospitaliter genannt wurden, sowie auf den Bereich rund um König Hugos Turm an der Nordostspitze des äußeren Verteidigungsrings. Inzwischen hatten sich die muslimischen Ballisten prächtig auf ihre Ziele eingeschossen.
»Gott gebe uns zweitausend Templer unter dem Kommando von Richard Löwenherz5!«, rief ein anderer Mitbruder zurück, der Wilhelms Verwünschung trotz des lärmenden Durcheinanders auf dem Wehrgang mitbekommen hatte. »Und dann holen wir uns Jerusalem und all die anderen Festungen wieder und treiben den Sultan mit seiner verfluchten Mameluckenbande in die ägyptische Wüste zurück, aus der er gekommen ist!«
Gerolt lachte unwillkürlich auf. »Ja, mit Richard Löwenherz als Befehlshaber und zweitausend gut gerüsteten Templern mehr in Akkons Mauern würde da drüben bei den Mamelucken jetzt das große Heulen und Zähneklappern beginnen!«
»Aber die Gebeine des alten Haudegens rotten schon seit fast hundert Jahren in ihrem Grab!«, erwiderte der Narbengesichtige trocken. »Außerdem hat Outremer6 noch zu keiner Zeit mehr als tausend Tempelritter gesehen! Und vergiss nicht, dass Richard Löwenherz als Feldherr auch nicht immer eine glückliche Hand bewiesen hat.«
»Ja, den Ruhm, Akkon vor der Schändung durch die Ungläubigen bewahrt zu haben, brauchen wir bestimmt nicht mit anderen zu teilen!«, mischte sich da ein vierter Templer ein. Er hatte die unverkennbare Aussprache eines Franzosen aus der Normandie und trug anstelle des üblichen, bis auf den Augenschlitz geschlossenen Topfhelms einen erheblich leichteren Helm mit breitem Rand, der bis auf den lang gezogenen Nasenschutz das Gesicht mit den auffallend edlen Zügen und dem kurzen pechschwarzen Kinnbart frei ließ. Im Nacken hing als zusätzlicher Schutz eine kurze Brünne aus Eisengeflecht vom Helmrand bis auf die Schultern herab.
Wilhelm der Narbige warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Du sagst es, Maurice! Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam!7 So haben wir es doch geschworen, nicht wahr?«
Leicht betretenes Schweigen trat in der kleinen Gruppe der Ordensritter mit dem blutroten Tatzenkreuz auf ihrem Gewand ein, wussten sie doch nur zu gut, dass ohne mächtigen Truppenentsatz von Zypern oder aus der Heimat die Chancen schlecht standen, das Heer des Mameluckenherrschers el-Ashraf Khalil zu schlagen und die Belagerung zu brechen. Blieb ein Entsatzheer aus, das diesen Namen auch verdiente, würde Akkon für sie alle zum Grab werden. Denn ein Templer floh nicht vor dem Feind. Niemals. Er harrte aus bis zum letzten Mann, auch wenn die Lage noch so aussichtslos war. Die Ritter vom Tempel waren stets die Ersten beim Angriff und die Letzten beim Rückzug! So verlangten es Ehre und Ordensregel. Und sogar wenn ihnen der Tod gewiss war, galt es, diesem au plus beau, mit Stil, ins Gesicht zu schauen.
Während die Turkopolen dem Feuer mit feuchtem Sand zu Leibe rückten, nutzte Wilhelm der Narbige die kurze Atempause, um das lederne Kinnband seines Helms zu öffnen und ihn sich mit der gefütterten Kappe vom Kopf zu reißen, schwitzte er offensichtlich doch noch mehr als Gerolt und die anderen Kameraden. Auf dem Turm, wo noch immer ein Teil der hölzernen Galerie lichterloh brannte, schrie indessen ein Befehlshaber nach einer Abteilung bester Armbrust- und Bogenschützen. Sie sollten von der oberen Plattform aus die muslimischen Mannschaften an den Wurfmaschinen unter Beschuss nehmen. Viel war dadurch zwar nicht zu gewinnen, wie jeder erfahrene Kreuzfahrer wusste, weil sich die gefährlichsten Katapulte und Schleudern sogar für die überragendsten Schützen außer Reichweite ihrer Langbogen befanden. Aber wenigstens würden die Mamelucken an den kleineren, näher stehenden Geräten ihren Blutzoll für ihren wütenden Angriff zahlen. Das war gut gegen das niederdrückende Gefühl der Ohnmacht und damit gut für die Kampfmoral der Männer. Kreuzritter waren in dem zweihundertjährigen Kampf um Jerusalem und das Heilige Land gewohnt, gegen eine oftmals auch zahlenmäßig erdrückende Übermacht des Feindes zu kämpfen – und dennoch zu siegen.
Aber die glorreiche Zeit der großartigen Triumphe über die Ungläubigen, die unter dem grünen Tuch ihres Propheten Mohammed mit dem silbernen Halbmond in die Schlacht zogen, gehörte der Vergangenheit an. Jerusalem war schon seit Langem an sie zurückgefallen. Der legendäre muslimische Heerführer Saladin hatte den Kreuzfahrern mit der Rückeroberung der Heiligen Stadt im Jahre 1187, also vor mehr als einem Jahrhundert, eine der bittersten und schmachvollsten Niederlagen zugefügt. Nicht einmal Richard Löwenherz hatte ihm die Stadt wieder entreißen können. Und von den einstmals vielen stolzen Kreuzfahrerfestungen und anderen mächtigen Bollwerken der Christenheit im einstigen christlichen Königreich Jerusalem behauptete sich jetzt nur noch Akkon gegen den scheinbar unaufhaltsamen Vormarsch der Ungläubigen. Fiel jetzt auch noch Akkon, bedeutete das gleichzeitig auch das Ende der Kreuzfahrerstaaten im Lande Christi. Die reiche und stark befestigte Hafenstadt, auf einer Halbinsel gelegen und auf zwei Seiten schützend vom Meer umgeben, hatte in ihrer bewegten Geschichte mehr als einmal einer Belagerung durch ein mächtiges Heer standgehalten.
Diesmal sah die Lage jedoch düster aus. Denn Sultan el-Ashraf Khalil lag mit mindestens vierzigtausend Berittenen und mehr als einhundertzwanzigtausend Mann Fußvolk vor Akkon. Dagegen vermochten die Eingeschlossenen gerade mal anderthalbtausend gut bewaffnete, kampferfahrene und berittene Ordensritter und eine sechzehntausend Kopf starke Hilfstruppe aufzubringen. Und mit etwas Glück kamen noch einige Tausend tapfere Männer aus der Bevölkerung der Stadt dazu, die sich auf rund vierzigtausend Seelen belief. Viele von ihnen rüsteten sich schon zur Flucht. Der unaufhörliche Beschuss und die immer neuen Brände, die in der Stadt bekämpft werden mussten, zermürbten die Menschen. Im Hafen lag bereits eine Flotte von kleinen und großen Handelsschiffen, um diejenigen, die mit einem Sieg der Muslime rechneten, gegen gute Bezahlung nach Zypern, Konstantinopel, Italien oder Frankreich zu bringen. Und täglich stieg der Preis für eine Schiffspassage.
Aber die Mehrheit harrte immer noch aus, weil für sie zu viel auf dem Spiel stand. Und weil sie ihre Hoffnung darauf setzte, dass König Heinrich II. schon bald mit frischen, kampferprobten Truppen aus Zypern eintreffen und das Oberkommando über die Verteidigung von Akkon übernehmen würde. Mit diesen Schiffen waren in den letzten Tagen aber auch eine Menge zwielichtiges Volk und skrupellose Geschäftemacher eingetroffen. Eine Stadt, die mit ihrer Eroberung durch den Feind rechnen musste, bot eine Vielzahl von Möglichkeiten, noch in den letzten Tagen des Widerstands einen schnellen Gewinn zu machen. Nicht jeder Kaufmann würde ausreichend Frachtraum ergattern können, um sein Warenlager zu retten. Dann schlug die goldene Stunde der gewissenlosen Aufkäufer. Auch würden Plündererbanden, die über ihre eigenen kleinen Boote verfügten, reichlich Gelegenheiten finden, im Chaos einer überstürzten Aufgabe ihrem schmutzigen Gewerbe nachzugehen.
Gerolt verdrängte diese und andere trübe Gedanken. Noch sprach niemand von Übergabe. Und noch hielten die Mauern, die sich in einem hervorragenden Zustand befanden, dem Beschuss des Feindes stand. Die Turkopolen waren noch immer damit beschäftigt, das Feuer auf dem Wehrgang zu löschen.
Indessen hatte Wilhelm mit seinem Helm Wasser aus einem nahen Löschtrog geschöpft und sich das kühle Nass über den verschwitzten Kopf gegossen. »Was für ein Genuss! Das ist fast so belebend, wie einen Feind mit der Klinge im Leib in den Staub sinken zu sehen!«, verkündete er und fuhr sich durch den nassen, zotteligen Bart, der nicht wenig Ähnlichkeit mit dem eines alten Ziegenbocks hatte.
Das Haupthaar stets kurz zu halten, sich jedoch niemals den Bart zu schneiden, gehörte zu den strengen Regeln des Templerordens. Gerolt von Weißenfels war nun ebenfalls versucht, das Kinnband zu lösen und sich wenigstens für einige Minuten von Kappe und Helm zu befreien. Aber er ließ es dann doch bleiben. Er hatte nicht vergessen, was erfahrene Ritter ihm immer wieder eingeschärft hatten, nämlich im Kampf niemals die eiserne Waffendisziplin persönlicher Ehrsucht oder kurzzeitiger Bequemlichkeit zu opfern.
Er war erst vor einem Dreivierteljahr an seinem achtzehnten Geburtstag zum Ritter geschlagen und in den Orden der »Armen Ritter Christi vom Tempel Salomons zu Jerusalem« aufgenommen worden. Zu dem Zeitpunkt hatte er sich jedoch schon drei Jahre im Heiligen Land aufgehalten, den erdrückenden Vormarsch muslimischer Truppen erlebt und sich in mehreren blutigen Schlachten als wagemutiger, draufgängerischer Knappe und Templerproband ausgezeichnet. Trotz seiner Jugend hatte er unter der heißen Sonne der Levante schon so manch erbitterten Kampf Mann gegen Mann ausgefochten und bewiesen, dass er Schwert und Lanze ausgezeichnet zu führen und die Nerven im blutigen Schlachtengetümmel zu bewahren verstand. In diesen Jahren hatte er mehr an Schönheit sowie an Grauen gesehen, als er jemals für möglich gehalten hätte, als er mit vierzehn seine Heimat nordwestlich von Trier verlassen hatte, seinem inneren Ruf gefolgt und ins Heilige Land gezogen war, um sich den Templern anzuschließen und Gott als Kriegermönch zu dienen.
Aber nie hätte er gedacht, dass er als Templer einmal ausgerechnet Seite an Seite mit den Johannitern gegen die Muslime kämpfen würde! Die einen hatten noch nie den anderen über den Weg getraut und es hatte seit Gründung der beiden Orden zwischen ihnen nicht wenige feindselige Zusammenstöße gegeben. Sogar hier in Akkon war es vor nicht langer Zeit zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Johannitern und den Templern gekommen. Päpstliche Vermittler hatten energisch eingreifen müssen, um den Frieden zwischen den beiden rivalisierenden Ritterorden wiederherzustellen. Jedoch genau das, was Gerolt nie für möglich gehalten hätte, nämlich eine wahre Waffenbrüderschaft mit den Schwarzmänteln, das widerfuhr ihm und seinen Kameraden vom Templerorden in dieser Aprilnacht. Und zu seiner großen Überraschung war es, als hätte es diese zweihundertjährige Rivalität zwischen den beiden Ritterorden nie gegeben. Eigentlich hatten er und seine Ordensbrüder auf diesem mittleren Abschnitt der nordwestlichen, turmbewehrten Festungsmauer gar nichts zu suchen. Dieser Teil des äußeren Verteidigungsgürtels gehörte zum Verantwortungsbereich der Johanniter und es war allein deren Aufgabe, auf diesem Mauerabschnitt feindlichem Beschuss standzuhalten und Schäden an den Wällen und Türmen unverzüglich auszubessern. Den Templern und ihren Hilfstruppen oblag die Sicherung des angrenzenden Mauerabschnitts, der vom westlichen Ende der Johanniterschanze bis an das Meer reichte, wo der Teufelsturm hinter dem St.-Lazarus-Tor die Mauer zur See hin abschloss. Aber der ungewöhnlich heftige und konzentrierte Angriff der Mamelucken auf die Johanniterschanze beim St.-Antons-Tor und auf den Bereich bis zum Rundturm des Königs, der als eine der Schwachstellen der gesamten Befestigung galt, hatte es nötig gemacht, den Johanniterrittern auf ihrem Festungsabschnitt unverzüglich Verstärkung durch einen Großteil der Templerwachen zukommen zu lassen.
»Ich wünschte, die drei Großmeister8 würden ihre persönlichen Querelen einmal vergessen und sich entschließen, den Kampf gegen die Mamelucken auf unsere Weise auszutragen – nämlich da draußen auf dem Schlachtfeld, wo wir unsere ganze Stärke zum Einsatz bringen können!«, stieß Wilhelm der Narbige missmutig hervor und deutete hinunter auf das freie Feld vor den Mauern. »Ich will ja nichts gegen Johanniter und die Ritter vom Deutschen Orden sagen, obwohl die Letzteren ja die Frechheit besessen haben, bei ihrer Ordensgründung als Habit9 ebenfalls den weißen Umhang zu wählen, als ob das nicht schon unser Vorrecht gewesen wäre …«
»Wenigstens haben diese Frischlinge nicht auch noch unser rotes Tatzenkreuz gestohlen, sondern sich mit einem schwarzen Kreuz und einer anderen Balkenform begnügt«, warf der Franzose ein, den Wilhelm vor Kurzem mit Maurice angesprochen hatte. »… aber was ein echter Templer ist, der versteckt sich nicht hinter Mauern und nimmt es untätig hin, dass er Tag und Nacht beschossen wird«, fuhr der narbengesichtige Ordensbruder verdrossen fort, »sondern er stellt sich den Muselmanen mit blankgezogenem Schwert oder eingelegter Lanze im offenen Kampf!«
»Ja, was kümmert uns deren angebliche Übermacht?«, hieb Maurice sogleich in dieselbe Kerbe und seine dunklen Augen, die unter einem sanft geschwungenen Kranz von langen schwarzen Wimpern lagen, blitzten vor kaum zu zügelnder Kampfbegeisterung.
»Wo Templer in die Schlacht ziehen, sind sie immer in der Unterzahl! So ist es von Anfang an gewesen! Und hat ein Templer je den Tod gefürchtet? Nein, niemals! Wenn wir sterben, dann wird es zum Ruhme Gottes sein! Wir sind milites Christi, Soldaten Gottes! Die Steine, auf denen der neue Tempel Gottes auf Erden errichtet wird!«
»Du sprichst mir aus der Seele! Wir haben den Ruhm des Martyriums um Christi willen gewählt!«, pflichtete Gerolt ihm bei und überlegte, bei welcher der letzten Kampfhandlungen er dem Franzosen, der nur zwei, drei Jahre älter als er sein konnte, schon einmal begegnet war. Der Mann gehörte einer anderen Einheit an, aber das Gesicht unter dem Eisenhut war ihm dennoch nicht völlig unbekannt. Und zwar nicht allein von flüchtigen Begegnungen hier in Akkon. Vage Bilder lösten sich aus den Tiefen seiner Erinnerung und stiegen ins Bewusstsein auf, Bilder von einem furios kämpfenden Templer, der mit dem Schwert in der Rechten und einem völlig zerborstenen Schild am linken Arm in einer Mauerecke über einem am Boden liegenden, verletzten Mitbruder stand und sich wie ein Löwe gegen eine Meute Hyänen allein einer Gruppe von Feinden erwehrte, bis sich endlich Verstärkung zu ihm durchschlug. Ja, das war dieser Maurice mit den ausdrucksvollen Zügen und dem kurzen schwarzen Kinnbart gewesen! Und zwar beim erbitterten Kampf um Tripolis vor zwei Jahren, als er, Gerolt von Weißenfels, noch als Knappe und mit schwarzem Umhang in die Schlacht gezogen war!
»Mir liegt der offene Kampf auch mehr als das hier«, warf ein anderer Ordensbruder ein. »Aber ich bin sicher, dass es nicht dabei bleiben wird. Bestimmt arbeiten die Großmeister schon an einem Plan, wie wir den Belagerungsring der Ungläubigen aufbrechen und …«
Mitten im Satz brach der Ritter ab. Denn in diesem Moment kam aus der Richtung, wo die gefürchteten Großschleudern der Mamelucken in Position standen, das unverkennbare Geräusch eines langen Wurfarms, der, jäh vom Spannseil befreit, wie die Peitsche eines Riesen hoch in die Luft schnellte. Nach einer winzigen Verzögerung war auch deutlich zu hören, wie der riesige, von Eisenbändern umschlossene und mit Erde und schwerstem Gestein gefüllte Kasten des Gegengewichts auf die Standbalken krachte und das Geschoss aus der Höhlung am Ende des Wurfarms geschleudert wurde.
»Das klingt ganz nach dem ›Wütenden‹! Nichts wie in Deckung!«, schrie Gerolt alarmiert seinen Kameraden zu und wünschte jetzt, er hätte seinen Schild nicht in der Waffenkammer der Stadtburg zurückgelassen.
Kaum hatte Gerolt die Warnung hervorgestoßen, als das Geschoss auch schon in hohem Bogen aus der Dunkelheit heranflog. Diesmal handelte es sich nicht um einen Feuertopf, sondern um einen scharfkantigen Felsbrocken von der Größe eines ausgewachsenen Ochsen. Wie ein vom Himmel fallender, erkalteter Komet stürzte er aus der Nacht herab und traf den Wehrturm der Johanniterschanze. Mit schepperndem Schwertgehänge hatte Gerolt sich in den Schutz der Mauer geworfen und war dabei schmerzhaft mit dem Helm aufgeschlagen. Doch seine geistesgegenwärtige Reaktion rettete ihm zweifellos das Leben.
Der scharfkantige Felsbrocken zertrümmerte die in Flammen stehende Galerie auf der gesamten Westseite des Wehrturms. Er machte aus den dicken Stützbalken, die schräg aus dem Mauerwerk aufragten, sowie aus den Laufplanken und der Brüstung Kleinholz, als handelte es sich bei den Hölzern um Kienspäne, die auch eine Kinderhand schon zu brechen weiß. Begleitet von einem Hagel aus Mauersteinen, die das Geschoss aus der Turmwand herausgebrochen hatte, flogen die brennenden Trümmer funkenstiebend durch die Nacht. Die unglücklichen Bogenschützen, die beim Einschlag des Felsens auf der umlaufenden Galerie gestanden und darauf gewartet hatten, an die Brüstung zu treten und ihre Pfeile auf die Mamelucken an den vorgeschobenen Katapulten abzuschießen, wurden durch die Luft geschleudert wie kleine Tonfiguren, die ein brutaler Fausthieb von einer Tischplatte fegte. Viele waren auf der Stelle tot, andere stürzten mit zerschmetterten Gliedern auf den Wehrgang oder hinter der Mauer in die Tiefe. Ihre Todesschreie gingen im Bersten der Hölzer unter.
Gerolt und Maurice, der ebenfalls beim unheilvollen Klang des Wurfarms augenblicklich in den Schutz der Mauer gehechtet war, kauerten sich zusammen und bargen den Kopf in den Armen, als der weit streuende Geschosshagel aus Holz- und Gesteinstrümmern auf den Wehrgang niederprasselte. Sie mussten mehrere schmerzhafte Schläge einstecken, aber nennenswerte Verletzungen trugen sie nicht davon. Helm und Kettenhemd bewahrten sie gottlob davor.
Als der Trümmerhagel aufgehört hatte, sie hastig wieder auf die Beine kamen und sich von brennenden und schwelenden Holzteilen befreiten, sahen sie zu ihrer Bestürzung, dass Wilhelm der Narbige weniger Glück gehabt hatte. Ihr Ordensbruder war in einer unnatürlich verdrehten Haltung über der Mauerbrüstung zusammengesackt. Und schon ein Blick auf ihn genügte, um zu wissen, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Das armlange Stück eines gesplitterten Stützbalkens, das halb in Flammen stand, hatte ihn über dem rechten Ohr getroffen. Wie eine primitive Lanze hatte das gesplitterte Ende seinen Schädel so leicht durchschlagen, als wäre es auf eine reife Melone getroffen, und ihn auf der Stelle getötet. Helm und wattierte Kappe lagen zu seinen Füßen.
»Elender Dummkopf!« Maurice versetzte der Beckenhaube des Toten einen wütenden Fußtritt, auf dass sie einige Schritte weit über den mit Trümmern übersäten Wehrgang schepperte. Die Schreie der Sterbenden und Verwundeten vor der Mauer wie auf dem Schanzwerk vermischten sich mit den knappen, harschen Befehlen der Kommandeure beider Orden, die in das Chaos auf diesem Mauerabschnitt wieder Ordnung zu bringen versuchten.
Gerolt schüttelte verständnislos den Kopf. »Warum musste er bloß mitten im Beschuss den Helm abnehmen? Eine kleine Beule im Stahl über dem Ohr und ein bisschen Brummen im Schädel, mehr hätte er nicht abbekommen!«
»Er hat die Gefechtsdisziplin missachtet! Das ist fast Verrat an seinem Templerschwur! Hier in Akkon wird jeder Ritter gebraucht – und zwar als Kämpfer gegen die Ungläubigen und nicht als leichtfertiger Dummkopf, der sich von einem lächerlichen Stück Holz in den Tod schicken lässt!«, stieß der Franke hervor. »Hätte er vorher im Kampf zwanzig Mamelucken in den Tod geschickt, hätte er seine Aufgabe wenigstens halbwegs erfüllt. Aber so hat er sich und dem Orden nur Schande gemacht!«
»Na, wenn ich mir sein narbenreiches Gesicht ansehe, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass er als Tempelritter große Tapferkeit bewiesen und sein Schwert in das Blut so manchen Feindes getaucht hat«, erwiderte Gerolt nachsichtig. »Ich jedenfalls möchte mir über einen Mann, dessen Leben ich nicht kenne, kein vorschnelles Urteil anmaßen.«
Maurice warf ihm einen anerkennenden Blick zu und zog die fein geschwungenen Augenbrauen hoch. »Nicht schlecht! Das ist wahrlich wie ein Templer gesprochen! Du weißt deine Worte wohl zu setzen. Ich sollte mir dich zum Vorbild nehmen, Bruder in Christo, sagt man mir doch nach, es mangele mir an dem gebotenen Respekt für meine Ordensbrüder.« Ein spöttischer Unterton schwang in seiner Stimme mit. »Würdest du mir auch verraten, mit wem ich das Vergnügen und die Ehre habe?«
»Gerolt von Weißenfels.« Der Franke beugte leicht den Kopf und revanchierte sich dann, indem nun er seinen Namen nannte: »Maurice von Montfontaine.« Er machte eine kleine Pause, um dann nicht ohne eine Spur von Überheblichkeit hinzuzufügen: »Aus dem alten Geschlecht derer von Coutances, aus dem unter anderem der Erzbischof von Rouen, Gautier von Coutances, hervorgegangen ist. Und von welcher Art sind deine ritterlichen Wurzeln, Gerolt von Weißenfels?«
Gerolt starrte ihn an und dachte mit einem Anflug von Bitterkeit an die schäbige kleine Burg nordwestlich von Trier im Eifeler Land, die sein Vater auf einem seiner wüsten Raubzüge als landloser Ritter seinem damaligen Besitzer nach kurzem Kampf abgenommen hatte. Der primitive Bergfried mit den hölzernen Befestigungsanlagen hätte damals der Grundstein für eine standesgemäße Burg sein können. Aber nichts von dem, was sein trinkfester und rauflustiger Vater in den Jahrzehnten nach seinem Handstreich in Angriff genommen hatte, war von Erfolg gekrönt gewesen. Alle großartigen Vorhaben waren über die ersten Anfänge nicht hinausgekommen. Zudem fehlten ihm auch die Weitsicht und das diplomatische Geschick, die richtigen Verbindungen zu pflegen und nützliche Allianzen mit den wahrhaft Mächtigen zu schmieden, um für treue Gefolgsdienste mit einem Lehen bedacht zu werden, das sich sehen lassen konnte.
»Wir sind hier nicht am königlichen Hof, wo es darum geht, zu blenden und den anderen auszustechen, Maurice von Montfontaine!«, antwortete Gerolt kühl. Es kostete ihn einige Anstrengung, sich seinen Groll darüber, dass der Franke ihn an seine äußerst bescheidene Herkunft als drittgeborener Sohn eines grobschlächtigen Raubritters erinnert hatte, nicht allzu sehr anmerken zu lassen. »Seit ich bei meiner Aufnahme in den Orden Armut, Keuschheit und Gehorsam geschworen habe, zählt die Vergangenheit nicht mehr, wie du eigentlich wissen solltest. Was zählt, ist allein das Gelübde – und meine Ehre als Templer!«
Damit wandte er ihm abrupt den Rücken zu, um dem arroganten Franzosen erst gar keine Gelegenheit zu einer Erwiderung zu geben. Er winkte einen anderen Tempelbruder heran, um mit ihm zusammen den Leichnam des Narbigen vom Wehrgang und hinunter zur Sammelstelle zwischen den beiden Wällen zu tragen, zwischen denen ein gut vierzig Schritte breiter Korridor ebenen Geländes lag. Und während sie ihrer düsteren Aufgabe in dem allgemeinen Tumult ohne viele Worte nachgingen, schwor sich Gerolt, in Zukunft möglichst einen Bogen um diesen überheblichen Maurice von Montfontaine zu machen!
2
Als Gerolt wenig später die Rampe hochstieg, die ihn zurück auf den Wehrgang am St.-Antons-Tor brachte, hatte er den Eindruck, als hätte der Feind seinen wütenden Beschuss der Johanniterschanze nochmals an Heftigkeit gesteigert. Dem Geräusch der gegen die Wälle krachenden Geschosse nach setzten sie jetzt noch mehr kleinere Katapulte und Schleudern ein. Das irritierte ihn, weil es zu diesem Zeitpunkt der Belagerung doch überhaupt keinen Sinn ergab. Wegen ihrer geringen Reichweite mussten diese Wurfmaschinen nahe an die Mauern herangefahren werden, und das bedeutete, dass sich die Bedienungsmannschaften den Brandpfeilen und Geschossen der Verteidiger von Akkon aussetzen mussten. Für den Einsatz der kleineren Geräte war es noch etliche Tage, wenn nicht gar Wochen zu früh. Die mit vielen wehrhaften Türmen gespickten Festungsmauern, wie sie Akkon gleich zweifach umgaben, vermochten so manchen schweren Treffer wegzustecken, ohne dass sich den Belagerern die Chance zum schnellen Brescheschlagen bot. Und eine solche war nötig, um die Sturmtruppen zum Einsatz bringen zu können. Warum also gebärdete sich Sultan el-Ashraf Khalil so unvernünftig wütig? Warum wartete er mit solch einem heftigen Beschuss nicht, bis die hohen Belagerungstürme einsatzbereit waren, mit deren Bau die Muslime schon am Tag ihrer Belagerung begonnen hatten? Holz stand ihnen ja mehr als genug zur Verfügung. Am Tell el-Fukar, wo jenseits des alten Friedhofs St. Nicholas die Ruinen eines Turms und einer Kirche stumme Zeugen der misslungenen muslimischen Belagerung von 1265 waren, und jenseits der Anhöhen gab es reichlich Bäume. An manchen Stellen standen sie sogar so dicht, dass man schon von einem Wald sprechen konnte.
Als Gerolt wieder auf die Mauerkrone gelangte, blieb er kurz stehen und sein Blick folgte dem breiten Wehrgang nach Westen, wo der gut fünfhundert Schritt lange Mauerabschnitt sich bis ans Meer erstreckte, dessen Bewachung und Verteidigung den Rittern vom Templerorden oblag. Dort harrten jetzt nur noch einige wenige Ordensbrüder aus, war doch fast die ganze Wachabteilung zur Unterstützung der Johanniter abgezogen und zu deren Schanze beordert worden. Beißende Rauchwolken, die von mehreren brennenden Gebäuden hinter dem zweiten Befestigungsring aufstiegen und von der Seebrise landeinwärts getrieben wurden, wehten wie schwarze Nebelbänke über den Wehrgang.
Unwillkürlich wandte Gerolt den Kopf etwas ab. Dabei wanderte sein Blick nun auf das freie Feld hinaus, das sich zwischen der Festungsmauer und dem gut zwei Meilen entfernt liegenden Heerlager der Sarazenen aus Damaskus und Hamah erstreckte, und blieb sogleich an dem verlassenen, hölzernen Belagerungsturm hängen. Wie eine plumpe, rechteckige Stele ragte der hölzerne Turm mit seiner breiten, hochgeklappten Fallbrücke im oberen Drittel der Konstruktion in die Nacht. Wie die Belagerungstürme vor dem Lager der Mamelucken, so war auch dieser hier noch nicht einsatzbereit, existierte von seinem Dach doch erst das Grundgerüst. Dieses musste noch mit Brettern vernagelt und vermutlich mit einem Schutz, etwa dünnen Blechplatten, versehen werden. Zudem fehlte auch noch an der Vorderfront und an den Seiten die notwendige Verkleidung aus großen Ochsen- und Kamelhäuten. Diese Bespannung wurde dann kurz vor einem Angriff reichlich mit Wasser übergossen, damit Brandpfeile den Turm nicht schon in Brand setzten, bevor er die Festungsmauer erreicht hatte und seine Fallbrücke auf die Zinnen herabfallen lassen konnte. Aber auch wenn der Belagerungsturm irgendwann fertiggestellt und mit Häuten verhängt war, würde er so schnell noch nicht zum Einsatz kommen. Denn der Graben vor der Festungsmauer war viel zu breit, als dass die Fallbrücke diese Distanz auch nur halbwegs hätte überwinden können. Die Muslime würden erst einmal versuchen, den Graben an mehreren Stellen mit Steinen und Sand aufzufüllen. Und das war eine langwierige Angelegenheit, die die Feinde viel Blut kosten würde, auch wenn sie sich noch so raffinierte Schutzmaßnahmen ausdachten. Von den Wällen würde ein dichter Hagel von Pfeilen auf sie niedergehen und in den Pausen dazwischen würden sie es mit siedendem Pech und griechischem Feuer zu tun bekommen.
Schon wollte Gerolt es bei den wenigen flüchtigen Blicken belassen und seine ganze Aufmerksamkeit wieder auf das Geschehen am Wallabschnitt zu seiner Rechten lenken, als ihn etwas stutzen und genauer hinsehen ließ. Ihm war plötzlich, als stände der Turm viel näher, als er ihn in Erinnerung gehabt hatte! Sein Verstand sagte ihm, dass das unmöglich der Fall sein konnte. Seit Einbruch der Dunkelheit herrschte auf diesem nordwestlichen Wallabschnitt völlige Ruhe. Die muslimischen Handwerker, die außerhalb der Reichweite der christlichen Bogenschützen am Turm gearbeitet hatten, waren beim letzten Tageslicht wie gewohnt ins Zeltlager zurückgekehrt. Und auch dort wies nichts auf irgendeine ungewöhnliche Tätigkeit des Feindes hin. Nur wenige Fackeln und Lagerfeuer brannten zwischen den zahllosen Zeltreihen.
Gerolt furchte die Stirn. Eigentlich seltsam, dass es dort so ruhig zuging. Und dann fiel ihm noch eine weitere Merkwürdigkeit auf, nämlich dass schon seit Tagen keine rechten Fortschritte mehr festzustellen waren. Zumindest keine sichtlichen. Warum eigentlich nicht? Im nächsten Moment hatte er den verrückten Eindruck, als bewegte sich der Belagerungsturm ganz langsam auf die Festungsmauer zu. Angestrengt und mit plötzlich jagendem Herzen, starrte er in die Dunkelheit. Spielten ihm seine Augen einen bösen Streich? War es die Müdigkeit einer zermürbend langen Nachtwache, die ihn etwas sehen ließ, was nur in seiner Einbildung stattfand? Es musste an den wabernden Rauchfahnen der nahen Brände liegen, die von der auffrischenden Seebrise verwirbelt wurden und ihm den Blick trübten. Oder täuschte er sich doch nicht?
Da! Der Turm ruckte! Er bewegte sich tatsächlich! Gerolt sah es jetzt ganz deutlich. Das klobige, hölzerne Ungetüm glitt wie auf unsichtbaren Schienen und wie von Geisterhand geführt auf die Templerschanze zu! Zwar bewegte es sich nur langsam von der Stelle, sodass man es bei flüchtiger Beobachtung kaum wahrnehmen konnte, aber es rückte doch stetig weiter vor! Und dann machte Gerolt noch eine zweite verstörende Entdeckung. Er bemerkte rätselhafte, unregelmäßige … ja, irgendwie wellenartige Bewegungen, die genau hinter dem Belagerungsturm durch das freie, sandige Feld gingen und sich irgendwo oberhalb bei den Buschdickichten und ersten Zelten der Wachen verloren! Es war, als hätte sich ein schmaler, nicht mehr als zwei, drei Schritte breiter Streifen des steinigen Feldes zwischen dem Belagerungsturm und dem Heerlager in eine unregelmäßige Dünung aus Sand verwandelt! Aber seit wann bewegte sich der Erdboden?
Gerolt spürte, wie ihm eine Gänsehaut über Arme und Rücken lief, als er plötzlich begriff, was er dort sah und wie das eine mit dem anderen in Zusammenhang stand: Die Muslime mussten heimlich dicht unter der Oberfläche einen Tunnel zum Belagerungsturm ausgehoben haben! Einen vermutlich nicht sehr tiefen Graben, der wegen der gebotenen Eile nach oben hin wohl auch nur notdürftig mit aufgespannten Fellen und Reisigbündeln vor dem Einbrechen geschützt war. Die Krieger unter dem Banner des Halbmonds waren ob ihrer einfallsreichen, raffinierten Belagerungskünste bekannt und gefürchtet. Sie verstanden sich wohl wie kein anderes Kriegsvolk darauf, durch den Bau von unterirdischen Tunneln Mauern und Türme zu untergraben und zum Einsturz zu bringen. Und wie es hieß, standen Sultan el-Ashraf Khalil für jeden Turm, den Akkons äußerer Verteidigungswall aufweisen konnte, tausend geübte Pioniere zum Untergraben zur Verfügung. Eine Zahl, die maßlos übertrieben sein mochte, jedoch nichts an der Gefahr änderte, die den Eingeschlossenen allein von dieser Seite her drohte.
Die stetige Vorwärtsbewegung des Belagerungsturmes bedeutete jedenfalls, dass sich in seinem Schutz längst schon viele Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Kriegern eingefunden haben mussten – und dass es im Innern des Turms große Räder mit Haltegriffen geben musste, an denen sich die Ungläubigen nun mit lautloser Verbissenheit ins Zeug legten.
Wie ein Blitz traf Gerolt die Erkenntnis, dass der wütende und zum Teil so unsinnige Beschuss der nordöstlichen Befestigungsanlagen von Akkon nichts weiter als ein geschicktes, lärmendes Ablenkungsmanöver war. Alle Aufmerksamkeit sollte sich dorthin richten und damit weg von dem scheinbar noch gar nicht einsatzbereiten Belagerungsturm und dem vor ihm liegenden Mauerabschnitt. Und die Tatsache, dass sich das Mameluckenheer auch nicht zum Kampf aufgestellt hatte, sollte die Eingeschlossenen in trügerischer Sicherheit wiegen und sie davon abhalten, ihre Wachmannschaften auf den Wällen beträchtlich zu verstärken. Alles sollte so aussehen, als gäbe es außer dem wütenden Beschuss nichts weiter zu befürchten. In Wirklichkeit aber hatte der Sultan einen tückischen Plan ausgeheckt, hatte er sich doch für einen überraschenden Sturmangriff auf die Templerschanze entschlossen! Und zwar gerade, weil alle einen Angriff an dieser Stelle wegen des legendären Rufes, den die Tempelritter als überragende Krieger bei den Ungläubigen genossen, für am unwahrscheinlichsten hielten!
Zwar wusste Gerolt nicht, wie die Feinde mit dem hohen, klobigen Turm den breiten Festungsgraben überwinden wollten. Aber er zweifelte nicht daran, dass sie irgendeine Möglichkeit gefunden hatten, auch dieses letzte Hindernis zu überwinden. Gelang den Moslemkriegern der überraschende Sturmangriff und brachen sie an diesem Wall so nahe am St.-Lazarus-Tor durch, bedeutete das zwangsläufig den Fall von ganz Akkon!
3
Mit wehendem Umhang und die linke Hand fest auf sein Schwert gepresst, um von der hin und her schwingenden Waffe nicht zum Fallen gebracht zu werden, rannte Gerolt los. Und schon im Laufen rief er den Alarm aus.
»Angriff auf die Templerschanze! … Alle sofort zurück zur Templerschanze! … Die Sarazenen greifen mit dem Belagerungsturm an! … Alle Templer sofort zurück! … Und trommelt die Turkopolen und Sergeanten zusammen! Jeder Mann wird gebraucht!«, brüllte er, so laut er konnte, während seine Augen Hauptmann Raoul von Liancourt suchten, der die Abteilung der Nachtwache kommandierte.
Auf der Johanniterschanze, wo noch immer ein Chaos aus rauchenden und schwelenden Trümmern herrschte, fuhren die ersten seiner Ordensbrüder zu ihm herum, als sie sein Gebrüll hörten. Auf ihren Gesichtern zeigte sich jedoch mehr Verständnislosigkeit als Erschrecken. Manche warfen ihm sogar missbilligende Blicke zu, wohl weil sie seinen Alarm für einen schlechten Scherz hielten.
Gerolt kümmerte sich nicht darum. Er wusste, was er beobachtet hatte, und er brüllte, was seine Lungen hergaben. Kameraden, die er mit Namen kannte, sprach er im Vorbeilaufen direkt an. »Raimund! Bertram! Martin! Lutger! … Helft mir! … Schlagt auch ihr Alarm! Einer muss zur Stadtburg hinüber, dort Alarm schlagen und Verstärkung holen! … Sie kommen mit dem Turm! … In wenigen Minuten stehen sie vor unserer Mauer! Ich schwöre es beim Allmächtigen und der Gottesmutter!«
Die Ersten setzten sich zögernd in Bewegung. Und dann tauchte Hauptmann Raoul von Liancourt vor ihm auf, der vom Alter her fast sein Vater hätte sein können. Der breitschultrige Templer stammte aus dem Küstenland der Normandie und das kantige Gesicht sowie der krause rotbraune Bart verrieten das Normannenblut seiner Ahnen, das in seinen Adern floss.
»Was hat es mit deinem Alarm auf sich?«, fragte er knapp und mit sichtlicher Anspannung. Raoul von Liancourt war kein Mann unnützer Worte.
»Der heftige Beschuss der Johanniterschanze ist nur ein Ablenkungsmanöver!«, stieß Gerolt hastig hervor. »In Wirklichkeit wollen sie mit dem Belagerungsturm einen Überraschungsangriff auf unseren Mauerabschnitt wagen! Ich habe gesehen, wie er sich bewegt hat!«
Ungläubig starrte ihn der kampferfahrene Templerhauptmann an. Aber er kannte Gerolt von Weißenfels zu gut, um dessen Beobachtung einfach als Hirngespinst abzutun. »Woher willst du das wissen?«
»Sie müssen einen Tunnel gegraben haben, durch den sie den Turm bemannen und bewaffnen konnten! Dass er scheinbar noch gar nicht einsatzbereit ist, gehört zu ihrer Täuschung! Der Turm bewegt sich jedenfalls beständig auf die Mauer zu! Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich weiß bei Gott, meinem Herrn und Erlöser, dass ich mich nicht getäuscht habe!«, sprudelte es aus Gerolt hervor. »Wir haben nicht mehr viel Zeit! Seht doch selbst, wie nahe er schon ist!«
Raoul von Liancourt wandte den Kopf, schirmte sein Blickfeld rechts und links mit den Händen ab, um nicht vom unruhigen Schein der Fackeln und brennenden Trümmer irritiert zu werden, und spähte in die Dunkelheit hinaus.
»Heiliger Peter und Paul, du hast recht! Der Turm ist tatsächlich vorgerückt!«, stieß er schon im nächsten Moment erschrocken hervor und schlug dann mit der geballten Faust auf die Zinne. »Diese Mamelucken versuchen, sich anzuschleichen wie feige Diebe in der Nacht! Und wir wären um ein Haar darauf hereingefallen!«
Abrupt wandte sich der Templerhauptmann um und gab nun selbst Alarm. Mit lauter, durchdringender Stimme erteilte er in schneller Folge eine Reihe von Befehlen, die der Sicherung und Verteidigung des eigenen Mauerabschnitts galten. Die Tempelritter, gut fünfzig an der Zahl, stürzten mit rasselnden Kettenhemden und scheppernden Schwertgehängen über den Wehrgang zurück zu ihren angestammten Verteidigungsposten. Einer von Raouls Unterführern eilte mit einer Gruppe von braun gekleideten und nur leicht bewaffneten Sergeanten die nächste Rampe hinunter. Sein Auftrag lautete, so schnell wie möglich zwei, drei kleine Katapulte auf die Templerschanze zu schaffen, um den Belagerungsturm mit Feuertöpfen zu beschießen und möglichst schon in Brand zu setzen, noch bevor er den Festungsgraben erreichen konnte.
Bei den Sergeanten handelte es sich um Männer, die zwar zum Orden gehörten und tapfere Kämpfer waren, aber wegen ihrer niederen Abstammung nicht zum Ritter geschlagen werden konnten. Denn nur Mitglieder aus ritterbürtigen Familien konnten Ordensritter werden und die begehrte weiße Clamys mit dem roten Tatzenkreuz tragen. Gerolt hatte Zweifel, dass es den Sergeanten gelang, noch rechtzeitig genug Katapulte mit extrem flacher Flugbahn auf den Wall zu bringen und mit dem Beschuss zu beginnen, bevor sich die Fallbrücke in Reichweite der Zinnen befand und auf sie niedersausen konnte. Er gab den Brandpfeilen der Bogenschützen, um die sich ein anderer Unterführer zu kümmern hatte, bessere Chancen. Aber so, wie er die Lage einschätzte, würde letztlich der Kampf Mann gegen Mann mit blankem Stahl darüber entscheiden, ob der Überraschungsangriff der Muslime Erfolg hatte oder scheiterte.
»Ein großes Lob deiner Wachsamkeit und scharfen Beobachtungsgabe, Gerolt von Weißenfels!«, sagte Hauptmann Raoul von Liancourt noch, bevor auch er in den Laufschritt fiel. »Damit hast du vermutlich gerade noch im letzten Moment drohendes Unheil von Akkon abgewendet. Und jetzt sieh zu, dass du auf deinen Posten kommst! Zeigen wir ihnen, was es heißt, gegen Templer zu kämpfen!«
»Worauf Ihr Euch verlassen könnt, Beau Sire!«, erwiderte Gerolt entschlossen und benutzte dabei die Anrede, die einem Truppenführer, einem Komtur10 oder einem anderen hochrangigen Templer gebührte.
Der Waffenlärm und das Geschrei der in Alarm versetzten Ritter, die sich beeilten, die Zinnen auf der Templermauer zu besetzen und sich für den bevorstehenden Kampf zu rüsten, drangen natürlich auch auf das Vorfeld hinaus und zu den Feinden im Turm. Als diese nun erkannten, dass man ihre List durchschaut hatte und dass die Zeit nun gegen sie arbeitete, da quollen plötzlich hinten aus dem Turm Dutzende Krieger, die zu den hohen Außenrädern rannten und sich in die Speichen stemmten, damit der Turm nun so schnell wie möglich das letzte Stück freien Feldes vor dem Graben überwand. Nur einen Augenblick später hob sich die Erde hinter dem Belagerungsturm. Begleitet von martialischem Geschrei, wurde sie zusammen mit Fellen, Brettern und Reisigbündeln zur Seite geschleudert, sodass ein brusttiefer Tunnelgang zum Vorschein kam, in dem sich die muslimischen Krieger dicht hintereinander gedrängt hatten. Aus der Entfernung sah es so aus, als hätte sich ein fetter Riesenwurm nur zwei, drei Handbreit unter der Oberfläche schnurgerade durch das Erdreich gewühlt und sich nun mit einem Schlag erhoben, um die dünne Schicht Sand und Steine von seinem endlos langen Rücken abzuwerfen.
Dieses Aufbrechen der Erde geschah in raschen, aber teilweise abrupten Wellenbewegungen, als bockte der Leib des Riesenwurmes an manchen Stellen besonders heftig. Nachdem nun auch die mächtigen Außenräder von kräftigen Sarazenen vorwärtsgetrieben wurden, nahm der schwere Belagerungsturm sichtlich Fahrt auf und rollte mit erschreckender Schnelligkeit auf den Festungsgraben zu. Aus dem nun offenen Tunnelgang quollen immer mehr Krieger hervor. Dutzende von ihnen schleppten mannshohe Leitern, die sie in Windeseile links und rechts vom Turm zu langen Sturmleitern zusammensteckten, um mit geradezu selbstmörderischem Mut den Graben zu überwinden und den Angriff ihrer Kameraden auf dem Turm zu unterstützen. Jede Gruppe wusste genau, wo sie sich aufzustellen und was sie zu tun hatte, um keine kostbare Zeit zu verlieren.
Gleichzeitig erwachte im Norden fast schlagartig das Lager, dessen Ruhe so trügerisch gewesen war wie der scheinbar noch nicht einsatzfähige Belagerungsturm. Ein Meer von Fackeln flammte auf, in dessen Licht jetzt hastig sandfarbene Planen von Katapulten gezerrt und Pferde vor die Lafetten gespannt wurden, um die Wurfmaschinen im Handumdrehen vor der Templerschanze in Stellung bringen zu können. Indessen zeigte sich im offenen Dachgebälk des heranrumpelnden Belagerungsturms schon eine Gruppe von Bogenschützen, die ihre ersten Pfeile auf die wenigen verbliebenen Templerwachen auf dem Wehrgang abschossen.
Gerolt rannte unter Aufbietung aller Kräfte und im Strom seiner Ordensbrüder über den zinnengekrönten Wall nach Westen. Jetzt kam es auf jede Sekunde an, würde der Belagerungsturm doch in wenigen Minuten den Festungsgraben erreichen. Und nur Gott allein und die Ungläubigen wussten, was dann geschah!
Aber bis zu jener Stelle an der Templerschanze beim St.-Lazarus-Tor, der der überraschende Angriff der Sarazenen galt, mussten er und die meisten seiner Mitbrüder erst einmal eine Distanz von gut fünfhundert bis sechshundert Schritten im Laufschritt überwinden! Und er verfluchte jede Elle davon.
»Eine Gasse, Männer!«, brüllte hinter ihm Raoul von Liancourt, als von links eine Abteilung Bogenschützen über eine der zum Wehrgang hinaufführenden Rampen erschien und sich dem Pulk der Ritter anschloss. »Bildet eine Gasse, Männer! … Alle Schwertkämpfer ohne Schild nach links an die Innenmauer! … Lasst die Schildbewehrten vor! … Alle Schilde in gewöhnlicher Schlachtformation zu einer Mauer überlappen und mit eingelegter Lanze im Gleichschritt vorrücken! … Keiner bricht die Linie auf! … Versetzt hinter der ersten Reihe die Bogenschützen! Alle anderen schließen sich dahinter an!« Augenblicklich verwandelte sich der Strom hastender und unterschiedlich bewaffneter Krieger in eine streng geordnete Formation.
Nicht von ungefähr standen die Tempelritter in dem Ruf, auch in höchst kritischer, ja aussichtsloser Lage eine eiserne, todesverachtende Gefechtsdisziplin zu bewahren. Das harte, tägliche Training zahlte sich auch in dieser Situation aus. Zudem kamen sie in dieser klar geordneten Aufstellung auch schneller voran, weil keiner den anderen behinderte.
Dennoch gelangte der Belagerungsturm an den äußeren Rand des Festungsgrabens, bevor noch die Mehrheit der heraneilenden Tempelritter ihm gegenüber Position beziehen konnte. Sirrend flogen im Innern die Seile von den Trommeln der Winden und die Fallbrücke fiel so schnell herunter, dass der ganze Turm erbebte und für einen Moment gefährlich schwankte, als die Haltetaue sich jäh spannten und die nachwippende Brücke in der Waagerechten hielten. Aber die Brücke reichte noch nicht einmal halb über den Festungsgraben. Ein Pfeilhagel ging von der Turmspitze auf die heraneilenden Templer nieder. Mit einem dumpfen, nachsirrenden Geräusch bohrten sich die meisten in die ovalen Langschilde der Ritter in der ersten Reihe. Einige fanden jedoch auch ihr Ziel. Jemand schrie getroffen auf. Ein anderer stieß einen schmerzerfüllten Fluch aus. Ein Pfeil prallte auf der rechten Seite von Gerolts Helm ab. Doch die Formation kam nicht einen Herzschlag lang aus dem Tritt. Die eigenen Bogenschützen nahmen nun ihrerseits die Muslime auf dem Dach des Turms ins Visier und sogleich fielen dort die ersten Krieger.
Gerolt verfolgte im Laufen mit großer Verblüffung, wie sich nun aus dieser schweren, breiten Plattform eine zweite, viel schmalere Brücke vorschob – sogleich gefolgt von einer dritten, die noch um einiges schmaler und leichter konstruiert war als der zweite Teil der Fallbrücke. Und dieser dritte Steg, der nur aus zwei Rundhölzern mit Querleisten bestand, zwischen denen eine leichte Matte aus geflochtenen Baststreifen gespannt war, reichte genau bis auf die Zinnen des Wehrgangs!
Kaum hatte das letzte Ende der dreiteiligen, ausschiebbaren Fallbrücke auf dem Mauerkranz aufgelegt, als die Angreifer auch schon aus dem Turm hervordrängten, die Fallbrücke bevölkerten und sich todesmutig hinaus auf den wackligen Mattensteg wagten. Die wenigsten trugen Helme. Turbane in allen Farben bis auf Weiß, das nur den Emiren zustand, bedeckten zumeist die Köpfe der Angreifer. In der einen Hand Schwert, Wurfspieß oder Streitaxt schwingend, mit der anderen Hand den Rundschild fest gefasst, stürmten sie vorwärts. Und dabei brüllten sie aus voller Kehle: »Allahu akbar! … Gott ist groß!« sowie »La ilaha illa ’llah! … Es gibt keinen Gott außer Gott!« Sie stießen sich in fanatischem Eifer fast gegenseitig von der Fallbrücke. Jeder wollte der Erste sein, der seinen Fuß auf die Festungsmauer setzte und damit Anspruch auf die zweifellos dafür ausgelobte Belohnung erheben konnte – sofern er den Kampf überlebte. Aber an flammendem Mut und der Bereitschaft, für ihren Gott und seinen Propheten zu sterben und dafür im Paradies reich belohnt zu werden, mangelte es ihnen ebenso wenig wie ihren Feinden, den verhassten Kreuzrittern.
Gut zwei Dutzend Krieger hatten es schon auf die Templerschanze geschafft und gerade tauchte über der Mauer auch schon der Kopf des ersten Sarazenen auf, der an der Festungsmauer auf einer der Sturmleitern hochgeklettert war, als die Ritter endlich heran waren und mit ganzer Stärke zum Gegenangriff übergehen konnten.
Nun erschallte der donnernde Schlachtruf der Templer, der seit fast zwei Jahrhunderten jeden Angriff der Kriegermönche begleitete und der ihren Feinden noch jedes Mal durch Mark und Bein gegangen war: »Beauséant alla riscossa!11«
Der auf beiden Seiten mit unbarmherziger Härte und Grausamkeit geführte Kampf Mann gegen Mann begann. Jede Seite wusste, dass schon die nächsten Minuten die Entscheidung über Gelingen oder Scheitern dieses Überraschungsangriffs brachten – und damit über das Schicksal von ganz Akkon. Gelang es der ersten Welle der arabischen Krieger, dem wütenden Ansturm der Ritter und ihrer Hilfstruppen lange genug standzuhalten und auf dem Wall Fuß zu fassen, damit weitere Krieger über die Fallbrücke und die Sturmleitern zu ihnen auf den Wehrgang fluten konnten, dann war der Dammbruch kaum noch aufzuhalten. Vermochten dagegen die Templer die Muslime gleich in den ersten Minuten an die Mauer zurückzudrängen und jegliche Verstärkung über die Fallbrücke zu verhindern, dann wurde der Belagerungsturm für alle, die sich darin oder auf der Fallbrücke befanden, zu einer tödlichen Falle. Denn schon flogen die ersten Brandpfeile. Sie spickten das hölzerne Ungetüm und setzten mehr Brände, als die Feinde zu löschen vermochten. Die Ritter wussten nur zu gut, was für sie und die Stadt auf dem Spiel stand. Und so warfen sie sich mit Todesmut und unbändigem Kampfeswillen den Muslimen entgegen.
Von drei Seiten schlossen sie ihre Feinde ein, um sie in ihrer Bewegungsfreiheit auf dem Wehrgang einzuschränken und ein zügiges Nachrücken der Krieger auf dem Turm unmöglich zu machen. Während die Bogenschützen sich nach hinten zurückzogen, auf die Zinnen sprangen und von dort ihre Pfeile auf die über die Fallbrücke nachdrängenden Sarazenen abschossen, übernahmen die Schwert- und Lanzenkämpfer die vordersten Reihen. Die Luft war erfüllt von einem wilden, barbarischen Gebrüll, in das sich das Splittern von Schilden und Lanzen, Flüche, gellende Schmerzensschreie, das Sirren der Pfeile, die dumpfen Aufschläge niederstürzender Körper, ersticktes Röcheln und das unablässige Klirren von scharf geschliffenem Stahl auf Stahl mischten.
Gerolt geriet schnell inmitten des vorderen Kampfgetümmels. Sein Herz jagte, laut rauschte das Blut in seinen Ohren und jede Faser seines Körpers befand sich in höchster Anspannung, aber sein Schwert führte er mit kühlem Kopf. Er wusste aus Erfahrung, dass man in solch einem Nahkampf keine zweite Chance erhielt, wenn man einen Gegner falsch einschätzte und einen Fehler machte.
»Such die Augen deines Feindes, halte sie fest und lies in ihnen! Dann wirst du wissen, was er vorhat und wie er seine Waffe führen wird!«, hatte ihm sein Vater schon von Kindesbeinen an eingeschärft. »Aber lerne auch, gleichzeitig das Geschehen zu deiner Rechten und Linken im Auge zu behalten! Oft genug ist es nicht das Schwert des Gegenübers, das den Tod bringt, sondern die Lanze oder die Streitaxt des Feindes an den Flanken! Und das Geheimnis des Sieges liegt weder in der Kraft noch in der Geschicklichkeit. Diese beide sind nur die folgsamen Knechte ihres Meisters – und der trägt den Namen kühler Verstand! Nur ein Dummkopf lässt sich im Kampf von Zorn oder Hass leiten. Und Dummköpfe, die zum Schwert greifen, leben nicht sehr lange!«
Diese und andere Lehren sowie die Kunst, ein Schwert meisterhaft zu führen, waren das Beste, aber eigentlich auch das Einzige, was er von seinem Vater mitbekommen hatte und wofür er ihm dankbar sein konnte. Ob das auch die vielen brutalen Schläge aufwog, die er so oft von ihm bezogen hatte, sowie die schmerzliche Gleichgültigkeit an seiner Person und seiner Zukunft, darüber war er noch zu keinem abschließenden Urteil gelangt. Vielleicht wäre vieles ganz anders gekommen, wenn die Mutter nicht schon so früh gestorben wäre.
Gerolt trieb die Araber auf seiner Seite mit einem Hagel kurzer, aber wuchtiger Schläge beständig zur Fallbrücke zurück. Und so mancher fiel unter seiner Klinge. Aus den Augenwinkeln registrierte er dabei, dass inzwischen fast jeder Sarazene, der auf einer der schmalen Sturmleitern an der Mauer hochgestiegen war und seinen Kopf über dem Zinnenkranz zeigte, sofort von Pfeilen oder von Schwerthieben getroffen wurde und in die Tiefe stürzte.
Der Ansturm der Muslime kam langsam zum Halten. Kaum einem gelang es noch, lebend über die Fallbrücke zu kommen und seinen Kameraden auf dem Wehrgang beizustehen. Die Bogenschützen machten aus der schwankenden, schutzlosen Plattform über dem Festungsgraben einen Ort des sicheren Todes. Aber noch war der Kampf nicht entschieden, dafür kämpften noch immer zu viele muslimische Soldaten zu erbittert auf der Templerschanze um die Oberhand.
Wenig später parierte Gerolt den Hieb eines Angreifers nach seinem Kopf. Die Wucht des Schlages ging durch seinen Arm bis in die Schulter hinauf. Doch während ein anderer, weniger durchtrainierter Kämpfer jetzt vermutlich gewankt hätte und einen Schritt zurückgewichen wäre, um sich für den nächsten Schlagaustausch zu wappnen, riss er sein Schwert blitzschnell zurück – und stieß zu, bevor der Mann wusste, wie ihm geschah. Der Sarazene stürzte tödlich getroffen zu Boden. Ein Pfeil von einem der letzten noch lebenden Bogenschützen im Turmgebälk sirrte wie eine zornige Hornisse gefährlich nahe an seinem schweißüberströmten Gesicht vorbei, während er mit einem schnellen Sprung über den Sarazenen hinwegsetzte und einem seiner Ordensbrüder zu Hilfe kam. Links vor ihm war ein Turkopole von einer muslimischen Streitaxt gefällt worden und in dem wüsten Gemenge einem Tempelritter vor die Füße gestürzt. Dieser erwehrte sich gerade zweier Gegner, die ihn in die Zange genommen hatten.
Gerolt sah, wie sein Ordensbruder stolperte und rücklings in den blutgetränkten Dreck des Wehrgangs fiel. Sein Kettenhemd unter der Clamys flog hoch und entblößte einen Gutteil seines nun ungeschützten Unterleibs. Und Gerolt sah auch die zum Todesstoß erhobene Lanze in der Hand des einen Angreifers. Er sprang mit einem gellenden Schrei auf den Mann zu. Sein Schwert schnitt durch die Luft, gerade als der Sarazene dem am Boden liegenden Templer den Wurfspieß in den Unterleib rammen wollte, und trennte die keilförmige Eisenspitze mitsamt einem unterarmlangen Stück Schaft vom Rest der Lanze. Der Araber fuhr entsetzt herum, erhielt von Gerolt jedoch keine Gelegenheit mehr, um zum Schwert greifen zu können. Der Tod ereilte ihn schon im nächsten Moment. Und dem anderen Krieger, der mit dem Lanzenträger den Templer in die Zange genommen hatte, erging es nicht besser. Sein Krummsäbel wurde ihm aus der Hand gerissen, als Gerolt sein Schwert mit aller Kraft schwang und die Waffe seines Gegners kurz hinter der Parierstange traf. Und dann drang ihm auch schon der zweiseitig geschliffene Stahl in den Leib.