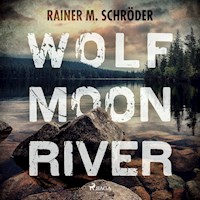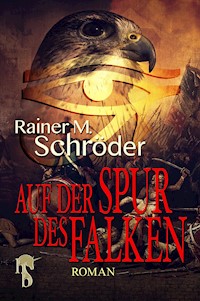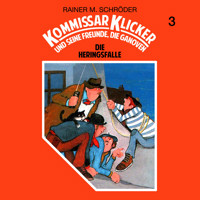4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Australien, 1809: Abby Lynn ist erwachsen geworden. Nachdem sie nur knapp der Deportation auf die berüchtigte Strafinsel Norfolk Island entgangen ist, muss sie mit ihrer kleinen Familie die Kolonie verlassen, da ihre Erzfeindin Cleo ihr auf die Spur gekommen ist und nur noch ein Ziel kennt: Abbys Leben endgültig zu zerstören. Abby und Andrew schließen sich mit ihrem Baby einem illegalen Siedlertreck an, der sich in der Wildnis Australiens eine neue Existenz aufbauen will. Verfolgt vom unbändigen Hass Cleos, den Soldaten um Lieutenant Danesfield und Buschbanditen kämpft sich die zusammengewürfelte Gruppe durch noch unerforschtes Land. Gefahr droht nicht nur durch Naturgewalten, sondern auch durch Streitigkeiten unter den Siedlern. Als sie hinter den Blue Mountains eine neue Heimat finden, sind die Verfolger nicht mehr weit und es kommt zum Kampf. Woher soll nun die Rettung kommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Abby Lynn
Verborgen im Niemandsland
Roman
Meiner treuen Leserschaft gewidmet,die auch nach dem BandAbby Lynn – Verraten und verfolgtkeine Ruhe gegeben und mich schließlich überzeugt hat, diesen vierten und endgültig letzten Abby-Lynn-Romanzu schreiben.
Erstes Buch
Treck ins NiemandslandApril – Mai 1809
Erstes Kapitel
Der Himmel über der berüchtigten australischen Sträflingskolonie New South Wales hatte die graue Farbe eines schmutzigen, verschlissenen Putzlappens und ein nasskalter, böiger Wind, der von der offenen See her über die britische Kolonie herfiel, setzte den Wellen in der keilförmigen Bucht von Sydney weiße Schaumkappen auf. Die Windböen wirbelten in den Straßen der Hafenstadt Sand und Abfälle auf und schleuderten diesen Dreck den Sträflingen, Soldaten und freien Siedlern in dichten, wirbelnden Wolken geradezu höhnisch ins Gesicht, wohin diese sich auf ihrem Weg auch wendeten.
Das hässliche Wetter war wie ein Spiegel von Cleo Pattersons aufgewühlter Stimmung, als sie sich an diesem ungemütlichen Morgen auf den Weg zur Garnison der verhassten Rotröcke, der Soldaten vom New South Wales Corps, machte. In der Frau des ersten Gefängniswärters loderten unversöhnlicher Hass und ohnmächtige Wut darüber, dass Abby sie im Kerker überlistet und sie um ihre Rache gebracht hatte. Das Baby, das Abby in der Zelle zur Welt gebracht hatte und das sie, Cleo, ihr hatte wegnehmen und später an ein Bordell verkaufen wollen, hatte dieses raffinierte Biest doch wahrhaftig unter ihren Augen in die Freiheit schmuggeln können! Wie hatte sie darüber vor Wut geschäumt! Nicht einmal im Suff war es ihr möglich gewesen, diese schmähliche Niederlage verwinden und vergessen zu können.
Aber damit nicht genug, war es ihrer Erzfeindin doch auch noch gelungen, vom Sträflingsschiff Phoenix zu entkommen1, das sie mit anderen Verbannten auf die tausend Seemeilen entfernte Insel Norfolk Island hatte bringen sollen. Eine von Gott verlassene Insel, die sogar die abgebrühtesten unter den Verbrechern als Hölle auf Erden fürchteten.
Auch jetzt, vier Tage nach der unglaublichen Begegnung mit Abby, erschien es ihr immer noch wie ein grässlicher Albtraum, dass diese Person in der Kutsche tatsächlich Abby gewesen war. Aber zum Teufel noch mal, sie war keiner Sinnestäuschung auf den Leim gegangen! Nicht den geringsten Zweifel hatte sie gehabt, dass es Abby und niemand sonst gewesen war. Der Teufel sollte alle holen, die ihr hämisch vorgeworfen hatten, mal wieder zu viel billigen Branntwein in sich hineingekippt zu haben und Gespenster zu sehen. Und Pest und Krätze insbesondere über den verfluchten jungen Soldaten, der sich von Abby und ihrem Mann, dem freien Siedler Andrew Chandler, so plump hatte täuschen lassen, statt ihre Flucht zu vereiteln und sie auf der Stelle zu verhaften!
»Aber wenn du glaubst, dass ich die Hände in den Schoß lege und dich entkommen lasse, dann hast du Miststück dich getäuscht! Verdammt soll ich sein, wenn ich eher Ruhe gebe, als bis sie dich räudige Ratte wieder eingefangen und auf die Hölleninsel gebracht haben!«, fluchte Cleo vor sich hin, als sie die Gassen des übel beleumundeten Viertels The Rocks mit seinen unzähligen schäbigen Tavernen und anderen Lasterhöhlen hinter sich gelassen hatte und die Garnison unterhalb der Festung nun vor ihr lag. Sie wusste, an wen sie sich zu wenden hatte, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wurde – und sie zu ihrer verdienten Rache kam! Unter den Offizieren des korrupten New South Wales Corps gab es einige, die selbst ein großes Interesse daran hatten, dass Abby Lynn Chandler auf der Hölleninsel von Norfolk elendig zugrunde ging. Und bei ihnen würde sie Gehör und die nötige Anerkennung für ihre unglaubliche Entdeckung finden!
Als Cleo das große Geviert mit den Baracken der Soldaten und den etwas besseren Offiziersunterkünften betrat, fand auf dem sandigen Hof gerade eine Auspeitschung statt. Unter gewöhnlichen Umständen hätte Cleo dem Mann, der mit nacktem Oberkörper an ein mannshohes Dreibein aus drei in die Erde gerammten Holzpfosten gefesselt stand und den Rücken blutig geschlagen bekam, keine weitere Beachtung geschenkt. Bestrafungen dieser Art gehörten zum Alltag in der Sträflingskolonie, wurde doch das berüchtigte »Botany Bay Dutzend«, fünfundzwanzig Schläge mit der neunschwänzigen, knotigen Lederpeitsche, schon für die lächerlichsten Vergehen verhängt. Doch an diesem Morgen blieb sie einen Augenblick stehen und sah der Auspeitschung mit grimmiger Genugtuung zu. Zu hören, wie die Lederriemen, in die Knoten geflochten waren und an deren Ende Eisenspitzen hingen, auf den Rücken klatschten und das Blut nur so spritzen ließen, weckte in ihr eine Art von innerem Jubel, sah sie vor ihrem geistigen Auge doch Abby dort am Dreibein stehen. Denn wenn sie erst gefasst war, wartete auf sie ganz sicher eine solche Auspeitschung! Aber sie würde nicht mit lächerlichen fünfundzwanzig Schlägen davonkommen, sondern die Neunschwänzige würde mindestens hundertmal auf ihren Rücken niedergehen, bis da nur noch rohes, blutiges Fleisch und bloß gelegte Knochen zu sehen waren!
Dass sie selbst wegen ihrer Verbrechen knapp dem Galgen entronnen und dank glücklicher Umstände nur nach Australien verbannt worden war, daran verschwendete Cleo nicht den Hauch eines Gedankens. Mitleid mit anderen war ihr so fremd wie einem Säufer die Abstinenz.
Als sie genug von dem grausamen Schauspiel, dem Klatschen der Peitsche und den Schreien des Mannes hatte, ging sie zur Schreibstube der Offiziere hinüber.
Ein dickleibiger Soldat im Rang eines Sergeanten saß hinter dem Schreibtisch, der aus massiver Eiche bestand und mit schweren Messingbeschlägen an den Kanten versehen war. Auf dem ledergebundenen, aufgeschlagenen Dienstbuch lagen einige Papiere, auf die er missmutig blickte, während er auf dem Ende eines Federkiels kaute.
Kurz hob er den Kopf und erfasste mit einem Blick die schlampige Gestalt, die vor ihm stand. »Was willst du, Weib?«, fragte er barsch.
»Ich muss mit Lieutenant Danesfield sprechen«, sagte Cleo. »Am besten aber mit Captain Grenville!«
Seine buschigen Augenbrauen zogen sich spöttisch in die Höhe. »So, am besten gleich Captain Grenville, ja? Warum denn nicht den Gouverneur oder gar den König persönlich?«, blaffte er.
»Es ist wichtig! Und ich weiß, dass Lieutenant Danesfield und auch Captain Grenville sehr an dem interessiert sind, was ich ihnen mitzuteilen habe!«
»So, was du nicht sagst«, erwiderte der Sergeant gedehnt. Er lehnte sich zurück und mit abfälligem Blick musterte er die plumpe, kräftige Gestalt mit den verrotteten Zähnen und der hässlichen Hautflechte auf der linken Gesichtshälfte, die in einem mit Schmutzflecken übersäten Kleid vor ihm stand. Er war sich sicher, sogar über den Tisch hinweg den Alkohol im Atem der Frau riechen zu können. »Du hast wohl schon heute Morgen mit dem Saufen begonnen, was? Wer bist du überhaupt?«
Angriffslustig reckte Cleo ihr schwammiges Doppelkinn vor. »Gar nichts habe ich heute Morgen getrunken!«, log sie mit geheuchelter Empörung. »Und ich verbitte mir diese dreiste Unterstellung, Sergeant! Ich bin Cleo Patterson, die Frau des obersten Gefängniswärters!«
»Du bist also eine Emanzipistin, eines von den läufigen Weibern, die der Verbüßung ihrer Reststrafe entkommen sind, weil sie sich einen freien Siedler als Mann geangelt haben«, höhnte der Sergeant. »Na, kein Wunder, dass du Schlampe keinen anderen als Winston Patterson, dieses dürre Klappergestell, abbekommen hast, obwohl es hier in der Kolonie an Weibern mangelt.«
»Also, das ist ja wohl der Gipfel …«, begann Cleo sich zu entrüsten und stemmte die Fäuste in die Hüften.
»Verschwinde!«, fuhr er ihr über den Mund. »Ich habe zu arbeiten. Wenn du etwas willst, geh rüber zur Schreibstube von Corporal Jamison! Der ist für Leute deines Schlages zuständig! Und nun raus, Weib!«
Cleo lief vor Wut dunkelrot an, beherrschte sich aber. Es brachte nichts, den Mann noch mehr gegen sich aufzubringen. Sie musste einfach mit einem der Offiziere sprechen! Und wenn das bedeutete, dass sie ihre Wut zügeln und sich unterwürfig zeigen musste, so wie es das korrupte Soldatenpack erwartete, dann würde sie das eben notgedrungen tun.
»Hören Sie mir wenigstens einen Augenblick zu, bevor Sie mich davonjagen, Sergeant«, sagte Cleo nun mit fester, aber bedeutend freundlicherer Stimme. »Denn wenn Sie mir nicht zuhören, werden Sie das vermutlich bitter bereuen, weil Sie dann ganz sicher Ärger mit Lieutenant Danesfield und Captain Grenville bekommen.«
Der Sergeant lachte trocken auf und wollte ihr schon wieder ins Wort fallen.
Doch Cleo redete schnell weiter. »Bei der Angelegenheit, die mich herführt, handelt es sich nämlich um den Fall eines entlaufenen Sträflings, an dem die beiden Offiziere ein großes persönliches Interesse haben.«
Der Sergeant grinste hämisch. »Ach was, ihr habt einen eurer Insassen entlaufen lassen?«
»Nein, die Frau ist von der Phoenix entkommen, mit der sie eigentlich nach Norfolk Island gebracht werden sollte!«
Die Miene des Soldaten verfinsterte sich. »Du musst heute wirklich sehr früh mit dem Saufen begonnen haben!«, sagte er ärgerlich. »Die Phoenix ist schon vor vier Tagen ausgelaufen. Und von dem Pack, das auf die Insel soll, ist keiner vom Schiff entkommen. Davon wüsste ich. Ach was, jeder in Sydney hätte davon erfahren. Und jetzt rate ich dir zum letzten Mal …«
»Warten Sie!«, rief Cleo beschwörend. »Ich weiß, dass die Frau vom Schiff entkommen ist, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ihr das unentdeckt gelingen konnte! Sie muss auch auf dem Schiff Helfer gehabt haben. Vermutlich hat ihr Mann, der über genug Geld verfügt, dort jemanden bestochen. Aber sie ist entkommen, glauben Sie mir! Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen, und der Soldat, der ihren Lügen geglaubt hat und sie entkommen ließ, wird sie Lieutenant Danesfield bestimmt zweifelsfrei beschreiben können. Ich habe nach seinem Namen gefragt. Er heißt James Chesterton! Und Sie sollten mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass der Lieutenant und der Captain an dieser Nachricht bestimmt sehr interessiert sind! Nicht von ungefähr haben die beiden Herren Offiziere regelrecht Jagd auf sie gemacht und die Farm Yulara am Hawkesbury, wo sie mit ihrem Mann gelebt hat, niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht!«
Nachdenklich zog der Sergeant seine Unterlippe zwischen die Zähne und überlegte sichtlich angestrengt, was er von der Sache halten sollte. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, die Frau, so abstoßend sie auch sein mochte, hinauszujagen. Der Lieutenant war kein Mann von großer Geduld, wenn man einen Fehler machte, das wusste er aus leidlicher Erfahrung. Deshalb ließ er sich gnädig zu der Frage herab: »Wer ist diese Frau überhaupt, die angeblich unbemerkt von der Phoenix entkommen sein soll?«
»Sie heißt Abby Lynn, das heißt, seit sie den freien Siedler Andrew Chandler geheiratet hat, nennt sie sich Abby Chandler. Ich kenne Abby gut. Ich bin mit ihr auf dem Sträflingsschiff Kent vor viereinhalb Jahren in die Kolonie gekommen. Sie machte natürlich die ganze Zeit auf unschuldig, ist aber ein ganz durchtriebenes Ding. Und die Chandlers haben den Offizieren hier ganz übel mitgespielt!«, sprudelte Cleo hervor und hatte Mühe, sich ihre Erleichterung nicht anmerken zu lassen, dass sie nun endlich seine ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. »Als das New South Wales Corps letztes Jahr gegen Gouverneur Bligh gemeutert hat, ihn abgesetzt und die Macht in die eigenen Hände genommen hat, da haben sich die Chandlers auf die Seite von Bligh gestellt und alles Mögliche versucht, um den Offizieren zu schaden! Andrew Chandler, also Abbys Mann, und dessen älterer Bruder Melvin sollen sogar zwei Rumdestillerien von Lieutenant Danesfield und Captain Grenville zerstört haben!«
»Also, das Wort ›Meuterei‹ will ich nicht noch einmal hören!«, verwarnte sie der Sergeant mit ärgerlich gerunzelten Brauen. »Dieser verdammte Bligh ist unfähig gewesen, sein Amt richtig auszuüben, sowohl damals auf seinem Schiff, der Bounty, als auch hier in der Kolonie als Gouverneur, und einzig und allein zum Wohle der Kolonie hat das Corps ihn abgesetzt! Haben wir uns verstanden?«
»Natürlich! Das war wirklich ein dummer Ausrutscher von mir, Sergeant! Natürlich war es nur zum Wohle der Kolonie!«, versicherte Cleo eiligst, obwohl doch jeder in der Kolonie wusste, dass es eine schändliche Meuterei gewesen war. Gouverneur Bligh hatte nämlich der korrupten Offiziersclique das lukrative Geschäft mit dem Rumhandel verbieten wollen, mit dem sie sich seit Jahren die Taschen füllten und die Kolonie aussaugten wie eine Plage von Blutegeln. Aber das kümmerte sie wenig. Ihretwegen konnten die verfluchten Rotröcke weiterhin ihre schmutzigen Geschäfte mit dem Rum betreiben – bis London reguläre Truppen und einen neuen Gouverneur nach Australien entsandte und der ganzen Bande das Handwerk legte. Ihr war das so gleichgültig wie der Mann da draußen, dessen Auspeitschung offensichtlich ein Ende gefunden hatte, waren doch seine Schreie nicht länger zu hören. Aber vielleicht war er auch nur in Ohnmacht gefallen.
»Also gut, dann wollen wir die Dinge mal der Reihe nach festhalten«, sagte der Sergeant, zog ein leeres Blatt Papier hervor und wollte den Federkiel gerade ins Tintenfass tunken, als hinter ihm die Tür aufging – und Lieutenant Danesfield erschien.
»Was ist das hier für ein endloses Gequatsche, Simonton?«, verlangte der hochgewachsene, schwarzhaarige Offizier mit den scharf geschnittenen Gesichtszügen zu wissen, ohne Cleo auch nur eines Blickes zu würdigen. Streng fixierte er den Sergeanten. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich absolute Ruhe wünsche?«
Sergeant Simonton sprang vom Stuhl auf und nahm Haltung an. »Entschuldigen Sie, Sir! Aber diese Frau hier gibt keine Ruhe, Sir! Sie besteht darauf, Sie in einer dringlichen Angelegenheit zu sprechen!«
»Werfen Sie sie raus!«, schnarrte Lieutenant Danesfield. »Und wenn sie nicht auf der Stelle geht, sorgen Sie dafür, dass sie die Neunschwänzige zu spüren bekommt. Das wird ihr den nötigen Respekt einbläuen, den Sie offenbar nicht bei ihr haben!«
»Jawohl, Sir!«
Der Offizier drehte sich schon um und wollte wieder in sein Büro zurückkehren, als Cleo schnell rief: »Warten Sie, Sir! Es geht um Abby Lynn … das heißt Abby Chandler! Sie ist von der Phoenix entkommen! Ich habe sie in der Stadt gesehen, Sir!«
Lieutenant Danesfield blieb augenblicklich stehen und fuhr ruckartig zu ihr herum. Erst jetzt ließ er sich dazu herab, ihr einen Blick zu gönnen. Eine steile Falte zeigte sich auf seiner Stirn, als er sie erkannte. »Was hast du da gesagt? Abby Chandler soll entkommen sein?«
»Es ist die Wahrheit, Sir! Abby Chandler ist entkommen und jetzt schon wer weiß wo!«, beteuerte Cleo.
Augenblicke später stand sie in seinem Büro und wiederholte noch einmal ihre Geschichte. Eindringlich schilderte sie dem Offizier, was sich vor vier Tagen zwischen Hafen und den Rocks ereignet und wen sie mit eigenen Augen gesehen hatte – nämlich Abby in einem eleganten Taftkleid zusammen mit ihrem Mann Andrew Chandler in einer Kutsche, die es eilig gehabt hatte, stadtauswärts zu kommen.
Erst wollte auch er ihrer Geschichte keinen Glauben schenken. Aber wenn Cleo auch nach Alkohol stank, so war sie doch zweifellos nicht betrunken. Und die genaue Beschreibung, die sie lieferte, gab ihm zu denken.
»Wehe, du hältst mich mit deiner Geschichte zum Narren!«, warnte er sie, schickte jedoch unverzüglich nach dem einfachen Soldaten James Chesterton, den er wenig später in ihrer Gegenwart verhörte.
Der verängstigte Soldat bestätigte den Vorgang, blieb jedoch in seiner Beschreibung von der Frau in der Kutsche recht vage. Sie konnte auf Abby zutreffen. Lieutenant Danesfield hämmerte mit der Faust wütend auf seinen Schreibtisch. »Du verdammter Idiot!«, brüllte er den Soldaten an. »Du hast vermutlich einen Sträfling entkommen lassen, wenn die Dinge tatsächlich so liegen, wie die Frau hier aussagt!«
»Ich bin mir ganz sicher!«, bekräftigte Cleo, um bei dem Lieutenant auch noch die letzten Zweifel auszuräumen.
»Wenn das wirklich der Fall ist, wird man dich an das Dreibein binden!«, drohte ihm der Offizier. »Raus, Mann! Aus den Augen! … Sergeant, wenn sich der Verdacht bestätigt, kommt er ins Loch, bis ich über seine Bestrafung befunden habe!«
Cleo warf dem Soldaten, der leichenblass geworden war, einen schadenfrohen Blick zu. Geschah ihm recht, dass er für seine Dummheit wohl bald die Neunschwänzige zu spüren bekam. Hätte er auf sie gehört, hätte er sich die Prozedur erspart!
»Ich nehme an, Sie werden unverzüglich eine Untersuchung befehlen, wie es möglich war, dass diese Frau von der Phoenix fliehen konnte, ohne dass jemand etwas davon mitbekommen hat, Sir!«, sagte Sergeant Simonton dienstbeflissen, als der gemeine Soldat in stummem Schrecken salutiert und das Zimmer verlassen hatte.
»Worauf Sie Gift nehmen können!«, bellte Danesfield. »Da werden noch mehr Köpfe rollen, wenn sich diese Ungeheuerlichkeit tatsächlich zugetragen hat! Sorgen Sie dafür, dass jemand an Bord des nächsten Schiffes ist, das nach Norfolk Island segelt, der dieser unglaublichen Schlamperei nachgeht. Ich will wissen, wer sich da hat bestechen lassen!«
»Aber bis wir die Antwort haben, werden einige Monate vergehen«, gab der Sergeant zu bedenken. »Die nächste Fahrt nach Norfolk Island ist erst für Mitte Juli geplant. Sie wissen doch, wie wenig Schiffe wir zur Verfügung haben.«
»Das ist mir egal! Ich will Gewissheit haben! Und stellen Sie Erkundigungen an, ob es einen Siedler dieses Namens …« Der Offizier sah kurz zu Cleo hinüber und fragte herrisch: »Wie war noch mal der Name des Mannes, den du als Andrew Chandler erkannt haben willst?«
»Er hat sich Mackenzie genannt … James Mackenzie, Sir!«, antwortete sie eilfertig.
»Nicht gerade ein sehr ungewöhnlicher Name, Lieutenant«, wandte der Sergeant ein, wohl, um schon für den Fall vorzubeugen, dass seine Nachforschungen nicht viel Hilfreiches zutage förderten. »Leute mit diesem Namen gibt es in der Kolonie wie Sand am Meer.«
»Aber wohl kaum viele freie Siedler, die zudem noch mit einem gewissen Major Robert Coburn befreundet sind«, sagte Cleo rasch. »Denn als dessen Freund hat er sich ausgegeben. Aber mich hat er nicht getäuscht. Es war Chandler und die Frau bei ihm war niemand anders als Abby, der Herr ist mein Zeuge!«
Lieutenant Danesfield machte eine unwirsche Handbewegung. »Reden Sie mit Major Coburn und bringen Sie Licht in diese Affäre, Sergeant. Also, an die Arbeit – und zwar auf der Stelle!«
»Jawohl, Sir!«
»Und was werden Sie jetzt tun, Sir?«, fragte Cleo mit heimlicher Genugtuung. »Ich meine, bis Nachricht aus Norfolk Island eintrifft. Sie werden Abby doch nicht davonkommen lassen, nicht wahr?«
»Natürlich nicht! Was für eine dumme Frage!«, schnaubte Danesfield aufgebracht. »Wenn sich Major Coburn nicht erinnern kann, mit einem Siedler namens James Mackenzie befreundet zu sein, werde ich in der ganzen Kolonie nach ihr suchen lassen! Und egal wo sie sich versteckt hält, sie wird mir nicht entkommen!«
Zweites Kapitel
Abby wechselte die Zügel des schwer beladenen Wagens, der von zwei kräftigen Ochsen gezogen wurde, in die linke Hand und fuhr sich mit der rechten über das verschwitzte, staubbedeckte Gesicht. Die vier Fuhrwerke und Überlandwagen, die vor ihnen ihre Spuren durch das trockene und in dieser Gegend ausgesprochen sandige Gelände zogen, wirbelten mächtig viel Staub auf. Und obwohl sie einen guten Abstand zum Vordermann einhielten, gerieten sie doch immer wieder in die lange Staubfahne der vor ihnen fahrenden Wagen. Zudem war der Wind aus Südosten eingeschlafen, sodass der Staub ungewöhnlich lange hinter den Wagen hertrieb.
Aber Abby wusste, dass die vielen anderen Gefährte, die noch hinter ihr in der langen Schlange des Trecks eingereiht fuhren, dasselbe zu ertragen hatten. Und ganz besonders übel dran waren die Männer und Frauen, die am Ende des Trecks dafür verantwortlich waren, dass die Viehherden zusammenblieben und den Anschluss an die Wagenkolonnen nicht verloren. Nur die Leute auf dem Wagen an der Spitze des Trecks, der aus dreiundzwanzig klobigen Fuhrwerken und hochbordigen Überlandwagen mit Segeltuchplane sowie zehn Reitpferden, einigen Dutzend Schafen, Rindern, Ziegen und anderem Getier bestand, blieben von dieser Belästigung verschont.
Gut hatten es auch die drei Reiter, zu denen an diesem Tag auch ihr Mann Andrew gehörte, die dem Treck stets einige Meilen vorwegritten, um das Gelände auszukundschaften, den besten Weg festzulegen und sich zu vergewissern, dass ihnen keine Gefahren drohten. Denn wenn das Land außerhalb der von der Kolonialverwaltung festgesetzten Grenzen auch unbesiedelt war, so mussten sie trotz der scheinbaren Endlosigkeit und Menschenleere des Buschlandes immer darauf gefasst sein, auf das Stammesgebiet von Aborigines zu stoßen. Und da die Eingeborenen seit der gut zwanzigjährigen Besiedlung des Küstenstreifens rund um Sydney schon viele böse Erfahrungen mit Siedlern und Soldaten gemacht hatten, die sie mit einem mörderischen Vernichtungshass wie wilde Tiere jagten und auch Kinder und Frauen gnadenlos niedermetzelten, war es nicht verwunderlich, dass sie den Weißen überwiegend feindlich gesinnt waren.
Zudem waren auch viele Sträflinge vor der Grausamkeit der Rotröcke in den Busch geflüchtet, wo sie sich zu Banden zusammengeschlossen hatten und immer wieder abgelegene Farmen überfielen. Bei der Mehrzahl dieser Buschbanditen handelte es sich um Iren, die in der Kolonie unter dem Hass und der grausamen Bestrafung vonseiten der englischen Soldaten ganz besonders stark zu leiden hatten.
»Hier, nimm einen Schluck Wasser!«, sagte Rosanna neben ihr. Die dicke Frau, die Köchin auf Yulara gewesen war und auch in den schweren Zeiten treu zu ihr und der Chandler-Familie gestanden hatte, reichte ihr eine verbeulte, blecherne Wasserflasche. »Man wird schneller müde, wenn man zu wenig trinkt!«
Ein müdes Lächeln huschte über Abbys staubiges Gesicht. »Manchmal habe ich das Gefühl, du kannst Gedanken lesen, Rosanna«, sagte sie dankbar, nahm die Flasche entgegen und gönnte sich mehrere lange Schlucke. Das Wasser war warm, tat aber dennoch gut, spülte es doch den Dreck aus dem ausgedörrten Mund.
»In vier Tagen fahren wir an der Spitze«, sagte Rosanna und rückte das Kissen zurecht, das sie sich unter ihren ausladenden Hintern geschoben hatte, um auf den harten Brettern des Kutschbocks die Stöße und das ständige Gerüttel des Wagens ein wenig erträglicher zu machen. »Und darauf freue ich mich jetzt schon.« Sie lachte kurz auf. »Wie man doch auf einmal für die kleinsten Freuden und Erleichterungen dankbar ist, an die man unter normalen Umständen nicht einmal einen Gedanken verschwendet hätte!«
»Ja, du hast recht«, pflichtete Abby ihr bei und dachte wieder einmal voller Bedrückung an Rachel, die sich in ihrem todkranken Zustand für sie aufgeopfert und an ihrer Stelle mit dem Sträflingsschiff nach Norfolk Island gesegelt war. Eingepfercht in den abscheulichen Sträflingsquartieren im stinkenden Unterdeck, befand sich ihre Freundin jetzt schon längst auf hoher See. Aber ob sie die verfluchte Insel überhaupt lebend erreichen würde, war fraglich, so wie Rachel bei ihrer letzten aufwühlenden Begegnung auf der Phoenix schon Blut gespuckt hatte. Vermutlich würde sie nie erfahren, wie es Rachel ergangen war und wie lange sie noch gelebt hatte. Und das würde sie bis ans Ende ihrer Tage bedrücken. Sie verdankte Rachel ihr Leben und dass sie mit Andrew und ihrem im Kerker zur Welt gekommenen Baby Jonathan mit diesem geheimen Treck ins Niemandsland hatte aufbrechen können. »Ich bin so froh, am Leben zu sein und mit Andrew und Jonathan in die Freiheit zu fahren.«
Rosanna wusste, woran Abby in diesem Moment dachte, und nickte. »Ja, das größte Wunder auf Erden ist und bleibt die Liebe, die keine Grenzen und keine Vorbehalte kennt, wie hoch der Preis auch sein mag«, sagte sie leise, um nach einer kurzen Weile nachdenklichen Schweigens in der ihr eigenen resoluten, nüchternen Art fortzufahren: »Aber wir sollten besser nicht glauben, jetzt schon in Sicherheit zu sein! Vor uns liegt noch eine gute Strecke Weges, bis wir es wagen können, uns irgendwo niederzulassen.«
»Ich weiß«, sagte Abby mit einem müden Aufseufzen. »Wir werden wohl noch Wochen unterwegs sein, bis wir uns wirklich sicher fühlen können und auch den richtigen Landstrich für eine Besiedlung gefunden haben.«
»Nehmen wir einen Tag nach dem anderen, Abby.«
»Ja, nur so geht es«, stimmte Abby ihr zu.
Sie waren wieder beim ersten Licht des neuen Tages aufgebrochen und mittlerweile hatte die Sonne am leicht bewölkten Himmel fast schon ihren höchsten Stand erreicht. Aber auch an diesem Tag lagen noch viele Stunden auf dem harten Kutschbock vor ihr und ihren Gefährten, die sich an diesem verbotenen und gefährlichen Treck in das noch unbesiedelte und unerforschte Land südwestlich der Kolonie beteiligt hatten. Und keiner konnte sagen, wie viele Tage, ja Wochen noch vor ihnen lagen, bevor sie sich endlich vor der Macht und Willkür des New South Wales Corps sicher fühlen konnten und außerdem noch genügend fruchtbares Land zum Siedeln gefunden hatten.
Abbys Blick ging über das karge, hügelige Buschland mit seinen verfilzten Dornenbüschen, den kleinen Waldstücken aus immergrünen, graustämmigen Eukalyptusbäumen und dem dürren, scharfkantigen Gras, das hier und da in Büscheln aus der rotbraunen Erde wuchs. Es erstreckte sich von Horizont zu Horizont. Wie ein schier endloser Ozean erschien ihr die Landschaft. Fünf Tage waren erst vergangen, seit sich die zwölf Familien nach all den geheimen Vorbereitungen zum gemeinsamen Aufbruch außerhalb der Siedlung Camden eingefunden und die letzten besiedelten Gebiete der Kolonie hinter sich gelassen hatten. Und in diesen Tagen war ihnen keine Menschenseele begegnet – gottlob nicht!
Der Erfolg ihres waghalsigen Unternehmens hing in besonderem Maße davon ab, dass niemand wusste, wo sie im Niemandsland verschwunden waren und wo sie sich eine neue Existenz aufbauten. Zwar rechneten alle damit, dass früher oder später ein rechtmäßiger Gouverneur mit regulären Truppen in Sydney landete, der Willkürherrschaft des New South Wales Corps ein Ende bereitete und wieder für Recht und Ordnung sorgte. Aber wann genau das geschehen würde, stand in den Sternen. Und bis dahin schwebten sie in großer Gefahr, die sie nicht auf die leichte Schulter nehmen durften.
Rosanna beugte sich nach hinten und warf durch den Spalt in der Segeltuchplane, die das Gestänge über dem Wagen bedeckte, einen Blick auf das wenige Wochen alte Baby, das gleich hinter der Rückenlehne des Kutschbocks in einem weich ausgepolsterten Weidenkorb lag.
»Jonathan schläft noch immer tief und fest«, sagte sie mit einem liebevollen Lächeln. »Was für einen göttlichen, unschuldigen Schlaf Babys doch haben!« Mutterglück durchströmte Abby wie eine warme Woge. »Ja, aber warte mal, bis er aufwacht und merkt, wie hungrig er ist. Dann schreit er wieder, dass man ihn bis ans Ende des Trecks hören kann!«
Während sich die Wagenkolonne langsam einer lang gestreckten Hügelkette näherte, auf deren Kuppen sich hier und dort Eukalyptusbäume zu kleinen, Schatten spendenden Hainen zusammendrängten, unterhielten sie sich eine Weile darüber, wie glücklich sie waren, dass auch noch einige andere, die früher mit ihnen auf Yulara am Hawkesbury River gelebt und ihren Teil zur kurzen Blütezeit der Farm beigetragen hatten, mit ihnen ins Ungewisse aufgebrochen waren. Da waren Glenn Osborne und der Schmied Vernon Spencer, dessen Erfahrungen auf diesem Treck genauso wenig mit Gold aufzuwiegen waren wie die des schottischen Zimmermanns Stuart Fitzroy. Sie hatten wie Rosanna treu zu ihnen gestanden, als die Chandler-Familie und sie, Abby, von Männern wie Lieutenant Danesfield und Captain Grenville verfolgt worden waren. Ganz besonders freute sich Abby auch darüber, dass ihre Freundin Megan, die mit ihr auf der Kent nach Australien gekommen war, sich mit ihrem Mann Timothy O’Flathery an dem Wagnis des Trecks beteiligt hatte. Es war schön, bei diesem riskanten Unternehmen eine Gruppe von Menschen um sich zu wissen, mit denen man eine bewegte Vergangenheit teilte und denen man vor allem blindes Vertrauen schenken konnte, was immer auch vor einem liegen mochte.
Ihr Gespräch brach ab, als sie drei Reiter bemerkten, die sich nun aus dem Schatten einer Baumgruppe lösten und mit ihren Halstüchern über ihren Köpfen hin und her winkten. Es war das verabredete Zeichen, anzuhalten und am Fuß der Hügelgruppe in einem weiten Halbkreis Aufstellung zu nehmen. Das Zeichen bedeutete jedoch nicht, dass irgendeine Art von Gefahr vor ihnen lag. In dem Fall hätten sie das Zeichen mit ihren Gewehren und Flinten gegeben.
»Es gibt wohl etwas zu besprechen. Na, eine Pause nach dem stundenlangen Durchgerüttel kommt mir ganz gelegen, wenn ich ehrlich sein soll«, sagte Rosanna und gönnte sich nun selber einen ordentlichen Schluck aus der Wasserflasche.
Andrew, der vollbärtige Arthur Watling und der schmächtige und kurzbeinige Douglas Brown, dem man nicht von ungefähr den Spitznamen »Little Brown« verpasst hatte, kamen auf ihren Pferden langsam den Hang herunter, während die hinteren Wagen rasch aufschlossen und sich sichelförmig aneinanderreihten.
Ein allgemeines erleichtertes Seufzen und Aufstöhnen setzte nun ein, als die Männer, Frauen und Kinder, insgesamt sechsunddreißig Personen an der Zahl, von den Wagen stiegen, ihre malträtierten Glieder reckten und streckten und zu Wasserflaschen und -schläuchen griffen. Und so manch einer goss sich sogar einen kräftigen Schwall über den Kopf.
»Was steht denn an, Leute?«, rief Silas Mortlock den drei Reitern zu und löste sich aus der Menge. Er war ein kräftiger, fast hünenhafter Mann von Ende dreißig, ein einstiger Seemann, der schon in früher Jugend alle Haare verloren hatte. Ein Geflecht von wulstigen Narben überzog seine Glatze wie auch seinen breiten Rücken, die Spuren grausamer Auspeitschungen und brutaler Prügel, die er im Gefängnis einer englischen Hafenstadt vonseiten sadistischer Aufseher über sich hatte ergehen lassen müssen.
»Vielleicht ist unser heutiger Spähtrupp dafür, dass wir hier schon unser Land für die Farmen abstecken«, warf Henry Blake ein, der alle um gut eine Haupteslänge überragte und das Gesicht eines Adlers mit der entsprechend ausgeprägten Hakennase hatte.
»Da lässt dich dein großer Riecher heute aber ganz übel im Stich, Henry!«, rief jemand aus der Menge. »Muss wohl am vielen Staub liegen, den er heute aufgefangen hat!«
Alles lachte über den gutmütigen Scherz, denn natürlich wusste jeder, dass das Ende ihrer Reise ins Ungewisse noch in weiter Ferne lag.
»Nein, es geht um eine Handelsstation, die einen knappen halben Tagesritt nördlich von hier liegt!«, antwortete Andrew, auf das Sattelhorn gebeugt. »Silas hat uns davon erzählt. Und wir müssen über den Vorschlag beraten, den er uns unterbreitet hat.«
»Was sagst du da? Hier draußen soll es eine Handelsstation geben?«, fragte Henry Blake verblüfft. »Davon habe ich ja noch nie gehört!«
»Kein Wunder, du hast ja mit deiner Familie auch im Nordwesten von Sydney gesiedelt und bist noch nie so weit in den Süden gekommen«, antwortete ihm Silas Mortlock. »Aber ich habe mit meiner Frau versucht, weit im Westen am Nepean River eine Existenz aufzubauen – leider ohne Erfolg, wie jeder weiß, sonst wäre ich heute nicht hier.«
»Da befindest du dich in allerbester Gesellschaft!«, rief ihm der hagere Frank Tate zu, der wie so viele andere ehemalige Sträflinge mit seiner ersten Farm keinen Erfolg gehabt hatte. Denn das gute, fruchtbare Land war fast ausnahmslos den freien Siedlern vorbehalten und den Offizieren. Emanzipisten wie sie hatten sich mit karger Ackerkrume zufriedenzugeben und zu sehen, wie sie Dürre und Überschwemmungen, Hunger und Buschbrand überstanden.
In der Runde erhob sich Gelächter.
»Ich bin dann oft im Busch auf die Jagd nach Kängurus, Wombats und Opossums gegangen, um unseren mageren Speiseplan etwas fetter und sättigender zu machen«, fuhr Silas Mortlock nun fort. »Und bei einem meiner längeren Jagdausflüge bin ich auf einen anderen Jäger gestoßen, der mir von dieser einsam gelegenen Handelsstation erzählt hat. Sie wird von einem Burschen namens Joshua Parker betrieben, der dort mit einem Eingeborenenhalbblut lebt, und nennt sich Parker’s Trading Post. Sie liegt in der Nähe eines kleinen Berges mit einer ungewöhnlich schmalen Spitze aus Felsgestein, dem man den Namen Needle Mountain gegeben hat.«
»Wovon lebt dieser Joshua Parker denn?«, wollte eine der Frauen wissen.
»Ja, mit wem will er denn in dieser gottverlassenen Einöde Handel treiben?«, fügte jemand anders verwundert hinzu.
Silas Mortlock zuckte die Achseln. »Es muss da drüben im Norden noch einige abgelegene Farmen geben. Er soll auch ganz gut mit den Aborigines stehen – wohl wegen des Halbblutes, mit dem er da zusammenlebt. Aber er macht auch Geschäfte mit entlaufenen irischen Sträflingen, die sich in das abgelegene Gebiet verzogen haben.«
Henry Blake kratzte sich am Kinn. »Schön und gut, Silas. Aber was haben dieser zwielichtige Bursche und seine Handelsstation mit uns zu tun?«
»Wir wollen Joshua Parker einen Besuch abstatten«, eröffnete Andrew nun die Versammlung.
Auf den Gesichtern der Männer und Frauen zeigte sich Unverständnis, teilweise auch Bestürzung. Ein Raunen ging durch die Menge.
Douglas Brown hob beschwichtigend die Hände. »Nicht, was ihr denkt, Leute!«, rief er schnell. »Wir haben nicht vor, mit dem ganzen Treck vor der Handelsstation aufzutauchen. Auf diese einfältige Idee sind wir wahrlich nicht gekommen. Wir wollen nur zu dritt zu Parker reiten und uns als Jäger ausgeben, er handelt nämlich nicht nur mit Fellen und anderen gewöhnlichen Waren, sondern bei ihm kann man auch Pulver, Blei und Zündkapseln kaufen. Und daran kommt man als Emanzipist in dieser Kolonie ja so schwer wie an gutes Land!«
Die Mienen entspannten sich wieder ein wenig.
»Und ihr wisst ja alle, dass wir nur über sehr wenig Pulver und Blei verfügen«, ergriff Andrew wieder das Wort, der trotz seines jugendlichen Alters große Autorität besaß, weil er der einzige Freie unter ihnen war. »Und wer weiß, wie lange wir hier draußen auf uns allein gestellt sein werden. Wenn es dazu kommt, dass wir uns mit unseren wenigen Gewehren und Pistolen verteidigen müssen, gegen wen auch immer, werden wir mit dem wenigen Pulver und Blei nicht lange aushalten können.«
»Ein Wagnis ist es trotzdem!«, sagte Stuart Fitzroy, der Zimmermann mit dem wild zerzausten rotbraunen Vollbart, und rieb sich den Beinstumpf, als spürte er die Gefahr wie einen Juckreiz.
»Aber ein Wagnis, das wir zu unserer eigenen Sicherheit eingehen müssen!«, bekräftigte Andrew.
Die Beratung ging noch eine Weile hin und her. Dann gab es keine Einwände mehr gegen den Vorschlag, drei Reiter zu Parker’s Trading Post am Needle Mountain zu schicken.
Aber Henry Blake und einige andere unternehmungslustige Männer, die über Gewehre oder Pistolen verfügten, wollten mit von der Partie sein.
Letztlich ließen sie das Los darüber entscheiden, wer an dem Abstecher zur Handelsstation teilnehmen sollte. Andrew, Silas Mortlock und Henry Blake zogen die drei kurzen Hölzer, die zur Teilnahme berechtigten. Henry Blake, der bei allem stets gern ein gewichtiges Wort mitreden wollte und nicht unter einem Mangel an Selbstbewusstsein litt, grinste zufrieden in die Runde.
Es wurde vereinbart, dass der Treck einen scharfen Schwenk nach Süden machte und in dieser Richtung weiterzog, bis die drei Männer die Kolonne wieder eingeholt hatten, womit in der zweiten Hälfte des nächsten Tages zu rechnen war, sofern alles nach Plan verlief. Denn eine Nacht würden die drei Reiter wohl oder übel allein im Busch campieren müssen.
»Ich wünschte, ihr müsstet euch nicht auf diesen Ritt machen!«, sagte Abby voller Sorge, als sie Andrew schnell etwas Proviant einpackte, nachdem sie seinen Ziegenhautschlauch an der Wassertonne frisch aufgefüllt hatte.
»Es muss sein und du weißt es so gut wie ich«, erwiderte er und schnallte eine Decke für die Nacht auf sein Pferd.
»Aber pass bloß auf dich auf! Und lasst euch nicht in irgendeine gefährliche Situation ein!«, beschwor sie ihn, als er sie zum Abschied in seine Arme schloss.
»Worauf du dich verlassen kannst, mein Liebling. Also mach dir keine Sorgen«, sagte er, gab ihr einen letzten Kuss, strich ihrem noch immer schlafenden Baby liebevoll über den Kopf und schwang sich auf sein Pferd.
Mit bangem Herzen blickte Abby den drei Reitern nach, bis sie hinter den Hügeln verschwunden waren. Sie wusste schon jetzt, dass sie keine ruhige Minute haben würde, bis Andrew mit seinen Gefährten wohlbehalten wieder zu ihnen zurückgekehrt war!
Drittes Kapitel
»Verdammt und zugenäht, Parkers Hütte muss doch irgendwo hier sein!«, fluchte Silas Mortlock, als sie wieder einmal auf einer Anhöhe eine kurze Rast einlegten und das Gelände vor ihnen nach der einsamen Handelsstation absuchten. Gute fünf Stunden waren sie nun scharf geritten und die Sonne würde höchstens noch eine Stunde über dem westlichen Horizont stehen. Aber noch immer konnten sie nirgendwo im Buschland auch nur einen Hinweis auf Joshua Parkers Handelsposten entdecken.
»Bist du dir auch sicher, dass wir in die richtige Richtung geritten sind?«, fragte Andrew, der nach den Strapazen eines langen Tages im Sattel alle Knochen im Leib spürte.
»Ganz sicher!«
»Sieht mir eher so aus, als hättest du dir einen Bären aufbinden lassen und diesen Parker mit seinem Laden gibt es überhaupt nicht«, sagte Henry Blake.
Silas schoss einen ungehaltenen Blick zu ihm hinüber. »Ich weiß, was ich gehört habe. Und ich lasse mir keinen Bären aufbinden, von keinem!«, erwiderte er gereizt. »Der Mann wusste, wovon er sprach!«
»Aber wenn deine Information und die Richtung stimmen, dann hätten wir diesen Needle Mountain doch schon längst sehen müssen!«, hielt Henry Blake ihm mit bissigem Unterton in der Stimme vor.
Silas Mortlock presste ärgerlich die Lippen zusammen, schwieg und starrte in das Buschland hinaus.
»Das Pulver und Blei, das wir uns holen wollten, können wir jedenfalls abschreiben«, fuhr Henry Blake fort. »Oder wollt ihr vielleicht noch länger durch den Busch irren? Sogar wenn es diese Station wirklich geben sollte, können wir noch tagelang durch die Gegend reiten, ohne darauf zu stoßen!«
Auch Andrew plagten heftige Zweifel, ob sie die Handelsstation wohl noch finden würden, bevor es dunkel wurde. Aber andererseits schätzte er Silas Mortlock als einen verlässlichen Mann ein. Er gehörte ganz gewiss nicht zu jenen Männern, die leichtfertig etwas daherredeten. Und die Chance, ihren kläglichen Vorrat an Pulver, Blei und Zündhütchen aufzufüllen, rechtfertigte es allemal, dass sie die Suche noch eine Weile fortsetzten.
»Auf eine Stunde mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an«, sagte er deshalb. »Wir haben noch gut anderthalb Stunden, bis die Sonne untergeht und wir irgendwo einen Lagerplatz für die Nacht suchen müssen, und die sollten wir nutzen!«
Henry Blake zuckte die Achseln. »Wie du meinst, Chandler«, sagte er, aber seine Miene ließ keinen Zweifel, dass er jede weitere Suche für zwecklos hielt.
»Gib mir noch mal das Fernrohr, Andrew!«, forderte Silas Mortlock ihn auf.
Andrew reichte ihm das zusammenschiebbare Messingfernrohr, während Henry Blake die Augen verdrehte, hatten sie das Gelände doch schon einmal sorgfältig damit abgesucht, ohne einen Hinweis auf die Station oder den Berg mit der nadelförmigen Felsspitze finden zu können.
Silas Mortlock setzte das Fernrohr ans Auge und führte es ganz langsam von Westen nach Osten über den Horizont und ebenso langsam wieder zurück.
»Ich sage euch …«, begann Henry Blake leicht genervt und wollte wohl seine Unlust an weiterer Zeitverschwendung zum Ausdruck bringen.
»Wartet mal!«, rief Silas Mortlock in diesem Moment und hielt in der Schwenkbewegung inne.
»Hast du etwas entdeckt?«, stieß Andrew hoffnungsvoll hervor und spähte in die Richtung, in die das Fernrohr zeigte. Aber alles, was er in der Ferne ausmachen konnte, war eine Gruppe von hohen Eukalyptusbäumen.
»Ja, ich glaube, da ist was!«, sagte Silas Mortlock aufgeregt. »Aber die Kronen der Bäume links von den runden Felsbrocken verwehren mir die Sicht. Ich bräuchte eine höhere Position, um Genaueres ausmachen zu können. Kommt näher und haltet mein Pferd. Dann steige ich auf den Sattel!«
»Na, dann wollen wir dem gelenkigen Akrobaten doch mal zur Hand gehen«, sagte Henry Blake spöttisch und führte sein Pferd ganz nahe an den gescheckten Wallach von Silas Mortlock heran, während Andrew ihn von der anderen Seite mit seinem Apfelschimmel in die Zange nahm.
Silas Mortlock übergab Andrew die Zügel seines Pferdes, das zwar unruhig schnaubte, als dieser nun auf den Sattel stieg, jedoch ruhig stehen blieb.
»Ich wusste doch, dass ich mich nicht geirrt habe!«, rief Silas Mortlock im nächsten Augenblick triumphierend. »Das ist er! Das muss der Needle Mountain sein. Gar keine Frage! Aber zu einem richtigen Berg fehlt ihm noch einiges an Höhe.« Er ging in die Hocke, glitt wieder in seinen Sattel zurück und sagte, zu Henry Blake gewandt: »Das zum Thema ›Richtige Richtung und sich einen Bären aufbinden lassen‹, mein Freund!«
Henry Blake verzog das Gesicht zu einem breiten Grinsen, zog seinen speckigen Lederhut und presste ihn in einer spöttischen Geste der Demut vor die Brust. »Ich nehme alles zurück und werde mich zukünftig hüten, an deinen Worten zu zweifeln.«
Andrew lachte. »Na, dann lasst uns losreiten und sehen, was uns dieser Parker verkaufen kann!«
Im Galopp ritten sie auf die Baumgruppe zu, schlugen einen Bogen um sie und sahen dahinter nicht nur den Needle Mountain, der bloß den ersten Teil seines Namens wirklich verdiente, sondern keine Viertelmeile von dem kleinen Waldstück entfernt auch die Handelsstation.
Das L-förmige Gebäude war aus rohen Baumstämmen errichtet. Die Lücken zwischen den einzelnen Stämmen bedeckte ein sehr nachlässig aufgetragenes Gemisch aus Lehm und Gras, das an vielen Stellen schon wieder herausgebröckelt war. Ein dichtes Geflecht aus Zweigen und Gras diente zusammen mit einigen Bahnen Segeltuch als Dach. Ein schwerer Hauklotz und ein Sägebock standen vor dem Haus. In dem Stamm, der über den Böcken lag, steckte eine doppelseitige Säge mit einem Holzgriff an jedem Ende. Überall lagen Zweige und Holzscheite herum sowie ein umgekippter Eimer und andere Gerätschaften, die für ein Leben im Busch von Nutzen waren, Joshua Parker und seiner Frau jedoch wenig Sorgfalt wert zu sein schienen. Ein großer billabong, ein Wasserloch von gut zwanzig Yard Durchmesser, befand sich links hinter dem Haus. Drei Schweine wühlten am Rand des niedrigen Teiches im Dreck und vor dem Haus liefen einige magere Hühner herum. An der Rückfront des kurzen Traktes, bei dem es sich allem Anschein nach um einen Stall handelte, war ein Fuhrwerk abgestellt. Eine Menschenseele war jedoch weit und breit nicht zu erblicken. Auch stieg kein Rauch aus dem mit Feldsteinen erbauten Kamin auf.
»Nicht gerade das Musterbeispiel für eine Heimstätte«, sagte Silas Mortlock spöttisch, als sie näher kamen und ihre Pferde in den Schritt fallen ließen. »Alles mehr recht und schlecht zusammengezimmert. Und das Wort ›Ordnung‹ scheint für diesen Parker und seine Frau auch ein Fremdwort zu sein.«
»Was willst du auch von einem Kerl erwarten, der sich von einem Bastard mit jeder Menge Aboriginesblut das Bett wärmen lässt«, sagte Henry Blake abfällig.
Solche verächtlichen Bemerkungen über die australischen Eingeborenen verabscheute Andrew und sie weckten seinen heftigen Widerspruch. »Die Aborigines sind nicht besser und nicht schlechter als jeder andere Mensch«, sagte er deshalb sofort, hatten er und Abby doch nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht. Abby verdankte ihnen sogar ihr Leben.
»Du sagst es«, stimmte Silas Mortlock ihm zu. »Ich für meinen Teil würde jederzeit mit Freuden einen Stamm Aborigines gegen das New South Wales Corps eintauschen!«
»Für den Handel wäre ich auch zu haben«, erwiderte Henry Blake und ließ es dabei bewenden, merkte er doch, dass seine Gefährten seine Verachtung für die Eingeborenen nicht teilten. »Und jetzt lasst uns zusehen, dass wir an unser Blei und Pulver kommen!«
Als sie vor der primitiven Handelsstation von ihren Pferden stiegen und ihre Gewehre an sich nahmen, klappte die Brettertür auf und ein stämmiger Mann um die dreißig erschien im Eingang. Er trug weite, verschmutzte Drillichhosen und über seiner nackten muskulösen, dicht behaarten Brust eine Weste aus Opossumfell. Im breiten Ledergürtel steckte links und rechts je eine Pistole. Die Zündhütchen unter den Hähnen verrieten, dass die Waffen geladen waren. Sein kantiges Gesicht war von Wind und Wetter gegerbt wie altes, rissiges Leder. Ein buschiger Walrossbart wucherte über seine Oberlippe und verdeckte fast den ganzen Mund. Ein ebenso buschiges Dickicht bildeten die Brauen über seinen Augen, die wachsam auf sie gerichtet waren.
»Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches, Gentlemen?«, fragte er mit sanftem Spott und ohne sie aus den Augen zu lassen. Wie zufällig stützte er seine Hände auf die Griffstücke seiner Pistolen.
»Wir sind auf der Jagd und wollen unsere Vorräte an Pulver und Blei auffrischen, Mister Parker«, ergriff Andrew das Wort. Nicht nur die Qualität seiner Kleidung und Ausrüstung verriet, dass er wohl kaum zum Heer der mittellosen Emanzipisten gehörte, sondern auch seine gehobene und dialektfreie Aussprache wies deutlich darauf hin, dass er eine gute Ausbildung genossen hatte. »Und ein paar Schachteln Zündhütchen könnten wir auch gebrauchen.«
»So, die Gentlemen sind an Zündhütchen, Pulver und Blei interessiert«, sagte Joshua Parker und hob leicht die buschigen Augenbrauen. »Darf ich fragen, was Sie in eine Gegend so fern von den Siedlungen unserer glorreichen Kolonie geführt hat, dass Sie mir hier Ihre Aufwartung machen?«
»Wie ich schon sagte, die Jagd«, antwortete Andrew kühl. »Aber wenn Sie kein Pulver und Blei für gutes Geld zu verkaufen haben, dann sagen Sie es uns. Dann hat man uns offensichtlich eine falsche Auskunft über Sie und Ihre Handelsstation gegeben!«
»Und von wem haben Sie diese Auskunft?«, wollte Joshua Parker wissen.
Silas Mortlock griff nun in das Gespräch ein. »Von einem Jagdfreund, dem ein Feuer die linke Gesichtshälfte verbrannt hat. William Cole ist sein Name. Aber er hat mir nichts davon erzählt, dass Sie Ihre Kunden erst einem Verhör unterziehen, bevor Sie mit ihnen Geschäfte machen!«, sagte er mit ärgerlichem Tonfall.
Joshua Parker grinste nun. »Schau an, von Billy Scarface haben Sie die Empfehlung. Na, wenn das so ist, dann lassen Sie mich doch mal sehen, was ich für Sie tun kann, Gentlemen! Kommen Sie, nur hereinspaziert!« Er stieß die Tür hinter sich mit dem Fuß auf und machte kurz eine einladende Bewegung, legte die Hand jedoch sofort wieder auf das Griffstück der Pistole zurück.
Andrew, Silas Mortlock und Henry Blake banden ihre Pferde an und blieben wachsam, als sie an ihm vorbei ins Haus traten. Augenblicklich umfingen sie Dämmerlicht und eine Vielzahl von nicht gerade angenehmen Gerüchen.
Unwillkürlich packte Andrew sein Gewehr fester. Hier draußen im Busch war es ratsam, stets auf der Hut zu sein – auch auf einer solchen Handelsstation.
Es dauerte einige Sekunden, bis sich ihre Augen an das Halbdunkel im Innern der Handelsstation gewöhnt hatten und sie Einzelheiten ausmachen konnten. Der große Raum, in dem sie sich befanden, diente den Parkers offensichtlich gleichzeitig als Laden, Lagerraum und Wohnbereich. Zu ihrer Rechten stand quer zur Länge des Raums so etwas wie eine Ladentheke. Joshua Parker hatte dazu vier Böcke aufgestellt und rohe Bretter darüber gelegt. Primitive Regale befanden sich dahinter sowie rechts von der Tür. Sie waren mit Säcken, Dosen, Flaschen, Schachteln und Kisten unterschiedlicher Größe in kunterbunter Unordnung vollgestellt. Es standen auch größere Tonnen und Kisten im Raum herum. An der Wand gegenüber dem Eingang waren Felle von Opossums, Kängurus, Wombats und anderen Tieren aufgestapelt und verbreiteten einen intensiven, unangenehmen Geruch nach verwesten Fleischresten.
Vor diesem Stapel Felle lag ein nackter Aborigine mit dreckverfilztem Haar, der mit weit geöffnetem Mund dort am Boden schlief. Das einzige Kleidungsstück war ein dreckiger Felllappen, der seine Scham bedeckte. Sein hagerer Körper trug Spuren der typischen Eingeborenenbemalung mit rotbrauner und weißer Lehmfarbe. Seine rechte Hand hielt den Hals einer leeren Flasche umfasst. Hinter ihm lehnte ein langer Speer an der Wand.
Einen Schritt weiter rechts von den Fellen und dem schlafenden Aborigine baumelten zwei Hängematten, die mit Ketten oben an den Dachbalken befestigt waren und in denen Decken in einem unordentlichen Durcheinander lagen. Jenseits dieser Schlafgelegenheit machte Andrew eine Kochstelle am Kamin und davor zwei primitive Sitzgelegenheiten sowie eine Tür aus, die wohl in den angrenzenden Stall führte.
»Murtamoo2!«, brüllte Joshua Parker in die Richtung der Hängematten. »Hoch mit deinem fetten Arsch! … Akamarie! … Hoch mit dir! … Na los, sieh zu, dass Taipan seinen Rausch gefälligst draußen ausschläft! Der Schmarotzer hat mal wieder mehr Rum gesoffen, als die verdammten Felle wert sind, die er angeschleppt hat!«
Sofort geriet in der zweiten Hängematte Bewegung in das Durcheinander der Decken und eine junge Frau in einem billigen, geblümten Kattunkleid kam darunter zum Vorschein. Trotz ihrer strähnigen blonden Haare sah man ihr auf den ersten Blick an, dass viel Aboriginesblut in ihren Adern floss und sie das Mischlingskind eines weißen Vaters oder einer weißen Mutter war.
»Cull-la! … Mach ich ja schon, Master Parker«, nuschelte die Frau schläfrig. Mit nackten Füßen ging sie zu dem betrunkenen Eingeborenen namens Taipan hinüber, rüttelte ihn mühsam wach und half ihm auf die Beine. »War i atyan, Taipan!« Leise redete sie in der Aboriginesprache auf ihn ein und zog den taumelnden Mann zur Tür.
»Ihre Frau?«, fragte Henry Blake sarkastisch und überflüssigerweise.
Der Händler bedachte ihn mit einem scharfen Blick, würdigte ihn jedoch keiner Antwort, sondern begab sich hinter den langen Brettertisch. »Also, kommen wir zum Geschäft, Gentlemen. Sie wollen Pulver, Blei und Zündkapseln. Gut, damit kann ich Ihnen dienen. Wie viel soll es denn sein?«
»So viel Sie entbehren können«, antwortete Andrew und trat mit seinen Gefährten zu ihm vor den Tisch.