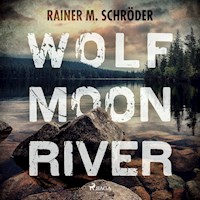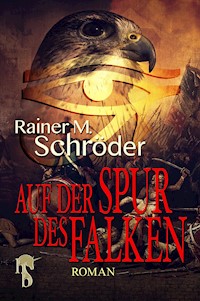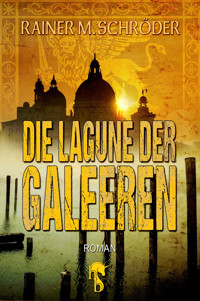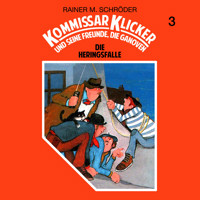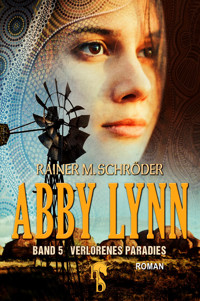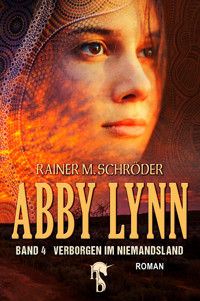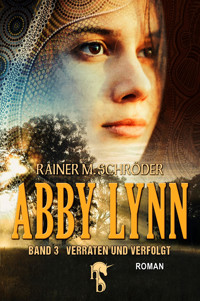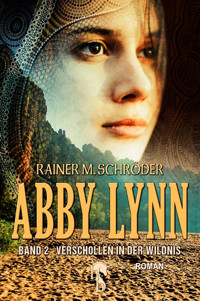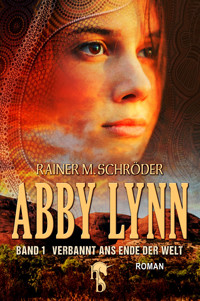6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Vier Highschool-Freunde sind zu einem Kanuausflug in die kanadische Wildnis von British Columbia aufgebrochen. Doch die Tour wird zum Albtraum. Jack weiß nicht mehr genau, wie es zu dem Drama kam, nur, dass er vor seinen ehemaligen Freunden Scott und Frank fliehen muss … und findet sich in den Stromschnellen des Wolf Moon River wieder. Am Ufer des reißenden Flusses endet durch einen tragischen Unfall auch der Flug der 15-jährigen Olivia, der neuen Freundin ihres Vaters und deren Sohn Patrick zu einem Treffen mit Olivias Vater, der in seiner Blockhütte auf sie wartet. Olivia und der widerstrebende Patrick müssen sich wohl oder übel zusammenraufen, um den gefährlichen Weg entlang des Flusses zu meistern, um Hilfe für Patricks verletzte Mutter zu holen. Es kommt zu einer schicksalhaften Begegnung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Wolf Moon River
Roman
1
Jack Larson fühlte sich hundeelend und der fürchterliche Kater hatte damit noch am wenigsten zu tun. Was hätte er dafür gegeben, wenn sein erbärmlicher Zustand nur die gerechte Quittung für ein übermäßiges Besäufnis gewesen wäre! Die bohrenden Stiche im Kopf, den ekelhaft pelzigen Belag auf der Zunge und die magensaure Übelkeit hätte er nur zu bereitwillig ertragen, wenn das wüste Durcheinandertrinken letzte Nacht das Einzige gewesen wäre, was er jetzt im Morgengrauen zu bereuen gehabt hätte!
Aber sein Elend war nicht von der harmlosen Sorte. Er steckte in wirklich ernsten Schwierigkeiten. Und zwar in Schwierigkeiten, die so beklemmend waren, dass er noch nicht gewagt hatte, sich die Konsequenzen bis ins Letzte vor Augen zu führen. Was da am Ende der Gedankenkette auf ihn wartete, war einfach zu erschreckend und so ausweglos, dass er sich jetzt nicht damit beschäftigen konnte.
Unmöglich!
Aber natürlich lauerte das Wissen darüber in seinem Hinterkopf. Es durfte nicht sein, dass er jetzt schon sein Leben verpfuscht hatte! Er hatte doch gerade erst die Highschool absolviert und sein achtzehnter Geburtstag lag nicht mal ein halbes Jahr zurück!
Nein, er durfte sich jetzt nicht in sinnlosen, angsterfüllten Überlegungen verlieren und die Sache dadurch restlos vermasseln! Er musste die Nerven bewahren, wenn er noch eine Chance haben und das Ding drehen wollte. Ein Schritt nach dem anderen! Später war Zeit genug, nach einem Ausweg zu suchen! Und einen solchen würde er bestimmt finden. Immerhin gab es in seinem Elend doch schon jetzt einen ersten Schimmer Hoffnung, denn er war frei!
Frank und Scott hatten sich für clever gehalten, als sie ihn hier unten einsperrten, hinter dieser angeblich bärensicheren Bohlentür. Aber sie waren ganz schön breit gewesen, wenn auch nicht so sternhagelvoll wie er. Egal, sie hatten es jedenfalls versäumt, ihm sein Feuerzeug abzunehmen. Das war ihr erster Fehler gewesen. Der zweite bestand darin, sich nicht vergewissert zu haben, dass sich in diesem stinkenden Keller mit seinen Bretterregalen voller verstaubter Einmachgläser und all dem anderen Gerümpel nichts verbarg, was ihm zum Ausbruch verhelfen konnte. Hätten sie es getan, wären sie schnell auf den verschrammten Holzkasten hinten in der Ecke unter einem Stoß halb verschimmelter Fensterrollos aus Bast gestoßen. Der Holzkasten enthielt einen Haufen altes Werkzeug. Und weil Frank und Scott diese beiden schweren Fehler begangen hatten, hatte er es ziemlich problemlos geschafft, sich aus dem Gefängnis unter dem Bretterschuppen zu befreien!
Er ließ das Werkzeug fallen, mit dem er die rostigen Scharniere der Kellertür aus dem Türrahmen gestemmt hatte. Erschrocken fuhr er bei dem lauten metallischen Scheppern zusammen, als der Schraubenzieher und das Schäleisen auf die drei herausgebrochenen Scharniere fielen. Für einen kurzen Moment fürchtete er, sich verraten und alles vermasselt zu haben. Dann jedoch rief er sich in Erinnerung, dass Frank und Scott das Geräusch unmöglich gehört haben konnten, stand der Bretterschuppen doch gute zehn, zwölf Meter vom Blockhaus entfernt, wo sie jetzt bestimmt noch oben in ihren Stockbetten lagen und ihren Rausch ausschliefen. Und Nachbarn gab es nicht. Sie waren hier in der tiefen kanadischen Wildnis, quasi am Arsch der Welt, zumindest der Welt von British Columbia. Und genau das war das nächste Problem, das er lösen musste, wenn er es aus diesem Dreckloch geschafft hatte.
Aber immer eins nach dem andern!
Jack Larson packte die Tür, zerrte sie mit aller Kraft auf. Es knirschte und ächzte im Türstock auf der anderen Türseite, wo außen noch der breite und mit einem Vorhängeschloss gesicherte Eisenriegel vorlag. Dank des Hebeldrucks gelang es ihm, das Eisenblatt so weit zu biegen, dass er sich durch einen Spalt hinaus in den Schacht mit der Außentreppe zwängen konnte. Sie führte auf der Ostseite des Schuppens hinauf ins Freie. Der Schacht selbst konnte durch zwei Klappen aus dicken Bohlenbrettern mit einem Schieberiegel verschlossen werden wie bei den Tornado-Schutzkellern im Mittleren Westen. Aber zu seinem großen Glück hatten Frank und Scott diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für unnötig erachtet.
Kühle Herbstluft schlug ihm entgegen, als er zitternd die Stufen hinaufstieg, und legte sich wie ein kaltes, belebendes Tuch auf sein verschwitztes Gesicht. Die erste Woche im September war angebrochen, und in der Luft lag schon die Ahnung, dass die Zeit der sonnendurchglühten Tage vorbei war und der eisige Frost des kanadischen Winters nicht mehr lange auf sich warten lassen würde.
Oben hielt er kurz inne und blinzelte mit keuchendem Atem in den grauen Dunst des frühen Morgens.
Er war wirklich frei! Und jetzt lag es in seinen Händen, welchen Verlauf sein Schicksal von hier aus nahm. Die Schwere dieser Erkenntnis ließ Jack Larson stärker frösteln als die kalte Morgenluft.
2
Olivia Wickersham lag schon eine ganze Weile wach im Bett. Mittlerweile war der neue Tag nicht mehr fern, wie die Geräusche der ersten Autos verrieten, die aus der Stille der Nacht auf der Mainstreet von Glendale Falls auftauchten und unten vorbeifuhren. In dem alten, aber liebevoll gepflegten Haus von Onkel Vincent und Tante Becky, das sich auf der Mainstreet gleich an den von ihnen betriebenen Hardware Store anschloss, herrschte noch nächtliche Ruhe, wenn wohl auch nicht mehr für lange. Das einzige schwache Licht im Raum kam von den Leuchtziffern ihres kleinen, batteriebetriebenen Radioweckers.
Olivia fühlte sich in der Dunkelheit geborgen wie in einem samtweichen Kokon, beschützt vor allem Schlechten und Bösen der Welt. Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren, als sie neun geworden war, hatte sie zum ersten Mal Zuflucht in einem dunklen Raum gesucht. Und seitdem empfand sie die Dunkelheit wie einen treuen, verlässlichen Freund, der sie mit Mauern undurchdringbarer Finsternis schützte und sie innerlich zur Ruhe kommen ließ, wenn sich in ihr mal wieder alles in heillosem Aufruhr befand.
Die Hände im Nacken verschränkt und die warme Daunendecke bis zum Kinn hochgezogen, blickte sie zur Zimmerdecke hinauf und ließ ihre Gedanken träge dahintreiben. Manchmal folgte sie ihnen für eine kurze Weile, dann ließ sie sie weiterziehen und wartete auf das, was ihr als Nächstes durch den Kopf ging.
Einige dieser Gedanken tauchten in jenem gemächlich dahinfließenden Strom wiederholt auf, sprangen wie aus dem Hinterhalt unverhofft hervor und wollten sich rücksichtslos zurück in den Vordergrund drängen. Es waren ihre Dämonen, wie sie sie nannte, und sie fand, dass sie diese Bezeichnung zu Recht trugen. Und wie es Dämonen nun mal zu eigen war, wollten sie sich in ihrem Bewusstsein festkrallen, sie mit bösartiger Verbissenheit zwingen, sich ihnen auszuliefern, und ihr für nichts anderes mehr Raum lassen. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte sie nicht einmal versucht, Widerstand zu leisten, sondern sich willig in die Abgründe jener schauderhaften Schreckensbilder ziehen lassen. Und zwar bis an die Grenze zur Selbstzerstörung.
Aber diese schrecklichen Jahre lagen hinter ihr, zumindest war sie entschlossen, einen Rückfall in jene einstigen Zustände nicht zuzulassen. Sie hatte gelernt, wie sie die Dämonen in ihrem Kopf in die Schranken weisen und es ihnen verwehren konnte, ihr ganzes Sinnen und Trachten zu beherrschen und sie zu lähmen.
Nein, das würde sie nie wieder zulassen! Für ihr neues Leben hatte sie zu viel Blut gelassen und zu viele Schmerzen ertragen, als dass diese ewigen trüben Grübeleien es zunichtemachen durften! Und damit verjagte Olivia Wickersham ihre Dämonen dorthin zurück, wo sie hingehörten, nämlich in die tiefste Tiefe ihres Bewusstseins.
Intensiver Kaffeeduft zog durch das Haus, stieg ihr in der Dunkelheit verlockend in die Nase und sagte ihr, dass Onkel Vincent schon auf war und unten in der Küche sein pechschwarzes Gebräu aus stark gerösteten Jamaikabohnen durch den Filter laufen lief, das er dann auch noch schwarz und pur trank. Sie selbst machte sich nichts aus Kaffee, aber sie liebte den herrlich aromatischen Duft, der irgendwie etwas Belebendes und Verheißungsvolles hatte, insbesondere am frühen Morgen, wenn das erste milde Licht sich über die Landschaft legte und allem einen weichen, friedvollen Schein verlieh.
Olivia blickte auf die Uhr neben dem Bett, wo genau in diesem Moment die Anzeige auf 6:18 umsprang. Nach dem Kalender war genau jetzt Sonnenaufgang in Glendale Falls und damit Zeit für sie, das warme Bett zu verlassen. Spätestens um kurz nach sieben musste sie unten am Seeufer sein und am Pontonanleger von Harold Gilroys Thunderbird Air Service auf ihre Gäste Catherine Sherwood und deren Sohn Patrick warten.
Obwohl, wirkliche Gäste waren die beiden ja nicht. Gäste kamen für ein paar Tage auf Besuch und verschwanden dann wieder, kehrten zu ihrem eigenen Leben zurück. Das hier war anders, auch wenn es angeblich »nur« darum ging, gemeinsam das verlängerte Labour-Day-Wochenende oben in der idyllischen, aber abgeschiedenen Blockhütte am Lake Anderson zu verbringen. Zum besseren gegenseitigen Kennenlernen, wie Dad es ausgedrückt hatte, mit einem breiten und doch etwas verlegenen Lächeln auf dem Gesicht.
Olivia schlug die Bettdecke zurück und lief in ihrem warmen Flanellpyjama hinüber ins Gästebad, wo sie sich unter die Dusche stellte. Dabei nahm sie den Gedanken, der sie gerade beschäftigt hatte, wieder auf und grübelte, was Catherine Sherwood denn nun war – für ihren Dad.
Sie war zugegebenermaßen eine recht attraktive Frau von Mitte vierzig und schien dem ersten Eindruck nach ganz okay zu sein, was aber nicht viel hieß. Denn bisher hatte sie Catherine Sherwood nur einmal kurz in Vancouver getroffen. Und bei dem gerade mal halbstündigen Treffen im Starbucks an der Ecke Robson und Thurlow Street hatte ihr Dad die meiste Zeit geredet. Was eigentlich gar nicht seine Art war und ihr verraten hatte, wie nervös er gewesen war. Aber es war ihm wichtig gewesen, dass sie Catherine endlich kennenlernte.
War sie die neue Flamme, die Freundin, die Geliebte, die zweite große Liebe ihres Vaters?
Aber nein, die neue Flamme konnte sie nicht sein. Denn das setzte ja voraus, dass es im Leben ihres Vaters vor Catherine schon andere Flammen gegeben hatte. Hatte es aber nicht. Jedenfalls ihres Wissens nicht. Gut möglich, dass es in den letzten Jahren flüchtige Affären oder One-Night-Stands gegeben hatte. Aber eine auch nur halbwegs ernste Beziehung war in den fast sechs Jahren seit dem Tod ihrer Mutter mit Sicherheit nicht darunter gewesen. Das hätte er nicht vor ihr verheimlichen können. Nicht ihr Dad, der der schlechteste Schauspieler der Welt war, was das Verbergen von Gefühlen betraf!
Also was war diese Catherine Sherwood, die zusammen mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Patrick vier Tage bei ihnen in der Blockhütte am Lake Anderson verbringen würde – und nachts dort das Bett mit ihrem Dad teilte?
Womöglich meine zukünftige Stiefmutter!, fuhr es Olivia durch den Kopf, während sie das Wasser abstellte, aus der dampfenden Dusche trat und sich abtrocknete. Sie wusste nicht, ob diese Vorstellung sie schockierte oder ihre Zustimmung fand. Irgendwie beides. Mit neunundvierzig war ihr Dad zu jung, um für den Rest seines Lebens Witwer zu bleiben. Sie wusste, dass er Mom nie vergessen und sie für ihn immer die große Liebe bleiben würde. Sein Schmerz und seine Verzweiflung über ihren Tod hatten lange die eine Hälfte ihres alltäglichen Lebens ausgemacht, und als hätten sie beide daran nicht schon schwer genug zu tragen gehabt, war dann auch noch die Sache mit ihr dazugekommen und hatte alles nur noch schmerzvoller und zermürbender gemacht. Deshalb wünschte sie ihrem Dad auch das Glück einer zweiten Liebe, kämpfte aber gleichzeitig dagegen, dass eine fremde Frau ihre Mutter ersetzen … nein, nicht ersetzen, aber doch ihre Bedeutung im Leben ihres Vaters einnehmen sollte.
Warten wir es ab!
Olivia schob den zwiespältigen Gedanken beiseite, putzte den beschlagenen Spiegel und schenkte ihrem eigenen Abbild ein schiefes, müdes Grinsen. Nicht gerade die umwerfende Offenbarung von makelloser Schönheit, die ihr da entgegenblickte! Sie hatte weiß Gott schon mal besser ausgesehen.
Ja, wirklich? Fragt sich nur, wann!, ging es ihr durch den Kopf. Und als ob das als Dämpfer am frühen Morgen nicht schon reichte, fiel ihr Blick, als sie das Handtuch aufhängte, auch noch auf die Waage, die in der Ecke rechts vom Waschtisch stand. Sie zog die Unterlippe zwischen die Zähne und rang kurz mit sich selbst, ob sie sich das wirklich antun und auf die Glasplatte steigen sollte. Um die erhebende Gewissheit zu haben, dass sie wieder ein, zwei Pfund mehr auf den Hüften hatte?
»Das lassen wir besser mal bleiben«, murmelte sie und sah zu, dass sie so schnell wie möglich aus dem Bad kam. Zum Glück brauchte sie für ihre kurzen Haare nicht lange, um sie trocken zu föhnen. Zurück in ihrem Zimmer zog sie sich schnell an. Dann steckte sie den Radiowecker in ihren Rucksack, der fertig gepackt neben der Tür stand, hängte ihn sich mit einem Gurt über die Schulter und eilte hinunter in die Küche.
Und plötzlich, als sie an die alte Blockhütte am Ufer des Lake Anderson dachte, die sich schon seit drei Generationen im Besitz ihrer Familie befand, verflog der Unmut und Kummer, der sie gerade im Bad ob ihrer körperlichen Unzulänglichkeiten befallen hatte, und sie freute sich auf den bevorstehenden Flug und das lange Wochenende dort oben in der Wildnis!
3
Die Sonne verbarg sich noch hinter den hohen und dicht bewaldeten Bergketten jenseits der dunklen, weiten Fläche des Lake Cariboo. Morgennebel hing in milchigen Schleiern über dem See, der zu dieser frühen, windstillen Stunde einem riesigen schwarzen Spiegel glich. Aber die tiefe Dunkelheit der Nacht war schon einem fahlen Zwielicht gewichen, das durch die Wipfel der fernen Schwarzkiefern sickerte, und je mehr sich der Himmel im Osten über den Bergkämmen aufhellte, desto mehr verblassten die Sterne. Nicht mehr lange, und die Sonne würde mit Macht hinter den Bergen hervorbrechen.
Jack Larson atmete die kalte Morgenluft tief ein. Nach dem Gestank im Keller, zu dem sein Erbrochenes und sein Urin nicht unwesentlich beigetragen hatten, tat es gut, die Lungen mit klarer und fast schon frostiger Luft vollpumpen zu können. Er hoffte, dass die Morgenkühle ihn auch von den stechenden Kopfschmerzen erlöste, zumindest von denen der übelsten Sorte. Denn noch war ihm, als wäre sein Schädel in einen Schraubstock gespannt und stünde kurz vor dem Zerplatzen. Auch quälte ihn ein fürchterlicher Durst. Sein Mund fühlte sich wie ausgedörrt und mit Watte ausgestopft an und sein Hals kratzte wie mit Sandpapier ausgeschlagen.
Er wankte schon hinüber zum Blockhaus, in dem es passiert war. Das Gebäude erhob sich auf einer kleinen Anhöhe gute fünfzig Meter vom Seeufer entfernt und war aus mächtigen Baumstämmen errichtet. An den Hausecken ragten die Enden der Stämme ein Stück hervor und lagen nach Sattelkerben-Bauart fugendicht aufeinander. Das recht komfortable Haus verfügte über ein ausgebautes Obergeschoss und gehörte Franks Onkel. Der Strom kam von den großen Feldern mit Solarzellen, die sich über die gesamte Dachfläche der Längsfront erstreckten und nach Süden hin ausgerichtet waren. Reichten Strom oder Spannung nicht, sprang ein Dieselgenerator an, der außerhalb des Hauses im Schuppen untergebracht war.
Jack Larson wollte seinen Durst am Außenwasserhahn neben der überdachten Veranda stillen. Gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, dass dann womöglich die Pumpe ansprang, die dafür sorgte, dass der Trinkwassertank im Haus aus dem eigenen Brunnen immer gut gefüllt und stets genug Druck auf den Leitungen war. Und diese Pumpe war alt, machte einen höllischen Krach und würde Frank und Scott bestimmt aus dem Schlaf holen.
Das durfte auf keinen Fall passieren! Dann war sein Ausbruch aus dem Keller vergeblich gewesen. Denn Frank und Scott, die er für seine Freunde gehalten hatte, waren seit letzter Nacht zu seinen schlimmsten Feinden geworden. Niemanden musste er mehr fürchten als sie!
Er hastete schnell hinunter zum Bootssteg, der gute zwanzig Meter auf den See hinausführte. Ihre beiden Kanadier-Kanus, das eine waldgrün, das andere dunkelrot und beide erstklassige Mohawks, lagen an Land gezogen im taunassen Gras und mit dem Unterboden nach oben neben dem Steg. Die Paddel lagen im Schutz der Bootswölbung auf den Holmen der Kanus, festgeklemmt unter Spanngurten.
Hastig kniete er sich hin, schöpfte mit den Händen klares Seewasser, schlug es sich ins Gesicht, kippte es sich über den Kopf und trank es in gierigen Schlucken. Es hatte einen leicht erdigen Geschmack, aber er nahm ihn nur unbewusst wahr. Seine Aufmerksamkeit galt dem östlichen Horizont, der sich blaugrün verfärbte und im nächsten Moment schon einen dünnen Streifen rötlichen Glühens erkennen ließ. Er musste sich beeilen und von hier verschwunden sein, bevor es heller Tag wurde.
Aber dafür musste er sich erst einmal ins Haus wagen! Er brauchte Proviant und auch ein paar Klamotten, am besten auch noch eins ihrer Zweimann-Zelte. Sie steckten hier am Lake Cariboo tief in der kanadischen Wildnis von British Columbia. Fünf Tage hatten sie für den Hinweg auf dem Blackwater River gebraucht. Selbst wenn er sich nur wenige Pausen gönnte, sich nicht schonte und paddelte, solange es dafür hell genug war, würde er mindestens drei elend lange Tage brauchen, bis er zurück in die bescheidene Zivilisation von Glendale Falls kam, wo er seinen klapprigen Subaru Outback abgestellt hatte und wo sie vor sieben Tagen zu diesem unheilvollen Kanu-Trip in den kanadischen Nordwesten aufgebrochen waren.
Zu sechst waren sie damals noch gewesen – und gute Freunde. Nun sah die Welt völlig anders aus. Nichts galt mehr, was er vor sieben Tagen noch für unumstößlich gehalten hatte.
Jack Larson rannte zum Blockhaus zurück, schlich hinauf auf die Veranda, wo vier rustikale Schaukelstühle nebeneinander aufgereiht standen, und zog das Fliegengitter auf. Als sie vorgestern hier eingetroffen waren, hatte es so fürchterlich gequietscht, dass Scott es sofort geölt hatte – und die Haustür gleich mit.
Welch eine Ironie, dass er ihm jetzt dafür dankbar sein musste, hätte er sich andernfalls doch nicht ins Haus wagen können! Er blockierte das Fliegengitter, damit es nicht hinter ihm zufiel, öffnete die Haustür und trat ins Haus, ohne auch diese Tür hinter sich zuzuziehen. Er wollte sich seinen Fluchtweg offen halten und notfalls nicht eine Sekunde mit dem Aufstoßen von Türen verlieren.
Nach der frischen kalten Morgenluft wurde ihm fast übel, als ihm schon an der Tür ein Schwall von ekelhaftem Mief entgegenschlug. Er umfing ihn förmlich, kaum dass er zwei, drei vorsichtige Schritte in den weiträumigen und nach oben zum Dach hin halb offenen Wohnraum gemacht hatte. Es war mehr als nur verbrauchte, abgestandene Luft, die sich ihm auf die Brust legte und ihm Übelkeit bereitete. Es war ein Gestank, der sich aus altem Bratenfett, durchgeschwitzter Kleidung, Anti-Insektenspray, schalem Dosenbier, Zigarettenrauch und kalter Asche zusammensetzte. Die Mischung erinnerte ihn an die Schrecken der Nacht und ließ ihn würgen.
Nur durch den Mund atmen!
Er verharrte einige Sekunden reglos im Raum, starrte hinauf zur Galerie im zweiten Geschoss, von der aus die beiden oberen Schlafzimmer abgingen. Das dritte Schlafzimmer, in dem … in dem es passiert war, lag unten, gleich hinter der Treppe.
Mit wild jagendem Herzschlag lauschte er angespannt in das Dämmerlicht. Es wurde vom Stand-by-Licht der Kaffeemaschine in der zum Wohnraum hin offenen Küche und dem der Stereoanlage beim Kamin aufgehellt. Es erstaunte ihn einmal mehr, wie viel Licht doch diese winzigen Leuchtdioden der elektrischen Haushaltsgeräte abgaben.
Es war still im Haus. Aber diese Stille hatte etwas Spannungsgeladenes und Bedrohliches, als könnte sie gleich in schrillen Terror umschlagen.
Doch nichts geschah.
Das Einzige, was er hörte, waren sein keuchender Atem und das Rauschen in seinen Ohren, das im Rhythmus seines jagenden Herzens an- und abschwoll.
Worauf wartest du, verdammt noch mal? Steh nicht herum! Beeil dich!, riss ihn eine innere Stimme aus seiner Starre.
Er huschte hinüber in die Küche. Sein Schlüsselbund lag mit den Schlüsseln von Frank und Scott und anderem persönlichen Kleinkram neben der Kaffeemaschine in einer Plastikschale. Behutsam zog er ihn heraus und steckte ihn ein. Führerschein, Versicherungskarte, hundertfünfzig Dollar in bar und seine Kreditkarte mussten noch wasserdicht verpackt in der Reißverschlusstasche seiner Goretex-Hose stecken. Zum Glück hatten Frank und Scott ihn gestern Nacht nicht splitternackt aus dem Haus gezerrt und unter dem Schuppen eingesperrt, sondern ihm erlaubt, Schuhe und Kleidung vom Boden aufzuklauben und sich anzuziehen. Aber um ganz sicherzugehen, fasste er nach der Tasche an seinem rechten Oberschenkel und spürte erleichtert, dass er sich nicht geirrt hatte. Es war alles da.
Aber nicht sein Handy.
Das lag noch oben in seinem Zimmer und dort würde er es auch zurücklassen müssen. Wie auch seine Klamotten. Denn all das befand sich ebenso im Obergeschoss. Und das war unerreichbar für ihn. Er würde auf sein Handy verzichten und im Freien übernachten müssen, so wie die Dinge lagen.
Verdammter Mist! Sich nach oben in sein Zimmer zu schleichen, kam nicht infrage. Die Bohlen der Treppe knarrten zu laut, als dass er dieses Risiko eingehen konnte.
Nein, so bescheuert würde er nicht sein! Er würde sich eben das coole, brandneue iPhone nehmen, mit dem Frank die letzten Tage so oft angegeben und das er hier unten zum Aufladen über der Küchentheke eingesteckt hatte.
»Geschieht dir recht!«, murmelte Jack Larson grimmig, trennte das Smartphone vom Ladekabel, packte es zum Schutz vor Wasser in einen kleinen Gefrierbeutel und steckte es sich in die linke Oberschenkeltasche. Sein Blick fiel auf die aufgerissene Sechserpackung mit Wegwerffeuerzeugen neben der Kaffeemaschine. Er griff sich drei heraus, er würde sie brauchen.
Indessen glitten draußen die ersten Sonnenstrahlen wie tastende Lichtfinger über den See, erreichten das Ufer mit dem Bootssteg und den beiden Kanus, krochen den kleinen grasbewachsenen Hang hinauf und stiegen an der Vorderfront des Blockhauses zu den Fenstern hoch.
Er hatte plötzlich das beunruhigende Gefühl, sich schon viel zu lange im Blockhaus aufgehalten zu haben und sein Glück zu hart auf die Probe zu stellen.
Proviant!, ermahnte er sich. Schnell und nur das Nötigste! Und dann nichts wie weg!
Auf Zehenspitzen schlich er hinüber zur angrenzenden Vorratskammer. Dort hatten sie ihre Dry Bags deponiert, ihre wasserdichten Beutel und Säcke aus robuster, gelber und roter PVC-Plane, in denen sie ihren Proviant, Wechselkleidung und alle anderen Ausrüstungsgegenstände transportiert hatten. Was hätte er jetzt dafür gegeben, wenn sie hier unten auch ihre Coleman-Campingkocher, die Brennstofftabletten aus Trockenspiritus und das Alu-Geschirr, das wie die Puppen in der Puppe ineinanderpasste, aufbewahrt hätten. Aber all der Kram befand sich zusammen mit den Zelten, Isomatten und den Schlafsäcken im Obergeschoss – und damit für ihn außer Reichweite.
Er wählte zwei gelbe Zwanzig-Liter-Beutel mit Trageriemen und Spanngurten aus, kehrte zurück in die Küche, öffnete alle Schränke und füllte die beiden Dry Bags hastig mit Lebensmitteln, die wie Energieriegel und Müsli schnell satt machten, nicht viel Platz einnahmen und wenig Gewicht hatten. Deshalb ließ er auch die Finger von den Konserven, bis auf drei Dosen mit Frühstücksfleisch mit einem auf dem Deckel angebrachten Dosenöffner.
Plötzlich wurde direkt über ihm eine Tür geöffnet und Dielenbretter knarrten unter schlurfenden Schritten.
Jack Larson fuhr erschrocken zusammen und erstarrte. Frank oder Scott war aufgewacht und kam aus dem Zimmer!
In einem Reflex, den seine jäh aufflammende Angst auslöste, griff er zu einem der großen Messer, die neben dem Herd in einem Messerblock steckten.
Die Gedanken jagten sich hinter seiner Stirn. Egal, wer da oben auf der Galerie war, wenn er jetzt hinunter in die Küche wollte, weil er nach dem vielen Bier, dem verdammten Wodka und Wild Turkey-Whisky fürchterlichen Brand hatte und sich eine kalte Coke aus dem Kühlschrank oder ein Glas Eiswasser holen wollte, dann war er, Jack Larson, geliefert!
Aber dann wird dir das Messer auch nicht viel nützen!, ermahnte ihn die innere Stimme. Der sieht dich doch schon, kaum dass er halb die Treppe herunter ist. Hier unten ist doch alles offen. Er wird seinen Kumpel oben mit seinem Geschrei alarmieren, sowie er dich entdeckt! Und willst du dann mit dem Messer auf sie los? Vergiss es! Und wenn es Frank ist, hast du sowieso keine Chance!
Seine Hand mit dem langen Fleischmesser zitterte. Er starrte hoch zur Decke, konzentrierte sich auf das Knarren der Dielenbretter auf der Galerie über ihm. Ihm war, als hätte sich sein Körper zu einem einzigen schmerzhaften Knoten verkrampft.
Kommst du runter oder willst du nur aufs Klo?
Geh verdammt noch mal bloß pinkeln!
Zwei, drei Sekunden würgender Angst verstrichen und sie erschienen ihm wie eine qualvolle Ewigkeit. Dann hörte er, wie die schlurfenden Schritte sich nicht in Richtung der Treppe von der Zimmertür entfernten, sondern zum oberen Bad hin am anderen Ende der Galerie.
Vor Erleichterung wurden ihm die Knie weich. Er lehnte sich Halt suchend an den Herd, während oben die Tür zum Bad quietschte und der Klodeckel laut hochklappte. Schnell steckte er das Messer in den Holzblock zurück. Er wusste, dass er aus dem Blockhaus verschwunden sein musste, bevor Frank oder Scott dort oben seine Blase entleert und abgezogen hatte. Denn Gott allein wusste, ob er danach nicht doch noch auf die Idee kam, sich hier unten etwas zu trinken zu holen!
In fieberhafter Eile zog Jack die Dry Bags zu, während es über ihm in der Kloschüssel laut plätscherte, warf sich die PVC-Beutel an den Riemen über die Schulter und hastete zur offen stehenden Tür. Auf dem Weg dorthin sah er Scotts Survivalmesser mit seiner abgegriffenen, speckigen Lederscheide, das Scott zusammen mit seinem kleinen Feldstecher auf einem Seitentisch neben einem der Wohnzimmersessel abgelegt hatte. Er nahm beides im Vorbeieilen an sich und war für einen flüchtigen Moment richtig stolz auf sich, dass er Messer und Feldstecher trotz seiner nervlichen Anspannung nicht übersehen hatte. Er würde es auf seiner Flucht bestimmt verdammt gut gebrauchen können.
Was auch für wetterfeste Kleidung galt!
Er schwankte kurz, ob er es nicht doch noch wagen sollte, hoch in seine Kammer zu schleichen, um sich seinen Schlafsack zu schnappen und die warme Kleidung aus dem Schrank zu holen. Aber diesen Gedanken verwarf er sofort wieder und zerbiss einen Fluch zwischen den Zähnen. Das Risiko war einfach zu groß, selbst wenn die Treppe nicht so laut geknarrt hätte. Jeden Moment konnte einer seiner einstigen Kumpel da oben auf der Galerie auftauchen und ihn entdecken. Und dann war alles vergeblich gewesen!
Aber neben der Tür hingen zwei Softshell-Regenjacken aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Hightech-Material am Garderobenhaken. Seine befand sich nicht darunter. Sie hing natürlich oben in seinem Zimmer hinter der Tür. Er zögerte jedoch nicht lange und schnappte sich Franks Jacke. Sie war ihm vermutlich eine Nummer zu groß, aber das war immer noch besser als die von Scott, die ihm um einiges zu klein sein würde. Hauptsache, er hatte eine warme Jacke! Und was die kalten Nächte betraf, so würde er sie schon irgendwie überstehen. Würde er sich eben ein Feuer machen und sich daran wärmen. Vielleicht paddelte er ja auch die Nächte durch und ruhte sich am Tag aus. War er erst auf dem Blackwater River, konnte er sich ja nicht verirren, und gefährliche Stromschnellen warteten dort auch nicht auf ihn.
Mal sehen, wie ich’s angehe. Wird schon irgendwie klappen!
Als er sich die Softshell-Jacke unter den Arm klemmte, fiel sein Blick für einen Moment in den Garderobenspiegel, dessen Rahmen mit Baumborke verziert war. Das Abbild des jungen Mannes von schlanker, sehniger Gestalt, dem nasse Strähnen seines wild zerzausten und dreckigen strohblonden Haars auf der Stirn klebten, war ihm erschreckend fremd. Er starrte in das schmale und blasse Gesicht, das ihm mit blutunterlaufenen und angstgeweiteten Augen aus dem Spiegel entgegensprang, und schauderte.
Was hast du getan?, fragte er den Fremden im Spiegel, und erneut lief es ihm kalt den Rücken hinunter. Wie konntest du nur so etwas Entsetzliches tun? Sag es! Rede mit mir! Du da bist nicht ich! Ich kenne dich nicht!
Der Bann brach, als er hörte, wie oben im Bad die Spülung rauschte. Er riss sich von seinem Spiegelbild los, huschte hinaus und zog die Haustür behutsam hinter sich ins Schloss. Dann rannte er hinunter zum Bootssteg und den Kanus. Dabei hängte er sich den kleinen Feldstecher an der Schnur um den Hals. Das Survivalmesser klemmte er sich hinter den Gürtel.
Er nahm das rote Mohawk, mit dem er vertraut war und für das er beim Outfitter in Glendale Falls auch den Leihvertrag unterschrieben hatte, zog das Paddel darunter hervor und drehte das Kanu rasch herum. Dann warf er die beiden Dry Bags und die Jacke ins Boot. Entschieden achtsamer legte er sein Holzpaddel dazu, das er von zu Hause mitgebracht hatte und das mit seinem T-Knauf, Schaft und Blatt genau auf seine Körpermaße abgestimmt war. Das kleine, leichte Notpaddel, dessen Blatt aus Polyamid und dessen Schaft aus Aluminiumrohr bestand, steckte noch zusammengeklappt unter dem Spannnetz an der Bugspitze.
Jack Larson wollte schon das andere Mohawk umdrehen, in den See hinausstoßen und die restlichen Paddel zerbrechen, damit Frank und Scott seine Verfolgung nicht aufnehmen konnten, und dann schnell sein Kanu ins Wasser schieben und verschwinden, als ihn plötzlich ein Gedanke heiß und stechend durchfuhr.
Jennifer! Wie eine glühende Nadel bohrte sich ihr Name in sein Bewusstsein. Ich darf ihre Leiche nicht zurücklassen!
4
Als Olivia die Treppe herunterkam, saß Onkel Vincent schon am Küchentisch und las das Lokalblatt, vor sich wie immer seinen großen Keramikbecher, der gut und gern einen halben Liter seines bitteren Jamaikagebräus fasste und das Park-Ranger-Logo trug. Nur seine weißen buschigen Augenbrauen, die sie an Schneewehen erinnerten, die gewölbte Stirnpartie und sein ebenfalls schon völlig ergrautes, aber noch immer dichtes Haar ragten über den Rand des Glendale Falls Journal hinaus.
»Guten Morgen!«, begrüßte ihr Onkel sie, der im nächsten Jahr sechzig wurde und damit gute zehn Jahre älter war als sein Bruder Henry, ihr Vater. »Ich hoffe, du hast gut geschlafen, mein Kind.«
»Ihr Name ist Olivia«, rügte ihn seine Frau sofort. Tante Becky, die ihre Herzensgüte gern hinter einer rauen Schale verbarg und immer beschäftigt sein musste, stand am Herd und rührte den Teig für Pancakes an, »und nicht ›mein Kind‹!«
»Und ob sie das ist!«, beharrte er.
»Sie ist schon eine junge Frau, falls du das noch nicht bemerkt haben solltest! Und da will man nicht mehr wie ein Baby behandelt werden!«
Onkel Vincent ließ die Zeitung sinken. »Ach was, wirklich? Wann ist denn das passiert?« Er zwinkerte Olivia dabei zu. »Das muss ja über Nacht geschehen sein!«
»Männer!« Tante Becky schnaubte missbilligend und gab einen Schwall Teig in die heiße Pfanne.
Olivia lachte. Dieses Geplänkel zwischen den beiden war ihr nur zu vertraut. Onkel Vincent und Tante Becky kabbelten sich ständig, konnten jedoch nicht ohne den anderen sein. Sie war gern bei ihnen. Hier in diesem alten Haus hatte sie Trost und Wärme gefunden, als sie geglaubt hatte, nie wieder lachen zu können und im Weiterleben keinen Sinn mehr zu finden.
»Möchtest du heiße Schokolade zu deinen Pancakes, Olivia?«, erkundigte sich Tante Becky.
Olivia verzog das Gesicht. »Danke, aber besser nicht. Ich mach mir einen Tee«, wehrte sie ab. Dabei hätte sie nur zu gern einen Becher heiße Schokolade genommen. Aber wenn sie schon den Pancakes nicht widerstehen konnte, die natürlich nur mit einem ordentlichen Schuss Ahornsirup so richtig gut schmeckten, dann durfte sie sich auf gar keinen Fall auch noch eine zweite Kalorienbombe leisten.
Die Pancakes schmeckten köstlich und sie nahm sich Zeit. Sie wollte jeden Bissen genießen. Indessen schmierte Tante Becky ihr Sandwiches zum Mitnehmen, wie immer natürlich viel zu viele, verpackte sie in Gefrierbeutel und füllte die Wasserflasche aus der Netztasche ihres Rucksacks mit Eistee. Die Zeiger der Küchenuhr standen auf zehn Minuten vor sieben, als sie die letzten Tropfen Sirup von der Gabel leckte und dann ihr Geschirr in die Spüle räumte. »So, ich mach mich dann mal auf den Weg.«
»Hast du auch deine Tabletten genommen, Olivia?«, erkundigte sich Tante Becky besorgt.
Onkel Vincent winkte ab. »Na, als ob sie die vergessen würde!«
»Ach was? Du vergisst deine doch auch ständig, und nicht nur die mit den Vitaminen!«, hielt Tante Becky ihm vor und stemmte die Fäuste in die breiten Hüften.
Olivia versicherte, ihre Tabletten genommen zu haben.
»Willst du den Jeep nehmen?«, bot Onkel Vincent ihr großzügig an. »Du kannst ihn auf dem Parkplatz der Marina stehen lassen und den Schlüssel bei Debbie im Office abgeben. Ich hol den Wagen dann am Mittag ab.«
Im ersten Moment war Olivia versucht, sein Angebot anzunehmen. Sie hatte den Führerschein noch keine zwei Wochen, war stolz darauf und nahm gewöhnlich jede Gelegenheit zum Fahren wahr, die sich ihr bot. Und Onkel Vincents Jeep Wrangler zu fahren, der mit allerlei Chrom und Überrollbügeln ausgestattet war, machte besonders viel Spaß.
Aber an diesem Morgen wollte sie den Weg zum See lieber zu Fuß gehen. Es war nur ein kurzes Stück bis zum Anleger und mit dem Jeep würde sie viel zu früh dort eintreffen und nur herumstehen und warten.
»Das ist ganz lieb von dir, Onkel Vincent«, sagte sie, »aber heute gehe ich lieber zu Fuß. Dabei kann ich besser nachdenken. Und mir geht eine Menge durch den Kopf, wie ihr euch denken könnt.« Sie begleitete ihre Worte mit einem schiefen Lächeln.
Er nickte verständnisvoll. »Mach dir aber nicht zu viele Gedanken. Dein Vater hat bisher noch immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und du weißt, was du ihm bedeutest«, sagte er ernst. »Ich weiß, dass es nicht leicht sein wird, und zwar für keinen von euch. Aber du wirst sehen, am Ende wird schon alles gut werden, mein Kind!«
»Olivia, Vincent! Ihr Name ist Olivia!« Tante Becky verdrehte die Augen, als ertrüge sie ihren Ehemann nicht länger, tätschelte dann jedoch Olivias Wange und sagte bekräftigend: »Ja, das wird es ganz bestimmt!«
Olivia dankte ihnen für alles, umarmte sie und sträubte sich auch nicht wie früher dagegen, als Tante Becky ihr zum Abschied noch ein »Gottes Segen!« mit auf den Weg gab und ihr mit der Daumenkuppe schnell ein Kreuz auf die Stirn malte. Dann fuhr sie in ihre warme Fleecejacke mit Kapuze, nahm ihren Rucksack und trat aus der herrlich warmen Küche hinaus in den frischen jungen Morgen.
Schwarz wie Scherenschnitte zeichneten sich die Umrisse der Bergketten am fernen Horizont ab, die sich jenseits der weiten Talmulde von Glendale Falls in den Himmel erhoben. Im Osten brach gerade das erste Licht durch die Wolken, die dort über den Gipfelkämmen hingen. Aber unten im Tal behaupteten sich noch die nächtlichen Schatten, die über der Ortschaft lagen. In diese Dunkelheit warfen die schmiedeeisernen, moosgrün gestrichenen Straßenlaternen, deren Glasschirme denen der alten Gaslaternen nachempfunden waren, kleine Inseln warmen Lichtes.
Der würzige Rauch der Holzfeuer, die in den Kaminen und Holzöfen vieler Häuser gegen die klamme Morgenkühle loderten, wehte von den Dächern herab und trieb über die Straße. Olivia mochte diesen Geruch, mit ihm verband sie ebenso schmerzlich schöne wie traurige Erinnerungen.
Sie ging die Mainstreet hinunter, die auf beiden Seiten von alten, ahornblättrigen Platanen gesäumt wurde. Ihre Blätter hatten schon Herbstfärbung angenommen. Die Gebäude entlang der Hauptstraße und in den Seitengassen bestanden überwiegend aus Zedernholz oder dunkelbraunem Backstein, waren liebevoll restauriert und vermittelten den idyllischen Eindruck eines kleinen, heimeligen Städtchens aus der Gründerzeit irgendwann im späten neunzehnten Jahrhundert, die natürlich alles andere als beschaulich und heimelig gewesen war.
Maggie’s Diner, einen Block weiter die Mainstreet hinunter und auf der gegenüberliegenden Seite, war nicht nur schon hell erleuchtet, sondern an der Theke und an zwei Tischen saßen schon die ersten Kunden und ließen sich das Frühstück schmecken. Auf dem Weg hinunter zur Marina kam Olivia an Souvenirläden, einem Fahrradverleih sowie an mehreren Geschäften vorbei, die sich auf Kleidung und Schuhwerk für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten spezialisiert hatten. Auch Freunde des Angelsports fanden auf dieser Straße mehrere Läden, in denen sie sich mit allem Nötigen und Unnötigen eindecken konnten. Und kurz vor der Marina hatten die Jamieson Brothers und Pete William’s Canoeing, die beiden größten Outfitter und Kanuverleiher der Kleinstadt, ihre im schweren Blockhausstil errichteten Ladenlokale, die mehr lang gestreckten Werkhallen ähnelten.
Olivia liebte diese Kleinstadt mit ihren gerade mal siebentausend ganzjährig hier lebenden Einwohnern. Hier hatte sie mehr als einmal Zuflucht und die Kraft zum Weiterleben gefunden. Was sehr viel mit Onkel Vincent und Tante Becky zu tun gehabt hatte, aber auch mit der grandiosen Natur, in die Glendale Falls eingebettet lag und die dafür sorgte, dass der Ort selbst in den kurzen Saisonzeiten nicht von Touristen überlaufen war. Denn wer sich schon so weit von den großen Städten an der Westküste nach Glendale Falls begab, der verbrachte seine kostbare Urlaubszeit nicht damit, in der Stadt herumzuhängen, sondern nahm Glendale Falls als Ausgangspunkt für Touren in die Einsamkeit der Natur. Glendale Falls war nun mal eines der Tore in eine Wildnis, in der man mehr Wölfen, Bären und sogar Raubkatzen wie Pumas und Luchsen begegnete als Menschen.
Um fünf nach sieben traf Olivia an der Marina ein. Sie ging an den vom Uferdamm abzweigenden Stegen vorbei, wo mehrere Dutzend Segel- und Motorboote vertäut lagen, und begab sich nach hinten zu den langen Anlegern aus breiten Pontons, wo die Wasserflugzeuge der örtlichen Buschpiloten lagen. Im Sommer konnte man hier ein halbes Dutzend dieser mit Schwimmern ausgestatteten Flugzeuge sehen, manchmal fand sich sogar ein richtiges Amphibienflugzeug darunter, dessen Motoren über den Flügeln saßen und das nicht auf Schwimmern stand, sondern mit dem Flugkörper im Wasser lag und auch so startete. Aber an diesem Morgen schwammen an den Pontons nur zwei Maschinen. Eine rote Murphy Moose und eine größere, sechssitzige DeHavilland Beaver, die einen zweifarbigen gelb-grünen Anstrich und zwischen der Kabine und dem Heck die geschwungene Aufschrift Gilroy’s Thunderbird Air Service trug.
Das war die Maschine, die sie und die Sherwoods zu ihrer Hütte am Lake Anderson bringen würde. Ihr Besitzer und Pilot, Harold Gilroy, belud schon den hinteren Frachtraum mit Kisten, die er auf einem Handwagen herangebracht hatte.
Olivia ging nicht zu ihm hin, sondern nickte ihm nur zu und bedeutete ihm, dass sie auf die beiden anderen Passagiere oben am Beginn des langen Anlegers warten wolle. Sie hatten vereinbart, sich hier um Viertel nach sieben zu treffen. Und jetzt war es so weit. Gestern noch hatte sie geglaubt, ganz cool und überhaupt nicht aufgeregt zu sein. Aber nun war sie es doch, wie sie feststellte. Sie war auf Patrick, Catherines Sohn, gespannt. Und sie fragte sich, ob sie sich mit ihm verstehen würde. Denn wenn das nicht der Fall war, würden die Tage in der Abgeschiedenheit des Lake Anderson wohl die reinste Hölle werden!
5
Jack Larson stand am Rand einer Panik, und er hatte Mühe, einen klaren Gedanken zu fassen. Es war ihm ein Rätsel, warum er plötzlich unbedingt wollte, dass die Tote nicht hier bei Scott und Frank zurückblieb. Er wusste nur, dass er sie ihnen unter keinen Umständen überlassen durfte. Was er außerdem noch wusste, war, dass ihm keine Zeit blieb, sich hier noch lange den Kopf zu zerbrechen. Aber irgendwie passte das schon prächtig zusammen, war er doch sich selbst ein verdammtes Rätsel, jedenfalls nach all dem, was geschehen war.
Gehetzt rannte Jack zurück zum Schuppen, und mit jedem Schritt, der ihn der Toten wieder näher brachte, wuchs in ihm der Widerwille gegen das, was er gleich tun musste. Er hätte viel dafür gegeben, wenn er einfach so hätte davonpaddeln können. Aber er durfte der Versuchung nicht nachgeben. Er musste tun, was getan werden musste!
Seine einstigen Highschool-Freunde hatten nicht bei Jennifers Leiche im Blockhaus schlafen wollen. Deshalb hatten sie ihn, Jack, gezwungen, sie in ihr Bettlaken zu wickeln und hinüber in den Werkzeugschuppen zu ziehen. Und da hatte sie für den Rest der Nacht auf dem Bretterboden gelegen. Direkt über seinem Kopf, während er im flackernden Licht seines Feuerzeugs verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit gesucht und sie wundersamerweise schließlich auch gefunden hatte.
Mit einem Würgen im Hals und kaltem Schweiß auf der Stirn zog er die Schuppentür auf. Jennifer lag, wo er sie vor vier, fünf Stunden abgelegt hatte.
Ja, wo sollte sie denn auch sonst liegen?
Das Laken war von ihrem Gesicht gerutscht und der starre, leblose Blick aus ihren glasigen Augen traf ihn wie ein Fausthieb in den Magen. Und da waren sie, diese grässlichen Würgemale.
Er schaffte es nicht mehr hinaus ins Freie, sondern taumelte hinüber zur Werkbank, stützte sich auf die Kante und krümmte sich, während er sich erbrach. Es kamen nur das Seewasser und bittere Galle, alles andere hatte er schon Stunden vorher unten im Erdloch ausgekotzt. Er richtete sich wieder auf und rang keuchend nach Atem. Dabei fiel sein Blick auf die Werkzeuge, die an der Wand hingen und vor ihm auf einem langen Werktisch säuberlich aufgereiht lagen.
Jack spuckte noch einmal aus, wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und starrte benommen auf die Werkzeuge. Ihm war, als stünde er neben sich und starrte sich selbst an.
Jemand anders schien in ihm das Kommando zu übernehmen.
Reiß dich zusammen! Und denk nach! Nimm mit, was dir vielleicht von Nutzen sein wird! … Zwei von den großen schwarzen Müllsäcken! … Ja, nimm ruhig den Spaten mit! … Und auch das Handbeil, das brauchst du für das andere Kanu! Scott ist ein verdammt guter Schwimmer! Da reicht es nicht, ihr Kanu einfach nur vom Ufer wegtreiben zu lassen. Du musst die Paddel und ihr Mohawk zerstören, sonst sitzen sie dir womöglich ganz schnell im Nacken!
Ihm war, als würde ein Fremder in seinem Kopf zu ihm sprechen, was auch überhaupt nicht absonderlich war, sondern ihm vielmehr einleuchtete. Es war ja auch nicht er, sondern der andere in ihm, der Jennifer … der ihr das Unaussprechliche angetan hatte.
Und so tat er, was diese fremde Stimme ihn zu tun aufforderte.
Spaten und Handbeil legte er zwischen die Beine der Toten und zog sie mithilfe des großen Bettlakens aus dem Schuppen und hinunter zu den Kanus. Kurz vor dem Bootssteg rollte sie ihm aus dem Laken, als er sie über eine kleine Bodenwelle zerrte. Die Leiche blieb mit dem Gesicht nach oben im feuchten Gras liegen. Ihre fahle Haut glänzte im Morgentau wie fleckiger, kalter Marmor. Ihr langes rehbraunes Haar lag wie ein Vorhang über ihrem Gesicht, als wollte die Tote ihre Scham darüber verbergen, dass ihr junger Körper fast entblößt, nur mit Unterwäsche bekleidet im hellen Morgenlicht lag.
Ein trockenes Würgen befiel Jack, doch er bekämpfte es, wie er auch gegen die Panik ankämpfte, die wieder übermächtig zu werden drohte.
Plötzlich drang aus der Ferne ein schwaches Motorengeräusch an sein Ohr, das aber schnell lauter wurde. Er suchte den Himmel ab, der im Osten über den Bergen in Flammen zu stehen schien, und entdeckte die vagen Umrisse eines Buschfliegers mit silbrig glänzenden Schwimmern unter dem Rumpf. Er fürchtete schon, der Kurs der Maschine würde sie in die Nähe der Landzunge bringen, auf der das Blockhaus stand, und hastig warf er das Laken über die Tote. Doch dann drehte der Buschflieger, kaum dass er die Bergkette im Osten hinter sich gelassen und den Lake Cariboo auf der südöstlichen Seeseite kurz gestreift hatte, nach Westen ab und verschwand schnell hinter einem Wolkenfeld.
Es war ein schweres Stück Arbeit, die Leiche wieder fest ins Laken zu wickeln und sie dann ins Kanu zu wuchten, hatte doch schon die Totenstarre eingesetzt. Im Leben war ihm Jennifers zarte Gestalt so federleicht erschienen, und jetzt meinte er, einen Körper aus Blei bewegen zu müssen.
Endlich lag sie im Kanu. Am liebsten hätte er sie noch umgedreht, sodass sie mit dem Gesicht nach unten lag. Aber dazu brachte er nicht die nötige Überwindung auf.
Jack war in Schweiß gebadet und plötzlich von grenzenloser Wut erfüllt, die er selbst nicht einzuordnen wusste. Er stellte die Paddel, für die er keine Verwendung hatte, schräg gegen den Bootssteg und trat sie in Stücke. Das Bersten der Schäfte klang in seinen Ohren so laut und durchdringend wie der Sturz eines gefällten Baumriesen. Dann griff er zum Handbeil und schlug mit aller Kraft auf den Unterboden des zweiten Kanus ein.
Bei den ersten beiden Schlägen prallte das Beil vom Fiberglasrumpf ab, doch der nächste wuchtige Schlag riss einen ersten Spalt. Wie besessen schlug Jack auf den Rumpf ein. Er wusste, dass jetzt die Zeit lief und jeden Augenblick Frank und Scott aus dem Blockhaus herausgestürmt kommen würden. Seine Schläge hallten laut über das Gelände am Seeufer.
Endlich splitterte das Fiberglas, sodass unter den Hieben breite Spalten im Rumpf aufklafften. Wie von Sinnen schwang er das Beil, als wollte er es buchstäblich in Stücke schlagen.
Dann hielt er, wie von einer unsichtbaren Hand jäh zurückgehalten, plötzlich inne und starrte mit brennenden Augen auf die Löcher und Spalten im Kanuboden, als würde er sich ihrer erst jetzt richtig bewusst.
Genug! Genug!
Ja, das musste reichen! Er warf das Handbeil zu seinen Sachen ins rote Mohawk. Das Kanu von Frank und Scott war ruiniert und nicht mehr zu flicken, zumindest nicht hier in der Wildnis!
Aber sicherheitshalber riss er es herum und stieß es so fest, wie er nur konnte, ins Wasser hinaus, wo es zehn, fünfzehn Meter weit am Bootssteg entlangglitt, um dann aber vollzulaufen und schnell zu sinken.
Nun packte er sein Boot mit beiden Händen rechts und links am Dollbord, schob es aus dem Gras den kurzen Schotterstrand hinunter und lief noch zwei, drei Schritte durch das flache Ufergewässer, bevor er mit einem Satz ins Kanu sprang. Es schwankte kurz bedenklich, als wollte es gleich kentern. Augenblicklich hatte er sein Paddel in den Händen, fing das gefährliche Schwanken mit Gegenbewegungen seines Körpers ab und begann, sein Kanu mit kurzen, kraftvollen Schlägen voranzutreiben, um möglichst schnell möglichst weit vom Ufer wegzukommen.
In einem wilden Stakkato stach er das Paddel durch den Spiegel des Sees, sodass das Wasser unter dem mächtigen Druck des Blattes gurgelte, rauschte und Wirbel bildete, riss es heraus und stach es schon wieder ein, noch bevor der dünne Schleier aus Wassertropfen, die vom Blatt mit in die Luft gerissen wurden, zurück auf die Oberfläche des Lake Cariboo fallen konnte.
Und dann hörte er sie auch schon in seinem Rücken.
Damit hatte er gerechnet.
Nicht jedoch mit den Schüssen!
6
Patrick Sherwood war stinksauer, und zwar nicht erst, seit er sich ins Klo dieses spießigen Motelzimmers in Glendale Falls eingeschlossen hatte, sondern schon seit er von diesem bescheuerten Wir-müssen-uns-alle-mal-in-Ruhe-kennenlernen-Trip zu dieser blöden Blockhütte gehört hatte. Und weil er sich nicht schon wieder über dieses bestimmt völlig vermieste Labour-Day-Wochenende ärgern wollte, kämpfte er in der Schlacht um die Insel umso verbissener.
»Patrick!« Energisch klopfte Catherine Sherwood gegen die Badezimmertür. »Sieh endlich zu, dass du fertig wirst – was immer du da drin treibst!«
Patrick nahm das Klopfen seiner Mutter vage durch den digitalen Kampflärm wahr, der aus seinen Ohrhörern schallte, reagierte jedoch nicht. Er saß mit seinem brandneuen Smartphone auf dem heruntergeklappten Klodeckel und war in sein Videogame vertieft. Gerade hatte er seine Truppen am Strand der Insel gelandet und ließ sie nun die gegnerischen Stellungen von drei Seiten angreifen. Er warf alles, was er an Feuerkraft und Granaten hatte, in die Schlacht. In schneller Folge blitzten im wilden Rhythmus seiner Finger die Detonationen und Geschossgarben auf dem Display auf. Diesmal musste er den Gegner vernichtend schlagen, und zwar in neuer Rekordzeit. Sonst würde er es wieder nicht schaffen, das nächste Level zu erreichen. Und allmählich stank es ihm, dass er über das siebzehnte einfach nicht hinauskam. Verdammt noch mal, er hatte doch das Zeug dafür, um ganz oben im Master Level zwanzig mitzuhalten! Wenn er doch bloß diese verflixten Bunkerstellungen und MG-Nester schneller ausheben könnte!
Wieder klopfte seine Mutter an die Tür, diesmal jedoch noch energischer. »Patrick, hast du es auf den Ohren? Komm da endlich raus! Und gib mir gefälligst eine Antwort!«
»Kann man denn nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen?«, blaffte er zurück und drückte mit dem Ellbogen den Hebel der Klospülung hinunter, ohne den Blick vom Display zu nehmen. Was ihn aber nicht vor der bösen Überraschung bewahrte, einen Hinterhalt an seiner linken Flanke nicht bemerkt zu haben. Und als im nächsten Augenblick unvermittelt eine gegnerische Kommandoeinheit aus dem Dschungel hervorstürmte, war es schon zu spät, um seine Schlachtordnung noch schnell genug umstellen zu können. Aus allen Rohren feuernd, fiel die gegnerische Einheit seinen Truppen in die ungeschützte Flanke und mähte alles nieder, was er da an Soldaten postiert hatte. Das nächste Level konnte er vergessen. Jetzt war geordneter Rückzug angesagt, wenn er nicht völlig aufgerieben werden und sein siebzehntes Level retten wollte.
»Was soll das? Willst du mich für dumm verkaufen? Noch leide ich nicht unter Demenz, mein Herr Sohn! Ich weiß ganz genau, dass du auf deinem Handy mal wieder eines dieser brutalen Ballerspiele spielst, von denen sich angeblich keines auf deinen Geräten befindet!«
Patrick lachte auf und murmelte ironisch: »Im Zweifel für den Angeklagten, Mom!« Und spielte ungerührt weiter.
»Aber wenn du meinst, dass ich dich zu Unrecht verdächtige«, die Stimme seiner Mutter wurde sarkastisch, »dann können wir die Angelegenheit ja gleich klären, indem ich mir mal ansehe, was du so alles auf dein Handy geladen hast! Und sollte ich was finden, was angeblich gar nicht da sein soll, werde ich das Gerät einkassieren! Haben wir uns verstanden?«
Patrick verzog das Gesicht und stellte das Spiel auf Unterbrechung. Seine Mutter mochte zwar in manchen Dingen reichlich altmodische Ansichten haben, aber etwas vormachen ließ sie sich so schnell nicht, und leider schon gar nicht von ihm.
»Okay, okay, kein Grund, zur Super-Nanny zu werden und den fiesen Datenschnüfflern von der NSA Konkurrenz zu machen, Mom!«, rief er hastig und ließ die App vom Screen verschwinden. »Bin ja schon so gut wie unterwegs!«
»Dass du immer so herumtrödeln musst!«
»Ich bin nicht langsam, sondern im Energiesparmodus«, erwiderte er, ließ den Klodeckel demonstrativ klappern, obwohl er sich das hätte sparen können, und kam aus dem Badezimmer. Smartphone und Ohrstöpsel hatte er wohlweislich unter seiner schwarzen Jeansjacke verschwinden lassen.
Catherine Sherwood stand fertig angezogen und mit vor der Brust verschränkten Armen zwischen den beiden Queensize-Betten und bedachte ihn mit einem halb missbilligenden, halb nachsichtigen Blick. Die beiden geliehenen Rucksäcke und ihre Duffel Bag standen schon neben der Tür.
So sauer er auch auf seine Mutter war, so musste er sich doch eingestehen, dass sie sich ganz ordentlich gehalten hatte. Immerhin war einundvierzig ja schon ein beachtliches Alter, jedenfalls sah er das so mit seinen fünfzehn Jahren, elf Monaten und zehn Tagen. Sie hatte sich ihre schlanke Figur erhalten, was sie ihrer täglichen frühmorgendlichen Schinderei namens Jogging verdankte. Und die neue, freche Kurzhaarfrisur stand ihr auch recht gut.
Nein, verstecken musste er seine Mutter wirklich nicht. Was aber wohl mit ein Grund war, warum dieser Wald-und-Wiesen-Fuzzi namens Henry Wickersham glaubte, sich in ihrer beider Leben drängen zu müssen und den seit dreieinhalb Jahren verwaisten Platz seines Vaters einnehmen zu wollen. Peinlich genug, wenn er mit fast fünfzig den leidenschaftlichen Lover gab, was Patrick sich lieber nicht so genau vorstellen wollte. Okay, sollten sie sich ruhig dann und wann treffen, solange es nicht bei ihnen zu Hause war, und ihren Spaß haben. Aber darüber hinaus sollte zwischen ihm und seiner Mutter besser nichts laufen!
»Himmel, das wurde aber auch höchste Zeit, Patrick!«
»Hektik ist nur was für Erwachsene«, erwiderte er mürrisch und strich sich eine Strähne seines leicht gelockten sandblonden Haars, das ihm wie ein Vlies bis auf die Schultern fiel, aus dem schmalen Gesicht.