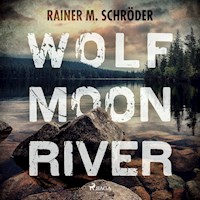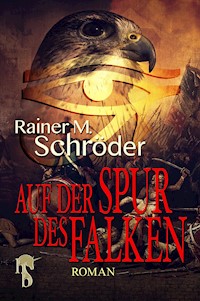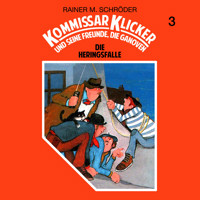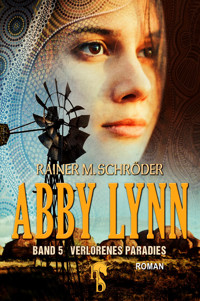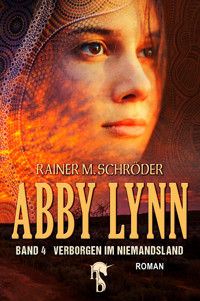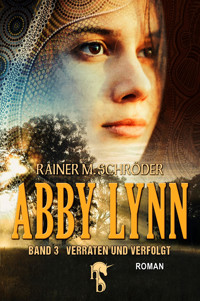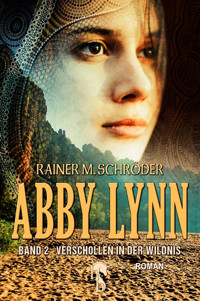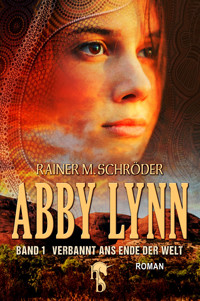6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kairo, 1291 – vier junge Gralshüter, Gerolt, Maurice, Tarik und McIvor, stehen vor einer schicksalhaften Mission: Sie müssen den Heiligen Gral aus der gefallenen Stadt Akkon nach Paris bringen. Doch nach einem heftigen Sturm gerät ihr Schiff in die Gewalt eines mächtigen Sultans und sie finden sich in den finsteren Kerkern Kairos wieder. Auf wundersame Weise gelingt Tarik die Flucht. Mit dem Gral in seinen Händen befreit er seine Freunde und ein mysteriöser Scheich namens Dshamal schließt sich ihnen an, rät ihnen zur Flucht über die endlosen Weiten der Wüste. Die Reise wird zum Albtraum: Sie müssen den erbarmungslosen Gefahren der Wüste, skrupellosen Sklavenhändlern und teuflischen Judasjüngern entkommen. Als sie auf eine geheimnisvolle Oase stoßen, scheint ihre Hoffnung zu schwinden. Und auch die letzte Etappe von Marseille nach Paris erweist sich als gefährliches Unterfangen, bei dem sie alle ihre Kräfte aufbieten müssen, um den kostbaren Gral gegen die Iskaris zu verteidigen. In unerschütterlicher Freundschaft setzen sie ihre Mission fort. Vier Ordensritter bei ihren Abenteuern voller Mut, Geheimnisse und unerschütterlicher Entschlossenheit … packend erzählt von Erfolgsautor Rainer M. Schröder in seiner Roman-Trilogie „Die Bruderschaft vom Heiligen Gral“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Die Bruderschaft vom Heiligen Gral
Das Amulett der Wüstenkrieger
Roman
In Liebemeiner Frau Helga,dem heiligen Gral meines Herzens
»Alles hat seine Stunde.Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit:eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ernten,eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen,eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen,eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz,eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen,eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen,eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen,eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden,eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen,eine Zeit für Krieg und eine Zeit für den Frieden.«(Aus der Heiligen Schrift, Buch Kohelet)
Prolog
Die Mächte der Finsternis18. Mai 1291
1
Im Laufschritt eilte Sjadú mit seinem Gefolge, das sich so wie er dem mächtigen Fürsten der Finsternis buchstäblich mit Leib und Seele verschrieben hatte, durch die brennende Hafenstadt. Wilder, satanischer Jubel erfüllte seine Brust beim Anblick des Untergangs von Akkon, der letzten bedeutenden Bastion der Kreuzritter im Heiligen Land. Wohin der Blick seiner dunklen Augen auch ging, er fiel auf Bilder des Todes, des Blutrausches, der Schändung und der Zerstörung. Überall um ihn her gellten Schreie, klirrten Waffen aufeinander, floss das Blut in Strömen. Tod und Verderben hatten hinter den eingestürzten Mauern und Wehrtürmen Einzug gehalten und fuhren reiche Ernte ein.
»Brenne, Akkon! Brenne mit deinen verfluchten Kirchen, Klöstern und Ordensburgen bis auf die Grundmauern nieder! Und ersaufe in deinem eigenen, dreifach verfluchten Christenblut!«, rief Sjadú und stieß die Streitaxt in seiner Rechten jäh in die Luft, als wollte er mit einem gewaltigen Hieb die tief hängende, schmutzig graue Wolkendecke über der Hafenstadt aufschlitzen und den Himmel spalten. »Heute ist der Tag der Abrechnung mit den Gralshütern gekommen!«
Die sieben bewaffneten Männer hinter ihm lachten beifällig, leckten sich wie nach Blut dürstend über die Lippen und konnten es sichtlich nicht erwarten, blankzuziehen und einem dieser verhassten Gralsritter ihre Klinge in den Leib zu stoßen.
Der Widerschein der lodernden Feuer tanzte über die breite, stark gewölbte Klinge der Streitaxt, die Sjadú mit drohender Geste gen Himmel reckte. Auch der kalte Stahl seines Schwertes fing den zuckenden Feuerschein auf und schien zu glühen. Das geriffelte Griffstück und die breite Parierstange der schweren Waffe, deren Enden als Fratzenköpfe mit aufgerissenen Mäulern und einem züngelnden Schlangenkopf anstelle der Zunge gearbeitet waren, ragten unter seinem wehenden Kaftan hervor.
Das weite arabische Obergewand aus grauschwarzer Wolle trugen er und seine Gefolgsmänner zur Tarnung. Auf den typischen Turban der muslimischen Krieger, die Akkon wochenlang belagert hatten und die stark befestigte Hafenstadt nach dem gelungenen Sturmangriff im Morgengrauen nun in Blut und Asche versinken ließen, hatten die Männer jedoch verzichtet. Stattdessen trugen sie ein bis auf die Schultern locker herabfallendes Kopftuch, das gegenüber dem Turban den Vorteil hatte, viel vom Gesicht seines Trägers zu verbergen, ohne jedoch Misstrauen zu erwecken. Denn es gehörte in allen arabischen Ländern zur gewöhnlichen Bekleidung und wurde überall von Fellachen1 und Beduinen zum Schutz vor der sengenden Sonne getragen. Eine doppelte Kordel, die über der Stirn um den Kopf herumlief, sorgte für einen sicheren Sitz.
Nur Khutriel, den Urakib als Boten zu Sjadú geschickt hatte, stach mit seinem sandfarbenen Obergewand und dem palmgrünen, blutbefleckten Turban in der Gruppe der Männer in schwarzgrauer Fellachenkleidung hervor. Er hatte die Sachen einem getöteten Mamelucken2 vom Leib gezerrt und sie sich in großer Eile übergeworfen.
Im fahlgrauen Licht des über der See heraufziehenden Unwetters eilte Sjadú durch die Straßen. Sein Ziel war eine scheinbar verlassene Kirchenruine auf der Südwestflanke des Montjoie. Der busch- und baumbestandene Hügel mit dem Kloster St. Sabas auf seiner flachen Kuppe erhob sich im Süden der befestigten Halbinsel und unweit des Hafens zwischen dem Viertel der Venezianer und dem der Genueser aus dem umliegenden Häusermeer.
Der Bote seines Unterführers Urakib hatte ihm vor wenigen Augenblicken die Nachricht überbracht, der er schon seit Jahrzehnten entgegengefiebert hatte. Urakibs Männer hatten Abbé Villard gestellt, den gerissenen alten Gralshüter, zusammen mit seinen beiden blinden Dienern Bismillah und Dschullab sowie vier offenbar frisch geweihten Rittern der geheimen Bruderschaft. Bei den vier neuen Gralshütern sollte es sich um einstige Templer handeln, wie ihm berichtet worden war! Und jetzt saßen sie in der besagten Kirchenruine in der Falle! Damit lag der Triumph zum Greifen nahe!
Beißende Rauchschwaden waberten wie schmutziger Nebel durch die Gassen und über die Marktplätze. An zahllosen Stellen loderten Brände, hatten die Sarazenen und Mamelucken Akkon doch wochenlang mit ihren Riesenschleudern und Katapulten unter Beschuss genommen. Ein dichter Hagel von ochsenkopfgroßen Tontöpfen, gefüllt mit griechischem Feuer3, war in den Tagen und Nächten vor dem Sturmangriff auf die eingeschlossene Stadt niedergegangen. Hatte man die Feuersbrünste bis zum Fall der doppelten Wehrmauern am Morgen noch zu löschen versucht, gab es jetzt niemanden mehr, der sich damit aufhielt. Wo Mauern und brennende Dachstühle unter lautem Bersten einstürzten, da stieg dichter Funkenregen wie glühende Fontänen aus den feurigen Trümmern auf und setzte Nachbarhäuser in Brand. Für das einst stolze und mächtige Akkon und jeden, der nicht rechtzeitig hatte fliehen können, war das unabwendbare Ende gekommen.
Überall in den Straßen und auf den kleinen Plätzen zwischen den einzelnen Vierteln stießen sie auf die grässlich zugerichteten Leichen von gefallenen Kreuzrittern und Turkopolen4. Johanniter, Deutschritter und Templer hatten zusammen nicht einmal zweitausend Mann gezählt und die Stärke ihrer leicht bewaffneten Hilfstruppen hatte unter zwanzigtausend gelegen. Dennoch hatten sie sich der hereinbrechenden Flut von mehr als hundertvierzigtausend bis an die Zähne bewaffneten Mamelucken tollkühn entgegengestellt, jedes Torhaus und jede Gasse standhaft bis zum letzten Atemzug verteidigt und den unausweichlichen Tod im Kampf gesucht, so wie sie es bei ihrer Aufnahme in einen der Ritterorden geschworen hatten.
Von diesen Ordensrittern hatten sich die legendären Templer im Kampf gegen die erdrückende Übermacht der muslimischen Soldaten in ganz besonderem Maße ausgezeichnet. Die gefürchteten Kriegermönche mit dem blutroten Tatzenkreuz auf dem weißen Umhang waren an diesem Tag ihrem Ruf als unbestrittene Elite unter den Kreuzrittern einmal mehr gerecht geworden. Und noch immer wehte ihr schwarz-weißes Ordensbanner, der Beaucant, stolz vom Turm des höchsten Gebäudes von Akkon. Bei diesem letzten befestigten Ort der Hafenstadt, den die Mamelucken auch nach Stunden des Kampfes noch immer nicht eingenommen hatten, handelte es sich um die wehrhafte Ordensburg der Armen Ritter Christi vom Tempel Salomons zu Jerusalem, wie der offizielle Name der Templer lautete. Sie lag nahe den Hafenanlagen auf der Südspitze der Halbinsel. Weniger als eine Hundertschaft von Tempelrittern hatte sich dort im Festungsturm der Eisenburg, wie das befestigte Ordenshaus mit den goldenen Löwen über dem Portal im Volksmund nicht ohne Grund genannt wurde, verschanzt und leistete erbitterten Widerstand5.
In den dunklen, von Fliegen und anderem Geschmeiß umschwirrten Strömen von Blut, die sich über Straßen, Höfe und Marktplätze ergossen, lagen aber auch Frauen, Kinder und Alte, die zu Hunderten niedergemetzelt worden waren. Zwar hatte der Großteil der Bevölkerung, die fast vierzigtausend Seelen gezählt hatte, Akkon schon in den ersten Wochen der Belagerung per Schiff verlassen. Aber es waren doch noch mehrere Tausend Einwohner zurückgeblieben, die gegen jede Vernunft auf ein Wunder gehofft oder nicht genug Geld besessen hatten, um den Preis für eine der wenigen, letzten Schiffspassagen nach Zypern bezahlen zu können. Und wer das blindwütige Morden, Plündern, Brandschatzen und Vergewaltigen an diesem Tag überlebte, auf den wartete das Elend der Sklaverei.
Sjadú labte sich an diesen Bildern fast apokalyptischen Grauens. Mitgefühl jedweder Art war ihm so fremd wie einem Raubtier. Nichts ließ sein Herz höherschlagen, als zu sehen, wie Christen gleich jeden Alters oder Geschlechts hingeschlachtet wurden. Dies hatten sie als Judasjünger, die den Fürsten der Finsternis anbeteten, mit den muslimischen Kriegern gemein. Aber das war auch schon alles, was es an Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gab, und schützte die Mohammedaner nicht vor ihrem abgrundtiefen Hass. Denn auch die Muslime gingen vor Gott, den sie Allah nannten, willfährig in die Knie und versagten sich der Herrschaft des Schwarzen Fürsten der Welt. Wenn die Zeit reif war, würde es deshalb auch ihnen an die Kehle gehen!
Aber noch mussten sie als Judasjünger all ihre Kräfte darauf richten, die Vorherrschaft der Christen auf Erden zu brechen. Der Fürst der Finsternis verfügte über gewaltige Macht und keiner übertraf ihn als Meister der Zerstörung und des Bösen. Aber das Große Werk, nämlich seine unbestrittene Herrschaft von Nacht zu ewiger Nacht auf der Erde, wartete noch auf seine Vollendung. Bevor es jedoch zu diesem heiß ersehnten Triumph kommen konnte, musste es ihnen erst einmal gelingen, den Sieg über ihre ärgsten Widersacher und Todfeinde, die geheime Bruderschaft der Gralsritter, zu erringen.
Und sie mussten um jeden Preis den Heiligen Gral in ihren Besitz bringen, dessen Schutz sich die geweihten Ritter der geheimen Bruderschaft zu ihrer heiligsten Aufgabe erkoren hatten. Der Heilige Gral war der wundertätige Kelch des letzten Abendmahls, das Jesus mit seinen Jüngern in der Nacht vor seiner Kreuzigung gefeiert hatte, und seitdem göttlicher Kelch ewigen Lebens und ungeheurer Macht. Erst wenn die satanische Zeremonie seiner Zerstörung vollzogen war, würde das Große Werk seinen triumphalen Abschluss finden und der Schwarze Fürst zum alleinigen Herrscher der Welt werden.
Und jetzt, nach über zwölf Jahrhunderten erbitterten, aber vergeblichen Kampfes mit dem zähen Feind, waren sie ihrem Ziel so nahe wie nie zuvor. Mit ein wenig Glück konnte er, Sjadú, erhabener Erster Knecht des gewaltigen Fürsten der Finsternis, diesen verfluchten, machtvollen Heiligen Gral noch heute in seinen Händen halten! Niemand aus menschlichem Fleisch und Blut würde ihm dann jemals die Stellung streitig machen können, der erhabene Erste Knecht und allseits gefürchtete Vertraute des Schwarzen Fürsten und Weltenherrschers zu sein! Eine Vorstellung, die ihn berauschte.
»Wir sollten besser einen westlichen Bogen um das Viertel der Venezianer schlagen, wenn Ihr mir diesen Ratschlag erlaubt, erhabener Erster Knecht unseres Fürsten«, schlug der stämmige, hellhäutige Khutriel an Sjadús Seite vor, als zu ihrer Linken der brennende Palast des Patriarchen auftauchte. Ein devoter Ton war jedem angeraten, der mit Sjadú redete und einen Vorschlag machte. Denn der Erste Knecht war für seinen maßlosen Jähzorn und seine eisige Unnachsichtigkeit bekannt und gefürchtet. Er verzieh keinen noch so kleinen Fehler und strafte mit grausamer Härte. Und als Erster Knecht hatte er nicht nur den Fuß des Schwarzen Fürsten geküsst, sondern auch als einziger Mensch von seinem Atem getrunken. Das gab ihm eine Macht, von der niedere Knechte wie Khutriel nur träumen konnten. Sogar der brutale Urakib, der immerhin einer der drei Unterführer des Ersten Kreises war und damit die höchste der sieben Stufen vor dem Thron des Schwarzen Fürsten erreicht hatte, beugte vor Sjadú voller Furcht den Nacken.
»Warum?«, fragte Sjadú kurz und scharf.
»Weil wir sonst dem Hafen zu nahe kommen, das könnte gefährlich werden und uns zudem Zeit kosten. In den Straßen rund um den Hafen gibt es wegen der marodierenden Mameluckentruppen nämlich kaum noch ein Durchkommen, zudem ist es von dort nicht weit bis zur belagerten Eisenburg der Templer. Dagegen ist es auf der Westseite der Stadt eher ruhig«, erklärte der ortskundige Khutriel, um dann noch hastig hinzuzufügen: »Aber natürlich liegt die Entscheidung ganz bei Euch, erhabener Erster Knecht.«
Sjadú gab mit einem knappen Nicken sein Einverständnis, den Umweg zu wählen, und folgte Khutriel, der in die nächste Seitengasse zu ihrer Rechten einbog. Ihn drängte es, so schnell wie möglich zu dieser ungeweihten Kirche namens St. Joseph von Arimathäa6 zu kommen, wo sein Unterführer Urakib den alten Gralshüter Abbé Villard von Saint-Omer und dessen Ritter gestellt hatte. Der Heilige Gral und der bevorstehende Triumph über die geheime Bruderschaft der Gralsritter, beherrschten vollkommen sein Sinnen und Trachten.
In ihm brannte das kalte Feuer kontrollierter Mordlust und Rachsucht, das bei seinem Aufstieg zum erhabenen Ersten Knecht eine entscheidende Rolle gespielt hatte.
»Ein drittes Mal wirst du mir nicht entkommen, Abbé Villard!« Seine Lippen formten die Worte so leise, dass nicht einmal Khutriel an seiner Seite etwas davon mitbekam. »Diesmal wirst du unter meiner Klinge fallen und sterben, Abbé!« Sjadú hatte lange auf diesen Tag gewartet, gute zweihundert Jahre, um genau zu sein.
2
Ganz ohne Zwischenfall gelangte Sjadú mit seinen Männern jedoch auch trotz des Umweges nicht auf die Südwestflanke des Hügels. Auf einem kleinen Platz, den zwei sich kreuzende Straßen zu Beginn des Genueser Quartiers bildeten, stießen sie mit einer gut zwanzigköpfigen Gruppe von plündernden Mamelucken zusammen. Ihr Anführer, für einen Araber geradezu ein Bär von einem Mann, pries schon aus zehn, zwölf Schritten Entfernung Allah und dankte ihm, dass er ihnen nach so langer Belagerungszeit endlich den Sieg über die räudigen Christenhunde geschenkt habe und ihnen dabei die wunderbare Gnade erweise, im Blut so vieler Feinde baden zu können.
Worauf Sjadú in seiner Ungeduld mit nicht minder großer Verachtung erwiderte: »Dein Allah ist ein so armseliger Krüppel von einem Gott wie der stinkende Heiland der Christen! Ihr seid allesamt lebensuntaugliches Geschmeiß, das nicht zum Herrschen, sondern nur zum Dienen und Kriechen im Staub taugt!« Und noch während er den lästerlichen Fluch aussprach, schleuderte er dem Mann seine Streitaxt entgegen.
Der bärenstarke Mameluckenkrieger riss geistesgegenwärtig den linken Arm mit seinem schon von Schwerthieben übel zugerichteten Rundschild hoch und die Klinge der Streitaxt bohrte sich mit einem dumpfen Laut tief in das bemalte Holz.
»Wer immer diese Ungläubigen sind, die Allah zu lästern wagen, sie haben für die Schändung seines heiligen Namens den Tod verdient! Macht sie nieder!«, schrie der Anführer der muslimischen Krieger und schleuderte seinen kurzen Wurfspeer. Doch bevor die fast dreifache Übermacht der Mamelucken sich auf Sjadú und seine sieben Gefolgsleute stürzen konnte, geschah etwas Unfassbares, das sie mitten im Angriff erstarren ließ. Denn die heranfliegende Lanze, die Sjadús ungepanzerter Brust gegolten hatte, bohrte sich nicht in seinen Leib, sondern wurde von einer unsichtbaren Macht im Flug abgebremst und verharrte nur eine Fingerbreite vor der blitzschnell ausgestreckten Hand des Judasjüngers in der Luft. Dort schwebte der Wurfspeer, als wäre er plötzlich aller irdischen Gesetze enthoben. Der hölzerne Schaft zitterte sichtlich, als wirkten mächtige, geheimnisvolle Kräfte auf ihn ein.
Ungläubiges Entsetzen überkam die Mamelucken und zeichnete sich auf ihren Gesichtern ab.
Fast gleichzeitig löste sich wie von Geisterhand die schwere Streitaxt mit einem Ruck aus der tiefen Kerbe des Rundschildes, erhob sich kurz in die Luft und spaltete im nächsten Moment den Schädel des bärenstarken Kriegers. Tot stürzte er vor die Füße seiner Kameraden.
Nun tippte Sjadú auch schon kurz mit den Fingerkuppen gegen die blutbespritzte Eisenspitze der schwebenden Lanze. »Töte diese stinkende Brut!«, zischte er. Und die Lanze drehte sich folgsam in der Luft, flog auf die noch immer vor Schreck wie gelähmten Soldaten zu und durchbohrte einen von ihnen. Der Stoß fiel so heftig aus, dass die Lanzenspitze auf dem Rücken des Mannes wieder hervortrat.
Jetzt löste sich schlagartig der lähmende Bann, der die muslimischen Krieger befallen hatte.
»Der Sheitan7! ... Das ist der leibhaftige Sheitan mit seinen Dshinni8!«, gellte einer der Mamelucken mit sich überschlagender Stimme. Gleichzeitig ließ er seinen blutbefleckten Krummsäbel fallen und stürzte in panischer Todesangst davon.
Alle anderen folgten ihm unter schrillem Wehgeschrei und angstvollen Anrufungen Allahs auf dem Fuße. Nicht einer dachte mehr daran, sich diesem Mann im Kampf zu stellen, der über derart teuflische Kräfte verfügte.
Sjadú schickte den kopflos davonstürzenden Mamelucken ein kurzes, verächtliches Auflachen hinterher, trat mit schnellem Schritt zu den beiden getöteten Männern hinüber und bückte sich im Vorbeigehen nach seiner Streitaxt. Der blutige Zwischenfall war ihm kein einziges Wort wert. Er hatte ihn schon vergessen, noch bevor sie die Straßenkreuzung hinter sich gelassen hatten.
»Wir sind gleich da!«, versicherte Khutriel. »Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Kirche des Arimathäers!«
Sjadú ersparte sich eine Erwiderung. Er verabscheute jedes unnötige Gerede, außerdem wuchs seine innere Anspannung, je näher sie ihrem Ziel kamen.
Wenige Minuten später führte Khutriel sie den Hügel Montjoie hinauf. Der ansteigende Weg, der dem Kloster St. Sabas entgegenstrebte, war steinig und breit genug für ein schweres Fuhrwerk. Als sie hinter einer Baumgruppe hervortraten, fiel der Blick ungehindert auf die Klosterpforte und jenseits der hohen Mauer auf die Abtei, die lichterloh in Flammen stand. Einige Schritte weiter aufwärts und auf der Höhe von mehreren heckenartigen Büschen wandte sich Khutriel plötzlich scharf nach rechts. Hinter dem engen Durchlass zwischen den mannshohen Sträuchern kam zu Sjadús Überraschung ein schmaler Pfad zum Vorschein, auf dem Unkraut wucherte. Ein deutliches Zeichen dafür, dass er selten begangen wurde. Wer mit den Örtlichkeiten nicht bestens vertraut war, der konnte nur durch einen glücklichen Zufall auf diesen versteckten Weg stoßen.
Khutriel ging eiligst voraus und Sjadú blieb ihm dicht auf den Fersen. Der schmale Trampelpfad schlängelte sich in einem Abstand von gut fünfzig Schritten zur Klostermauer ein gutes Stück um die Abtei herum, durchquerte dabei einen kleinen, recht verwilderten Zypressenhain und führte hinter den Bäumen hinunter auf einen ebenen, staubigen Platz, der einen Teil der Südwestflanke des Hügels einnahm. Hier stand die unscheinbare Kirche St. Joseph von Arimathäa, abseits der Betriebsamkeit umliegender Viertel und zudem auch noch im Schutz von alten immergrünen Bäumen. Einzig die Eisenburg der Templer mit ihren in luftiger Höhe thronenden Löwen ragte jenseits der Baumspitzen in den Himmel auf. Dort tobte noch immer der Kampf.
»Hier halten sie sich versteckt?«, fragte Sjadú mit argwöhnischem Blick auf die nicht fertiggestellte Kirche.
Khutriel nickte. »Ja. Euch dies auszurichten, hat Urakib mir jedenfalls aufgetragen«, schränkte er vorsichtshalber ein. Er wollte nicht der unglückselige Bote sein, der seinen Kopf verlor, falls sich die Nachricht als falsch herausstellte und Urakib die Gralshüter inzwischen hatte entkommen lassen!
Die gedrungen wirkende Kirche St. Joseph von Arimathäa war als doppeltes Oktagon errichtet worden. Auf einem achteckigen Grundriss erhoben sich die Außenmauern des schmucklosen Gotteshauses. Einzig leichte Strebepfeiler gliederten die schlichten Backsteinwände. Eine flache Kuppel überspannte das innere Oktagon, das sich mit seinen acht Rundbogenfenstern in seinem Zentrum aus dem Dach erhob und wie ein zu kurz geratener Wehrturm aussah. Fast alle Kirchenfenster sowohl des inneren wie des äußeren Oktagons waren mit Brettern und Holzplatten vernagelt oder nachlässig zugemauert, als wäre kein Geld mehr für Kirchenglas vorhanden gewesen, darunter auch das dreibogige Fenster der Apsis9. Das schlichte Portal mit der schweren Kirchentür verbarg sich hinter einem Baugerüst, das bis auf halbe Gebäudehöhe reichte und sich halb um die Kirche herumzog. Es sah jedoch nicht so aus, als wäre in letzter Zeit noch an dem Bau gearbeitet worden. Die Bretter vor den Fenstern machten einen stark verwitterten Eindruck, als hätte seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten keiner mehr Hand angelegt.
Sjadú suchte den kleinen Vorplatz nach Leichen ab, denn er wusste von Khutriel, dass es zum Kampf mit den Gralsrittern gekommen war. Doch außer einigen großen dunklen Flecken vor dem Baugerüst, bei denen es sich zweifellos um Blut handelte, vermochte er keine Spuren des Gefechts zu entdecken. Wenn es Tote gegeben hatte, lagen diese wohlversteckt im angrenzenden Gebüsch oder im Innern der Kirche.
Die schwere Kassettentür hinter dem schmalen Durchgang aus Stützbalken und Querstreben wurde aufgestoßen und Urakib erschien im dunklen Rundbogen des Kirchenportals. Der Judasjünger und Unterführer des Ersten Kreises war ein hochgewachsener, kräftig gebauter Mann mit den kantigen Gesichtszügen eines Hauklotzes. Eine hässlich breite Hasenscharte spaltete seine Oberlippe rechts unter der Nase. Er trug noch immer den schwarzen Umhang mit dem weißen Kreuz der Johanniterritter. In dieser Verkleidung hatte er mit seinen Männern in den letzten Tagen der Belagerung in den Mauern von Akkon die Spur der Gralshüter aufgenommen und schließlich ihr Versteck gefunden.
»Gepriesen sei der einzig Wahre, der Schwarze Fürst der Welt von Nacht zu ewiger Nacht!«, rief Urakib erleichtert, als er seinen Boten mit Sjadú und dessen Begleitern heraneilen sah. »Gut, dass Ihr endlich hier seid, erhabener Erster Knecht!« Und schnell wich er ins Kircheninnere zurück, um dem mächtigen Anführer der Judasjünger Platz zum Eintreten zu machen.
Wortlos drückte Sjadú seinem Unterführer im Vorbeigehen die bluttriefende Streitaxt in die Hand und nahm das Innere der Kirche mit wenigen raschen Rundblicken in sich auf. Sofort huschte ein widerwillig anerkennendes Lächeln über sein Gesicht. Der alte Abbé, auf ewig verflucht sollte er sein!, war von Anfang an ein ebenbürtiger Feind gewesen und verstand sich darauf, perfekte Verstecke für seine geheime Bruderschaft und den verfluchten Heiligen Gral zu schaffen. Und diese Kirche war ein weiteres beeindruckendes Beispiel für seine Gerissenheit!
In der Kirche St. Joseph von Arimathäa herrschte Dämmerlicht, obwohl es noch nicht Abend war. Es fielen nämlich nur wenige dünne Streifen Tageslicht durch einige Ritzen der zugemauerten oder mit Brettern verschlossenen Fenster. Der Innenraum bot dem Eintretenden einen völlig kahlen, ja verlassenen Anblick. Der Mangel an Licht verstärkte diesen Eindruck noch. Wer immer sich als gläubiger Christ hierhin verirrte, der musste augenblicklich das Verlangen verspüren, das Gotteshaus umgehend wieder zu verlassen. Dies war kein Ort, der zu Andacht und Gebet einlud, sondern vielmehr das unbestrittene Reich tiefer Schatten, modriger Luft und scheinbar völliger Verlassenheit, die einen gewöhnlichen Menschen wohl erschauern lassen musste, wie Sjadú annahm. Er dagegen liebte das Kalte, Verlassene und Tote wie auch den Geruch von Moder und Verwesung.
Überall lagen Werkzeug und Baumaterial herum, auf dem sich der Staub von Jahren niedergelassen hatte, und hingen die eingerissenen Netze großer Spinnweben in klebrig grauen Schleiern herab. Zwischen den teilweise noch eingerüsteten Säulen fanden sich Berge von Bauschutt sowie große Fässer, Schulterkiepen und Kübel, die mit erstarrtem Mörtel gefüllt waren. Alles in allem sah es so aus, als hätten die Bauarbeiter an einem schon sehr weit zurückliegenden Tag urplötzlich ihre Arbeit eingestellt, alles stehen und liegen gelassen und Hals über Kopf das Weite gesucht.
Sjadú gefiel das Düstere und Kahle der Kirche ungemein. Es gab weder Kirchenbänke, noch fiel das Auge irgendwo auf Kreuze, Heiligenbilder, Statuen von Märtyrern, Mosaiken mit biblischen Szenen oder andere christliche Symbole. Eine ganz besondere Beruhigung für ihn als Judasjünger war, dass die Kirche noch keine priesterliche Weihe erfahren hatte, er nirgendwo Weihwasser zu fürchten brauchte und dass nicht einmal im Halbrund des Altarraums ein Kruzifix zu finden war. Der völlig nackte Raum verschwand halb hinter einer von der Decke herabhängenden, löchrigen Bahn schmutzigen Segeltuchs. Dort brannten auf einem Mauervorsprung drei dicke Kerzen und dort stand auch einer von Urakibs Männern und blickte schweigend zu ihnen herüber.
»Wen von den Gralshütern hast du gefangen?«, fragte Sjadú knapp und mit kühler Schroffheit, um seine innere Erregung zu verbergen. »Ist der Abbé unter ihnen?«
Urakib wich dem stechenden Blick Sjadús aus. »Nein, der weißhaarige Abbé der Bruderschaft ist uns leider nicht ins Netz gegangen«, sagte er kleinlaut. »Wir hatten gar keine Gelegenheit dazu, weil er sich überhaupt nicht vor der Kirche gezeigt hat. Aber wir wissen jetzt, dass er und auch seine vier neuen Gralshüter, diese Tempelritter, unter der Kirche ihr Versteck haben. Der Zugang muss sich irgendwo unten in der Krypta10 befinden. Bagheel hat sie beobachtet, wie sie da unten verschwunden sind. Dort haben wir an der Hinterwand des Tabernakels auch eine Öffnung mit drei Hebeln gefunden. Ich bin sicher, Ihr werdet wissen, wie der geheime Mechanismus zu bedienen ist!«
Eine Welle der Enttäuschung überkam Sjadú und Zorn stieg heiß wie bittere Galle in ihm auf. Die Nachricht des Boten hatte bei ihm den Eindruck erweckt, dass Abbé Villard in der Falle saß! Und in der Falle sitzen bedeutete für ihn, dass ein Entkommen so gut wie unmöglich war. Doch was er nun hörte, ließ ihn zweifeln, ob diese Falle überhaupt rechtzeitig zugeschnappt war oder ob der Abbé und seine Anhänger vielleicht längst über alle Berge waren!
Aber Sjadú dachte nicht daran, sich seinen Zorn anmerken zu lassen. So reagierte er auf die bitter enttäuschende Auskunft seines Unterführers nur mit der kühlen Frage: »Wen hast du dann gefangen genommen?« – »Einen von den beiden blinden Dienern des Abbés, diesen Dschullab! Er hängt da drüben hinter dem Fetzen Segeltuch!« Urakib deutete zum Altarraum hinüber. »Er lebt, aber er will nicht reden.«
»Das wird sich schnell ändern. Ich habe bisher noch jeden zum Reden bekommen«, sagte Sjadú und ging auf den Altarraum zu. »Aber sag, wo sind deine anderen Männer?«
Urakib schluckte bei dieser Frage sichtlich. »Tot!«, würgte er beschämt hervor. »Nur Bagheel, Khutriel und ich haben das Gefecht mit den Gralsrittern überlebt.«
»Was redest du da?«, zischte Sjadú ungläubig. »Ihr wart doch wie üblich zu siebt! Und zwei von euren sechs Gegnern waren blind! Außerdem weiß ich von Khutriel, dass der andere Blinde sich mit den vier neuen Gralshütern schon gleich nach dem ersten Klingenkreuzen hier in die Kirche abgesetzt und nur dieser Dschullab den Durchgang zur Kirchentür verteidigt hat!«
Urakib wurde nun so bleich wie ein Leichentuch. »Aber die vier Neuen müssen schon im Besitz der geheimnisvollen Kräfte geweihter Gralshüter gewesen sein!«, verteidigte er sich. »Es war erschreckend, wie die vier Tempelritter und auch der Blinde die Klinge geführt haben! Jedenfalls sind meine Männer ihnen nicht gewachsen gewesen!«
Blitzschnell hob Sjadú die Rechte und schlug ihm mit dem Handrücken hart ins Gesicht. »Wage es nicht noch einmal, so etwas zu sagen! Gralshüter sind uns Judasjüngern nicht überlegen! Du und deine Männer, ihr habt schlichtweg versagt! Ihr habt euch täuschen lassen, nicht euer Bestes gegeben und damit Schande über euch und die ganze Gefolgschaft des Schwarzen Fürsten gebracht! Passiert das noch einmal, schneidest du dir besser gleich selber die Kehle durch!«
»Verzeiht, erhabener Erster Knecht!«, stieß Urakib hervor, fiel vor ihm auf das rechte Knie und senkte den Kopf, als wollte er Sjadú seinen entblößten Nacken zum tödlichen Schlag darbieten. »Gebietet über mein Leben und straft mich mit dem Hieb Eurer Klinge, wenn der Tod es ist, den ich Euch für das Versagen meiner Männer schulde!« Er hielt ihm die blutbeschmierte Streitaxt hin.
Sjadú ignorierte die ihm dargebotene Waffe. Stattdessen stieß er ihm seinen Stiefel grob in die Seite, sodass der Unterführer der Länge nach auf die Steinplatten stürzte. »Das nächste Mal bezahlst du mit deinem Blut!«, drohte er kalt, trat über ihn hinweg und winkte Bagheel mit herrischer Geste heran. »Bring zwei Kerzen! Ich will mir den geheimen Mechanismus in der Krypta ansehen!«
Urakib sprang hastig auf die Beine, riss Bagheel die Kerzen fast aus den Händen und beeilte sich, dem Ersten Knecht den Weg hinunter in die Krypta zu leuchten.
Die Treppe führte nicht auf geradem Weg in die Tiefe, sondern wurde auf halber Strecke von einem Absatz unterbrochen und machte dahinter einen scharfen Knick nach links. Der Lichtschein der Kerzen fiel auf den Absatz und das letzte Dutzend Steinstufen. Und dann lag die kühle Gruft vor ihnen.
Sjadú erfasste mit einem Blick die drei schlichten steinernen Sarkophage an der hinteren Längswand und das Halbrund der Altarnische am Kopfende der etwa fünfzehn Schritte breiten und knapp halb so tiefen Krypta. Drei Stufen führten zum Altarraum hinauf. In verblüffendem Gegensatz zum oberen Bereich der Kirche war dieser Teil mit seiner kunstvollen Holztäfelung, dem mächtigen Altarblock aus schwarzem Marmor sowie einem dreiteiligen Passionsgemälde und dem darüber hängenden Kruzifix vollkommen fertiggestellt und musste auf einen Gläubigen wie eine spirituelle Oase in einer kalten, unbehausten Steinwüste wirken. Auf der Marmorplatte des Altars, der die doppelte Dicke einer kräftigen Männerfaust hatte, standen zwei schwere eiserne Kerzenleuchter. Ihre ungewöhnlich breiten und klobigen, quadratischen Füße waren mit der Altarplatte fest verschraubt. In einer ölgefüllten Wandleuchte aus dunkelrotem Glas brannte mit ruhiger Flamme das ewige Licht, das in keinem geweihten Altarraum fehlen durfte.
Zwei lebensgroße Statuen, die auf breiten Sockeln ruhten, fassten das kostbar vertäfelte Halbrund der Altarnische rechts und links ein, als sollten sie den heiligen Bezirk bewachen. Beide Skulpturen bestanden aus grauem Gestein, bei dem es sich wohl um Granit handelte. Die linke Statue stellte einen Mann in einem langen, priesterähnlichen Gewand dar, der wie ein zu Stein erstarrter Wachposten mit der linken Hand den Schaft einer senkrecht stehenden eisernen Lanze umfasst hielt. Sjadú nahm an, dass sie den heiligen Joseph von Arimathäa darstellte. Bei der Figur auf der anderen Seite des Halbrunds handelte es sich um eine Frau. Es war jedoch keine Darstellung der Gottesmutter, sondern die einer älteren und vor allem wohlhabenden Frau, wie der vornehme Umhang und der angedeutete Schmuck verrieten. Ihre aufrechte Haltung mit dem leicht in den Nacken gelegten Kopf war die einer selbstbewussten Frau und aus ihren Gesichtszügen sprach Entschlossenheit. Vermutlich handelte es sich um Maria Magdalena.
Sjadú hasste es, solch einen geweihten Raum zu betreten, und sein Herz begann zu rasen. Aber wie die Dinge lagen, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich dazu zu überwinden.
Mit einem Würgen in der Kehle trat er an den schweren Altarblock und Urakib setzte schnell die Kerzen in den beiden Leuchtern in Brand, damit der erhabene Erste Knecht bei seiner Untersuchung des geheimnisvollen Mechanismus möglichst viel Licht hatte. Aber sofort wich er vom geweihten Altar wieder zurück.
Die goldene Tür des Tabernakels stand weit auf. In seine Hinterwand war eine zweite kleine Geheimtür eingelassen, die ebenfalls offen stand. Und in dieser versteckten Nische ragten drei gut daumendicke und handlange Eisenhebel aus dem Mauerwerk.
Sjadú berührte sie nicht und er nickte gnädig, als Urakib ihm auf seine Frage hin hoch und heilig versicherte, keinen der Hebel angefasst, geschweige denn bewegt zu haben. Er war zu gut mit den raffinierten Tricks und Schutzmechanismen vertraut, mit denen die Gralsritter den Heiligen Gral zu schützen suchten. Sie hatten zu allen Zeiten die besten und einfallsreichsten Baumeister und Techniker in ihre Dienste genommen und raffinierte Verstecke ersonnen, denen sogar er widerwillig Bewunderung zollen musste. Und er hatte nur ein einziges Mal den törichten Fehler begangen, die Funktionsweise eines solchen Hebelsystems durch reines Ausprobieren der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten herausfinden zu wollen. Er war kläglich gescheitert. Das war ihm eine Lehre gewesen. Und da sich einer der Gralshüter in ihrer Gewalt befand, der zweifellos in das Geheimnis eingeweiht war, gab es erst recht keinen Anlass, unvorsichtig zu sein und ein unnötiges Risiko einzugehen.
Sjadú wandte seine Aufmerksamkeit nun dem Altar zu und untersuchte dessen Oberfläche. Dies kostete ihn große Überwindung und kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Wer von dem unterirdischen Versteck und dem Geheimfach mit den drei Hebeln hinter dem Tabernakel nichts ahnte, der hätte kaum etwas Auffälliges entdeckt. Doch er fand sehr schnell die haarfeine Linie im scheinbar fugenlos glatten Marmor, die den schweren Marmorblock in zwei Teile schnitt.
Ihm entfuhr ein kurzes, grimmiges Auflachen. Der tonnenschwere Altar bestand aus zwei Blöcken, die vermutlich auf einem raffinierten System von Rollen ruhten und den Zugang zum Versteck freigaben, wenn man die richtige Stellung der drei Hebel kannte. Aber nein, das allein würde wohl nicht reichen. Er war sicher, dass die schwere eiserne Lanze in der Hand der Statue eine wichtige Rolle im geheimen Schutzmechanismus spielte, und seine Ahnung sagte ihm, dass dies auch auf die beiden Kerzenleuchter zutraf, deren Füße kaum ohne guten Grund so klobig ausgefallen und mit der Altardecke verschraubt waren.
»Nun, das werden wir schnell herausfinden«, murmelte Sjadú, flüchtete förmlich aus dem geweihten Altarraum und begab sich wieder nach oben.
Als er Augenblicke später hinter den stockfleckigen, rissigen Vorhang trat, erkannte er Dschullab sofort wieder. Der blinde Gefolgsmann von Abbé Villard hing hinter dem Segeltuch von der Decke herab. Die Beine pendelten in Kniehöhe über dem Boden. Man hatte ihm die Hände auf dem Rücken gefesselt, ein langes Seil an die Fessel gebunden und ihn daran hochgezogen. Dabei waren ihm die Arme aus den Schultergelenken gerissen worden. Er musste ungeheure Schmerzen haben, doch kein noch so schwacher Laut kam über seine Lippen.
»So sieht man sich wieder, Gralsdiener«, sprach Sjadú ihn voller Hohn an. »Obwohl, das Vergnügen des Wieder-Sehens ist ja leider nur einseitig.«
Die blinden, milchig trüben Augen von Dschullab richteten sich auf den Judasjünger. »Ich sehe mehr, als du jemals in deinem jämmerlichen Leben als Teufelsknecht vor die Augen bekommen wirst!«, gab er verächtlich, aber vollkommen ruhig zur Antwort und spuckte ihm dann so treffsicher ins Gesicht, als verfügten seine Augen über ihre volle Sehkraft.
Sjadú wischte sich den Speichel von der Wange. »Wenn du glaubst, mich mit solchen Lächerlichkeiten provozieren zu können, dann hast du noch immer nicht begriffen, mit wem du es zu tun hast«, erwiderte er mit kalter Beherrschung. »Ich weiß, dass du ein tapferer Mann bist und wohl auch unter der grausamsten und längsten Folter nichts verraten wirst, Dschullab. So ist das auch bei meinen Leuten. Aber dennoch wirst du reden und mir alles verraten, was ich wissen will, glaube mir. Denn für deinesgleichen gibt es etwas viel Schlimmeres und offenbar wirklich Unerträgliches – und das ist die Folter, die andere, völlig Unschuldige für euch erleiden müssen und die ihr sofort beenden könnt, sowie ihr zu reden beginnt! Euer lächerlicher Christenglaube erlaubt es euch nicht, andere für euch Todesqualen erleiden zu lassen, ist es nicht so?«
Damit wandte er sich von ihm ab und erteilte seinen Männern den Auftrag, schnellstens einige Christen in der Stadt aufzugreifen und zu ihm zu bringen.
»Es werden ja jetzt schon überall Überlebende zusammengetrieben, um in die Sklaverei verkauft zu werden! Notfalls kauft ihr einer Mameluckenbande ihre menschliche Beute ab!«, befahl er und warf einem Mann seines Vertrauens einen Beutel mit Goldstücken zu. »Aber ich will nur Frauen und Kinder! Je jünger, desto besser! Wir wollen unserem blinden Gralsdiener doch etwas bieten, was ordentlich an sein barmherziges Christenherz rührt. Mal sehen, wie viel Blut er auf sein Gewissen zu laden gewillt ist, bevor er redet!«
Die Männer lachten höhnisch und eilten davon, um auszuführen, was der erhabene Erste Knecht ihnen aufgetragen hatte.
»Gottes Fluch treffe dich! Du wirst bis in alle Ewigkeit im Fegefeuer brennen!«, stieß Dschullab in ohnmächtiger Verzweiflung hervor. Niemals würde er einen anderen Menschen leiden lassen, wenn es in seiner Macht stand, es zu verhindern. Der heilige Abbé und sein Bruder Bismillah würden es verstehen und billigen. Dennoch zerriss es ihn innerlich, dass ihm keine andere Möglichkeit blieb, als dem skrupellosen Teufelsknecht Sjadú den Zugang zum unterirdischen Heiligtum der Gralshüter zu verraten.
3
Gute siebzig Ellen11 unter der Krypta der Kirche kniete Abbé Villard von Saint-Omer mit seinem blinden Gefährten Bismillah vor dem marmorweißen Altar des innersten Heiligtums der Gralshüter im Heiligen Land. Seine Vorgänger hatten es vor mehreren Hundert Jahren in den verzweigten Höhlen unter dem Montjoie gebaut. Und nun war dessen Ende als sicheres Versteck der Gralsritter gekommen. Schon bald würden hier ihre Schwerter aus den Scheiden fliegen und die scharfen, doppelschneidigen Damaszenerklingen auf die ihrer Todfeinde treffen!
Dichtes eisgraues Haar fiel dem alten Gralsritter wie ein gesponnenes Vlies auf die hageren Schultern, die unter dem weißen Umhang mit dem blutroten Tatzenkreuz der Templer deutlich hervorstachen. In demselben silbrigen Weißgrau leuchtete im Licht weniger Öllampen auch sein Vollbart, der ihm bis auf die Mitte der Brust wallte. Sein ledrig verwittertes Gesicht mit den zahllosen tief eingegrabenen Linien und Furchen besaß viel Ähnlichkeit mit einem alten, von Wind und Wetter zerschundenen Stück Treibholz. Es waren die äußeren Spuren der Last der Verantwortung, die er zu viele Jahre hatte tragen müssen. Aber noch mehr waren sein Herz und seine Seele ermüdet. Sie trugen die Spuren und Wunden von zweihundert Jahren Einsamkeit als oberster Gralshüter und waren gezeichnet davon, die rasche Vergänglichkeit jener Gefährten hinnehmen zu müssen, die sein Leben für eine kurze Wegstrecke mit ihrer kostbaren Kameradschaft und Treue begleitet und den Schutz des heiligen Kelchs mit ihrem Leben bezahlt hatten. Ein Ausdruck tiefer Müdigkeit, aber auch großer Gelassenheit lag in seinen zerfurchten Zügen.
Abbé Villard spürte die Nähe der Judasjünger, die von der Bruderschaft auch Iskaris, nach dem Jesusverräter Judas Iskariot, genannt wurden, so deutlich wie Tiere das Nahen einer Naturkatastrophe. Doch er dachte nicht an Flucht. Seine Mission war erfüllt, sein Lebensweg an seinem Ende angelangt. Und zu groß war die innere Erschöpfung, die ihn nach zwei Jahrhunderten in seinem Amt als Gralshüter bis in die letzte Faser seines Körpers erfüllte.
»Du solltest jetzt gehen, Bismillah«, brach Abbé Villard die Stille ihres Gebetes. »Noch ist Zeit genug, um durch die Katakomben der frühen Christengemeinde zu entkommen.«
Bismillah, der den braunen Umhang eines Turkopolen trug, richtete den Blick seiner milchig trüben Augen auf den Abbé. »Wie könnt Ihr glauben, dass ich Euch jetzt verlasse, Herr! Die Iskaris werden bald hier sein und es wird zum Kampf kommen.«
Der Abbé nickte. »Ja, so wird es sein.«
»Wie könnte ich da jetzt die Flucht ergreifen? Ich stehe bis zu meinem letzten Atemzug zu meinem Treueschwur und werde mit Euch kämpfen! Keine Macht der Welt kann mich in dieser Stunde, wo sich unser Schicksal erfüllen wird, von Eurer Seite wegbringen! Es ist schon bitter genug, dass mein Bruder …« Bismillah brach mitten im Satz ab, weil ihm die schändlichen Worte vom Verrat nicht über die Lippen kommen wollten.
»Quäle dich nicht mit unsinnigen Vorwürfen«, sagte Abbé Villard sofort und legte ihm seine Hand besänftigend auf die Schulter. »Dein Bruder ist ein tapferer Mann, dessen Treue und Mut jenseits aller Zweifel liegen. Keinem von euch kann ich genug für das danken, was ihr in der langen Zeit eurer Bruderschaft für mich und unsere Gemeinschaft getan habt!«
»Er hat ihnen den geheimen Mechanismus verraten, statt den Tod zu wählen! Ich spüre es so deutlich, wie ich Euren Atem spüre, und ich weiß, dass auch Ihr es spürt! In wenigen Minuten wird Sjadú mit seinen Männern das Heiligtum stürmen und entweihen!«, murmelte Bismillah mit gesenktem Kopf, als schämte er sich für den Verrat seines Bruders. »Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ausgerechnet mein Bruder derjenige sein würde, der den Iskaris den Weg in die heilige Grotte weist, nachdem dieses Versteck Hunderte von Jahren eines der bestgehüteten Geheimnisse der Gralshüter gewesen ist!«
»Gewiss, er hat ihnen die Funktion des geheimen Mechanismus erklärt und ihnen den Weg durch die Gänge hierhin ins Heiligtum gewiesen«, räumte Abbé Villard ein. »Aber er wird es nicht aus Angst vor Schmerzen und Tod getan haben, sondern weil ihm Sjadú und seine Teufelsknechte keine andere Wahl gelassen haben, dessen bin ich mir ganz sicher. Und wir beide wissen doch nur zu gut, über welch teuflische Mächte Sjadú und seine Männer verfügen. Also gräme dich nicht und denke gut von deinem Bruder, so wie ich es tue. Zudem: Akkon ist gefallen, das Heilige Land für die Kreuzritter verloren und der Heilige Gral auf dem Weg nach Paris. Und damit hat dieser Ort, sosehr er uns auch am Herzen liegen mag, keine weitere Bedeutung mehr. Mag Sjadú ihn also nur betreten und mit seiner Gegenwart beschmutzen, es wird nicht der Triumph sein, den er sich erhofft hat! Und dass es dazu nicht gekommen ist, verdanken wir zu einem wesentlichen Teil der Tapferkeit und Selbstaufgabe deines Bruders.«
Bismillahs Züge glätteten sich ein wenig und er nickte mit stummer Dankbarkeit für die Worte, die der Gralshüter für seinen Bruder gefunden hatte. Und jeder versank wieder in seinen eigenen Gedanken, die sich sehr ähnlich waren.
Schon bald wird auch dieser wunderbare Ort den Weg allen menschlichen Schaffens gehen und aufhören zu existieren, ging es Abbé Villard durch den Kopf, während er seinen Blick noch ein letztes Mal durch das unterirdische Heiligtum schweifen ließ. Und obwohl er in seinem starken Glauben stets die rasche Vergänglichkeit aller von Menschenhand erschaffenen Werke akzeptiert hatte, regte sich nun doch eine Spur stillen Bedauerns in seiner Brust. Denn dies war ein Ort von wahrlich ergreifender Schönheit, mit dessen Ausbau christliche Handwerker und Künstler schon zur Zeit von Joseph von Arimathäa und Maria Magdalena in dem verzweigten Labyrinth unterirdischer Gänge und Höhlen begonnen hatten.
Die heilige Grotte, wie Abbé Villard das Heiligtum der Gralshüter auch nannte, war ein Gewölbe mit einer Deckenhöhe von mehr als zwanzig Ellen. Es besaß die Form einer Rotunde12 mit einem Durchmesser von gut vierzig Schritten. Hinter dem äußeren Kreis des Umgangs strebten acht geriffelte hellgraue Doppelsäulen mit korinthischen Kapitellen der gewölbten Decke entgegen. Diese schlanken Doppelsäulen, die ein Mann gerade noch umfassen konnte und die durch Rundbogen miteinander verbunden waren, bildeten wie der Umgang einen perfekten inneren Kreis um das Heiligtum der Grotte. Denn in seinem Zentrum und damit genau unter der Mitte des Deckengewölbes erhob sich auf einem dreistufigen Sockel der Altar. Er bestand aus leuchtend weißem Marmor, der wie poliertes Perlmutt glänzte. Zwei goldene, fünfarmige Kerzenleuchter rahmten ein ebenfalls goldenes, gut anderthalb Ellen hohes Kruzifix ein. Kunstvolle Mosaiken bedeckten Wände und Decken. Sie stellten groß angelegte Wandgemälde aus Stein dar, wie nur begnadete Künstler sie zu schaffen vermochten.
Rechts und links von der Tür, die aus dem Vorraum in das Heiligtum führte, zeigte das Mosaik lebensgroß eine Prozession der Märtyrer und Heiligen. Sie mündete, von beiden Seiten kommend, auf eine Darstellung des letzten Abendmahls: Jesus in der Mitte seiner Jünger, mit dem Kelch in seinen erhobenen Händen. Und über seinem Kopf schwebte ein weißer Vogel.
Das Mosaik des Deckengewölbes zeigte einen dunkelblauen Sternenhimmel, in dessen Mitte ein schlichtes weißes Kreuz prangte. Hunderte von weißen, spitz gezackten Sternen umgaben das Kreuz in konzentrischen Kreisen. In den vier Ecken, den Kuppelzwickeln, fanden sich, ebenfalls in weißen Mosaiksteinen, die Symbole der vier Evangelisten: der Engel für Matthäus, der Löwe für Markus, der Stier für Lukas und der Adler für Johannes.
In einer rechts gelegenen Ausbuchtung lag das Baptisterium, in das man steigen und untertauchen musste, um beim Eintritt in die Kirche das heilige Sakrament der Taufe zu empfangen. Gespeist wurde das Becken von einem kräftigen, unterirdischen Wasserlauf. Er sprudelte aus der offen liegenden Felswand, die sich wie ein krummer Rücken dem Becken zuneigte und über die sich das klare Wasser ergoss. Links vom Becken stand noch die schmale Geheimtür offen, durch die die vier frisch geweihten Gralsritter vor wenigen Minuten die Grotte mit dem Heiligen Gral verlassen hatten. Dahinter erstreckte sich ein langer Felsgang, der in einer zum Meer hin offenen Höhle an der Südspitze von Akkon endete. Und dort würde das Beiboot der zyprischen Handelsgaleere Calatrava auf sie warten, deren Kapitän den gut bezahlten Auftrag erhalten hatte, die vier Ritter nach Zypern zu bringen. Von da an waren sie dann auf sich allein gestellt, um einen sicheren Weg ins ferne Paris zu finden und den heiligen Kelch in der dortigen Templerburg einem Eingeweihten zu übergeben. Ein geheimes Versteck wartete in der mächtigen Stadtburg schon auf den Kelch des ewigen Lebens.
Obwohl er wusste, dass er sich lange in seinen Entscheidungen geprüft und alles getan hatte, was in seiner Macht stand, beschlich ihn nun doch die quälende Sorge, ob er in den letzten Wochen auch wirklich alles bedacht und mit den vier Templern die richtige Wahl getroffen hatte. Würden sie der gewaltigen Aufgabe gewachsen sein, die er auf ihre Schultern gelegt hatte?
Gewiss, jeder von ihnen war ein herausragender Kämpfer, der mit Recht die weiße Clamys, den Mantel der Tempelritter, trug und dem Orden der gefürchteten Kriegermönche alle Ehre gemacht hatte. Aber würden die vier Männer in den schweren Prüfungen, die zweifellos auf sie warteten, sich auch als jene verschworene Gemeinschaft erweisen, die sie bilden mussten, um den Iskaris und anderen Gefahren gewachsen zu sein? Immerhin hätten ihre Charaktere gar nicht unterschiedlicher sein können!
Abbé Villard rief sie sich einzeln vor sein geistiges Auge. Und er sah sie so deutlich vor sich, als würden sie vor ihm stehen.
Da war Gerolt von Weißenfels, der drittgeborene Sohn eines unbedeutenden Raubritters aus der südwestlichen Eifel. Ein kräftiger, blond gelockter Mann mit einem freundlich offenen Gesicht und ein begnadeter Schwertkämpfer von gerade mal neunzehn Jahren, der aber schon seit drei Jahren im Heiligen Land gekämpft und sich den Eintritt in den Eliteorden mit Schwert und Lanze redlich erstritten hatte. Um ihn machte er sich am wenigsten Sorgen, Gerolt war ein ruhiger und um Ausgleich bedachter Mann, der auch im ärgsten Kampfgetümmel Übersicht und ruhig Blut bewahrte und die besten Anlagen für einen natürlichen Anführer hatte.
Ähnlich verhielt es sich mit dem Levantiner Tarik el-Kharim ibn Suleiman al-Bustani, in dessen Adern eine gute Portion Beduinenblut floss. Seine christlichen Vorfahren kamen aus Ägypten und sein Großvater Said hatte sich beim sechsten Kreuzzug im Dienst des Königs Ludwig IX. von Frankreich nicht nur wiederholt durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet, sondern auch einen Mordanschlag auf den König verhindert. Um ein Haar hätte er dafür mit seinem eigenen Leben bezahlt, hatte der vergiftete Dolch des gedungenen Meuchelmörders ihn doch im Handgemenge schwer verwundet. König Ludwig hatte ihn daraufhin nach seiner Gesundung in den erblichen Ritterstand erhoben. Tarik el-Kharim, eine schlanke und sehnige Gestalt mit leicht getönter Haut und krausem schwarzem Haar, war in jeder Hinsicht ein würdiger Nachkomme seines Großvaters. Er war ein Mann des Frohsinns und der unerschütterlichen Zuversicht, zugleich aber ein ausgezeichneter Bogenschütze und leichtfüßiger Schwertkämpfer, den jeder Gegner fürchten musste.
Der dritte Ritter im Bunde war der Franzose Maurice von Montfontaine. Und bei ihm waren gewisse Bedenken, was seine Charakterstärke anging, wohl nicht ganz abwegig. Denn der zweiundzwanzigjährige Edelmann Maurice, ein bestechend gut aussehender Ritter von edler Geburt mit verwandtschaftlichen Beziehungen zum französischen Königshaus, zeichnete sich nicht nur durch seine elegante Schwertkunst aus, sondern auch durch sein äußerst hitziges Temperament. Er ließ sich leicht zu einer unbedachten Handlung hinreißen und ihm saß die Klinge locker, vor allem wenn er sich in seiner Ehre verletzt wähnte. Zudem trug er noch immer die auffahrende Arroganz seiner edlen Herkunft in sich. Nicht einmal die eiserne Disziplin der Templer hatte ihm dies austreiben können. Seine Jugendjahre waren von Maßlosigkeit und wilden Exzessen geprägt gewesen. Dass er sein Erbe erst mit Frauen, Wein und Glücksspiel durchgebracht, ein Duell nach dem anderen provoziert, die Rettung seines Seelenheils schließlich einige Zeit vergeblich als Novize in einem französischen Benediktinerkloster gesucht und erst nach langen Irrungen zu seiner Bestimmung im Orden der Templer gefunden hatte, warf ein bezeichnendes Licht auf sein komplexes, zerrissenes Innenleben. Und ob er die inneren Anfechtungen und die Neigung zu sündhaftem Leben, die seine Jahre vor dem Eintritt in den Orden geprägt hatten, endgültig überwunden hatte, das allein konnte nur die Zukunft zeigen. Er betete zu Gott, dass es so sein möge!
Auch als er an den Schotten McIvor von Conneleagh dachte, der mit seinen achtundzwanzig Jahren der älteste der vier Gralsritter war, regten sich Sorgen in seiner Brust. Dieser Bär von einem Krieger aus dem schottischen Hochland, der eine Eisenklappe über dem ausgestochenen linken Auge und einen kurzen Zopf im Nacken trug und dessen Züge so derb und kantig waren wie seine ganze Gestalt, erweckte äußerlich den Anschein eines in sich ruhenden, kampferprobten und gänzlich unerschrockenen Mannes. Und wahrlich, keiner vermochte den schweren Bidenhänder, das Langschwert, das mit beiden Händen ergriffen und geführt werden musste, mit einer derartigen Geschicklichkeit zu führen wie er. Und seine Gutmütigkeit im Kreise der Kameraden stand seiner Tapferkeit in nichts nach. Doch auch er führte in seinem Innern noch immer einen erbitterten Kampf mit seinem ganz eigenen Dämon, der sich tief in seiner Seele festgekrallt hatte und der nicht so leicht zu besiegen war wie ein Feind auf dem Schlachtfeld. Nach dem Verlust seiner großen Liebe hatte er nämlich seinen Jugendfreund, der ihn aus verletzter Eitelkeit verraten, die Frau seines Herzens in den Freitod getrieben und sie damit beide um ihr Glück gebracht hatte, zu einem Messerkampf herausgefordert. Ein grotesk ungleicher Kampf, dessen Ausgang von vornherein festgestanden und dazu geführt hatte, dass McIvor von seiner Familie verstoßen und geächtet worden war. Das Blut, das er damals in seinem wilden Zorn vergossen hatte, hatte mehr als nur seine Klinge befleckt und ihn in die Rastlosigkeit getrieben. Die Schandtat seiner Jugend quälte ihn noch immer, obwohl seitdem gute zehn Jahre verstrichen waren. Und sie ließ ihn immer wieder in düstere Gemütsstimmungen versinken und um sein Seelenheil fürchten. Eine Furcht, die eines Tages ihn und seine Kameraden in eine bedrohliche Situation führen und ihn dazu veranlassen konnte, als Gralshüter einen nicht wiedergutzumachenden Fehler zu begehen …
Mit Macht befreite sich Abbé Villard aus dem dunklen Strudel seiner sorgenvollen Gedanken. Sie brachten nichts. Die Entscheidung war längst gefallen und alle vier hatten ihr schweres Amt angetreten. Nun lag alles in ihren Händen – der Heilige Gral und der Kampf mit den Mächten der Finsternis. Und wer war er überhaupt, dass er den Ratschluss des Allmächtigen in Zweifel zog? Das Auge Gottes, wie er den geheimnisvollen weißen Falken nannte, hatte ihm diese vier Männer unmissverständlich offenbart. Und dass der göttliche Segen wahrhaftig auf ihnen lag, hatten die beiden Weihen hier im Heiligtum bewiesen. Niemals wäre es ihnen gelungen, die Gralsschwerter aus dem Felsen im Wasserbecken zu ziehen, wenn es nicht so gewesen wäre. Auch wären ihnen die besonderen Kräfte, die göttlichen Gnadengaben, versagt geblieben, wenn sie nicht berufen gewesen wären. Ein jeder von ihnen hatte in Ausübung seines heiligen Amtes Gewalt über eine besondere Kraft der Natur erhalten. Eine göttliche Kraft, die jedoch erst noch in ihnen wachsen musste. Aber das stand auf einem völlig anderen Blatt. Alles, was ihm jetzt noch zu erhoffen blieb, war …
»Die Iskaris!«, rief da Bismillah plötzlich leise und ließ ihn aus seinen Gedanken auffahren. »Sie kommen, Herr!«
4
Im nächsten Augenblick wurde auch schon in der Rundung der umlaufenden Wand die Geheimtür aufgestoßen, durch die man vom Vorraum mit dem Sarkophag des Joseph von Arimathäa in das Heiligtum der Gralshüter gelangte. Doch nicht Sjadú, der Erste Knecht des Fürsten der Finsternis, stürmte an der Spitze seiner Gefolgschaft mit blankgezogener Klinge in die heilige Grotte, sondern die Vorhut bildeten zwei raugesichtige Schergen, deren Verlust bei einem Gegenangriff Sjadú wohl am leichtesten verschmerzen konnte.
Abbé Villard und Bismillah hatten jedoch keinen Sinn darin gesehen, ihre Todfeinde schon an der Tür in ein Gefecht zu verwickeln, sondern waren am Altar geblieben. Sie wussten, was sie erwartete, und keiner von ihnen fürchtete sich vor dem Unausweichlichen. Für sie hatte der Tod keinen Schrecken, davor bewahrte sie ihr unerschütterlicher Glaube an die Liebe und Barmherzigkeit Gottes.
Die Iskaris, zehn an der Zahl, drängten sich durch den gerade mannsbreiten Eingang und fächerten sich sofort zu einer halbkreisförmigen Angriffslinie auf. Einer der nachdrängenden Männer hob augenblicklich seine Lanze, als er den weißhaarigen Gralsritter vor den Stufen des Altars erblickte, und schleuderte ihm seine Waffe entgegen. Töricht, wie der Mann war, hoffte er, derjenige zu sein, der sich rühmen konnte, den legendären Abbé Villard von Saint-Omer niedergestreckt zu haben.
Abbé Villard rührte sich nicht von der Stelle. Er hob nur die linke Hand und die Lanze wurde mitten im Flug von ihrer Bahn abgelenkt, schoss mehrere Schritte links von ihm vorbei und prallte gegen den Felsen, aus dem sich das klare Quellwasser in das Becken ergoss.
Mit zwei schnellen, katzengleichen Sätzen war Sjadú bei dem Mann, der die Lanze geschleudert hatte. »Du hirnloser Trottel! Hast du vergessen, mit wem du es zu tun hast? Und wer hat dir erlaubt, den ersten Streich zu führen?«, schrie er ihn an und schlug ihm den Knauf seines Schwertes so brutal ins Gesicht, dass der Mann zu Boden geschleudert wurde und bewusstlos liegen blieb. Und mit wild funkelnden Augen blickte Sjadú in die Runde seiner jäh erstarrten Männer. »Keiner von euch rührt mir den alten Gralsritter an! Er gehört mir! Es wird allein mein Schwert sein, das ihn in Stücke schneidet! Ihr könnt euch den Blinden vornehmen. Der wird euch schon Schwierigkeiten genug machen. Aber ihr greift erst an, wenn ich es euch sage!«
»Ja, erhabener Erster Knecht«, murmelten die Männer verstört.
»Du hast dich wahrlich nicht verändert, Sjadú, und bist in den achtzig Jahren, die wir uns nicht mehr gesehen haben, deinem bösartigen Charakter treu geblieben«, sagte Abbé Villard in ruhigem Ton.
»Und auch der Gestank, den ihr Judasjünger verbreitet, ist so ekelhaft wie eh und je«, warf Bismillah ein und verzog angewidert die Nase. Iskaris strömten oft einen abstoßenden, an Verwesung erinnernden Geruch aus.
Sjadú schenkte dem Blinden weder eine Antwort noch einen Blick. Seine Augen fixierten allein den ergrauten Gralshüter, als er nun durch einen der Rundbogen auf ihn zutrat, dann aber in Kenntnis der Kräfte, über die der alte Ritter wohl noch immer verfügte, gut zehn Schritte vor ihm stehen blieb.
»In der Tat, gut achtzig Jahre sind seit unserer letzten Begegnung vergangen, Villard. Es war damals eine sehr unbefriedigende Begegnung, für uns beide, wie ich wohl annehmen darf«, sprach er ihn an, und ein falsches Lächeln trat auf sein Gesicht, das von makelloser Ebenmäßigkeit und Schönheit war. Auch der meisterlichste aller Bildhauer oder Maler hätte kein Abbild eines Menschen mit so vollkommenen Zügen und Proportionen erschaffen können. Im Fall von Sjadú war es jedoch ein Trugbild, eine perfekte Maske, hinter der sich das abgrundtief Böse und Schlechte der Welt verbarg. »Aber diesmal wirst du mir nicht entkommen. Längst ist die Zeit vorbei, in der du mir ein ebenbürtiger Gegner warst. Deine Stunde hat geschlagen, alter Mann.«
»Das wird sich zeigen«, erwiderte Abbé Villard gelassen, obwohl er insgeheim wusste, dass Sjadú recht behalten würde. Im Stundenglas seines Lebens rannen in diesen Minuten die letzten Rinnsale Sand durch den engen Hals. Aber das hieß nicht, dass der oberste der Iskaris leichtes Spiel mit ihm und Bismillah haben würde. Sie würden ihr Leben mit dem Schwert in der Hand teuer verkaufen, und wenn das Ende des Gefechtes gekommen war, würden nicht nur ihre Leichen im Blut liegen, dessen war er so gewiss, wie er an Gott glaubte und an das Leben nach dem Tod. »Aber wenn du gekommen bist, um den Heiligen Gral in deinen Besitz zu bringen, so kommst du wieder einmal zu spät. Mir scheint, dass dies deine Bestimmung ist.«
Diese Worte wirkten auf Sjadú wie ein Kübel eisigen Wassers, der sich über ihn ergoss. Und erst jetzt wurde ihm wohl bewusst, dass auf dem Altar kein Kelch stand. Und außer dem Abbé und dem Blinden sah er auch keinen von den vier neuen Gralshütern, deren Namen ihm Dschullab bereitwillig genannt hatte, als er einem der herbeigeschleppten jungen Mädchen seinen Dolch an die Kehle gesetzt hatte. Nun bemerkte er auch die offen stehende Tür neben dem Wasserbecken auf der anderen Seite der Rotunde.
Das Gesicht des Judasjüngers verlor schlagartig jegliche Schönheit und verzerrte sich vor maßloser Wut, weil er offenbar wieder einmal zu spät gekommen war, um des Heiligen Grals habhaft zu werden. Mit sich überschlagender Stimme schrie er zwei Namen und befahl diesen Männern, auf der Stelle die Verfolgung der Gralsritter aufzunehmen. »Holt sie ein und haltet sie auf, so lange ihr könnt, und wenn es euch das verfluchte Leben kostet!«, rief er. »Auf keinen Fall dürfen wir ihre Spur verlieren!«
Die beiden Iskaris rannten in einem sicheren Bogen um den Abbé und seinen blinden Gefährten herum und verschwanden im nächsten Moment durch die hintere Tür in den Katakomben, die die erste Christengemeinde noch zur Zeit ihrer Verfolgung dort angelegt hatte.
»Sie müssten schon Flügel haben, wenn sie meine Ritter jetzt noch einholen wollten«, sagte der Abbé spöttisch. »Du hast auch diesmal verloren, Sjadú.« Und damit zog er sein Schwert aus der Scheide. Augenblicklich zog auch Bismillah an seiner Seite blank.
»Sie werden mir nicht entkommen – so wie auch du mir diesmal nicht entkommst, Villard!«, schrie Sjadú in wildem Zorn und entblößte sein halb verfaultes Gebiss, das in einem krassen Gegensatz zu seinen vollkommenen Gesichtszügen stand. »Urakib, du nimmst dir mit den anderen den Blinden vor! Hackt ihm die Arme ab und schneidet ihn in Streifen!«
Sofort stürzten sich die restlichen Iskaris auf Bismillah, der mit unglaublicher Behändigkeit zu einer der Doppelsäulen zurückwich, um sich in diesem seinem letzten Gefecht zum Ruhme Gottes zumindest den Rücken so lange wie möglich frei zu halten. Und es würde für die Iskaris alles andere als ein leichter Kampf werden, auch wenn sie ihn in erdrückender Überzahl angriffen! Seinen Augen mochte die Sehkraft fehlen, aber er war alles andere als blind, was die genaue Wahrnehmung seiner Umgebung betraf. Er sah nur auf andere Art und Weise, nämlich mit der Oberfläche seiner Haut. Dank der göttlichen Gnadengabe, die ihm bei seiner Weihe geschenkt worden war, vermochte er jede kleinste Bewegung um sich herum aufgrund der Luftveränderungen wahrzunehmen und genau zu lokalisieren.
Sein Schwert flog blitzschnell hoch und parierte den Streich, den der erste heranstürmende Iskari noch aus dem Lauf heraus nach ihm führte. Für seinen völlig unbedachten Vorstoß erhielt jener sogleich die tödliche Quittung. Denn kaum waren ihre Klingen laut klirrend aufeinandergetroffen, als Bismillah nach der Parade sein Schwert kurz zurückriss, das Handgelenk leicht abknickte und ihm seine Waffe mitten in die Brust rammte.
»Sag dem Höllenmeister, wenn er dich gleich auf ewig ins Fegefeuer wirft, dass ein Blinder dich nach dem ersten Streich in den Tod geschickt hat!«, rief Bismillah trocken dem zu Boden stürzenden, röchelnden Judasjünger zu. »Und sag ihm, dass noch mehr von euch gleich folgen werden!« Aber er wusste auch, dass die anderen Iskaris nun gewarnt sein und denselben Fehler, nämlich seine Kampfkraft zu unterschätzen, nicht begehen würden. Den nächsten tödlichen Hieb zu setzen, würde erheblich schwieriger sein.
Der Abbé hatte sich indessen gegen den wuchtigen Schlag gewappnet, der ihn jeden Augenblick treffen musste. Doch diesen Schlag würde Sjadú nicht mit dem Schwert ausführen, sondern er würde wie aus dem Nichts mit der unsichtbaren Kraft kommen, die der Fürst der Finsternis ihm verliehen hatte, als der Erste Knecht seinen Atem getrunken hatte.
Und so geschah es auch. Die Luft vor ihm schien sich plötzlich zu einem wagenradgroßen Ball zu verdichten, hinter dem sich Sjadús Gestalt leicht verzerrte, als blickte er durch schwach bewegtes Wasser. Der Ball, den nur ein erfahrener Gralshüter zu erkennen vermochte, raste auf ihn zu und zielte auf seine Brust. Doch noch bevor dieser ihn treffen und zu Boden werfen konnte, warf Abbé Villard ihm ein ähnlich verdichtetes Luftgebilde entgegen. Der Zusammenprall erschütterte sie beide ähnlich stark und ließ sie einen Schritt zurückwanken.
Sofort versuchte es Sjadú ein zweites Mal, wobei er die Druckwelle in Form eines schmalen Rammbockes bildete, der den Unterleib des Gralshüters zum Ziel hatte. Doch auch diesen fast unsichtbaren Angriff vermochte der Abbé mit einer konzentrierten Gegenattacke abzuwehren. Zur selben Zeit steigerte sich links von ihm das Aufeinanderprallen von Schwertklingen zu einem wütenden, metallischen Crescendo, das im Gewölbe so laut widerhallte, als lieferten sich Dutzende von Kriegern ein unerbittliches Gefecht.
Ein ärgerlicher Ausdruck huschte über das Gesicht des Ersten Knechtes, als er sah, dass er Abbé Villard auf diese Weise nicht überwältigen konnte. Nun riss er den Mund weit auf, hauchte gegen seine flache linke Hand und streckte sie ihm mit breit gespreizten Fingern entgegen. Augenblicklich schossen Flammen zwischen seinen Fingern hervor, die sich in Sekundenschnelle zu einer Feuerwand von doppelter Mannesbreite vereinten und nach dem Gralsritter griffen.
Doch Abbé Villard wusste auch diesen teuflischen Angriff noch rechtzeitig abzuschmettern, bevor die Flammen ihn umhüllen und seine Kleidung in Brand setzen konnten. Die lodernde Feuersbrunst prallte nur zwei, drei Schritte von ihm entfernt gegen die unsichtbare Barriere, die er kraft seiner göttlichen Gnadengabe vor sich aufgebaut hatte. Die Flammenwand zerbarst in unzählige einzelne, kleine Feuerzungen wie ein explodierender Feuerwerkskörper. Die Feuersplitter stiegen wie Funkenregen bis zur Gewölbedecke hoch und erloschen beim Niedersinken.
Sjadú fluchte unterdrückt, fasste sich aber schnell wieder und schenkte dem Abbé ein widerwillig anerkennendes Grinsen. »Nicht schlecht, alter Gralshüter! Du weißt dich noch immer deiner verfluchten Christenhaut zu erwehren.«
»Ich weiß, was ich einem speichelleckenden Knecht des Schwarzen Fürsten schuldig bin«, erwiderte Abbé Villard mit trockenem Spott. »Du sollst doch nicht sagen können, ich hätte es dir leicht gemacht. Du musst schon mehr aufbieten, wenn du mich am Boden liegen sehen willst!«
»Das werde ich, und zwar in deinem eigenen Blut!«, antwortete Sjadú grimmig. »Also warum lassen wir nicht die neckischen Spiele und fechten es von Mann zu Mann aus? Ich denke mal, ein Ritter wie du stirbt gewiss lieber durch eine Klinge als auf irgendeine andere Art!«
»Mir soll es recht sein. Doch es wird sich zeigen, wer hier durch wessen Klinge stirbt«, erwiderte Abbé Villard scheinbar gleichmütig. Insgeheim war er jedoch froh, dass Sjadú sein Glück nun mit dem Schwert versuchen wollte. Denn die drei Abwehrmaßnahmen hatten ihn doch mehr Kraft gekostet, als er sich hatte anmerken lassen. Ein, zwei weitere Angriffe dieser Art hätten ihn mit Sicherheit dermaßen erschöpft, dass er kaum mehr auf den Beinen hätte stehen können.
»Dann lass die Schwerter sprechen!«, stieß Sjadú hervor, kam mit federnden Schritten auf ihn zu und griff an.
Abbé Villard parierte die ersten Schläge mit Leichtigkeit, gab sich jedoch keinen Illusionen hin. Ihr erstes Klingenkreuzen hatte nichts zu bedeuten und war nicht mehr als ein gegenseitiges Abtasten. Der Iskari versuchte, ihn mit leicht durchschaubaren Attacken und Finten zu beschäftigen, während er ihn mit höchster Wachsamkeit beobachtete, um herauszufinden, wo seine Schwächen lagen und auf welcher Körperseite er seine Deckung mehr als anderswo vernachlässigte.