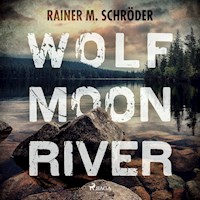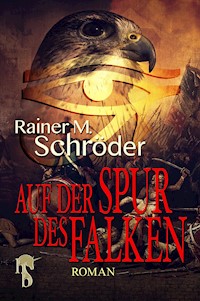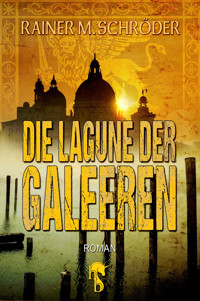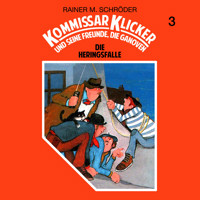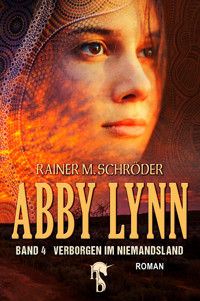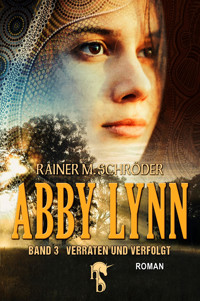4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Sprache: Deutsch
Tobias Heller, der Sohn eines Expeditionsleiters und Ägypten-Forschers, wächst in der Obhut seines Onkels auf Gut Falkenhof auf. Mit 16 Jahren beschließt er, es seinem Vater gleichzutun: Er sehnt sich nach der weiten Welt und will seine eigenen Abenteuer erleben. Als eines Abends der mysteriöse Graf von Zeppenfeld auf Gut Falkenhof auftaucht, ahnt Tobias nicht, dass er sich schon mitten im größten Abenteuer seines Lebens befindet: Der Graf versucht mit allen Mitteln, einen wertvollen Stock aus Ebenholz in seine Macht zu bringen. Er weiß, dass der Silberknauf in Form eines Falkenkopfes ein Geheimnis birgt. Als Tobias sich weigert, den Stock herauszugeben, ist plötzlich nichts mehr, wie es einmal war. Er ist fest entschlossen, das Geheimnis des Ebenholzstocks zu lösen, und sieht in der Flucht von Gut Falkenhof den einzigen Ausweg. Band 1 der »Falken«-Reihe von Rainer M. Schröder. Europa in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Es ist die Zeit der Restauration und der Geheimbünde, die Zeit von aufregenden Erfindungen und abenteuerlichen Entdeckungsreisen. Tobias Heller, der Sohn eines Forschers und Entdeckers, wächst in der Obhut seines Onkels auf und besitzt einen Ebenholzstock mit einem Silberknauf in Form eines Falkenkopfes. Was Tobias nicht ahnt: Der Knauf birgt ein Geheimnis und ist der Auslöser eines so aufregenden wie gefährlichen Abenteuers, das Tobias und seine Freunde, den Beduinen Sadik und die Landfahrerin Jana, durch ganz Europa führen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Im Zeichen des Falken
Roman
In Liebemeinem Sohn Axelund meinem ersten EnkelTobias Wiemer.Möge euer Leben dasAbenteuer eurer Wünsche sein.
Erstes Buch:Tobias
Februar 1830
Auge in Auge!
Der hohe, weitläufige Dachboden vom Landgut Falkenhof mit seinem Gewirr mächtiger Stützbalken und Querstreben aus eisenharten Eichenbalken lag in Dämmerlicht getaucht. Zu beiden Seiten des mannshohen Mittelganges standen unter den Dachschrägen alte, ausrangierte Schränke, klobige Seekisten und eisenbeschlagene Truhen. Sie enthielten allerlei Trödel vergangener Generationen und bargen wohl auch so manches Geheimnis. Im Zwielicht waren sie nur als Silhouetten zu erkennen, und Tobias Heller wusste mehr, wo welche Truhe und welches wurmstichige Möbelstück stand, als dass er sie tatsächlich sehen konnte. Nur dort, wo die beiden Dachluken aufgeklappt waren, zeichnete sich das kalte, stählerne Blau des Winterhimmels mit fast blendender Helle ab. Der Staub, den Tobias und der Franzose aufgewirbelt hatten, tanzte hier im Sonnenlicht. Es fiel in Form von zwei breiten, scharfkantigen Lichtbalken schräg und genau parallel zueinander durch die rechteckigen Öffnungen im Dach.
»Allons! Nur zu, mon ami!«, forderte ihn der Franzose auf, und sein hageres Gesicht mit dem bleistiftschmalen Schnurrbart, der wie ein schwarzer Kohlestrich rechts und links auf die Oberlippe gemalt schien, verzog sich spöttisch. Gleichzeitig machte er mit seinem Florett eine einladende Geste. Sie hatte fast etwas Geringschätziges an sich, da er den Arm tief sinken ließ und sich dadurch für einen gegnerischen Angriff scheinbar sträflichst entblößte. Nur seine Augen, in denen kein Anzeichen von Spott und Leichtsinn zu finden war, verrieten, dass er sehr wohl wusste, was er tat und welches Risiko er einging.
»Nun zeig Maurice Fougot schon, wie gut du die Klinge zu führen verstehst, Tobi!«
Tobias ignorierte seine schmerzenden Muskeln, fasste das Florett fester und ließ ihn nicht aus den Augen. Sein Atem dampfte in der frischen Februarluft, die mit dem Licht des klaren Mittags durch die Dachluken strömte. Doch auf seiner Stirn stand der Schweiß dicht in feinen Perlen, und er schmeckte Salz auf den Lippen. Es war ein eigenartiger, ihm jedoch nicht unangenehmer Geschmack, denn es war nicht allein der Geschmack seines eigenen Schweißes und damit seiner körperlichen Anstrengung, sondern was er auf den Lippen schmeckte, war seine ungeheure innere Erregung und Anspannung. Er hätte lügen müssen, um zu sagen, dass er diese nicht genoss.
»Na, worauf wartest du noch …? Keine courage für einen Angriff …? Wie lange willst du mich denn noch warten lassen, mon petit Tobi?« Der Franzose, der mehr als doppelt so alt war wie sein jugendlicher Gegner und diesem zweifellos auch an Kraft und Ausdauer überlegen, ließ seine Klinge spielerisch gegen die von Tobias wippen. Es war ein leichter Schlag, so wie man einem unartigen Kind einen warnenden Klaps versetzt, und damit in dieser Situation genauso von oben herab herausfordernd wie seine Worte. Und kaum hatten sich ihre Klingen flüchtig berührt, da wich er auch schon mit leichtfüßig tänzelnden Schritten zurück, näher an die geöffneten Dachluken heran – und damit in das helle Licht.
Tobias hasste es, wenn man seinen Namen verstümmelte und ihn wie ein kleines Kind Tobi nannte. Schon vor sechs Jahren, und zwar genau an seinem zehnten Geburtstag, hatte er sich das ausdrücklich verbeten – von jedermann auf Gut Falkenhof. Es war sein einziger Wunsch gewesen, und sogar Agnes Kroll, die grauhaarige und wohlbeleibte Köchin und Haushälterin, hatte sich seitdem daran gehalten, obwohl es ihr anfangs doch sehr schwer gefallen war. Denn sie hatte ihn von Kindesbeinen an bemuttert und ihn so in ihr Herz geschlossen, wie sie es auch bei einem eigenen Kind, das ihr verwehrt geblieben war, nicht intensiver hätte tun können.
Ja, es machte ihn wütend, so gönnerhaft und gleichzeitig doch auch so herablassend behandelt zu werden. Ganz besonders von Maurice Fougot. Er hatte den Franzosen von Anfang an nicht leiden mögen. Aber er hielt seine Wut im Zaum, denn er wusste, dass ihn der Franzose mit wohl durchdachter Absicht so nannte. Er wollte ihn reizen und ihn zu einer unbedachten Handlung verleiten, um den Vorteil auf seiner Seite zu haben. Doch diesen Gefallen würde er ihm nicht tun. Auf diesen billigen Trick fiel er nicht mehr herein. Früher, ja, da hatte er seinem hitzigen Temperament in solch einem Moment blindlings nachgegeben und dann auch die Quittung dafür erhalten. Er hatte jedoch schnell gelernt sich zu beherrschen und in derart kritischen Situationen seinen Verstand die Entscheidungen fällen zu lassen. Denn so hitzköpfig er manchmal auch sein mochte, so gehörte er doch ganz gewiss nicht zu denjenigen, die einen schwerwiegenden Fehler zweimal begehen.
Es gab Situationen im Leben, da erhielt man keine Gelegenheit, eine falsche Entscheidung beim zweiten Mal wiedergutzumachen. Das hatte ihm sein Onkel Heinrich, dem das Gut Falkenhof eine knappe Kutschenstunde südwestlich von Mainz gehörte und der in seinen jungen Jahren viel von der Welt gesehen hatte, immer wieder eingebläut.
Auch sein Vater Siegbert Heller, der um fast zwanzig Jahre jüngere Bruder seines Onkels, der sein ganzes Leben der Erforschung unbekannter Länder gewidmet hatte, damit wieder einige der ›weißen‹ Flecken von den Landkarten verschwanden, die noch unerforschte Regionen kennzeichneten, auch sein Vater betonte immer wieder, wenn er von seinen gefährlichen Entdeckungsreisen in Afrika und Arabien berichtete, dass neben Erfahrung und Wissen in erster Linie Selbstkontrolle und ein scharfer Verstand die wichtigsten Eigenschaften waren, die ein Entdeckungsreisender brauchte, wollte er auch noch von dem berichten können, was er gesehen und erlebt hatte.
Tobias erinnerte sich noch sehr genau daran, wie sein Vater ihm einmal von einer gefährlichen Situation mit feindseligen Wüstennomaden der Sahara erzählt und ihm geschildert hatte, wie es ihm gelungen war, die Gefahr abzuwehren und schließlich sogar das Wohlwollen der Nomaden zu erringen. Damals, es war schon einige Jahre her, ihm aber dennoch so frisch in Erinnerung, als wäre es erst gestern gewesen, damals hatte sein Vater seinen Bericht mit den ihm unvergesslichen Worten beendet: »Ein Toter hat keine zweite Chance, mein Sohn. Deshalb musst du dir verdammt sicher sein, dass du das Richtige tust, wenn dein Leben und das deiner Begleiter auf dem Spiel steht.«
All dies fuhr Tobias wie ein einziger Gedanke, der jedoch mehr ein Gefühl war, durch den Kopf, während er dem Franzosen nachsetzte, die bernsteinfarbenen Augen voller Wachsamkeit und das Florett in der Sixt-Auslage haltend. Einige Strähnen seines sandbraunen Haares klebten ihm verschwitzt am Kopf. Sein schlanker, kräftiger Körper stand unter einer hohen Anspannung. Wie eine Klaviersaite, die bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit gedehnt wird. Doch dieser Anspannung lag keine Nervosität oder gar Angst zugrunde. Im Gegenteil. Es war fast eine freudige Erregung, die von ihm Besitz ergriffen hatte. Er wusste, dass er dieses Gefecht zu seinen Gunsten entscheiden konnte, wenn er nur die Nerven bewahrte und sein Können im entscheidenden Moment richtig einsetzte.
›Lass dich nicht locken …! Lass ihn kommen!‹, ermahnte er sich im Stillen. ›Verlier nicht den Kopf …! Hab Geduld!‹
Tobias ahnte, was der Franzose im Schilde führte. Ja, er war sich sogar ganz sicher. Das Rückzugmanöver und dieses gegenseitige spielerische Klingenspiel täuschten ihn nicht. Der Franzose wollte ihn unter die offene Luke in das helle Lichtfeld locken. Ihm würde die Sonne dann in den Rücken scheinen, während sie ihn, Tobias, blenden und den Angriff zu spät erkennen lassen würde.
Das Gesicht des Franzosen, ja, seine ganze Haltung trug einen Ausdruck von spöttisch aufreizender Selbstsicherheit, die die Zwillingsschwester des Leichtsinns war, wie Onkel Heinrich einmal gesagt hatte. Hier jedoch eines nur vorgetäuschten Leichtsinns!
Tobias sah dem Franzosen genau an, dass er im nächsten Moment einen Ausfall machen und den Angriff wagen würde, sowie er aus dem Schatten ins Licht vortrat. Möglich, dass er seinen Angriff mit einer Finte einleitete.
Nun gut, sollte er es doch versuchen! Er würde ihm schon die passende Antwort erteilen – mit seinem Florett!
Tobias rückte ein, zwei Schritte weiter vor, während die Klingen unablässig in Bewegung waren. Sie zuckten hin und her und schienen miteinander zu spielen, während sie sich in Wirklichkeit gegenseitig abtasteten und auf eine Gelegenheit zum blitzschnellen Vorstoß warteten. Der Franzose versuchte eine Flankonade, jedoch ohne ernsthafte Vehemenz und Schnelligkeit, wohl um ihn zu testen, und Tobias parierte den Flankenstoß betont schulmäßig und ohne Phantasie zu zeigen. Hell klirrte Stahl auf Stahl. Doch es war ein kaltes Klirren und ein kaltes Funkeln, wie auch der Himmel jenseits der Dachluken von einem kalten, harten Blau war.
Nur noch ein Schritt, und die Sonne würde ihm ins Auge stechen!
»Mon dieu! Ich sterbe bald vor Langweile! Ist das deine idée von männlichem Kampf? Terrible! Dein Vater würde sich deiner schämen, wüsste er, wie zögerlich du bist, Tobi! Ah, kein Wunder, warum er dich in der Obhut deines Onkels gelassen hat und ohne dich zu seiner neuen Expedition nach Ägypten aufgebrochen ist!«, höhnte Maurice Fougot und bewegte sich zentimeterweise rückwärts. Die blank polierte Glocke seines Floretts warf das Sonnenlicht funkelnd zurück.
Ohne sich dessen bewusst zu sein, fuhr sich Tobias mit der Zungenspitze über die Lippen, blieb ihm jedoch eine Erwiderung schuldig. Das Vibrieren seiner Klinge schien von seinem ganzen Körper aufgenommen und erwidert zu werden und durch seine Hand wieder in die Klinge zurückzufließen. Er war bereit! Mehr als bereit sogar!
Gleich! Nur ruhig Blut!
Der rechte Mundwinkel des Franzosen hob sich verächtlich und mit ihm der pechschwarze Kohlestrich auf der rechten Oberlippe. »Ich seh schon, es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis du ein Mann bist und dich wie ein solcher zu benehmen weißt! Bis dahin passt wohl dieser Kameltreiber … Wie war doch noch der Name deines Freundes und heidnischen Muselmanen …? Ah ja, Sadik Talib, nicht wahr? Bis dahin passt er wohl auf dich auf und schützt dich vor den Widrigkeiten des Lebens, nicht wahr? Du solltest deinem Vater dankbar sein, dass er dir seinen treuen Diener zurückgelassen hat. Das zeugt von großer Weitsicht, denn du brauchst ihn in der Tat. Weißt du was, du solltest besser mit Steckenpferdchen spielen, als zur Waffe eines Mannes zu greifen.«
»Verdammter Froschschenkelfresser!«, gab sich Tobias nun wutentbrannt, deutete einen Ausfallschritt an und befand sich für einen winzigen Augenblick im grellen Licht der Lukenöffnung.
Der Franzose fiel auf die Täuschung herein, weil er seinen Blick auf die gegnerische Klinge gerichtet hielt und nicht auf die Augen seines Gegenübers, der sie bei seiner Vorwärtsbewegung augenblicklich zusammengekniffen hatte. Er antwortete nun auf Tobias’ scheinbar halbherzigen Angriff mit einem flèche, einem Sturzangriff.
Doch Tobias stand in dem Moment schon nicht mehr im grellen Rechteck der Dachöffnung. Er hatte das Gewicht verlagert, kaum dass er mit dem Oberkörper nach vorn gekommen war, und stand längst wieder im Schatten des Dachstuhls über ihm, als der Franzose vorsprang und den Stoß ausführte.
Tobias parierte den Angriff mit einer blitzschnellen Drehung seines Handgelenkes. Diesmal war der Klang der aufeinandertreffenden Klingen nicht mehr spielerisch hell, sondern scharf und durchdringend, und das Florett des Franzosen fuhr an seiner Brust vorbei ins Leere.
Fast im selben Augenblick erfolgte Tobias’ riposte, sein Gegenangriff. Sein Arm streckte sich – und brachte die Spitze mitten ins Ziel. »Getroffen!«, schoss es ihm im selben Augenblick durch den Kopf, als er den Widerstand spürte, der sich seiner Klinge entgegenstellte. »Du bist mir auf den Leim gegangen, Maurice Fougot …! Ich habe dich erwischt …! Es ist aus …! Du bist geschlagen …! Endgültig!«
Universalgelehrter und Geheimbündler
Umgürtet von Wäldern, Wiesen und Weiden erhob sich Gut Falkenhof auf einer sanften Anhöhe. Es zählte nicht zu den herausragenden herrschaftlichen Landgütern des Großherzogtums Hessen-Darmstadt, doch auf seine Art war es schon beeindruckend. Es war als massives Geviert aus rostrotem Backstein erbaut, recht ungewöhnlich für diesen Landstrich. Zweigeschossig und wie eine kleine Festung ragte es auf. Der quadratische Innenhof war groß genug, dass ein halbwegs geschickter Kutscher auch ein klobiges Fuhrwerk mit einem Zweiergespann auf dem Platz wenden konnte.
Die beiden doppelflügeligen Tore, je eins im West- und im Ostflügel des Gevierts eingelassen, hatten die Baumeister so hoch und breit bemessen, dass ein hochbeladener Heuwagen ohne Schwierigkeiten durch die Rundbögen der Einfahrten fahren konnte. Die Tore waren aus Eichenbalken gezimmert, von denen ein jeder den Umfang eines kräftigen Männeroberschenkels hatte. Eisenbänder hielten sie zusammen. Zur Verzierung trug jede Torhälfte noch ein halbes Dutzend weitere Eisenbeschläge, die fast über die gesamte Breite des Flügels liefen und wie Lanzen mit kunstfertig geschmiedeten Spitzen aussahen. Von Weitem bot sich dem näherkommenden Betrachter das trügerische Bild eines Gitters aus Speeren, das den Torbogen zum Falkenhof versperrte.
Das Tor gen Osten ging auf einen Feldweg hinaus. Es trennte die Stallungen, die auf der linken Seite des Hofes lagen, von Scheune und Lagerschuppen auf der rechten. Im Ostflügel hatten sich früher, als das Gut noch richtig bewirtschaftet wurde, auch die armseligen Quartiere des Personals und der Landarbeiter befunden. Zum Westtor dagegen führte eine lange Allee alter Ulmen vom Wald her, hinter dem die Landstraße nach Mainz lag, die leichte Anhöhe herauf. In diesem Trakt des trutzigen Gevierts hatte schon immer die jeweilige Herrschaft der Adelsfamilie von Falken ihre Zimmer, die Bibliothek, Salons und Festräume gehabt. Jetzt wurden sie vom Universalgelehrten Heinrich Heller, von Sadik Talib, Tobias und dessen Vater bewohnt – sofern Letzterer auf Falkenhof weilte, was bei seinen oft mehrjährigen Forschungsreisen selten und dann auch nie für allzu lange Zeit der Fall war.
Den letzten Spross der Adelsfamilie, Major Bertram von Falken, Träger des Roten Adlerordens zweiter Klasse und Ritter des Eisernen Kreuzes, hatten die erdrückenden Schulden gezwungen, das Gut zu verkaufen. Mätressen und Kartenspiel hätten ihn in den Ruin getrieben, hieß es in Mainz und auf den umliegenden Gütern – nicht ohne Häme bei manchen.
Heinrich Heller hatte sich nicht darum gekümmert, weshalb der Major verkaufen wollte oder musste. Er hatte die Sache als das gesehen, was sie war, nämlich eine günstige Gelegenheit in einer ansonsten deprimierenden Lebenslage: Falkenhof war groß genug, sodass er endlich ausreichend Platz für seine vielfältigen Experimente und Studien hatte, lag abgeschieden und doch auch wieder nahe genug an Mainz, wo er aufgewachsen war und studiert hatte, und wurde zudem noch zu einem erschwinglichen Preis angeboten.
1819 war das gewesen. In jenem Jahr hatte er seine Professur der Philosophie und Naturwissenschaften in Gießen verloren und die Stadt quasi bei Nacht und Nebel verlassen müssen. Es hatte ihn betrübt, nicht aber überrascht. Ihn überraschte damals schon lange nichts mehr.
Männer wie er, die sich für die Menschenrechte, für die Einheit und Freiheit Deutschlands einsetzten und sich vehement gegen Zensur und Fürstenwillkür aussprachen, konnten kaum mit dem Wohlwollen der Herrschenden rechnen. Nicht seit der österreichische Staatskanzler Fürst Metternich – nach Napoleons vernichtender Niederlage bei Waterloo im Juni 1815 und seiner Verbannung nach St. Helena – in Europa das Heft in die Hand genommen hatte. Mit der ›Heiligen Allianz‹ der Fürsten und gekrönten Häupter Europas hatte Metternich eine Epoche der Restauration, des Rückschritts eingeleitet. Das angeblich gottgewollte Recht des Mächtigen auf Herrschaft war wieder zum obersten Prinzip erhoben worden. Und Hand in Hand war damit die Unterdrückung aller liberalen und republikanischen Ideen gegangen.
Die Karlsbader Beschlüsse vom 20. September 1819 versuchten, alle Forderungen nach Reformen und nach mehr Freiheit gleich im Keim zu ersticken: Die Burschenschaften, in der sich die studentische Opposition mit ihrem Wahlspruch »Ehre, Freiheit, Vaterland« formiert hatte, wurden ebenso verboten wie die Turnvereine, die ein anderes Sammelbecken republikanischer Anhänger waren.
Aber damit nicht genug des Rückschritts und der Freiheitsbeschneidung. Alle Universitäten erhielten staatliche Aufpasser, die Kuratoren. Ihre Aufgabe war es, nicht nur aufmüpfige Studenten zu überwachen, sie der Universität zu verweisen oder gar ihre Inhaftierung zu veranlassen, wenn sie sich politisch in Wort oder Schrift gegen das herrschende System ausgesprochen hatten – nein, ihre Bespitzelung galt hauptsächlich allen fortschrittlich denkenden Professoren. Sie waren einer besonders unerbittlichen Verfolgung von Metternichs Spionen ausgesetzt.
Des Weiteren mussten alle Druckschriften unter zwanzig Bögen zur Vorzensur eingereicht werden. Und in Mainz hatte man eine »Zentraluntersuchungskommission« eingesetzt. Eine eigenständige Behörde, deren alleinige Aufgabe darin bestand, angeblich revolutionäre Umtriebe, demagogische Verbindungen und Geheimbünde im Volk aufzudecken und diese sogenannten »Umstürzler« einzukerkern und mundtot zu machen. Ein blühendes Denunziantentum und eine politische Friedhofsstille waren die Folge gewesen.
Das System der Unterdrückung, der Argumentation mit Knüppel und Kerker, hatte Erfolg gebracht. Doch ob auch den gewünschten? Gewiss, die Flammen waren ausgetreten, nicht jedoch die Glut unter der Asche. Unter der scheinbar friedlichen Oberfläche gärte es noch immer in allen 39 Kleinstaaten des Deutschen Bundes. Vielleicht sogar mehr denn je!
»Elf Jahre ist das nun schon her, seit ich Gießen verlassen musste«, murmelte Heinrich Heller und rollte die kostbare Papyrusrolle mit den altägyptischen Hieroglyphen zusammen. Seit den frühen Morgenstunden hatte er sich mit ihrer Entzifferung beschäftigt. Doch nach dem Mittag hatte er sich nicht mehr so recht auf die Arbeit konzentrieren können. Immer wieder waren seine Gedanken in die Vergangenheit seines eigenen, schon über sechzig Jahre währenden Lebens gewandert.
»Elf Jahre«, murmelte er erneut. »Wie rasch doch die Zeit vergeht!« Er schüttelte den Kopf und fuhr sich gedankenverloren über den eisgrauen Bart, der ein viel jünger scheinendes Gesicht umrahmte. Die Falten und Furchen, die das Alter hinterlassen hatte, unterstrichen zusammen mit der hohen Stirn und der fast kantigen Kinnpartie viel eher das ausdrucksstarke Gesicht des Gelehrten, der nie ein weltfremder Träumer gewesen war. Durch den Zwicker mit seinen runden, goldgefassten Gläsern auf der kurzen Nase bekam sein Gesicht jedoch auch seine lebensfrohe, heitere Note, wie sie auch seinem Wesen entsprach.
Im Gegensatz zu seinem viel jüngeren Bruder und auch zu seinem Neffen war er von kleiner, untersetzter Figur. Um die Leibesmitte herum hatte das gute Essen, das Agnes Kroll auf den Tisch des Hauses brachte und das er in reichhaltigen Portionen genoss, sichtbare Spuren in Form eines kleinen Bauches hinterlassen.
An diesem Februartag trug Heinrich Heller weite, schwarze Tuchhosen und über einem altmodischen Hemd mit gerüschter Brust eine smaragdgrüne Seidenweste mit gelbem Lilienmuster. Was seine Kleidung betraf, hatte der Herr Professor schon immer einen sehr eigenen, um nicht zu sagen eigentümlichen Geschmack an den Tag gelegt. Aber das war auch wirklich die einzige Marotte, die man ihm nachsagen konnte. Sonst hatte er nichts von einem exzentrischen Privatgelehrten an sich.
Exzentrisch war er nur in seiner Sucht nach universalem Wissen, die vor keinem scheinbar noch so unbedeutenden Objekt der Wissenschaft Halt machte. So beschäftigte er sich genauso intensiv mit der Chemie wie mit der Insektenkunde, und die noch junge Wissenschaft der Aeronautik faszinierte ihn nicht weniger als die Artenkunde der Muscheltiere. Über die Farbenlehre vermochte er so sachkundig zu dozieren wie über Astrologie, Mineralogie und die Anatomie des menschlichen Körpers. Seine Sammlungen und Experimentierstätten nahmen den ganzen Südflügel vom Falkenhof ein. Und seine Bibliothek umfasste mehrere Tausend, meist ledergebundene Bände. Dazu kamen noch zahlreiche handschriftliche Texte aus aller Herren Länder sowie kostbare Dokumente und Karten aus vergangenen Jahrhunderten, die allein ein Vermögen wert waren.
Die Experimentierstätten und die Bibliothek hätten so manch anderen Gelehrten vor Neid erblassen lassen, und er wusste auch, wie glücklich er sich seiner Mittel und Möglichkeiten schätzen durfte. Doch der liebste Ort auf Gut Falkenhof war ihm sein kleines Studierzimmer, in dem er auch die altägyptischen Schriftrollen aufbewahrte und zu entschlüsseln versuchte.
Es war ein holzgetäfelter, leicht zu überschauender Raum mit eingebauten Bücherwänden, zwei schlichten Glasschränken, die mit allerlei Papieren und merkwürdigen Dingen aus aller Welt vollgestopft waren, und mit einem alten Schreibtisch, auf dem immer ein heilloses Durcheinander von Notizen, Büchern und anderem zu herrschen schien. Eine chinesische Seidenmalerei an der Wand, zwei persische Teppiche auf dem dunklen Parkettboden, ein patinagrüner Kerzenkandelaber unter der stuckverzierten Decke und zwei schon leicht abgewetzte, dunkelgrüne Ledersessel mit einem zusammenklappbaren Beistelltischchen aus Kirschholz vor dem Kamin vervollständigten die Einrichtung.
Heinrich Heller war so in seine Gedanken versunken gewesen, dass er völlig vergessen hatte, Holz im Kamin nachzulegen. Ein kalter Windzug brachte ihm sein Versäumnis schnell zu Bewusstsein.
»Ah, das vermaledeite Feuer! Ist es mal wieder passiert! Ein Kohlebecken sollte ich mir an die Seite stellen! Es wird Zeit, dass der Frühling kommt«, redete er mit sich selbst, wie er es oft tat, legte die Papyrusrolle aus der Hand und ging zum Kamin. Dabei zog er das steife linke Bein ein wenig nach. Eine lebenslängliche Erinnerung an eine abenteuerliche Dschunkenreise über das Südchinesische Meer – und den Taifun, der den Mast wie einen Kienspan splittern ließ. Der stürzende Mast hatte seine Knie zerschmettert. Doch er hatte das Ziel, das er sich gesetzt hatte, erreicht – und war zurückgekommen, vor fast vierzig Jahren!
»Vierzig Jahre? Ich als junger, wissbegieriger Abenteurer auf einer Dschunke zwischen lauter Halsabschneidern? Das klingt nach einer Geschichte aus einem anderen Leben – und doch ist es ein und dasselbe«, murmelte er fast belustigt, während er mit dem Kamineisen in der Glut stocherte und dann trockene Scheite auflegte. Augenblicke später loderten Flammen aus der Glut und leckten gefräßig am Holz hoch.
Er blieb vor dem Feuer stehen und genoss die Wärme, die ihm entgegenschlug, und seine Gedanken wanderten wieder zurück. Nicht ins Südchinesische Meer, sondern nach Gießen.
Wenn er es recht betrachtete, konnte er überhaupt von Glück reden, dass er damals nur seine Professur und sonst nichts verloren hatte. Nur knapp war er einer Einkerkerung entgangen. Doch mit seiner Lehrtätigkeit war es endgültig vorbei gewesen.
Anfangs hatte es ihn geschmerzt. Aber dann hatte er sich ohne Verbitterung damit abgefunden. Die völlige Freiheit von den Pflichten eines Professors, auch wenn sie nicht ganz freiwillig gewählt war, bot ihm doch die Möglichkeit, sich seinen vielen Interessengebieten ungestört und unbelastet von jedweden Ablenkungen widmen zu können.
Und so hatte er Gut Falkenhof erstanden und Gott mehr als einmal dafür gedankt, dass sein Vater sich nicht mit alt-ägyptischen Schriftzeichen und »weißen« Flecken auf der Landkarte beschäftigt hatte, sondern ein nüchterner und vor allem geschäftstüchtiger Tuchfabrikant gewesen war. Ihm hatten er und sein jüngerer Bruder es zu verdanken, dass sie ihren ganz besonderen Leidenschaften nachgehen konnten, ohne sich um den täglichen Lebensunterhalt sorgen zu müssen. Ihr Vater hatte ihnen ein erhebliches Barvermögen hinterlassen sowie zwei immer noch recht einträgliche Tuchfabriken, eine in Mainz und eine in Frankfurt.
Die Flammen warfen ihren roten, unruhigen Schein auf sein Gesicht, und es schien, als würde sein eisgrauer Bart glühen. Während er so vor dem Kamin stand und in das auflodernde Feuer blickte, wurde sein Ausdruck ernst und sorgenvoll. Die Zukunft bereitete ihm Sorgen. In vielerlei Hinsicht.
Doch vor allem sorgte er sich um Tobias.
Fougot gibt auf
Es gab ein dumpfes, trockenes Geräusch, das so gar nicht zu diesem Kampf zu passen schien, und die Florettklinge bog sich weit durch, als die stumpfe Spitze das wattierte Lederwams des Franzosen traf. Federnd sprang Tobias zurück, hob die Waffe in einem jahrelang antrainierten Reflex zum Gruß und ließ das Florett dann sinken. Abwartend und mit fliegendem Atem stand er da. Die Erregung, die ihn noch vor einem Augenblick von Kopf bis Fuß erfüllt hatte, wich nun einem Gefühl, das weniger von Triumph als von Genugtuung geprägt war. In dieses Gefühl mischte sich aber auch die ernüchternde Erkenntnis, sich total verausgabt und eine extreme Gratwanderung hinter sich gebracht zu haben.
Einen scheinbar unendlich langen Augenblick verharrte Maurice Fougot in dieser grotesken Haltung: den Oberkörper weit nach vorn gebeugt und das Florett mit dem ausgestreckten Fechtarm schräg nach unten auf die Bohlen gerichtet – ins Leere. Es schien, als hätte ihn jegliche Kraft verlassen, sich aus der Niederlage aufzurichten und dem Blick seines Schülers zu begegnen, der nun nicht länger sein Schüler mehr war.
Für Tobias war Maurice Fougot immer nur »der Franzose« gewesen. All die Jahre, die er bei ihm schon Unterricht im Fechten nahm, hatte er ihn nicht gemocht und nie eine persönliche Beziehung zu ihm gefunden. Maurice Fougot hatte sich auch nie darum bemüht, seine Sympathie zu gewinnen. Im Gegenteil. Vom ersten Tag an hatte er ihm zu verstehen gegeben, dass er der festen Überzeugung sei, seine Zeit mit ihm nur zu vergeuden. Allein die großzügige Bezahlung seines Onkels habe ihn bewogen, sich zweimal die Woche mit ihm »zu beschäftigen«, wie er sich wörtlich ausgedrückt hatte.
Er hatte sich stets unnahbar, überheblich und häufig genug auch regelrecht abweisend verhalten. Ein ausdrückliches Lob hatte er nie ausgesprochen. Blendende Paraden und Angriffe hatte er höchstens mit einem gönnerhaften Nicken oder einem eher widerwillig klingenden Grunzlaut zur Kenntnis genommen. In seiner Kritik hatte er sich dagegen ganz und gar nicht wortkarg gezeigt, sondern von ausgesprochen scharfer Beredsamkeit.
Nein, gemocht hatte er den Franzosen wahrlich nicht, jedoch als Meister seines Faches respektiert. Er war der beste Lehrer gewesen, den er je gehabt hatte, und es waren schon einige vor ihm auf Falkenhof gewesen, um ihn in der Kunst des Fechtens zu unterrichten. Deshalb empfand er nun eine merkwürdige Verlegenheit, nachdem er ihn mit seinen eigenen Waffen besiegt und sich ihm mehr als ebenbürtig gezeigt hatte. Fast schämte er sich – für Maurice Fougot, weil dieser ihm nichts mehr entgegenzusetzen hatte und weil er seinen Lehrer, auch wenn er ihn nicht mochte, zum wiederholten Mal so gedemütigt hatte. Er hatte plötzlich das Gefühl, etwas verloren zu haben, etwas, das er im Augenblick nicht zu benennen wusste.
Der verlegene Moment verstrich, als sich Maurice Fougot aufrichtete. Auch er hob das Florett kurz zur Respektsbezeugung, die das Gefecht abschloss.
»Bien …! Das war keine schlechte Parade«, brach er das Schweigen. Sein Gesicht war völlig ausdruckslos und verriet nicht das Geringste von dem, was in ihm vor sich ging. Er legte das Florett aus der Hand und öffnete die Gurte seines Lederwamses. »Vielleicht war die Zeit mit dir doch nicht ganz vertan.«
Tobias traute seinen Ohren nicht. Das war das erste Mal, dass der Franzose unmissverständlich zum Ausdruck brachte, wie gut er geworden war. Er fühlte Stolz, denn diese Worte waren mehr als nur ein Lob. Es war das Eingeständnis, dass er vor seinen kritischen, ja ungnädigen Augen bestanden hatte. Aber es verstärkte auch seine Verlegenheit, und dabei war Schüchternheit bei ihm sonst wahrlich kein ausgeprägter Wesenszug!
»Danke, Monsieur.«
»Non-sens …! Du brauchst dich nicht zu bedanken!«, erwiderte Maurice Fougot, und seine Stimme hatte wieder die ihr eigene Schärfe und Distanz. »Ich habe dir nichts geschenkt, nicht so viel, compris?« Und er schnippte mit den Fingern.
Tobias nickte nur stumm, fuhr sich mit dem linken Handrücken über die schweißnasse Stirn und legte nun auch das Florett zu Boden, um sich vom fest geschnürten Lederwams zu befreien.
In dem Moment trat eine Gestalt aus dem Dunkel des hinteren Dachbodens, wo sich die Treppe befand. Es war Sadik Talib, der Araber und langjährige Diener seines Vaters.
»Es-salum ‘alekum, Sihdi Fougot«, grüßte er mit seiner melodischen Stimme, die manchmal einen ganz gewöhnlichen Satz zu einem halben Lied werden ließ. »Der Friede sei mit Euch.«
Der Franzose fuhr herum und zog in sichtlicher Verwunderung, ihn hier oben auf dem Dachboden zu sehen, die Augenbrauen hoch. »Dein Wort in Gottes Ohr, beziehungsweise bei dir wohl in Allahs Ohr, aber das mit dem Frieden wird sich erst noch herausstellen müssen«, gab er wenig freundlich zur Antwort.
Sadik Talib, der eine grobe Wollhose und über einem dicken bleigrauen Pullover noch eine warme Lammfelljacke trug, war einen Kopf kleiner als Tobias und von schmächtiger, jedoch sehniger Gestalt. Ausgeprägte Wangenknochen, eine scharfe Nase und hellblaue Augen unter buschig schwarzen Brauen gaben seinem Gesicht mit der getönten Haut ein markantes Aussehen. Schlank und feingliedrig waren seine Hände, die so geschickt im Umgang mit den verschiedensten Dingen waren.
Sein genaues Alter vermochte er nicht zu nennen, doch er musste Anfang vierzig sein, wie Tobias Vater, denn hier und da durchzogen schon graue Strähnen sein krauses, blau-schwarzes Haar. Zudem konnte er sich noch gut daran erinnern, wie Napoleon Bonaparte die Mameluken bei den Pyramiden besiegt hatte. Damals war er schon alt genug gewesen, eine Stellung anzunehmen, und seine Eltern hatten ihn an einen reichen Weinhändler aus Alexandria verkauft. Bei Napoleons Landung in Ägypten hatte er sich mit seinem Herrn in Cairo aufgehalten und dort auch im Juli 1798 den Einzug der siegreichen französischen Truppen erlebt, und das lag inzwischen immerhin schon zweiunddreißig Jahre zurück, denn mittlerweile schrieb man das Jahr 1830.
Tobias fühlte sich gleich besser, als er Sadik erblickte, der ihm Freund und Bruder zugleich geworden war. Er hoffte, dass Sadik seinen Kampf mit angesehen hatte, wagte in Gegenwart des Franzosen jedoch nicht, ihn danach zu fragen.
Sadik trat näher, ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht, das unter der dunklen Tönung aber noch immer einen Anflug von Blässe hatte. Der Winter in diesen nordischen Breiten war ihm schlecht bekommen, und lange hatte er das Bett gehütet, niedergeworfen von einer schweren Erkältung, die einfach nicht hatte von ihm weichen wollen. Das war auch mit ein Grund gewesen, warum Tobias’ Vater Anfang Dezember des vergangenen Jahres ohne ihn gen Ägypten aufgebrochen war.
Der Franzose hängte das Wams an den Haken, der aus einem Stützbalken ragte.
»Bist du schon lange hier oben?«, wollte er wissen und fragte sich im Stillen wohl, ob der Araber gehört hatte, was er über ihn gesagt hatte.
»Lange genug, Sihdi Fougot«, antwortete Sadik vieldeutig.
»Hast du zugesehen?«, fragte Tobias mit glänzenden Augen, weil er sich nun doch nicht länger beherrschen konnte und Sadiks Urteil wissen wollte, denn auch er wusste eine Klinge ausgezeichnet zu führen. Nur zog er den Säbel einem Florett vor.
Sadik nickte und sagte in seiner Heimatsprache: »Wamalla jazlimi-’n-nasa juzlami.«
»Und was heißt das?«, fragte Maurice Fougot forsch.
»Dass man sich im Leben entscheiden muss, ob man entweder der Hammer oder der Amboss sein will«, erklärte Sadik Talib, der viel belesen und eine geradezu unerschöpfliche Quelle von arabischen Weisheiten und Sprichwörtern war. Zu jeder Gelegenheit wusste er eine passende Stelle aus dem Koran zu zitieren oder den Spruch eines Weisen anzuführen. Gelegentlich waren es äußerst merkwürdige, ja sogar komische Sprichwörter. Und Tobias hegte manchmal den Verdacht, dass einige dieser ungewöhnlichen Sprüche auf seinem eigenen Mist gewachsen waren. Sadik Talib hatte es faustdick hinter den Ohren, das stand eindeutig fest!
Der Franzose hob die Brauen an. »Und?«
»Tobias wollte immer Hammer sein. Doch nicht jeder, der hämmert und klopft, ist ein Schmied, heißt es an den Feuern der Beduinen«, flocht Sadik ein weiteres Sprichwort ein. »Doch er hat bewiesen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat.«
Maurice Fougot hatte für Sadiks oftmals blumige Art zu reden wenig übrig, wie sein dünnes Lächeln verriet. »Ja, so kann man es wohl auch ausdrücken.«
Sadik bewahrte sein Lächeln. »Es gibt viele Vögel am Himmel, aber jede Art pfeift anders.«
Tobias musste sich ein Lachen verkneifen. Sadik war bisher noch keinem eine Antwort schuldig geblieben, und er war der deutschen Sprache ebenso mächtig wie der französischen. Auch Englisch beherrschte er nicht schlecht, denn bevor er in die Dienste seines Vaters getreten war, hatte er schon viele Jahre lang reichen Abenteurern und ernsthaften Forschungsreisenden aus England und Frankreich mit seinen vielfältigen Fähigkeiten auf ihren Reisen als Dolmetscher und Mädchen für alles zur Seite gestanden.
Der Fechtlehrer ging auf die anzügliche Bemerkung nicht ein und griff nach seiner Jacke. »Es wird Zeit, dass ich in die Stadt zurückkomme. Es liegt Schnee in der Luft. Und vorher muss ich noch mit deinem Onkel sprechen. Also, au revoir … Monsieur Tobias!«, verabschiedete er sich kühl.
»Ja, au revoir, Monsieur Fougot«, erwiderte Tobias etwas beklommen. Er hatte das merkwürdige Gefühl, dass er ihn nicht wiedersehen würde.
»Sabah en-nur!«, rief Sadik ihm nach. »Euer Tag möge erleuchtet sein!«
Der Franzose blieb kurz stehen, warf einen Blick zu Tobias und Sadik zurück und gab ein leises, schwer zu deutendes Lachen von sich. Er nickte, als wäre die Erleuchtung in der Tat über ihn gekommen, und eilte dann zur Treppe. Seine Stiefel polterten energisch die Stufen hinunter und verklangen kurz darauf auf dem Flur des Obergeschosses.
Tobias wartete, bis er sicher sein konnte, dass ihn der Franzose auf keinen Fall mehr hören konnte. Dann wandte er sich Sadik zu. Und nun stand ihm die Freude im Gesicht geschrieben, das erwachsenere Züge trug, als man von einem Sechzehnjährigen gemeinhin erwarten konnte.
»Du hast alles mit angesehen, nicht wahr? Ich wette, dir ist nichts entgangen! Dem Franzosen habe ich es heute gezeigt!«, sprudelte er hervor und ließ sich von seiner eigenen Begeisterung mitreißen. »Schon die letzten Wochen habe ich ihn häufig geschlagen. Sechzehn zu vier und einmal auch siebzehn zu drei. Aber heute hat er nur einen einzigen Stich angebracht. Doch das ist reine Dummheit gewesen. Ich bin mir meiner Sache einfach zu sicher gewesen und auf eine Finte hereingefallen. Aber danach hat er keinen Treffer mehr landen können. Ich dagegen neunzehn! Neunzehnmal hintereinander ist er mir in die Klinge gelaufen, und dabei hat er jeden miesen Trick versucht, den er kennt, und du weißt, der Franzose kennt mehr Tricks, als ein Straßenköter Läuse hat!«
Sadik nickte bedächtig. »Aiwa …! Ja, ich habe alles gesehen.«
»Und auch alles gehört?«
»Allerdings.«
»Er hat dich einen Kameltreiber genannt!« Empörung sprach aus seiner Stimme. »Ich an deiner Stelle hätte den Franzosen zu einem Duell gefordert – aber ohne Schutzkleidung!«
Sadik lächelte belustigt. »Weshalb denn, du Hitzkopf? Kamele sind der ganze Stolz eines wahren Beduinen. Je mehr Kamele, desto höher sein Ansehen, habe ich dir das nicht oft genug erzählt? Also, weshalb hätte ich mich darüber erregen sollen?«
»Und was ist mit dem ›heidnischen Muselmanen‹?«, wollte Tobias wissen, der sich von Maurice Fougots abschätzigen Äußerungen über seinen Freund Sadik persönlich verletzt gefühlt hatte und es noch immer tat.
Dieser hob in einer Geste der Abgeklärtheit die Hände. »Die Worte galten weniger mir denn dir. Er wollte, dass dir der Zorn die Augen trübt und deiner Hand die Führung des Verstandes raubt. Außerdem: Die Katzen sterben nicht daran, dass die Hunde sie verfluchen. Oder wie Scheich Abdul Kalim, dessen Weisheit noch heute von vielen Stämmen gerühmt wird, gesagt hätte: Das Gebell der Schakale macht auf die Wolken keinen Eindruck.«
Tobias wusste nicht, ob er sich auf den Arm genommen fühlen oder lachen sollte, und so verzog er das Gesicht zu einem schiefen Grinsen. »Du immer mit deinem weisen Scheich Abdul Kalim! Manchmal glaube ich, dass der Bursche nur in deiner blühenden Phantasie existiert!«
Sadik Talib zuckte nur gleichgültig mit den Achseln und antwortete auf diese Unterstellung mit unübertrefflicher Schlagfertigkeit: »Auch wenn du Gold in den Kot steckst, so bleibt es doch Gold, mein Freund.«
Tobias seufzte resignierend. »Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Mit Worten gewinnst du jedes Gefecht, Sadik. Aber du hast noch immer nichts dazu gesagt, dass ich Fougot neunzehn zu eins in die Knie gezwungen habe.«
»Du warst gut heute«, erklärte Sadik lapidar.
»Neunzehnmal besser als der Franzose!«, betonte Tobias und hatte Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen, denn er hatte mehr als diesen trockenen Kommentar von ihm erwartet.
»Am Festtag sind alle große Herren«, erwiderte der Araber mit seiner Vorliebe für rätselhafte Antworten. »Oder: Das Bellen aus der Ferne ist leichter als das Knurren in der Nähe.«
»Was heißen soll?«
Sadik antwortete nicht sofort, sondern schob seinen Pullover hoch und zog ein kostbares Messer aus einer kunstvoll gearbeiteten Scheide aus gehämmertem Silber, die innen mit dunklem Holz ausgeschlagen war. In die gut zwei Finger breite Klinge waren arabische Schriftzeichen eingraviert. Von Weitem ähnelten sie Feuerzungen. Das Griffstück bestand aus Elfenbein, das im Laufe der Jahre eine fast gelbliche Farbe angenommen hatte. Ornamente, die auf beiden Seiten einen Skarabäus einrahmten, waren in das Elfenbein geschnitzt. Er nahm die Spitze der beidseitig geschliffenen Klinge zwischen Daumen und Zeige- und Mittelfinger, sah sich um und deutete schließlich auf einen alten Kleiderschrank, dessen linke Seite angekohlt war und der auch sonst überall Brandspuren aufwies.
»Siehst du den Schrank und die Rosette über den Türen?«
»Tab’an!«, antwortete Tobias auf Arabisch. »Natürlich!«
Der Schrank stand etwa zehn, zwölf Schritte von ihnen entfernt neben anderem Gerümpel unter der Dachschräge. Sadik hob die Hand mit dem Messer.
»Hasib …! Pass auf!«, rief Sadik und schleuderte das Messer.
Es flog mit einem leisen, hohen Sirren durch die Luft und bohrte sich tief ins Holz. Die Klinge ragte mitten aus der Rosette heraus, teilte sie in zwei fast gleich große Hälften.
Tobias folgte ihm zum Schrank. »Ich weiß, dass du so gut mit dem Messer umzugehen verstehst wie niemand sonst, den ich kenne. Aber ich verstehe nicht, was das mit mir und dem Franzosen zu tun haben soll.«
»Sehr viel. Überlege!«
»Nein, das ist mir zu hoch, Sadik. Du wirst dich schon zu einer Erklärung durchringen müssen, die auch ein Nicht-Araber und vor allem ein Nicht-Beduine versteht«, zog er ihn damit auf, dass er besonders stolz auf seine beduinische Abstammung war.
Sadik zog das Messer aus der Rosette. »Geh mit dem Finger über den Einschnitt!«, forderte er ihn auf.
Tobias verzog spöttisch das Gesicht, leistete seiner Aufforderung aber Folge. »Also gut, ich habe gefühlt. Aber was soll das, Sadik?«
»Was genau hast du gefühlt?«
»Die Einkerbung im Holz natürlich!« Die Ungeduld sprach unverhohlen aus seiner Stimme.
»Kein Blut?«
Tobias furchte die Stirn. »Nein, kein Blut. Natürlich nicht!«
»Hätte ich auf einen Menschen geworfen, du hättest Blut gespürt, viel Blut sogar«, sagte Sadik mit ruhigem Ernst. »Und das ist es, worauf all das Üben gerichtet ist, das Messerwerfen und das Fechten – nämlich den Gegner zu treffen! In sein Fleisch! Möglichst da, wo ihn der Stich tötet oder doch zumindest kampfunfähig macht.«
Tobias bekam einen trockenen Mund. »Willst du damit sagen, dass all die Gefechte mit Fougot nicht das Geringste bedeuten, weil es kein wirklicher Kampf auf Leben und Tod ist?«
Der hagere Araber fuhr fast versonnen mit dem Daumen über die Klinge seines Messers, ließ es dann in die Scheide unter seinem Pullover gleiten und sagte dabei: »Oh, es bedeutet schon etwas. Sehr viel sogar, Tobias. Du hast Sihdi Fougot geschlagen. Doch wenn man einmal so weit ist, bleibt man nicht dort stehen. Nein, du wirst dich nicht damit begnügen.«
Tobias schluckte. »Ich will mich meiner Haut so gut wie möglich erwehren können, wenn ich auf Entdeckungsreisen in Gefahr gerate und es daraus keine andere Möglichkeit als den Kampf gibt.«
Ein Lächeln huschte über das hagere Gesicht des Arabers. »Ja, ich weiß, du kannst es nicht erwarten, deiner Heimat den Rücken zu kehren und deinen Vater auf seinen Forschungsreisen zu begleiten – oder besser noch ganz eigene, unerforschte Wege zu gehen.«
»Mein Vater hat mir das Pistolenschießen beigebracht«, fuhr Tobias fort, weil er das Gefühl hatte, sich verteidigen zu müssen, »und mein Onkel war es, der den Franzosen verpflichtet hat, als ich von meinem Vater und auch von dir im Fechten nichts mehr lernen konnte. Und bist du es nicht gewesen, der mir voller Stolz erzählt hat, dass ein Beduine den Umgang mit der Waffe genauso selbstverständlich von Kindesbeinen an lernt wie das Melken der Kamelstuten und das Erzählen von Geschichten?«
Sadik nickte mit einem Schmunzeln auf den Lippen. »O ja, davon habe ich dir sehr wohl erzählt. Doch eine schnelle Hand und ein ausgezeichnetes Arabisch machen dich noch lange nicht zum Beduinen, mein Freund«, sagte er mit sanfter Zurechtweisung. »Ich wollte dir auch nur sagen, dass du eines nie vergessen sollst, wenn du eine Waffe in die Hand nimmst: Wenn du sie niederlegst, kann sie vom Blut eines anderen befleckt sein! Du wirst es erfahren: Eines Tages wird Blut an deiner Klinge sein, Tobias! Und das ist eine Erfahrung, die einen jeden Menschen verändert. Zum Guten oder zum Schlechten, das weiß man vorher nicht.«
Sadiks Mahnung verursachte ihm Unbehagen, und so wechselte er schnell das Thema. »Komm, hilf mir, die Luken zu schließen«, bat er. »Und verrat mir, wo du den ganzen Tag gesteckt hast. Ich hab dich kaum zu Gesicht bekommen. Hast du dich vorm Holzhacken drücken wollen?«
»Ich war auf meinem Zimmer und habe gelesen.«
»So? Was hat dich denn so in den Bann geschlagen und alles andere vergessen lassen?«
»Der Koran.«
»Den ganzen Vormittag?«, fragte Tobias ungläubig, während er eine der Luken schloss.
Sadik reckte sich nach dem Aufstellholz der zweiten Luke. »Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt, heißt es in meiner Heimat. Und der Koran ist der schönste von ihnen allen.«
»Na, nichts gegen den Propheten Mohammed und Allah und deinen Koran, Sadik, aber da kenne ich noch ein paar andere Gärten, die mir entschieden besser gefallen«, erwiderte Tobias.
Sadik zuckte darüber großmütig mit den Schultern. »Wie ein Brot aussieht, hängt immer vom Hunger des Betrachters ab.«
»Entschuldige, Sadik. Ich wollte nicht über deinen Glauben spotten«, sagte Tobias, weil er seine unüberlegten Worte sofort bereute, und berührte ihn am Arm. »Vergiss, was ich Dummes gesagt habe, und stell mir eins von deinen Rätseln!«
»Du magst viele Stärken haben, aber das Lösen arabischer Rätsel gehört kaum dazu«, neckte ihn Sadik.
»Eines Tages komme ich schon noch dahinter. Übung macht den Meister. Also los, fang schon an«, bat Tobias.
Sadik zog die Stirn kraus. »Mal sehen. Ein einfaches arabisches Rätsel für einen jungen Hitzkopf wie dich«, murmelte er mit lustigem Augenzwinkern, während sie zur Treppe gingen. Dann blieb er stehen und tat, als wäre ihm etwas eingefallen. Dabei wusste Tobias ganz genau, dass Sadik ein Rätsel nach dem anderen erzählen konnte, pausenlos und stundenlang, wenn es von ihm verlangt würde. »Ah ja, das könnte etwas für dich sein.«
»Nun mach schon!«, drängte Tobias.
»Dann höre gut zu.« Sadik stellte sich in Positur und rieb erst einmal seine Nasenflügel mit Daumen und Zeigefinger. »Es ist ein typisches Beduinen-Rätsel, so viel will ich dir verraten. Also aufgepasst: ›Ich habe einen Überwurf voller Knöpfe. Er lässt sich weder falten noch tragen.‹ Na, nun sag, was es ist!«
»Ein Überwurf voller Knöpfe, der sich weder tragen noch falten lässt«, wiederholte Tobias murmelnd und überlegte angestrengt. »Ein Überwurf …«
Sadik wartete geduldig ans Treppengeländer gelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt, ein vergnügtes Lächeln auf den Lippen.
Tobias kam nicht drauf. »Gib mir noch einen Hinweis, bitte!«
Der Araber schüttelte den Kopf. »La …! Nein, kommt nicht in Frage. Ich habe dir schon genug verraten. Versuche, wie ein Beduine zu denken!«
Sosehr Tobias sich auch bemühte, ihm wollte nichts Rechtes zu dem Rätsel einfallen. Schließlich gab er auf.
»Mist! Ich komm nicht drauf! Was ist es?«
»Der Himmel und die Sterne«, lüftete Sadik des Rätsels Lösung. »Ich sagte dir doch, dass es ein typisches Beduinen-Rätsel ist.«
Tobias schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. »Natürlich! Das Firmament! Mein Gott, es ist so einfach! Warum bin ich bloß nicht darauf gekommen?«
»Deine Frage erinnert mich an die Geschichte vom Blinden, den man fragte: ›Was suchst du?‹ Worauf dieser antwortete: ›Einen Korb voller Augen‹«, spottete Sadik.
Tobias gab sich empört. »Danke, Sadik! Und ich Dummkopf war versucht, mich wegen dir mit dem Franzosen anzulegen.«
»Aber eben auch nur versucht!«
Sie mussten nun beide lachen.
Doch als sie vom Dachboden stiegen, ging es Tobias nicht aus dem Sinn, was Sadik Talib ihm prophezeit hatte, und er sollte noch oft an diese Worte denken: »Eines Tages wird Blut an deiner Klinge sein, Tobias!«
Der gescheiterte Plan
Das Feuer prasselte munter im Kamin und vertrieb den Hauch von Kühle aus dem Studierzimmer, als es klopfte. Heinrich Heller war an seinen Schreibtisch zurückgekehrt und wollte sich gerade setzen. Er wandte sich nun um und rief: »Ja, bitte, herein!«
Die Tür ging auf und Lisette erschien, die junge Frau von Jakob Weinroth, der bei ihm als Kutscher und Stallknecht angestellt war, während sie im Haushalt arbeitete und auch mal Agnes in der Küche zur Hand ging.
»Monsieur Fougot wünscht Sie zu sprechen, Herr Professor«, meldete sie mit ihrer zarten Stimme.
»Nur zu, Lisette! Führ ihn herein!«, rief er erfreut.
Lisette knickste leicht, gab die Tür frei, und Maurice Fougot trat an ihr vorbei ins Zimmer.
»Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei einer wichtigen Arbeit, Monsieur Professeur, so beschäftigt, wie Sie immer sind«, sagte der Franzose mit freundschaftlicher Höflichkeit und Respekt, während Lisette die Tür geräuschlos hinter ihm schloss. Er sprach den Titel Professor französisch aus, sodass die Betonung auf der letzten Silbe lag und aus dem letzten o ein ö wurde.
»Ach was!«, fegte dieser die Bedenken des Fechtlehrers mit einer fröhlich-einladenden Handbewegung beiseite. »Im Gegenteil. Es ist mir stets ein außerordentliches Vergnügen, mit Ihnen zu plaudern. Kommen Sie, setzen wir uns ans Feuer und leisten Sie mir bei einem Glas Cognac Gesellschaft. Französischen Cognac!«, fügte er augenzwinkernd hinzu. »Es ist heute ein ungemütlich kalter Tag, da werden wir uns auch zu so früher Stunde schon ein Glas erlauben dürfen, was meinen Sie?«
Maurice Fougot neigte zustimmend den Kopf. »Ich nehme dankend an.«
»Bitte, nehmen Sie doch Platz!« Heinrich Heller führte ihn zu den Sesseln am Feuer, holte dann die Cognac-Karaffe und zwei Gläser und goss ein.
Sie prosteten sich zu.
Der Franzose kippte den großzügig bemessenen Cognac auf einen Zug hinunter, atmete mit einem schweren Seufzer aus und sagte: »In der Tat, der war nötig!«
Heinrich Heller sah ihn ahnungsvoll an. »War es so schlimm?«
»Schlimmer«, antwortete der Franzose knapp.
Nun war es am Professor zu seufzen. »Unsere wohl durchdachten Vorkehrungen haben also nichts genutzt«, stellte er betrübt fest und griff zur Karaffe, um das Glas seines Gastes noch einmal zu füllen.
Maurice Fougot schüttelte den Kopf. »Nicht das Geringste, Monsieur Professeur. Es hat ihn überhaupt nicht berührt. Ohne jeden effet. Nicht den geringsten Eindruck hat es auf ihn gemacht.« Er zuckte mit den Achseln. »Alors, es kam ja nicht überraschend. Ich habe es geahnt.«
»Ja, das haben wir wohl beide.«
Einen Augenblick schwiegen sie, und nur das Knistern der Scheite und das Prasseln der Flammen waren zu hören. Dann bat der grauhaarige Gelehrte: »Erzählen Sie, wie es gelaufen ist.«
Maurice Fougot drehte sein Glas in der Hand und ließ sich mit der Antwort Zeit. »Ich bin mit ihm auf den Dachboden gegangen. Wegen des Dämmerlichtes, Sie verstehen. Erschwerte Bedingungen.«
Heinrich nickte mit einem müden Lächeln. Der ganze Tag war für Tobias unter »erschwerten Bedingungen« abgelaufen. Und dennoch hatten sich ihre Hoffnungen nicht erfüllt!
»Er wollte gleich zur Waffe greifen«, fuhr der Fechtlehrer fort. »Doch ich habe ihn Fußarbeit machen lassen. Pratique ohne Waffe, das er schon immer so sehr hasst. Da hat er sich in den vergangenen drei Jahren nicht geändert. Nun, wir haben geübt. Exercice. Eine geschlagene Stunde. Wie bei einem Anfänger. Körperhaltung, Schrittfolge. Immer wieder von vorn. Fast wäre er mir mit bloßen Händen an die Kehle gegangen!« Er lachte freudlos auf.
»Zum Teufel noch mal, er hätte müde sein müssen«, warf Heinrich Heller irritiert ein. »Er hat am Vormittag zwei Stunden lang kräftig beim Holzschlagen mit anpacken müssen, und Ihr Unterricht fand diesmal direkt nach dem Mittagessen statt – und zwar nach einem extrem schweren und fetten Essen, wie vereinbart! Himmel, wie kann er nach all dem nicht müde gewesen sein!? Ich bin am Schreibtisch eingenickt!«
Maurice Fougot verzog spöttisch das Gesicht. »Oh, müde war er wohl schon, und das macht es ja umso schlimmer.«
»Ja, ich verstehe. Natürlich. Bitte, fahren Sie fort.«
Maurice Fougot erlaubte sich ein halbes Lächeln. »Der Rest ist schnell berichtet, Monsieur Professeur. Als wir endlich zum Florett griffen, glaubte ich schon, es hätte etwas genutzt, unser Plan. Er war so zornig auf mich, dass er nicht warten konnte, es mir zu zeigen.«
»Und Sie haben den Punkt eingeheimst.«
Maurice Fougot sah ihn mit einem merkwürdigen Lächeln an, aus dem ebenso Verdrossenheit wie Stolz sprach.
»Ja, den ersten Punkt habe ich erreicht, Monsieur Professeur«, sagte er betont langsam und legte eine dramatische Pause ein, bevor er hinzufügte: »Aber dabei blieb es auch. Es war der einzige Treffer, der mir gelang – gegenüber neunzehn, die Ihr Neffe anbringen konnte!«
Heinrich Heller atmete tief durch und lehnte sich zurück. »Also gut, der Tag ist gekommen, von dem wir beide wussten, dass er nicht mehr fern war. Nur wünschte ich, er wäre nicht ganz so schnell gekommen.«
»Er liegt schon hinter uns«, bemerkte der Fechtlehrer lakonisch und nippte an seinem Cognac.
Heinrich Hellers Gestalt straffte sich auf einmal. »Herr im Himmel, warum reden wir so im Trauerton darüber, über Sie und Tobias? Gut, unsere persönlichen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Aber ist das ein Grund, in Wehmut zu versinken? Objektiv gesehen sollte das genaue Gegenteil der Fall sein!«
Maurice Fougot sah ihn skeptisch an.
»Sie haben Großartiges geleistet«, erklärte Heinrich Heller. »Sie können stolz sein!« Er erhob sich und streckte ihm die Hand hin. »Ich möchte Ihnen meine Hochachtung und meinen aufrichtigen Dank aussprechen, und ich bin sicher, das auch im Namen meines Bruders sagen zu können: Sie waren ausgezeichnet!«
Maurice Fougot lächelte ein wenig gerührt, als er die ihm dargebotene Hand ergriff und den herzlichen Druck erwiderte. »Merci, aber das Gleiche gilt auch für Tobias. Er war der beste Schüler, den ich je hatte – und es gibt nichts mehr, was ich ihm noch beibringen könnte.«
Sie nahmen wieder Platz. Heinrich Heller strich sich über seinen vollen, jedoch akkurat geschnittenen Bart. »Nun, ich bin sicher, dass Sie ihm die ein oder andere Finesse …«
Maurice Fougot ließ ihn erst gar nicht ausreden und sagte höflich, aber mit Nachdruck: »Excusez-moi, dass ich Ihnen ins Wort falle, aber es ist, wie ich sagte: Es gibt nichts mehr, was ich ihm noch beibringen könnte, auch keine Finessen. Es fällt mir nicht weniger schwer als Ihnen, aber wir müssen der Tatsache ins Auge sehen: Tobias ist kein Schüler mehr, was die Kunst der Klingenführung betrifft. Er ist mir ebenbürtig. Zumindest. Und er kann zudem noch den Vorteil der Jugend zu seinen Gunsten in die Waagschale werfen.«
»Die sich aber auch zum Nachteil auswirken kann«, gab Heinrich Heller zu bedenken. »Es stände ihm gewiss nicht schlecht zu Gesicht, würde er noch ein wenig mehr Selbstdisziplin an den Tag legen. Er ist in einem ungestümen Alter. Und ich schätze Ihren Einfluss auf den Jungen sehr hoch ein. Es wäre mir deshalb sehr daran gelegen, dass Sie auch weiterhin zweimal die Woche mit ihm üben.«
Maurice Fougot lächelte etwas wehmütig. »Damit täte ich keinem von uns einen Gefallen, glauben Sie mir. Tobias kann mich nicht ausstehen …«
»Sie waren streng mit ihm, gut! Aber …«
»Ich war mehr als streng mit ihm«, fiel der Franzose ihm ins Wort. »Wir haben vorher darüber geredet, Monsieur Professeur. Er sollte mich von Anfang an unsympathisch finden, ja mich aus ganzem Herzen ablehnen. Es war Teil meines Konzeptes.«
Heinrich Heller nickte. »Jaja, Sie wollten ihn herausfordern, seinen Ehrgeiz wecken, es Ihnen eines Tages heimzuzahlen.«
»Correct! Nach meiner ersten Stunde mit ihm erkannte ich sofort sein ungeheures Talent. Ich hatte einen ganz seltenen Diamanten vor mir. Doch es war noch ein Rohdiamant, und um ihm den wirklich meisterlichen Schliff zu geben, brauchte ich seine ungeteilte Hingabe und einen geradezu brennenden Ehrgeiz. Und das in seinem jugendlichen Alter mit gewöhnlichen Anreizen und gutem Zuspruch zu erreichen, hielt ich für genauso ausgeschlossen wie Sie. Deshalb habe ich es ihm bewusst erschwert, indem ich ihn so gut wie nie lobte, mich arrogant und verächtlich verhielt und ihn wie einen dummen kleinen Jungen behandelte, der ein Florett nicht von einem Steckenpferd unterscheiden kann«, sinnierte Maurice Fougot, den Blick in die Flammen gerichtet. »Und es ist mir nicht leichtgefallen, drei Jahre lang bei dieser Rolle zu bleiben. Wie oft hatte ich das Verlangen, ihm zu zeigen, wie stolz mich seine Fortschritte machten, wie bewundernswert schnell er komplizierte Kombinationen und Taktiken begriff und wie sehr er mir ans Herz gewachsen war. Aber ich habe mir all das um seiner selbst willen versagt, weil ich ein Ziel vor Augen hatte, so schwer es mir auch fiel: die tiefe Abneigung in seinen Augen zu lesen.« Er schwieg, und auch Heinrich Heller sagte nichts.
Es war Maurice Fougot, der schließlich wieder das Wort ergriff. »Non, es ist unmöglich, dass ich jetzt noch kommen und mit ihm fechten kann. Meine Aufgabe ist beendet. Er braucht von nun an jemanden als Partner, mit dem er sich im Guten messen kann, den er respektiert und der auch sein Vertrauen, womöglich sogar seine Freundschaft zu gewinnen vermag.«
»Ja, das leuchtet mir ein«, räumte Heinrich Heller ein, und seine Stimme hatte einen sorgenvollen Unterton.
»Sie sorgen sich um Tobias, nicht wahr, Monsieur Professeur?«
»In der Tat. Wie ich es schon sagte, er befindet sich in einem schwierigen Alter – und sein Vater ist vor ein paar Monaten, wie Sie ja wissen, wieder zu einer längeren Reise aufgebrochen.«
»Tobias wäre wohl gern mitgegangen.«
Heinrich Heller lachte leise auf. »Gern ist mächtig untertrieben! Er hat gebettelt, geweint und geflucht! Nichts hat er unversucht gelassen, seinen Vater umzustimmen und die Erlaubnis zu erhalten, ihn begleiten zu dürfen. Ich glaube, er hätte seinen linken Arm dafür gegeben. Aber natürlich blieb sein Vater hart. Tobias ist eben noch nicht erwachsen, obwohl er andererseits auch kein Junge mehr ist. Er steckt dazwischen, und genau das ist es, was es so schwierig macht.«
»Es wäre wohl leichter für ihn und Sie, wenn er nicht so aufgeweckt und seinen Gleichaltrigen in vielen Dingen nicht schon so himmelweit überlegen wäre«, mutmaßte Maurice Fougot.
Heinrich Heller verzog das Gesicht. »Ja, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich die außergewöhnlichen Begabungen des Jungen einmal auch als schwere Belastung empfinden würde. Aber so ist es gekommen. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte seinen brennenden Ehrgeiz und die Sucht, die ihn immer wieder in die unerforschte Fremde hinauszieht, diesmal länger beherrschen können. Warum ist er nicht zwei, drei Jahre bei uns geblieben? Er hätte die Zeit gut dafür nutzen können, seine Reisetagebücher zu bearbeiten und zu veröffentlichen und sich um seinen Sohn zu kümmern.« Er seufzte schwer. »Aber andererseits verstehe ich ihn natürlich. Ich kenne diesen inneren Drang, der ihn ruhelos vorantreibt, nur zu gut. Ich weiß, wie es ist, wenn man meint, nicht mehr atmen zu können und von den Mauern seines bürgerlichen Zuhauses in der Heimat erdrückt zu werden. Männer wie Tobias’ Vater kennen in Wirklichkeit nur ein Zuhause und eine Heimat – Unterwegssein in fremden Ländern. Denn hinter jedem Tal, das das Ziel ihrer Expedition war, liegt immer wieder ein neues, noch nicht erforschtes Tal. Ich habe selbst eine gute Portion Reisefieber mitbekommen und weiß, wovon ich spreche. Doch es hat nie mein Leben beherrscht, wie es bei meinem Bruder der Fall ist. Ich glaube, er würde an Schwermut und Fernweh sterben, würde man ihn zwingen, seine Forschungsreisen aufzugeben und ein bürgerliches Leben zu führen. Und ich fürchte, auch Tobias hat das im Blut. Nur ist diese Veranlagung bei ihm noch nicht durchgebrochen. Aber wie lange wird es noch gut gehen?«
Verständnisvoll und interessiert hatte Maurice Fougot zugehört. »Wie lange wird Ihr Bruder fort sein?«
Heinrich Heller hob die Hände. »Wer kann das schon sagen? Die Quellen des Nils will er erforschen, und diesmal wird er seine Expedition von Madagaskar aus beginnen. In einem guten Jahr will er wieder zurück sein, so hat er versprochen. Doch Pläne sind leicht geschmiedet und Vorsätze schnell gefasst. Ob sie sich dann aber auch mit der Wirklichkeit vereinbaren lassen, steht auf einem anderen Blatt geschrieben.«
»Sie rechnen also nicht damit, dass er so bald wieder zurück sein wird«, folgerte Maurice Fougot.
»Nein«, kam die Antwort ohne langes Zögern. »Als mein Bruder zu seiner letzten Expedition aufbrach, hörte ich Ähnliches von ihm. Erst zweieinhalb Jahre später sah ich ihn hier wieder – von der Malaria gezeichnet und dem Tod mehr als einmal nur knapp entronnen, doch schon mit neuen Plänen und jenem fiebrigen Glanz in den Augen, der mehr verrät als tausend Worte. Dass er über ein halbes Jahr geblieben ist, lag nur an seiner schlechten körperlichen Verfassung.«
»Gott sei Dank hat sich Ihr Bruder gut erholt«, bemerkte der Fechtlehrer.
Heinrich Heller schien Fougots Worte gar nicht gehört zu haben, denn er ging nicht darauf ein. »Wissen Sie«, fuhr er fort, ganz in seine sorgenvollen Gedanken versunken, »für Tobias war es damals nicht so schlimm, als sein Vater Falkenhof verließ. Er war keine dreizehn Jahre, in vieler Hinsicht noch ein Kind. Und wenn er auch damals natürlich schon von aufregenden Expeditionen träumte und sich wünschte, eines Tages zusammen mit seinem Vater loszuziehen, so wusste er doch, dass es nur ein schöner Traum war. Ein Traum, der sich bestenfalls irgendwann später einmal erfüllen würde. Sein Vater war mehr ein Idol – bewundert, aber unerreichbar.«
»Während Sie ihn aufgezogen haben.«
»Nun ja, ich war ihm schon mehr als nur ein Vater und doch zwangsläufig auch weniger, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe ihn auf meine Art erzogen und ihm das mitgegeben, was ich ihm anzubieten hatte.«
Maurice Fougot lächelte. »O ja, ein ganzes Universum an Wissen.«
Heinrich Heller erwiderte das Lächeln. »Tobias ist wie ein Schwamm, der alles in sich aufsaugt. Ich habe in der Tat dafür gesorgt, dass Geist und Körper beschäftigt waren, zusammen mit Ihnen und Karl Maria Schwitzing, seinem Hauslehrer, der eine beachtliche Kapazität ist. Aber die Jahre, wo wir leichtes Spiel mit ihm hatten, sind ein für alle Mal vorbei.«
»Wem erzählen Sie das, Monsieur!«
»Sie haben mir heute gesagt, dass es nichts mehr gibt, was Sie Tobias beibringen können«, sagte Heinrich Heller nachdenklich. »Und der Tag, an dem Herr Schwitzing mir Gleiches sagen wird, liegt auch nicht mehr in allzu ferner Zukunft. Er hat mich schon vorgewarnt. Und was soll dann geschehen?«
»Universität?«
Fast geringschätzig winkte Heinrich Heller ab. »Er würde sich zu Tode langweilen! Bei aller gebotenen Bescheidenheit, aber was er hier in jungen Jahren schon gelernt hat, stellt den Lehrplan so mancher Universität in den Schatten.«
»Und was ist mit Ihnen? Sie könnten ihn mit Ihrem Wissen doch noch eine Ewigkeit in Atem halten.«
»Ach, es geht ja nicht allein um die Anhäufung von möglichst viel Wissen, Monsieur Fougot. Der Junge weiß heute schon zehnmal mehr, als er von seiner Reife her sinnvoll nutzen und in praktische Entscheidungen umsetzen kann.«
»Wissen und Weisheit sind eben noch längst nicht ein und dasselbe«, pflichtete Maurice Fougot dem Gelehrten bei.
»Ein wahreres Wort ist selten gesprochen worden. Aber es wäre vermessen, von ihm zu erwarten, dass er auch die Reife eines erwachsenen Mannes an den Tag legt, nur weil sein Gehirn mit mehr Wissen vollgestopft ist, als so manch gelehrter Mann sich in mühseliger Arbeit hat aneignen können«, nannte Heinrich Heller das Dilemma beim Namen. »Er braucht jetzt mehr als nur Buchwissen, das ist das Problem, vor dem ich stehe – und er auch, nur dass er sich dessen natürlich nicht bewusst ist. Und ich tauge nicht dazu, einen so ungestümen Geist wie Tobias zu zähmen, der ganz nach seinem Vater schlägt. Nicht auf meine alten Tage.«
»Was Sie für ihn getan haben, Monsieur Professeur, bedarf wohl keiner wortreichen Würdigung, und ich weiß, dass Tobias Sie liebt und verehrt«, versuchte der Fechtlehrer ihn ein wenig aufzumuntern.
Heinrich Heller lächelte müde. »Was in meiner Macht stand, habe ich getan, und darin wird sich auch in Zukunft nichts ändern. O ja, es gibt noch so unendlich vieles, was er nicht weiß und von mir lernen könnte. Aber ich bin einundsechzig, und wer weiß, wie viele Jahre mir noch auf Gottes Erde vergönnt sind? Es wäre wohl zu viel von mir verlangt, dass nun ich zu seinem Lehrer werden soll, der ich zwar so oder so schon immer gewesen bin, jedoch nicht mit einem festen Stundenplan à la Karl Maria Schwitzing. Nein, ich kann diese Aufgabe so nicht übernehmen – und ich würde daran gewiss scheitern. Abgesehen davon kann ich meine wissenschaftlichen Studien nicht hintenanstellen. Was das betrifft, bin ich nicht weniger egoistisch als mein Bruder, und ich glaube, in meinem Alter ist dies kein Fehler, sondern eine Notwendigkeit.«
»So sehe ich es auch. Ihre Verdienste um die Erziehung von Tobias stehen außer Frage. Sie haben wahrlich nicht die geringste Veranlassung, sich Selbstvorwürfe zu machen.«
»Das tue ich auch nicht. Ich mache mir nur Sorgen um ihn. Denn ich spüre seine Unruhe. Wie lange kann ich ihn noch halten? Es zieht ihn magisch in die Welt! Es ist ein wahrer Segen, dass der gute Sadik bei ihm ist. Sonst wäre er wohl schon längst versucht gewesen, auf eigene Faust loszuziehen und die Abenteuer zu suchen, die er bisher nur aus Büchern und Erzählungen anderer kennt. Nun ja, der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Also, was beklage ich mich?« Er zwang sich zu einem Lächeln, das aber wenig überzeugend ausfiel.
»Ich bedaure, Ihnen nicht helfen zu können«, sagte Maurice Fougot mit aufrichtigem Mitgefühl. »Wenn ich es recht betrachte, bin ich für meinen Teil doch recht froh, dass ich Tobias so weit habe bringen können – auch wenn sich in den Stolz der bittere Tropfen eines verletzten Egos mischt, denn niemand ist gern der Unterlegene. Aber offenbar sollte es so und nicht anders sein, und ich habe meine Aufgabe im rechten Augenblick zum Abschluss gebracht.«
Etwas in der Stimme des Franzosen ließ Heinrich Heller aufhorchen. »Oh! Das klingt nach Abschied«, sagte er überrascht und mit fragendem Unterton.
Maurice Fougot nickte. »Ja, ich werde schon bald nach Paris zurückkehren.«
»Aber gewiss doch nicht wegen Tobias, nicht wahr?«