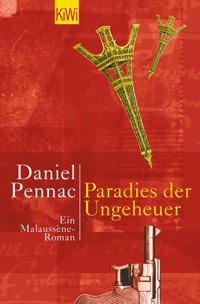16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Benjamin Malaussène Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In Frankreich kommt niemand an ihm vorbei. Seine Bücher führen stets die Bestsellerlisten an. Nun legt Daniel Pennac, Autor von u. a. »Wie ein Roman« und »Schulkummer« und humorvoller Chronist unserer Zeit mit geradezu soziologischem Blick, den letzten Band seiner Malaussène-Saga vor. Über vierzig Jahre lang hat Daniel Pennac die Geschicke der unkonventionellen und chaotischen Familie Malaussène in insgesamt acht Romanen festgehalten. Mit skurrilem Humor, aber gleichzeitig immer am Puls der gesellschaftlichen Realität. Im letzten Teil der Malaussène-Saga treffen nun alle überlebenden Figuren der Familie Malaussène noch einmal aufeinander. Die Handlung führt die Ereignisse um die Entführung des korrupten Industriellen Lapietà fort. Es entwickelt sich eine dramatische Krimifarce, gespickt mit aberwitzigen Wendungen und absurder Komik, in der alle Beteiligten ein doppeltes Spiel zu spielen scheinen. Denn obwohl sie ständig die Lüge anprangern, lügen doch alle, dass sich die Balken biegen. Das gilt für die Moral, die Politik, die Wirtschaft, die Diplomatie, die Liebe, das Geschäft, kurz: das ganze Leben. Ein echter, unverwechselbarer Pennac also. Und natürlich wirft der Autor in Gestalt seiner Figuren auch hier wieder einen Blick auf die reale Welt. Die scheinbare Beiläufigkeit, mit der er ernste Themen unserer Gegenwart in seinen humoristischen Roman einfließen lässt, weist ihn als großen Erzähler aus, dessen Bücher immer auch Kommentare zur Zeit sind. Ein ganz großes Lesevergnügen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Ähnliche
Daniel Pennac
Der letzte Malaussène
Der Fall Malaussène 2Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Daniel Pennac
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Daniel Pennac
Daniel Pennac, geboren 1944, lebt in Paris. Über zwei Jahrzehnte arbeitete er als Lehrer, bevor er sich 1995 endgültig nur noch dem Schreiben widmete. Neben zahlreichen Romanen, wie den erfolgreichen Malaussène-Krimis, hat er Kinder- und Jugendbücher und einen Band mit eigenen Zeichnungen veröffentlicht. Bekannt wurde Pennac vor allem durch die literarische Streitschrift für die Rechte des Lesers »Wie ein Roman«. Für «Schulkummer« erhielt er 2007 den renommierten Prix Renaudot, mit »Der Körper seines Lebens« führte er in Frankreich wochenlang die Bestsellerlisten an.
Eveline Passet studierte nach einer Kindheit im Südhessischen in Paris Slawistik und ein wenig auch Romanistik (Abschluß: Maîtrise). Sie lebt in Berlin, wo sie seit 1985 als literarische Übersetzerin (Russisch, Französisch) arbeitet sowie als Rundfunkautorin (künstlerische und Literaturfeatures, vielfach in Ko-Autorschaft mit Raimund Petschner). Darüber hinaus entwickelt sie unterschiedliche öffentlichkeitswirksame Projekte zum Übersetzen und bietet Fortbildungen für ÜbersetzerInnen an: Unter anderem moderiert sie seit 2005 gemeinsam mit Gabriele Leupold im Literarischen Colloquium Berlin eine Vortragsreihe zur deutschen Sprachgeschichte.
Übersetzungen (Auswahl)
Daniel Pennac, Monsieur Malaussène, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1997.
Große Kinder – kleine Eltern, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1999.
Adel vernichtet, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2000.
Vorübergehend unsterblich, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2000.
Paradies der Ungeheuer, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2001.
Wenn alte Damen schießen, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2002.
Sündenbock im Bücherdschungel, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2003.
Der Diktator und die Hängematte, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2005.
Schulkummer, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2009.
Der Körper meines Lebens, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2014.
Der Fall Malaussène – sie haben mich belogen, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2019.
- Wassili Golowanow, Das Buch vom Kaspischen Meer, Übers. zs. mit Valerie Engler, Matthes & Seitz, Berlin, 2019.
Werke und Literaturprojekte
Eigene Autorenwerke, Literaturprojekte, Herausgaben
1997 gemeinsam mit Raimund Petschner Erarbeitung des literarischen Teils der Ausstellung Ilja Ehrenburg und die Deutschen für das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst.
2003 Realisierung der Videodokumentation Spurwechsel. Ein Film vom Übersetzen (russischer Titel: ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ), zusammen mit Gabriele Leupold, Olga Radetzkaja, Anna Schibarowa und Andreas Tretner.
2012 gemeinsam mit Gabriele Leupold Herausgabe des Sammelbandes Im Bergwerk der Sprache. Eine Geschichte des Deutschen in Episoden, Wallstein Verlag, Göttingen.
Rundfunkfeatures (eine kleine Auswahl):
Die wiederbelebte Stimme. Der Geschichtenerzähler Daniel Pennac. Literaturfeature zusammen mit Raimund Petschner, DLRBerlin, 1997.
Das große Netz und die feinen Fäden. Einstieg in die Pariser Métro. Feature zusammen mit Raimund Petschner, SWR/DLRBerlin, 2000.
In einer Zeit unter der Erde. Pariser Métro und Literatur. Literaturfeature zusammen mit Raimund Petschner, SWR/DLRBerlin, 2000.
Nach dem Bann. Russische Exilschriftsteller heute, Literaturfeature, DLRBerlin, 2003.
An der Schwelle zur Moderne. Das Erdbeben von Lissabon und das Denken der Welt, Feature zusammen mit Raimund Petschner, DLF, 2006.
»Das unergründlich Lebendige«. Alberto Giacometti und die Wirklichkeit, Feature zusammen mit Raimund Petschner, DLF, 2007.
Der Tag startet meist bedeckt. 100 Jahre Volksauto, Feature zusammen mit Raimund Petschner, WDR, 2008.
»Das Fluidum der Welt und die Not des Lebens«. Die Wandlungen des Lew Nikolajewitsch Tolstoj, Literaturfeature zusammen mit Raimund Petschner, DLRKultur, 2010.
Getrennt vereint. Das deutsch-deutsche Gespräch über russische Literatur, Literaturfeature, DLRKultur, 2014.
Auszeichnungen
Zahlreiche Arbeitsstipendien des Deutschen Übersetzerfonds, nicht zuletzt für Übersetzungen der Werke von Daniel Pennac. Des weiteren Stipendienaufenthalte in verschiedenen Übersetzerkollegien, im Künstlerhaus Kloster Cismar, in Bordeaux.
2014 Übersetzerpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e.V.
2017 Zuger Übersetzer-Stipendium für ihr Lebenswerk und ihre Arbeit an den Tagebüchern von Michail Prischwin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In Frankreich kommt niemand an ihm vorbei. Seine Bücher führen stets die Bestsellerlisten an. Nun legt Daniel Pennac, Autor von u. a. »Wie ein Roman« und »Schulkummer« und humorvoller Chronist unserer Zeit mit geradezu soziologischem Blick, den letzten Band seiner Malaussène-Saga vor.
Über vierzig Jahre lang hat Daniel Pennac die Geschicke der unkonventionellen und chaotischen Familie Malaussène in insgesamt acht Romanen festgehalten. Mit skurrilem Humor, aber gleichzeitig immer am Puls der gesellschaftlichen Realität. Im letzten Teil der Malaussène-Saga treffen nun alle überlebenden Figuren der Familie Malaussène noch einmal aufeinander. Die Handlung führt die Ereignisse um die Entführung des korrupten Industriellen Lapietà fort. Es entwickelt sich eine dramatische Krimifarce, gespickt mit aberwitzigen Wendungen und absurder Komik, in der alle Beteiligten ein doppeltes Spiel zu spielen scheinen. Denn obwohl sie ständig die Lüge anprangern, lügen doch alle, dass sich die Balken biegen. Das gilt für die Moral, die Politik, die Wirtschaft, die Diplomatie, die Liebe, das Geschäft, kurz: das ganze Leben. Ein echter, unverwechselbarer Pennac also. Und natürlich wirft der Autor in Gestalt seiner Figuren auch hier wieder einen Blick auf die reale Welt. Die scheinbare Beiläufigkeit, mit der er ernste Themen unserer Gegenwart in seinen humoristischen Roman einfließen lässt, weist ihn als großen Erzähler aus, dessen Bücher immer auch Kommentare zur Zeit sind.
Ein ganz großes Lesevergnügen!
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motti
Inhalt des ersten Bandes
Der Malaussène-Stamm
I Pépère
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
II Die Suche
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
III Action!
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
IV Intermezzo
16. Kapitel
V Die Zeit der Verhöre
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
VI Das Kapitel vom Anfang des Endes
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
VII Die Implosion
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
VIII Maman
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Register
Danksagung
Zum Andenken an Joseph Ponthus und in Erinnerung an den Freund Nemo.
Inhalt des ersten Bandes
Der Fall Malaussène
Knapp und bündig. Sein Titel: Der Fall Malaussène, Untertitel: Sie haben mich belogen. Die drei Malaussène-Cousins Maracuja, C’Est Un Ange, Monsieur Malaussène (Mara, Sept, Mosma) und ihr Freund Tuc haben Georges Lapietà – einen nicht gerade unauffälligen Geschäftsmann, zudem Vater des erwähnten Tuc – entführt, um eine »Installation«, eine »Performance«, kurz ein spektakuläres Kunstereignis zu schaffen. Aber da entreißen ihnen echte Gauner Lapietà. Wer sind diese Gauner? Das erfährt der Leser hier.
Ach, noch etwas! Alceste, Verfasser von Sie haben mich belogen und Verfechter der »wahren Wahrheit«, bringt dieser Tage im Verlag Éditions du Talion seinen neuen Roman heraus: Ihr sehr großer Fehler.
Damit jetzt aber genug.
Um meinen Leserinnen und Lesern das Leben zu erleichtern, gibt es auf Seite 431 ein Personenregister, angereichert mit einzelnen Begriffserläuterungen.
Der Malaussène-Stamm
IPépère
»›Opi‹, das hätte mich angekotzt, aber ›Großvater‹ ist genehmigt. Oder Pépère, wenn euch das lieber ist. Ich fand immer, ich würde einen guten Großvater abgeben. Söhne, nein, keine Söhne, denen kann man nichts beibringen. Enkelsöhne, die ja, die respektieren einen. Was mich angeht, ich habe meinen Großvater immer respektiert.«
Pépère
1
»Nun, Kébir, hast du ordentlich aufgeräumt?«
Wie kann Pépère einem so große Angst einjagen, mit seinem kleinen Ranzen und der sanften Stimme? Wie ist das möglich? Die Frage stellt sich bei jedem Gespräch mit Pépère. Nicht nur Kébir, den anderen auch.
»Ist alles so gelaufen, wie du wolltest? Ist alles, wie es sein soll?«
Sie ist wirklich nett, seine Stimme. Er putzt dich nie runter, er redet mit dir.
»Aufräumen ist wichtig, mein Kleiner.«
Er erklärt die Dinge.
»Ein ordentliches Zimmer bedeutet Ordnung im Kopf.«
Erklärt immer alles.
»Ein Bett zum Beispiel. Du machst picobello dein Bett, danach denkst du mit aufgeräumtem Kopf. Stimmt doch? Danach kannst du dich nicht mehr vertun. Na ja, weniger.«
Freundlich wiederholt er:
»Stimmt doch, mein Kébir?«
Dazu dieses innige Lächeln, diese sanfte Stimme, diese alte Hand, die er dir auf den Kopf legt und die, während er sie zurückzieht, dein Ohr streift. Man spürt die Kälte des Siegelrings.
»Dasselbe mit gewichsten Schuhen. Du kannst dich darin sehen, alles sauber. Sie sind dein Gewissen. Das schindet Eindruck. Wo du auftauchst, sehen alle sofort, du respektierst dich und respektierst die anderen. Wie beim Klo.«
Eine Sauberkeit, auf die er auch Wert legt. Großen.
»Du weißt, dieser kleine Satz in den Toiletten: ›Bitte hinterlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn selbst vorfinden möchten.‹ So ungefähr. Im Café von Albert, auf dem Klo von Onkel Albert, hing der Satz, erinnerst du dich?«
Jeder erinnert sich daran, zwangsläufig, so fett wie es da geschrieben stand.
»Weißt du, was der Satz besagen will?«
Bei Pépère lernt man jedes Mal ein bisschen was dazu. Ohne das Gefühl zu haben, am Lernen zu sein. Er bewegt einen irgendwie zum Nachdenken. Mit Nachdenken kommt man voran. Jeden Tag ein bisschen mehr.
»Er will besagen, dass man wirklich an die anderen denken soll.«
Stimmt.
»Wer auf die Brille pisst, der denkt nicht an die anderen.«
Nein.
»Der denkt nur daran, sich zu erleichtern, Pech für den Nächsten. Oder die Nächste. Wenn eine Nächste, ist es noch widerwärtiger.«
Auch das stimmt.
»So etwas darf man nicht machen, Kébir.«
Nein.
»Ganz zu schweigen vom Geruch.«
Es gibt immer etwas, das er noch zu sagen hat.
»Weil, wenn er sich festsetzt, bleibt der Geruch nämlich nicht nur für den Nächsten. Er bleibt für alle Welt. Und für alle Zeit. Oder nicht?«
Doch.
»Also, von so einem Kerl, der auf die Brille pinkelt, von dem sag ich, dass er an niemanden denkt. Ich sage nicht, dass er an nichts denkt, aber an niemanden, das steht fest. Es geht ihm nur um sich.«
Stimmt.
»Aber so funktioniert das Familienleben nicht, mein Kébir.«
Das Familienleben, das bedeutet Pépère alles.
»Man muss an die andern denken.«
Ja.
»Sonst funktioniert es nicht.«
Nein.
»Wenn du die Scheiße nicht wegwischst, kann es nicht funktionieren.«
Richtig.
»Das hab ich euch von klein auf beigebracht.«
Ja.
»Ich hab es euch sogar vorgemacht. Oft.«
Ja, doch.
»Mich mit Leib und Leben reingekniet.«
Das muss man wirklich sagen.
»Das muss man doch wirklich sagen, hm? Ich hab mich bei jedem von euch mit Leib und Leben reingekniet. Ich war geduldig. Ich habe euch alles beigebracht und immer nachgeprüft, ob ihr begriffen habt. Oder nicht?«
Doch, schon.
»Und was mache ich gerade mit dir, Kébir, hier, jetzt?«
Jetzt gerade verlassen sie den Bahnhof. Kébir hat Pépère am Bahnhof abgeholt. Man weiß nie, wo er herkommt. Man weiß nur, wo er ankommt. Er kommt an dem Bahnhof an, von dem er sagt, man soll ihn da abholen. An irgendeinem Bahnhof, auch Busbahnhof. Er kündigt den Bahnhof und die Uhrzeit an, er steigt aus dem Zug oder Bus, er setzt sich mit seinem kleinen Ranzen ins Auto und sagt dir, wo langfahren, und da fährst du dann lang. Wohin, das weißt du auch nie. Wer ihn fragt, wo er herkommt (am Anfang, wenn einem noch die Routine fehlt, passiert das natürlich), dem antwortet er freundlich: »Stell ich dir vielleicht Fragen, die vergrätzen?« Und nie wieder stellst du diese Frage.
»Wir reden von Aufräumen, richtig? Bieg da vorne rechts ab, dann fünfzehn Kilometer der Straße nach.«
Die nächste rechts ab, okay.
»Gut. Also, hast du nach der Arbeit aufgeräumt?«
Ehm, also …
»Hast du aufgeräumt, Kébir?«
Er heißt nicht Kébir. Er heißt Marcel. Aber Pépère nennt ihn Kébir. Er hat nie begriffen, warum sich Pépère darüber beeumeln kann. Marcel Kébir. Jedenfalls ist Pépère nicht sein Großvater, er will bloß so genannt werden.
»›Opi‹, das hätte mich angekotzt, aber ›Großvater‹ ist genehmigt. Oder ›Pépère‹, wenn euch das lieber ist. Ich fand immer, ich würde einen guten Großvater abgeben. Söhne, nein, keine Söhne, denen kann man nichts beibringen. Enkelsöhne, die ja, die respektieren einen. Was mich angeht, ich habe meinen Großvater immer respektiert.«
Er hebt den Finger mit dem Singelring. Ein schwerer rechteckiger Ring, und lang. So lang wie das erste Glied seines Ringfingers. Aus Gold.
»Mein Großvater hat ihn mir vermacht. Mein einziges Erbe.«
Gut, aber wir reden hier nicht über Großväter oder Erbschaften, sondern übers Aufräumen.
»Vier Möglichkeiten, Kébir. Zweimal zwei. Entweder hast du aufgeräumt, oder du hast nicht aufgeräumt. (Zwei.) Wenn ja, dann entweder ordentlich oder nicht ordentlich. (Zwei.) Macht vier. Da sind wir uns doch einig?«
Schwierig, die Dinge anders zu sehen.
»Also?«
Also? Ja, also, kompliziert zu erklären …
»Lass dir Zeit, mein Kleiner, wir haben noch vierzehn Kilometer vor uns.«
Wirklich schwer zu erklären.
»Aber bis wir da sind, musst du es mir gesagt haben, danach ist es zu spät.«
Das sind die Sätze, mit denen Pépère einem Angst einjagt. Obwohl er sie wie alles sagt, freundlich.
»Weil mir nämlich gesagt worden ist, du hättest nicht aufgeräumt.«
Kébir konnte nicht aufräumen, was nicht dasselbe ist.
»Was hat dich abgehalten? Blieb doch nur noch die Treppe. Dort klar Schiff zu machen. Das war doch wohl nicht zu viel verlangt.«
Warum wirft er ihm das vor? Er weiß doch, dass was dazwischengekommen ist.
»Manchmal habe ich den Eindruck, ich hätte dir nichts beigebracht.«
Scheiße, Pépère tut, als wäre nichts Unerwartetes passiert.
»Die Sache bekümmert mich, Kébir, das sag ich dir offen und ehrlich.«
Das ist wirklich nicht gerecht.
»Woran lag es? Weil Pascou was abgekriegt hat?«
Ja, deshalb, das weiß Pépère genau.
»Du bist also die Treppe hochgerannt, statt dort klar Schiff zu machen?«
Ja doch, um Pascou zu helfen, um nachzusehen, ob es schlimm ist. Aber oben hat Kébir gesehen, dass Gérard weitaus übler dran war. Gégé hat sich gar nicht mehr gerührt. Der halbe Kopf hat ihm gefehlt. Die obere Hälfte.
Pépère scheint mit einem Mal erschöpft.
»Das hatte mit der Sache nichts zu tun. Gérard war nicht deine Aufgabe. Pascou auch nicht. Du hattest auf der Treppe klar Schiff zu machen.«
Aber Kébir war hochgerannt, um Pascou Deckung zu geben! Pascou konnte nicht mehr schießen. Er hatte seine Knarre fallen lassen.
»Eben. Pascou fällt aus, lässt seine Kanone los, die klackert stufenabwärts, und du, statt sie einzusammeln, rennst treppauf Richtung Ausgang! Hattest du Angst? Sei ehrlich, Kébir, hattest du Angst?«
Nein, Angst hat er nicht gehabt. Angst hat er jetzt.
»Die unten, wie viele waren das?«
Drei. Die drei Malaussènes. Die beiden Jungen und das Mädchen.
»Und …?«
Und was?
»Und die Knarre von Pascou.«
Ja.
»Du lässt drei Hanseln am Leben und lässt ihnen obendrein eine Shœltzer 72 zurück!«
Das ging alles im Affenzahn, verdammt! Sekunden. Kébir und Pascou hatten schon gezogen, waren drauf und dran, klar Schiff zu machen, da ballert es aus allen Ecken.
Pascou wird getroffen, lässt seine Wumme fallen. Kébir rennt hoch, um ihn zu decken. Ein Reflex halt. Unten hat er nicht sehen können, von wo sie beharkt werden, also ist er logischerweise hochgerannt! Er wollte nicht, dass Pascou abgeknallt wird!
»So etwas nennst du aufräumen …«
»Ich bin hoch, um ihn zu decken, verdammt!«
Kurze Stille hier.
Dann Pépères geduldige Stimme:
»Erstens, mein Kébir, redest du nicht in diesem Ton mit mir. Zweitens, beantworte diese Frage: Was hast du oben gesehen?«
Oben hatte Kébir die beiden Autos hinter der Nagelsperre gesehen und dass es Pascou echt schlecht ging – sein Arm baumelte wie tot herab –, außerdem hatte er Gérard gesehen, vor der Nagelsperre, mit fehlendem Kopf. Dann war da noch ein Typ, der wie eine gesengte Sau auf den Transporter zugaloppierte, wo die andern gerade Gérards Leiche reinwarfen. Der Typ hat zweihändig gefeuert. Voll krass! Die andern haben zurückgeschossen, aber das ging dem am Arsch vorbei. Und der vom Kombi hat ihn gedeckt. Geballer von allen Seiten. Zurückprallende Kugeln. Hätten sie die Stellung gehalten, wär der Treppenschacht vielleicht zur Falle geworden. Da haben sie sich halt verpisst. Dabei hat er Pascou gedeckt. Im doppelten Wortsinn. Im Rennen hat Kébir sich über Pascou gebeugt und zugleich auf den Gegner geschossen.
»Was für Fahrzeuge auf der Gegenseite?«, fragt Pépère.
Ein roter BMW und ein cremefarbener VW Kombi.
»Hast du dir die Kennzeichen aufgeschrieben?«
Eine Sache, die Pépère ihnen beigebracht hat. Die amtlichen Kennzeichen von allen Fahrzeugen notieren, die sich auf dem Operationsfeld befinden. Immer »das einschlägige Kennzeichen der in den Vorfall verwickelten Fahrzeuge aufnehmen«. So seine Formulierung.
»Kébir, hast du die Kennzeichen aufgenommen?«
Das von dem Kombi ja, aber vom BMW nicht. Das ist verdeckt gewesen von dem Körper des Typen, der Gégé umgelegt hat.
»Gib mir die Nummer des Kombis.«
Pépère schreibt sich die Nummer auf die Hand.
»Meinst du, das waren echte Polizisten?«
Einer hat so etwas wie einen Dienstausweis hochgehalten, aber ihre Kisten waren keine von der Polizei. Keine Sirene, kein Blaulicht, nichts. Vielleicht ja Zivilwagen, aber ein roter, tiefergelegter BMW ist für einen Bullen doch ein bisschen komisch. Außerdem waren sie nur zu dritt. Nicht gerade die Menge bei so einer brenzligen Sache wie immerhin Lapietà wiederzufinden! Die BRB hätte eine Armee in Marsch gesetzt. Sogar mit dem Fernsehen im Schlepptau.
»Es ist also, wie ich gesagt habe: Du hast dich verdrückt, ohne auf der Treppe klar Schiff gemacht zu haben. Was hätte dich das gekostet? Drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Peng! Peng! Peng! Hattest du keine drei Sekunden?«
Nein, eben, die drei Sekunden hatten sie nicht mehr. Sie hatten sich unbedingt verpissen müssen, ehe der Irre, der sie zweihändig beharkte, den Transporter erreichte. Eine P5 in der Linken, eine Stein in der Rechten.
»Du hast die Kaliber erkannt?«
Anhand der Musik. Kébir hatte zu seinem zwanzigsten Geburtstag eine Stein bekommen, und nach dem Coup in Beauregard hatte Pépère ihm eine P5 geschenkt.
»Ach, apropos Beauregard, die Shœltzer von Pascou ist dort zum Einsatz gekommen. Er behauptet, dass nicht, aber ich bin sicher, dass doch. Und er hat sie nicht weggeworfen. Ein hübsches Geschenk, dass du da den Jungs von der Ballistik gemacht hast, Kébir.«
Oh! Verflixte Kacke …
»Siehst du? Das bedeutet es, nicht aufzuräumen.«
Verflixte Kacke …
»Halt da an der Kreuzung.«
Pépère steigt nicht aus. Er redet nicht mehr. Er hält seinen Ranzen auf dem Schoß, senkrecht. Umklammert ihn wie eine Alte-Damen-Handtasche. Ein abgerockter kleiner Ranzen. Völlig abgewetzt. Unmöglich, noch auszumachen, ob aus Leder. Ein Ranzen wie Pennerschuhe. Keine Farbe mehr. Pappkarton, könnte man meinen. Aber Pépère hängt an ihm. Man sieht ihn nie ohne. ›Mein Reiseköfferchen‹ sagt er dazu. Aber jetzt schweigt er. Er blickt auf die Straße, geradeaus.
Nach kurzem Nachdenken sagt er:
»Der Typ aus dem Transporter hat binnen drei Sekunden sein halbes Magazin in Gérards Kopf entleert, und du hast es in der dreifachen Zeit nicht hingekriegt, auf der Treppe klar Schiff zu machen. Bist du dir über das Kräfteverhältnis im Klaren, Kébir?«
Kébir denkt darüber nach, als der andere Wagen auftaucht. Ein E-Auto. Ein Voxor. Neuestes Modell. Lautlos hält er neben ihnen. Kébir schrickt zusammen. Wer sitzt am Steuer? Das bleibt im Dunkeln und hinter getönten Scheiben. Der Wagen hat sich so dicht an sie herangeschoben, dass Kébir seine Tür nicht würde öffnen können. Die Scheiben des Voxor bleiben geschlossen, und die Zeit hört auf zu vergehen. Kébir empfindet das so: Die Zeit ist vergangen, jetzt gibt es keine mehr. Wie eine leere Flasche. Kébir hätte gern, dass Pépère ihn ansieht, aber niente. Pépère blickt geradeaus. Nicht einmal ein Seitenblick auf den Voxor neben ihnen.
»Du hast auf die Brille gepisst, mein Lieber.«
Kébir würde sich gern richtig verteidigen. Er hat sich echt nichts vorzuwerfen, ist doch wahr. Immerhin hat er Pascou gerettet. Er ist angstlos durch den Kugelhagel von dem Verrückten mit den zwei Wummen gerannt. Er hat das Auto von Kamel genau in dem Moment erreicht, als der losfuhr. Eine Sekunde später, und Kamel hätte sie im Kugelhagel von dem Irren und dem andern, der vom Kombi aus schoss, stehen lassen. In dem Moment hat sich Pascou die zweite Kugel gefangen. Im Fuß diesmal. Aber das ist wirklich nicht seine Schuld. Er hat Pascou gerettet, so viel dazu.
Pépère denkt nach, ohne ihn anzusehen. Immer ein heikler Augenblick in ihrer Beziehung. Man fragt sich, was er überlegt, wenn etwas in die Hose gegangen ist. Sich dehnende Sekunden … Pépère schüttelt den Kopf.
»Das stinkt jetzt bis zum Himmel.«
Die getönten Scheiben des Voxor …
Kébir sieht dort sein eigenes Spiegelbild.
Endlich blickt Pépère ihn an.
»Ich werde dir trotz allem eine letzte Chance geben, mein Kleiner.«
Kébir braucht einen Moment, bis er begreift, was Pépère da gesagt hat. Aber dann: Oh, ich bin also nicht tot? Verdammt, ich bin nicht tot! Beim Haupte meiner Mutter, ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Puh, was für eine Erleichterung!
»Aber es ist das letzte Mal. Wenn du es versaust …«
Ich mach alles, was du willst, Pépère! Ich schwör, alles! Puh, was für eine Erleichterung! Wie viel Luft wieder in den Lungen …
»Du fährst nach Paris zurück und sammelst die Shœltzer ein.«
Na klar, aber ja doch! Gleich morgen! Er überlässt diesen kleinen Deppen doch nicht die Knarre!
»Haben wir uns verstanden, Kébir? Du darfst es nicht wieder vermasseln. Du sammelst die Shœltzer ein und übergibst sie mir persönlich.«
Wegen irgendetwas in Pépères Stimme sieht Kébir sich ohne Shœltzer zurückkommen. Vor Pépère ohne Pistole erscheinen.
Deshalb fragt er leise:
»Und wenn sie sie den Bullen gegeben haben? Oder einfach entsorgt?«
Pépère sieht ihn geduldig an.
»Das sind Kinder, Kébir, die werden sie schon behalten haben. Kinder mögen Waffen. Du vielleicht nicht? Bist du kein Kind? Und Pascou? Kein Kind? Eine Kanone behalten, die zum Einsatz gekommen ist, überleg mal, was für eine Dummheit! Das kann doch nur ein Kind machen. Oder?«
Ja, doch, klar. Wäre Kébir nicht der Steppke, der er ist, er hätte Sinn und Verstand für Prioritäten gehabt: Als Erstes auf der Treppe klar Schiff machen, als Zweites die Shœltzer einsammeln, als Drittes oben Pascou helfen.
Pépères Hand legt sich auf den Kopf des Jungen.
»Keine Panik, hm? Die Malaussènes sind ein Klacks. Zumindest wissen wir, wo sie wohnen.«
Kébir zögert kurz, ehe er fragt:
»Geh ich allein hin?«
Pépère schenkt ihm sein gütiges Lächeln.
»Nein, mein Kleiner, keine Sorge, ich gebe dir drei Jungs mit.«
Kébir spürt die Kälte des Siegelrings.
»Geh ganz entspannt hin«, sagt Pépère leise. »Und vor Ort arbeitest du schön. Entscheidend ist das Ergebnis. Ihr knöpft sie euch vor, nehmt die Shœltzer, und dann …«
Pépère hat ihn am Ohr gepackt.
»Dann räumst du fertig auf.«
Kurze Pause.
»Du beseitigst sie. Alle drei. Also auch das Mädchen.«
Er zieht sanft am Ohrläppchen.
»Weil, ein Zeuge, mein Kébir, der macht eine Zeugenaussage.«
2
Ich, Benjamin Malaussène, Onkel und Vater dreier Vollidioten, die sich auf der verfluchten Treppe beinahe hätten umbringen lassen, erinnere mich sehr gut an die Art und Weise, wie ich davon erfahren habe.
Ich lag in der Koje, nahtlos angelöffelt an Julie, die Nase voll des Odeurs von Julius dem Hund, der vor unserer Zimmertür schlief, als ein unbezwingbarer Harndrang mich wie des Öfteren seit einigen Monaten (wird wirklich Zeit, dass ich mich drum kümmere) wach werden ließ und zwang, unser Bett zu verlassen, ohne Julie aufzuwecken, über Julius hinwegzusteigen und ihn mit gebieterischem Zeigefinger am Boden festzunageln, damit er mir nicht folgte, die Treppe des Haushaltswarenladens hinunterzugehen, ohne dass die Stufen knarrten und ohne unten Licht zu machen für den Fall, dass die Tür zum Schlafsaal offen stand, kurz, das zartfühlende Gespenst zu geben, um Mosma, Sept und Mara nicht zu wecken, die im Schlafsaal den Schlaf der Gerechten schliefen. Ich also endlich unten und mit überdehnter Blase auf Zehenspitzen die Klotür ansteuernd, da höre ich plötzlich Stimmengemurmel.
Verharren.
Da wurde geredet.
Zwei tonlose Stimmen.
Die Stimmen von Monsieur Malaussène und C’Est Un Ange.
Neugier ist doch etwas Verrücktes. Pinkelbedürfnis? Wann war das? Meine Ohren gingen auf.
Hier, was mein Sohn und mein Neffe im nächtlichen Familienschlafsaal sagten:
Sept(der Neffe): Hast du sie den Hahn spannen gehört?
Mosma(der Sohn): Und ob! Ein Ton, den ich nie vergessen werde.
Sept: Genau das gleiche Geräusch wie im Kino. Witzig, was?
Mosma: Mega. Hab mich halb totgelacht.
Sept: Und genau die gleichen Sätze: »Verdammt, wird brenzlig, wir verpissen uns! Los, Kébir, knall sie ab, die Bastarde! Mach klar Schiff!« Kinojargon.
Mosma: Obwohl die Typen bestimmt nicht oft ins Kino gehen.
Sept: Aber es wird von ihnen gespeist.
Stille. Eine lange. Dann C’Est Un Ange, in diesem unaufgeregten Ton, den er von jeher hat, wenn er etwas verstehen will:
»Jetzt mal im Ernst, Mosma, ich frage mich, warum sie in Filmen immer ewig lang den Hahn spannen. Selbst im Western. Die Revolvertrommel dreht sich doch von allein weiter, wenn man den Abzug drückt, oder?«
»Das Abzugszüngel, ja«, korrigierte Mosma.
»Man braucht also gar nicht zu spannen«, schlussfolgerte Sept. »Vor allem die modernen Knarren nicht. Das heißt, seit den Uranfängen des Tonfilms hat dieses Klicken für die Regisseure eine sprechende Funktion. Es folgt den narrativen Gesetzen: Achtung, ich spanne. Klick! Zuschauer, du bist schon mal gewarnt. Ein kleines, die Fantasie anstachelndes Zeichen, ehe es knallt, auf der Leinwand wie in der Wirklichkeit.«
Mosma hatte offenbar keine Lust, darauf einzusteigen. Er brummte:
»Ist gut, Sept. Wenn du aus der Sache ein Cineastengespräch machen willst, geh zu meinem alten Vater. Der begeistert sich für derlei Spitzfindigkeiten.«
Der alte Vater, das bin ich. Aber das war nicht feindselig gemeint. Höchstens mit einem Hauch Sohnesüberdruss. Das ist der Lauf der Dinge: Die Söhne rauben den Vätern die Geduld bis zu dem Tag, an dem die Väter den Söhnen auf den Wecker gehen. Mosmas Bemerkung hatte mich amüsiert, und so setzte ich mich Richtung Schlafsaal in Bewegung, um an der Unterhaltung teilzunehmen. Aber ein Haltegriff von hinten und eine Hand auf dem Mund stellten mich still. Eine vertraute Stimme flüsterte mir ins Ohr:
»Klappe, Ben, und rühr dich nicht.«
Es war Hadouch.
Eine Aufforderung, die durch meine sich vor mir aufbauende Schwester Verdun mittels Zeigefinger auf den Lippen bekräftigt wurde. Ihr anderer Zeigefinger wies auf eine dritte an der Wand zum Schlafsaal lehnende Gestalt, die derselben Unterhaltung wie wir lauschte. Ich glaubte, Titus zu erkennen.
Stille.
Reglosigkeit und Stille.
Bis aus der Dunkelheit wieder Mosmas Stimme erklingt.
Mosma: Diese Typen kennen uns.
Sept: Wie kommst du darauf?
Mosma: Sie haben gewusst, wie wir ticken. Sie haben sich sofort Mara gekrallt, um uns lahmzulegen. Sie wussten, wir würden keinen Finger rühren, wenn Mara dadurch in Gefahr gerät.
Sept: Das hätte sich jeder denken können.
Mosma: Nicht jeder. Dass sie als Allererstes Mara das Messer an die Kehle gesetzt haben, dafür mussten sie sie kennen, und auch die Art unseres Verhältnisses, unserer, wenn du so willst, Liebe zu ihr, und ihre Beziehung mit Tuc.
Sept: Eine Klinge an der Kehle, von egal wem, hätte dieselbe Wirkung gehabt.
Mosma: Nein, wäre es nicht um Maras Kehle gegangen, ich wäre schnurstracks auf den Typen los. Es gab einen Moment, wo er unkonzentriert war. Da hätte ich ihm die Schulter ausrenken und den Ellbogen zermatschen können. Aber ich habe gezögert.
Sept: Hättest dus gemacht, hätten die anderen Kerle sich uns vorgenommen.
Mosma: Nein. Weil er dann nämlich seine Klinge an seiner eigenen Kehle gehabt hätte.
In der Stille, die folgte, lockerte Hadouch langsam seinen Griff und zog seine Hand von meinem Mund zurück. Wovon war da die Rede, gütiger Gott? Konnte mir jemand erklären, wovon diese Kinder da redeten? Anscheinend war es das, was meine aufgerissenen Augen im Halbdunkel ausgedrückt hatten, denn Verdun gab mir mit einem Zeichen zu verstehen, dass ich später eine Erklärung bekäme.
Mosma: Die Person, die uns verraten hat, die kennt uns bestens, sag ich dir. Sie wussten nicht nur, dass wir Lapietà entführt hatten, sie wussten auch, wer wir sind, wer Mara ist! Sie wussten, dass sie mit Tuc zusammen ist. Sie wollten uns schlicht Lapietà und seinen Sohn wegschnappen. Geiseln. Lösegeld. Und uns drei, da störende Zeugen, beim geringsten Problem beseitigen. Wozu es im Übrigen auf dieser scheiß Treppe auch um ein Haar gekommen wäre. Viel gefehlt hat nicht.
Sept: Drei, vier Sekunden, würde ich sagen.
Stille.
Sept: Also, wer hat uns deiner Meinung nach an diese Mistkäfer verraten?
Mosma: Wenn ich das wüsste … Jedenfalls jemand aus unserem engen Umfeld.
Das war der Moment, in dem die Stimme von Mara erklang, die über ihnen im Stockbett lag. Sie verkündete klipp und klar:
»Ich weiß, wer.«
Mosma: Schnauze da oben.
Ehe Mara protestieren konnte, ging ihr Curriculum vitae auf sie nieder wie eine Lawine. Wer hatte sie in dieses Schlamassel, diese Entführung von Lapietà, reingeritten? Mara. Wer war Tuc in dieses Performanceprojekt gefolgt? Mara. Wer hat sie von klein auf mit einer endlosen Kette von Dummheiten genervt? Mara! Eine bekotzte Serie aus unberechenbar vielen Folgen. Und immer das gleiche Szenario: Mara stürzt sich in ein wahnwitziges Abenteuer. Die berühmte Mara’sche Spontaneität! Maras Ungestüm! Maras Überzeugung! Maras unvergleichliche Energie! Mara und ihre Installationen! Mara und ihre Performances! Mara und ihre verheerenden Lieben! Tuc, die jüngste Leidenschaft! Die Entführung von Lapietà, der jüngste Einfall! Und jedes Mal folgt ihr dieser hirnamputierte Sept, um sie vor einer unvermeidlichen Katastrophe zu bewahren. Nach vollbrachter Tragödie dann beseitigt dieser andere Hirnamputierte, Mosma, die Spuren, um Benjamin nicht mit den Folgen zu behelligen.
An dieser Stelle warf Mara mit vollkommen gelassener Stimme ein, dass Mosma im Übrigen ihrer bescheidenen Meinung nach die Tendenz habe, »mich überzubehüten«. (Ihr Begriff.)
Mosma: Ach ja? Findest du, er hat nicht genug um die Ohren mit dem, was er ganz von allein abbekommt, mein alter Vater? Eure Eltern haben ihm seine gesamte Jugend hindurch den letzten Nerv geraubt, und wir sollen da noch draufsatteln? Im Namen wovon? Der Malaussène-Tradition? Soll er denn nie Ruhe kriegen? Müssen wir ihm wirklich erzählen, dass wir uns alle drei um ein Haar hätten abknallen lassen wegen dir? Und dass wir gerade davongekommen waren, als du auf einen Bullen schießen musstest? Einen Bullen, Mara, Gott verdammt, du hast auf einen Bullen geschossen! Den du zweimal getroffen hast! Zwei Kugeln aus einer Shœltzer 72 im Fleisch eines Bullen! Maracuja Malaussène! Und das soll ich Benjamin erzählen? Dass seine Nichte Bullen umlegt!
Das war kein Flüstern mehr, aber auch noch kein Brüllen. Am ehesten leicht angespannte brüderliche Autorität. Der Ton, schien mir, in dem ich mit Thérèse gesprochen habe, als sie in diesem Alter war.
Es folgte eine tiefe Stille. Die C’Est Un Ange auf seine begütigende Art beendete:
»Was Mosma dir zu sagen versucht, Mara, ist nur, dass er es satthat, dich ständig irgendwo rauszuhauen. Er hätte gern, dass du ein bisschen erwachsener wirst. Dass du ab und an mal die Fliege machst.«
»Und hör auf, wegen Tuc auszuflippen«, schloss Mosma. »Solange das Lösegeld nicht bezahlt ist, kann deinem Kerl nichts passieren.«
3
Pépère ist ohne das leiseste Türenschlagen von dem einen in den anderen Wagen umgestiegen, hat sich neben den Fahrer gesetzt, ihm gesagt, wie er fahren soll, und sich in Schweigen gehüllt. Warum dieses Schweigen? Fragen dieser Art stellt man ihm nicht. Wenn er redet, dann redet er. Wenn er schweigt, dann schweigt er. Der Stromer ist mit einem Atmer gestartet. Nichts zu hören, außer Reifen auf Asphalt. Der Stromer gleitet über die vor Sonnenlicht spiegelnde Straße.
Nach einer Weile sagt der Fahrer:
»Schönes Wetter, was, Pépère?«
»Jobst du beim Wetterdienst?«
Das kam hervorgeschossen wie eine Schlangenzunge.
Danach wieder Schweigen.
Draußen ist es in der Tat schön, aber so, als sollte es nie mehr regnen. Sie sind zwei unter einem Gluthimmel dahingleitende Stockfische. Der Ältere denkt über den Jungen nach, den er am Steuer des anderen Wagens zurückgelassen hat. Was, wenn er umgedreht worden wäre? Der Verdacht springt ihn an wie eine Tarantel. Kébir umgedreht? Pépère wird an nichts anderes mehr denken können, das weiß er. Komm, mach halblang, erst mal rekapitulieren. Pascou lässt die Shœltzer mit seinen Fingerabdrücken in den Treppenschacht fallen, und Kébir sammelt sie nicht ein. Das soll nicht absichtlich gewesen sein? Nicht vorsätzlich? Dazu drei Zeugen, die er am Leben lässt! Und das bei meiner Ausbildung! Da soll keine Gelegenheit ergriffen worden sein, den Flics Indizien und Zeugen auf dem Tablett zu servieren? Und überhaupt, was hatten die Bullen da zu suchen? Wer hat sie vorab informiert? Waren das wirklich Bullen? Und wenn nicht, wer dann?
Zum Fahrer sagt Pépère:
»Die Erde trocknet gerade ein wie eine Feige in der Sahara, und du nennst das schönes Wetter?«
Diese Art von Lügen hört man jeden Morgen im Radio, dass angeblich schönes Wetter herrscht, und Hinz und Kunz wiederholt das zwanzigmal am Tag. Eine verdammte Herde, die vom schönen Wetter redet und demnächst verdurstet.
»Denk ein bisschen nach, verflucht.«
Also noch einmal: Letztes Jahr tauscht Kébir seine Shœltzer gegen Pascous Stein ein. Pascou war immer verrückt nach einer Shœltzer. Ab dem Moment, wo er die von Kébir hat, ballert er auf jedes Ziel. Beharkt im Wald die Bäume. Beschneidet Äste. Eine Kugelorgie. Und als Krönung setzt er die Shœltzer im Casino von Beauregard ein. Für nichts und wieder nichts, just for fun, wie sie sagen. Ergebnis: zwei Verletzte. Und Pascou entsorgt die Shœltzer nicht! Eine Waffe, die ein einziger Fingerabdruck ist! Die er in den Treppenschacht fallen lässt, als er getroffen wird, und die Kébir nicht einsammelt. Anders gesagt: die er den Bullen rüberschiebt.
Was zu beweisen war.
Zum Fahrer sagt Pépère:
»Denk ein bisschen nach, ehe du nachplapperst.«
Schönes Wetter, schönes Wetter … Wie die Tusse da mit ihrem »Paris Plages« … Das ganze Jahr in der Sonne liegen. Angeblich zur Verbesserung der hauptstädtischen Luft. Strände am Seine-Ufer … Wer für diesen Markt der lässig Hingestreckten wohl den Zuschlag erhalten hat? Das wüsste ich zu gern …
»Plappere nichts nach, was in den Nachrichten kommt. Das hab ich dir schon hundertmal gesagt.«
Umgedreht, der kleine Kébir. Kein Zweifel. Ein Wendehals. Seit wann? Von wem? Gegen wen? Pépère kann auf den nächsten zwanzig Kilometern an nichts anderes denken. Die Chinesen? Nein, Kébir hätte sich nie an einen Chinesen rangetraut. Nicht einmal mit bewaffnetem Auge. Außerdem, warum sollten sie? Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen. Die Terrains sind klar abgesteckt. Und dieser Vollidiot hinter seinem Steuer: Schönes Wetter, Pépère!
»Denk ein bisschen nach, Scheiße!«
Schweigen.
Der Fahrer würde gern das Radio einschalten, aber das mag Pépère nicht.
»Reiner Lärm, eure debile Musik.«
In dem E-Auto denkt Pépère, Blick geradeaus, seinen kleinen Ranzen auf den Knien, über die Lüge nach … Nicht nur in Bezug auf seine Kids. Über die Lüge allgemein. Die private und die gesellschaftliche Lüge. Die Lüge als Kommunikationsmittel, Regierungsmodus, Strategie, Führungsstärke. Unglaublich, was man den Wählern alles verkaufen kann, den Bürgern, den Kunden, den Arbeitnehmern, den Anwohnern … Die Bürgermeisterin mit ihren Stränden. Stark sind sie, kann man nicht anders sagen. Aber wir, wir können uns anpassen, mit unseren bescheidenen Mitteln … Was ihn angeht, ihn, Pépère, er lügt nie. Er hat seinen Jungs nie ein X für ein U vorgemacht. Er hat sie zu Wahrheit pur erzogen. Die Welt, wie sie ist. Ohne Zierrat. Man lügt nicht. Oder wenn, dann gegenüber der Polizei, was der Wahrheit dient. Sonst stirbt man.
»Hast du das GPS ausgeschaltet?«
Vor dem Losfahren, ja, anwortet der Fahrer, ausgebaut. Kein GPS mehr im Auto. Er ist ohne gekommen.
»Bist du nach Karte gefahren?«
Ja.
»Eine Höllenarbeit, heutzutage eine Straßenkarte aufzutreiben.«
Ja.
»Bieg an der nächsten Kreuzung rechts ab.«
Abbiegen.
Und wenn ich mich irre? Wenn Kébir sauber ist? Nein, man spürt es, wenn einer lügt. In der Hinsicht hat mich nie wer einseifen können. Wieso hätte er heute eine solche Angst vor mir haben sollen, wenn er mir nicht etwas vorgemacht hat? Heute sehr viel mehr als sonst. Stimmt schon, dass er immer ein bisschen Bammel vor mir hat, aber vorhin, das war echtes Muffensausen, wahrnehmbar wie ein Geruch. Nein, er muss umgedreht worden sein. Die ganze Zeit auf dem Treppenabsatz oben, und erledigt die drei Zeugen unten nicht – schlicht ein Ding der Unmöglichkeit, so wie ich ihn ausgebildet habe.
Den Fahrer fragt Pépère:
»Und dein Handy?«
Ausgeschaltet.
»Ausgeschaltet-ausgeschaltet oder nur ausgemacht?«
Richtig ausgeschaltet, Akku raus und alles.
»Seit wann besitzt du es?«
Vorgestern geklaut.
Wo?
Im Bahnhof Saint-Lazare. Geklaut, SIM-Karte rausgenommen, Netz gewechselt.
Oha, gut gemacht! Da lässt sich nicht meckern in Sachen Umsicht.
»Gut gemacht, mein Kleiner.«
Es wird weiter gefahren.
Und weiter geschwiegen.
Dann spricht Pépère den Fahrer mit Vornamen an.
»Frédéric?«
»Ja, Pépère?«
»Wie alt warst du, als ich dir den ersten Unterricht gegeben habe?«
»Zwölfeinhalb.«
»Und was habe ich dir gesagt? Als Erstes?«
»Man krückt nicht.«
Die erste Stunde, in der Tat zum Thema Lüge. Vor rund zehn Jahren. Boulevard de Courcelles. Frédérics Hand durch einen Zangengriff Pépères in dessen Manteltasche festgesetzt. Was hat deine Hand in meiner Manteltasche verloren, mein Junge? Ich bestehle Sie, Monsieur. Und was stiehlst du? Ihr Handy, Monsieur. Wie sie da so Seite an Seite gingen, Loden, Kaschmir und Cordsamt, hätte man schwören können, ein Großvater und sein Enkel auf Sonntagsspaziergang. Besitzt du keines? Doch, Monsieur. Wozu dann meines klauen? Aus Lust. Lust auf mein Handy? Nein, Monsieur, ich hatte Lust zu klauen. Das ist gut, mein Kleiner, hatte Pépère dazu gesagt, ohne die Hand des Bürschchens loszulassen, du klaust zwar schlecht, aber wenigstens krückst du nicht.
Frédéric, Dieb ohne Not, rekrutiert in einem der schicken Viertel. Pépère hatte sich auf diesem Wege einige geangelt. Die Berufenen. Der vornehme Teil seiner Truppen. In Lacoste-Klamotten und mit einer Nummer der Valeurs actuelles unter dem Arm erregen sie bei Fahndungen keinen Verdacht. Von mir aus sollen sie die Eliteunis für Racker öffnen, aber unter der Voraussetzung, dass entsprechend parfümierte Ärsche in die Gangs integriert werden. Sozialpolitik à la Pépère. Es muss durchmischt werden, so seine Überzeugung.
Frédéric blickt frei heraus hinüber zu Pépère. Die Erinnerung an dieses erste Mal lässt ihn lächeln.
»Ich erinnere mich, weil ich damals nicht wusste, was ›krücken‹ bedeutet.«
Ah, die Frage des Sprachgebrauchs. Der jeweilige Jargon dieser Jugendlichen. Ihr Vokabular musste durchmischt werden. Die Schickeria hatte sich die Vorstadt anzueignen, und umgekehrt. Damit sie sich nicht wegen Wortschatzfragen die Fresse polieren.
Pépère verspürt das Bedürfnis, auf den Anfang ihres Gesprächs zurückzukommen.
»Fred, plappere nichts nach. Das ist wichtig, sag ich dir.«
Frédéric nickt.
Der Stromer gleitet lautlos über den schmelzenden Asphaltteppich.
»Wenn du morgens etwas im Radio hörst (er hat immer Wert darauf gelegt, dass sie informiert sind, Zeitungen, Radio, dass sie nicht nur auf kursierende Gerüchte abonniert sind), und wenn es nur das Wetterfroschgequake ist, dann behalte es für dich. Genauso, wenn du auf deinem Display Fake News liest. Nicht nachplappern. Erst verdauen. Gleiche mit deinen Kumpels die Info ab, fragt mich, falls nötig, danach kannst du dann darüber reden. Aber nur, wenn es sich lohnt. Denn, mal ehrlich, Frédéric, gibts irgendeinen gewichtigen Grund zu sagen, das Wetter sei schön, wenn der Himmel blau ist?«
Nein. Genau betrachtet fällt Frédéric keiner ein.
Es bleiben noch ein paar Kilometer. Zeit genug, um die Unterrichtsstunde abzuschließen.
»Weißt du, warum man nichts nachplappern soll?«
»Um nicht unterbelichtet zu wirken?«
»Im Gegenteil, manchmal ist es nützlich, als beschränkt zu gelten. Das entwaffnet. Das ist ein Unschuldszeichen. Finde was Besseres, mein Kleiner. Warum die Klappe halten?«
Jetzt ging es durch flaches Land. Pépère wartet auf die richtige Antwort. Aber Frédéric fällt keine ein.
»Weil quasseln, um nichts zu sagen, mein Kleiner, ein Denunziantenreflex ist.«
Ein Denunziant, erklärt Pépère, ist in erster Linie ein Quassler, der egal bei welchem Thema vorgreifen will: Er legt los, quasselt und quasselt, und am Ende quatscht er. Man braucht ihn nur aufs Glatteis zu locken … Am Ende sagt er zwangsläufig, was nicht gesagt werden darf. Der schlimmste Denunziant, und die häufigste Spielart ist der unfreiwillige Quatscher.
»Das habe ich euch oft erklärt. Oft.«
Sie haben sogar Übungen dazu gemacht. Pépère stellte Fragen. Antworteten sie mehr als das strikt Notwendige, kriegten sie eins auf die Nuss. Zum Beispiel Taschengeldabzug. Frédéric hatte einige Zwanziger lassen müssen.
»So. Lass mich da drüben raus.«
Ein schnurgerader Strich zwischen gepflügtem Ackerland. Am jeweils äußersten Ende der Horizont. Pépère sagt:
»Ich bin am Ziel.«
Trotzdem steigt er nicht aus.
»Ich möchte dich um etwas bitten, mein Kleiner.«
»Geht es um Kébir?«
»Stell keine Fragen. Was habe ich dir gerade gesagt? Presch nicht vor, hörst du. Zu viel quasseln und vorpreschen ist ein und dasselbe. Du machst dich angreifbar. Warum sollte es um Kébir gehen? Weil ihr gespürt habt, dass ich ihn nach dieser Treppengeschichte auf dem Kieker habe? Was geht das euch an, hm?«
Kurze Pause.
»Nein, es geht nicht um Kébir.«
Erneute Pause.
»Es geht um den Kerl mit dem Kombi.«
»Der, der den Typen mit den zwei Wummen gedeckt hat?«
»Um den, ja.«
»Hat ganz allein schon mächtig Schaden angerichtet.«
Verdammt, dachte Pépère, ich werde ihn nie dazu bringen, den Mund zu halten. Er muss alles kommentieren, er kann einfach nicht anders. Er muss sich einfach in Szene setzen. Unglaublich dieses Bedürfnis der Oberschichtkids, geliebt zu werden, ein echtes Gift. Aber ja, mein Junge, Pépère hat dich lieb, wirklich. Und jetzt hör mal gut zu. Hör auf, ständig an mir hochzuspringen wie ein junger Hund. Du bekommst dein Zuckerchen.
Pépère legt seine Hand auf den Kopf des Jungen.
»Ich will, dass du ihn auftreibst, den Kerl mit dem Kombi, und ihn mir bringst.«
»Ist so gut wie erledigt, Pépère.«
Himmel, nein, solange es nicht erledigt ist, kann es nicht so gut wie erledigt sein!
»Weißt du wenigstens, wo er wohnt?«
Frédéric spürt das kalte Gewicht des Siegelrings auf seinem Nacken. Und in Pépères Stimme einen gewissen Überdruss, als der ihm verkündet:
»Ich habe seine Autonummer. Morgen bekommst du von mir seinen Namen und seine Adresse.«
Pépère kneift dem Jungen ins Ohr.
»Komm schon, ich zähle auf dich, mein Kleiner.«
Er zieht sanft am Ohrläppchen.
»Ihr werdet zu dritt sein. Du wirst der Chef sein. Und machst es perfekt.«
Dann steigt er aus.
Die Sonne geht gleißend auf ihn nieder.
Der dritte Wagen taucht erst auf, nachdem der Stromer verschwunden ist.
4
Meine Nacht ging in der Küche zu Ende, vor einem Kaffee, den zu trinken Bestürzung und nachträgliche Angst mich abhielten. Fast hätte man mir meine drei Jüngsten ermordet. Die Nachricht ließ mich so stark zittern, dass ich mich am Tisch festhielt.
Ich hätte lieber die klassische Elternwut auf jenes Kind empfunden, das, um Haaresbreite von einem Auto erfasst, mit dem Leben davonkommt, das, von der Meeresströmung fortgerissen, durch ein Wunder wieder an Land gespült wird, das Kind, das von einem Felsen stürzt und, der weisen Vorsehung sei Dank, im Blattwerk eines Baumes hängen bleibt. Wir hatten dir doch gesagt, dich nicht über den Rand hinauszulehnen, dich nicht vom Ufer zu entfernen, vor dem Überqueren nach links und rechts zu gucken. Wie oft müssen wir dir das noch sagen? Bist du dir im Klaren, was du angestellt hast? Das war doch Absicht, du bist unmöglich! Siehst du, in welcher Verfassung deine Mutter ist? Wirklich, ich weiß nicht, was mich davon abhält, dir … dich … Ja, wovon eigentlich? Den Erretteten aus dem Fenster zu werfen und so ein für alle Mal Schluss zu machen mit den Urängsten? Davon steckt etwas in der tobsüchtigen Erleichterung der Familien – eine tröstende Kindsmordlust, die leider nicht zu meinem Repertoire gehört. Sobald ein Mitglied meines Stammes am Tod vorbeigeschrammt ist, spult sich vor meinem Auge die ganze Serie ab: Jérémy, zerfetzt von seiner selbst gebastelten Bombe (Paradies der Ungeheuer), Julie, mit zerschmetterten Knochen in einem Flusskahn (Wenn alte Damen schießen), Clara, Opfer eines Gemetzels in Saint-Hivers Bett, während Verdun an Thians Brust von gegnerischen Kugeln durchbohrt wird (Sündenbock im Bücherdschungel), Thérèse, in ihrem Wahrsagerinnenwohnwagen bei lebendigem Leibe verbrannt (Adel vernichtet) … Und das ist längst nicht alles … Louna, beinahe erwürgt von diesem Neurologenlover, den Le Petit auf den Namen Planche à Voile getauft hatte (Vorübergehend unsterblich), Julie, die in Monsieur Malaussène unser Kind verliert und, im selben Krankenhaus, am selben Tag, Gervaise ihr Leben. Auf zweitausend und etlichen Seiten haben sie mir alles angetan. Und jetzt die Letztgeborenen – drei auf einen Streich diesmal! – von Kugeln zu Hackfleisch zerbreit in einem Treppenschacht. Das ist das Bild, ja: Mara, Sept und Mosma tot, wie sie daliegen in schwarzem Blut, die Hände auf dem Rücken gefesselt, eine Mülltüte über dem Kopf, am Ende eines Treppenschachts, der nach städtischer Pisse und kaltem Joint riecht. Nichts weiter als ein Haufen Abfall, den Kugeln durchsieben. Es gelang mir nicht, sie mir nicht tot vorzustellen, ich konnte machen, was ich wollte. Ganz zu schweigen von dem Entsetzen, das sie empfunden haben müssen, die Angst, die Einsamkeit, die grauenvolle Verblüffung, die mit dieser Art von Sterben einhergeht … Es gelang mir nicht, die Kleinwinzigkeit der Chance zu ermessen, die sie mir lebend zurückgegeben hatte, plappernd als wäre nichts gewesen drüben im Schlafsaal, wo die Älteren großgeworden waren, ich glaubte noch immer nicht daran.
Daher die Reglosigkeit des Kaffees in meiner Tasse.
Und ich ganz unten.
Mit mir am Tisch Verdun, Hadouch, Titus (und Julie, die sich zu uns gesellt hatte), offenbar ohne Eile darauf wartend, dass ich den Kopf wieder über Wasser bekam. Sicherlich fürchteten sie einen Anschiss. Denn, wirklich … Seit wann wussten sie davon? Und was genau wussten sie? Wussten sie, dass es unsere Kinder waren, die Lapietà gekidnappt hatten? Hatte Mara es Titus vorher gesteckt? »Petter, wir bereiten gerade eine Installation vor, du wirst Augen machen!« Und die Schießerei unter der Esplanade von La Défense, die ihnen allen dreien beinahe den Garaus gemacht hätte, ein Auftrag von Verdun? Hatte sich Titus daran beteiligt? Zusammen mit wem? Silistri? Hadouch? Mo und Simon? Die heilige Allianz von Bullen und Banditen? Wer war noch über all dies auf dem Laufenden? Der Rest meines Stammes? War ich der einzige Dödel? Wie lange wollten sie mich in Unwissenheit halten? Bis ans Ende meiner Tage? Was verheimlichten sie mir noch? Führten wir dermaßen voneinander abgeschottete Leben? Der Stamm in der Wirklichkeit und ich eingelegt in Formalin? Lauter Fragen, in die eine mich jetzt nach oben katapultierende Wut einströmte.
Kaum hatte ich den Kopf über Wasser, stellte Julie ein Aufnahmegerät auf den Tisch.
»Hör dir das an, Benjamin, etwas sagen kannst du später.«
Julie drückte die Starttaste.
Ich vernahm eine Stimme:
Und Sie, Monsieur, was denken Sie über den Fall Lapietà?
Natürlich erkannte ich die antwortende Stimme. Es war meine.
Ich denke an die Familien.
Meine eigene Stimme. Die diesem verdammten Journalisten in dem TGV, der mich aus dem Vercors zurückbrachte, Antwort gab. Er hatte den Abbé Courson de Loir zur Lapietà-Entführung interviewt und die Gelegenheit genutzt, dessen Sitznachbarn zu löchern. Er fragte:
An die Familien? An die Familie Lapietà? An die Familien von Geiseln allgemein?
Und ich hörte mich antworten:
Eher an die der Entführer. Im Moment wissen sie bestimmt noch nicht, was diese jungen Menschen da getan haben, aber es wird bitter für die Familien, wenn ihre Kinder erst einmal verhaftet sind.
Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich, während ich redete, dachte: Schnauze, du armer Depp!
Was veranlasst Sie zu der Annahme, es handele sich um junge Menschen?
Aber statt meine Schnauze zu halten, schwadronierte ich:
Der Inhalt des Manifests. Kennen Sie einen einzigen Erwachsenen, insbesondere unter den Politikern, der heute imstande wäre, ein solch ausgeprägtes soziales Gewissen an den Tag zu legen?
Ich armer Tropf.
Nachdem Julie ihr Gerät wieder verstaut hatte, ging über dem Tisch eine dichte Stille nieder.
»Deshalb haben wir dir nichts gesagt, mein Lieber.«
Hadouch stellte einen frischen Kaffee vor mich hin.
»Den trink aber, bevor er kalt wird.«
Die restliche Nacht widmeten wir der Analyse dessen, worüber die Kinder im Schlafsaal geredet hatten. Verdun und Titus hatten sie bereits befragt, aber gehofft, die nächtliche Flüsterei würde ihnen weiteren Aufschluss über die Bande von Vermummten geben, die unseren Gören Lapietà und seinen Sohn weggeschnappt hatte. Aber Fehlanzeige. Nicht ein Name, den diese Kerle in Sturmhaube und Einsatzkommandokluft, BRB-Binde am Arm, fallen gelassen hatten. Sie waren gut bewaffnet, wenn man von der Shœltzer 72, die treppenabwärts gehüpft war, ausging und von der Kalaschnikow, die Silistri umgemäht hatte. Gewalttäter, die vor dem Gebrauch ihres Arsenals nicht zurückschreckten.
Ich verschluckte mich am Kaffee:
»Silistri ist tot?«
Hadouch klopfte mir auf den Rücken.
»Noch nicht, er wird versorgt.«
»Von wem?«
»Von Postel-Wagner. Und Sébastien, dem Pfleger.«
»Ist es schlimm?«
»Nicht gerade eine Schramme«, räumte Titus ein.
»Zurück zu unseren Gören«, schlug Verdun vor.
Und nahtlos:
»Mara ist schwanger.«
Ich:
»Schwanger? Aber wir haben doch gerade erst ihren siebzehnten Geburtstag gefeiert!«
Hadouch nickte.
»Nicht mehr ganz jung, stimmt. Wie alt war deine Mutter, Ben, als du auf die Welt gekommen bist?«
»Schwanger von wem?«
»Was meinst du?«, fragte Verdun. »Von Lapietàs Sohn natürlich.«
»Von Tuc? Und wie kommst du darauf, dass sie schwanger ist?«
»Sie strahlt etwas aus, als wäre sie nicht allein in ihrem Haus. Außerdem hat sie leicht erhöhte Temperatur, ohne sich fiebrig anzufühlen.«
»Und wirkt leicht beschwipst, ohne getrunken zu haben«, ergänzte Julie.
»Weiß sie es?«
»Dass sie schwanger ist? Eher unwahrscheinlich, dafür ist es zu früh. Vielleicht ahnt sie etwas.«
Ich bohrte meinen Blick lange in Verduns Augen. Der Blick, der mir antwortete, war der des Babys Verdun, dieses zornfunkelnden Wurms an der Brust des alten Thian. Verdun war wütend. Sie kam auf das Thema zurück, das sie und die anderen vorrangig beschäftigte, und fragte:
»Was meint ihr, wer die Kinder verraten hat? Wer hat Lapietà an diese Bande verkauft?«
»Drei Spuren«, antwortete Titus. »Der Fahrer des Lasters, den diese Vollidioten bei der Firma Bernhard gemietet haben, um den Clio von Lapietà zu verladen, oder der Kumpel von Lapietàs Sohn aus der Rue de Charenton, wo sie den Clio nach der Entführung versteckt haben, oder aber Alice, die OMNI-Spielerin, auf deren Namen sie ihn gemietet hatten. Ich geh dem nach. Ich habe Lieutenant Valmondois nach Colmar geschickt, den Trucker befragen, und Lieutenant Brochard kümmert sich um den Kumpel von Tuc. Auf die ist Verlass, die können in die Mangel nehmen, die beiden. Um Alice kümmere ich mich. Aber es gibt Wichtigeres.«
»Die Shœltzer?«, fragte Hadouch.
»Ja. Ich habe sie einem Kollegen von der Ballistik gegeben, der die Sache etwas vorgezogen hat. Die Knarre ist schon früher verwendet worden. Im Casino von Beauregard. Eine Kugel in der Hand eines Croupiers, der die Hände allzu saumselig gehoben hat, eine andere hat einem Sicherheitsmann, der meinte, den Alarmknopf bedienen zu können, die Nase kupiert.«
»Ist eine Präzisionswaffe, die Shœltzer«, bestätigte Hadouch.
»Sie werden den Prügel holen kommen«, versetzte Titus. »Sie denken bestimmt, dass unsere Gören ihn behalten haben, und wollen ihn zweifellos einsammeln, bevor er in Polizeihände gerät.«
»Und da sie nicht wissen, ob ihr echte oder auch Pseudo-Flics wart«, ergänzte Verdun, »werden sie hier zwecks Überprüfung auf der Matte stehen.«
Woraufhin sie zu anderem übergingen, als sei häuslicher Besuch von Killern, die beinahe unseren Nachwuchs eliminiert hätten, dasselbe wie ein kleiner Apéro in gehobenen Kreisen.
Verdun fragte Titus nach seinem Programm für den Tag. Er musste seinen Rapport zum Fall Lapietà bei Divisionnaire Menotier abliefern, seinem direkten Vorgesetzten, auf den der Chef der aktiven Dienste Legendre einen presslufthammerharten Druck ausübte, möglicherweise infolge ministerieller Ungeduld.
»Ich werde auch erwartet«, sagte Verdun. »Einbestellt beim Generalstaatsanwalt.«
»Bei Souzier?«
»Ja. Am Samstag wurde bei der Morgenkontrolle ein Untersuchungshäftling von mir tot aufgefunden. Erhängt an einem Kompressionsstrumpf. Ich habe den Staatsanwalt gebeten, sich für eine Beschleunigung der Administrativuntersuchung einzusetzen. Ich plane, in der Zelle vorbeizuschauen und die Mithäftlinge zu befragen.«
Hier wandte sie sich Titus zu.
»Ich würde dich gern um eine Haussuchung bitten, falls du einen Moment hättest. Ginge das?«
»Wie heißt er, dein Erhängter?«
»Balestro. Jacques Balestro.«
»Geht klar. Ich sehe mich nach der Menotier-Session mal bei ihm um. Wo hat er gewohnt, der Balestro?«
»In einem dieser Front-de-Seine-Hochhäuser. Dem, das aussieht wie übereinandergestapelte Aquarien.«
»Ah, ich weiß, welches du meinst. Das Paradies der Qataris. Wonach suchst du? Nach Kompressionsstrümpfen?«
»Unter anderem. Ich möchte vor allem wissen, auf welchem Fuß Balestro gelebt hat. Ginge das? Ich stelle dir den Befehl aus. In der Zwischenzeit betrachte ich mir seinen Leichnam im Leichenschauhaus.«
Da das Gespräch eine etwas technische Wendung nahm, bekam ich schwere Lider. Der unterbrochene Schlaf forderte sein Recht. Ich war gerade am Wegdösen, als eine dunkle Erinnerung mich noch einmal kurz ein Auge auftun ließ:
»Entschuldigt, aber vorhin im Schlafsaal, hat Mosma da nicht gesagt, Mara hätte einen Bullen umgelegt?«
»Nicht weiter schlimm, ein Bulle«, beruhigte mich Hadouch.
»Und außerdem ein ganz kleiner«, erläuterte der Capitaine Adrien Titus.
5
Besagter kleiner Bulle biss, während Nadège seinen Verband wechselte, die Zähne zusammen. Tatsache ist, dass wenige Zentimeter fehlten, und die zwei Schüsse hätten Nadège zur Witwe gemacht. Und die schlimmste aller Rächerinnen ist eine Verlobte, die Witwe wird. Die Verlobte des Polizeiinspektors auf Probe Manin versprach im Flüsterton:
»Verdammt, die Schlampe, ich schwör dir, wenn ich die erwische …«
Warum hatte Manin ihr sagen müssen, dass es sich um eine Frau handelte? Es war ihm im Eifer des Wiedersehens herausgerutscht.
Nachdem der Riese Talvern ihn zusammengenäht und Clara und Gervaise ihn verbunden hatten, hatte sein Chef, der Capitaine Adrien Titus, den Polizeiinspektor auf Probe Manin nach Hause gebracht, in die Nummer 62 der Rue Julien-Lacroix, in seine Wohnung, in die Wohnung von Nadège, in die … Ja, in wessen Wohnung eigentlich? Das war ein ständiger Streit zwischen den beiden. Begonnen hatten sie als WG, der Polizeilehrling und die junge Krankenpflegerin. Um in ihrem Alter in Paris eine Wohnung zu mieten, reichten kaum zwei Einkommen. Selbst im 20. Arrondissement. Also Wohngemeinschaft, ohne irgendwelche Hintergedanken. Aber dann teilten sie – Not kennt kein Gebot – das Bett. Um mehr Luft zu haben. Mit einem Doppelbett gewannen sie ein Zimmer, und außerdem war es im Bett nicht schlecht. Nicht schlecht wie jene Weine, von denen die Kenner, wenn sie sie im Restaurant probieren, nie sagen, dass sie »gut« seien, sondern stets »nicht schlecht«. »Nicht schlecht, der Tropfen, ja, lässt sich trinken.« Man hatte einander probiert und in vollen Zügen genossen. Aber wir bleiben WG-Partner, klaro? Definitiv, jeder bleibt frei, das verstand sich von selbst.
Kurz, Manin war gegen vier Uhr morgens in sein Nest zurückgekehrt, nicht sicher angesichts der Dezibel ihrer letzten Trennung, ob Nadège zu Hause wäre. Und selbst wenn, da bei ihm auch bei ihr war, hätte sie ihm durchaus die Tür vor der Nase zuschlagen können. Aber als sie ihn im Türrahmen erblickte, eine Leiche auf zwei Beinen, schrie sie seinen Namen. Sie umarmte ihn so fest, dass er ohnmächtig wurde.
Bett.
Vorsichtiges Ausziehen seiner Sachen.
Beim Anblick des Verbands fragte Nadège:
»Wer hat dir das angetan?«
Ausweichende Antwort:
»Ist nicht weiter schlimm, war bloß ein bisschen härter als gedacht.«