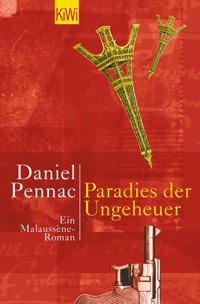9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Benjamin Malaussène Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Vier Morde an alten Frauen innerhalb eines Monats. Außerdem erwischt`s noch einen Polizisten. Belleville ist in Aufruhr. Die Polizei untersucht fieberhaft, denn es geht um Drogenkriminalität, um Korruption und Verbrechen auf höchster Ebene. Eine der vielen verdächtigen Spuren führt zu den Malaussènes, wo einige alte Männer als »Großväter« Familienanschluss gefunden haben. Benjamin Malaussène allerdings, der geborene Sündenbock, wird von der Polizei aufs Korn genommen, und Julie, seine große Liebe, gerät bei ihrer jounalistischen Arbeit in tödliche Gefahr. Bis alles aufgeklärt ist und die Täter überführt sind, hat Benjamins Schwester Thérèse viel Wahres aus dem Kaffeesatz gelesen, wird wieder ein Kind geboren, verliebt sich ein Polizist. Und dann bekommen die Malaussèneschen Kinder von einem der Großväter eine Geschichte erzählt, einen Krimi, originell, spannend, böse, witzig – echter Pennac. Pennacs Malaussène-Romane sind in Frankreich Bestseller, und in Deutschland sind sie längst Kult.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Ähnliche
Daniel Pennac
Wenn alte Damen schießen
Ein Malaussène-Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Daniel Pennac
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Personen
Widmung
Motto
I Die Stadt, eines Nachts
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
II Der Sündenbock
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
III Pastor
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
IV Die Witwe Ho und andere Feen
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
die Mutter aller großen und kleinen Malaussènes, ständig verliebt oder schwanger
Benjaminder ewige Sündenbock; Familienoberhaupt des Stammes und Verlagslektor; unsterblich verliebt in
Julie Corrençonhoch moralische Journalistin in tödlicher Gefahr
ClaraBenjamins Lieblingsschwester, eine begnadete Fotografin und Köchin
Thérèsedie spindeldürre Schwester mit Seherblick
Jérémyder jüngere Bruder mit Herz und nervensägenden Fragen
Lounadie große Schwester
Le Petitder kleine Bruder mit rosa Brille
Verdunfrischgeborener Schreihals
Julius der Hundnicht immer appetitlich riechender Epileptiker
StojilkovićFreund der Familie, Vergil-Übersetzer und Schachspieler; befreundet mit der
Witwe Dolgorukidie mit anderen Witwen aktiven Widerstand gegen die Ewigkeit leistet
Rognon, Risson, Merlan, Verdun, Semellesbei den Malaussènes untergeschlüpfte Wahlgroßväter
Armand le CapelierStaatssekretär für Senioren, Träger eines astreinen Mittelscheitels
die Reine Zaboautoritäre Chefin der Editions du Talion
Ponthard-DelmaireStararchitekt mit Hang zum Zerstörerischen
Edith Ponthard-Delmaireseine unglückliche Tochter
Commissaire divisionnaire Cercairebeinharter Kriminalkommissar und Widersacher von
Commissaire divisionnaire Coudriernapoleonisch angehauchter Kriminalkommissar mit Hang zu starkem Kaffee
VaniniPolizeiinspektor, dem nur ein kurzer Auftritt vergönnt ist
Pastorjunger Polizeiinspektor mit zarter Seele und genialen Verhörfähigkeiten
Van Thianalter Polizeiinspektor und Verkleidungskünstler
Amar und Hadouchberühmt für das Couscous in ihrem Restaurant
und noch viele mehrnämlich Bürger Belvilles, Polizisten, Ärzte, Krankenschwestern, Kinder und Jugendliche, sowie ein Staatsrat und seine Frau …
Inhaltsverzeichnis
Der Sozialversicherung zugedacht.
Für Igor, für André Vers, Nicole
Schneegans, Alain Léger
und Jean-François Carrez-Corral.
Und jedes Wort ein Andenken
an Jean und Germaine.
Inhaltsverzeichnis
»Und keiner rettete irgendwen
durch das Schwert. Mir und
dem Hund brachte es Abwechslung.«
Robert Soulat (L’Avant-Printemps)
»Ach, alt werden!«, sagte mein Vater.
»Aber mir ist nichts Besseres
eingefallen, um nicht jung zu sterben.«
Inhaltsverzeichnis
IDie Stadt, eines Nachts
Die Stadt ist das Lieblingsfutter der Hunde.
1
Es herrschte Winter über Belleville, und auf der Straßenkreuzung befanden sich fünf Personen. Sechs, wenn man die spiegelglatte Eisfläche dazurechnet. Sogar sieben mit dem Hund, der le Petit zum Bäcker begleitet hatte. Ein epileptischer Hund, dem die Zunge seitlich aus dem Maul hing.
Die Eisfläche glich einer Landkarte von Afrika und nahm die ganze Kreuzung ein, die zu überqueren die alte Dame sich unterfangen hatte. Ja, auf der Eisfläche bewegte sich, sehr alt und wacklig, eine Frau. Mit millimetergenauer Vorsicht schob sie Hausschuh vor Hausschuh. Sie trug in der Hand einen Einkaufskorb, aus dem eine aufgeklaubte Stange Porree ragte, um die Schultern ein altes Umschlagtuch und in der Kuhle hinterm Ohr ein Hörgerät. In beharrlichem Kriechgang hatten ihre Filzschuhe sie auf der afrikaförmigen Fläche bis, sagen wir, in die tiefste Sahara gebracht. Sie musste noch den gesamten Süden absolvieren, die Länder mit den Apartheidsregimen und so. Es sei denn, sie würde über Eritrea oder Somalia abkürzen, aber im Rinnstein das Rote Meer war grauslich zugefroren. Diese Überlegungen rumorten unter dem Bürstenschnitt des Blondschopfs im grünen Loden, der die alte Frau vom Trottoir aus beobachtete. Und sich dabei allerlei sehr Hübsches ausmalte. Plötzlich breitete sich das Umschlagtuch der alten Frau aus wie die Segel einer Fledermaus, und alles erstarrte. Sie hatte das Gleichgewicht verloren; sie fing sich wieder. Enttäuscht stieß der Blondschopf einen Fluch durch die Zähne. Er fand es immer amüsant zu sehen, wie jemand hinschlug. Das gehörte zur Unordnung in seinem blonden Schädel. Obwohl: von außen betrachtet picobello, der Schädel. Nicht ein Haar, das in der dichten Bürste über die anderen hinausragte. Aber alte Leute, die mochte er nicht sonderlich. Er hielt sie irgendwie für schmuddelig. Er stellte sie sich sozusagen untendrunter vor. Er stand also da und fragte sich, ob die Alte auf dem afrikanischen Packeis noch hinschlittern würde oder nicht, als er zwei andere Personen auf dem gegenüberliegenden Gehsteig entdeckte, die im Übrigen einen gewissen Bezug zu Afrika hatten: Araber. Zwei. Beziehungsweise Nordafrikaner. Oder Maghrebiner. Der Blondschopf fragte sich immer, wie er diese Leute nennen sollte, damit es nicht rassistisch klang. Bei seinen politischen Ansichten war es überaus wichtig, dass es nicht rassistisch klang, er war nämlich Frontal National und machte daraus keinen Hehl. Und genau deswegen sollte ihm niemand nachsagen können, er sei es, weil er rassistisch war. Nein, nein, es handelte sich hier nicht, wie er es früher einmal im Grammatikunterricht gelernt hatte, um eine kausale Beziehung, sondern um eine konsekutive. Er war Frontal National, sodass er über die Bedrohungen vorurteilsfrei hatte nachdenken müssen, die von einer unkontrollierten Einwanderung ausgingen; und er war zu dem Schluss gelangt, dass klar und nüchtern betrachtet nicht lange gefackelt werden durfte, sondern diese Eselficker alle rauszuschmeißen waren, weil nämlich erstens die Reinheit des französischen Geblüts, zweitens die Arbeitslosigkeit und drittens die Sicherheit. (Wer so viele gute Gründe für eine gesunde politische Meinung hat, der darf sich diese nicht beschmutzen lassen mit dem Vorwurf, Rassist zu sein.)
Kurz, die alte Frau, die afrikaförmige Eisfläche, die beiden Araber auf dem Trottoir vis-à-vis, le Petit mit seinem epileptischen Hund und der seine Überlegungen anstellende Blondschopf … Er hieß Vanini, war Inspektor bei der Polizei, und was ihn am meisten plagte, war das Sicherheitsproblem. Deshalb stand er hier und waren weitere Inspektoren in Zivil über ganz Belleville verstreut. Deshalb baumelten über seiner rechten Hinterbacke verchromte Handschellen. Deshalb trug er im Holster unter der Achsel eine Dienstwaffe. Deshalb auch steckte in seiner Hosentasche ein Schlagring und im Ärmel eine Nervengasdose – eine private Ergänzung des regulären Arsenals. Das war sein Clou: Erst die regulären Waffen gebrauchen, dann in aller Ruhe mit den eigenen losschlagen, das hatte sich bewährt. Denn es gab ja nun wirklich ein manifestes Sicherheitsproblem! Die vier alten Frauen in Belleville, die man innerhalb eines knappen Monats mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden hatte, dürften ja wohl nicht Harakiri begangen haben!
Gewalt …
Ja, verdammt, Gewalt …
Der Blondschopf Vanini streifte die Araber nachdenklich mit einem Blick. Man konnte doch nicht hinnehmen, dass sie unsere alten Weiber wie Hammel ausbluten ließen? Plötzlich ergriffen den Blondschopf echte Rettergefühle; da waren auf dem Trottoir vis-à-vis diese beiden Araber, die wie Unschuldslämmer in ihrem Kauderwelsch palaverten, und auf dem Trottoir hier er, Inspektor Vanini, ganz blond vom Kopfe her und im Herzen dieses köstliche Gefühl, wie es einen durchströmt, wenn man der verzweifelt winkenden Hand in die Seine nachspringt. Die Alte vor den beiden Arabern erreichen. Präventivschlag. Sofort eingeleitet. Schon setzt der junge Inspektor seinen Fuß auf den afrikanischen Kontinent. (Wenn man ihm gesagt hätte, dass er eines Tages eine solche Reise unternehmen würde …) Mit großen sicheren Schritten steuert er der Alten nach. Er schlittert nicht auf dem Eis, er trägt seine stollenbewehrten Knobelbecher, die er seit der vormilitärischen Ausbildung nicht mehr abgelegt hat. Er nähert sich also Hilfe bringend der Alten beziehungsweise der älteren Seniorin, ohne die Araber da drüben aus dem Auge zu lassen. Gütig. Alles an ihm ist jetzt gütig. Denn die zierlichen Schultern der alten Dame erinnern ihn mit einem Mal an die seiner Großmutter, die er, Vanini, so geliebt hat. Leider erst nach ihrem Tod! Ja, die Alten sterben oftmals zu rasch; sie warten nicht, bis wir mit unserer Liebe zu ihnen kommen. Vanini hat es seiner Großmutter sehr übel genommen, dass sie ihm nicht Zeit ließ, sie lebend zu lieben. Aber na ja, jemand Totes zu lieben ist noch allemal besser als gar nicht zu lieben. Zumindest dachte Vanini das, während sich der Abstand zwischen ihm und der unsicher wankenden Alten verringerte. Sogar ihr Einkaufskorb war anrührend. Und ihr Hörgerät … Auch Vaninis Großmutter war in den letzten Jahren ihres Lebens schwerhörig gewesen und hatte dieselbe Geste gemacht wie jetzt die alte Dame, hatte wie diese unablässig die Lautstärke des Apparats durch Drehen an dem kleinen Rädchen ausgesteuert, das sich zwischen dem Ohr und den an dieser Stelle des alten Schädels spärlich wachsenden Haaren befand. Ja, diese vertraute Geste des Zeigefingers, das war ganz Vaninis Großmutter. Der Blondschopf glich jetzt hinschmelzender Liebe. Beinahe hätte er darüber die Araber vergessen. Er bereitete schon vor, was er sagen wollte: »Darf ich Ihnen helfen, Großmutter«, er würde es enkelhaft sanft sagen, beinahe flüstern, um die alte Dame nicht durch ein plötzliches Losdonnern seiner Stimme im Hörgerät zu erschrecken. Noch einen großen Schritt und er, überströmende Liebe, hätte sie eingeholt, da drehte sie sich um. Abrupt. Den ausgestreckten Arm auf ihn gerichtet. Als weise sie mit dem Finger auf ihn. Doch anstelle des Zeigefingers schwang die betagte Dame eine altgediente P 38, ein deutsches Antikstück, das im Verlaufe des Jahrhunderts keinen Rost angesetzt hatte, ein unverändert modernes altes Eisen, ein Traditions-Mordwerkzeug mit hypnotisierender Mündung.
Sie drückte ab.
Sämtliche Gedanken des Blondschopfs zerstäubten. Und ließen am Winterhimmel von Belleville eine hübsche Blume sprießen. Noch ehe das erste Blütenblatt zu Boden fiel, hatte die alte Dame ihre Waffe wieder im Einkaufskorb verstaut und ihren Weg fortgesetzt. Der Rückstoß hatte sie im Übrigen einen guten Meter auf der Eisfläche vorangebracht.
2
Ein Mord also und drei Zeugen. Nur, wenn Araber nichts sehen wollen, dann sehen sie nichts. Eine merkwürdige Angewohnheit. Das muss irgendwie mit ihrer Kultur zusammenhängen. Oder mit unserer, von der sie womöglich etwas allzu genau begriffen haben. Sie haben also nichts gesehen, die Araber. Vielleicht nicht einmal das Peng gehört.
Bleiben der Junge und der Hund. Aber das Einzige, was le Petit durch seine rosagerandete Brille gesehen hat, ist diese Metamorphose eines blonden Kopfes in eine Himmelsblume. Und das hat ihn so beeindruckt, dass er, die Beine unter dem Arm, nach Hause gerannt ist, um es uns zu erzählen, mir, Benjamin Malaussène, sowie meinen Brüdern und Schwestern, den vier Großvätern, meiner Mutter und meinem alten Freund Stojilković, der mir eben beim Schach einheizt.
Die Tür des ehemaligen Haushaltswarenladens, der uns als Wohnung dient, fliegt auf, und le Petit trötet:
»Horcht mal her! Ich hab ’ne Fee gesehen!«
Deshalb hört das Haus noch lange nicht zu schwirren auf. Einzig meine Schwester Clara, die eine Lammschulter à la Montalbán zubereitet, bemerkt mit ihrer samtenen Stimme:
»Ach ja, Kleiner?! Das musst du uns erzählen …«
Julius der Hund geht stracks seinen Fressnapf inspizieren.
»Eine echte Fee, steinalt und richtig lieb!«
Mein Bruder Jérémy lotet sofort aus, ob ihm das neue Perspektiven eröffnet, sich vor seiner Arbeit zu drücken:
»Hat sie dir die Hausaufgaben gemacht?«
»Nein«, antwortet le Petit, »sie hat einen Mann in eine Blume verwandelt!«
Da niemand auch nur mit der Wimper zuckt, kommt le Petit zu Stojilković und mir.
»Es ist wahr, Onkel Stojil, ich habe eine Fee gesehen, und sie hat einen Mann in eine Blume verwandelt.«
»Besser als umgekehrt«, antwortet Stojil, ohne das Schachbrett aus den Augen zu lassen.
»Warum?«
»Weil, wenn die Feen erst einmal Blumen in Männer verwandeln, das flache Land ungenießbar wird.«
Stojils Stimme klingt wie Big Ben in einem nebeligen Film-London. So tief, dass man glauben könnte, um uns herum die Luft vibriere.
»Schach und matt, Benjamin, matt durch Abzugschach. Ich finde, du bist heute Abend ziemlich unkonzentriert …«
Ich bin nicht unkonzentriert, sondern besorgt. Mein Blick ruht nicht wirklich auf dem Schachbrett, mit einem Auge belauere ich die Großväter. Die Dämmerung ist eine üble Zeit für sie. Bei Einbruch der Nacht kriegen sie ihren Gieper auf Drogen. Ihr Hirn verlangt nach dem dreckigen Stoff. Sie brauchen ihren Schuss. Man darf sie unter keinen Umständen aus den Augen lassen. Die Kinder wissen das so gut wie ich, und jedes beschäftigt nach besten Kräften seinen persönlichen Großpapa. Clara befragt Opa Rognon (ehemals Schlächter in Tlemcen) nach immer mehr Einzelheiten zur Lammschulter à la Montalbán. Jérémy, der die sechste Klasse wiederholt, gibt vor, alles über Molière wissen zu wollen, und Großvater Risson, pensionierter Buchhändler, ergeht sich in biografischen Indiskretionen über den Dichter. Maman, die reglos in ihrem Schwangerensessel sitzt, lässt sich zum x-ten Male von Opa Merlan, Ex-Frisör, das Haar richten und wieder anders richten. Und le Petit bekniet Verdun (mit 92 Jahren der Doyen unserer vier Großväter), ihm bei seiner Schreibübung zu helfen.
Jeden Abend wiederholt sich dasselbe Ritual: Verduns Hand zittert wie Espenlaub, doch le Petits Hand, die er umfasst, stabilisiert sie von innen, sodass der Greis fest daran glaubt, er schreibe so gestochen schön wie vor 14-18. Trotzdem ist Verdun traurig, er lässt den Kleinen einen einzigen Namen in sein Heft schreiben: Camille, Camille, Camille, Camille … seitenweise. Es ist der Vorname seiner Tochter, die vor siebenundsechzig Jahren starb, gerade einmal sechsjährig, am Ende des Krieges, niedergemäht vom letzten großen Angriff, dem der Spanischen Grippe. Verdun griff zur Nadel, weil er mit seinen zittrigen Händen nach dem Bild von Camille greifen wollte. Er sah sich aus dem Graben springen, sah sich Haken schlagend den Kugeln ausweichen, Stacheldrähte durchschneiden, Minen umkurven, sah sich seiner Camille ohne Waffe, mit ausgebreiteten Armen entgegenlaufen. So träumte er sich durch den Krieg, aber am Ende fand er eine tote Camille wieder, starr und mit sechs Jahren stärker verschrumpelt als er heute mit zweiundneunzig. Folglich doppelte Dröhnung.
Seit ich ihn bei uns verstecke, drückt er nicht mehr. Wenn die Vergangenheit ihn an der Gurgel packt, betrachtet er nur den Kleinen und murmelt mit verschwimmendem Blick: »Warum biste nur nicht meine kleine Camille?« Manchmal purzelt eine Träne auf das Schreibheft, dann sagt le Petit:
»Hast wieder einen Tintenklecks gemacht, Verdun …«
Das ist so herzergreifend, dass Stojilković, Ex-Seminarist, Ex-Revolutionär, Ex-Besieger der Wlassow-Armee wie der Nazi-Pest, dass Stojil, derzeit Busfahrer für Touristen aus dem Osten und samstags/sonntags für einsame alte Frauen, dass also mein Freund Stojil sich räuspern muss, ehe er knurrt:
»Ich hoffe, Gott hat eine anständige Entschuldigung parat, falls Er existiert.«
Die größte Arbeit jedoch vollbringt in dieser kritischen Abendstunde meine Schwester Thérèse.
Im Augenblick sitzt sie in ihrer Magierinnenecke und möbelt Opa Semelle die Stimmung auf. Der alte Semelle wohnt nicht bei uns. Er war der Schuhmacher unserer Straße, der Rue de la Folie-Régnault, und hat seine eigene Hütte gleich nebenan. Er hing nie an der Nadel. Um ihn kümmern wir uns vorbeugend. Er ist alt, er ist Witwer, er hat keine Kinder, das Rentnerdasein geht ihm an die Nieren: das ideale Opfer für Dealer. Einen Moment nicht aufgepasst, und der alte Semelle ist so zerlöchert wie eine Dartsscheibe. Nach fünfzig Jahren Maloche watete der Rentner Semelle von allen vergessen durch die Keller seiner Depression, aber Jérémy schlug zum Glück Alarm. »Not am Mann!« Und Jérémy schickte dem Meister aller Bürgermeister einen Schrieb, worin er, Semelles Krakelschrift perfekt nachzitternd, um die Ehrenmedaille der Stadt Paris nachsuchte für fünfzig Jahre Arbeit in stets demselben Kabuff. (Ja, für dergleichen kriegt man in Paris einen Orden.) Ein jubelnder Semelle, als der Herr Oberbürgermeister grünes Licht signalisierte! Der Herr Oberbürgermeister erinnerte sich sogar persönlich an den alten Semelle! Semelle hatte im Oberstübchen des Herrn Oberbürgermeisters ein Erinnerungskämmerlein! Semelle war, wie sein Name ja schon besagte, eine der heiligen Schuhsohlen von Paris! O Ruhm, o Glück!
Dennoch hat Semelle heute, am Vorabend des großen Tages, kalte Füße. Er befürchtet, während der Zeremonie einen Schnitzer zu begehen.
»Es wird alles gut laufen«, versichert Thérèse, in deren Hand die des Greises flach ruht.
»Bist du sicher, dass ich keinen Stuss verzapfe?«
»Aber ich sage es Ihnen doch. Habe ich mich jemals geirrt?«
Meine Schwester Thérèse ist ein spröder Knochen. Ihr Körper ist lang und eckig, ihre Haut trocken, und ihre Stimme gibt Bescheid, dass sie immer Bescheid weiß. Der Nullpunkt an Charme und Reiz. Sie ist im Magiegeschäft tätig, auf eine Weise, die ich missbillige, und doch kann ich mich nicht sattsehen, wenn sie ihr Handwerk ausübt. Sobald ein neuer Greis bei uns auf der Matte steht – innerlich ein Wrack, für sich selbst gestorben –, zieht Thérèse ihn in ihre Ecke, ergreift energisch die alte Hand, öffnet einen nach dem anderen die eingerosteten Finger, glättet sie ausgiebig, wie man ein zerknittertes Blatt Papier glatt streicht, und wenn sie spürt, dass die Hand endlich ganz entspannt ist (Hände, die sich jahrelang nicht mehr wirklich geöffnet haben!), fängt sie zu reden an. Sie lächelt nicht, sie schmeichelt nicht, sie spricht den Alten nur von der Zukunft. Und etwas Unglaublicheres als die Zukunft – Zukunft! – konnte ihnen nicht widerfahren. Die versammelten Gestirne von Thérèse helfen bereitwillig mit: Saturn, Apollo, Venus, Jupiter und Merkur organisieren kleine Stelldicheins, fädeln Erfolge in letzter Minute ein, eröffnen Aussichten, kurz, geben den alten Knochen wieder Rückgrat, überzeugen sie, dass bei ihnen Matthäi noch längst nicht am Letzten ist. Thérèse entlässt jedes Mal aus ihren Händen einen jungen Burschen. Dann holt Clara ihren Fotoapparat hervor, um die Verwandlung festzuhalten. Die Porträts dieser Neugeborenen zieren die Wände unserer Wohnung. Ja, meine alterslose Thérèse ist ein Jungbrunnen.
»Eine Frau! Bist du sicher?«, ruft der alte Semelle.
»Jung, brünett und mit blauen Augen«, präzisiert Thérèse.
Semelle dreht sich mit einem 3000-Watt-Lächeln zu uns um.
»Habt ihr gehört? Thérèse sagt, dass ich morgen bei der Ordensverleihung eine junge Frau kennenlerne, die mein Leben umkrempelt!«
»Nicht nur Ihres«, verbessert Thérèse, »sie wird das Leben von uns allen umkrempeln.«
Ich hätte gern der in Thérèses Stimme leise mitschwingenden Sorge nachgelauscht, doch da klingelt das Telefon, und am andern Ende der Leitung höre ich die Stimme von Louna, meiner dritten Schwester.
»Und?«
Seit Maman schwanger ist (zum siebten Mal, und zum siebenten Male ist der Vater unbekannt), meldet sich Louna nicht mehr mit »Hallo?«, sondern mit »Und?«.
»Und?«
Ich werfe einen flüchtigen Blick auf Maman. Heiter und reglos thront sie über ihrem erfüllten Leib.
»Nichts.«
»Worauf wartet denn das Gör bloß, verdammt?«
»Du bist die ausgebildete Krankenschwester, Louna, nicht ich.«
»Aber es sind bald zehn Monate, Ben!«
Es stimmt, das siebente Kleine hält sich nicht an die Regeln, es überschreitet bei Weitem die Spielzeit.
»Vielleicht hat er einen eingebauten Fernseher und sieht die Welt, wie sie ist, und hat es deshalb nicht eilig mitzumischen.«
Herzhaftes Lachen von Louna. Dann fragt sie noch:
»Und die Großväter?«
»Auf dem Tiefstand.«
»Laurent sagt, du kannst notfalls das Valium verdoppeln.«
(Laurent ist der ärztliche Gatte meiner krankenschwestern- den Schwester. Sie rufen jeden Abend durch, um die Stimmungstemperatur zu messen.)
»Louna, ich hab schon Laurent gesagt, dass von jetzt an wir für die Alten das Valium sind.«
»Wie du willst, Ben, du bist der Kapitän.«
Kaum habe ich aufgelegt, da klingelt wie der Postmann (oder die Eisenbahn, ich weiß nicht mehr) der Quasselkasten ein zweites Mal.
»Wollen Sie mich zum Narren halten, Malaussène?«
Uh! Ich erkenne sie gleich, diese tobende Rätsche. Es ist die Reine Zabo, die Hohepriesterin der Editions du Talion, meine Chefin.
»Sie müssten seit zwei Tagen auf der Arbeit sein!«
Stimmt vollkommen. Wegen dieser Geschichte mit den fixenden Großvätern hatte ich eine Virushepatitis vorgetäuscht und so der Reine Zabo zwei Monate abgetrotzt.
»Gut, dass Sie anrufen, Majestät«, sage ich, »ich wollte Ihnen nämlich gerade vorschlagen, mich noch einen Monat zu entschuldigen.«
»Kommt nicht infrage, morgen früh Punkt acht erwarte ich Sie hier.«
»Morgen um acht Uhr in der Früh? Da stehen Sie aber zeitig auf, um mich in einem Monat zu erwarten!«
»Ich warte keinen Monat. Wenn Sie morgen um acht Uhr nicht hier sind, dann heißt das, dass Sie rausgeflogen sind.«
»Das werden Sie nicht tun.«
»Ach nein?! Halten Sie sich für so unentbehrlich, Malaussène?«
»Keineswegs. Sie sind die Einzige, Majestät, die in den Editions du Talion unersetzlich ist! Aber wenn Sie mich rausschmeißen, dann muss ich meine Schwestern auf den Strich schicken und meinen jüngsten Bruder auch, ein reizendes Kind mit rosa Brille. Ein solches moralisches Fehlverhalten würden Sie sich nie verzeihen.«
Sie schenkt mir ihr schallendes Gelächter. (Ein Gelächter, so bedrohlich wie austretendes Gas.) Dann, übergangslos:
»Malaussène, ich habe Sie als Sündenbock angestellt. Sie werden dafür bezahlt, dass Sie sich an meiner Stelle anschnauzen lassen. Sie fehlen mir schrecklich.«
(Sündenbock, ja, das ist mein Job. Offiziell bin ich »Verlagslektor«, in Wahrheit: Sündenbock.) Und barsch fragt sie:
»Weshalb wollen Sie noch länger zu Hause bleiben?«
Mit einem Blick umfasse ich Clara, die am Herd steht, le Petit, Hand in Hand mit Verdun, Jérémy, Thérèse und die Großväter, und Maman, die über allem thront, glatthäutig und leuchtend wie die gesättigten Jungfrauen der italienischen Meister.
»Sagen wir, dass meine Familie mich im Augenblick ganz besonders braucht.«
»Ihre Familie, Malaussène? Was für eine Art Familie ist das denn?«
Julius der Hund, der mit heraushängender Zunge zu Mamans Füßen liegt, verkörpert ganz gut den Ochsen wie den Esel, und die hübsch gerahmten Porträts der Großväter scheinen von der Zukunft alles zu erwarten: echte Weise aus dem Morgenland!
»Die Art ›Heilige Familie‹, Majestät …«
Kurzes Schweigen am anderen Ende, dann ihre schnarrende Stimme:
»Ich bewillige Ihnen zwei Wochen, keine Minute mehr.«
Längeres Schweigen.
»Aber lassen Sie sich eines gesagt sein, Malaussène: Glauben Sie nicht, dass Sie Ihre Sündenbockrolle los sind, nur weil Sie Urlaub haben! Sündenbock, das sind Sie bis ins Mark. Sollte zum Beispiel derzeit in Paris ein Schuldiger gesucht werden, der für irgendeine kapitale Dummheit den Kopf hinhalten muss, so steht es hundert zu eins, dass man Sie verantwortlich machen wird!«
3
Passenderweise suchte, versteinert über der Stadt in seinem Ledermantel stehend, den Blick auf Vaninis Leiche geheftet, bei nächtlichen zwölf Grad minus der Commissaire divisionnaire Cercaire gerade nach einem Schuldigen.
»Den Kerl, der das getan hat, den mach ich platt!«
Totenbleicher Schmerz umflorte seinen schwarzen Schnurrbart. Er war ganz die Sorte Flic, die solche Sätze in den Raum und anschließend auf den Kopf stellt:
»Den mach ich platt, den Kerl, der das getan hat!«
(Die Augen hielt er dabei auf das eigene Bild im düsteren Spiegel des Eises gerichtet.)
Vor seinen Füßen maulte der Polizist in Uniform, der auf der vereisten Kreuzung Vaninis Umrisse mit Kreide nachzog, wie ein kleines Kind:
»Verflixt, das rutscht ab, Cercaire!«
Cercaire war auch die Sorte Flic, die sich mit Namen anreden lässt. Kein »Chef«. Erst recht kein »Monsieur le divisionnaire«. Einfach nur: »Cercaire«. Er liebte seinen Namen: Zerkarie!
»Hier, nimm das.«
Er reichte dem Polizisten ein Springmesser, das dieser als Eispickel benützte, ehe er Vanini seinen Asphaltanzug aufmalte. Der Kopf des Blondschopfs glich tatsächlich einer frisch erblühten Blume: rotes Herz, gelbe Blütenblätter und an den Rändern noch ein gewisses zinnoberrotes Zerfließen. Der Polizist hielt einen Augenblick inne.
»Zieh den Strich möglichst dick«, befahl Cercaire.
Vom blauen Band der Polizeibeamten auf Abstand gehalten, verfolgten alle Augen des Viertels die Arbeit des Kreidezeichners, als würden gleich die Münzen fliegen.
»Und kein einziger Zeuge, richtig?«
Der Kommissar hatte die Frage mit sonorer Stimme gestellt.
»Alles Schaulustige?«
Schweigen. Ein Häuflein Menschen, in die weiße Watte ihres Atems gehüllt. Gedrängt Wolle an Wolle; das rückte nur kurz für die Fernsehkamera einen Spaltbreit auseinander.
»Dieser Junge ist für Sie gestorben, Madame!«
Cercaire hatte das Wort an eine Vietnamesin in der ersten Reihe gerichtet, eine winzige Alte in gerade geschnittenem Thaikleid, grobwollenen Jesuitensocken und Holzpantinen. Die alte Frau sah ihn ungläubig an, und als ihr klar wurde, dass der Koloss sich wirklich an sie gewandt hatte, nickte sie ernst:
»Sehl jun!«
»Ja, wir nehmen die ganz Jungen, um Sie zu beschützen.«
Cercaire spürte, dass ihm das Zoom übers Gesicht schleckte, aber er war Polizist genug, um ein Kamerasurren zu ignorieren.
»Besüssen?«, fragte die alte Frau.
Noch eine viertel Stunde, und ihr schmales, skeptisches und aufmerksames Gesicht würde in den Abendnachrichten die verdienstvollsten unter den Fernsehzuschauern an das Gesicht von Ho Chi Minh erinnern.
»Genau, Sie beschützen! Alle alten Damen dieses Viertels ohne Ausnahme. Damit Sie in Sicherheit leben können. In SI-CHER-HEIT, verstehen Sie?«
Und plötzlich, satt im Objektiv, mit einem unterdrückten Schluchzer in der Stimme:
»Er war mein bester Mann.«
Und schon war der Kameramann in den Aufnahmewagen abgetaucht, der schleudernd und rutschend davonjagte. Auch die Menge verzog sich in die Häuser, und in den Straßen herrschte wieder die Einsamkeit der Polizisten. Nur die Vietnamesin hatte sich nicht vom Fleck gerührt, nachdenklich schaute sie zu, wie der Leichnam von Vanini in einen Krankenwagen geschoben wurde.
»Na«, fragte Cercaire, »wollen Sie sich nicht im Fernsehen bestaunen, wie alle? Die Nachrichten kommen in zehn Minuten!«
Sie schüttelte den Kopf.
»I geh luntel nah Palis!«
Wie die Alteingesessenen unterschied sie Belleville von Paris, in das man »runterging«.
»Die Wamilje!«, erläuterte sie und lächelte dabei durch sämtliche Zahnlücken.
Cercaire ließ so unvermittelt von ihr ab, wie er sich für sie interessiert hatte. Er schnippte mit den Fingern und verlangte sein Messer zurück, das der kleine Polizist in Uniform eingesteckt hatte, dann brüllte er:
»Bertholet! Du schaltest das 10., das 11. und das 20. Arrondissement ein. Sie sollen alle Ecken und Winkel durchkämmen und die Kundschaft komplett bei mir abliefern.«
Von der Höhe seiner eingefrorenen Knochen herab eröffnete sich für Inspektor Bertholet die Aussicht auf eine Nacht, die er damit verbringen würde, ein Heer schlafblinzelnder Verdächtiger zu wecken.
»Da dürfte ein hübscher Haufen zusammenkommen …«
Cercaire wischte den Einwand fort, indem er sein Messer wegsteckte.
»Bis man den Richtigen gefunden hat, ist der Haufen immer zu groß.«
Cercaire ließ das Blaulicht des Krankenwagens, der Vanini fortbrachte, nicht aus den Augen. Der große Bertholet blies sich auf die Finger.
»Wir müssen ja aber auch noch das Verhör von Chabralle unter Dach und Fach bringen …«
Reglos in seiner Lederkluft spielte Cercaire dort, wo Vanini gefallen war, die Rolle des Denkmals.
»Ich will den Hund, der das getan hat.«
Cercaire schluckte Tränen hinunter, die aus Stein waren. Er sprach mit dem ruhigen Schmerz des Chefs.
»Verdammt, Cercaire, in acht Stunden läuft der Gewahrsam von Chabralle ab. Willst du, dass er sich verpisst?«
Die Stimme des großen Bertholet war einen halben Ton lauter geworden. Wenn er sich anschaute, wie lange sie schon hinter Chabralle her waren, war ihm zum Knochenkotzen bei dem Gedanken, der Kerl könne morgen früh irgendwo draußen unbehelligt sein Buttercroissant in einen dampfenden Milchkaffee tauchen. Nein!
»Chabralle führt uns seit knapp vierzig Stunden an der Nase herum«, sagte Cercaire, ohne sich umzudrehen, »und er wird auch nicht im letzten Augenblick auspacken. Wir können ihn genauso gut gleich nach Hause schicken.«
Da war nichts zu machen. Rache lag in der Luft. Bertholet kapitulierte. Trotzdem versuchte er noch einen Vorstoß.
»Und wenn wir Pastor bitten würden, Chabralle weichzuklopfen?«
»Den Pastor von Divisionnaire Coudrier?«
Diesmal hatte sich Cercaire mit einem Ruck umgedreht. Blitzartig hatte er sich das Duell Chabralle-Pastor vorgestellt. Chabralle, der Killer aller Killer, in seinem Kroko – und der Engel Pastor, dieser kleine Marquis von Kommissar Coudrier, in seinen viel zu weiten, mamagestrickten Pullovern, in denen er versank. Chabralle gegen Pastor! Großartig, der Vorschlag von Bertholet! Gut hinter seinem Schmerz verschanzt, amüsierte sich Cercaire köstlich. Seit einem vollen Jahr spielten Cercaire und Coudrier ihre beiden Schützlinge Pastor und Vanini gegeneinander aus. Vanini, das kleine Genie des Sondereinsatzkommandos, und Pastor, der Hochbegabte im Verhör … Wenn man Coudrier glauben wollte, würde Pastor sogar ein Mausoleum zum Sprechen bringen! Vanini war aus gehärtetem Stahl, und Vanini war tot. Es war Zeit, Coudriers Kleinen Prinzen aus dem Verkehr zu ziehen – zumindest symbolisch.
»Keine schlechte Idee, Bertholet. Wenn es diesem Wollknäuel gelingt, Chabralle weichzuklopfen, fang ich an, Rosen zu züchten.«
Dreihundert Meter weiter stadtabwärts, an der Ecke des Faubourg du Temple und der Avenue Parmentier, klimperte eine Vietnamesin auf der Klaviatur im Maul eines Geldautomaten. In Wollsocken und Holzpantinen hatte sie sich, winzig wie sie war, auf die Zehenspitzen gereckt. Es war 20 Uhr 15; ihr Konterfei flimmerte eben auf den Bildschirmen der Grande Nation, in jedem Haushalt stellte sie die in diesen Zeiten beunruhigende Frage:
»Besüssen?«
Sie selbst hingegen ließ in tiefster städtischer Nacht in aller Sorglosigkeit das Banknotenklavier ausspucken, was es hergab.
Sie hörte nicht, wie der große Schwarze und der kleine, farbecht kabylische Rotschopf näherkamen. Sie schnupperte nur den Zimtgeruch des einen und den Minzatem des anderen. Im Maul der Maschine löste dies einen heiteren Schwall aus. Die Luft war noch mit etwas Drittem gesättigt: mit einer kräftigen Brise jugendlicher Ungeduld. Schweißgeruch, trotz der Kälte. Die beiden waren gerannt. Die Vietnamesin drehte sich nicht um. Vor ihr stapelten sich allmählich die Scheine. Bei zwei acht entschuldigte sich die Maschine, dass sie nicht mehr bereitstellen könne. Die Vietnamesin raffte, was an Banknoten gekommen war, mit einer Hand zusammen und stopfte es durch den Schlitz unter ihr Thaikleid. Einer der Scheine nutzte die Gelegenheit, auf und davon zu segeln, direkt an der Nase des Rotschopfs vorbei. Aber der rechte Fuß des großen Schwarzen nagelte den Schein unbarmherzig am Boden fest. Ende einer Flucht. Unterdessen hatte die Alte ihre Kreditkarte zurückbekommen und sich zur Metro Goncourt aufgemacht. Sie hatte die jungen Kerle sanft beiseitegeschoben. An den Bauchmuskeln des Schwarzen wäre ein Hagel von Muong-Pfeilen zerbrochen, und der Kabyle war breiter als lang. Aber sie hatte sich furchtlos zwischen den beiden Halbwüchsigen hindurchgezwängt und lief nun ganz ruhig in Richtung Metro.
»Hey, du da!«
Der Schwarze hatte sie mit zwei Schritten eingeholt.
»Hastn Hunni verlorn, junge Frau!«
Es war ein großer Mossi aus Belleville, dritte Generation. Er wedelte ihr mit dem Hunderter vor dem Gesicht herum. Sie steckte den Schein ohne Hast ein, bedankte sich höflich und setzte ihren Weg fort.
»Sag ma, biste noch ganz gesund, in unsrer Ecke so ’ne Stange Geld zu ziehn?«
Jetzt lief auch der Rotschopf neben ihnen her. Zwei auseinanderstehende Schneidezähne verliehen ihm ein Lächeln, das breiter als er selber war.
»Lieste keine Zeitung? Haste nich mitgekriegt, was wir Junkies mit euch ollen Schachteln machen?«
Durch die beiden klaffenden Schneidezähne pfiff der Wind des Propheten.
»Ollnsastln?«, fragte die Alte. »Nig werstehn Ollnsasteln …«
»Alte Schabracken«, übersetzte der große Schwarze.
»Du weißt doch, was uns alles einfällt, um euch die Kohle abzunehmen?«
»Kalt machen wir euch. Allein drei im letzten Monat hier in Belleville!«
»Wir rösten euch den Hintern mit ein paar Marlboro, wir zwacken euch ritsch, ratsch die Titten ab und brechen euch jedes Fingerchen einzeln. Bis ihr euern hübschen kleinen Geheimcode ausspuckt. Und dann zerlegen wir euch hier an der Stelle in zwei Teile.«
Der dicke Daumen des Rotschopfs beschrieb auf Höhe seines Halses einen Halbkreis.
»Wir hamm da einen Fachmann«, erläuterte der große Mossi.
Sie gingen jetzt die Stufen zur Metro hinunter.
»Fährst du nach Paris rein?«, fragte der Rotschopf.
»Su mein Swigeldoddel«, antwortete die alte Frau.
»Und du nimmst die Metro mit dem ganzen Zaster in der Tasche?«
Der rechte Arm des Rotschopfes hatte sich wie ein Umschlagtuch um die Schulter der Alten gelegt.
»Mein Swigeldoddel gleins Baby bon«, erklärte diese und strahlte plötzlich über und über vor Freude, »wiele Gesenk mahen!«
Als sie auf den Bahnsteig kamen, fuhr gerade ein Zug in die naturalistische Höhle der Brüder Goncourt ein.
»Wir fahrn mit dir mit«, entschied der große Mossi.
Er ließ den Hebel einer Waggontür hochklacken, und sie glitt zischend auf.
»Könnt ja sein, dass du eine unangenehme Begegnung hast.«
Der Wagen war leer. Die drei stiegen ein.
4
Unterdessen bei den Malaussènes, wie es in den belgischen Comics meines Bruders Jérémy heißt: Die Großväter und die Kinder haben gegessen, den Tisch abgeräumt, das Geschirr gespült, sich die Zähne geputzt, die Schlafanzüge übergestreift, und jetzt hocken sie auf ihren Doppelstockbetten mit im Leeren baumelnden Schlappen und Augen, die ihnen aus den Höhlen treten. Denn das kleine runde Ding, das mit hundsgemeinem Pfeifen und im Affenzahn sich auf dem Fußboden des Kinderzimmers dreht, lässt ihnen das Blut in den Adern regelrecht stocken. Es ist schwarz, es ist kompakt, es ist schwer, und während es um die eigene Achse saust, zischelt es wie ein Vipernnest. Wenn dieses Ding explodiert, dann geht bestimmt die ganze Familie mit hoch. Dann kann man die Fleischfetzen und Eisenbettsplitter von der Place de la Nation bis zu den Buttes Chaumont einsammeln.
Was jedoch mich fasziniert, ist nicht dieses runde Ding und nicht das tiefgefrorene Entsetzen der Kinder wie der Greise: Was mir die Sprache verschlägt, ist das Gesicht des Erzählers; gestenlos, mit starrem Blick und gedämpfter Stimme ist der alte Risson stärker konzentriert als die explosive Ladung dieses Unheil bringenden Kreisels. Der alte Risson erzählt jeden Abend zur selben Stunde, und kaum macht er den Mund auf, da wird das Erzählte wirklicher als die Wirklichkeit. Sobald der alte Risson, sehr aufrecht, den Kopf umkränzt von einer unglaublichen weißen Mähne und im Auge ein Lodern, sich in der Zimmermitte auf seinen Hocker setzt, versinken die Betten, Schlappen, Schlafanzüge und Wände des Zimmers ins Unvorstellbare. Nichts mehr existiert mit Ausnahme dessen, was er den Knirpsen und Großvätern erzählt: im Moment diese schwarze Masse, die sich zu ihren Füßen dreht und ihnen den Zersplitterungstod verspricht. Es handelt sich um eine französische Granate, die am 7. September 1812 in der Schlacht von Borodino abgefeuert wurde (einer säuischen Schlächterei, wo ganze Bataillone von Feen Bataillone von Männern in Blumen verwandelt haben). Die Granate ist Fürst Andrej Bolkonski vor die Füße gefallen, der zögernd und schwankend dasteht, um seinen Männern ein Beispiel zu geben, während der Ordonnanzoffizier den Hans Guckindieluft in einem Kuhfladen spielt. Der Fürst Bolkonski fragt sich, ob es der Tod ist, was da vor seinen Augen kreiselt, und der alte Risson, der Krieg und Frieden ganz gelesen hat, weiß, dass es der Tod ist. Doch im Schummer des Zimmers, wo nur eine kleine Stehlampe, über die Clara ein Kaschmirtuch geworfen hat, einen schwachen goldbraunen Kegel auf den Fußboden wirft, im Schummer des Zimmers zieht Risson den Genuss in die Länge.
Bevor der alte Risson zu uns kam, war ich es, Benjamin Malaussène, der unentbehrliche große Bruder, der den Jüngeren ihre vornächtliche Portion Erfundenes servierte – jeden Abend und von jeher: »Benjamin, erzähl uns eine Geschichte.« Ich glaubte, mich könne in der Rolle keiner schlagen. Ich war stärker als die Glotze zu einer Zeit, als die Glotze schon stärker als alles andere war. Und dann erschien Risson. (Früher oder später taucht immer der König auf, der den König zu Fall bringt …) Ein Abend genügte diesem leidenschaftlichen Buchhändler, um mich zur Laterna magica zu degradieren und sich in den Rang von Cinemascope-Panavision-Soundsurrounding und dem ganzen Klimbim zu erheben. Und es sind nicht Groschenromane, was er den Kindern serviert! Sondern die Mount Everests der anspruchsvollen Literatur, dickleibige Romane, die er sprudelnd lebendig im Gedächtnis bewahrt hat. Er lässt sie in allen Einzelheiten vor einer Zuhörerschaft wiedererstehen, die sich jedes Mal in ein einziges, riesiges Ohr verwandelt.
Dass Risson mich ausgestochen hat, schmerzt mich nicht. Erstens ging mir langsam die Puste aus und ich schielte schon nach gebrauchten Fernsehern, und zweitens sind es seine wahrhaft halluzinativen Geschichten, die Risson dauerhaft von der Droge heruntergebracht haben. Er hat seinen Verstand und seine Jugend wiedergewonnen, seine Leidenschaft, das, wofür allein er lebt.
Eine sagenhafte Wunderheilung, wirklich! Die Haare meiner Seele stehen mir noch jetzt zu Berge, wenn ich daran denke, wie er bei uns auftauchte.
Das war vor einem Monat, in den Abendstunden. Ich wartete auf Julie, die uns einen neuen Großvater angekündigt hatte. Wir saßen eben beim Nachtessen. Clara und Opa Rognon hatten für uns Wachteln zubereitet, die so gemästet waren wie die Kindlein von Gilles de Rays. Wir hockten mit gezückten Messern und Gabeln da und wollten uns gerade auf die Canapés mit den kleinen nackten Leibern stürzen – da, plötzlich: Ding Dong.
»Das ist Julia!«, rufe ich.
Und mein Herz hüpft von allein zur Tür.
Es war wirklich meine Corrençon, ihr Haar, ihre Rundungen, ihr Lächeln, alles. Aber hinter ihr … Hinter ihr stand der abgewrackteste Greis, den sie uns je gebracht hatte. Er musste einmal stattlich gewesen sein, doch jetzt war er so zusammengerutscht, dass ihm jede Körpergröße abhanden gekommen war. Er musste wohl einmal schön gewesen sein, aber wenn Tote eine Farbe haben, so hatte die Haut dieser Karkasse die Totenfarbe. Er war ein von lose schlotternder Haut überzogenes scharfkantiges Skelett, dessen Bewegungen dermaßen spitzig waren, dass die Knochen jedes Mal durchzukommen drohten. Haare, Zähne, Fingernägel, ja das Weiß der Augen, alles war gelb. Und die Lippen – nicht mal ein Strich. Doch am meisten beeindruckte, dass sich im Innern dieses Gerippes und in der Tiefe der Augen eine schreckliche Lebendigkeit spüren ließ, etwas, das beim besten Willen nicht kleinzukriegen war. Der leibhaftige, lebendige Tod, in den der Gieper auf Heroin die großen Junkies verwandelt, die auf Entzug sind. Dracula in Person!
Julius der Hund hatte sich knurrend unter ein Bett verkrümelt. Uns waren Messer und Gabel aus der Hand gefallen, und die kleinen Wachteln auf den Tellern hatten Gänsehaut bekommen.
Zuletzt rettete Thérèse die Situation. Sie stand auf, nahm den Ausgebuddelten bei der Hand und führte ihn zu ihrem runden Tischchen, wo sie sich sofort daranmachte, ihm wie den drei anderen Großvätern eine Zukunft zu basteln.
Was mich betraf, so verschwand ich mit Julie in meinem Zimmer, wo ich ihr die Szene der Wut im Flüsterton machte.
»Hast du sie noch alle?! Uns einen in diesem Zustand anzubringen! Willst du, dass er hier abnibbelt? Findest du, dass mein Leben zu einfach ist?«
Julie hat eine Gabe. Die Gabe, mir Fragen zu stellen, die mich aus der Bahn werfen. Sie fragte mich:
»Hast du ihn nicht wiedererkannt?«
»Muss ich ihn kennen?«
»Es ist Risson.«
»Risson?«
»Risson aus dem Kaufhaus, der ehemalige Buchhändler.«
Im Kaufhaus habe ich gearbeitet, bevor ich zu den Editions du Talion kam. Ich spielte dort dieselbe Rolle wie im Verlag, Sündenbock, und wurde rausgeschmissen, nachdem Julie in ihrer Zeitung einen großen Artikel über die Art meiner Tätigkeit veröffentlicht hatte. Dort gab es tatsächlich einen alten Buchhändler, einen Mann von sehr gerader Statur und mit prächtigem, weißhaarigem Schädel, der in die Literatur vernarrt, aber auch ein verdammter kleiner Altnazi war. Risson? Ich versuchte das Bild des kleinen zerknitterten Alten zu glätten, den sie uns angeschleppt hatte, und es zu vergleichen … Risson? Schon möglich. Ich sagte:
»Risson ist ein altes Schwein, sein Hirn ist in Scheiße eingelegt, ich kann ihn nicht ausstehen.«
»Und die anderen Großväter?«, fragte Julie, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen.
»Wie, die anderen?«
»Was weißt du von deren Vergangenheit, davon, was sie vor Jahrzehnten gemacht haben? Merlan zum Beispiel. Könnte doch ein Gestapo-Spitzel gewesen sein, oder? So ein Frisör kriegt allerhand mit, also hat er auch was zu erzählen … Oder Verdun? Hat putzmunter die Gräben des Ersten Weltkriegs überlebt. Vielleicht ist er ja hinter seinen Kameraden in Deckung gegangen? Oder Rognon? Metzger in Algerien, überleg mal! ›Der Schlächter von Tlemcen‹, das klingt doch, als könne er ganz gut für ein Massaker verantwortlich zeichnen …«
Während sie noch flüsterte, gaben unter ihrer Hand bereits unsere ersten Knöpfe nach, und ihr Savannenlachen strömte direkt in die Weichteile meines Ohrs.
»Nein, glaub mir, Benjamin, es ist besser, niemandem auf den Grund zu gehen; Verjährung hat etwas für sich.«
»Scheiß auf die Verjährung! Ich erinnere mich noch Wort für Wort an meine letzte Unterhaltung mit dem alten Risson: Dieser Kerl hat ein Hakenkreuz anstelle des Herzens.«
»Na und?«
(Als ich Julie das erste Mal sah, stahl sie im Kaufhaus einen Shetlandpulli. Ihre Finger schnappten von allein zu, und die Hand sog und schleckte auf. Ich beschloss auf der Stelle, Julies Shetlandpulli zu werden.)
»Benjamin, wichtig ist nicht zu wissen, was Risson gedacht oder getan hat, als sein Hirn noch gut geschmiert war, sondern gegen diese Dreckskerle vorzugehen, die es in Altöl verwandelt haben.«
Ich weiß nicht, wie sie es angestellt hat, aber dieser letzte Satz fiel bereits zwischen den Laken, und ich glaube, es gab weit und breit kein Stückchen Kleidung mehr. Was Julie nicht davon abhielt, bei ihrem Thema zu bleiben.
»Weißt du, warum Risson so abgedriftet ist?«
»Ist mir vollkommen schnuppe.«
Das stimmte. Es war mir gleichgültig. Nicht mehr aufgrund irgendeiner anti-Risson’schen Moral, sondern weil mein Herz zwischen Julies Brüsten gebettet lag. Sie wollte es mir trotzdem erklären, indessen ich mich bediente. Und während sie Rissons Geschichte erzählte, fuhren mir all ihre Finger durchs Haar.
Erster Akt: Als ich letztes Jahr nach Julies Artikel vom Kaufhaus gefeuert wurde, knöpfte sich die Gewerbeaufsicht die Firmenleitung vor. Sie wollte wissen, wie ein Betrieb aussah, der einen Sündenbock anstellt, damit er vor den zeternden Kunden Rotz und Wasser heult und so sämtliche Scherereien aus der Welt schafft. Und der strengen Dame Gewerbeaufsicht kam allerlei zur Ansicht. Unter anderem ein Risson, der schwarz buchhändlerte und schon seit mehr als zehn Jahren auf dem Altenteil hätte sitzen müssen. Abgang von Risson. Ende des ersten Aktes.
Zweiter Akt: Entlassen und mutterseelenallein in seiner kleinen Zweizimmerwohnung in der Rue Broca, verkriecht sich Risson mit einer Depression ins Bett. Typus: Früh übt sich, was eine Leiche werden will, die nach sechs Monaten oder mehr von Nachbarn mit feiner Nase als gemischtes Kompott in den Federn gefunden wird. Bis eines Morgens …
Dritter Akt: … gnädiger Gott im Himmel, Risson ein blutjunges Mädchen bei sich aufkreuzen sieht, häusliche Altenpflege, sozusagen Gratisgeschenk des Rathauses. Eine kleine Schwarzhaarige mit azurblauen Augen, lebhaft wie ein Frettchen und sanft wie der Traum von einer Frau. O Freude! O Idylle am Ende der Tage! Das junge Ding, es umzärtelt den Risson, es macht ihn kirre, und es stopft ihn tonnenweise mit unsäglichen Medikamenten voll, um seine zehrende Sehnsucht zu lindern.
Vierter Akt: Risson gibt seine ganze Knete für immer mehr Zaubergutsels aus, wechselt wie selbstverständlich von den Pillen zur Nadel, driftet ab und vergreist mit schwindelerregender Geschwindigkeit, sodass er eines Morgens, von einem kräftigen intravenösen Schuss völlig euphorisiert, auf dem Markt am Port-Royal alle Kleider von sich wirft. Murren und Schimpfen der Händler über den Striptease des Methusalem!
Fünfter Akt: