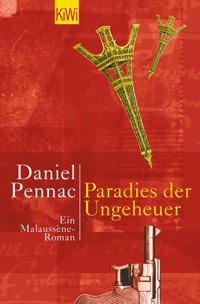
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Benjamin Malaussène Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Endlich – der erste aller Malaussène-Romane als E-Book Von Beruf ist Benjamin Malaussène Sündenbock, aber auch großer Bruder und Ernährer zahlreicher Halbgeschwister. Die ganze Sippschaft wohnt in einem alten Laden im bunten Pariser Stadtteil Belleville. Väter gibt es nicht, und Maman ist ständig in Liebesabenteuern unterwegs. Benjamin arbeitet in einem großen Pariser Kaufhaus in der Reklamationsabteilung, hält für alle Pannen seinen Kopf hin. Aber man will ihm noch mehr anhängen: eine Serie geheimnisvoller Bombenexplosionen im Kaufhaus, deren Opfer sich ausgerechnet immer in seiner Nähe aufhielten. Doch die Ermittlungen des Kriminalkommissars Coudrier führen in eine andere Richtung. Benjamin könnte aufatmen, wenn nicht zu Hause bei den Geschwistern dauernd etwas schief ginge: Jeremy bastelt in der Schule erfolgreich eine Bombe, Louna kriegt Zwillinge, Julius der Hund erleidet seinen ersten epileptischen Anfall. Und in all dem Trubel verliebt Benjamin sich unsterblich in die überwältigende Journalistin »Tante Julia«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Ähnliche
Daniel Pennac
Paradies der Ungeheuer
Ein Malaussène-Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Daniel Pennac
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Voilà – die Malaussènes und ihre Freunde
Widmung
Motti
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Zitiert wurde nach
Inhaltsverzeichnis
Voilà – die Malaussènes und ihre Freunde:
Mutter aller großen und kleinen Malaussènes, ständig in Liebesangelegenheiten unterwegs oder schwanger, serviert die Männer gleich nach vollbrachter Leistung ab.
Benjaminder älteste Spross Mamans, Ersatzvater für seine zahlreichen jüngeren Geschwister und Sündenbock vom Dienst.
LounaKrankenschwester mit weitem Herzen und heranwachsenden Problemen.
Thérèseernsthafte Jungastrologin mit stenografischen Fähigkeiten.
ClaraBenjamins Lieblingsschwester mit samtener Stimme, hat eine Leica als Auge.
Jérémyrenitenter Junge mit explosivem Tatendrang.
Le Petitder Kleine, frech und mit besonderer Vorliebe für Kannibalistisches.
Julius der Hundnicht immer gut riechender Gefährte, der durch einen seelischen Schock zum Epileptiker wird.
ThéoBenjamins bester Freund und tuntige Tante der Familie mit einem Helfersyndrom für alte Männer.
»Tante Julia«umwerfende, bildschöne Journalistin, die wie eine Bombe bei Benjamin einschlägt.
Laurent BoudinArzt und Verursacher von Lounas wachsenden Problemen.
Coudrierweitblickender Napoleonverehrer mit einer leisen Sympathie für Benjamin.
StojilSchach spielender Wachmann und weiser Ratgeber in allen Lebenslagen.
Inhaltsverzeichnis
Für »le Gros«
Für Robert Soulat
Inhaltsverzeichnis
»Mit Spielzeug versuchen die Titanen den kleinen Dionysos in ihren Kreis zu locken. Von den glitzernden Gegenständen angezogen, nähert sich das Kind, und der monströse Kreis schließt sich. Gemeinsam töten die Titanen Dionysos; nachher kochen und verschlingen sie ihn.«
RENÉ GIRARD DER SÜNDENBOCK
»… die Gläubigen aber hoffen, die Gegenwart des Heiligen möge genügen, auf dass er (…) an ihrer Stelle getroffen werde.«
RENÉ GIRARD DER SÜNDENBOCK
»Die Bösen haben zweifellos etwas begriffen, wovon die Guten keine Ahnung haben.«
WOODY ALLEN
Inhaltsverzeichnis
1
Luftig und lockend wie ein Brautschleier schwebt die weibliche Stimme herab aus dem Lautsprecher.
»Monsieur Malaussène bitte zur Reklamation.«
Eine nebelumflorte Stimme, als würde ein Hamilton-Photo plötzlich sprechen. Doch hinter diesem Schleier von Miss Hamilton kann ich ein leises Lächeln ausmachen. Das nicht im Mindesten sanft ist. Gut, ich komme schon. Vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche. Wir schreiben den 24. Dezember, 16 Uhr 30, das Kaufhaus ist brechend voll. Geschenkbeladene Kunden verstopfen die Gänge. Ein Eisverkäufer, der förmlich zerfließt, geht nervös und finster seinem Geschäft nach. Verkrampftes Lächeln, glänzender Schweiß, dumpfes Geschimpfe, hasserfüllte Blicke, Angstgeschrei von Kindern, wenn einer der wattebärtigen Weihnachtsmänner eines am Schlafittchen packt.
»Keine Angst, mein Liebling, das ist nur der Weihnachtsmann!«
Blitzlichtgeprassel.
Was mich betrifft, so sehe ich in puncto Weihnachtsmann einen vor mir, der, riesig und durchscheinend, in grässlicher Menschenfressergestalt diese stockende Menge überragt. Sein Mund ist kirschrot. Sein Bart ist weiß. Sein Lächeln ist gütig. Aus den Mundwinkeln ragen Kinderbeine. Das jüngste Bild von le Petit, er hat es gestern in der Schule gemalt. Die Lehrerin, scharfzüngelnd: »Finden Sie es normal, dass ein Kind in diesem Alter so einen Weihnachtsmann malt?« Und ich: »Und der Weihnachtsmann, finden Sie den ganz normal?« Ich nahm den Kleinen auf den Arm, er war kochend heiß. Er hatte so starkes Fieber, dass die Gläser seiner Brille beschlagen waren, was ihn noch stärker schielen ließ.
»Monsieur Malaussène bitte zur Reklamation.«
Er hat es gehört, verdammt noch mal, der Monsieur Malaussène! Er steht sogar schon am Fuße der zentralen Rolltreppe. Und hätte sie auch bereits betreten, wenn nicht die schwarze Mündung eines Geschützrohrs ihn in Schach hielte. Denn er hat mich im Visier, dieser Dreckskerl, Irrtum ausgeschlossen. Der Panzerturm hatte sich um seine Achse gedreht, bis er in meine Richtung zielte, dann hatte das Geschützrohr sich gehoben und war schließlich, auf den Punkt zwischen meinen Augen gerichtet, erstarrt. Turm und Rohr gehören zu einem AMX 30, den ein kleiner, vor Begeisterung glucksender Greis fernsteuert. Einer von Théos zahllosen kleinen Alten, der wirklich sehr klein ist, einen Meter vierzig, und alt wie Methusalem. Stets erkennbar an dem grauen Kittel, in den Théo sie alle steckt, um sie nicht aus den Augen zu verlieren.
»Zum letzten Mal, Opa, legen Sie das Spielzeug an seinen Platz zurück!«
Die Spielwarenverkäuferin war es sichtlich leid, ihn zu schelten. Sie hat den hübschen Kopf eines Eichhörnchens, das seinen Nussvorrat noch in den Backen verwahrt. Der Alte bockt mit kindlichem Starrsinn, behält den Finger auf dem Auslöser. Ich knalle die Hacken zu einer tadellosen Habachtstellung zusammen und sage:
»Der AMX 30 ist veraltet, mon Colonel, taugt nur noch für den Schrottplatz oder Südamerika.«
Mit untröstlichem Blick betrachtet der kleine Tattergreis sein Spielzeug, dann gibt er mir mit resignierter Geste zu verstehen, dass er die Waffen streckt. Das Lächeln der Verkäuferin diplomiert mich als Gerontologen. Wie aus dem Nichts taucht Cazeneuve, der Etagensheriff, auf und schnappt sich wütend den Panzer.
»Dass du aber auch überall Chaos veranstalten musst, Malaussène!«
»Schnauze, Cazeneuve.«
Ein Klima …
Jetzt, da ihm sein Panzer fehlt, hält der Alte Maulaffen feil. Ich lasse mich mit einer gewissen Erleichterung von der Rolltreppe nach oben tragen, als hoffte ich auf frischere Luft in größerer Höhe.
Oben angekommen, stoße ich auf Théo. In Flamingorosa. Der Anzug sitzt wie angegossen. Wie üblich wartet er vor dem Fotoautomaten. Er lächelt mir freundlich zu.
»Einer deiner Piepmätze stellt in der Spielwarenabteilung alles auf den Kopf, Théo.«
»Bestens. Dann packt er seinen wenigstens nicht vor den Schultoren aus.«
Lächeln und Gegenlächeln. Dann zeigt Théo aus dem Augenwinkel auf den Glaskasten der Reklamation.
»Sieht ganz so aus, als ginge es da drin um dich.«
Eindeutig. Ich brauche keine zwei Sekunden, um zu begreifen, dass Lehmann sich seit geraumer Weile abrackert. Er erklärt einer Kundin, dass der Fehler einzig und ausschließlich bei mir liege. In kurzen, kleinen Stößen schießen der Dame Tränen aus den Augen. In einer Ecke hat sie ein fettes Baby abgestellt, das mit Gewalt in einen klapprigen Kinderwagen gequetscht wurde. Ich öffne die Tür. Ich höre, wie Lehmann ehrlich und unverhohlen Solidarität bekundet:
»Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Madame, das ist absolut inakzeptabel, im Übrigen …«
Er hat mich gesehen.
»Im Übrigen – da ist er gerade, fragen wir ihn, was er dazu meint.«
Seine Stimme hat das Register gewechselt. Von Anteilnahme zu Giftigkeit. Die Sache ist einfach. Lehmann legt sie mir mit der Ruhe eines Hypnotiseurs dar. Das fette Baby sieht mich heiter wie ein Leichenbitter an. Also, vor drei Tagen habe meine Abteilung doch dieser Dame hier einen Kühlschrank verkauft, in den sie, dank des Fassungsvermögens, das Weihnachtsessen für fünfundzwanzig Personen, Vor- und Nachspeise inbegriffen, kalt gestellt hat. »Kalt gestellt« sei freilich ein Euphemismus, denn erstens habe in der vergangenen Nacht aus einem Grunde, den ich ihm bitte erklären möge, sich selbiger Kühlschrank in einen Verbrennungsofen verwandelt, weshalb es zweitens ein Wunder sei, dass nicht jetzt die Frau im Kühlfach liege, denn die Flamme, die ihr heute Morgen beim Öffnen der Tür entgegengeschlagen sei, hätte sie gut und gern das Leben kosten können. Ich werfe einen kurzen Blick auf die Kundin. Ihre Augenbrauen sind wahrhaftig angesengt. Der Schmerz, der durch ihre Wut hindurchschimmert, hilft mir, kläglich aus der Wäsche zu gucken. Das Baby betrachtet mich, als wäre ich die Ursache allen Übels. Ängstlich wandert mein Blick zu Lehmann, der sich mit verschränkten Armen auf die Kante seines Schreibtischs stützt.
»Ich warte.«
Stille.
»Sie sind doch die Technische Kontrolle, oder?«
Ich nicke und stottere, dass, ja, eben drum, mir unbegreiflich, die Kontrolltests wurden alle … »Wie bei dem Gasherd vergangene Woche oder dem Staubsauger der Kanzlei Boëry!«
Schuld an den massakrierten Robbenbabys bin ich, das kann ich unmissverständlich in den Augen des kleinen Dotzes lesen. Lehmann wendet sich erneut an die Kundin. Er redet, als ob ich nicht da wäre. Er dankt der Dame, dass sie ohne Zögern und mit Nachdruck ihre Beschwerde vorgebracht habe. (Draußen steht sich Théo noch immer in der Schlange vor dem Fotomaton die Beine in den Bauch. Ich darf nicht vergessen, ihn um ein Bild für le Petits Album zu bitten.) Lehmann vertritt die Ansicht, dass es die Pflicht der Kundschaft sei, zur Verbesserung des Handels beizutragen. Selbstredend trete die Garantie in Kraft, das Kaufhaus werde der geschätzten Kundin umgehend einen neuen Kühlschrank liefern.
»Was den darüber hinausgehenden Schaden betrifft, den Sie und Ihre Familie erlitten haben (so redet er, der Exunteroffizier Lehmann, in dessen Stimme ein Hauch gutes altes Elsass nachhallt, wo ihn dieser Klapperstorch, der regelmäßig Riesling tankt, abgelegt hat), so wird es Monsieur Malaussène eine Freude sein, diesen wiedergutzumachen. Aus eigener Tasche, versteht sich.«
Und er fügt hinzu:
»Fröhliche Weihnachten, Malaussène!«
Nun, da Lehmann ihr meinen Werdegang im Hause nachzeichnet, da er ihr erklärt, dass dieser Werdegang dank ihres entschiedenen Auftretens hiermit abgeschlossen sei, lese ich im müden Blick der Kundin nicht mehr Wut, sondern zunächst Verlegenheit, dann Mitleid, und schließlich steigen ihr erneut Tränen in die Augen und hängen zitternd an ihren Wimpern.
So weit wären wir schon mal. Jetzt muss ich nur noch meine eigene Tränenpumpe in Betrieb setzen. Zu diesem Zwecke wende ich die Augen ab und versenke meinen Blick im Mahlstrom des Kaufhauses auf der anderen Seite der Glastür. Ein unbarmherziges Herz pumpt mehr und mehr rote Blutkörperchen in die verstopften Arterien. Die gesamte Menschheit scheint unter einem gigantischen Geschenkpaket einherzukriechen. Aus der Spielzeugabteilung steigen unablässig hübsche durchsichtige Luftballons nach oben und verklumpen sich unter dem milchigen Glasdach. Durch diese vielfarbigen Trauben sickert das Tageslicht herein. Schön ist das. Vergeblich versucht die Kundin, Lehmann zu unterbrechen, der mitleidlos meinen künftigen Lebensweg entwirft. Nicht gerade rosig. Noch zwei, drei miserable Jobs und erneute Entlassungen, schließlich Dauerarbeitslosigkeit, Obdachlosenasyl und am Ende ein anonymes Armenbegräbnis. Als die Kundin ihre Augen wieder auf mich richtet, laufen mir die Tränen herunter. Lehmann hebt nicht die Stimme. Er treibt systematisch den Stachel ins Fleisch.
Was ich nun in den Augen der Kundin sehe, überrascht mich nicht. Ich sehe darin sie. Ich brauchte nur loszuheulen, damit sie sich an meine Stelle versetzte. Mitgefühl. Als Lehmann einmal kurz Luft holt, gelingt es ihr endlich, ihn zu unterbrechen. Rückzieher auf der ganzen Linie. Sie wird keine Schadensersatzansprüche erheben. Es genügt, wenn der Kühlschrank auf Garantie geht. Ich brauche ihr das Weihnachtsessen für fünfundzwanzig Personen nicht zu ersetzen. (Bestimmt hat Lehmann zwischendurch mein Gehalt erwähnt.) Sie würde sich Vorwürfe machen, wenn ich ihretwegen direkt vor den Festtagen den Arbeitsplatz verlöre. (Lehmann hat mindestens zwanzigmal das Wort »Weihnachten« fallen gelassen.) Jeder kann mal einen Fehler machen, sie selber hat erst kürzlich auf der Arbeit …
Fünf Minuten später verlässt sie das Reklamationsbüro mit einem Gutschein für einen neuen Kühlschrank. Der Kinderwagen mitsamt Baby bleibt kurz in der Tür stecken. Die Frau schiebt und drückt und schluchzt nervös auf.
Lehmann und ich bleiben allein zurück. Ich schaue ihm eine Zeit lang zu, wie er sich schieflacht. Dann – vielleicht war ich einfach ausgelaugt? – flüstere ich:
»Eine hübsche Schweinebande, wir beiden, hm?«
Er öffnet gerade seine dreckige Kläfferschnauze, als etwas sie ihm wieder verschließt.
Es steigt aus der Tiefe des Kaufhauses auf.
Und ist das dumpfe Geräusch einer Explosion. Auf die Schreie folgen.
Inhaltsverzeichnis
2
Wir drücken unsere zwei Nasen an der Glastür platt. Zuerst sehen wir nichts. Zwei- oder dreitausend Luftballons, durch die Detonation losgerissen, versperren uns die Sicht. Als sie langsam höher steigen, enthüllen sie uns allmählich, was ich lieber nicht gesehen hätte.
»Scheiße«, murmelt Lehmann.
Unter den Kunden herrscht helle Panik. Alle suchen einen Ausgang. Die Stärksten trampeln die Schwächsten nieder. Einige laufen direkt über die Ladentheken und wirbeln Fontänen von Slips und Schuhen auf. Hie und da versucht ein Verkäufer oder Wachmann, die Panik einzudämmen. Ein langer Typ in violetter Weste hängt über einer Vitrine mit Parfümeriewaren. Ich öffne die Glastür des Reklamationsbüros. Als hätte ich während eines Taifuns ein Fenster geöffnet. Das Kaufhaus ist ein einziges Heulen. Neben mir versucht ein Lautsprecher, die Ruhe wiederherzustellen. Bestünde im Augenblick nicht die Gefahr, an anderem zu sterben, so könnte man sich wegen Miss Hamiltons Stimme zu Tode lachen: ein Parfümzerstäuber mitten im Hurrikan. Unten herrscht Krieg. Oben haben die Ballons ihre Durchsichtigkeit wiedergewonnen. Diese ganze Szenerie des Grauens ist in ein einzigartig mildes, rosa Licht getaucht. Lehmann ist nachgekommen und brüllt mir ins Ohr:
»Wo kommt das her? Wo hats gekracht?«
Aus der Stimme des Exmilitärs weht mich der alte Eifer von Indochina an. Ich weiß nicht, wo es gekracht hat. Ein Berg von Leibern, aus dem Arme und Beine ragen, blockiert die Rolltreppe. Auf allen vieren kraxeln Kunden die Treppe hinauf, die abwärtsrollt, doch unter dem Ansturm einer Schar, die von oben kommt, weichen sie zurück. Und ehe man sich verständigen kann, landen alle am Fuß der Rolltreppe und stürzen über das Menschenknäuel. Gewimmel und Geschrei.
»Scheiße!«, brüllt Lehmann. »Scheiße, Scheiße, Scheiße …«
Unter Einsatz der Ellbogen kämpft er sich zur Rolltreppe durch, bedient den Notstopp, bringt das Ding zum Stehen.
Im Licht vor der Fotomaton-Kabine betrachtet Théo die vier Ausfertigungen seines Antlitzes. Anscheinend ist er zufrieden. Er gibt mir eines der Bilder:
»Hier, für das Album von le Petit.«
Und schließlich beruhigt sich alles. Es beruhigt sich, weil nichts weiter folgt. Irgendwo ist etwas explodiert, sonst ist nichts passiert. Folglich beruhigt sich alles. Und bald kann man Miss Hamilton hören, wie sie sanft unserer werten Kundschaft empfiehlt, das Kaufhaus ruhig und geordnet zu verlassen, und die Angestellten auffordert, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Genau dies geschieht auch. Die Menge strömt langsam den Ausgängen zu. Zurück bleibt ein wüstes Feld aus Handtaschen, Schuhen, bunten Päckchen und alleingelassenen Kindern. Ich rechne damit, hundert oder mehr Leichen zu Gesicht zu bekommen. Aber nein. Hie und da beugen sich Angestellte über halb benommene Kunden, die aber schließlich aufstehen und zum Ausgang humpeln.
Dann folgt der Auftritt der Polizei, durch eine kleine Seitentür, die extra für sie reserviert wurde. Schnurstracks steuern die Flics auf die Spielzeugabteilung zu. Die Spielzeugabteilung! Sofort denke ich an das Eichhörnchen und Théos Alten. In Sätzen springe ich die stehende Rolltreppe hinunter; mit einem Vorgefühl, das sich – wie jedes Vorgefühl – als falsch herausstellt. Die Leiche ist ein etwa sechzigjähriger Mann, der eine ziemliche Wampe gehabt haben muss, geht man von dem aus, was sein Bauch alles kreuz und quer verspritzt hat. Die Bombe hat den Mann praktisch in zwei Teile zerlegt. Während ich mich so diskret wie möglich übergebe, muss ich, wer weiß warum, an Louna denken. An Louna und Laurent und das Kleine. Dreimal schon hat sie mich angerufen: »Ich brauch einen Rat, Ben, deine Meinung.« Was soll ich dir denn raten, mein armer Liebling, guck mich doch an!
Ungeordnete Gedanken, während auf den kreuz und quer verspritzten Kunden Decken niedersegeln.
»Nicht gerade schön, was?«
Der kleine Flic schenkt mir ein nettes Lächeln. In meiner augenblicklichen Verfassung ist das besser als nichts. Weshalb ich ihm mit einer gewissen Dankbarkeit, wenn auch unverbindlich antworte:
»Nein, nicht sonderlich.«
Er nickt und sagt:
»Tja aber die Selbstmörder in der Métro, die sehn schlimmer aus!«
(Na, das päppelt doch auf …)
»Fleischfetzen, wo man hintritt, und manchmal klemmt sogar ein Finger oder Zeh in ner Achse fest … Ich erzähl das bloß, weil, ich als der Kleinste, ich darf sie immer abkratzen.«
Der Mann ist gar kein Bulle, sondern Feuerwehrmann. Dunkelblau mit roten Nahtstreifen. Und wirklich sehr klein. An seinem Koppel blinkt ein Helm, der größer ist als er.
»Aber ganz unerträglich, wissen Sie, ist es, wenn sie in ihren Autos verkohlen. Ein Geruch … den kriegen Sie nicht mehr los. Den ham Sie noch nach vierzehn Tagen in den Haaren!«
Am Himmel der Spielwarenabteilung schweben keine Ballons mehr. Sie sind von der Explosion allesamt hinaufgetrieben worden, nach da oben, zum Glasdach. Jemand führt mein kleines Eichhörnchen weg; es schluchzt. Der Feuerwehrmann zeigt auf den zugedeckten Leichnam und sagt zu mir:
»Haben Sie gesehen? Sein Hosenstall stand offen!«
(Nein, hab ich nicht. Nein.)
Zum Glück trennt uns, den liebenswürdigen Feuerwehrmann und mich, der Lautsprecher. (Sozusagen vom Gong gerettet.) Die Angestellten werden gebeten, nun ihrerseits das Kaufhaus zu verlassen. Jedoch nicht Paris. Erfordernis der Ermittlungen. Fröhliche Weihnachten.
Ganz am Ende der Spielwarenabteilung schnappe ich mir einen Ball – einen dieser bunten, durchsichtigen, die endlos hüpfen – und stecke ihn ein. Auch ich muss Geschenke machen. In der nächsten Abteilung wickele ich ihn in sternenübersätes Geschenkpapier. Ich deponiere meinen Dienstanzug im Umkleideraum und gehe.
Draußen wartet die dicht gedrängte Menge darauf, dass der ganze Laden in die Luft fliegt. Die eisige Kälte macht mir klar, dass ich beinahe vor Hitze umgekommen wäre. Da sich die Menge auf der Straße drängt, hoffe ich, die Métro für mich zu haben.
Aber die Menge ist auch in der Métro.
Inhaltsverzeichnis
3
Beim Friedhof Père Lachaise habe ich ein Nutzungsrecht auf ein paar Quadratmeter. In der Rue de la Folie-Régnault 78. Als ich nach Hause komme, läutet das Telefon Sturm. Und sobald man nach mir klingelt, stehe ich auf der Matte.
»Ben, du bist okay?«
Es ist meine Schwester Louna.
»Wieso okay?«
»Im Kaufhaus, die Bombe …«
»Sind alle in die Luft geflogen, bin der einzige Überlebende.«
Sie lacht. Sie schweigt. Dann sagt sie:
»Apropos in die Luft fliegen, ich hab eine Entscheidung getroffen.«
»Welcher Art?«
»Typus Bombe. Ich schick ihn zu den Englein, meinen kleinen Untermieter. Ich treibe ab, Ben. Ich will lieber Laurent behalten.«
Erneute Stille. Ich höre, wie sie weint. Aber in großer Entfernung. Sie versucht, es vor mir zu verbergen.
»Hör mal, Louna …«
Aber was soll ich ihr sagen? Es ist die alte Geschichte. Sie – die nette Krankenschwester, er – der schöne Arzt, Liebe auf den ersten Blick und der Entschluss, sich bis ans Lebensende tief in die Augen zu schauen; sie und er, und weiter nichts. Doch, je mehr Jahre ins Land gehen, mit desto größerer Wucht macht sich die Lust auf ein Drittes bemerkbar. Die weibliche Gier, sich zu verdoppeln: das Leben.
»Hör mal, Louna …«
Sie horcht, aber weil sie nichts hört, sagt sie zuletzt:
»Ich höre.«
Und da lege ich los. Ich sage ihr, dass sie diesen kleinen Untermieter behalten muss. Seinen Vorgängern hat sie den Mietvertrag gekündigt, weil sie die betreffenden Väter nicht liebte; da würde sie doch jetzt nicht diesem sein Wasserbett vor die Tür stellen, weil sie seinen Papa zu sehr liebt! He, Louna? Ohne Scheiß, hör auf mit dem Quatsch. (»Hör du auf mit dem Quatsch«, flüstert eine vertraute Stimme leise in meinem Innern, »das klingt ja wie Abtreibung ist Mord!«) Aber ich bin in Fahrt und quassele weiter:
»Es wäre soundso nie mehr wie zuvor, du würdest das deinem Laurent bitter verübeln, ich kenne dich! Nicht, dass du dem Abtreiber die Eierstöcke ständig unter die Nase reiben würdest, aber so etwas wie Auszehrung wäre angesagt, wenn du weißt, was ich meine.«
Sie weint, sie lacht, und weint von Neuem. Eine halbe Stunde lang!
Kaum habe ich, klatschnass, aufgelegt, schon klingelt es erneut.
»Hallo, mein kleiner Butzemann, wie gehts?«
Maman.
»Es geht, Maman, es geht.«
»Eine Bombe im Kaufhaus, stell dir das mal vor, in unserm Geschäft wäre so was nicht möglich gewesen.«
Sie spielt auf den netten Haushaltswarenladen im Parterre an, wo ich meine Kindheit damit zugebracht habe, mir zwei linke Hände zu bewahren, und der schließlich in eine Wohnung für die Kinder umfunktioniert wurde. Sie vergisst dabei das Eisengitter von Morel, dem Gemischtwarenhändler vis-à-vis, das an einem Junimorgen 1962 durch eine Plastikbombe hochging. Sie vergisst dabei auch die beiden Zweireiher, die uns einen Besuch abstatteten und ihr anrieten, sich die Kundschaft besser auszusuchen. Sie ist niedlich, unsere Mutter, sie vergisst die Kriege.
»Gehts den Kindern gut?«
»Es geht ihnen gut, ja, sie sind unten.«
»Was macht ihr Weihnachten?«
»Wir bleiben unter uns.«
»Robert fährt mit mir nach Châlons.«
(Châlon-sur-Marne, arme Maman.) Ich sage:
»Robert ist wirklich toll!«
Sie gluckst.
»Du bist ein guter Sohn, mein kleiner Butzemann.«
(Schön, jetzt ist der gute Sohn an der Reihe …)
»Deine anderen Kinder sind auch nicht missraten, meine kleine Mutter.«
»Das verdanke ich dir, Benjamin, du warst immer ein guter Sohn.«
(Nach dem Glucksen nun das Heulen.)
»Und ich lass euch immer allein …«
(Schön, jetzt ist die schlechte Mutter an der Reihe …)
»Du lässt uns doch nicht allein, Maman, du ruhst dich aus, du ruhst dich aus!«
»Was bin ich nur für eine Mutter, Ben, kannst du mir das sagen? Was für eine Rabenmutter …?«
Da ich die Zeit, die sie braucht, um ihre eigenen Fragen zu beantworten, einmal gestoppt habe, lege ich den Hörer leise aufs Federbett und gehe in die Küche, um mir einen türkischen Mokka zu brauen, einen mit richtig schöner Schaumkrone. Als ich wiederkomme, spürt das Telefon noch immer der Identität meiner Mutter nach …
»… das war das erste Mal, dass ich ausgebüchst bin, Ben, mit drei Jahren …«
Als der Mokka getrunken ist, stürze ich die Tasse kopfüber auf die Untertasse. Der zerfließende Satz ist so dick, dass Thérèse die Zukunft des ganzen Viertels daraus lesen könnte.
»… das war dann schon viel später, ich war so an die acht oder neun, glaube ich … Ben, hörst du mir zu?«
Just in diesem Augenblick kapriziert sich das Haustelefon darauf, zu schnarren.
»Ich hör dir zu, Maman, aber jetzt muss ich auflegen, die Kinder wollen mit mir gegensprechen! Also dann, ruh dich gut aus, und vergiss nicht, Robert ist wirklich ein toller Mann!«
Ich lege auf und nehme ab. Die bittere Stimme von Thérèse bohrt sich mir ins Trommelfell.
»Ben, Jérémy geht mir auf den Keks, er will seine Hausaufgaben nicht machen!«
»Zügele deine Zunge, Thérèse, sprich nicht wie dein Bruder.«
Da dröhnt auch schon die Stimme dieses Bruders an mein Ohr.
»Wenn hier jemand nervt, dann ist es diese blöde Kuh, die erklärt mir die Sachen nicht richtig!«
»Zügele deine Zunge, Jérémy, sprich nicht wie deine Schwester. Und gib mir Clara, ja?«
»Benjamin?«
Claras Stimme, warm, samten. Von dunkelgrünem, glatt gespanntem Samt, über den jedes Wort mit der ruhigen Selbstverständlichkeit einer schneeweißen Kugel rollt.
»Clara? Wie geht es le Petit?«
»Das Fieber ist gesunken. Aber ich habe Laurent trotzdem noch einmal geholt, der Kleine soll noch zwei Tage das Bett hüten, sagt er.«
»Hat le Petit noch andere Weihnachtsungeheuer gemalt?«
»Ein Dutzend, aber sie sind längst nicht mehr so rot. Ich habe sie fotografiert. Ben, für heute Abend habe ich uns ein Gratin dauphinois gemacht. In einer Stunde ist es fertig.«
»Ich werde da sein. Gib mir le Petit.«
Der Kleine hat ein ganz dünnes Stimmchen:
»Ja, Ben?«
»Nichts. Ich wollte dir bloß sagen, dass ich ein Foto von Théo für dein Album habe und dass ich euch heute Abend eine neue Geschichte erzähle.«
»Eine von Menschenfressern?«
»Nein, eine, die von Bomben handelt.«
»Och na ja, ist trotzdem super …«
»Jetzt muss ich eine Stunde schlafen. Wenn sich einer der Sprechanlage nähert, bringst du ihn sofort um.«
»In Ordnung, Ben.«
Ich lege auf, lasse mich aufs Bett fallen und bin schon eingeschlafen, bevor ich liege.
Eine Stunde später werde ich von einem riesigen Köter geweckt. Eine Attacke von der Seite; unter der Wucht des Anpralls stürze ich vom Bett und rolle gegen die Wand. Er nutzt meine eingezwängte Lage, um mich endgültig außer Gefecht zu setzen und mir die Wäsche angedeihen zu lassen, für die ich heute Morgen keine Zeit hatte. Dabei stinkt er selber wie eine städtische Müllhalde. Seine Zunge riecht nach einer Mischung aus angegangenem Fisch, Tigersperma und dem Tout-Paris der Hundewelt.
Ich sage:
»Ein Geschenk?«
Er macht einen Satz zurück, setzt sich auf seinen kolossalen Hintern und betrachtet mich mit schräg gelegtem Kopf und hängender Zunge. Ich krame in der Tasche meiner Jacke, hole den verpackten kleinen Ball hervor und präsentiere ihn dem Tier mit den Worten:
»Für Julius. Fröhliche Weihnachten!«
Unten im einstigen Haushaltswarenladen schwebt der Muskatgeruch des Kartoffelgratins noch in der Luft, als ich die Kinder längst weit in die Erzählung hinein entführt habe. Über den Schlafanzügen lauschende Augen, während die Füße von den Doppelstockbetten herab im Leeren baumeln. Ich bin an der Stelle, wo Lehmann sich zu der wild gewordenen Rutschbahn durchkämpft. Er zerteilt die Menge mit den kräftigen Schlägen eines Kunstarmes, den ich ihm für die Gelegenheit angedichtet habe.
»Wie hat er denn seinen richtigen verloren?«, fragt Jérémy wie aus der Pistole geschossen.
»In Indochina, auf dem Weg nach Dalat, bei Kilometer 317, ein Hinterhalt. Seine Männer liebten ihn so, dass sie sich absetzten und ihn und seinen Arm, die schon nicht mehr eins waren, zurückließen.«
»Und wie hat er überlebt?«
»Der Kapitän seiner Kompanie hat ihn drei Tage später allein geholt.«
»Drei Tage später! Und was hat er in der Zeit gegessen?«, fragt le Petit.
»Seinen Arm!«
Geschickte Antwort, die alle zufriedenstellt: le Petit hat seine Menschenfressergeschichte gekriegt, Jérémy seine Kriegsgeschichte, Clara ihre Portion Humor; und was Thérèse angeht, die steif wie ein Gerichtsschreiber an ihrem Pult hockt, so stenografiert sie wie stets meine Erzählung komplett mit, Abschweifungen eingeschlossen. Ein ausgezeichnetes Training für ihre Ausbildung zur Sekretärin. In zwei Jahren allnächtlicher Übung hat sie bereits Die Brüder Karamasow,Moby Dick, Gösta Berlings Saga, Asphalt-Dschungel und zwei, drei Erzeugnisse aus meiner eigenen Denkfabrik zu Papier gebracht.
Ich erzähle also, bis das Blinkern der Augen mir sagt, dass gleich die Lichter ausgehen. Als ich die Tür hinter mir schließe, leuchtet im Dunkeln der Weihnachtsbaum. Da habe ich mich doch gut aus der Affäre gezogen: Keiner hat auch nur einen Augenblick daran gedacht, sich auf seine Geschenke zu stürzen. Außer Julius, der seit zwei Stunden alles daransetzt, sein Päckchen auszupacken, ohne das Papier zu zerreißen.
Inhaltsverzeichnis
4
Die Fortsetzung kündigt sich am folgenden 25. Dezember um acht Uhr früh mit der Türklingel an. Ich will schon »Kommen Sie rein, es ist offen« brüllen, als eine ungute Erinnerung mich davon abhält. Auf diese Weise fanden nämlich letzte Woche Julius und ich uns plötzlich einem hellen Holzsarg gegenüber, um ihn herum drei Möbelpacker, die betreten aus der Wäsche guckten. Der blasseste sagte nur:
»Wir kommen wegen der Leiche.«
Julius der Hund hatte sich mit einem Affenzahn unter meiner Koje verkrümelt, und ich, tranäugig und struwwelig, wies mit Bedauern auf meine Wenigkeit im Pyjama:
»Kommen Sie in fünfzig Jahren wieder, ich bin noch nicht ganz so weit.«
Also, es läutet. Ich tapere zur Tür, gefolgt von Julius, der immer gern neue Leute kennenlernt. Ein Bulle von einem Kerl, der nichts als Nacken ist, steht in pelzkragenbesetzter Fliegerweste vor mir wie ein irischer Fallschirmspringer, der über dem deutschen Frankreich ausgeklinkt wurde.
»Caregga, Inspektoranwärter.«
Ein weißer Polizeistab, der es bis zum Kugelschreiber gebracht hat. Kaum hat er seine Muskelmasse in die Wohnung geschoben, da bohrt ihm Julius die Schnauze in den Hintern. Hastig setzt sich der Bulle. Ohne meinem Hund einen Tritt zu verpassen. Vielleicht ist es dieses Detail, was mich veranlasst, ihm einen Kaffee anzubieten:
»Kaffee?«
»Wenn Sie für sich auch einen machen …«
Ich verschwinde in der Küche. Er fragt:
»Schließen Sie nie ab?«
»Nein.«
Und denke: »Das verbietet mir die sexuelle Freiheit meines Hundes«, spreche es aber nicht aus.
»Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. Eine reine Routineangelegenheit.«
Genau damit habe ich gerechnet. Sanftes Wecken der Musterangestellten des Kaufhauses. Eine Handvoll Gewerkschaftsleute und ein Dutzend Querköpfe, die als Erste von der Flicschaft aufgesucht werden. Das Weihnachtsgeschenk der Direktion an ihre lieben Kleinen.
»Sind Sie verheiratet?«
Das Zuckerwasser trällert im kupfernen Mokkatöpfchen.
»Nein.«
Ich gebe drei Löffel gemahlenen türkischen Kaffee hinein und rühre das Ganze so lange um, bis es so samten ist wie Claras Stimme.
»Und die Kinder da unten?«
Dann stelle ich das Töpfchen wieder auf den Herd und lasse die Flüssigkeit langsam hochsteigen, wobei ich darauf achte, dass der Kaffee nicht zu kochen anfängt.
»Halbbrüder und Halbschwestern, die Kinder meiner Mutter.«
Inspektor Caregga gibt seinem kleinen Stift Zeit, das Notizheft zu füllen, dann lässt er die nächste Frage vom Stapel:
»Und die Väter?«
»Verstreut.«
Ich werfe einen Blick durch die Küchentür: Caregga notiert emsig, dass meine arme Mutter die Männer in alle Winde verstreut. Ich kehre mit Mokkatöpfchen und Tassen in der Hand zurück. Ich gieße den sämigen Saft ein. Ich stoppe die Hand des Inspektors, die sich der Tasse entgegenstreckt.
»Warten Sie, der Kaffee muss sich erst absetzen.«
Er lässt den Satz sich setzen.
Julius, der vor ihm hockt, sieht ihn leidenschaftlich an. »Welche Funktion üben Sie im Kaufhaus aus?«
»Mich anschnauzen lassen.«
Er zuckt mit keiner Wimper. Er notiert.
»Früher ausgeübte Berufe?«
Holla, die Auflistung könnte lang werden: Lagerist, Barkeeper, Taxichauffeur, Zeichenlehrer in einer christlichen Einrichtung, Meinungsforscher in Seifenfragen, wahrscheinlich habe ich etwas vergessen, und im Kaufhaus Technische Kontrolle, mein jüngster Job.
»Seit?«
»Vier Monaten.«
»Gefällt Ihnen die Stelle?«
»Wie jede andere. Für das, was ich mache, bin ich überbezahlt, für das, was mich ankotzt, bin ich unterbezahlt.«
(Kommen wir endlich zur Sache, Teufel noch mal!)
Er macht Notizen.
»Sie haben gestern nichts Ungewöhnliches bemerkt?«
»Doch, eine Bombe ist explodiert.«
Da hebt er dann doch den Kopf. Aber sein Ton bleibt vollkommen unbeirrt:
»Ich meine, vor der Explosion.«
»Nein, nichts.«
»Sie wurden anscheinend dreimal ins Reklamationsbüro gerufen.«
Na, endlich sind wir beim Thema. Ich erzähle ihm von dem Herd, dem Staubsauger und dem pyromanischen Kühlschrank.
Er sucht etwas in seiner Innentasche, dann breitet er vor mir den Plan des Kaufhauses aus.
»Wo befindet sich das Reklamationsbüro?«
Ich zeige es ihm.
»Sie sind also mindestens dreimal an der Spielwarenabteilung vorbeigekommen?«
Kombinationsgabe hat er, der Kerl!
»Das ist richtig.«
»Haben Sie sich dort auch aufgehalten?«
»Ja, beim dritten Mal, zehn Sekunden.«
»Und Sie haben nichts Ungewöhnliches bemerkt?«
»Abgesehen davon, dass mich ein AMX 30 ins Visier genommen hat, nichts.«
Schweigend macht er seine Notizen, verschließt seinen Stift, trinkt seinen Mokka in einem Zuge mitsamt Satz, erhebt sich und sagt:
»Das wärs, verlassen Sie Paris nicht, vielleicht haben wir noch andere Fragen an Sie, auf Wiedersehen, danke für den Kaffee.«
Tja. Auf eine gerade wieder zugegangene Tür heftet man nur im Film einen langen Blick. Inspektor Caregga hat Julius und mich mit seinem offenen Wesen geködert. Hat eine große Zukunft in der Lachbrigade vor sich, der Junge. Aber die Geschichte, die ich heute Abend den Kindern erzählen werde, habe ich im Sack. Es wird diese hier sein, allerdings mit einem Schlagabtausch, dass die Witzwortfetzen fliegen; außerdem werden wir in einer explosiven Mischung aus Hass, Misstrauen und Bewunderung auseinandergehen, und sie werden zu zweit sein, die Flics, zwei grausliche Kerle, von mir erfunden, die die Kinder bereits kennen: ein Kleiner, mit rauborstiger Mähne, der so zerquält hässlich aussieht wie eine Hyäne, und ein glatzköpfiger Hüne, dessen einzige Behaarung zwei Koteletten sind, die »ihre Ausrufezeichen auf seine mächtigen Kieferknochen niedersausen lassen«.
»Hyänen-Hipp und Rudi-Rufzeichen!«, wird le Petit brüllen.
Und Jérémy hinzufügen:
»Hyänen-Hipp wegen seinem Namen und der Visage.«
»Rudi-Rufzeichen, wegen seinem Namen und dem Backenbart.«
Erneut der Kleine.
»Böser als Sarg-Ede und verrückter als der Hölzerne Tscheche.«
»Sind sie befreundet?«, wird Clara fragen.
Ich darauf:
»Seit fünfzehn Jahren weicht der eine nicht von der Seite des anderen. Unzählige Male haben sie sich gegenseitig das Leben gerettet.«
»Was fahrn sie für ne Karre?«
Jérémy, der die Antwort liebt.
»Einen Peugeot 504, ein rosa Cabrio mit V6-Motor, gefährlich wie ein Hecht.«
Und die letzte Frage wird von Thérèse kommen:
»Ihre Sternzeichen?«
»Stier. Alle beide.«
Nachdem Caregga fort ist, gehe ich zu den Kindern, wo der Weihnachtsbaum, wie es so schön heißt, in hellem Lichterglanz erstrahlt. Jérémy und der Kleine stoßen in einem Meer von Geschenkpapier Möwenschreie aus. Thérèse, die Brauen professionell hochgezogen, tippt auf einer nagelneuen Kugelkopfmaschine meine gestrige Erzählung ab. Louna ist zu Besuch gekommen und betrachtet das Familienidyll mit einer Träne im Auge, die Füße entenhaft nach außen gewinkelt, als wäre sie im sechsten Monat. Ich registriere das Fehlen von Laurent. Clara kommt mir in einem Jerseykleid entgegengeflogen, das ihr einen hübschen Flammenkörper gibt. In der Hand hält sie die alte Leica, um die sie mich seit Jahren insgeheim beneidet und die ich nun ihrer Fotoleidenschaft dargebracht habe. Das Kleid hat Théo ausgesucht. Auf diesem Gebiet sollte man sich immer an Männer wenden, die Männer bevorzugen. (Aber vielleicht ist das ein Vorurteil.)
»Hier, Benjamin, das ist für dich.«
Clara reicht mir etwas in hübschem Geschenkpapier … in einem Karton … in Seidenpapier … ein Paar Schlappen, schlagsahnefarben, gefüttert, genau das, was ich mir gewünscht habe, es ist Weihnachten.
Inhaltsverzeichnis
5
Am nächsten Tag, dem 26.: Wiederbeginn der Arbeit. Wie jeden Tag begleitet mich Julius bis zur Métro Père-Lachaise, dann treibt er durch Belleville, immer seinem Trieb nach, während ich meinem Hund das Chappi verdiene. Seinen nagelneuen Ball hält er seit vorgestern Abend fest in der Sabberschnauze verkeilt.
Die Zeitung, die ich kaufe, räumt dem »abscheulichen Kaufhaus-Attentat« einigen Raum ein. Da ein einziger Toter zu wenig ist, schildert der Verfasser des Artikels die Szenerie, wie sie im Falle eines Dutzends Toter hätte aussehen können! (Wenn Sie wirklich träumen wollen, dann wachen Sie auf …) Zuletzt immerhin widmet der Schreiberling auch dem Verstorbenen ein paar Zeilen. Ein Kfz-Schlosser aus Courbevoie, zweiundsechzig Jahre alt, bieder und rechtschaffen, das Viertel vergießt heiße Tränen um ihn, aber »zum Glück« war der Werkstattbesitzer Junggeselle und kinderlos. Ich fantasiere nicht, da steht wirklich »zum Glück Junggeselle und kinderlos«. Ich blicke mich um: Dass Gott Zufall »zum Glück« bevorzugt Junggesellen abserviert, scheint die kleine familiäre Welt der Métro nicht zu verstören. Was mich in so gute Laune versetzt, dass ich an der Station République aussteige, um den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen. Wintervormittag, düster, schmutzig, eisig, verstopft. Paris ist eine Lache, in der das Gelb der Scheinwerfer versackt.
Ich hatte befürchtet, zu spät zu kommen, aber das Kaufhaus ist noch später dran. Mit den Eisengittern vor seinen kolossalen Schaufenstern wirkt es wie ein unter Quarantäne stehender Ozeandampfer. Aus den unterirdischen Heizkesseln steigt Dampf auf und verliert sich wabernd im Morgennebel. Kleine Lichtsprengsel hie und da zeigen mir allerdings, dass das Herz arbeitet. Dort drinnen ist Leben. Ich betrete also das Gebäude, und schon bin ich von Licht überflutet. Jedes Mal derselbe Schock. All dies Licht, das lautlos aus der Höhe des Kaufhauses herabstürzt, das von Spiegeln, Kupfer, Glas, falschem Kristall zurückbrandet, das sich in die Gänge ergießt, einem die Seele überzuckert – all dies Licht erleuchtet nicht, es erfindet eine Welt.
Während mir dies durch den Kopf geht, durchfilzt mich ein flinkfingriger Flic von Kopf bis Fuß. Zuletzt stellt er fest, dass ich keine Atombombe bin, und lässt mich durch.
Ich bin nicht der Erste. Die Mehrzahl der Angestellten ist bereits in den Gängen des Erdgeschosses versammelt. Alle mit aufwärtsgerichtetem Blick. Die meisten sind Frauen. Ihre Augen haben einen verschleierten Glanz, als ob sie den Heiligen Geist hörten. Oben auf der Kommandobrücke säuselt Sainclair in ein Mikrofon. Er würdigt das »bewundernswerte Verhalten der Belegschaft« während der jüngsten »Ereignisse«. Er spricht Chantredon – dem Typen, der durch die Vitrine der Kosmetikabteilung geflogen ist und im Krankenhaus seine Wunden leckt – die tiefe Anteilnahme der Direktion aus. Er entschuldigt sich bei jenen, die gestern Besuch von der Polizei erhielten. Alle Angestellten kämen an die Reihe, »die Direktion eingeschlossen«, doch all dies diene ausschließlich dem Ziel, »sämtliche für einen erfolgreichen Abschluss der Ermittlungen notwendigen Elemente beizusteuern«.





























